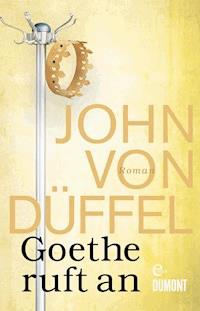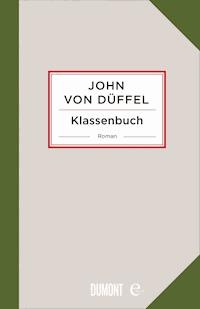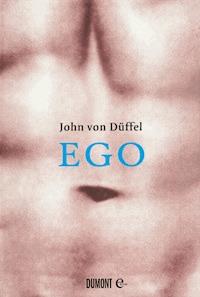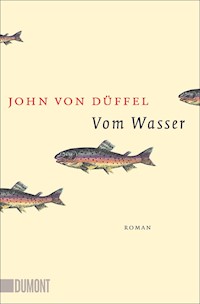9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Großvater Jorge de Houwelandt, ein asketischer Gottsucher, sieht nach einem mit unerbittlichem Stolz gelebten Leben an der Seite seiner Frau Esther seinem achtzigsten Geburtstag entgegen. Den Familiensitz im Norden Deutschlands haben die beiden mit der spanischen Küste vertauscht – denn »was Jorge brauchte, war das Meer«. Sein Sohn Thomas, der am väterlichen Starrsinn zu zerbrechen droht, verwaltet das Elternhaus aus der Vorgründerzeit. Dessen einziger Sohn Christian – Erstgeborener des Erstgeborenen –, hat den Großvater kaum je kennen gelernt und möchte allen familiären Verlegenheiten, Verlogenheiten und Verstrickungen aus dem Wege gehen. Jorges Frau Esther plant, den großen Geburtstag des Patriarchen in Deutschland zu feiern, um die versprengte Familie noch einmal zusammenzubringen. Je näher das Fest rückt, desto verzweifelter kämpfen die de Houwelandts um Recht und Unrecht in der Vergangenheit. Sie müssen dabei erfahren, dass ihre jeweilige Wahrheit nur eine Version ist und dass alle Generationen durch gemeinsame Muster und Wurzeln unentrinnbar miteinander verbunden sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
John von Düffel
HOUWELANDT
Roman DuMont
eBook 2014
© 2004 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Ausstattung und Umschlag:
Groothuis, Lohfert, Consorten (Hamburg)
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook: 978-3-8321-8808-5
www.dumont-buchverlag.de
Du hast weder Jugend noch Alter
Sondern nur, als wäre es ein Mittagsschlaf
Träume von beidem.
WILLIAM SHAKESPEARE
Teil I
Jorge
Die Insel vor ihm hatte die Farbe des Sandsteins, den man hier brach. Das Land in seinem Rücken entließ seine Hügel ins Licht. Es war eine buckelnde Herde, die vor der aufsteigenden Sonne davonkroch, spärliche Haine, gewundene Terrassen, Gärten aus Geröll. Auf den Spuren der Dämmerung wanderten Schatten wie dunkle Wolken über das Land. Doch der Morgen im Sommer war kurz, und sobald die Sonne steil stand, würde sich nichts mehr rühren. Jorge de Houwelandt watete bis zu den Hüften in den Uferwellen und rieb sich eine Handvoll Wasser ins Gesicht. Das Meer schmeckte nach Schlaf. Ohne die Augen zu öffnen, legte er das Kinn auf die Brust, streckte die Arme aus und tauchte ein.
Mit angehaltenem Atem schwamm er ein paar Züge unter Wasser, in seinen Ohren das Rollen der Kiesel und Steine in der sanften Dünung. Er wußte, daß Esther ihm vom Strand aus zusah, daß sie die schiefergraue Oberfläche nach seinem Kopf absuchte und darauf wartete, ihn zwischen den Wellen wiederauftauchen zu sehen, die sich zu dieser frühen Stunde noch nicht brachen, sondern an Land huschten wie Tiere unter einem Tuch. Er brauchte nicht zu atmen. Er verspürte keinen Drang nach Luft. Was er brauchte, war das Meer.
Er konnte die Feier noch immer absagen. Er war das Familienoberhaupt. Wenn er nicht wollte, würde sein Geburtstag nicht stattfinden, alle würden bleiben, wo sie waren. Er, Jorge, brauchte kein Fest.
Die kleine Bucht warf einen Schattensaum über das allmählich erwachende Meer. Nur auf der Insel lag schon Licht. Es fing sich in den Klippen und verlieh dem Sandstein für Augenblicke die Farbe von gebrannten Ziegeln. Jorge glitt schwerelos durch die anschmiegsame, zudringliche Frische der flüssigen Welt und betrachtete die rundgewaschenen Steine und Muscheln unter sich. Ein, zwei Züge noch, dann erreichte er die Felder von Seegras und totem Tang. Danach kam nur noch Tiefe und sich selbst überschattendes Blau.
Jorge dachte nicht daran aufzutauchen. Er wußte, daß Esther ihn beobachtete. Für einen Moment war es, als könnte er hören, wie sie von einem Fuß auf den anderen trat und der Steinstrand unter ihren Sandalen knirschte. Er sah ihr zum Meer gewandtes Gesicht und die Strähnen ihres noch immer dichten Haars im auflandigen Wind. Sie würde nicht nach ihm rufen, obwohl ihr sein Name auf den Lippen lag, Esther würde die Luft anhalten, als wären ihre und seine Lungen eins. Doch er vermißte nichts. Er hatte sie hinter sich gelassen wie alles an Land.
Das Wasser war flüssiges Glas, farblos vor Frühe. Durch die Tanggärten strich schon der Herbst. Jorge tauchte zwischen zwei algenverhangenen Bojen hindurch, die den Schwimmbereich markierten. Der Gedanke an Sauerstoff durchzuckte ihn, doch es war nur ein Reflex wie vor dem Einschlafen – schon vorbei. All seine Sinne richteten sich auf das bodenlose Blau, das sich unter ihm auftat, und die hinaufdrängende Tiefe. Sie hatte ein so weiches Fell. Jorge war überwältigt von dem Gefühl des Entronnenseins auf der Haut. Wie jeden Morgen.
Hinter einem Fischerboot mit eingezogenem Motor durchbrach er die Oberfläche. Das Tier, das ihn trug, hatte den Rücken krumm gemacht und ihn in die Höhe gehoben. Jorge schnappte nicht nach Luft, sie strömte in ihn ein. Er war vollkommen ruhig.
Es würde keinen Geburtstag geben, und erst recht nicht, wenn es, wie Esther betonte, sein achtzigster war.
Thomas
Er hatte früh aufstehen wollen, um vor den für Mittag angekündigten Regenschauern mit dem Rasenmähen fertig zu sein, doch er mußte seinen Wecker im Halbschlaf zu Boden gerissen haben. Jedenfalls wachte Thomas de Houwelandt anderthalb Stunden später als geplant vom Klingeln des Postboten auf und überlegte, vorerst regungslos, was ihn wohl mehr Mühe kosten würde, sich jetzt den Bademantel überzustreifen und zur Tür zu rennen oder noch ein Weilchen liegen zu bleiben, sich auf die andere Seite zu drehen, um dann im Laufe des Nachmittags oder des morgigen Tages zur Post zu fahren und das Paket oder Päckchen oder was auch immer abzuholen – gegen Vorlage seines Personalausweises, von dem er momentan auch nicht wußte, wo er steckte. Ihm fielen die vorhergesagten Regenschauer wieder ein und das Gras, das von den Rändern her bereits zu blühen anfing. Er verscheuchte den Gedanken an die Mieter der Parterrewohnung im Kinderhaus, die sich über den Zustand des Gartens beklagt hatten – »verwildert«, was wußten die schon von »Verwilderung«! Für den andauernden Regen, der ihm jedes Mähen unmöglich machte, konnte er schließlich nichts.
Thomas verbrachte einen angenehm dämmrigen Moment, in dem er sich mit dem Wetter beschäftigte. Er ließ die Ausläufer eines Tiefdruckgebietes über Schottland gegen ein baltisches Hoch aufmarschieren, das sich von der Ostsee her über Polen weiter westwärts bewegte und in seinem Gefolge schwül-warme Meeresluft mit sich führte. Während Schlesien von einer Hitzewelle überrollt wurde, lagen weite Teile Frankreichs und der Beneluxländer bereits unter einer dichten Wolkendecke. Über der norddeutschen Tiefebene, etwa auf Höhe des achten Längengrads, würden die feindlichen Luftmassen aufeinandertreffen, um sich in Gewittern und ergiebigen Regenfällen zu entladen. Mit nach innen verdrehten Augen sah Thomas eine Front von imposanten Kumuluswolken heraufziehen, alpine Formationen, die sich zusammenschoben, aufeinandertürmten und zu neuen Wolkenkolossen ballten. Von fern her streiften bereits graue Regenbärte über das flache, dunkelgrüne Land. Erste Tropfen schlugen ein wie verirrte Geschosse. Thomas glaubte den Regen bereits riechen zu können und spürte einen von Wolken und Wasser getriebenen Wind um die Nase, der die Tannen vor seinem Fenster aufrauschen ließ, vielstimmig durchs Zimmer pfiff und sich in sämtlichen Ritzen und Spalten festsaugte.
Es konnte sich nur um ein Paket oder Päckchen für seinen Vater handeln, er selbst erwartete keine Post, jedenfalls nichts, wofür es sich lohnen würde aufzustehen, und was kümmerte es den Alten in seinen ewigen Ferien zweitausendfünfhundert Kilometer von hier, ob er diese Sendung nun einen Tag früher oder später entgegennahm. Thomas war es leid, für seinen Vater unterschreiben zu müssen – »im Auftrag«, als hätte er mit den »Aufträgen« seines Vaters nicht schon Ärger genug! Er haßte den Papierkram, insbesondere das Fotokopieren und Nachsenden von Steuerunterlagen, das ihn zwingen würde, ein weiteres Mal zur Post zu gehen und das korrekte Porto für einen Expreßbrief nach Spanien aufzukleben, nur weil sich der alte Herr mit der Erfindung des Faxgerätes nicht anfreunden konnte und es vor allem ihm, Thomas, nicht gönnte, obwohl es seine Arbeit wesentlich erleichtert und ihm etliche Gänge erspart hätte, schließlich war er Verwalter und nicht der Laufbursche seines Vaters!
Doch mittlerweile hatte sich Thomas dermaßen wachgeärgert, daß er genausogut aufstehen konnte, auch wenn es ihm wie eine Niederlage erschien. Mißmutig schlug er die Augen auf und blinzelte zum Fenster hinaus, wo er zwischen schwarzen, geschwungenen Tannenzweigen einen makellos blauen Himmel erblickte. Er haßte diese Tannen, die alles überschatteten und seine Wohnung sogar an sonnigen Hochsommertagen in ein finsteres Loch verwandelten, in eine nach Waldboden, Schwamm und Schimmelpilzen riechende Höhle. Sein Vater hatte die Bäume damals vor das Gesindehaus pflanzen lassen, angeblich um sich und seine angehende Familie von den Mietern abzuschirmen, die nach Kriegsende bei den de Houwelandts Einzug hielten. Doch Thomas, der viele Jahrzehnte später mit der dunkelsten aller Wohnungen vorliebnehmen mußte, sah darin einen langgehegten, gegen sich gerichteten Plan. Noch mehr als das ärgerte ihn allerdings der blaue Himmel, der keinerlei Anzeichen von Eintrübung zeigte und ihm nur Arbeit machen würde, Gartenarbeit. An Schlaf war nicht mehr zu denken.
Thomas zählte bis drei, um die Decke so entschlossen, wie man ein Pflaster abreißt, beiseite zu schlagen und aus dem Bett zu steigen. Doch er brachte keine kontrollierte Bewegung zustande. Sein guter Vorsatz verzuckte wie eine Fehlzündung, die Muskulatur sprang nicht an, nicht einmal ein Fluch oder Seufzer kam ihm über die Lippen, so als hätte es eines weiteren Beweises bedurft, wie erschöpft und gerädert er noch immer war. Die Erinnerung an letzte Nacht, an seine wachsende Wut und das für seinen Seelenfrieden erforderliche Quantum Rotwein schob sich wie eine Glasscheibe zwischen ihn und seinen unbeweglichen Leib. Ihm brummte der Schädel, ihm brummten die Ohren, seine Gedanken flogen in Schlaufen wie Brummer, die beharrlich gegen das ebenso durchsichtige wie unnachgiebige Nichts von einem Hindernis dengelten. Und es dauerte eine Weile, bis Thomas begriff, daß dieses Brummen nicht seiner Phantasie, nicht irgendeiner Traumfrequenz entstammte, sondern seinem auf dem Boden der Tatsachen liegenden Wecker, der sich durch den Sturz verstellt haben mußte oder schlichtweg kaputtgegangen war. Alles, was er noch von sich gab, war das sporadische Rattern des Klöppels auf teppichtauben Alarmglocken – ein nicht ganz rund laufender, irgendwie eiförmiger Schall, der vor Thomas’ innerem Auge das Bild einer ausleiernden Spiralfeder heraufbeschwor, die mit etwas Geduld irgendwann ausgelärmt haben würde. Doch wie zum Hohn hoben prompt die Klingelgeräusche des Postboten wieder an, der jetzt offenbar die Mieter im oberen Stockwerk behelligte. Jedenfalls drang ein durch mehrere Wände und Zwischendecken gedämpfter Summton an sein leidgeprüftes Ohr, womit sich endgültig bestätigte, was Thomas schon von Anfang an geahnt hatte: Dieser Tag war nicht sein Freund.
»Komme ja schon«, murmelte er und strich über seine Unrasur, glaubte sich aber kein Wort.
Esther
Die Steine zu ihren Füßen waren von einer feinen Salzkruste überzogen. Die Gischt vergangener Fluten hatte sich über den Strand gelegt wie Staub. Unter den Kieseln war es angenehm kühl. Esther de Houwelandt setzte sich, spitzelte ihre Sandalen beiseite und bohrte die Zehen zwischen Basalt- und Marmorabrieb, Feuersteinen und Muschelschalen hindurch, bis ihr Spann vollständig bedeckt war. Noch hatte der Steinstrand nicht angefangen zu glühen, doch ihre Fußsohlen hatten schon Durst. Sie legte den Kopf zurück, wie um sich die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen, und genoß den Schatten. Das Meer schlug nach seinem eigenen Schweigen und zerfiel.
Noch acht Tage!
Sie ging ihre Reise ein weiteres Mal durch. Esther wußte, wie sie zum Flughafen kommen würde. Sie kannte sämtliche Prozeduren vom Schalter bis zum Terminal. Start und Landung, die Ankunft in Deutschland, das alles hatte sie Tag und Nacht immer wieder durchgespielt. Sie wußte auch, wie sie am besten zu Beate Gerber kam, falls es mit dem Abholen nicht klappen sollte. Doch das war unwahrscheinlich. Auf Beate war auch nach der Trennung von Thomas Verlaß.
Ihre Schwiegertochter war die erste, die Esther in ihre Pläne eingeweiht hatte, und Beate hatte sie nicht enttäuscht. Sie bot sofort ihre Hilfe an, setzte sämtliche Hebel in Bewegung und wahrte dennoch absolute Diskretion, das verstand sich von selbst. Beate Gerber sprühte vor Ideen, wenn es um die Gestaltung der Feierlichkeiten ging. Sie kundschaftete Restaurants aus, holte Kostenvoranschläge ein und informierte sich über jeden Partyservice im Umkreis. Während der letzten Wochen hatte sie sich als Esthers Sachwalterin vor Ort unentbehrlich gemacht und die gesamte Organisation mit einer Sorgfalt und Begeisterung vorangetrieben, auf die Esther bei ihren leiblichen Töchtern nicht rechnen konnte. Und das, obwohl Beate, strenggenommen, nicht mehr lange eine de Houwelandt sein würde und es im Grunde auch nie war.
Ein Anflug von Reisefieber streifte sie mit der leichten Brise, die auf dem Rücken der ersten Wellen die Bucht erreichte. Doch es war mehr Beklommenheit als Vorfreude. Esther zweifelte nicht daran, daß sie mit Beates Hilfe ein dem Anlaß gebührendes Fest auf die Beine stellen würde: kulinarisch anspruchsvoll, aber nicht extravagant, großzügig, aber ohne übertriebene Opulenz. Sie kannte ihre Familie gut genug, um das beste aller möglichen Arrangements zu treffen. Wechselnde Sitzordnungen, Umtrünke zur Auflockerung sowie eine ausgeklügelte Bettenverteilung schwebten ihr vor. Die letzten noch offenen Fragen der Tischdekoration und Beleuchtung ließen sich problemlos an Ort und Stelle klären. Esther war stolz auf den Stand der Vorbereitungen bis jetzt, stolz auf sich und ihre Schwiegertochter, mit der sie sich in allen Punkten schnell einig geworden war.
Sorgen bereitete ihr nicht die Planung, sondern das Unwägbare. Gegen das Wetter wußte sie Rat und arbeitete im Einvernehmen mit Beate Wind- und Regenvarianten aus. Der Partyservice, für den sie sich entschieden hatte, lieferte auf Wunsch Zelte in verschiedenen Größen. Sogar einen Temperatursturz bezog sie in ihre Überlegungen mit ein und ließ über einen Versandhandel ein Dutzend Wolldecken im Angebot bestellen. Doch keine Decke dieser Welt konnte das Fest vor den Launen und der Unbill ihrer Kinder schützen, die sich von Jorge losgesagt hatten und doch nach ihm kamen mit ihrem Stolz, ihrer Unnahbarkeit, ihrem Inseldasein. Sie verlangte von ihnen nicht, daß sie gute Miene zum bösen Spiel machten. Sie erwartete keine falschen Freundlichkeiten und symbolischen Versöhnungen. Aber Esther wollte und wünschte sich sehr, daß alle ohne Ausnahme verstanden, wie wichtig diese Feier für sie war. Beate hatte das sofort erkannt, im Unterschied zu ihren beiden Töchtern, bei denen Esther schüchtern vorgefühlt hatte, ohne im geringsten ermutigt zu werden. Offenbar wollten sie Jorge in seiner Gleichgültigkeit gegenüber Familienangelegenheiten noch übertreffen. Und das galt um so mehr für Thomas, obwohl er als Erstgeborener eigentlich die Pflicht gehabt hätte, die Familie zusammenzuhalten.
Esther fixierte das Khakihemd ihres Mannes, das er wie immer mit einer zum Wasser drängenden Hast über den Kopf gezogen und achtlos neben seinen Espandrillos hatte fallen lassen. Sie hob es auf, faltete es zusammen und legte es auf seine ausgeblichenen Shorts. Wie von fern her streifte sie ein Hauch von alter Mann. Doch als sie sich argwöhnisch über die Hemdbrust und insbesondere die Achselgegend beugte, um daran zu riechen, schien diese Spur von Schweiß, Meersalz und Mattigkeit schon wieder verflogen. Es war Jorges Geruch, aber auch der brackige, schal gewordene Atem der Steine, die sie mit ihren Zehen gelupft und gelüftet hatte. Sie durfte auf keinen Fall vergessen, vor ihrer Abreise einen Stapel frischer Hemden herauszulegen und Jorge beizeiten zu ermahnen, daß er sie auch anzog.
Nur acht Tage noch, und sie hatte ihm noch immer nichts davon gesagt.
Esther wußte, wie und mit welchen Worten sie ihrem Mann beibringen mußte, daß sie in einer Woche nach Hause flog. Sie hatte sich ihre Erklärung in unzähligen Selbstgesprächen zurechtgelegt. Sie wartete nur auf den richtigen Zeitpunkt.
Es war das erste Mal, daß sie allein verreiste, ohne ihn. Früher hatte Jorge manchmal wochenlang mit Vermessungsarbeiten in anderen Städten, Landstrichen und Ländern zu tun. Doch seit seinem Ruhestand und ihrem gemeinsamen Umzug nach Spanien waren sie keine Nacht mehr voneinander getrennt gewesen, geschweige denn für einen Zeitraum von zwei Wochen. Trotzdem glaubte sie, das Richtige zu tun, wenn sie ihn für die Dauer der Geburtstagsvorbereitungen hier zurückließ. Was Jorge zu seinem Glück am meisten brauchte, war Ordnung. Sein Leben bestand aus einer strikten Abfolge von Ritualen, aus dem Meer am Morgen, dem Garten am Vormittag, der Besteigung des Hausbergs nach der Mittagsruhe und schließlich dem Abendgebet in der Kapelle. Wehe dem, der seinen Tagesablauf störte! Nur äußerst widerwillig änderte Jorge seine Gewohnheiten oder setzte sie aus.
Genau das war Esthers Argument. Dadurch, daß sie im Vorfeld alles in die Wege leitete, konnte er so weiterleben wie bisher. Nach dem Schwimmen würde er sein Frühstück im Merendero am Strand einnehmen und zum Abendessen ins Restaurant gehen. Mittags begnügte er sich ohnehin mit ein paar selbstgepflückten Früchten, Obst und Gemüse aus dem Garten, dazu ein Stückchen Brot mit Olivenöl oder gesalzener Butter und ein mit Wasser verdünntes Glas Wein. Jorge würde ihre Abwesenheit kaum bemerken. Das hoffte und fürchtete sie zugleich. Esther ahnte schon jetzt, daß ihm die Einsamkeit weniger ausmachen würde als ihr.
Nach Abschluß der Vorbereitungen hatte sie noch eine Woche Spanien eingeplant, um das Haus nach Jorges Strohwitwertum wieder auf Vordermann zu bringen. Sie würde waschen und packen, um dann, wie es sich gehörte, Seite an Seite mit ihrem Mann anzureisen. Ihr gemeinsamer Aufenthalt in Deutschland würde sich auf ein Minimum beschränken, nicht länger als die jährliche Stippvisite bei ihrem Steuerberater und den örtlichen Behörden. Jorge brauchte sich um nichts zu kümmern. Er mußte lediglich achtzig werden und seinen gewohnten Rhythmus aus diesem Anlaß für fünf Tage unterbrechen. Dabei hatte sie Hin- und Rückflug so gebucht, daß er am Morgen des ersten Tages sogar noch schwimmen konnte und am Nachmittag des fünften Tages rechtzeitig zum Gebet wieder in der Kapelle sein würde.
Esther wußte, daß sie ihrem Mann unrecht tat, indem sie ihn derart bevormundete. So unselbständig war er nicht. Doch sie war entschlossen, alles zu tun, damit er seinen Widerstand gegen das Fest aufgab. Es kränkte sie, daß ihre Kinder sie nicht unterstützten. Doch die größte Gefahr war Jorge selbst. Er konnte alles platzen lassen. Wenn sie ihn nicht vor vollendete Tatsachen stellte, wenn sie ihm die Wahl ließ, würde er seinen Geburtstag verbieten.
Sie sah seinen weißen Schopf jenseits des ausgeleinten Schwimmbereichs etliche Meter hinter dem letzten Fischerboot. Für einen Moment folgte sie mit ihrem Blick dem Gleichmaß seiner Züge. Auf immer dieselbe Weise duckte er sich in die Hebungen und Senkungen des Meeres, um sich dann zu strecken wie jemand, der unter Wasser erst zu voller Länge aufschoß. Jorge schwamm in einem Bogen auf die Insel zu wie jeden Morgen. Meter für Meter wiederholte er seinen gestrigen Weg, als wollte er die Tage dazu bringen, einander zu gleichen. Esther kannte die Strecke, seine tauchende Art zu schwimmen, seine immergleiche Geschwindigkeit. Genauso würde es sein an jedem Morgen während ihrer Reise. Ihre Abwesenheit würde nichts daran ändern. Alles würde bleiben, wie es war. Nur sie wäre nicht mehr hier, um es zu sehen.
Thomas
Er erwischte den Postboten auf halbem Weg über den Hof vor der »Hundehütte«, wie die Geschwister ihr Elternhaus nannten, einen zweistöckigen Bau aus der Vorgründerzeit, der zu schmal, zu grau und zu verwinkelt geraten war, um eine Villa am Stadtrand zu sein. Fast schien es, als habe ihr Erbauer seinerzeit voller Mißtrauen in die Zukunft geblickt und für sich und die Seinen keine Vermehrung von Reichtum und Ansehen erwartet. Die »Hundehütte« war eine Trutzburg des Erreichten. Weder Personal noch Gäste hatten in ihr Platz, weshalb sämtliche de Houwelandts, deren Geschäfte prosperierten, mit Anbauten wie dem Gesindehaus um 1900 und dem Kinderhaus Anfang der siebziger Jahre eine Spur von Großzügigkeit in die gotische Verschmocktheit und pastorale Enge ihres Familiensitzes zu bringen versuchten. Doch Bedienstete gab es, wenn Thomas von sich selbst einmal absah, schon lange nicht mehr. Soweit seine Erinnerung reichte, wohnten im Gesindehaus ältliche Paare und einsame Pensionäre, die geräuschlos vor sich hinstarben. Auch wurde das Kinderhaus entgegen seiner Bestimmung nie von ihm oder den Geschwistern bezogen. Sie alle hatten das steingewordene Angebot, sich mit ihren Familien an der Seite ihres Vaters niederzulassen, abgelehnt. Zwar standen pro Wohnung zwei Kinderzimmer bereit, was einer Aufforderung zur Fortpflanzung gleichkam, doch mieteten sich auch dort wiederum nur alte Leute ein, die offenbar zu schwach und hinfällig waren, um gegen die reizlosen schuhkartonförmigen Siebziger-Jahre-Räume aufzubegehren. Thomas war nicht nur der einzige de Houwelandt, der hier lebte. Er war mit seinen siebenundfünfzig Jahren auch der Jüngste, was ihm noch immer das Gefühl gab, ein Rebell zu sein.
Jetzt stand er in Bademantel und Pantoffeln auf dem Hof, den Blicken der argwöhnischen Mieterschaft preisgegeben, die vermutlich noch Tage von diesem Auftritt reden würde. Thomas knotete die Enden des Frotteegürtels notdürftig vor seinem Bauch zusammen und fuhr sich mit einer flüchtigen Geste durchs Haar, um wenigstens den Willen zu einer Frisur erkennen zu lassen. Es war fast zehn, hellichter Tag. Die Sonne blendete, und das Unkraut zwischen den Steinplatten schoß unverschämt grün bis auf Knöchelhöhe empor. Ein leichter Niesreiz lag in der Luft. Vom Garten her roch es nach blühender Wiese und Gräserpollen. Es roch, mit einem Wort, ungemäht. Thomas versuchte, den Postboten möglichst unauffällig in eine Ecke zu ziehen, die den Mietern ringsum weniger Einsicht bot, doch die Gesten, die er aus den Ärmeln seines Bademantels schüttelte, wurden von dem Beamten nicht verstanden. Mutlos schaute er die grauen, moosbefleckten Mauern der Hundehütte hinauf und hoffte insgeheim, der Giebel würde sich ein Stück weit vor die Sonne schieben, um ihn mit seinem spitzen Schatten zu verschlucken. Doch auch diesen Gefallen tat ihm sein Vaterhaus nicht. Statt dessen schaute es ungerührt mit seinen vor Staub und Wasserflecken erblindenden Fenstern auf ihn herab.
»Hier unterschreiben«, forderte ihn der Postbote auf. Thomas ergriff den gezückten Kugelschreiber wortlos. Ihm war auf einmal kalt, trotz der sommerlichen Temperaturen. Seine Hände zitterten. Er überlegte kurz, ob er nicht besser versuchen sollte, als erste Handlung des Tages eine Zigarette zu schnorren, doch sein Gegenüber machte ein zutiefst entmutigendes Nichtrauchergesicht.
Nur mit Mühe brachte Thomas seinen in Einzelteile zerfallenden Namen oberhalb der vorgedruckten Linie aufs Papier. Es war kein Wunder, daß er es nicht aushielt an diesem unwirtlichen und von der Zeit vergessenen Ort, wenn sogar sein zäher, unbeugsamer Vater hier nicht länger leben wollte und in südliche Gefilde gezogen war, nachdem er seine Kinder und Kindeskinder allesamt vertrieben hatte. Niemand blieb aus freien Stücken hier, weder die greisen Pärchen und Pensionäre, für die es zu spät war, um zum Sterben das Land zu verlassen, noch er, Thomas, der Erstgeborene. Ihn ereilte der Auftrag, hier nach dem Rechten zu sehen, ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als er seinem Vater nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Er war so gut wie geschieden, ohne Bleibe und feste Anstellung, so daß er nun die Leere und den Tod auf dem einstigen Familiensitz verwaltete, als hätte er nie ein eigenes Leben gelebt.
Der Postbote händigte ihm kein Paket oder Päckchen aus, sondern einen gewöhnlichen Brief, der mit etlichen Sondermarken beklebt war. »Einschreiben«, erklärte der Mann. Doch mehr als die Frage, warum jemand so viel Porto für ein paar Seiten Papier aus dem Fenster warf, beschäftigte Thomas der Umstand, daß der Name seines Vaters nicht auf dem Adreßfeld, sondern auf dem Absender stand: Dr. ing. Jorge de Houwelandt. Ein Stempel. Noch dazu mit seiner hiesigen Anschrift. Und adressiert an dasselbe Haus, in derselben Straße, in der nämlichen Stadt, nur eben an ihn, Thomas. Ein Brief, der sich demnach – im Widerspruch zu den zahlreichen Marken und Vermerken der spanischen Post – gar nicht von der Stelle bewegt haben dürfte. Wie auch immer man das verstand, es war kein gutes Omen.
Dieser Tag war nicht nur nicht sein Freund, er war hochgradig feindselig.
Thomas drehte den Briefumschlag in seinen Händen, als ließe sich auf diese Weise Aufschluß über seinen Inhalt gewinnen. Der Postbote hatte ihn bereits mit einem Nicken stehen lassen, um die Briefkästen des Kinderhauses mit Rentenbescheiden, Arztrechnungen und Pauschalreise-Angeboten für Senioren zu füttern. Jetzt stieg er wie eine Frau auf sein robustes, gelbes Fahrrad und rollte grußlos mit Thomas’ Unterschrift davon. Es war ein Einschreiben, sicher, aber daß ihn dieser Brief heute morgen tatsächlich erreicht hatte, erschien Thomas mit einem Mal wie ein unglaublicher Zufall. Gleichzeitig war ihm klar, daß er nun keine Möglichkeit mehr hatte, so zu tun, als habe er ihn nicht erhalten.
Jorge
Das Meer warf seine weißen Arme um die Insel und schlug sie in ihrem Nacken zusammen. An den Klippen brach sich das Schweigen des Wassers zu Schaum, sprengte durch Höhlen und Klüfte, schoß in Fontänen zum Himmel und trieb beinahe gewichtlos wie Schnee durch die Luft. Über den muschelbewachsenen Stümpfen kochte das Weiß. Dann neigte sich das Meer in seiner ganzen Fläche und stürzte ab.
Die Insel war der Bucht vorgelagert, ein verlorenes Stück Ladung auf dem Weg zum Kontinent. Vor ihrer landabgewandten Seite ging eine andere Brandung, keineswegs wilder, aufgewühlter, sondern fast behäbig, aber machtvoll, die Ausschläge eines ungeheuren, in sich ruhenden Elements. Es atmete nur. Doch wenn es sich hob oder senkte, kippte die Welt.
Jorge schwamm hart an der Kante der Drift, mit der das Meer an der Bucht vorüberzog. Aus den Augenwinkeln betrachtete er die gleißenden, sonnenblitzenden Tank- und Containerschiffe auf ihrem Weg zur Straße von Gibraltar. Sie waren Silberpapier am Horizont, ins Meer gespiegelt, Trugbilder von schwimmenden Inseln im weißlichen Dunst. Sie bewegten sich so, wie Land sich verschob, unmerklich, spurlos. Plötzlich waren sie woanders oder fort.
Es gab kaum Stellen, von denen aus sich die Insel anschwimmen ließ. Entlang der Landseite erstreckte sich eine flach abfallende Halde von Steinen, die ausgeschlagenen Zähne und Zacken der Klippen. Das Wasser war hier zu niedrig, um zu schwimmen, und die Steinlandschaft zu kantig und verkarstet, um hindurchzuwaten. Seeigelkolonien nisteten in den zahllosen Ritzen, Spalten und Kratern, schwarze, bräunlichrot leuchtende Stachelkugeln, die sich aneinanderschmiegten wie ein dichter, schimmernder Pelz. Uneinnehmbar auch die Meerseite. Dort, wo sich die Brandung nicht wundwusch an dem rötlichen, von der Sonne gehärteten Stein, rankten sich Muscheln die Felswände hinauf. Ihre ausgestorbenen, versteinerten Schalen schnitten rasiermesserscharf, keine Hand fand dort Halt. Wer ihnen oder den angrenzenden Muschelbänken zu nahe kam, den schleiften die Wellen vor und zurück über unzählige Klingen. Ihm blieb nur die Hoffnung, daß das Meer an seinem blutigen, rohen Fleisch bald das Interesse verlor und ihn wieder ausspie.
Jorge kannte all die Schauergeschichten der Gestrandeten, doch sie schreckten ihn nicht. Er verspürte eine Nähe zu der Grausamkeit des Elements wie einen tiefen, tröstlichen Schmerz.
Über die schwerfällig schwankende See hinweg konnte er das Plateau sehen, einen ausgehöhlten, hünengrabartigen Felsen, der von den Seitenausläufern der Brandung regelmäßig geflutet wurde und bei ablaufendem Wasser wieder auftauchte, triefend, zerklüftet und schwarz. Für einen Schwimmer bot sich hier die eleganteste und zugleich einzige Möglichkeit, unbeschadet an Land zu gehen: Er mußte die richtige Welle abpassen, sich von ihr auf das Plateau tragen lassen und dann rechtzeitig in den Stand springen, um nicht vom Rückstrom des Wassers wieder ins Meer gerissen zu werden. Jorge beherrschte diese Technik seit so vielen Jahren, daß er sich kaum noch erinnern konnte, ob er sie den Fischerjungen abgeschaut hatte oder ob sie ihn nachahmten, wenn sie zur Insel schwammen und über das Plateau an Land gingen. Doch in letzter Zeit kamen sie immer seltener. Die Insel und der Schmerz, der sie umgab, gehörten ihm.
Jorge spürte den Hub einer mächtigen Welle in seinem Rücken und fing an zu rudern, kurze schnelle Schläge über Kopf. Er mußte sich hineinbegeben in ihren Sog, sich ihr einverleiben für Momente, ihrer Wucht und ihrem unaufhaltsamen Gang, bevor sie ihren Scheitel an die Klippen schlug und sich ihr massiger Körper dem Land ergab. Plötzlich verschwand der Widerstand unter Jorges Händen. Seine Arme und Beine wurden vom Wasser erfaßt und taumelten schwerelos im Auftrieb der sich hebenden See. Jorge legte sich flach auf den Rücken des Brechers. Ihm konnte nichts mehr geschehen. Er war jetzt Teil von etwas Größerem, er war eins mit der Gefahr.
Für einen letzten langen Zug unter Wasser tauchte er ein in das sonnendurchschossene Grün. Mit seinen vorgestreckten Händen strich er über Garben von gebündeltem Licht, das aus der Tiefe zu ihm heraufstrahlte. Dann sah er vor sich, umgeben von schäumenden Luftwirbeln und schwappendem Tang, die Buckel und Furchen des Plateaus. Jorge machte sich lang, er glitt auf dem Wasser dahin wie ein Schatten. Als er festen Boden unter sich sah, winkelte er die Beine ruckartig an. Seine Füße setzten auf, geübt und sicher. Jorge stand auf Anhieb. Er wankte nicht und wartete, bis das Wasser, das ihn getragen hatte, um seine Knie und Waden abgeflossen war. Dann ging er über den aufragenden, schwarzglänzenden Felsen an Land.
Er lebte hier.
Thomas
Er blies eine letzte Rauchwolke gegen die Fensterscheibe in das von Tannennadeln gefächerte und feingesiebte Licht. Dann umfaßte er die vorgewärmte Espressotasse und nippte an dem sämig-schwarzen Sud. Seine Hände hatten sich beruhigt. Der Schwindel seiner Vorfrühstückszigarette durchlief seinen Körper in abschüssigen Bahnen und verflog. Für die Tannen inmitten der Aussicht empfand Thomas erstmals so etwas wie Zärtlichkeit. Sie boten ihm Schutz.
Er hatte die Hundehütte ziemlich verkommen lassen, das war nicht zu leugnen. Die Fassade gehörte gesandstrahlt, es zeigten sich Risse im Verputz, Feuchtigkeit drang in das Mauerwerk. Die letzten Reste von grauer Farbe blätterten ab und machten dem Moos Platz, das sich vom Erdgeschoß bis in den ersten Stock ausgebreitet hatte. Gegen dieses Haus war Thomas von Anfang an machtlos gewesen. Sicher gab es fleißigere und gewissenhaftere Verwalter als ihn, Hausmeistertypen mit Klempner-Erfahrung, Werkzeuggürteln und Baumärkten als Steckenpferd. Er dagegen hatte Geschichte studiert, ein beachtliches Promotionsstipendium erhalten und drei Jahre lang eine akademische Laufbahn als wissenschaftlicher Assistent an einem renommierten Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte eingeschlagen. Doch auch wenn das mittlerweile ein Vierteljahrhundert her war und seine Doktorarbeit aufgrund einiger strittiger Grundsatzfragen auf Eis lag, besaß er noch immer genügend Selbstachtung, um sich von dem – sub specie aeternitatis – unaufhaltsamen Verfall der Dinge nicht versklaven zu lassen. Die Fenster allerdings hätte er putzen können, das stimmte.
Thomas wandte den Blick von den toten Augen seines Vaterhauses ab und zog die Vorhänge zu. Dann setzte er sich an seinen Schreibtisch und nahm sich den Brief vor.
Sein Name auf dem Adreßfeld war in der Handschrift seiner Mutter abgefaßt. Geschwungene Unterbögen, ein schmiegsamer, rechts geneigter Buchstabenfluß, das verhieß Milde und Nachsicht. Andererseits schrieb der Alte nie selbst. Er ließ ausrichten, übermitteln und bestellen, ohne je direkt in Kontakt mit ihm zu treten. Mutter war sein Medium. Wenn er kommunizierte, dann ausschließlich durch sie. Sie war es, die regelmäßig Postkarten mit mehr oder weniger gleichlautenden Lebenszeichen schickte. Sogar seine Unterschrift fehlte, es hieß immer nur »Grüße auch von Deinem Vater«. Sie war es, die alle vierzehn Tage zur selben Zeit anrief, um sich nach dem Zustand der Hundehütte zu erkundigen, insbesondere nach dem Wohlergehen der verstaubten Gummibäume und Kakteen in Vaters Arbeitszimmer, der Azalee im Wintergarten und der leise vor sich hin rieselnden Zimmertanne neben dem alten Schwarz-Weiß-Fernseher. Thomas telefonierte ausgiebig mit ihr. In einem säuselnd sonoren Tonfall gab er beruhigende Antworten, die mit der Wahrheit wenig zu tun hatten. Doch es waren nicht ihre Fragen, sondern die seines Vaters, die er aus dem Geplauder heraushörte, und sie liefen in letzter Instanz alle auf eine einzige Frage hinaus: »Schaffst du das?« Mehr wollte der Alte nicht von ihm wissen, er erwartete keine wortreichen Erklärungen, er wollte ein lautes, vernehmliches Ja oder Nein. Das und nur das würde ihn interessieren, wenn er Mutter im Anschluß an ihr Telefonat mit seinem Blick und seinem Schweigen prüfte, und Thomas wußte, daß sie, wenn es hart auf hart kam, nicht die Unwahrheit sagen würde.
Es gab keinen Zweifel mehr: Was er hier in Händen hielt, war seine Kündigung.
Thomas hatte in seinem Leben viel angefangen und wenig zu Ende gebracht. Wie es jetzt weitergehen sollte, wußte er nicht. Und es schien, als wäre dieser Brief das letzte Glied in der lebenslangen Beweiskette seines Vaters, daß er nichts taugte. Dennoch verspürte er eine Welle der Erleichterung. Nach seinem Abgang von der Universität, einigen unersprießlichen Ausflügen in den Schuldienst und vielen Jahren als Hausmann hatte Thomas mehr als zwei Dutzend Gelegenheitsjobs angenommen. Er war als Vertreter von Haustür zu Haustür gezogen, hatte an Marktständen Obst und Gemüse verkauft, Zeitungen ausgetragen und sogar in einem Unicafé zusammen mit seinen ehemaligen Studenten gekellnert. Verglichen damit besaß eine Verwaltertätigkeit durchaus ihre angenehmen Seiten. Was ihm zu schaffen machte, war nicht die Aufgabe als solche, sondern ihre Vergeblichkeit. Thomas sah keinen Sinn darin, dieses ausgestorbene Haus zu hüten und instand zu halten, Blumen zu gießen und zu lüften, so als wären seine Eltern nur in den Ferien und nicht fortgezogen – wenn sie für ein, zwei Wochen im Jahr zurückkamen, lebten sie wie Gäste im eigenen Haus. Er sah keinen Sinn darin, die kaninchenstallgroßen Kinderzimmer unterm Dach, einschließlich seines eigenen, in exakt demselben Zustand zu bewahren, in dem die Geschwister und er sie verlassen hatten, so als bestünde auch nur die entfernteste Aussicht auf ihre Rückkehr. Alles in ihm sträubte sich gegen die Konservierung der Lüge, daß sich dieses Haus noch einmal bevölkern und mit Leben füllen könnte, und wenn er ehrlich war, sabotierte er diesen Sitz einer Familie, die es nicht mehr gab und nie gegeben hatte.
Mit einem Ruck riß Thomas den Brief auf, der ihm jetzt nichts mehr anhaben konnte. Er war entschlossen, den Kampf mit seinem Vater wieder aufzunehmen. Der Alte täuschte sich, wenn er die Episode seiner gescheiterten Verwalterschaft als endgültige Niederlage ansah. Sie war nur eine Gefechtspause. Thomas hatte sich und seine Kräfte in der Unterdrückung neu gesammelt. Die eigentliche Schlacht würde jetzt erst beginnen!
Er zog eine Einladungskarte hervor, reich ornamentierte Buchstaben auf festem, weißem Karton, »zum 80. Geburtstag von unserem geliebten Mann, Vater und Großvater«. Der Text erinnerte an eine Todesanzeige, doch Thomas hatte keine Zeit, darüber nachzudenken. Was ihn vielmehr beschäftigte, waren der Ort und das Datum. Sie sollte hier stattfinden, diese Feier, in genau einem Monat. Und obwohl die Unterschrift des Alten wie immer fehlte, zweifelte Thomas keine Sekunde daran, daß es mit diesem Familienfest Ernst war. Überdies handelte es sich um eine gedruckte Einladungskarte! Wie viele mochte es davon geben? Wer würde kommen, wer absagen? Und wo in Gottes Namen sollten sie alle wohnen? Dann fiel sein Blick auf die Rückseite, wo in der ebenmäßigen, beinahe gleichmütig rechtsgeneigten Handschrift seiner Mutter stand: »Ich hoffe, es ist alles bereit.«
Esther
Sie hörte den Geländewagen schon von weitem. Der Steinstrand knirschte unter dem Druck der Reifen, Kiesel spritzten zu beiden Seiten. Esther erkannte Hermann Lobeck an seinem ruppigen Fahrstil und dem dunkel vibrierenden Motorengeräusch. Aber sie wandte sich nicht um.
Es gab Momente, da wurde ihr bei dem Gedanken an ihre bevorstehende Reise ganz leicht. Sie brauchte die Veränderung, sie konnte nicht anders, es war ihre Natur. Auch wenn die kommenden Wochen viel Arbeit und Aufregung bedeuten würden, so versprachen sie doch zumindest Abwechslung, und danach suchte Esther. Sie plante nicht nur, sie lebte in ihren Plänen. In solchen Momenten machte es ihr nichts aus, daß Jorge sich gegen das Fest so sehr sträubte. Es weckte ihren Kampfgeist.
Aber dann wieder fühlte sie sich unendlich schwach. Die Verantwortung für das Gelingen des Festes lastete schwer auf ihren Schultern. Es kam ihr vor, als hätte sie die gesamte Familienfeier allein zu bewältigen, eine Feier, die in Wirklichkeit niemand wollte, Jorge nicht und ihre Kinder auch nicht. In solchen Momenten wußte sie nicht, was sie trauriger machte: Jorges stummer, beharrlicher Widerstand, mit dem er seine einsiedlerische Lebensweise gegen jede Abweichung verteidigte, oder die Gleichgültigkeit ihrer Kinder, die sich nicht darum scherten, ob die Familie, für die sie gelebt hatte, jemals wieder zusammenkam. Esther wußte, daß sich bei den de Houwelandts nichts bewegen würde, wenn sie nicht selber dafür sorgte, und sie rechnete ebensowenig mit Dank. Sie hatte bald sechzig Jahre an der Seite eines Mannes gelebt, der sich an seinem achtzigsten Geburtstag nichts Besseres vorstellen konnte als Schwimmen, Bergwandern und Beten. Und sie hatte drei Kinder zur Welt gebracht, die ihrem Vater zu seinem Ehrentag allenfalls eine Postkarte schicken würden, vorausgesetzt, man mahnte sie vorher per Telefon an.
Wenn Esther daran dachte, mußte sie sich den wahren Grund ihrer Reise eingestehen. Nicht die Details der Vorbereitungen erforderten ihre Anwesenheit, sondern die Fallstricke der Familiendiplomatie. Sie stand am Beginn einer Friedensmission, die ihre Geduld auf eine harte Probe stellen würde. Sie mußte um Verständnis werben, ausgleichen und trösten, wo seit Jahrzehnten nur Verbitterung herrschte und niemand ihren Trost mehr brauchte. Sie mußte nach allen Seiten hin Überzeugungsarbeit leisten, auch wenn ihre Ermutigungen, Bitten und Beschwörungen nie lange vorhielten. Esther würde von ihren Kindern allerhand zu hören bekommen, das wußte sie, und gleichzeitig war ihr klar, daß ein einziges falsches Wort genügte, um die mühsam herbeigeredete Gemeinsamkeit zu zerstören. In solchen Momenten spürte sie schmerzlich genau, wie unvereinbar die Menschen waren, die sie liebte. Und sie gab Jorge gegen ihren Willen recht.
Beide Türen des Geländewagens schlugen zu. Esther hörte das Trippeln der Absätze von Marita Lobeck, Hermanns zwanzig Jahre jüngerer Frau, die auch am Steinstrand nicht auf hohe Schuhe verzichten konnte. Mit ihrem neonfarbenen Bikini und den grellbunten Tüchern, die sie um Hals und Hüften geschlungen hatte, war sie nicht zu übersehen. Esther grüßte und löste damit einen für die Entfernung übertriebenen Winkreflex aus. Die Lobecks waren ihre Nachbarn in der Siedlung und pflegten diese Nachbarschaft auch ungefragt am Strand.
Marita stöckelte auf sie zu, um einen halbwegs eleganten Gang bemüht, während sich Hermann mit seiner Fototasche und einem Stativ herumschlug. Wenn sie ihn sah, wußte Esther, was sie an ihrem Mann hatte. Hermann ging erst auf die Siebzig zu, zeigte aber bereits die üblichen Verfallserscheinungen des Alters sowie deutliche Spuren eines exzessiven Lebens, das er überwiegend im Sitzen verbracht zu haben schien. Jedenfalls wirkten seine Beine, verglichen mit dem Rest des Körpers, beängstigend dünn.
»Schlechtes Wetter«, rief er und schaute über den Rand seiner Schirmmütze in den wolkenlos blauen Himmel, »Frankfurt 14, Berlin 13, bewölkt, mit gelegentlichen Auflockerungen. Regenwahrscheinlichkeit 40 Prozent.«
»In Australien hat er immer über die Hitze geflucht. Dabei ist dort jetzt gerade Winter!« Marita tätschelte Esthers Schulter, als wollte sie sagen, bleib sitzen. Bei jeder Bewegung raschelte Chiffon. Ihre Haut roch nach Kokosmilch.
»Australien hat sich wirklich gelohnt. Wenn Sie mal schauen möchten, ich habe alle Bilder digital.« Hermann setzte seine Fototasche neben Esther ab. Es war gerade mal halb elf, doch er schwitzte aus allen Poren.
»Haben Sie alles gefunden, die Schlüssel, die Post?« Esther hatte den Lobecks angeboten, während ihres Australientrips auf das Haus aufzupassen, freilich nicht ohne den Hintergedanken, daß sich die beiden im Gegenzug ein bißchen um Jorge kümmern würden, solange sie weg war.
»Ganz wunderbar«, bedankte sich Marita, »sogar die Bougainvillea blüht! Und duftet, herrlich! Wie haben Sie das bloß hingekriegt?«
»Sie hat sie gegossen«, beendete Hermann das Thema. Er hantierte mit seiner Kamera und starrte angestrengt auf ein briefmarkengroßes Display, auf dem per Knopfdruck Sträuße von irisierend bunten Pixeln erschienen. »Hier haben wir sie schon. In voller Blüte«, zufrieden hielt er Esther die Rückseite seiner Kamera hin, wo ein Miniaturbild der Pflanze zu sehen war, die sie bis gestern versorgt hatte.
»Das ist natürlich alles virtuell. Heutzutage braucht man solche Bilder nicht mehr zu entwickeln, um damit irgendwelche Fotoalben vollzukleben. Man speichert sie einfach und ruft sie ab bei Bedarf. Das heißt, wenn Marita das Grünzeug mal wieder verkümmern läßt.«
Hermann Lobeck hatte als Makler im Rhein-Main-Gebiet ein Vermögen verdient und war dann auf höchster Ebene bei einem Gebäudeversicherer eingestiegen, dessen Auslandsgeschäft mit den Feriendomizilen und Alterssitzen wohlhabender Deutscher er nach eigenem Bekunden »aus dem Boden gestampft« hatte. Von daher hielt er es für sein gutes Recht, bisweilen etwas grob zu sein. Marita war seine »vorläufig dritte Frau«, wie er sagte. Er bot ihr ein sorgloses Leben und das Gefühl, mit Ende Vierzig noch vergleichsweise jung zu sein. Dafür mußte sie seine Launen ertragen und sich in aller Öffentlichkeit von ihm »mein kleines Bettschwein« nennen lassen. Das war der Handel. Doch Marita schien es recht zu sein, solange sie sich die Illusion von Jugendlichkeit bewahren konnte, die durch den Altersunterschied entstand – was in den Kreisen, in denen sie mit Hermann Lobeck verkehrte, kein Problem war.
»Ist es gestattet?«
»Aber bitte!«
Hermann rückte mit seinem formlosen, weichtierhaften Körper dicht an Esther heran, um ihr – wo sie schon einmal dabei waren – seine virtuellen Australienfotos zu zeigen. Eifrig klickte er an den Anfang der Bilderserie zurück, während sie ein mildes Lächeln aufsetzte, das irgendwo zwischen höflichem Interesse und Belustigung spielte.
Sie mußte sich zusammenreißen, um gegenüber den Lobecks nicht überheblich zu werden. Es war leicht, die beiden als neureiche Banausen abzutun und sich für etwas Besseres zu halten. Doch das gestattete sie sich nicht. Esther sah darin den Anflug einer Arroganz, die ihrem Wesen nicht entsprach. Sie meinte zu spüren, wie Jorges Verachtung sich ihrer bemächtigen wollte, um sie gegen den Rest der Welt zu vereinnahmen. Es war dieselbe abweisend-herablassende Haltung, mit der er seinen Nachbarn und allen übrigen Ruheständlern der Siedlung begegnete. Wenn er ihnen nicht aus dem Weg ging.
Niemand war ihm gut genug.
Esther hatte zu lange unter dem Namen de Houwelandt gelebt, um nicht zu durchschauen, daß Jorges eigentümliche Unnahbarkeit aus Stolz bestand. Ein Stolz, aus dem es kein Entkommen gab. Viele Jahre hatte sie im Bannkreis seines Hochmuts, in bitterer Isolation verbracht. Ihn, Jorge, focht das nicht an. Er hatte sich eingerichtet in seinem Abstand zu allem und umgab sich mit Einsamkeit wie andere Menschen mit Musik. Aber so war sie nicht. Sie brauchte Gespräche, Gelächter und Nähe. Sie wollte teilhaben am Leben anderer und andere an ihrem Leben teilhaben lassen, auch wenn Jorge das als Schwäche ansah. Esther brauchte Menschen und war bereit, sich mit denen zu arrangieren, die sie vorfand. Es wäre ihr nie in den Sinn gekommen, unerfüllbare Ansprüche an ihre Umgebung zu stellen, nur um wie Jorge einsam und im Recht zu sein. Und es bereitete ihr im Gegensatz zu ihm nicht die geringste Mühe, freundschaftlich mit ihren Nachbarn zu verkehren, auch wenn sie nun mal waren, wie sie waren.
Hermann war unsichtbar. Auf keinem der Fotos existierte von ihm mehr als ein Schatten. Sie zeigten Marita im Dschungel vor prähistorischen Baumwurzeln, vor den Hütten der Aborigines, vor einer Tankstelle mit Känguruh-Attrappen, vor einer Shopping-Mall in Sidney und am Hafen mit Blick auf die Königswellen des Pazifik. Zwischendrin gab es das eine oder andere Stilleben: Candlelight-Dinner für zwei Personen mit riesigen Steaks oder Hummern, die über die Teller ragten. Doch Hermann selbst tauchte nirgendwo auf. Marita, so schien es, war mit einem Gespenst verreist.
Trotzdem erschien er Esther immer noch greifbarer als Jorge. Hermann Lobeck konnte zuweilen laut und unangenehm sein, aber er war – außer auf seinen Fotos – wenigstens da. Man konnte mit ihm lachen, man konnte ihm böse sein. Er war gelegentlich peinlich, aber immer hilfsbereit, auch wenn Jorge sich lieber die Zunge abbiß, als ihn um Hilfe zu bitten. Hermann hatte ihr – nicht ihm! – bereits zweimal den Wagen repariert, die Heizung eingestellt und einen Job als Honorarkraft bei einer Kanzlei in der Stadt vermittelt, für die sie aus dem Spanischen ins Deutsche übersetzte und seit anderthalb Jahren auch vice versa. Mit der Zeit hatte sie dank dieser Nebenbeschäftigung eine nicht unbeträchtliche Summe angespart, Geld, das sie jetzt für ihre Reise brauchte und für den Familiensitz der de Houwelandts, dessen Herrichtung sie unmöglich Thomas allein überlassen konnte. Doch Esther dachte nicht an ihren Sohn, sie hütete sich, an ihn zu denken, um nicht in Mutlosigkeit zurückzufallen. Denn Seite an Seite mit Hermann Lobeck fühlte sie sich stark. Sie war entschlossen, ihren stummen Streit mit Jorge notfalls bis zur Stunde ihrer Abreise auszufechten und nicht zu verzweifeln an seinem Stolz und seiner Teilnahmslosigkeit.
»O Gott, wo ist er denn jetzt auf einmal?« rief Marita Lobeck, die bis ans Wasser hinuntergetrippelt war und aufs Meer starrte, »Jorge ist weg!«
Esther schaute auf. So schnell ließ sie sich nicht erschrecken. Es genügte ein Blick, und sie wußte genau, wo er an diesem wie an jedem Morgen gerade war. »Hinter dem Fischerboot«, gab sie zurück.
Hermann verstaute die Kamera mit einem Seufzer, so als sei seine Vorführung durch diesen Zwischenruf unwiederbringlich gestört. Für einen Moment scharrten seine Füße scheinbar sinnlos im Kies, dann wuchtete er sich hoch. »Laßt uns was trinken gehen.«
Christian
Sein Bedarf an Schweigen war noch nicht gedeckt, trotz der halbstündigen Heimfahrt vom Sender. Es war erst elf, doch für einen so jungen Tag hatte er schon mit zu vielen Leuten gesprochen und zu vielen Leuten zugehört. Christian de Houwelandt bog nicht in die verkehrsberuhigte Seitenstraße ein, in der er mit Ricarda wohnte, sondern fuhr weiter geradeaus Richtung Stadtrand. Er konnte jetzt noch nicht nach Hause. Er konnte nicht schon wieder zuhören und reden. Er brauchte die Autostille um sich herum. Christian bremste an einer Fußgängerampel ohne Fußgänger und schüttelte den Kopf.
Er hatte immer gedacht, wenn er einer Frau anbieten würde, mit ihm eine Familie zu gründen, dann gäbe es darauf keine andere Antwort als Ja. Er hatte seit seiner Geschlechtsreife in der festen Überzeugung gelebt, von Frauen mit mehr oder weniger dringlichen Kinderwünschen umgeben zu sein. Und er hatte geglaubt, seine bisherige Kinderlosigkeit sei einzig und allein seinem diplomatischen Geschick als Mann und Liebhaber zu verdanken, einem Arsenal von Themenvermeidungsstrategien und Hinhaltetaktiken, mit denen er sich der Fortpflanzungswut der Gattung und der Gene entzog. Bis gestern. Gestern hatte er Ricarda zum Essen eingeladen, sie von ihrem Tag erzählen lassen und ihr zugehört. Dann hatte er ihr angeboten, mit ihm eine Familie zu gründen. Er hatte ihre Hand genommen und geflüstert: »Ich will ein Kind von dir.« Doch sie hatte nicht ja gesagt. Ricarda sagte nichts.
Wieder mußte er abbremsen. An einer Kreuzung staute sich der Verkehr. Vor und hinter ihm nur Viertürer und Kombis. Neben ihm eine junge Mutter in einem Polo mit Kindersitz auf der Rückbank und Sonnenblenden an den Seitenfenstern. Die Frau rief etwas über die Schulter nach hinten und streckte dabei tastend den Arm ins Halbdunkel. Als sie Christians Blick bemerkte, lächelte sie ihn an, und er lächelte zurück. Es waren Sichtblenden im Teddybär-Design mit großen, runden Kulleraugen und balkenförmigen Barthaaren neben der Knopfnase. Teddybären hatten keine Barthaare. Es mußte sich um Katzen handeln. Ein echter Vater hätte das sofort gewußt.
Gestern noch hatte Christian unwillkürlich neun Monate vorausgerechnet – ein Kind im späten Frühjahr oder frühen Sommer, das schien ihm kein schlechter Zeitpunkt zu sein. Dann wieder kam es ihm vor, als ginge das alles ein bißchen zu schnell, schließlich würde ein Kind ihr Leben von Grund auf verändern. Es wäre der letzte Sommer mit Ricarda allein – nur noch wenige Wochen! –, und sie hatten nicht einmal einen gemeinsamen Urlaub geplant. Vielleicht, hatte er überlegt, sollten sie das sorglose Leben zu zweit noch eine Weile genießen, ohne Verpflichtungen und schlechtes Gewissen. Aber er war dreiunddreißig und Ricarda nur knapp ein Jahr jünger, und wenn er es recht bedachte, hatten sie ihr Leben lange genug genossen und kein schlechtes Gewissen gehabt. »Ich will ein Kind von dir«, hatte er zu ihr gesagt, doch er meinte: »Jetzt oder nie!«
Ricarda hatte geschwiegen. Sie hatte ihn einen Moment lang angesehen, auf ihren Teller gestarrt und nichts gesagt, während er das Schweigen fast ein bißchen zu gekonnt überbrückte. Dann nahm sie ihren Gesprächsfaden wieder auf, während er seinerseits immer stiller wurde. Sie erzählte weiter von ihrem neuesten Mandanten, einem streitbaren Immobilienmakler, und dem Prozeß, den sie gerade vorbereitete. Sonst sagte sie nichts, was bei einer Jetzt-oder-Nie-Frage soviel hieß wie Nein.