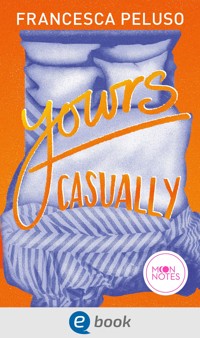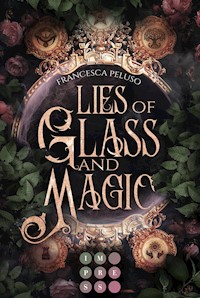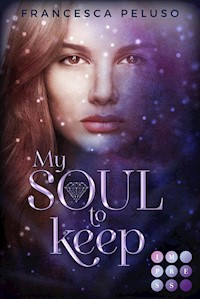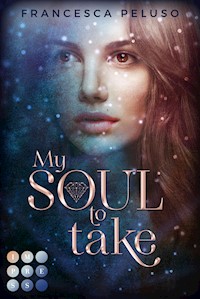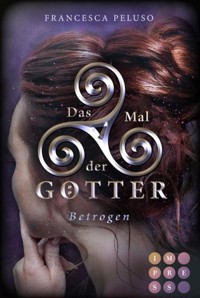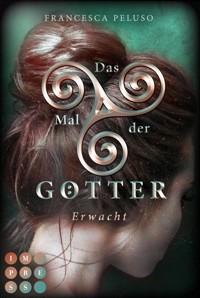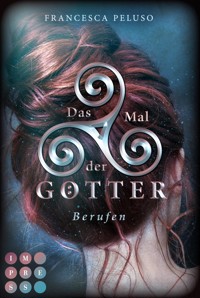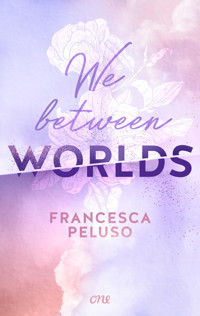
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Ferham Creek
- Sprache: Deutsch
Die liebsten Tropes vereint: Haters to Lovers & Fake-Dating
An der Elite-Privatschule auf der Eastside der Küstenstadt Ferham Creek ist Peyton Torres die Außenseiterin. Als Stipendiatin von der Westside wird sie von ihren reichen Kommilitonen im besten Fall ignoriert, meistens jedoch schikaniert. Peyton träumt davon, Fotografie zu studieren. Um ihrem Ziel näher zu kommen, jobbt sie für die Lokalzeitung und im Golf Club. Die Arbeit dort könnte so entspannt sein, wäre da nicht der gleichermaßen attraktive wie arrogante Charles McCoy. Als Sohn der Bürgermeisterin ist er der Meinung, sich alles erlauben zu können. Doch dann leistet sich Charles einen Fehltritt, der seine Mutter das Amt kosten könnte - und er braucht dringend Peytons Hilfe ...
Für Fans von Outer Banks, Gossip Girl & O.C. California
Band 2 (SECRETS BETWEEN US) erscheint am 25.07.2025
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Kapitel 1 Charles
Kapitel 2 Charles
Kapitel 3 Peyton
Kapitel 4 Peyton
Kapitel 5 Charles
Kapitel 6 Peyton
Kapitel 7 Peyton
Kapitel 8 Charles
Kapitel 9 Charles
Kapitel 10 Peyton
Kapitel 11 Charles
Kapitel 12 Charles
Kapitel 13 Peyton
Kapitel 14 Peyton
Kapitel 15 Charles
Kapitel 16 Charles
Kapitel 17 Peyton
Kapitel 18 Charles
Kapitel 19 Peyton
Kapitel 20 Charles
Kapitel 21 Peyton
Kapitel 22 Peyton
Kapitel 23 Charles
Kapitel 24 Peyton
Kapitel 25 Charles
Kapitel 26 Charles
Kapitel 27 Peyton
Kapitel 28 Peyton
Kapitel 29 Charles
Kapitel 30 Charles
Kapitel 31 Peyton
Kapitel 32 Peyton
Kapitel 33 Peyton
Kapitel 34 Charles
Kapitel 35 Charles
Kapitel 36 Peyton
Kapitel 37 Peyton
Band 1
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Francesca Peluso wird vertreten durch die Agentur Härle
Copyright ® 2024 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Anne Schünemann, Schönberg
Umschlaggestaltung: © SO YEAH DESIGN, Gabi Braun
Umschlagmotiv: © Sinisha Karich / shutterstock.com; ChunnapaStudio / shutterstock.com; oxygen_8 / shutterstock.com; klyaksun / shutterstock.com
Kartengestaltung & Stadtwappen: © Francesca Peluso
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7517-6472-8
Sie finden uns im Internet unter one-verlag.de
Bitte beachten Sie auch luebbe.de
Für all meine Glückssterne, für meine guten Feen,alle Wimpern, die ich über die Jahre verloren habe,und alle Marienkäfer, die mir begegnet sind.
Ohne euch wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin.
Kapitel 1 Charles
Sobald man den Whitestone River überquert hatte, befand man sich in einer anderen Welt. Als wäre dieser Fluss eine Art magisches Portal. Doch es war nicht wie bei dem Schrank, der nach Narnia führte, oder dem zweiten Stern rechts, der einen nach Neverland navigierte. Nein, die Brücken des Whitestone Rivers brachten niemanden auf eine zauberhafte Reise. Viel eher führten sie hinein in den schlimmsten Albtraum. Oder besser gesagt: in den Inbegriff von Hässlichkeit.
Jedenfalls, wenn man Charles fragte. Für ihn war die andere Seite des Flusses eine Mischung aus Mülldeponie, Ghetto und einem Filmschauplatz der Achtzigerjahre. Und je weiter man Richtung Westen fuhr, desto schlimmer wurde es.
»McCoy, was stehst du da so herum? Hat es dir etwa die Sprache verschlagen?«, stichelte Alex, der Kapitän des Lacrosse-Teams, mit einem breiten Grinsen. Seine hellbraunen Haare fielen ihm lose in die Stirn und könnten mal wieder geschnitten werden, wie Charles fand.
Neben Alex standen fünf Jungs, die am Montag ihren ersten Tag an der Highschool haben würden. Und ehe der anbrach, würden sie sich beweisen müssen. Was der Grund war, warum sie an diesem Abend hier waren.
Die fünf Freshmen stammten alle aus gutem Hause, und auf ihren Gesichtern spiegelten sich Panik oder Belustigung. Die einen sahen sich in ihrer Arroganz schon als festen Teil der Lacrosse-Mannschaft. Die anderen waren bis auf die Knochen verängstigt und wollten lieber wieder nach Hause.
Theatralisch legte sich Charles eine Hand auf die Brust und seufzte. »In der Tat. So viel Hässlichkeit macht mich sprachlos«, erwiderte er und wischte sich eine imaginäre Träne aus dem Auge, bevor er leise lachte.
Ein Grinsen schlich sich auf Alex’ Gesicht. »Sag das deiner Mom, sie ist doch die Bürgermeisterin.«
Charles nickte. »Das sollte ich vermutlich tun. Dieses Drecksloch hier ruiniert den guten Ruf von Ferham Creek. Ich würde uns allen damit einen Gefallen erweisen.«
Ferham Creek war eine kleine Hafenstadt an der Küste von Massachusetts im Bezirk Essex County. Die Stadt genoss das gute Image des Bay State, war aber noch weit genug von Boston entfernt, um dem Tumult und der Hektik der Großstadt zu entkommen.
Gutsituierte Familien, aufstrebende junge Geschäftsmenschen, aber auch Touristen, die den Charme der Kolonialarchitektur suchten, zog es nach Ferham Creek. Wenn es die Westside nicht gäbe, wäre die Stadt vermutlich genauso überlaufen wie Boston selbst.
»Der heilige Samariter Charles McCoy. Womit haben wir deine Anwesenheit in unseren Reihen verdient?«, zog Drew ihn lachend auf. Im Gegensatz zu Alex trug er seine braunen Haare perfekt gestylt.
Alex legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Deine Mom hat Wichtigeres zu tun, als sich um die Westside zu kümmern, glaub mir. Interessiert doch eh niemanden, was die hier so treiben.« Abschätzig sah er sich auf dem Parkplatz um und deutete auf das marode Gebäude hinter ihnen, das nur durch eine schwache Notbeleuchtung erhellt wurde.
Es war nicht mit ihrer eigenen Schule zu vergleichen. Die Saint Clarice Preparatory School gehörte zu den angesehensten privaten Bildungsinstituten Amerikas. Die Westside High hingegen ... Himmel, es gab Schrottplätze, die schöner waren. Geklebte Fensterscheiben, fehlende Dachziegel und abgeplatzte Treppenstufen. Hier sollte dringend mal das Bauamt vorbeischauen und prüfen, ob das Ding nicht einsturzgefährdet war.
»Wenn’s dich nicht interessiert, was die hier treiben, warum sind wir dann hier, Alex?«, fragte Drew.
»Nenn es Rache, Vergeltung, Karma ...«
»Dummheit?«, ergänzte Drew. »Du willst der Westside High eine Lektion erteilen. Das hat rein gar nichts mit Karma zu tun.«
Alex zuckte mit den Schultern.
Charles wunderte es immer noch, dass sein bester Freund mitgekommen war. Drew hatte sich den ganzen Sommer über rargemacht. Was vermutlich an der Trennung von Eleanor van der Berg gelegen hatte. Doch auch in seinen geselligen Momenten war Drew eigentlich nicht für derartigen Blödsinn zu haben. Er war der Vernünftigste ihrer Gruppe.
Alex kniff die Augen zusammen. »Und ob es das hat«, widersprach er vehement. »Du kapierst das nicht, Drew. Unsere Sportlerehre wurde verletzt.«
»Bist du sicher, dass es nicht eher dein Stolz war, der verletzt wurde, Alex?« Charles lachte. Man konnte schlecht von Ehre sprechen, wenn man im Begriff war, dem gegnerischen Team für seine letzte Niederlage eins reinzuwürgen.
»Ihr checkt es echt beide nicht. Wärst du noch Teil des Teams, würdest du das verstehen, Charles«, brummte Alex und schnippte seine Zigarette weg. Wenn der Coach sehen würde, dass er rauchte, würde er ihn einen Kopf kürzer machen, so viel stand fest.
Charles zuckte mit den Schultern. »Bin ich aber nicht.« Es war ihm egal, aus welchem Grund sie auf der Westside waren. Ihm war langweilig gewesen, und Alex’ Nachricht war ihm da gerade recht gekommen.
Auch wenn Charles sich im vergangenen Jahr dazu entschieden hatte, Lacrosse an den Nagel zu hängen, und seither nicht mehr allzu viel mit den Jungs des Teams zu tun hatte, waren sie immer noch seine Freunde. Sie begegneten sich täglich auf den Fluren der Schule. Außerdem gehörten ihre Eltern denselben Kreisen an, da war es selbstverständlich, dass sie den Kontakt hielten.
»Die Newbies müssen doch wissen, wie der Hase läuft«, versuchte Alex es weiter und deutete auf die zukünftigen Freshmen, die ab nächster Woche die Luft der Highschool schnuppern durften.
In diesem Moment konnte Charles diesen Wunsch ein bisschen verstehen, und er war froh, dass er sich vor dem Team nicht mehr beweisen musste. Aber es gab noch weitere Gründe, warum er kein Lacrosse mehr hatte spielen wollen. Er wollte kein Profi werden, dafür war er ohnehin nicht gut genug. Was wiederum seinem Vater ein Dorn im Auge gewesen war, denn dieser hatte ebenfalls in seiner Jugend gespielt und wollte, dass Charles die Tradition fortführte. Für Charles war das allein schon Grund genug, dem Sport abzuschwören.
»Was hast du dir dieses Mal für die Neuen ausgedacht?«, fragte Charles an Alex gewandt. Er erinnerte sich noch gut an ihren eigenen Einstieg. Der damalige Kapitän, Theodore Irvine, hatte von ihnen verlangt, die Fahne der Westside High zu klauen. Doch nicht während einer Nacht-und-Nebel-Aktion, nein, bei laufendem Schulbetrieb. Theo war ein fantastischer Captain und der Vorzeigesohn der Eastside gewesen, bevor er im vergangenen Jahr die Highschool mit Bestnoten abgeschlossen hatte und nach Harvard gegangen war. Charles hatte als Freshman zu Theo aufgesehen, nun hatte er seinen Platz eingenommen. Abgesehen von der Position als Kapitän.
Alex zuckte mit den Schultern. »Nur etwas Kultur und Kunst. Wir müssen sie doch in ihrer Bildung unterstützen.« Wenn er so sprach, wirkte er wie der Inbegriff von Unschuld, dabei war er alles andere als das.
Skeptisch betrachtete Charles die Farben und vielen Stifte, die Alex jetzt von der Ladefläche seines Geländewagens aus verteilte. Das alles würde mehr werden als ein simpler Streich ...
»Du willst also in die Sporthalle einbrechen und was genau tun? Die Wände beschmieren?«, fragte Charles weiter.
Alex nickte. »Die Jungs sollen ihrer Kreativität freien Lauf lassen.« Er zog seinen Schlüsselbund aus der Hosentasche und schloss die Türen zur Sporthalle der Westside High auf. »Nur das Einbrechen sparen wir uns. Wir sind doch keine Amateure.« Er klimperte fröhlich mit den Schlüsseln, als wären es Kastagnetten.
»Du hast deinem Dad den Schlüssel geklaut?«, fragte Drew mit hochgezogener Augenbraue. »Glaubst du nicht, dass es im Polizeirevier auffällt, wenn er fehlt? Oder dass du die erste Person bist, die man verdächtigt?«
»Du machst dir zu viele Sorgen, Drew.« Alex seufzte und machte eine wegwerfende Handbewegung. »Ich habe sämtliche Schlüssel der Stadt nachmachen lassen. Du weißt doch, ich hab da so meine Kontakte. Meinem Alten fällt das nicht auf.«
Charles schüttelte den Kopf. »Wäre für dich jedenfalls besser, wenn er es nicht merkt. Dein Dad macht dich kalt, wenn er es herausfindet.«
Mit Sheriff Goldman war nicht gut Kirschen essen. Er war selten gut gelaunt, erwartete Disziplin und Ordnung, und es kursierten Gerüchte, dass ihm in Gegenwart seiner Söhne schon häufiger die Hand ausgerutscht sei. Doch Charles gab nichts auf Gerüchte, davon hörte man in ihren Kreisen ohnehin zu viele. Solange Alex und sein Zwillingsbruder Franklin diese üblen Nachreden widerlegten, glaubte er seinen Freunden. Trotzdem wollte er sich mit dem Sheriff nicht anlegen. Und Alex sollte das besser auch nicht tun.
Grünliches Neonlicht wies ihnen den Weg in die Sporthalle. Es roch nach Gummi, Schweiß und nassen Wänden. Charles rümpfte die Nase.
Allein dieser Gestank war kaum auszuhalten. So etwas gab es an der Saint Clarice Prep nicht. Da duftete es angenehm nach Pfirsich oder Orange, je nachdem mit welchem Putzmittel die Flure geschrubbt worden waren.
»Willkommen in unserer persönlichen Kunstgalerie«, tönte Alex und stieß die Türen auf. Dunkel lag die Sporthalle vor ihnen.
Zu Charles’ Überraschung wurde der Raum für viel mehr genutzt als bloß für den Schulsport. Natürlich gab es auch hier Regale voller Basketbälle, Hockeyschläger, Federbälle und sonstigem Krempel. Doch daneben standen Bühnenrequisiten, Kostüme, Instrumente und Notenständer auf engstem Raum nebeneinander.
»Ist ja armselig, dass jeder einzelne Club auf die Sporthalle angewiesen ist, um zu proben«, feixte einer der Newbies, dessen Namen Charles nicht kannte.
Wo er allerdings recht hatte, hatte er recht. Sie alle waren den Luxus der Saint Clarice Preparatory School gewohnt. Dort gab es für jeden Club eigene Räumlichkeiten. Mehrere Hallen für die verschiedenen Sportarten, eine gigantische Bühne inklusive Umkleidekabinen und Requisitenräumen sowie ein überdachtes Freilichttheater. Niemand kam sich in die Quere, niemand wurde in seiner Kreativität, Leistung und Förderung beschnitten.
»Schaut euch diese Schläger an, die hätten schon vor drei Saisons im Müll landen sollen«, flüsterte Alex und betrachtete skeptisch einen der Lacrosseschläger.
»Und trotzdem haben sie ausgereicht, um uns zu besiegen«, murmelte Drew und verschränkte die Arme vor der Brust.
Alex warf ihm einen vernichtenden Blick zu, doch Drew hatte recht. Eine ernüchternde Erkenntnis, wie Charles fand.
»Dann seht am besten zu, dass ihr die geforderte Leistung haltet und ihr die kommende Saison gewinnt. Eine zweite Niederlage gegen die Westside wird der Coach kaum billigen. Vielleicht wird er darüber sogar so wütend, dass er euch auf eine staatliche Schule schicken wird.« Drew sah den Kapitän herausfordernd an.
Die erschrockenen und angewiderten Blicke der Newbies waren genau die Reaktionen, die Charles im Spiegel sah, wenn er sich vorstellte, nicht auf eine elitäre Privatschule gehen zu können. Keiner, der auf der Eastside lebte, wollte das.
»Dann lasst uns dieses Drecksloch mal etwas aufpolieren. Nur weil sie sich keinen Interior Designer leisten können, müssen sie ja nicht auf eine Renovierung verzichten.« Alex grinste breit und zog einen schwarzen Filzstift hervor. Er machte den Anfang. In einer krakeligen Handschrift schrieb er einen Satz an die hellgelbe Wand der Sporthalle. Wobei es nicht irgendein Satz war. Es war eine Beleidigung, die es in sich hatte. Danach gab es kein Halten mehr für die Jungs. Die nächste Gemeinheit folgte, und noch eine und noch eine, bis Charles aufhörte mitzuzählen.
Die Wand füllte sich immer weiter mit fiesen Sprüchen und Beleidigungen. Es wurde sich über unfreundliche Ladenbesitzer, arrogante Lehrkräfte, den Stadtrat und sogar über Mitglieder der Ferham Falcons ausgelassen, einer Gang der Westside. Bald zierten auch gigantische Penisse, Strichmännchen und Brüste die Fläche.
Charles lief an der Wand entlang, die nun jeder Toilettenkabine aus amerikanischen Teenie-Serien Konkurrenz machte. Manche Namen, die dort standen, kannte er nicht. Es musste sich um Kids handeln, die die Newbies noch aus der Middle School kannten. Charles kümmerte es nicht, mit wem sie damals Probleme gehabt hatten, doch ein Satz stach ihm ins Auge.
PEYTON TORRES IST EINE DUMME SCHLAMPE, DIE AUF DER EASTSIDE NICHTS ZU SUCHEN HAT
Skeptisch runzelte er die Stirn. Er hatte diesen Namen schon mal irgendwo gehört, doch ihm fiel nicht ein, wo. Was er jedoch sofort erkannte, war die Handschrift. Es war Alex gewesen, der den Satz niedergeschrieben hatte. Mit einem verwunderten Blick sah er zum Kapitän hinüber.
Dieser klatschte gerade zufrieden in die Hände. »So sieht dieses Loch schon wesentlich ansprechender aus, findet ihr nicht?«
Charles zuckte mit den Schultern. Alex würde schon seinen Grund gehabt haben, so über eine Frau zu sprechen, auch wenn er sich wahrlich keinen plausiblen Grund vorstellen konnte. Zumal er nicht wusste, wer Peyton Torres war. Aber das würde er irgendwann schon herausfinden ...
»Noch nicht ganz«, sagte einer der Newbies auf Alex’ Frage hin. Er ging zu einem der Kleiderständer und zog ein Kostüm hervor. »Die haben hier wirklich keinen Geschmack!« Er hielt sich das Kleid vor den Körper, um damit zu posieren.
»Und dann auch noch diese grottige Qualität«, bemängelte ein anderer und zog an einem der Säume. Die Naht löste sich, und der Stoff riss. »Upsi«, kam es lachend von dem Freshman, und der Rest der Gruppe stimmte ein.
Da wurde ein Requisit umgestoßen, das nächste folgte. Ein Bühnenbild wurde beschmiert und ein anderes zerbrach. Wenige Minuten später sah die Turnhalle aus wie ein Schlachtfeld.
Plötzlich erklang ein Geräusch, und Charles hielt inne. »Habt ihr das gehört?«
Das Lacrosse-Team lauschte. Alex zuckte mit den Schultern. »Was meinst du, McCoy?«
Charles schüttelte mit dem Kopf. Da war das Geräusch wieder. Es waren Schritte und das Klimpern von Schlüsseln. »Alex? Du hast doch überprüft, ob der Nachtwächter da ist, oder?«
Sein Freund wurde blass und schüttelte dann kaum merklich den Kopf. »Das ist die Westside, woher sollte ich wissen, dass es einen Nachtwächter gibt? Was will man hier schon klauen?« Er deutete auf die alten Sportgeräte und die bereits in Mitleidenschaft gezogenen Instrumente. Nichts davon hatte einen großen Wert, und allein die mangelnde Instandhaltung verriet die finanziellen Probleme der Schule.
Charles kniff die Augen zusammen.
Da ging das Licht in einem der Flure an und leuchtete durch die Türen zu ihnen in die Halle.
»Scheiße, mein Dad bringt mich um«, zischte Alex und strich sich fahrig durch die zerzausten braunen Haare.
Charles konnte nicht widersprechen. Sollte man sie hier erwischen, würde Sheriff Goldman ihnen die Hölle heiß machen. Das durfte nicht passieren. Durch die Türen, die auf den Flur führten, konnte er den Nachtwächter bereits sehen. Er pfiff vor sich hin, vermutlich passend zu dem Lied, das aus seinen Kopfhörern kam.
»Okay, hör zu«, raunte Charles hastig. »Ihr alle verschwindet durch die Umkleidekabinen, die aufs Spielfeld führen. Ich halte euch den Rücken frei.«
»Bist du sicher?«, fragte Drew ihn zögernd.
»Na klar!« Er lachte. Was wollte der Nachtwächter schon machen, wenn er Charles erwischte? Die Polizei rufen? Die Bürgermeisterin würde wohl kaum zulassen, dass man ihren Sohn verhaftete. Charles würde rein gar nichts passieren, da konnte er ruhig seine Freunde decken, denn ohne eine Ablenkung würde keiner von ihnen unbemerkt hier rauskommen.
»Wir schulden dir was, McCoy!«, rief Alex über die Schulter, als sie durch die Seitentür zu den Umkleidekabinen verschwanden. Im selben Moment wurde die Tür zur Sporthalle geöffnet und das Licht eingeschaltet.
Der Nachtwächter riss entsetzt die Augen auf, als er das Chaos entdeckte. Ungeschickt zerrte er sich die Kopfhörer von den Ohren, sodass sie wie eine Krause um seinen Hals lagen. Auf einem Schild an seiner Uniform stand O. Howard.
»Hallo Mr Howard, was für ein schöner Abend«, flötete Charles, um seinen Freunden etwas Zeit zu verschaffen. »Was führt Sie hierher?« Er vergrub die Hände in den Hosentaschen und wippte auf den Fußballen.
Der Nachtwächter starrte ihn an, und ein dunkler Schatten legte sich auf sein Gesicht. Dann zog er einen Taser aus dem Gürtel an seiner Hüfte. »Stehen bleiben und Hände hinter den Kopf.«
Charles hob eine Augenbraue. »Ihr auf der Westside habt wirklich keine Ahnung von Anstand oder Etikette. Aber gut, von mir aus.«
Missmutig kam der Nachtwächter auf ihn zu und griff nach den Handschellen. »Ich werde den Sheriff rufen«, drohte er, als er Charles die Handschellen anlegte.
Kurz spielte Charles mit dem Gedanken, wegzulaufen, verwarf ihn aber wieder. Sollte man ihn auf der Flucht ertappen, würde ihn das in ein noch schlechteres Licht rücken. Ergab er sich sofort und kapitulierte, würde ihm das bestimmt zugutekommen.
Es war ein seltsames Gefühl. Er war noch nie verhaftet worden. Unbekümmert zuckte er mit den Schultern. »Von mir aus. Richten Sie Mr Goldman meine Grüße aus«, setzte er noch nach.
Ein Schnauben war die Antwort, als Mr Howard nach dem Funkgerät griff und irgendeinen Code durchgab. Charles achtete gar nicht darauf, was die Stimme am anderen Ende sagte.
»Wo sind deine Freunde?«, blaffte der Nachtwächter ihn an und sah sich prüfend um.
Charles verzog den Mund. »Welche Freunde, Sir?«, fragte er gespielt traurig.
Mr Howard kniff die Augen zusammen. »Du bist nicht allein gewesen, Junge. Also, wo sind die anderen?«
Er seufzte. »Ich fürchte, da muss ich Sie enttäuschen. Ich sehe zwar unverschämt gut aus und bin unglaublich charmant, aber irgendwie möchte trotzdem niemand mein Freund sein. Haben Sie eine Ahnung, woran das liegen könnte?«
Der Nachtwächter verdrehte die Augen. »Redest du immer so viel?«, fragte er genervt und schob Charles vor sich her in Richtung Ausgang.
Charles ging anstandslos mit ihm mit. »Glauben Sie, dass das der Grund ist?«, fragte er scheinheilig. »Ich rede einfach zu viel?« Ihm machte es inzwischen wirklich Spaß, den Wächter auf die Palme zu bringen.
»Halt die Klappe«, zischte der und verstärkte den Griff an Charles’ Oberarm. »Du bist hiermit festgenommen, das wird in deiner Akte auftauchen.«
Ein Grinsen schlich sich auf Charles’ Gesicht, und er schüttelte kaum merklich den Kopf. »Das wage ich stark zu bezweifeln.«
Kapitel 2 Charles
Ungeduldig saß Charles auf dem Plastikstuhl neben dem Tresen. Das Polizeirevier war um diese Uhrzeit gähnend leer. Wer sollte auch an einem Samstagabend um kurz vor zwölf Uhr hier sein? Immerhin hatte man ihn direkt auf das Revier der Eastside gebracht, in dem Sheriff Goldman residierte. Auf der Westside wäre wohl mehr los gewesen. Dort herrschte schließlich eine der höchsten Kriminalitätsraten von ganz Essex County.
Gedankenverloren nippte er an dem Kaffee, den ihm Sheriff Goldmans Sekretärin zubereitet hatte. Mrs Williams war in den Fünfzigern, ausgesprochen freundlich, und Charles liebte es, wie sie auf seinen Charme ansprang.
Sobald Sheriff Goldman den Anruf des Nachtwächters entgegengenommen hatte, hatte dieser Charles auf direktem Weg hierhergebracht. Mrs Williams hatte er es zu verdanken, dass er bei ihr im Foyer sitzen durfte und nicht im Büro des Sheriffs auf seine Mutter warten musste.
Gerade, als Charles glaubte, er würde sich hier zu Tode langweilen, ging die Tür zum Polizeirevier auf, und seine Mom trat ein. Dicht gefolgt von seinem Dad. Ach, verdammt. Er hatte gehofft, dass nur seine Mom kommen würde. Aber nein, Henry McCoy, der umsorgende Ehemann und Vater, hatte es sich nicht nehmen lassen, sie zu begleiten. Das bedeutete gewaltigen Ärger.
Mrs Williams erhob sich und strich sich beim Aufstehen die Haare zurück und den Rock glatt. Was man eben so tat, wenn die Bürgermeisterin plötzlich vor einem stand. Ein etwas zu breites Lächeln erschien auf ihrem Gesicht. »Bürgermeisterin McCoy, Mr McCoy, entschuldigen Sie die späte Störung. Danke, dass Sie beide gekommen sind«, sagte sie und neigte den Kopf.
Seine Mom trat auf die Sekretärin zu und reichte ihr die Hand. »Ich habe zu danken, Mrs Williams. Ist Sheriff Goldman benachrichtigt?«
»Er ist in seinem Büro und wartet auf Sie«, erwiderte die Sekretärin.
Charles’ Mom nickte ihr lächelnd zu. »Danke sehr.«
Dann war es nun wohl Zeit für die große Show. Charles erhob sich in einer fließenden Bewegung und lächelte Mrs Williams charmant an. »Haben Sie vielen Dank für den Kaffee, er war vorzüglich.«
»Sehr gern, Charles.«
Er lächelte noch etwas breiter. »Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen.«
Sein Vater gab ein Schnauben von sich und fasste Charles am Oberarm. »Das ist doch bitte nicht dein Ernst«, zischte er ihm zu.
»Charles, geht es dir gut?«, wollte seine Mom wissen. Sorge lag in ihren braunen Augen, und ihr Blick glitt prüfend über ihn hinweg, als suchte sie nach Verletzungen.
Er nickte. Was sollte ihm schon fehlen? Er hatte höchstens zu viel Farbe eingeatmet. »Alles in Ordnung. Das ist nur ein kleines Missverständnis.«
Sein Vater runzelte die Stirn, und seine Nasenflügel bebten. Kein gutes Zeichen. »Missverständnis?«, blaffte er. »Du hast die Turnhalle der Westside Highschool verwüstet und einen enormen Schaden angerichtet. Das nennst du ein Missverständnis?«
Enormer Schaden? Na, das war ja wohl gewaltig übertrieben. Nichts, was ein bisschen Farbe nicht wieder richten konnte. Und die Instrumente hatten ohnehin schon bessere Tage gesehen. Die paar Kratzer würden da gar nicht auffallen.
»Ja, wenn du es so sagst ...« Charles zuckte mit den Schultern. Diese Nacht landete definitiv in den Top drei seiner beknacktesten Entscheidungen, aber ändern konnte er daran jetzt ohnehin nichts mehr.
»Wie sollte ich es sonst sagen?!«, erwiderte sein Dad aufgebracht, versuchte aber seine Stimme unter Kontrolle zu halten.
Charles sah ihn wortlos an. Jeder sagte ihm immer, dass er genauso aussah wie sein Vater. Dabei hoffte Charles inständig, dass das nicht stimmte. Oder hatte er auch diese gefährlich pochende Ader auf der Stirn, wenn er wütend war?
Oh, bitte nicht.
Seine Mom legte ihrem Mann schlichtend eine Hand auf die Brust. Sie war immer die Ruhe selbst. Wie sie das in ihrem Job schaffte, war Charles schon immer ein Rätsel gewesen.
»Charles, was hast du dir dabei gedacht?«, fragte sie leise und achtete darauf, dass keiner der noch anwesenden Polizisten ihnen zuhörte.
Bevor Charles antworten konnte, hatte sein Vater die Hände in die Luft geworfen und ein genervtes Schnauben ausgestoßen. »Emma, offensichtlich hat unser Sohn überhaupt nicht gedacht!«
Charles verzog kaum merklich das Gesicht. Da war etwas dran. Mit Denken hatte der Abend wenig zu tun gehabt ...
Seine Mom warf seinem Vater einen tadelnden Blick zu. »Henry, bitte. Gib ihm die Chance, sich zu erklären.«
Nur war eine Erklärung genau das, womit Charles nicht dienen konnte. Also zwang er sich zu einem zerknirschten Ausdruck. »Er hat recht, Mom. Da gibt’s nichts zu erklären. Es war unüberlegt und leichtsinnig, und es kommt nicht wieder vor.«
Für gewöhnlich reichten diese Worte, um seine Mutter zu beruhigen und sie dazu zu bringen, seine Fehltritte zu vertuschen.
Er war Charles McCoy, so etwas wie der Prinz der Eastside. Da waren unangebrachtes Verhalten oder Ausrutscher nichts, was er sich auf Dauer leisten konnte. Aber wenn er mal was vergeigte, regelte seine Mom das für gewöhnlich unter dem Radar.
»Wer war noch bei dir?«, fragte sein Vater.
Charles hob eine Augenbraue und schüttelte langsam den Kopf. »Ich bin keine Ratte, Dad«, sagte er in einem empörten Ton. Für kein Geld der Welt würde er seine Freunde verraten. Da half seinem Vater auch der mürrische Gesichtsausdruck nicht weiter. »Wie ich also schon dem Nachtwächter sagte: Ich war allein unterwegs.« Ein Grinsen umspielte seine Lippen.
Henry McCoys Augen wurden schmal. »Lass die Spielchen, Charles.«
»Ich war allein«, beteuerte er erneut. Eindringlicher dieses Mal.
Sein Dad stieß ein hartes Lachen aus. »Und das empfindest du jetzt als ehrenhaft? Deine Freunde zu decken?«
Charles nickte kaum merklich. Mit Ehre hatte das wenig zu tun in seinen Augen, vielmehr mit Loyalität. »Ich bin kein Whistleblower, ich falle niemandem in den Rücken.« Das war nicht seine Art, nicht gegenüber seinen Freunden. Man brauchte Verbündete, denen man vertrauen konnte. Das mochten in Charles’ Fall nicht viele Menschen sein, aber die Anzahl spielte auch keine Rolle. Seine Freunde konnten sich auf ihn verlassen – und er sich auf sie.
»Und wie du das tust«, zischte sein Vater. »Du fällst deiner Mutter in den Rücken. In wenigen Monaten stehen die Wahlen an, und wir können uns solche Fehltritte nicht leisten!« Seine Stimme wurde lauter, und als sich einige Köpfe in ihre Richtung drehten, atmete er tief durch und senkte wieder die Stimme. »Was glaubst du, wird passieren, wenn herauskommt, dass der Sohn der Bürgermeisterin Eigentum der Stadt beschädigt und über die Bewohner der Westside hergezogen ist?«
Charles öffnete den Mund, schloss ihn dann aber wieder. An die Wiederwahl seiner Mutter hatte er heute Abend überhaupt nicht gedacht. Es gab zwar kaum noch ein anderes Thema im Rathaus oder bei ihnen zu Hause, aber ausgerechnet an diesem Abend hatte er keinen einzigen Gedanken daran verschwendet. Das wurde ihm nun zum Verhängnis ...
Er sah seine Mutter von der Seite an. Sie behielt die Fassung, war souverän wie immer, doch Charles konnte hinter ihre Fassade blicken. Er sah ihre Sorge, aber das war nicht das Schlimmste. In den Augen seiner Mom lag vor allem eines: Enttäuschung.
»Henry, bitte, nicht hier«, flüsterte sie mit einem aufgesetzten Lächeln. Sie fuhr sich über das cremefarbene Etuikleid, das kein normaler Mensch zu dieser Uhrzeit trug, aber seine Mom hätte niemals das Haus im Schlafanzug verlassen. Egal, aus welchem Anlass.
Doch sein Dad war noch nicht fertig mit ihm. »Du magst es nicht wissen, weil du dich erfolgreich vor der Verantwortung drückst, aber wir brauchen die Wähler auf der Westside, Charles«, sagte er eindringlich. »Verdammt noch mal, denk doch wenigstens einmal nach, bevor du eine solche Scheiße baust.«
Charles zuckte zusammen. Er war harte Worte von seinem Vater gewohnt. Doch normalerweise motzte er ihn nie in der Öffentlichkeit an. Immerhin hatten die McCoys einen Ruf zu verlieren – und es ziemte sich nicht, seinen Sohn anzuschnauzen, wenn es Zuschauer gab.
In diesem Moment wurde die Tür zum Büro geöffnet, und Sheriff Goldman trat in den Flur hinaus. Er war einige Jahre älter als Charles’ Dad, und seine Haare waren bereits von grauen Strähnen durchzogen. Die cremefarbene Uniform betonte seine schmale, mittelgroße Statur. Auf Charles wirkte der Sheriff stets breiter und größer als er in Wahrheit war, was er seiner finsteren Miene und der kühlen Art zuschrieb. Sheriff Goldman strahlte mit jeder Pore Dominanz und Autorität aus.
Der Blick seiner eisgrauen Augen wanderte von Charles zu seiner Mom, blieb dann an seinem Dad hängen. Der grimmige Gesichtsausdruck des Sheriffs veränderte sich dabei nicht. »Mr McCoy«, begrüßte er Charles’ Dad und neigte leicht den Kopf. »Bürgermeisterin McCoy, wenn Sie so weit sind, können wir über die Sache reden.«
Er blickte zurück zu Charles, dem sofort ein Schauer über den Rücken lief. Wie konnten Augen nur so verdammt kalt sein? Sie erinnerten ihn an einen verfluchten Blizzard.
»Ich bin sofort da, Sheriff«, sagte Charles’ Mom in einem unbeschwerten Ton, der überhaupt nicht zur Situation passte. Sie legte ihrem Sohn beruhigend eine Hand auf die Schulter.
Charles biss sich auf die Innenseite seiner Wange. Er wollte es ihr wirklich nicht noch schwerer machen.
Als sein Dad ihn wütend ansah und zum Sprechen ansetzte, hob sie die Hand. »Henry, es reicht«, sagte sie leise, aber eindringlich.
Manchmal hasste er den Job seiner Mom. Auch wenn es durchaus Vorteile hatte, der Sohn der Bürgermeisterin zu sein, die Nachteile konnte er nicht ignorieren. Denn in gewissen Situationen ging die Bürgermeisterin vor. Dann war Emma McCoy nicht mehr Mutter und Ehefrau, sondern stand dem Stadtrat von Ferham Creek vor. Und in einer solchen Situation befand sich Charles gerade. Seine Mom, die Bürgermeisterin, sein unüberwindbarer Schild.
Charles holte tief Luft und trat näher an sie heran. »Tut mir leid, Mom. Ich –«
Sie hob eine Hand, um ihn zu unterbrechen, und fuhr ihm dann in einer liebevollen Geste über die Wange. »Wir werden zu Hause darüber reden. Zuerst muss ich die Sache mit Sheriff Goldman klären.« Dann trat sie zum Sheriff und folgte ihm in sein Büro.
Das würde eine lange Nacht werden ...
Sein Vater zückte sofort das Handy und tippte darauf herum. »Niemand darf davon erfahren«, sagte er mit ernster Stimme. »Ich muss den Register informieren und der Schulleitung der Westside High Bescheid geben. Vielleicht kann das Chaos bis Montag beseitigt werden.« Wieder fasste er Charles am Oberarm, dann zog er ihn in ein leeres Büro, sodass sie niemand hören konnte.
Kam nun die richtige Standpauke?
Er runzelte die Stirn und dachte an das Durcheinander in der Sporthalle. »Das ist in zwei Tagen«, murmelte er.
»Was du nicht sagst.« Henry McCoy schnaubte. »Aber du kamst ja auf die Idee, pünktlich zum Schulanfang eine Sporthalle zu ruinieren.«
Charles verdrehte die Augen. Er wollte gar nicht daran denken, dass am Montag sein letztes Highschool-Jahr begann. Darauf hatte er absolut keine Lust. »Als hättest du noch nie Mist gebaut«, brummte er. Sein Vater war kein Heiliger, so viel stand fest. Charles sah seinem Dad nicht nur verdammt ähnlich, nein, er war in seiner Jugend genauso gewesen wie er. Zumindest wenn er den Worten seiner Mom glauben konnte.
Sein Dad presste fest die Lippen aufeinander. »Das ist doch kein ›Mist‹ mehr! Wärst du jemand anderes, hättest du die Nacht vermutlich hinter Gittern verbracht, gefolgt von einer Anzeige wegen Sachbeschädigung, Einbruch und Vandalismus. Verstehst du das denn nicht?« Die Ader auf seiner Stirn pochte gefährlich, und Charles hatte kurz Sorge, dass er jeden Moment einen Herzinfarkt erlitt.
»Doch, Dad.« Er schnaubte. »Ich bin ja nicht begriffsstutzig.« Er verstand das Rechtssystem ziemlich gut, dafür brauchte er keine Belehrungen.
Sein Vater schüttelte den Kopf. »Da bin ich mir gerade nicht sicher.«
Charles verschränkte die Arme vor der Brust. Er war solche Bemerkungen seines Dads gewohnt, dennoch taten die Worte ein klitzekleines bisschen weh. Nicht, dass er das zugeben würde. »Es ist wohl pädagogisch keine Glanzleistung, seinen Sohn zu beleidigen«, brummte er.
Die Nasenflügel seines Vaters blähten sich vor Wut auf. »Komm mir jetzt nicht mit Pädagogik, wenn es dir schon an gesundem Menschenverstand mangelt.«
Charles seufzte. Hatte dieser Mann noch nie etwas von jugendlichem Leichtsinn gehört? »Du übertreibst maßlos.«
»Ich übertreibe?«, zischte ihm sein Dad zu. »Deine Taten könnten deine Mutter die Wiederwahl kosten! Kapierst du das nicht?«
Doch, auch das verstand Charles. Obwohl er nicht damit rechnete, dass seine Taten derartige Konsequenzen nach sich ziehen würden. Es war ein harmloser Streich gewesen, mehr nicht.
Sein Vater sah ihn kopfschüttelnd an. Wut und Enttäuschung loderten in seinen blauen Augen auf. »Mitglieder des Stadtrats versuchen schon länger, deine Mom aus ihrem Amt zu drängen«, flüsterte er Charles zu. »Entweder, weil sie selbst dieses Amt anstreben oder weil sie lieber jemanden von der Westside als Bürgermeister sehen würden, allen voran Carter Thomson. Deine Aktion heute Nacht spielt denen in die Karten.«
Carter Thomson, dieser Name war bereits im Hause McCoy gefallen, daran konnte sich Charles erinnern. Er war ein Immobilienmakler der Westside, unbedeutend und langweilig. Charles hätte nie vermutet, dass seine Eltern eine Bedrohung in diesem Mann sahen.
Sein Dad glaubte doch nicht allen Ernstes, dass jemand wie Thomson Bürgermeister wurde? Die Westside konnte froh sein, dass sie zwei oder drei Ratsmitglieder stellen durfte. Größenwahnsinnig sollten sie nicht werden.
Trotzdem versuchte Charles etwas Reue zu zeigen, sei es auch nur für seine Mom. »Was soll ich deiner Meinung nach tun? Mich öffentlich entschuldigen? Das mach ich, wenn’s sein muss.«
»Auf gar keinen Fall, Charles!« Die Stimme seines Vaters wurde etwas lauter, bevor er sich räusperte und im Flüsterton fortfuhr: »Niemand darf wissen, was du getan hast. Das darf nicht auf dich zurückfallen. Daher wäre es das Beste, du sagst dem Sheriff, wer heute bei dir war.«
Charles presste die Lippen aufeinander. »Das kann ich nicht tun, Dad.«
»Deine Mutter –«
»Meine Mutter hat mich nicht zu einem Verräter erzogen«, fuhr Charles ihm über den Mund. »Sie würde nicht wollen, dass ich Freunde ans Messer liefere.«
Nein, Emma McCoy schrieb Loyalität groß. Wenn Charles seine Freunde verpfeifen würde, wäre sie vermutlich noch enttäuschter von ihm, als sie es ohnehin schon war. Und Charles würde den Mist, den er gebaut hatte, nicht auf seine Freunde abwälzen, nur damit er aus dem Schneider war.
»Aber was ist, wenn sie deinetwegen ihr Amt verliert? Und das nach nur einer Amtsperiode? Wie würde das deiner Meinung nach aussehen?«
Charles schüttelte vehement den Kopf. »Es muss etwas anderes geben, was ich tun kann.«
Sein Vater legte ihm die Hand auf die Schulter und sah ihn ernst an. »Spätestens am Montag wird ganz Ferham Creek wissen, dass es an der Westside High zu Vandalismus gekommen ist, so was spricht sich schneller rum, als man schauen kann«, flüsterte er. »Bete dafür, dass wir deinen Namen und den deiner Mutter aus der Sache heraushalten können.«
Das klang mehr wie eine Drohung oder eine dunkle Vorahnung als nach etwas, wofür Charles beten sollte. Doch er nickte. »Und dann?«
»Deine Mutter wird trotzdem in den Umfragewerten fallen. Passiert etwas Schlimmes, gibt man immer dem Ranghöchsten die Schuld, so ist das Leben.«
Ein Scheißleben, wenn Charles ehrlich war. Es war nicht fair, dass seine Mom darunter leiden musste, dass er Mist gebaut hatte. Warum war er auch mit Alex und den Jungs losgezogen? Er war ja nicht einmal mehr Teil des verdammten Teams. Seine Langeweile war schuld gewesen ...
Charles ballte die Hände zu Fäusten. »Wie verhindere ich das?«, fragte er leise, seine Stimme klang gepresst. Scham kroch in ihm empor, doch er überspielte es.
»Lass dir was einfallen, Junge.«
Kapitel 3 Peyton
Östlich des Whitestone Rivers lag eine andere Welt. Anders konnte Peyton es nicht beschreiben. Sie mochte sich noch in derselben Stadt befinden, zumindest geografisch, aber nichts erinnerte sie hier an das Ferham Creek, das sie kannte. Rein gar nichts.
Weiße Gartenzäune reihten sich fein säuberlich aneinander. Gepflegte Vorgärten mit Blumenbeeten und Hollywood-Schaukeln, in denen vermutlich noch nie eine Menschenseele gesessen hatte. Neuwagen mit blitzsauberen Karosserien, die in der Sonne um die Wette glänzten.
Nun könnte man denken, dass diese Seite der Stadt ein wahres Paradies sei. Dass hier alles perfekt wäre, wie in einem Bilderbuch. Doch spätestens, wenn die Bewohner der Eastside Menschen begegneten, die offensichtlich nicht aus ihren Kreisen stammten, bröckelte diese Fassade. Peyton spürte die Blicke der Leute, ihr Naserümpfen. Nein, die Eastside war kein Paradies. Zumindest nicht für jemanden wie sie. Dieser Teil der Stadt war entweder der Inbegriff eines unerreichbaren Traums, der einen nur mit Neid und Eifersucht zurückließ, oder die Verkörperung allen Ungleichgewichts und aller Ungerechtigkeiten. Doch trotz ihrer Abneigung für die Eastside hatte die eines für sie zu bieten: Hoffnung. Die Hoffnung auf ein besseres Leben.
Die Emily Dickinson Library war ein typisches Gebäude aus der Kolonialzeit und lag nur wenige Querstraßen vom Hafen entfernt. Vier schmale Stufen führten hinauf zur Veranda, die sich entlang der Vorderseite der Bibliothek erstreckte. Meterhohe Säulen mündeten in dem Tympanon des Dachs. Der zweigeschossige Bau war nun dank der Großzügigkeit der Bürgermeisterin um einen neuen Flügel erweitert worden, der dem Stil der damaligen Zeit perfekt nachgeahmt war.
»Peyton, machst du noch ein Foto von der anderen Seite? Wir müssen alle Bilder zur Absprache an die Presseabteilung des Rathauses schicken, da ist es besser, jeden Winkel abgelichtet zu haben!«, rief ihr Clarissa zu, die Redakteurin des Ferham Creek Registers.
Peyton nickte stockend, doch Clarissa machte sich gar nicht die Mühe, auf ihre Antwort zu warten. Stattdessen lief sie zu Tessa Harris, der Sekretärin der Bürgermeisterin. Peyton bezeichnete sie lieber als die Augen und Ohren von Ferham Creek. Egal, was in den politischen Reihen dieser Stadt geschah, Tessa Harris wusste darüber Bescheid. Vermutlich noch vor der Bürgermeisterin selbst.
Obwohl sie keine große Lust hatte, diese Selbstinszenierung zu fotografieren, griff Peyton nach ihrer Kamera und machte sich auf den Weg zum Podium, auf dem Bürgermeisterin McCoy und ihr Ehemann standen und in die Menge winkten. Wie Superstars, die einen neuen Film oder ein neues Album präsentierten. In der Tat erinnerte sie diese Szene an Angelina Jolie und Brad Pitt bei den Oscarverleihungen ... als sie noch zusammen gewesen waren, selbstverständlich. Doch stattdessen wurde heute nur ein neuer Flügel der städtischen Bibliothek eröffnet. Natürlich gestiftet von Bürgermeisterin McCoy und Familie.
Es klickte. Einmal, zweimal. Peyton seufzte. Emma McCoy musste sich wohl kaum Gedanken darum machen, ob sie auf Fotos gut rüberkam. Die Frau sah aus wie ein verdammtes Supermodel. »Gnade uns Gott, wenn wir nicht die Schokoladenseiten einfangen sollten«, murmelte Peyton vor sich hin und äffte damit Clarissa nach.
Ein Lachen erklang hinter ihr, und sie zuckte zusammen. »McCoys besitzen ausschließlich Schokoladenseiten, nur damit du es weißt«, sagte eine ihr nur zu bekannte Stimme.
»Na, wenn das nicht Prince Charming persönlich ist.« Peyton begrüßte den Neuankömmling mit einem zuckersüßen Lächeln. So süß, dass es ihre Zähne zusammenklebte und ihr den Magen umdrehte. Sie ließ ihren Blick über Charles McCoy gleiten. Seine hellblonden Haare waren über den Sommer gewachsen und reichten ihm bis in den Nacken. Seine Haut war sonnengebräunt, da hatte wohl jemand viel Zeit auf der Jacht der Eltern verbracht. Falls die McCoys überhaupt eine Jacht besaßen. So genau wusste Peyton das nicht. Aber bestimmt kannten sie jemanden, der eine hatte.
Er trug eine helle Leinenhose und ein weißes Hemd. Manchmal fragte sie sich, ob er immer so makellos aussah, selbst wenn er gerade erst aufgestanden war, oder ob er Stunde um Stunde in sein Styling investierte. Sie hoffte auf Letzteres, denn alles andere wäre unfair.
Sollte Prince Charming aber nicht ebenfalls auf diesem Podium stehen, das sie so sorgsam fotografierte? An der Seite seiner Mom ins Publikum lächeln, während diese das bescheuerte rote Seidenband durchschnitt? Was tat er hier unten? Beim Pöbel, wie er wohl sagen würde ...
Mal ehrlich, warum konnten diese Menschen ihre Spenden nicht einfach wortlos und ohne Eigennutz oder Anerkennung leisten? Warum brauchte es diesen ganzen Rummel?
Ein Grinsen schlich sich auf sein Gesicht. »Mir war nicht bewusst, dass wir Spitznamen füreinander haben.«
Peyton runzelte die Stirn und schob einen ihrer geflochtenen braunen Zöpfe mit den rosafarbenen Spitzen über die Schulter zurück. Doch, das hatten sie. Er nannte sie für gewöhnlich Stipendiatin. Nicht, dass das ein Kosename oder Ähnliches wäre, es bezeichnete viel eher das, was sie war. Er hätte sie genauso gut Schülerin, Kellnerin oder Mensch nennen können. Lief alles auf dasselbe hinaus. Allerdings hatte Peyton noch nie miterlebt, dass Charles McCoy sie beim Vornamen genannt hatte. Falls er überhaupt wusste, wie sie hieß. Peyton wagte das zu bezweifeln. Er hatte sie als seine Mitschülerin erkannt, so viel stand fest, aber ihren Namen kannte er garantiert nicht.
Warum auch? Es war nicht so, dass sie häufig miteinander sprachen. Seit sie auf dieselbe Schule gingen, hatten sie vielleicht drei Sätze gewechselt. Und Peyton bedauerte nicht, dass es nur so wenige gewesen waren. Sie versuchte, der Elite der Saint Clarice aus dem Weg zu gehen – so gut es mit ihrem Job als Fotografin eben ging.
»Ich kann dich auch verzogener Snob nennen, aber ich denke, so weit sind wir noch nicht in unserer Beziehung«, flüsterte sie ihm zu.
Charles sah sie mit hochgezogener Augenbraue an, dann lachte er. »Vielleicht verdiene ich mir irgendwann diese Auszeichnung und erweise mich des Namens würdig.«
»Oh, glaub mir, das tust du längst.« Peyton winkte ab und widmete sich wieder ihrer Kamera. Sie hatte einen Job zu erledigen, und der bestand nicht darin, sich mit dem Prinzen der Eastside zu unterhalten. Oder sich von ihm nerven zu lassen.
Sie meinte ihre Worte absolut ernst: Charles McCoy war ein verzogener Snob. Jemand, der alles bekam, was er haben wollte. Jemand, dem alle Türen offen standen und der sich um nichts Sorgen zu machen brauchte. Und jemand, der all das als selbstverständlich betrachtete.
»Machst du das häufiger?«, fragte er und folgte ihr.
Peyton wandte sich nicht zu ihm um, verdrehte aber genervt die Augen. »Was meinst du?«
»Fotos schießen für den Register.«
Sie nickte, beließ es aber dabei. Gespräche mit dem Prinzen der Eastside zu führen, stand nicht auf ihrer To-do-Liste, und dafür wurde sie auch nicht bezahlt. Viel eher würde sie mehr Gehalt verlangen, sollte man sie zwingen, mit McCoy zu reden.
»Dann hoffe ich, dass du deinen Job beherrschst und meine Mom in ein gutes Licht rückst«, murmelte Charles und schielte über Peytons Schulter auf die Kamera.
Wollte er ihr jetzt ihren Job erklären? Hatte Prince Charming etwa auch Ahnung von Fotografie? Sie wagte das zu bezweifeln. Vielleicht war er Profi im Selfies machen, aber mehr auch nicht.
»Die Bürgermeisterin ist nicht mein Problem«, sagte sie und ließ die Kamera sinken. »In ihrem Fall hast du recht: Diese McCoy hat ausschließlich Schokoladenseiten. Ihr Sohn macht mir hingegen zu schaffen.« Ihn in Szene zu setzen war in der Tat ein Problem, denn Charles McCoy befolgte selten, was man von ihm erwartete. Genauso wie jetzt. Statt wie geplant neben seiner Mutter zu stehen, ging er Peyton auf die Nerven.
Er lachte und fuhr sich durch die Haare. »Glaub mir, in der Hinsicht komme ich ganz nach meiner Mom.«
Sie musterte ihn erneut von Kopf bis Fuß und verzog dann das Gesicht. »Keine Ahnung, wer dir das gesagt hat, aber da muss ich leider widersprechen.«
Er sollte ja nicht glauben, dass sein angeblicher Charme – wer hatte eigentlich behauptet, dass er Charme besaß? – oder sein annehmbares Äußeres sie in irgendeiner Weise beeindruckten. Taten sie nämlich nicht.
Mit dem Kinn deutete sie in Richtung Podest. »Wenn du noch mit auf die Fotos willst, solltest du dich jetzt dazustellen.« Denn sie würde seinetwegen garantiert keine unbezahlten Überstunden machen. Charles McCoy mochte der Traum der halben Saint Clarice Prep sein, aber er war ganz gewiss kein Bestandteil von Peytons Träumen.
»Ich glaube nicht, dass sie mich dort oben brauchen«, sagte er und schob die Hände in die Hosentaschen. Ein seltsamer Ausdruck trat in seine blauen Augen, den sie sich nicht erklären konnte.
»Ich brauche dich hier unten aber auch nicht. Also entweder gehst du dort hoch oder du lässt mich kommentarlos meine Arbeit machen.«
Er lachte. »Du bist ja ein wahrer Sonnenschein. Ist mir bisher nie aufgefallen.«
Wie sollte ihm das auch aufgefallen sein? Das war die längste Unterhaltung, die sie je geführt hatten. Und dabei konnte es auch gern bleiben.
Seufzend stemmte Peyton eine Hand in die Hüften. »Ich will nicht unhöflich sein, aber ich arbeite hier. Du lenkst mich ab, und das kann ich nicht gebrauchen.« Als sie das Blitzen in seinen Augen sah, seufzte sie erneut und schüttelte den Kopf. »Du lenkst mich nicht auf diese Weise ab. Du störst meine Konzentration.«
Charles zuckte mit den Schultern. »Du drückst auf den Auslöser. Was kann daran schon so schwer sein?«
Eins, zwei, drei ...
Peyton atmete tief durch. Sie würde sich nicht von ihm provozieren lassen. Lust, ihm die Bedeutung von Kameras und Fotografie zu erklären, hatte sie allerdings auch nicht. Seine Unwissenheit war keine Überraschung für sie. Solche Dinge hörte sie ständig.
Warum kaufst du teure Kameras, wenn jedes Handy gute Fotos schießen kann?
Warum verschwendest du deine Zeit in Workshops, wenn YouTube dir alles beibringen kann, was du wissen musst?
Warum stehst du so früh morgens auf, um Sonnenaufgänge zu fotografieren, wenn du das Bild einfach mit Photoshop bearbeiten könntest?
Peyton war all diese Fragen leid. Gute Fotografie hatte nichts mit Filtern, Bearbeitungen oder Handys zu tun. Zumindest nicht die Art von Fotografie, die sie liebte.
Dass ein Laie verstand, wie man Licht und Schatten richtig einsetzte, wie man Linsen oder Objektive einstellte oder wie man Kontraste nutzte, war vermutlich zu viel verlangt.
Einatmen, ausatmen.
»Wenn du schon nicht an der Eröffnung teilnimmst, musst du dann nicht irgendwo anders sein? Beim Golfen oder Segeln?« Was reiche Kids halt so in ihrer Freizeit taten. Nicht, dass Peyton davon Ahnung hatte. Sie war nie segeln, geschweige denn golfen gewesen. Es sei denn Minigolf zählte dazu, aber selbst darin war sie ziemlich grottig.
Sie wusste, dass beides zu Charles’ Hobbys zählte. Denn neben den Fotos, die sie für den Register schoss, kellnerte sie im Ferham Valley Golf Club, in dem auch Charles’ Vater Mitglied war.
»So langsam habe ich das Gefühl, dass du mich loswerden willst. Das ist aber nicht nett«, sagte er. Spott funkelte in seinen Augen.
Peyton runzelte die Stirn. »Wenn du dieses Gefühl nur sehr langsam bekommst, war ich wohl nicht deutlich genug.«
Er lachte auf. »Autsch.« Gespielt getroffen fuhr er sich über die Brust. »Sollte eine Stipendiatin nicht nett und zuvorkommend sein?«
»Und warum sollte sie das?«
»Weil ich nett zu dir bin.«
»Ach, bist du das?«
Charles hob eine Augenbraue und sah sie verwirrt an. »War ich das etwa nicht? War ich irgendwann mal gemein zu dir oder so?«
Peyton presste die Lippen aufeinander. Nein, er war nie wirklich gemein zu ihr gewesen. Er ignorierte sie für gewöhnlich, was für sie in Ordnung war. Charles war nett und zuvorkommend, zumindest zu den meisten anderen Menschen. Doch für Peyton gab es da einen Unterschied. Sie hatte immer das Gefühl, dass er nur nett zu anderen war, weil er sich etwas davon erhoffte, nicht weil er es aus Nächstenliebe tat.
»Nein«, murmelte sie.
Das Lächeln kehrte auf Charles’ Gesicht zurück. »Na also, dann wäre es nur fair, wenn du auch nett zu mir bist. Oder etwa nicht?«
Nein, wollte sie am liebsten sagen. Sie wollte nicht nett zu ihm sein. Vor allem nicht, nur weil sie Stipendiatin war. Was das eine mit dem anderen zu tun hatte, wusste sie sowieso nicht. Sollte sie ihm etwa dankbar sein? Warum? Nur weil seinesgleichen sie unter sich duldete?
Dass Peyton nicht lachte. Charles mochte ihr gegenüber kein komplettes Arschloch sein, doch es gab andere, die das waren. Manche ihrer Mitschüler und Mitschülerinnen hatten Probleme mit ihr, nur weil sie nicht von der ach so noblen Eastside kam. Und jene Leute gehörten zu Charles’ Freundeskreis.
»Ich werde sehen, was sich machen lässt. Zumindest, wenn du jetzt abziehst und mich meinen Job erledigen lässt«, brummte sie und machte eine Handbewegung, als wollte sie eine lästige Fliege verscheuchen. Eine Fliege namens McCoy.
Charles nickte, dann grinste er wieder. »Wie hättest du mich denn gern?«
Perplex sah Peyton ihn an. »Wie bitte?«
»Na, auf dem Podest. Wie hättest du mich gern?«
Sie schluckte und schüttelte langsam den Kopf. Kam er sich nun clever vor mit dieser Frage? Himmel, was sollte der Unsinn? »Stell dich auf die rechte Seite deiner Mom, lächele in die Kamera und versuche niemandem mehr auf die Nerven zu gehen«, wies sie ihn an.
»Gehe ich dir denn auf die Nerven?«
»Du hast ja keine Ahnung«, säuselte sie.
Charles lehnte sich vor, sodass sie in etwa auf Augenhöhe waren. »Dir auf die Nerven zu gehen könnte ein Hobby von mir werden. Was für ein Glück, dass morgen die Schule wieder losgeht und ich deine Gesellschaft häufiger genießen kann.«
Peyton verdrehte die Augen. »Mach es doch lieber zu deinem Hobby, ein einziges Mal in deinem Leben das zu tun, was von dir erwartet wird. Geh da hoch, posiere neben deiner Mom, und lass mich mit deinem Charme in Ruhe, oder was auch immer das sein soll.« Sie hob die Kamera an und knipste einige Fotos.
»Du hältst mich also für charmant?«
Sie schüttelte den Kopf, ohne in Charles’ Richtung zu schauen. »Ich halte dich für nervig und eingebildet, wenn du es genau wissen möchtest. Wenn du jemanden beeindrucken willst, versuch es bei deinen Eastside-Groupies.« Bei ihr würde all der Mist, den er von sich gab, nicht funktionieren.
»Die sind aber gerade nicht hier.«
»Ja, überaus bedauerlich«, murmelte Peyton und konzentrierte sich wieder auf die Bürgermeisterin und ihren Ehemann. Dabei fiel ihr auf, wie ähnlich Charles seinem Vater, Henry McCoy, sah. Prince Charming hatte beneidenswert gute Gene mit auf den Weg gegeben bekommen.
»Dann will ich mal nicht so sein und deiner Bitte nachkommen«, tönte Charles und lächelte sie an, bevor er sich mit beiden Händen durch die Haare fuhr.
»Meiner Bitte?«, fragte Peyton skeptisch.
»Auf die Bühne zu gehen und neben meiner Mom zu posen«, erklärte er. »Denk an die Schokoladenseite. Wir wollen ja nicht, dass du die Fotos versaust.« Er zwinkerte ihr zu und ging in Richtung Podium davon.
Peyton massierte sich mit Daumen und Zeigefinger die Nasenwurzel und atmete tief durch. »Wenn hier einer die Fotos versaut, dann du«, murmelte sie. Auch wenn sie zugeben musste, dass die Familie der Bürgermeisterin da oben eine fantastische Figur abgab. Die perfekte Vorzeigefamilie der Eastside, wohlhabend und gutaussehend.
Leider konnten Fotos nur selten den wahren Kern einer Person einfangen. Sosehr sich Peyton auch bemühte, auf den Fotos sah Charles McCoy perfekt aus. Als sie die Bilder betrachtete, hatte sie das Gefühl, dass er jedes Mal direkt in die Kamera blickte. Als würde er einzig für sie lächeln.
Was für ein Unsinn.
Sie presste missmutig die Lippen aufeinander. »Beschissene Schokoladenseite.«
Kapitel 4 Peyton
Peyton stand vor den Toren der Saint Clarice Preparatory School, eine der besten Schulen des Landes, die ihr alle Türen öffnen würde. Es war der erste Tag ihres letzten Jahres auf der Highschool.
Statt der erwarteten Freude bildete sich ein Kloß in ihrem Hals. Von diesem Jahr hing alles ab. Ihre Noten mussten tadellos sein, ihre Bemühungen auf höchstem Niveau. Etwas anderes konnte sie sich nicht leisten.
Von zu Hause kannte sie keinen Druck. Zumindest nicht von ihren Eltern. Den Druck machte sie sich selbst. Nur wenn sie einen phänomenalen Abschluss hinlegte, konnte sie aufs College gehen. Nur dann könnte sie sich ihren Traum erfüllen.
Mit halbem Ohr lauschte sie ihren Mitschülern, die aufgeregt von ihren großartigen Ferien erzählten. Ferien, die Peyton nicht gehabt hatte. Denn sie hatte unentwegt gearbeitet. Entweder für den Ferham Creek Register oder im Golfclub.
Seufzend fuhr sie sich über die weiße Bluse ihrer Schuluniform. Die Saint Clarice besaß einen hervorragenden Ruf, und Peyton war dankbar, dass sie sich ein Stipendium erarbeitet hatte. Der graue Blazer hatte rote Säume, und auf der linken Brusttasche prangte der Leitspruch der Schule: Vivere est militare. Zu leben, heißt zu kämpfen.
Nichts konnte Peyton mehr nachempfinden als diese Worte. Ihr ganzes Leben war ein Kampf. Allein das Überleben an der Saint Clarice war ein verdammtes Gefecht, wenn man nicht zu dieser Gesellschaft dazugehörte. Als Stipendiatin musste sie härter arbeiten und wesentlich mehr leisten als all ihre reichen Mitschüler.
»Na, sieh mal einer an, was die Flut angespült hat«, ertönte eine Stimme hinter Peyton.
Sie drehte sich um und stand dem Inbegriff der Highschool-Diva gegenüber. Gwendolyn Boyd.
»Das ist wohl das Konzept von Ebbe und Flut. Die Flut kommt immer wieder«, murmelte Peyton und betrachtete Gwendolyn mit hochgezogener Augenbraue.
Ihr langes blondes Haar war perfekt gestylt, die Nägel in einem unauffälligen Rosaton lackiert, und der Schlüssel in ihrer Hand gehörte zu einem nagelneuen Mercedes CLE Coupé. Das Ding kostete ja nur schlappe 65.000 Dollar.
»Ja, das scheint wohl so«, sagte Gwendolyn und rümpfte die Nase. »Nicht einmal Kaschmir kann deine Herkunft verbergen. Schade um den teuren Stoff.«
Peyton zuckte mit den Schultern. Solche Sticheleien waren nichts Neues für sie. Es kümmerte sie schon lange nicht mehr, was die reichen Kids der Eastside über sie sagten. Immerhin hatten sie recht: Sie war keine von ihnen und würde es auch niemals sein.
»Wohl eher schade um die Ziegen. Im Gegensatz zu dir wäre es mir nämlich lieber, wenn keine Tiere für das Teil gequält worden wären.«
»Die einzige Qual hier bist du«, murmelte Gwendolyn und musterte sie. Ihr Blick blieb an Peytons Haaren hängen. »Ich habe gar nicht mitbekommen, dass die Zweitausender wieder modern sind. Ich fürchte, Hilary Duff hätte gern ihre Frisur zurück.«
Peyton strich sich über ihre beiden geflochtenen Zöpfe. Ihre hellbraunen Haare waren von rosafarbenen Strähnen durchzogen. Ombrés schienen in den gehobenen Kreisen der Eastside nicht im Trend zu sein, aber wen interessierte das?
»Und ich glaube, Regina George hätte gern ihre Sprüche zurück.« Gwendolyn Boyd war das perfekte Ebenbild der hinterhältigen Cliquenanführerin aus Mean Girls.
Auf Gwendolyns Gesicht erschien ein kaltes Lächeln. »Es ist wirklich schön, dich zu sehen, Peyton. Ich habe dich über den Sommer ja so vermisst.«
Und wie sie das hat, dachte Peyton. Gwendolyn hatte ihre Mai Tais und Hot-Stone-Massagen vermutlich kaum genießen können, so sehr war sie von ihrer Sehnsucht nach Peyton zerfressen gewesen.
»Dann trifft es sich ja gut, dass die Schule wieder angefangen hat«, entgegnete Peyton barsch und lief an Gwendolyn vorbei. »Wir sehen uns in Geschichte.«
Sowie in Englisch, in Biologie, auf den Fluren, beim Essen und zu unzähligen weiteren Gelegenheiten. Peyton drehte sich der Magen um. Die Schule wäre so viel angenehmer, wenn Menschen wie Gwendolyn Boyd sie einfach in Ruhe lassen würden.
Zugegeben, nicht alle ihre Mitschüler waren gemein oder gehässig. Statt fieser Kommentare oder Sticheleien wurde Peyton meistens einfach nicht beachtet. Das war in Ordnung für sie. Schließlich war sie nicht hier, um Freundschaftsarmbänder zu knüpfen oder auf Pyjamapartys eingeladen zu werden.
In einem hatte Gwendolyn jedoch recht: Als Peyton die Flure der Saint Clarice betrat, konnte sie nicht leugnen, dass sie hier trotz Schuluniform auffiel wie ein bunter Hund. Jeder peppte die Uniform nach eigenem Ermessen und Geschmack auf. Haarspangen von Chanel, Handtaschen von Gucci und Seidenhalstücher von Yves Saint Laurent. Allein die Tatsache, dass sie inzwischen all diese Marken kannte und unterscheiden konnte, ging ihr gehörig auf die Nerven.
Sie trug eine schwarze Beanie, ihr Rucksack war abgewetzt, und manche Nähte lösten sich bereits auf. Beides waren No-Name-Produkte, die sie vor etlichen Jahren secondhand gekauft hatte. Peyton passte optisch einfach nicht zu ihren reichen Mitschülern.
Manchmal erinnerte Peyton die Schule an Serien wie Gossip Girl oder Young Royals. Allerdings müsste sie dann in die Rolle von Dan Humphrey oder seiner kleinen Schwester schlüpfen, und das wollte sie ganz gewiss nicht.
Himmel, nein, sie wollte garantiert nicht wie Dan Humphrey sein. Doch die Clique aus Gossip Girl war durchaus mit der hiesigen vergleichbar. Das Pendant zu Serena van der Woodsen, der Vorzeigeblondine, der alles in den Schoß fiel und die nie hart arbeiten musste, wäre dann ja wohl eindeutig Charles McCoy.
Ihr erster Kurs war Algebra I. Ein Fach, welches Peyton meistens leichtfiel. Manche mochten es kaum glauben, aber Fotografie und Mathematik hatten einige Gemeinsamkeiten. Gäbe es da nicht diesen winzigen Nachteil: In ihrem Kurs saß besagter Charles McCoy.
Als sie den Raum betrat, hockte er gerade auf seinem Tisch und quatschte mit Andrew Hill, der, soweit Peyton wusste, sein bester Freund war. Sie gehörten zu der Gruppe, die Peytons Existenz weitestgehend ignorierten.
Charles und Andrew waren die Lieblinge der Lehrer und die Träume jeder Schwiegermutter. Da wunderte es auch niemanden, dass die beiden bis vor Kurzem noch auf Doppeldates mit zwei It-Girls der Eastside gegangen waren. Während Charles sich mit Gwendolyn vergnügt hatte, war Andrew in einer Beziehung mit der Eiskönigin persönlich gewesen. Jener Eiskönigin, die nun neben Charles saß und ein zaghaftes Lächeln zur Schau trug: Eleanor van der Berg. Eine rothaarige Schönheit, mit makelloser Porzellanhaut und einer Haltung, um die sie jede Ballerina beneiden würde.
Peyton tigerte zu ihrem Stammplatz in der zweiten Reihe am Fenster. Doch so unerkannt wie sonst schaffte sie es nicht dorthin.
»Sonnenschein, wie schön dich zu sehen«, tönte Charles und lächelte sie an. »Ich hoffe, du hast dein Foto bekommen. Dürfte bei dem Motiv nicht sonderlich schwer gewesen sein.«
Peyton verdrehte die Augen. Aber er hatte recht. Sie hatte ihr Foto bekommen. Ein Foto, das heute Morgen auf dem Titelblatt des Registers abgedruckt worden war. Die strahlende Familie McCoy: Bürgermeisterin Emma McCoy, ihr Mann und Finanzvorstand von Boyd Enterprise, Henry McCoy, und der Eastside-Prinz Charles. Ein wahres Meisterwerk ... oder auch nicht.
»Ach, sei nicht so«, erwiderte Charles schmollend. »Wie wäre es mit einem Lächeln? Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, nett zueinander zu sein.« Er schob sich von dem Tisch herunter und schlenderte auf sie zu.
Peyton kam nicht umhin, die verwirrten Blicke von Andrew und Eleanor zu bemerken.
»Haben wir das? Kann mich nicht daran erinnern.« Sie nahm einen Block, Stifte und ihre Wasserflasche aus dem Rucksack. Auf dem Block klebte ein gelber Notizzettel:
Viel Spaß am ersten Schultag. In Liebe, Mom
Schnell schlug sie den Block auf, damit Charles den Zettel nicht sah. Generell versuchte sie, ihn zu ignorieren. Was leichter gesagt war als getan.
»Was hat dir den Tag verdorben, Sonnenschein?«, fragte er und lehnte sich gegen ihren Tisch.
Was genau sollte das hier werden? Sie sah hinüber zu seinen Freunden, die sie neugierig beobachteten.
»›Sonnenschein‹? Was ist aus ›Stipendiatin‹ geworden?«, wechselte Peyton das Thema. Sie war der Meinung, dass Charles ihr diese Spitznamen gab, weil er nicht den leisesten Schimmer hatte, wie sie wirklich hieß.
Er zuckte mit den Schultern. »Wäre dir ein anderer Kosename lieber? Darling, Liebes oder Prinzessin?«
»Ich glaube, ich muss mich gleich übergeben«, murmelte sie.
Er stieß ein leises Lachen aus. »Tu mir einen Gefallen und dreh dich vorher in die andere Richtung.«
Peyton hob eine Augenbraue. »Angst, dass ich deine Schuhe ruiniere?« Sie schielte nach unten. Zu ihrem Erstaunen trug Charles stinknormale Stan Smiths.
»Unsere Beziehung ist noch nicht bereit für den Austausch von Körperflüssigkeiten, fürchte ich«, entgegnete er und grinste breit.
»Mach weiter so, und du verdienst dir die Bezeichnung des Snobs noch«, wisperte sie und grinste zurück. Sie hatte keine Ahnung, was Charles eigentlich von ihr wollte oder warum er plötzlich mit ihr sprach, aber es kümmerte sie auch nicht.
Er lehnte sich vor, und sie musterte ihn überrascht. Er roch gut. Nicht nach Parfum oder übertriebenem Aftershave, sondern nach frisch gewaschener Wäsche mit einem holzigen Unterton. Doch der Blick, mit dem er sie betrachtete, irritierte Peyton. Als versuche Charles aus ihr schlau zu werden. Warum auch immer ...
»Hätte ich gewusst, dass es so unterhaltsam ist, mit dir zu plaudern, hätte ich es schon viel eher getan.« Seine blauen Augen leuchteten auf. War das Schalk, der dort aufblitzte, oder eine unterschwellige Drohung?
»Oh, wirklich?«, fragte sie gespielt überrascht. »Dabei hatte ich mich schon an deine mangelnde Aufmerksamkeit gewöhnt.« Ihr war nicht einmal klar, warum er nun mit ihr sprach. Noch dazu auf diese lockere Art, die sie ihm aber nicht abkaufte. Auf sie wirkte Charles angespannt, so als stünde sein ganzer Körper unter Strom. Zugegeben, er konnte das sehr gut überspielen, aber seine Kieferpartie war verspannt und seine Schultern ungewöhnlich steif. Als würde ihn irgendwas beschäftigen, was ihm ganz und gar nicht gefiel.
Sein Mundwinkel zuckte, als würde auch ihm die Anspannung dort auffallen. »War mir ein Vergnügen, Stipendiatin«, raunte er und schlenderte zurück zu seinem Platz, als ihre Lehrerin den Unterricht begann.
»Mir nicht«, murmelte Peyton und sah ihm nach. Ihr war es wahrlich kein Vergnügen gewesen.
Kapitel 5 Charles
»Was war das gerade?«, fragte Drew, nachdem der Unterricht vorbei war und er Charles zu ihren Spinden gezogen hatte.
Charles sah ihn mit gerunzelter Stirn an. »Was meinst du?«, fragte er unschuldig und holte die Bücher aus seinem Spind, die er für den nächsten Kurs brauchte.
Drew deutete auf Peyton und dann auf ihn. »Das. Was hast du mit Peyton Torres zu schaffen? Also abgesehen von der Tatsache, dass du sie nicht ausstehen kannst.«
Sein bester Freund wirkte vollkommen verwirrt, und nun war Charles es ebenfalls. Peyton Torres? Das war Peyton Torres! Damit hatte er nun gar nicht gerechnet. Er hatte gewusst, dass er diesen Namen schon einmal gehört hatte, doch mit Alex’ Beleidigung an der Wand hatte er ihn nicht zuordnen können. Dass die Stipendiatin Peyton Torres hieß, war ihm neu. Doch das machte ihn jetzt nur noch neugieriger auf sie. Doch zu dieser Neugierde mischte sich nun noch etwas anderes. Da war plötzlich ein Druck auf seiner Brust, als er an Peyton und Alex’ Worte über sie dachte.
Er zuckte mit den Schultern. »Wir haben uns gestern kurz bei der Eröffnung des neuen Bibliotheksflügels unterhalten. Sie ist lustig, was eine willkommene Abwechselung ist.«