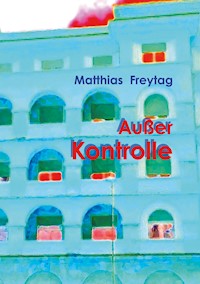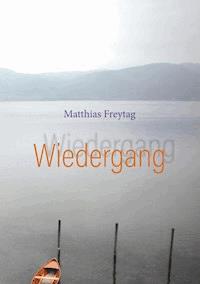Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er hatte gut gelebt, das wußte er jetzt. Selbst wenn ihm vieles entglitten war – weil er es mit aller Macht bei sich hatte halten wollen. Er selber entglitt sich nun, und es war gut, loszulassen. Der Pfad am Abgrund entlang, undurchdringliche Felswand des Daseins auf der einen, Unergründlichkeit des Nichtmehrseins auf der anderen Seite: Jetzt sah er hinaus, sah nicht mehr nur, ängstlich und zugleich von einem Sog ergriffen, senkrecht hinab. Er sah die Ferne hell, ins Weite dehnte sich ein windstilles Meer, und die ganze Wand spiegelte sich darin, so klar im schrägen Spätlicht, daß es war wie ein weites Land, das sich ausbreitete bis an den Horizont und das einlud zur Wanderschaft ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Erste Nähe, erste Ferne
Ausflug nach F***
Begegnung
Aus heiterem Himmel
Fehltritt
Nachtlicht
Nebelleben
Weg am Rand
Abschied
Letzte Worte
Die Mutprobe
Erste Nähe, erste Ferne
Eine Dorf-, Ferien- und Kindergeschichte
Vorspiel
Das war vor manchen Jahren, ich war zwölf oder dreizehn Jahre alt. Damals fuhren die Eltern mit uns Kindern, meiner Schwester und mir, wieder einmal in den Sommerferien in das kleine Dorf, wo wir bei einer Familie im Haus, im ersten Stock, zwei Zimmer während unserer Urlaubswochen bewohnten.
Dies Dorf lag im bayerischen Allgäu, noch recht nah an der Grenze zum württembergischen Nachbarland, woher wir kamen. Gerade die Grenzüberquerung, so gering sie anmutet, übte einen besonderen Reiz aus, die Strecke kam mir jedesmal viel weiter vor, als sie tatsächlich war – und von noch weiter her als die Hinfahrt schien mich die Rückfahrt zu führen. In der Innenwelt freilich gelten die offiziellen Landkarten wenig, sondern das Erleben ist es, das, durch die Zeit, Grenzen zieht. Diese wiederum sind auf gewisse Weise fließend, längst abgeschlossene Epochen eines Lebens können auf einmal wieder ganz gegenwärtig sein – auch wenn uns gerade dadurch zugleich deren Unwiederbringlichkeit offenbar wird. Und so war und ist das Dorf, in welchem Landstrich es sich auch befinden mochte, das Dorf meiner Kindheit und für immer, schmerzlichschön, Teil meiner Heimat.
Es war wirklich ein kleines Dorf. Im Kern bestand es aus einer Kirche und elf, zwölf Häusern; einige dazugehörende Höfe lagen in der Nachbarschaft verstreut. Trotzdem hatte es einmal eine Schule dort gegeben. Das Schulhaus stand noch, der Unterricht indessen war eingestellt, und es beherbergte nun Ferienwohnungen. Auch der Pfarrhof stand noch. Aber wie keinen Lehrer, gab es keinen dorfeigenen Pfarrer mehr. Und ebenfalls hatte man die Poststelle und die Käserei aufgelöst. Neu hinzugekommen dagegen war, ein wenig abseits gerückt, ein Erholungsheim für Kinder.
Außerdem existierte in dem Ort ein alter Gasthof. Der war nicht eingegangen; im Gegenteil hatte er den Besitzer gewechselt, war ausgebaut worden und frisch aufgeblüht. Hatte das Haus früher vor sich hingedämmert und bereits ausgesehen, als wolle es anfangen zu verfallen, so stand es jetzt wieder stattlich da am freien Platze, frisch mit Schindeln verkleidet, im Dachstock sogar erhöht. Vermehrt reisten Urlauber an und wohnten in den Gastzimmern, und abends – besonders am Wochenende – kamen die Einheimischen von überall aus der Umgegend herbei, um ihr Bier, ihren Schnaps zu trinken, weniger um zu essen, und natürlich, um miteinander zu reden, zu streiten, zu lästern und zu lachen, um Karten zu spielen oder auch, mit viel Getöse, Tischfußball oder Billard; und der Platz vor der Wirtschaft war dann mit parkenden Autos dicht verstellt.
Unser »Ferienhaus«, in dem das Ehepaar einen Lebensmittelladen betrieb (wobei der Mann halbtags noch auswärts arbeitete), lag schräg dem Gasthof gegenüber, aus den Fenstern unserer zwei Zimmer sah man zu ihm hin. Und nachts im Bett konnte ich die gedämpften Geräusche vernehmen, bis schließlich Auto um Auto abfuhr und es still wurde. Und waren alle fort, war die Nacht im Ort wirklich vollkommen still.
Vor dem Haus stand kein weiteres Gebäude mehr. Früher einmal hatten sich davor, auf der anderen Straßenseite, die alte Kegelbahn und eine große Scheune befunden; die Straße war damals noch nicht asphaltiert gewesen. Irgendwann, als wir wieder – das dritte oder vierte Mal – auf Urlaub herkamen, war sie es schließlich, und nachdem der neue Wirt angekommen, hatte er bald die Kegelbahn abgerissen und statt ihrer eine Wirtschaftsterrasse und eine Minigolfanlage eingerichtet. Auch die Scheune stand danach nicht mehr lange.
So erstreckte sich jetzt vor dem Haus jenseits der Straße nur noch Wiese, man hatte freie Sicht über den Hang, zu dem sich die grünen Matten, als Kuhweide dienend, anhoben, bis zum Wald hinauf, der gegen den Himmel mit seinen großen Fichten dunkel und in ausgezackter Linie abschloß.
Unsere Gastgeberfamilie bestand aus dem Ehepaar, ihren zwei Mädchen und einer Großmutter. Zwischen meinen Eltern und den Wirtsleuten hatte sich im Laufe der Zeit ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt, und oft saßen sie am Abend zusammen in der Küchenstube und spielten Karten. Die größere Tochter war ein wenig älter als meine Schwester, die etwa drei Jahre mehr zählte als ich. Die beiden verstanden sich recht gut, nicht selten machten sie in den Abend hinein gemeinsam Spaziergänge, auf denen sie, wie ich sah, wenn ich manchmal ihnen hinterherschlich, viel zu bereden hatten. Genau deshalb auch wurde das Nachschleichen immer bald langweilig: Sie taten sonst nichts weiter, und ich kam nie nahe genug heran, um sie belauschen zu können. Also ging ich zurück, ließ sie weiterspazieren und quasseln, was sie wollten. Zuweilen allerdings, bevor ich umdrehte, versuchte ich noch, sie zu erschrecken, was leicht gelang: Sie waren eben, soviel älter sie sein mochten, doch nur Mädchen.
Die jüngere Tochter war ungefähr in meinem Alter, und sie und ich und dazu der Sohn des Gastwirts spielten häufig miteinander, eigentlich an jedem Tag, wenn die Eltern nicht mit meiner Schwester und mir Ausflüge machten. Doch nahmen sie so manches Mal dabei eins der Mädchen oder auch beide mit. Und selbst wenn wir von einem Ausflug zurückkehrten, konnte noch Zeit sein zum Spielen: wenn nicht gerade für Fußball und Verstecken, dann für Fangen oder Federball … – zu allem möglichen gab es außer uns noch genügend andre Kinder, aus dem Dorf selber oder von den Feriengästen.
I
Einige Tage waren wir bereits hier, und ich fühlte mich schon wieder ganz zu Hause. In jenem Jahr bildete von den Spielen Fußball den großen Renner. Auf der Wiese vor dem Haus jagten wir den Ball, eingegrenzt von der Straße, der Terrasse und Minigolfanlage und vom Grundstück des alten Pfarrhauses. Und schräg nach hinten, wo die Wiese ohne Unterbrechung in das Weideland überging, begrenzten unseren Wetzplatz die Kuhzäune. Raum hatten wir mehr als genug. Weil zudem das Spielfeld so schief und krumm war, gab es auch kein Aus, wenn der Ball nicht gar zu sehr in einen Winkel entrollte. Ansonsten sprang jeder der Kugel über Zaun und Straße hinterher. Wir hatten auch nur ein Tor, das aus je einer Stange links und rechts bestand; und öfters waren die Mannschaften uneins, ob der Ball zu hoch und es kein Tor oder ob er richtig und es sehr wohl ein Tor gewesen sei. Der Torwart stimmte dann auf jeden Fall gegen einen Treffer, da er keiner Mannschaft angehörte und nur seinen eigenen Ruf siegreich, was möglichst torlos meinte, verteidigen wollte.
Anna, so hieß die jüngere Tochter unsrer Wirtsfamilie, spielte eifrig mit. Ja, häufig war sie die eifrigste von allen, trieb die Spieler ihrer Mannschaft lautstark und wenig zimperlich an. »Los, du Lahmi, lauf, schlaf nicht im Stehn … Hast du keine Augen im Kopf? Mann, ich stand völlig frei, du Blindschleiche … Wozu hast du denn Beine …«: Auf die Weise war sie nicht zu überhören, doch war es keine Angeberei, wenn sie sich so aufführte. Denn sie wurde Hals über Kopf vom Spielfieber gepackt und stürzte sich selber mit allem Einsatz in die Hitze des Gefechts. Überdies spielte sie mindestens so gut wie jeder von uns: temperamentvoll, flink, technisch geschickt, eine torgefährliche Mischung für den Gegner. Sie war das einzige Mädchen dabei. Irgendwann einmal sagte ich voller Anerkennung zu Wolfgang, dem Sohn des Gastwirts: »Mit ihr Fußball zu spielen ist prima. Sie spielt wie ein richtiger Junge.« – »Ja, gell«, antwortete er mit fachmännischer Miene. »Aber schade, daß sie nicht wirklich einer ist.« – »Manchmal schon«, sagte ich.
Meist spielten Anna und ich in verschiedenen Mannschaften, worin sich eine gewisse Rivalität kundtat. Sie entstand aus einer Spannung, die nur aus dem Spiel sich herzuleiten schien, einem Spiel, das oft den Zweikampf brachte. Weil sie und ich unter einem Dach wohnten, wir uns auch gut verstanden, Freunde waren – deshalb besaß dieses Duell etwas sehr Anziehendes, zumal es nie Entzweiung bedeutete und wir auf alle Fälle abends wieder im selben Haus zusammensein würden. Es war ein Kräftemessen unter Freunden, um im Erkunden und Erkundenlassen der Kräfte das Verbundensein miteinander stärker zu spüren. Einen Teil des Anreizes bildete für mich natürlich auch, daß sie ein Mädchen war. Nur aber in dem Sinne, um zu versuchen, als Junge ihr doch meine Überlegenheit am Ball zu zeigen, oder gar, um sie, wenn sie rannte und schoß und kämpfte wie die andern, doch einem Jungen angenähert zu sehen, woraus dann in solchen Momenten – durch ihre »Verwandlung« – ein noch unbeschränkteres Freundschaftsgefühl für sie aufblühte. In dieser Wirkung empfand ich es wenigstens. Wahrscheinlich aber war bereits zu jenem Zeitpunkt in den Empfindungen der Spannung und der tiefer verbundenen Nähe untergründig etwas anderes verborgen gewesen …
Das sage ich heute. Damals rollte der Ball und zog uns mit sich fort. Unser Hauptgedanke war das Tor: nicht so sehr deswegen, weil die einen die andern triumphierend besiegen wollten, sondern um des Spieles willen. Sein Sinn war, Tore zu schießen; von ihm waren wir erfüllt wie vom Sinn der Welt.
Fußball hatten wir auch früher hier gespielt, wenngleich nicht so besessen wie dieses Mal. Die anderen Jahre waren als Hauptspiele mehr Verstecken oder Räuber und Gendarm an der Reihe gewesen. Jetzt war derlei zurückgedrängt. Dennoch spielten wir etwa Verstecken schon auch, einmal sogar in den ersten Tagen:
Versteckspiel: Wer erinnert sich nicht ein bißchen wehmütig an das kribbelnde Hochvergnügen, das man einst darin fand. Wer würde nicht zuweilen – nun, da er erwachsen heißt – es so gern einmal wieder auskosten. Aber wer fürchtet nicht zugleich, daß, wenn man es gestände und andere gar noch bäte mitzuspielen, alle einen für infantil, für verrückt erklären würden. Kinderkram ist das doch, richtig und wichtig für die Kleinen, aber nichts für einen reifen, realitätsbewußten Menschen. Und viele scheuen sich deshalb wohl, den Wunsch auch nur sich selber einzugestehen.
Wie war das doch …? Die Spannung beim Abzählen: Suchen wollte man meistens nie, wer würde dafür übrigbleiben? Viel lieber wollte man sich verstecken … Ene, mene, Mäusedreck, und du bist weg … Die Erleichterung, wenn man draußen, und die Aufregung, wenn endlich die Entscheidung gefallen war und derjenige, der suchen mußte, anfing zu zählen. Jetzt hieß es möglichst schnell ein gutes Versteck finden. Und schließlich das atemanhaltende Stillsein oder auch das geheimnisvolle Flüstern, wenn man zu zweit im Versteck saß. Vielleicht kauerte man in einem Scheunen- oder Schuppenwinkel: heimelig-erregende Abenteueratmosphäre, hinter Stößen von Holz, Lattengestängen, hinter allerlei, auch spitzem und scharfem Gerät, oder in knisterndem Heu, dämmrige Beleuchtung schummerte, vielleicht fielen durch Ritzen Sonnenstrahlen, glänzender Staub schwebte in ihnen … Oder man hockte im Freien irgendwo, genauso gut verborgen, jedoch, anstatt in mildem Dämmerschein, war man der Sonne ausgesetzt, die heiß herabbrannte und die Luft aufheizte, daß man sich manchmal fast wünschte, gefunden zu werden. Zuletzt freilich siegte der Stolz, man duckte sich noch tiefer, preßte sich noch mehr an, wenn der, der suchte, in die Nähe kam. Oft war er so nah, daß man ihn fast hätte berühren können; daß er einfach auf die andere Seite des Holzstapels oder um die Hausecke hätte zu schauen brauchen – und es aus unerfindlichen Gründen doch nicht tat … Oder es war ausgemacht, sich »frei schlagen« zu können: lauern im Versteck, wittern, ob die Luft rein ist, das vorsichtige Herausschleichen, das Heranpirschen und Losspurten, um den Freiplatz zu erreichen, bevor man erspäht wurde – als hinge das Leben davon ab. Indes hing es ja überhaupt nicht davon ab, das alles war das Leben, ganz und gar …
An einem der ersten Tage also spielten wir Verstecken. Jemand begann zu zählen: eins, zwei, drei, vier … – bis fünfzig war Zeit, und alle rannten wir fort – ich mit Anna zusammen, ohne Ahnung zunächst, in welches Versteck. »Halt«, rief ich schließlich, faßte sie am Arm. »Wo wollen wir denn hin?« – »Weiß nicht«, sagte sie achselzuckend. »Oder – wie wär’s bei den Bretterstapeln an der Kirchhofsmauer?« – »Ach nein, da guckt er bestimmt bald nach. Und ich glaub auch, Wolfi ist dorthin.« – »Eckstein, Eckstein …«, erklang es da. – »Sakradi, so schnell«, fuhr Anna auf. »Los, wir gehen in die Scheune vom Riedmiller, ins Heu.« – Und wir sprangen davon, zum Glück waren wir bereits außer Sicht gewesen.
Wir stiegen die Leiter ins Obergeschoß der Scheune hinauf, Anna voran, und krochen raschelnd durch die Heumassen nach hinten. »Da findet er erst die andern drei, eh er uns hier entdeckt, wenn überhaupt«, frohlockte sie. – »Ja«, antwortete ich, hämisch-zufrieden wie sie, »selbst wenn er hochklettert, sieht er uns noch lang nicht.« Und ich sagte: »Du, komm, wir beugen vor uns noch mehr Heu auf«, sagte ich. – »Au fein.« Anna klatschte in die Hände. »Wir machen eine richtige Mauer ringsum, ganz hoch, wie eine Burg. Und unten bauen wir noch eine Höhle hinein.« – Schon hatte sie begonnen, so viel auf einmal nur ging, Bündel von Heu zu packen. Schnell war unsere Burg fertig, wir saßen nebeneinander im Dämmerlicht der Höhlung, die uns, wenn wir die Knie anzogen, völlig überdeckte. Dazu hüllte ein heimliches Zwielicht uns ein, und von dem Heu entströmte ein betörender warmer Duft, der träumerisch machte. Wir kicherten und glucksten oft grundlos, das will sagen, bloß aus der süßen Aufregung des Verstecktseins heraus, weil draußen irgendwo einer herumtappte und uns angestrengt suchte. Wir verstummten indes jedesmal sofort wieder und horchten.
Zuletzt wurde für Annas Schalk das Stillsitzen und An-sich-Halten zu arg. Sie kitzelte mich mit einem trockenen Grashalm, den sie über meine Stirn herabbaumeln ließ. Zuerst erkannte ich nicht, was vorging. Ich spürte etwas an der Nase, wischte danach und traf nur diese selber. »Au, was war das?«, zischte ich. – »Ist was?«, fragte Anna flüsternd unschuldsvoll. »Haust du deine Nase?« – »Ah, du warst das«, flüsterte ich zurück. – »Ich?«, tat sie höchst verwundert, und gleich darauf kitzelte es wieder. – »Hör auf«, schimpfte ich lustig-ärgerlich, schüttelte ruckartig den Kopf. – »Was zappelst du bloß so?« Dann kam der Grashalm erneut. »Bsbsbs«, summte sie. – »Laß das«, fauchte ich.
»Pscht, leise«, machte sie nur und kicherte und wollte wieder. Diesmal fuhr ich blitzschnell mit beiden Händen nach oben, daß ich in vollem Schwung oben anstieß und es von dort herabrieselte. Wir mußten beide niesen, aber ich hatte ihre Hand fest, zog den ganzen Arm herunter, daß Anna gegen mich fiel, und setzte mich schwer auf ihn, den sie jetzt trotz der weichen Unterlage nicht mehr befreien konnte; sie lag auf dem Rücken.
»Jetzt hab ich dich«, triumphierte ich. »Und glaub nicht, daß ich wieder loslasse.« – »Doch, bitte, laß los«, bettelte sie. – »Nein nein.« – »Ach, bittebitte. Ich will auch ganz brav sein.« – »Ja ja«, machte ich und drückte mich noch schwerer auf den Arm. – »Auu, du, das tut weh«, kam es kläglich. »Laß mich wieder los.« – »Pscht. Jammer nicht so laut.« – Ich griff jetzt nach einem Grashalm. Indessen, saß ihr Arm auch fest, die Hand war frei beweglich. Vor Schmerz quiekte ich plötzlich auf, sie hatte mich gezwickt. »Willst du mich wohl loslassen, nein?« Und sofort zwickte sie nochmals, versuchte den Arm wegzuziehen, zwickte wieder. – Ich kapitulierte, rückte aufzuckend zur Seite. »Na siehst du«, lachte sie halblaut. – »Na warte«, zischelte ich. – Da hörten wir unten in der Scheune etwas klappern. Mit einem Schlag waren wir mucksmäuschenstill, krochen vorsichtig wieder ganz in die Höhle zurück und lauschten: Es scharrte, jemand kletterte die Leiter herauf.
»Ob er uns gehört hat?«, fragte sie, kaum verstehbar, so leise. – »Abwarten«, hauchte ich. – Er war oben angelangt, es knarschte durch das Heu. Dann Stille. Und nach einer Pause, die uns ewig vorkam, rief es: »Rauskommen, hat keinen Zweck mehr, ich weiß, wo.« – Es klang, als stünde er direkt vor unserem Wall; der mußte von außen wie ein massiver Haufen aus Heu erscheinen, nichts wußte er. Wir verharrten reglos, atmeten ganz flach; flacher, als nötig war, die Spannung spielerisch erhöhend. Wieder Stille, zum Schneiden dicht. Endlich entfernte er sich, und wir hörten ihn fluchen, während er polternd abwärts kletterte.
Eine ganze Weile noch regten wir uns nicht. Dann seufzte Anna erleichtert auf: »Puh, da haben wir ganz schön Glück gehabt.« – Gleich darauf spürte ich ihre Hand auf der Wange. »Mein armer Kleiner«, sagte sie lustig, »hab ich dich schlimm gezwickt? Kannst du noch sitzen?« – Ich wich mit dem Kopf aus, sich von einem Mädchen mitleidig streicheln zu lassen, war eines Jungen nicht würdig. Ich schalt sie: »Deine Zwickerei hätt uns fast verraten. Zwicken, pah, das tun wirklich bloß Mädchen.« – »Na und«, versetzte sie eingeschnappt, »und Jungen quietschen deshalb nicht los wie …« – Sie verstummte und drehte mir den Rücken zu. Nach langen Minuten des Schweigens, das auch diesmal dicht gewesen, aber anders, nicht in prickelnder Aufmerksamkeit, sondern dumpf und bedrückend, gab ich mir einen Stoß. Seltsam unerträglich war es mir, trotz allem Ärger, geworden, daß sie mit mir schmollte. »Komm, sei wieder gut«, bat ich. »Ich spiele mit dir auch noch viel lieber sogar als mit Wolfgang.« – »So?«, kam es kurz. – »Wirklich. Und noch viel schöner fänd ich’s, wenn ich mit dir auch bei mir daheim zusammenwäre. Dann könnten wir zusammen radfahren, durch Gärten streifen, und alle wären neidisch, wie du Fußballspielen kannst …« – »Ja, wirklich?« Mit einem Ruck drehte sie sich wieder um, kniff mich aus verspieltem Trotz und Übermut in den Arm, wischte wie der Wind zur Höhle hinaus, lachte vergnügt. – »Dich krieg ich schon«, rief ich und sprang ihr hinterher. – Einen Augenblick später rutschten und rollten wir den »Burgwall« hinab und blieben unten – halb vom Heu begraben – rücklings, bäuchlings liegen.
Als wir uns freigewühlt hatten, tönte von weit draußen Rufen herein: »Wo seid ihr …? Kommt endlich, wir warten nur noch auf euch.« – Andere Stimmen klangen dazu: »Hallo, kommt, wir wollen nicht mehr …« – »Die haben wir fein drangekriegt. Alle zusammen finden uns nicht«, freute ich mich. »Sollen wir da so einfach jetzt rauskommen?« – »Warte, ich weiß was«, sagte Anna. Wir schleichen uns an und erschrecken sie.« – »Prima, das wird ein Spaß.« – Wir stiegen rasch hinunter und gingen auf Schleichpfad. Alles andere war unwichtig, war vergessen.
An einem Fußballtag, abends, nachdem wir genug gewetzt waren, standen Anna, Wolfgang und ich an der Garage, mit einem ruhigeren Ballspiel beschäftigt. Anna war gerade am Werfen und bereits bei dreimal Klatschen angekommen. Denn jeder mußte, wenn er den Ball an die Wand geworfen, die Hände zusammenschlagen, bevor er ihn wieder fing. Dafür gab es drei Stufen: erst nur einmal klatschen, danach zweimal, zuletzt dreimal, und fünfmal hintereinander mußte man jedesmal fangen. Ließ einer vorher den Ball fallen, kam der nächste an die Reihe. Und hatte man die dritte Stufe überwunden, wurden zum In-die-Hände-Klatschen weitere Hürden eingebaut. Zum Beispiel mußte man den Ball nun zuerst unter einem Bein hindurch oder, mit dem Rücken zur Wand, über den Kopf werfen. Schon in früheren Jahren hatten wir das hingebungsvoll getrieben, ich weiß nicht mehr bis zu welcher Höhe der Schwierigkeiten.
An jenem Abend waren wir erst am Anfang, und Anna warf also gerade. Nur noch ein Wurf von ihr und sie wäre in einem Durchgang mit den ersten drei Stufen fertig gewesen. In diesem Moment wurde sie von ihrer Mutter ins Haus gerufen. »Gleich, ich komm gleich«, rief sie, den Ball festhaltend, zurück. – »Nein, sofort«, befahl es. – Anna brummte unwillig. »Macht ja nicht ohne mich weiter«, ermahnte sie uns streng, als sie fortging.
Es dauerte länger, bis sie wiederkam, und wir taten einstweilen überhaupt nichts, saßen bloß auf der Kirchhofsmauer, die dort nahe an der Garagenwand vorbeilief. Wolfgang drehte den Ball in seinen Händen hin und her. »Weißt du was?«, sagte er schließlich und warf mir den Ball zu. »Solang du da bist, ist Anna viel mehr deine Freundin. Aber das macht mir nichts aus, denn wenn du wieder fort bist, kann ich ja die ganze Zeit mit ihr spielen.« – »Du hast’s halt gut«, antwortete ich, »nicht einmal vier Wochen hab ich. Ich würd so gern das ganze Jahr hierbleiben, hier kann man viel mehr machen, als bei uns in der Stadt. Und wir könnten immer zusammensein, du und ich und Anna.« – Anna erschien wieder, und wir spielten, wo wir aufgehört hatten, weiter in unserer Kinderwelt. Doch im Rückblick glaube ich, in das kleine Gespräch war schon manches hineinvermischt gewesen, was nicht mehr zu ihr gehörte, das Ingredienz des Kommenden war.
Es kam bald. Vorher gingen wir noch zum Baden, an einen kleinen See in der Nähe. Eine buschig-waldige Insel lag in ihm. Auf seiner einen Seite wuchsen steil hangabwärts dichte Nadelbäume bis an das Wasser, das übrige Ufer bestand zum großen Teil aus Gras, ging in sanftgeneigte, wellige Weideflächen über. Am oberen Ende des Sees aber, wo der Bach einmündete, waren Partien mit Schilf verwachsen und die Umgebung sumpfig. Der See sah fast so dunkel aus wie der Wald: Selbst wenn der Himmel sich blauglänzend darüber wölbte, hellte sich die Farbe nur grünlich auf. Ein ganz weiches, tragendes Moorwasser hatte er, wunderbar leicht konnte man darin schwimmen.
Früher war dieser See ein unberührt stilles Gewässer gewesen, lediglich auf staubigen Sand- und Schottersträßchen erreichbar, und nur Eingeweihte waren in ihm geschwommen. Früher. Jetzt strebten mittlerweile an sonnigen Tagen ganze Scharen herbei, weitherum galt er als Badeziel für Ausflügler und Feriengäste, die Sträßchen waren verbreitert und geteert, auf der Insel hatten sie eine FKK-Kolonie – zu der ein Plankensteg führte – eingerichtet und hatten auch einen Teil der Uferwiesen als offizielles Badestrandareal eingezäunt, wo man Eintritt zahlen mußte.
Dorthin gingen wir nicht, wir lagerten an einem abgelegeneren, noch frei zugänglichen Stück. Die Eltern waren mit uns hinausgefahren, außer meiner Schwester und mir waren auch die ältere Tochter unsrer Wirtsleute sowie Anna und Wolfgang dabei. Das war Ferienglück: die Luft, den sachten Wind, die Sonne auf der Haut spüren, auf der Wiese umhertollen und spritzend, kreischend ins frische Wasser hinein. Einen Ball hatten wir natürlich mitgenommen; Anna, Wolfgang und ich kickten immer mal wieder, ohne Tor, jeder versuchte einfach, jedem das Leder abzujagen und es selber so lange wie möglich zu behalten. Dann und wann machte für kurz auch jemand der andern mit, doch zogen sie die Decke im Gras vor. Auch wir drei spielten längst nicht so verbissen wie sonst im Ort. Die See- und Sonnenatmosphäre, die kühlende Nähe des Wassers, das so herrlich trug, und des darüberher dunkelnden Waldes, die luftige Lässigkeit der Badekleidung – das durchwehte alles mit einer größeren Leichtigkeit und heiteren Trägheit zugleich. Diese Trägheit bedeutete für uns nicht Untätigkeit, mehr entsprach sie einem laisser-faire, nie konnten wir so lang daliegen wie die Großen, sei es im Schatten oder in der Sonne, höchstens ein Buch dabei zur Unterhaltung. Nein, meistens waren wir irgendwie in Bewegung, darin wohnte für uns mehr Ruhe und Entspannung als im Liegen, und sehr oft waren wir im Wasser, planschten dort vor allem in Ufernähe, wo man noch zu stehen vermochte, herum, denn Wolfgang konnte nicht schwimmen. Manchmal ließen wir ihn auch zurück, schwammen Anna und ich weiter hinaus.
Einmal schwammen wir bis zur Insel. Das FKK-Gelände übte eine Anziehungskraft auf uns aus, besonders weil es so geheimnisvoll verborgen lag: Von unserer Seite war nichts davon zu sehen, der Strand öffnete sich wohl zur Waldseite hin, zwischen Ufer und Insel war dort ein Teil des Sees abgesperrt. Den Reiz des Verborgenen empfanden wir hauptsächlich auf komische Art, wenn wir uns vorstellten, daß die Leute die Umständlichkeit dieses Abgetrenntseins auf sich nahmen, damit sie sich ganz nackt ausziehen durften. Das fanden wir schon etwas absonderlich, weshalb wir die Insel »Geschlossene Anstalt« nannten; bereits ein, zwei Jahre früher war das Wort aufgekommen. Ein gewisses Befremden, das in unsere Empfindungen hineintastete, trug sicherlich mit zu unsrer Neugier bei und rief die andere Funktion der Komik hervor: Spannungen, Reizungen abzuleiten. Das rührte nicht zuletzt von dem Dürfen her.
Halb schwammen, halb gingen wir im flachen Wasser an der Insel hin und aßen von den blauen Moosbeeren, die an ihrem Ufer wuchsen. »Warst du mal dort?«, fragte ich Anna kauend. – »Ich? Bei den Nackerten? Jesusmariaundjosef, ich bin doch nicht narrisch«, rief sie fröhlich. – »Was Besonderes muß aber schon dran sein.« – »Wieso? Was wollen die Besonderes machen?« – »Weiß nicht … viel anderes als wir tun die, glaub ich, auch nicht.« – »Warum gehn’s dann überhaupt da her und lassen sich auch noch einsperren?« – »Die wollen eben ganz braun werden, überall.« – »Schmarrn, das kann ich grad so gut, wenn ich mich sonst wo in die Sonne lege, wo mich keiner sieht, sogar daheim im Garten, und baden geh ich halt normal und darf das dann überall.« Anna schob sich eine Handvoll Beeren in den Mund. – »Legst du dich denn ganz nackt in die Sonne?«, fragte ich sie ganz selbstverständlich, oder beinahe: Kaum war die Frage heraus, lief – nur flüchtig – ein grieselnder Schauer über mich. – »Wozu, ich werd auch so braun genug. Das andre sieht man eh nicht.« Sie kicherte kurz und meinte: »Ich werd brauner wie du.« – Sie streckte ihren Arm vor. »Halt mal deinen Arm gegen meinen«, forderte sie mich auf. – Wir hielten beide aneinander. »Na siehst du, viel brauner«, triumphierte sie. – »Pah, geh ich halt jetzt zu den Nackten und hol’s auf und werd’s noch viel mehr, ringsum.« – »Du wirst eh bloß rot«, lachte sie. »Außerdem darfst du gar nicht zu denen rein.« – »Wieso? Die dürfen nicht heraus – schon komisch, was?« – »Ja, schon … Nackt wie die Sünd, sagt die Oma immer.«
Da war es wieder aufgetaucht, dies Befremden. Jedoch es kam und entschwand in spielerisch-leichtem Wellengeschaukel, trieb Reizung heran – die sich in Lachen löste. Was in Tiefen hinabführen mochte, darüber hob nun die Lustigkeit hinweg. Das Befremdliche war eine abenteuerliche Witterung, wie beim Versteckspiel: kribbelnd-erregend – ohne daß es nachzuwirken schien.
II
Mit dem nächsten Tag wurde alles anders. Knapp zwei Wochen waren vergangen. Den Vormittag über hatte es geregnet, so daß man nicht hinauskonnte. Ich war zuerst im Zimmer geblieben, später hatte ich mich auf dem großen Dachboden aufgehalten, der einer Rumpelkammer glich. Anna hatte ich noch nicht gesehen.
Besänftigend war es gewesen, das Klopfen und feine Klingeln des Regens unter dem schützenden Dach zu hören, und in den Singsang mischte sich der Duft von Staub und von Sägespänen, es war nämlich dort oben auch eine kleine Tischlerwerkstatt eingerichtet. Nicht ohne Grund hatte es mich da hinaufgezogen, wo ich dem Regen zuhorchte, ungestört war, eine vertrauliche Höhlengeborgenheit mich umgab. Denn in mir zitterte eine Unruhe, rastlos tickend wie von kleinen Uhren, die einer zu großen Zeit nachzueilen scheinen. Ich hatte in der Nacht schlecht – nein, verwirrend hatte ich geträumt:
Ich spielte mit Wolfgang bei der Garage, wir warfen uns den Ball hin und her einander zu. Wo ist Anna?, fragte da ich ihn. – Woher soll ich das wissen?, entgegnete er spöttisch, sie ist doch deine Freundin. – Darauf schleuderte er heftig den Ball – als ich ihn auffing, war es Anna, und sie war Jahre älter, war schwer. Ich verlor das Gleichgewicht, fiel mit ihr in den Armen hin, ins Heu. Sie blickte mich mit glitzernden Augen an. Deren Mitte war so schwarz und tief, ich hatte Angst, dort hineinzustürzen und hielt mich krampfhaft an ihr fest. Mein armer Kleiner, sagte sie summend. Komm, wir wollen schauen, was sie auf der Insel machen. Sie strich mir übers Haar, ich wandte den Kopf ab. Schau her, du, befahl sie flüsternd und zwickte mich. Ich sah sie an. Was wirst du denn so rot?, hörte ich sie fragen, sah in ihre Augen, fiel in sie hinein, oder sie kamen näher und näher, das Schwarze wurde immer größer. Und ich trieb im See, Anna schwamm von der Insel her auf mich zu, noch immer so beunruhigend älter; verfließend, aber so hell, schimmerte ihr Körper durchs Wasser. Willst du wissen, wo ich noch ganz weiß bin?, fragte sie geheimnisvoll, lächelte mich von der Seite an und schwamm zurück. Komm mit, rief sie, komm mit … – Diesen Ruf noch im Ohr, war ich aufgewacht.
Der Traum blieb mir deutlich in Erinnerung und ängstigte und lockte mich in einem. Vor allem verwirrte er mich, und je länger er in mir nachwirkte, desto mehr verschob sich die Verwirrung von dem, was mich auf der Insel gestaltlos, mich bang und sehnlich machend, erwartete, auf die Verwandlung Annas, auf ihre gleichermaßen unwirkliche wie unausweichliche Gestalt. Das rumorte immerzu in mir. So verbrachte ich die Zeit, manchmal schien sie festzustecken, aufdringlich verharrte jede Minute, plötzlich dagegen waren ganze Viertelstunden spurlos versunken.
Mittags gingen wir auswärts, in einer nahen Ortschaft essen, das lenkte ab und half, vor den Eltern mir nichts anmerken zu lassen. Ich fühlte große Scheu, über das, was mich umtrieb, mit irgendjemandem zu sprechen. Und es war sowieso bloß ein Traum. Wie es in den Tag erzählen? Jedes Wort zerrisse sofort alles. Wäre damit aber, woraus es entstanden, ebenso verschwunden? Ich ahnte, ich wußte: nein. Viel zu bald – und dennoch nicht schnell genug – kehrten wir zurück.
Die Eltern hielten Mittagsschlaf; was meine Schwester tat – ich achtete nicht darauf. Draußen triefte es vor Nässe und immer noch regnete es von Zeit zu Zeit. Ich stieg wieder auf den Dachboden, indes entglitt mir auch da bald jeder Rest von Ruhe. Ich kletterte wieder abwärts, in den Bühnenraum, wo eine Tischtennisplatte stand, ließ auf einem Schläger den Ball auf und nieder springen, fand nicht die nötige Konzentration, außerdem – was war?, ja: der Ball, der Ball … Ich verließ den Raum, schlich den Gang vor, in dem unsre Zimmer lagen, drückte mich an dem Zimmer der beiden Mädchen vorbei, stieg ins Erdgeschoß hinunter. Aus der Küche drangen Stimmen. Schnell huschte ich vorbei, in den Raum, in dem wir immer frühstückten; von den Hausleuten wurde er nur wenig benutzt. Dort befand sich ein Harmonium, in den früheren Jahren hatte ich hin und wieder mich hingesetzt und zum Spaß auf ihm, ohne jedes Können, in Tönen geschwelgt. An diesem Tag war es mir ein tiefes Bedürfnis. Ich versuchte aufs Geratewohl die Register, wollte einen möglichst vollen Klang, trat mit Eifer den Blasebalg, drückte die Manuale, daß es nur so düster und herzzerreißend dissonant wehklagte oder wütend, drohend grollte.
Die Hausfrau trat unvermerkt herein. »So, fleißig«, vernahm ich im Rücken ihre Stimme und schrak zusammen. »Spiel nur weiter«, meinte sie gutmütig. »Ein bißchen leiser vielleicht, ja? Und ein bißchen lustiger, hm? Draußen hängen Wolken schon genug.« – Sie lächelte, wie Erwachsene lächeln, wenn sie Kinder ihre wichtigen Spiele treiben sehen. Ich nickte nur. Dann fragte ich zusammenhangslos: »Und wo ist Anna?« – »Anna? Die wird oben sein. Soll ich sie herunterschicken?« – »Neinnein«, antwortete ich hastig. – Die Frau ging endlich wieder hinaus. Eine Weile hockte ich noch vor dem Instrument, schob Registerhebel zurück, zog andre heraus, immer so fort, ein schwaches Schleifgeräusch und stumpfes Ploppen am andern, ich mochte nicht mehr spielen.
Schließlich verließ ich das Zimmer. Und kaum war ich aus der Tür, kam sie herunter: Anna. Das Treppengeländer rutschte sie herab, trug ein Turnleibchen und knappe rote Shorts, was sie öfters schon angehabt hatte. Den Oberkörper flach auf das Holz gelegt, das Hinterteil heraus- und in die Höhe gedrückt und den Handlauf zwischen den nackten Schenkeln, so rutschte sie auf mich zu. Das fuhr durch mich hin wie ein schmerzhaftes Ziehen, ein heißer Strahl schoß durch meinen Körper, ein Strom.
Als sie, nach wenigen Sekunden, unten vor mir stand, fühlte ich uns beide so weit wie nie voneinander weggerissen. Vielmehr, ich spürte sie viel näher als sonst je, innen … Ich wußte nicht, was und wohin. »Hu, siehst du Gespenster?«, lachte sie. Ohne Antwort abzuwarten, plapperte sie weiter: »Was sollen wir machen? Tischtennis spielen, ein Puzzle? Oder gehn wir zu Wolfi rüber, zum Tischfußball …? Na? Sag schon.« Sie stupfte mich neckend mit dem Finger, ich zuckte zurück. – »Ich, nein – ich mag nicht«, brachte ich schleppend hervor. – »Was dann? Stadt, Land, Fluß? Malen wir was …?« – »Ich will gar nichts«, patzte ich ihr ins Wort. – »Ojeoje, und ich dachte, du wolltest mit mir – Mama hat …« – »Ist ja gar nicht wahr«, rief ich und polterte schon die Treppe hinauf. – »Ts, dann nicht. Ich geh zu Wolfgang«, hörte ich sie noch.
Für den Rest des Tages mied ich sie ganz. Die folgende Zeit verlebte ebenso ich in einem Hin- und Hergerissensein zwischen Meiden und Suchen. Sie war auf einmal älter geworden, beinahe wie im Traum. Ich nicht? Auch, ja. Ich kam mir vor wie ein unsichrer, tapsiger kleiner Junge – der keiner mehr sein konnte. Etwas war eingetreten, das uns nicht mehr harmlose, unbeschwerte Spielkameraden sein lassen wollte; das sowohl trennte wie gleichzeitig von einer viel intensiveren, viel tieferen Verbindung zwischen uns beiden sprach. In Wahrheit nämlich bedeutete Annas Nähe mir unendlich mehr; und einzig, weil mir das oft beinahe zu viel wurde, wich ich ihr aus; wich aus, obwohl ich im Innersten nichts als ihr Nahsein ersehnte. Aber so seltsam andersartig als früher.
Tags darauf machten meine Eltern mit uns eine Autofahrt, und Anna war dabei. Am Morgen ging es mir wieder besser, die wild zackige Erregung hatte sich gemildert. Gestern abend war von dem Ausflug gesprochen worden, und Bestürzung hatte mich zuerst erschüttert, als ich’s erfuhr. »Frag doch Anna, ob sie mitmöchte«, wurde ich aufgefordert. – Ich tat es nicht, weigerte mich, meine Schwester mußte zu ihr gehen; die Eltern schüttelten die Köpfe. Jetzt, nach einer Nacht erfrischenden Schlafs, verspürte ich sogar aufgeregte Freude darüber, daß ich neben ihr sitzen würde.
Wir fuhren. Anna saß zwischen meiner Schwester und mir in der Mitte, ganz nah, und die freudige Aufregung war großenteils erneut in bängliches Zittern umgeschlagen. Je länger wir allerdings fuhren, desto mehr hieß ich, mir einigermaßen wunderlich, diese zitternde Scheu willkommen, genoß sie und erschauerte, wie bei einer jagenden Achterbahnfahrt. Doch blieb ich die meiste Zeit schweigsam, zu Anna sagte ich überhaupt nichts, dafür unterhielt sich meine Schwester mit ihr, und Anna war das lustiglebendige Mädchen wie immer. Ich saß daneben, schaute aus dem Fenster und – ich spürte, wie bei jedem Schucker des Autos ihr Bein an meinem sich rieb. Nach und nach half ich dem selber ein wenig auf die Sprünge, schob mein Bein, tastend vorsichtig, näher an ihres heran. Ich spickte hinüber, nicht mehr nur Knie an Knie, Schenkel lag an Schenkel, ich merkte, wie entsetzlich weit ich von der Tür abgerückt war, den freien Raum dort sah ich wie einen schwindelerregenden Abgrund. (Eine Handbreit maß er in Wirklichkeit.) Was klopfte mein Herz so? Gleich erschlägt es dich, dachte ich. Wie wundersam warm aber von Anna ein Strömen ausging, kam von ihr nicht Gegendruck …? Ich spickte aufs neue hinüber. Wohin schaute sie?; ich brachte es nicht fertig, die Augen zu heben. Immer wieder kamen Kurven, bei jeder Rechtskurve mehr ließ ich mich etwas stärker zu ihr hindrücken; was passierte nach links, sie nicht auch …? Endlich legte ich den Arm auf meinen Schenkel, schwer war er, als wäre in ihm alles Gewicht der Welt. Und die Stille zwischen uns, nur durch die Musik aus dem Radio war sie zu ertragen. Mühsam sachte ließ ich den Arm in die Kuhle unserer Schenkel gleiten, und schaute wieder zum Fenster hinaus, den andern Arm, mich an ihn pressend, hinter meinen Rücken geschoben. Dann, eine Berührung. Steif drehte ich den Kopf: Auch Annas Arm war herabgeglitten, beide lagen nebeneinander, nicht zufällig-leicht, sondern jeder dem andern, Haut an Haut, entgegengedrückt. Die Kurven und Schucker der Fahrt, Bein an Bein, wie das rieb, Arm an Arm, wie das brannte geradezu …
Bald darauf hielten wir an und stiegen aus. Dieser Halt trieb für die übrige Fahrt wieder Distanz zwischen uns. Das Bein- und Armspiel spukte als bittersüße Erinnerung durch mich hin. In mir verlangte etwas, es fortzusetzen. Indes, ich besaß keinen Mut mehr, und Anna tat ebensowenig mehr dazu. Lange spürte ich den Druck, die Hitze ihres Armes nach. Fürchtete ich den Brand? War es, weil das doch kein Spiel mehr sein würde; keines mehr wie früher auf jeden Fall? Zu schwierig noch für mich …? Aus dem Zwiespalt wuchs neue Verlegenheit. Ich versuchte sie zu überspielen, indem ich nicht mehr stumm war, sondern redete, alles mögliche, was ich sah oder hörte oder mir gerade einfiel, aufgriff, Witze machte, auch mit Anna jetzt redete. Und ich merkte, daß auch hier, was Spiel hieß, sich verzerrt hatte.
Während der Tage danach gab es immer wieder einen steilen Zakkenstoß in der Ereignislinie. Die Stöße verteilten sich, zeigten aber, daß unterschwellig ein Vibrieren stetig weiterlief, mich begleitete. Besonders in stilleren Momenten spürte ich Gedanken und Empfindungen tief von ihm durchdrungen, Anna, Anna, zitterte es. Und nachts, vor dem Einschlafen, sprach ich oft mit ihr. Nicht wirklich, ich stellte mir’s vor. Harmlose Dinge waren es; ein sachtes Berühren des Armes, der Hand in die Worte verwoben, ein wie vorbeifliegender Kuß auf die Wange, war das äußerste, was ich in den Phantasien mich traute. Jenseits davon gab es mehr, ich wußte es, die Kinder fielen schließlich nicht vom Himmel, ich ahnte, wie das zwischen Anna und mir weiter und dorthin führen konnte … doch war es zu schwer, zu verworren, zu reißend. Diese Strecke war ein schwanker Steg über dunklen Wassern, die in Wahrheit schäumen würden, wenn man in sie stürzte … Ich beschränkte mich, hingebungsvoll beinahe, auf die Idylle scheu-zärtlichen Zusammenseins. Dennoch, trotz aller selbsterrichteten Schutzdämme, wurde mir bewußt, daß man sich verlieben, daß man von Liebe erfaßt werden konnte; was das sein konnte – weit entfernt von allem kindlichen »Mögen«. Wie nahe war ich dem schon?
Tagsüber wurde das alles etwas überblendet, wirkte in blassere Ferne gerückt. Anna selbst wurde wieder so leibhaftig wirklich, daß jedem aus der Nacht übriggebliebenen Wunsch und Traum die Kraft versagte. Ich versuchte, mit den alten Ferienspielen das Zittern zu bannen, mit deren vertrauten Harmlosigkeiten den Klippen in Annas Nähe auszuweichen, um nur bei ihr sein zu können. Nicht immer gelang es, und die Zacken stießen durch.
Wir spielten auch wieder Fußball, und alles schien unverändert, wenn man uns zuschaute. Gerade hierbei aber lief ich, nicht lang nach jener Fahrt, mitten in eine der Zacken hinein. Wir wetzten bereits eine ganze Zeit auf unsrer Wiese umher, und wie üblich stürmten Anna und ich in verschiedenen Mannschaften. Da rollte der Ball auf mich zu und sie sprang ihm nach, in vollem Lauf. Ich sah sie auf mich zuschießen und die Szene jenes Traums zuckte wieder in mir auf: sah den Ball heranfliegen, sah mich mit Anna im Arm fallen, mit der verwandelten … – Ich wich aus, ließ den Ball, ließ Anna vorbei, konnte nicht mit ihr um ihn kämpfen, der Ruf eines andren Kampfes drang von fern zu mir her, undeutlich, trotzdem erschauernd hörbar. Und eines verstand ich genau: Zu sehr war sie Mädchen geworden.
Bei den nächsten Spielen suchte ich, immer in dieselbe Mannschaft wie Anna zu kommen, um nicht wieder so ihr gegenüberstehen zu müssen. Und am folgenden Tag spielte ich überhaupt nicht mit, erfand vor Anna, die mich fragte, irgendeine Ausrede und stand oben im Zimmer versteckt am Fenster, schaute ihnen, schaute ihr sehnsüchtig zu.
Ferienglück, Ferienleichtigkeit – wie ging es sich jetzt unsicher und schwer an demselben Ort, wo sie mich früher getragen hatten. Einmal aber nahm mich etwas weit nach oben hinauf, das war keine Zacke, die hochstieß, um mich in Schmerz auffahren und stürzen zu lassen. Das Glück trug mich empor über die schwankenden Gründe und hielt mich, für eine Weile, sicher. Draußen wurde es schon dunkel, Annas und meine Eltern spielten Karten, wir zwei saßen mit am Tisch. Ihr Vater saß an der Langseite auf der Bank, Anna daneben, nahe der Tischecke und leicht schräg gegenüber meinem Vater, der an der Schmalseite seinen Platz hatte. Neben ihm, an der anderen Ecke, saß ich, vorn an ihm vorbei sah ich zu Anna. Sie half ihrem Vater, und wie er versuchte, wenn die andern nur eine flüchtige Sekunde ihre Karten unbedacht hielten, einen Blick in sie hinein zu erhaschen, genauso übte sie sich darin: reckte bisweilen den Hals, hob die Nase in die Höhe und spickte unter unschuldig gesenkten Lidern vorsichtig in die Runde. Ich besaß keine große Ahnung von dem Spiel und schaute bloß zu, beobachtete vor allem Anna, schüchtern, aber unwiderstehlich angezogen.
Vielleicht hatte sie es längst bemerkt, bisher hatte sie es jedenfalls nicht beachtet. Jetzt blickte sie auf einmal geradewegs zu mir. Wie ein Schlag war es, als der Blick traf. Indessen stieß er mich nicht fort, es war im Gegenteil, als sei eine Verankerung eingetrieben worden und richte uns unverrückbar einander zu. Sie lächelte, knitz und lieb und hinschmelzend, wie sie das konnte, und gab mir Zeichen mit Augen und Kopf, ich solle für sie bei meinem Vater in den Karten spionieren. Ich hob fragend die Augenbrauen, zuckte mit den Achseln, nicht so sehr, um abzulehnen, als um auszudrücken, daß ich nicht wußte, wie die Karten ihr melden. Sie nickte auffordernd, schnitt Grimassen, ich versuchte zu kiebitzen, sah wieder zu ihr, hob die Schultern, schüttelte den Kopf. Sie runzelte zweifelnd die Brauen, formte mit den Lippen stumm ein Wort: Wie?, was?, mochte es bedeuten. Ich spickte aufs neue nach den Karten, da hielt mein Vater sie eng an sich, schaute grinsend und prüfend auf uns beide. »Na, ihr wollt mir wohl helfen?«, sagte er. »Laßt mich besser mal allein spielen. Eurer Hilfe trau ich nicht so recht.« – »Anna, hm?«, ergriff darauf ihr Vater verschmitzt-bedenklich das Wort. »Wer weiß, wem du hilfst. Ihr zwei – halt du deine Augen lieber auch mehr aus meinem Blatt.« – Vergnügtes Lachen klang um den Tisch, und das Spiel ging weiter.