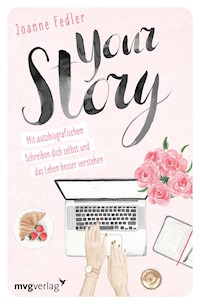6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Zeit für Freundinnen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
Eine Nacht, acht Frauen, keine Kinder, keine Tabus! Geheimnisse werden enthüllt und Freundschaften auf die Probe gestellt, als sich Joanne und ihre sieben Freundinnen in Helens Landhaus zur Pyjamaparty treffen. Zwischen Erdbeer-Daiquiris, Garnelen-Koriander-Curry und Schokolade bis zum Abwinken wird das Mutterdasein mal so richtig unter die Lupe genommen. Im Lauf der Nacht bröckelt die sorgsam gehütete Fassade jeder einzelnen Frau. Und was dabei herauskommt, lässt kein Leserinnenherz kalt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Ähnliche
Joanne Fedler
Weiberabend
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Dieses Buch ist allen Müttern auf der Welt gewidmet. Wann immer du dir wie eine schlechte Mutter vorkommst und dich vollkommen allein fühlst – du bist es nicht.
Du bist es nicht.
Vorbemerkung
Im Juni 2003 arbeitete ich an einem Artikel über Andrea Yates, eine Amerikanerin, die ihre fünf Kinder in der Badewanne ertränkt hatte. Während meiner Recherche wich das Grauen, das mich zum Schreiben getrieben hatte, allmählich einer widerstrebenden Empathie. Ich schämte mich dieses Mitgefühls, denn ich verstand nicht ganz, wie meine Empörung über eine solche Tat so ein Gefühl zulassen konnte.
Während ich noch mit dieser Reaktion rang, brachen die Nachrichten von Kathleen Folbigg über die australische Volksseele herein. Eine weitere Mutter, die ihre eigenen Kinder getötet hatte, diesmal vier, über einen Zeitraum von zehn Jahren. Ich war angewidert, ließ mich aber auf den Klatsch in der Presse ein. Besonders auf die Berichte über ihre Tagebücher, in denen sie das Gefühl beschrieb, die Mutterschaft raube ihr das eigene Selbst und zerstöre ihre Persönlichkeit. Ihre Geständnisse schreckten mich auf. Nicht zuletzt deshalb, weil sie jenen Erinnerungen ähnelten, die ich schriftlich festgehalten hatte, während der besonders zermürbenden Zeiten, als meine Kinder noch klein waren.
Mein Artikel, der im Wochenendmagazin des Sydney Morning Herald erschien, endete mit dem Satz: »Wenn es eine Hölle gibt, dann wird Folbigg für das, was sie getan hat, vielleicht darin schmoren. Doch zum Glück werde ich nicht diejenige sein, die ein Urteil über sie fällen muss.«
Um ehrlich zu sein, war ich sehr nervös, was die Reaktion der Leser anging. Ich erwartete, verdammt zu werden. Aber abgesehen von ein paar empörten Briefen älterer Leserinnen und Leser begegneten mir andere Mütter mit dem leisen Eingeständnis, dass keine von ihnen begierig darauf wäre, ihre Leistungen als Mutter einer genauen Prüfung unterziehen zu lassen. Zahlreiche Mütter konnten sich mit der Aussage meines Artikels identifizieren, die durchaus leicht hätte missverstanden werden können – nämlich dass die Handlungen von Müttern, die ihre Kinder töten, zwar unvorstellbar sind, ihre Verzweiflung und Einsamkeit aber nicht einmalig.
Einige Monate später traf ich mich mit einigen Freundinnen zu einer Pyjama-Party. Bei einem üppigen Festmahl – und zu vielen Daiquiris – enthüllten wir einander unsere Lebensgeschichten als Mütter, Ehefrauen, Berufstätige und als die Individuen, die wir waren, bevor wir Eltern wurden. Es gab Offenbarungen und Geständnisse, viel zu lachen, Wein, Fußmassagen und grauenhafte Filme auf DVD.
Das Drängen meiner Freundin und Agentin Jane Ogilvie spornte mich an, ein Buch über diese Insel in der Zeit zu schreiben, über jenen geheiligten Raum der Ehrlichkeit. Weiberabend entstand aus diesem Zusammentreffen und beschreibt die Ereignisse und Emotionen eines einzigen Abends, den acht Frauen zusammen verbringen, allein, Mann- und Kinder-frei.
Alle Gespräche in diesem Buch basieren auf tatsächlichen Gesprächen mit Frauen. Das weiß ich, weil ich eine von ihnen bin. Die Erzählerin bin ich. Ich habe die Fakten meines eigenes Lebens nicht verändert, nur die Namen meines Mannes und meiner Kinder und ein paar weitere Details, um Menschen zu schützen, die ich liebe (aber im richtigen Leben bin ich nicht so ein Miststück, ehrlich!). Die anderen Frauen sind »fiktionalisiert« – ich habe Eigenschaften mehrerer Freundinnen zu einem neuen Charakter vereint und Szenarien erfunden, die nicht unbedingt dem wahren Leben der Frauen entsprechen, die an jenem Abend dabei waren, um deren Identität zu verschleiern. Außerdem will ich damit meine kostbare Freundschaft mit diesen Frauen schützen und das Vertrauensverhältnis wahren, das diese Gespräche überhaupt erst möglich gemacht hat.
Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich an die Macht der Wahrheit glaube, und an die Freundschaft von Frauen. Ich habe es geschrieben, weil Muttersein unterbewertet, über-romantisiert und verdammt hart ist. Wenn du selbst Mutter bist, weißt du genau, was ich meine.
Und schließlich habe ich dieses Buch meinen Kindern zu Ehren geschrieben, meinen besten Lehrern, die mir meine ganze Unvollkommenheit vor Augen führen. Ich habe es getan, weil ich sie liebe und mir vorgenommen habe, ihnen immer die ungeschminkte Wahrheit über das Leben zu erzählen, damit sie genug Informationen haben, um für ihr Leben die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Eine Geschichte kann man nicht auf leeren Magen genießen, deshalb ist diese hier durchsetzt mit verschiedenen köstlichen Gerichten. Sie sollen das kreative und sinnliche Vergnügen anregen, das Frauen aus einem schönen Teller liebevoll zubereiteten Essens ziehen. Genau wie ich, hast auch du sicher schon tränenreiche und zum Schreien komische Gespräche mit Freundinnen erlebt, am Küchentisch mit köstlichem, selbst gekochtem Essen und diesem gesegneten Glas Wein …
Alle Geschichten, die du auf den kommenden Seiten lesen wirst, sind wahr – sie sind mir entweder selbst passiert, oder irgendjemand von irgendwo hat sie mir erzählt. Aber beim Schreiben erschafft man immer eine Mischung aus Wahrheit, Imagination und Übertreibung. Wenn dieses Buch dir unangenehme Gefühle bereitet, war es nur eine Geschichte. Wenn du hier Erleichterung oder Trost findest, bitte, genieße es.
Joanne Fedler
Was du über uns wissen musst
Die Erzählerin (alias ich)
Alter:37 (genauso alt wie Marianne Faithfulls Lucy Jordan, als ihr dämmert, dass sie wohl nie im Sportflitzer durch Paris fahren und sich den warmen Wind durchs Haar wehen lassen wird … seufz.)
Familienstand: Seit kurzem mit Frank verheiratet, dem Vater meiner Kinder, mit dem ich seit acht Jahren zusammen bin.
Kinder: Jamie (7½) und Aaron (4).
Beruf: Schriftstellerin (ehemals Jura-Dozentin und Frauenrechts-Aktivistin).
Was mich beschäftigt: Werden unsere Kinder uns je verzeihen, dass wir ihnen Großeltern, Cousins und Cousinen geraubt haben, indem wir vor vier Jahren Südafrika verließen? Ist Australien nach den Anschlägen auf Bali noch »sicher«? Eine Kindergärtnerin bezeichnete Aaron vor kurzem als Störenfried. Atkins oder Weight Watchers? Oh, und Hautschäden durch Sonneneinstrahlung im Dekolletébereich.
Wovon ich träume: Schreiben können wie Amy Tan oder Toni Morrison und eine weltberühmte Schriftstellerin werden; innerhalb der nächsten zehn Jahre ein eigenes Haus in Sydney besitzen; ansonsten alles, was Robbie Williams ohne Hemd beinhaltet.
Bloß nicht erwähnen: Autoren unter dreißig, die Bestseller geschrieben haben; Makler und Vermieter; Krebs, egal wo.
Heimliche Allianzen: Ich weiß, das klingt schulmädchenhaft, aber Hel ist meine beste Freundin. Unter all diesen Australiern fühle ich mich manchmal als kulturelle Randgruppe.
Drei Wörter, die mich beschreiben: Mutter, Schriftstellerin, Immigrantin.
Helen (alias Hel)
Alter:43
Familienstand: Glücklich verheiratet mit David, Inhaber von »Burly«, einer Firma, die Arbeitsoveralls herstellt (in Khaki, Marine und Grau, und ab nächstem Jahr auch in Beige).
Kinder: Nathan (6), Sarah (5) und Cameron (3). Schwanger mit Nummer vier.
Beruf: Vollzeit-Mutter.
Was mich beschäftigt: Sarah hat neulich gefragt, was es heißt, jemandem »einen zu blasen«; habe geantwortet: »Das macht der Friseur nach dem Haareschneiden« – etwas Besseres ist mir auf die Schnelle nicht eingefallen; ob wir den Weihnachtsurlaub in Byron Bay verbringen oder das Geld sparen sollen, um nächstes Jahr nach Bali zu fahren; die Fliesen um den Pool – hellbeige oder terrakottafarben? Nathans Gewicht.
Wovon ich träume: Dass David vor acht Uhr abends nach Hause kommt, nur einmal in der Woche; Jo das Rezept für ihre Salatsauce entlocken; und vielleicht, in einem früheren Leben, ein bisschen lesbischer Sex (aber das darfst du auf keinen Fall veröffentlichen!).
Bloß nicht erwähnen:Die Kochkünste der Schwiegermutter. Die Preise für neue Kinderschuhe. Tage, an denen die Krippe im Fitness-Studio voll ist.
Geheime Allianzen: Jo und ich leben, um zu essen, und eines Tages werden wir eine Fresstour durch Italien unternehmen. Aber ich verstehe mich mit allen gut.
Drei Wörter, die mich beschreiben: Mutter, Ehefrau, Haushälterin (und daran ist nichts auszusetzen).
Tamara (alias Tam)
Alter:41
Familienstand: Verheiratet mit Kevin, einem Schönheitschirurgen, der auf Brustimplantate spezialisiert ist (und nein, ist es nicht offensichtlich, dass ich meine nicht habe machen lassen?).
Kinder:Zwei Jungen, Kieran (6) und Michael (7).
Beruf:Ausgebildete Heilpädagogin, derzeit als Bürokraft tätig.
Was mich beschäftigt: Wird Kieran (ein hochbegabtes Kind) in der Schule ausreichend gefordert und gefördert, so dass sein Entwicklungspotenzial maximiert wird? Steht Michaels Bettnässen in Verbindung mit Minderwertigkeitsgefühlen, weil er nicht so »begabt« ist wie sein jüngerer Bruder? (Aber darüber würde ich in seiner Gegenwart nie sprechen.)
Wovon ich träume: Dass beide Kinder sich im sportlichen, musischen, schulischen und sozialen Bereich hervorragend entwickeln; irgendwann mal mit der ganzen Familie Urlaub zu machen – Kevin ist ein Workaholic; das Prozac abzusetzen – aber ich habe es damit nicht besonders eilig.
Bloß nicht erwähnen: Gluten. Konservierungsmittel. Künstliche Zusatzstoffe in Lebensmitteln.
Geheime Allianzen: Ich habe keine – obwohl ich Dooly öfter sehe als die anderen, weil Michael und Luke gute Freunde sind.
Drei Wörter, die mich beschreiben: Mutter, Gesundheitsfanatikerin, Leserin.
Liz
Alter:42
Familienstand: Angenehm verheiratet mit Carl.
Kinder: Chloe (6) und Brandon (3).
Beruf: Geschäftsfrau, leite meine selbst aufgebaute Werbeagentur »Craze«.
Was mich beschäftigt: Habe gerade ein weißes Schamhaar entdeckt (wie krass!); überfällig zur Mammographie (Mutter ist mit 41 an Brustkrebs gestorben); arbeite so hart, dass ich keine Zeit habe, im Garten herumzuwerkeln (dem einzig friedvollen Ort in dieser verrückten Welt).
Wovon ich träume: Dass Craze an die Börse geht; dass die Kinder zu selbstsicheren, unabhängigen, lebenstüchtigen Individuen heranwachsen; dass Lily (koreanisches Kindermädchen) uns nie verlässt (käme ohne sie nicht zurecht).
Bloß nicht erwähnen: Kindergeburtstage. Mutters Tod. Ende des Geschäftsjahres.
Geheime Allianzen: Ich war mit Fi in der Schule – wir haben zusammen schlimme Zeiten durchgestanden.
Drei Wörter, die mich beschreiben: Geschäftsfrau, Visionärin, Expertin im Delegieren.
Ereka
Alter:40
Familienstand: Verheiratet mit Jake, unbestritten mein Seelengefährte und der beste und sensibelste aller »New Age«-Männer.
Kinder: Olivia (6) hat einen leichten Hirnschaden, und Kylie (4½) hängt noch an der Brust.
Beruf: Frei schaffende Künstlerin (das ist eher meine Rettung als ein Beruf, aber ich habe im vergangenen Jahr zwei Gemälde verkauft. Na gut, an eine Tante, aber hey, sie hat bar dafür bezahlt, und ich habe mir von dem Geld eine Gucci-Handtasche und passende Schuhe gekauft – irgendwann ergibt sich vielleicht sogar die Gelegenheit, sie zu tragen).
Was mich beschäftigt: Die 25 Kilo, die ich seit Olivias Geburt zugelegt habe; warum kein einziger dieser angesagten jungen Designer daran gedacht hat, eine Linie mit sexy Klamotten für dicke Menschen zu entwerfen; dass ich seit Olivias Geburt versuche, mich mit Jakes Familie zu versöhnen; Leute, die Mitleid mit mir haben; wie ich Kylie abstillen soll.
Wovon ich träume: Fettabsaugung; ein normales Leben; noch einmal ganz von vorn anfangen zu können (ich kann zumindest davon träumen, oder?).
Bloß nicht erwähnen: Mädchen in Bikinis (die deprimieren mich). Den Fettgehalt von Peking-Ente – manche Dinge sind es einfach wert. Fotos von mir selbst von vor zehn Jahren (da war ich dünn und wunderschön).
Geheime Allianzen: Ich habe keine – manchmal schließe ich mich selbst aus. Es ist einfach zu schwer, sich immer als Außenseiterin zu fühlen.
Drei Wörter, die mich beschreiben: Dick, Künstlerin, Mutter.
Courtney-Jane (alias CJ)
Alter:42
Familienstand: Geschieden von Tom (alias DVS – Dieser Verdammte Scheißkerl).
Kinder: Scarlett (4) – hat ständig was zu jammern, Jorja (6) – still, eine Einzelgängerin, und Liam (8) – mein Sonnenschein.
Beruf: Anwältin für Familienrecht.
Was mich beschäftigt: Männer, die sich nicht nur von ihren Frauen, sondern auch gleich von ihren Kindern scheiden lassen; wie alle Frauen nach einer Scheidung leiden – finanziell, gesellschaftlich (und sexuell nicht zu vergessen); meine Libido, die nicht weiß, wohin mit sich selbst; grauenhafte Migräneanfälle; Nikotinentzug (habe vor 84 Tagen und 13 Stunden mit dem Rauchen aufgehört); die Lehrerin glaubt, Liam könnte ADHS haben, aber ich habe nicht die Kraft, dem nachzugehen.
Wovon ich träume: Ein Mann, der eine 42-Jährige mit drei Kindern »sexy« findet. Das war’s eigentlich schon.
Bloß nicht erwähnen: Zigaretten. Überfällige Unterhaltszahlungen von DVS. Sex. Zigaretten.
Geheime Allianzen: Liz und ich sind als Einzige hier voll berufstätig, aber sie hat keine Ahnung, wie schwer es eine alleinerziehende Mutter hat. Jos linkspolitische Ansichten kann ich nicht ausstehen. Als die einzige Geschiedene bin ich hier vermutlich die Außenseiterin.
Drei Wörter, die mich beschreiben: Single, sexuell ausgehungert, Exraucherin.
Fiona (alias Fi)
Alter:42
Familienstand: Verheiratet mit Ben (62).
Kinder: Gabriel (5) und Kirsty (17), Stieftochter aus Bens erster Ehe.
Beruf: Habe mich kürzlich als Heilmasseurin qualifiziert; leite mein eigenes Geschäft »earthtouch« (kleines »e«) von zu Hause aus.
Was mich beschäftigt: Zu viel Plastik auf dem Planeten; warum Menschen, die es sich leisten können, nicht über World Vision ein Kind unterstützen – den Leuten ist nicht klar, dass wir auf dieser Erde alle in einem Boot sitzen; ich versuche, mit Schmutz und Unordnung lockerer umzugehen, die nun mal unvermeidlich sind, wenn man mit anderen Menschen zusammenlebt.
Wovon ich träume: Ein Treffen mit dem Dalai-Lama; ein dreimonatiger Schweigeaufenthalt in einem buddhistischen Kloster in Nepal, irgendwann in meinem Leben; einen zarten ökologischen Fußabdruck auf der Erde hinterlassen – weniger Elektrizität verbrauchen, weniger konsumieren, umweltbewusster leben; eine Putzfrau finden, die so gründlich ist wie ich.
Bloß nicht erwähnen: Den Krieg im Irak. John Howard und George Bush. Versteckten Schmutz.
Geheime Allianzen: Ich kenne Liz, seit ich dreizehn war – sie hat schon immer gern Leute herumkommandiert, aber sie hat ein Herz aus Gold. Sie war es, die mich ermuntert hat, meine eigene Firma zu gründen.
Drei Wörter, die mich beschreiben: Heilerin, Beschützerin des Planeten, Sauberkeits… äh … also schön, …fanatikerin.
Louise (alias Dooly – benannt nach Dr. Doolittle wegen unserer vielen Haustiere)
Alter:39
Familienstand: Verheiratet mit Max (manisch-depressiv).
Kinder: Tyler (4) und Luke (7).
Beruf: Qualifizierte Sozialarbeiterin, arbeite derzeit vier Vormittage die Woche mit Senioren.
Was mich beschäftigt: Ständige Geldsorgen – überfällige Rechnungen, die Kosten für Max’ Medikamente, steigender Zinssatz – die Kinder müssen deshalb vielleicht bald auf einige Freizeitaktivitäten verzichten, vorübergehend; natürlich dieser Zwischenfall letztes Jahr.
Wovon ich träume: Ich habe eigentlich keine Träume … Vielleicht einfach nur die Hypothek abbezahlen zu können; dass sich das alltägliche Leben leichter anfühlt; ich hätte auch nichts dagegen, zehn Kilo abzunehmen, aber das ist die geringste meiner Sorgen.
Bloß nicht erwähnen: Helens Schwangerschaft. Überfällige Impfungen der Haustiere (kann sie mir jetzt einfach nicht leisten). Diesen armen Wellensittich.
Geheime Allianzen: Tams Michael und mein Luke spielen zusammen Fußball und sind gute Freunde, deshalb sehe ich Tam öfter als die anderen.
Drei Wörter, die mich beschreiben: Fürsorglich, schokosüchtig, mehr fällt mir nicht ein.
Das Menü
Erdbeer-Daiquiris
Kanapees von Mozarellabällchen mit frischem Basilikum, sonnengetrockneten Tomaten und Kapern
Räucherlachs-Dip mit Mascarpone
Sushi (selbst gemacht)
Salat von Rote Bete, Avocado, Rucola, geröstetem Kürbis, Pinienkernen, Frühlingszwiebeln und gehobeltem Parmesan mit hausgemachtem Dressing
Thai-Curry mit Garnelen (und Koriander)
Vegetarische Lasagne (von Lily)
Pfannkuchen mit Butternusskürbis und Ricotta
Artischocken mit Balsamico-Dressing
Gefrorene Beeren mit weißer Schokoladensauce
Zabaglione
Karamell-Likör
Frische Feigen mit vier Sorten Käse und glasiertem Ingwer
Schokolade bis zum Abwinken
1Eine Handvoll ganz normaler Frauen
Was zum Teufel glaubst du, was du da tust?«, fragt Helen, als ich anfange, ein Bündel Koriander mit meiner jüngsten Neuerwerbung zu hacken – ein wunderschönes Gemüsemesser von Victorinox aus der Schweiz, scharf wie ein Skalpell, das schneidet wie ein Traum. Ich habe eine Schwäche für Messer. Das ist eines der Dinge, die du über mich wissen musst, wenn du je zum Kreis meiner engeren Freundinnen zählen willst. Meine Freundinnen würden dir erzählen, dass ich eine tolle Köchin bin, eine faule Kuh, was das Zurückrufen angeht, und dass ich einmal nackt für einen Fotografen posiert habe. Außerdem würden sie dich amüsiert in meine jüngsten Obsessionen einweihen: Robbie Williams, alles, was Amy Tan je geschrieben hat, und der Drang, dafür zu sorgen, dass alle meine Freundinnen regelmäßig einen Pap-Abstrich machen lassen. Ich bin vor ein paar Monaten knapp am Krebs vorbeigeschrammt und betrachte diese Vorsorge jetzt als heilige Mission. Gebärmutterhalskrebs ist so leicht festzustellen und zu behandeln. Und wir haben so viel, wofür es sich lohnt, zu leben: Wir alle haben kleine Kinder.
Helen hat schon drei, und jetzt ist ihre Periode überfällig – längst überfällig. Im fortgeschrittenen Alter von dreiundvierzig, wenn unsere Gebärmutter praktisch schon als Fossil gelten kann, bedeutet das entweder, dass die Wechseljahre etwas früh einsetzen, oder dass sie (wieder einmal) schwanger ist. In beiden Fällen weiß ich nicht recht, wie die angemessene Reaktion auf ihre Neuigkeiten aussehen sollte. Geheuchelte Freude? (Nicht einmal Robbie Williams in nassen Boxershorts könnte mich dazu bewegen, die letzte zermürbende Phase der Schwangerschaft und das Straflager der ersten paar Monate mit einem Neugeborenen noch einmal auf mich zu nehmen.) Aufrichtiger Neid? (Welche Frau würde nicht bis in alle Ewigkeit auf Koffein und gebratene Speisen verzichten, um noch einmal ihr eigenes, eben auf die Welt gekommenes Baby in die Arme schließen zu können?) Milde Gereiztheit? (Sind Sexualkunde und das Wissen um Verhütung nicht wie Fahrradfahren, oder braucht meine Freundin mal einen Auffrischungskurs?) Erleichterung? (Ich bedränge Frank wegen einer Vasektomie, seit im Januar meine Periode ausgeblieben ist – ein Hoch auf die »Pille Danach« … ähem … das kann wohl jedem mal passieren.) Vielleicht tut es erst mal aufrichtige Ambivalenz, zumindest für den Moment.
»Ich hacke Koriander für das Thai-Curry«, sage ich und rücke dem Bündel Blätter mit gnadenlosem Geschick zuleibe. Es flirtet mit mir, lässt sein nussiges Aroma aufsteigen, so dass mir das Wasser im Mund zusammenläuft. Ich schwöre, wenn Koriander ein Parfüm wäre, würde ich es benützen.
»Ich hasse Koriander«, sagt sie und schüttelt ihre schwarze Lockenmähne, die mal wieder gewaschen werden müsste. Aber wer hat heutzutage schon Zeit für solchen Luxus wie Körperpflege?
»Ja, darüber solltest du wirklich mal mit einem Therapeuten sprechen«, erwidere ich. »Wenn man solche Probleme zu lange mit sich herumschleppt, werden sie nur schlimmer …«
»Hab Erbarmen – ich bin schwanger«, jammert sie. »Von dem Geschmack muss ich mich schon übergeben, wenn ich keinen Braten in der Röhre habe.« Mit diesen Worten taucht sie einen Löffel in die blubbernde Kokosmilch und schlürft auf diese genießerische Art, die ich an ihr so liebe.
Eines muss man über Helen wissen: Trotz ihrer unverzeihlichen Feindseligkeit gegenüber Koriander ist sie eine großartige Köchin. Sie und mich verbindet eine fast spirituelle Liebe zum Essen. Es ist schon vorgekommen, dass sie plötzlich vor meiner Tür stand, zerzaust und verschwitzt, mit drei kreischenden Kindern im Auto, um einen kleinen Behälter mit irgendwelchen köstlichen Resten abzuliefern. »Probier mal«, mehr sagt sie nicht, bevor sie wieder in ihren Kombi steigt. Und da stehe ich dann in der Tür, stecke die Nase in eine Plastikschüssel und genieße die pure Ekstase, die drei Esslöffel indonesischen Lamm-Currys oder Hühnerleberpastete auszulösen vermögen, die sie gerade gezaubert hat. Unsere Unterhaltung dreht sich meist um zwei Themen: Essen und die Kinder. Wie man den Saft eines Brathühnchens von Fett befreit; welche Nahrungsmittel oder Haushaltsreiniger die Ursache für Camerons Ekzeme sein könnten; ob Hühnerfond den Geschmack einer indischen Linsensuppe besser zur Geltung bringt als Salz; ob Aaron auf ADHS getestet werden sollte oder bloß mal eine ordentliche Tracht Prügel braucht; das Häuschen am Wasser in der Salamander Bay für die Sommerferien, oder doch die Ferienwohnung in Batemans Bay?
Helen ist geistig stabil, vernünftig, himmlisch respektlos, und in ihrem kleinen, stämmigen Körper steckt keine einzige wichtigtuerische Ader. Fröhlichkeit – diese altmodische Eigenschaft – umgibt sie wie ein unsichtbarer Umhang. Jede meiner miesepetrigen Stimmungen, ob nun von PMS, Heimweh oder den jüngsten Greueltaten meines Sohnes hervorgerufen – verfliegt in ihrer ausgelassenen Gegenwart binnen weniger Minuten. Ich vertraue ihr alle meine Geheimnisse an, und wenn ich ein »Das darfst du aber niemandem erzählen« vorausschicke, kann ich ziemlich sicher sein, dass sie das auch schafft. Aber ich kenne Helen, und wenn sie sich doch mal verplappert, gesteht sie mir ihr Missgeschick, bevor ich es von irgendjemand anderem erfahre. Ich muss sie dann allerdings daran erinnern, dass ein Geständnis nicht automatisch mit Vergebung einhergeht. Verschwiegenheit und Ehrlichkeit sind für mich zwei verschiedene Tugenden, während sie die beiden in ihrem Kopf so unzertrennlich vermischt hat wie eine pâté aus Frischkäse und roter Paprika.
In einem Internat wäre Helen das Mädchen gewesen, das als Haussprecherin gewählt wird. Sie nimmt die Dinge in die Hand. Sie setzt neue Trends. Und sie verkörpert Fröhlichkeit durch und durch. Sie allein ist für meinen Sinneswandel in Bezug auf Austern verantwortlich. Letzten Juli, bei unserem jährlichen, einwöchigen Urlaub ohne Männer, aber mit allen Kindern, hat sie mich mit Mini-Bloody-Marys abgefüllt. Jedes Gläschen enthielt, kaum sichtbar, eines dieser ekligen Dinger, die ich anfänglich als »Schleimklumpen« verschmäht hatte. Vielleicht hat der Wodka auch geholfen, aber am Ende des Abends verzichtete ich auf die Bloody Marys und schlürfte die Schleimklumpen pur wie himmlisches Manna. Seitdem bringt mich der bloße Anblick von schwarzem Pfeffer, einer Zitrone und Tabasco-Sauce dazu, zu sabbern wie ein Pawlowscher Hund. Helen mag zwar keine Tabasco-Sauce, aber das ist einer ihrer kleineren Fehler, den ich ihr gerne verzeihe. Beim Koriander kenne ich kein Pardon.
»Ich mache einen Extra-Topf Curry für dich, aber in den großen Topf kommt Koriander«, erkläre ich mit meiner strengsten Stimme. Ich entschuldige mich nicht dafür, ich bin nun mal sehr unflexibel, wenn es um Koriander geht. In meinen gemeineren Momenten stelle ich manchmal sogar Helens Liebe zum Essen in Frage. Wie aufrichtig kann diese Liebe schon sein, wenn man Helens Abneigung gegen dieses himmlische Kraut bedenkt, das ein kulinarisches Erlebnis auf ganz neue Ebenen hebt? »Das ist, als würde man beim Sex den Oralsex weglassen«, sage ich ihr immer. »Da würde ich lieber gleich ein Buch lesen.« Dann fängt sie an zu lachen, und glaub mir, wenn du Helen einmal lachen gehört hast, dann wirst du nach immer neuen Wegen suchen, das noch einmal hervorzurufen. Es ist ansteckend und lächerlich, und wenn ich nur ihr zügelloses, brüllendes Gelächter höre, muss ich meinerseits so sehr lachen, dass ich mir manchmal ins Höschen mache.
»Was, wenn ich einen Nachschlag will?«, fragt sie, taucht den Löffel erneut ins Curry und leckt ihn ab.
»Ich bringe genug für einen Nachschlag auf die Seite«, sage ich. »Jetzt mach dich nützlich, und stell ein paar Kerzen auf. Die anderen kommen bald.«
»Du bist eine herrische Ziege«, sagt sie und zwickt mich in den Arm. »Und sei ja nicht geizig mit den Garnelen«, brummt sie, bevor sie in ihren ausgelatschten Stiefeln zum Schrank schlurft, die Teelichter herausholt, und sie im Wohnzimmer verteilt. Ambiente ist mir wichtig – es versteckt das Schlimmste und bringt das Beste zum Vorschein. Und heute Abend haben wir alle ein bisschen Unterstützung in Form von schmeichelndem Kerzenlicht verdient.
Diese Dinner-Partys oder Mädel-Abende hat Helen ins Leben gerufen. Mehr als jede andere von mütterlichen Pflichten belagerte Frau Anfang vierzig, die ich kenne, achtet Helen geradezu fanatisch darauf, auch Dinge zu tun, die ihr Spaß machen. In ihrem herrlichen, breiten Lächeln liegt eine Energie und Leidenschaft fürs Feiern, die man sonst nur bei Teenagern findet. Wie ich, schleppt auch Helen mehr Gewicht mit sich herum, als streng genommen notwendig wäre, aber sie geht damit genauso um wie mit einem quengelnden Kind – sie beachtet es einfach nicht. Während ich über meine schlaffen Arme fluche und festzustellen versuche, wie viel genau von meinem Fettbauch man zwischen den Fingern kneifen kann, versteckt sie ihre Röllchen, wie sie sie nennt, unter übergroßen T-Shirts und weiten Shorts. Es ist ihr einfach egal, wie sie aussieht. Mir hingegen ist es nicht egal, und deshalb leide ich.
Vor ein paar Monaten hat sie meinen Brautabend organisiert, am Tag vor meiner Hochzeit mit Frank, der seit acht Jahren mein Partner und der Vater meiner Kinder ist. Sie setzte sich über das besorgte Geschnatter der anderen hinweg und mietete für den ganzen Tag ein Boot, das sie dann in einem stark beanspruchten blauen Badeanzug und mit ihrem riesigen Sonnenschlapphut selbst steuerte. Sie wollte, dass ich das Steuer übernehme, als wir unter der Sydney Harbour Bridge hindurchsegelten. Und ich tat es. Sie wollte, dass wir das Boot in einer stillen Bucht vor Anker legen und köstliches Essen verzehren. Und wir taten es. Sie wollte mir für die Hochzeitsnacht das gesamte Schamhaar abrasieren. Und sie tat es. Während sie sich auf diese Tätigkeit konzentrierte, um die sie niemand beneidete, inspizierten die anderen ständig ihr Werk und riefen dazwischen: »Du hast eine Stelle vergessen!« Bedauerlicherweise trat währenddessen die Ebbe ein, und wir waren gestrandet – für die nächsten sechs Stunden. Mit Hilfe der Küstenwache und der einsetzenden Flut brauchten wir nur zwei weitere Stunden, um wieder von der Sandbank herunterzukommen. Obwohl der Bootsbesitzer, mehrere Ehemänner, ein zukünftiger Ehemann und die Wasserschutzpolizei verzweifelt versuchten, uns zu lokalisieren, ging die Sonne unter, ohne dass es zu einer einzigen Verhaftung oder Scheidung kam. Und ich habe es zu meiner Hochzeit geschafft, in einem Stück, von meinem Schamhaar mal abgesehen.
Seitdem besteht Helen auf regelmäßigen Treffen. Nach den aufregenden Ereignissen unseres »Gründungstags«, für einige von uns heute noch der größte Spaß und der schlimmste Ärger, den wir je erlebt haben, wagt es niemand, diese Zusammenkünfte zu verpassen. Diese Zeit ohne unsere Männer und Kinder ist so kostbar, dass auch kaum eine von uns zu spät kommt.
Heute ist ein besonderer Abend. Es wird eine Pyjama-Party. Eine wahrhaftige, Bring-deinen-Schlafanzug-und-deine-Zahnbürste-mit-Übernachtungsparty. So etwas habe ich nicht mehr erlebt, seit ich fünfzehn war, und ich muss zugeben, dass ich ein bisschen nervös bin. Wir feiern im prächtigen Haus von Helens Eltern auf Darling Point (sie sind für einen Monat in Italien), und obwohl die Aussicht spektakulär ist, mache ich mir Gedanken, wer wo schlafen soll (es gibt nur fünf offizielle Betten in diesem Haus, und ein paar Sofas für den Rest). Ich schlafe nicht besonders gut – sieben Jahre von Kindern gestörter Schlaf bringen das mit sich. Heute braucht es nur einen leisen Furz von Frank, und ich fahre aus dem tiefsten REM-Schlaf, sitze aufrecht im Bett und frage: »Was? Wer?« Und das war’s dann. Ich kann nicht wieder einschlafen. Frag nur mal meine Kinder: Ich bin eine böse Hexe, wenn ich müde bin.
Als ich die Mädels per E-Mail zu der Übernachtungsparty eingeladen habe, kamen lauter atemlose, mädchenhaft aufgeregte E-Mails zurück. Tam schrieb als Erste, dass sie gern kommen würde, aber wohl nicht über Nacht bleiben könne. CJ musste natürlich erst ihre Schwester bestechen, damit diese die Nacht bei ihren Kindern verbringt, weil sie keinen Mann hat, der mal für sie einspringen könnte. Dooly musste vermutlich auch irgendwo eine bezahlte Aushilfe suchen oder einen Gefallen von jemandem einfordern – Max kommt kaum mit sich selbst klar, von den Kindern ganz zu schweigen. Aber trotz geringfügiger logistischer Schwierigkeiten haben wir uns alle fest vorgenommen, heute Abend hier zu sein.
Wir sind eine Handvoll ganz normaler Frauen, eine Ansammlung mutiger, leidenschaftlicher, anbetungswürdiger, intelligenter Mütter. Ein paar von uns sind außerdem hoch neurotisch. Mindestens zwei von uns, soweit ich weiß, nehmen Prozac (aber Helen hat mich zur Geheimhaltung verpflichtet, denn Dooly hat ihr gesagt: »Es ist nicht offiziell, also sag nicht, du hättest das von mir.«) Es geschieht etwas, wenn wir uns auf diese Weise versammeln, frei von unseren Kindern und Lebenspartnern. Unsere Stimmen verändern sich. Sie werden schriller. Wir sitzen unbefangen und breitbeinig da und ziehen einander mit dem Zustand unserer Unterhosen auf. Unsere Witze – sofern man sie so bezeichnen kann – sind unsäglich schlecht; man kann gar nicht unterscheiden, ob wir, durch Helens Gelächter angesteckt, wegen der erbärmlichen Pointe lachen, oder weil der Witz so miserabel vorgetragen wurde. Wir kichern verächtlich über Penisgrößen (wenn Männer nur wüssten, wie wichtig die Größe wirklich ist). Und obwohl wir gern trinken würden, als wären wir dreiundzwanzig, kann sich keine von uns einen überflüssigen Kater leisten. Deshalb tanzen wir stattdessen, aber niemand wäre scharf darauf, diese misslungene Zurschaustellung bebender und zuckender Körperteile mit anzusehen. Und wir essen, als könnte allein die Völlerei uns alle wieder jung und sexy machen.
Die Bedeutung des Essens ist bei diesen Zusammenkünften nicht zu unterschätzen. Helen ist eine unersättliche Listenschreiberin und genießt die erregende Vorfreude bei der Planung des Essens. Nur den wahren Liebhaberinnen guten Essens unter uns wird die Aufgabe anvertraut, tatsächlich etwas zuzubereiten. Das sind Helen und ich. Die anderen müssen den Alkohol und die Schokolade heranschaffen.
Jede von uns hat ihr geheimes Laster. Helen hat unsäglich viel Geld für einen riesigen Kübel Erdbeer-Daiquiri ausgegeben und eine Sammlung von Musik mitgebracht, von der ich noch nie gehört habe – darunter, man stelle sich vor, der Soundtrack des Films Meerjungfrauen küssen besser (»Warte nur, bis du den vierten Titel hörst«, sagt sie). Ereka wird mit fünf Joints in der Handtasche kommen und im Verlauf des Abends stündlich einen davon hervorholen. Liz wird eine Flasche Rotwein mitbringen, der offiziell als Antiquität eingestuft werden müsste. Tamara wird sicher irgendeine glutenfreie Köstlichkeit dabeihaben und sich erst auf unser lautstarkes Drängen hin bereit erklären, ihr Handy auszuschalten. Wenn sie das nicht tut, wird es noch vor dem Nachtisch ein halbes Dutzend Male klingeln – Kevin ist zwar in der Lage, aus einem Stückchen der äußeren Schamlippen eine Brustwarze zu rekonstruieren, kann aber ohne die Hilfe seiner Frau keine zwei Kinder ins Bett bringen. Dooly wird auf keinen Fall ohne Schokolade erscheinen – ich tippe auf einen schweren Schokokuchen oder Mousse au chocolat. Obwohl ich das weiß, bin ich doch nie ganz gewappnet, wenn sie dann mit einem Eimer voll Schokokonfekt vor der Tür steht – buchstäblich fünf Liter Cadbury’s Favourites. Fiona wird zweifellos ihre Aromatherapie-Ausrüstung mitbringen, um uns die perfekte Mischung ätherischer Öle zuzubereiten, je nachdem, ob wir entspannt, erfrischt, beruhigt oder angeregt werden möchten. CJ wird natürlich sofort schreien, dass sie unbedingt Letzteres braucht, und uns alle dazu aufstacheln, einander die Füße zu massieren. Und sie wird Harvey dabeihaben. Er begleitet sie überallhin, und irgendwann im Lauf des Abends wird sie ihn hervorzaubern und einer von uns auf den Teller stellen, wenn diejenige gerade auf der Toilette ist. Er wird für hysterisches Gelächter sorgen und Tam womöglich zu einem verfrühten Aufbruch bewegen.
Tam kommt als Erste. Vermutlich glaubt sie, wenn sie pünktlich da ist, oder sogar etwas zu früh, wäre das ein Ausgleich dafür, dass sie später als Erste schlapp macht (da ich allerdings selbst eine ordnungsfanatische Jungfrau bin, weiß ich die Tugend der Pünktlichkeit durchaus zu schätzen). Sie trägt eine rosa Jogginghose und ein passendes rosa-weißes Sporttop. Jemand – nicht ich – sollte ihr mal sagen, dass Pfirsichrosa wirklich nicht ihre Farbe ist, bei ihrer hellen Haut und den vielen Sommersprossen. Sie ist schlank und attraktiv, aber auf eine unscheinbare Art und Weise. Sie hält nichts von Make-up, gibt aber ein kleines Vermögen – das in einem italienischen Delikatessengeschäft besser angelegt wäre – dafür aus, sich das Haar kastanienbraun färben zu lassen. Das ist doch wohl ziemlich feige, wenn man auch so aufregende Farben wie Feuerrot, Heidelbeerblau oder Karamellblond zur Auswahl hat. Aber das ist eben Tam. Sie hat die mausgraue Unauffälligkeit zur größten Tugend erhoben, was ihre äußere Erscheinung angeht.
Sie plappert wie ein Wasserfall und braucht geduldige Zuhörerinnen. Meistens geht es um ihre beiden Jungs. Wir haben alle Kinder, und dieser Abend ohne sie sollte genau das sein – eine Pause von alledem. Für Tam muss man in der richtigen Stimmung sein. Sie ist nicht gerade entspannende Gesellschaft, aber in einer großen Gruppe wie heute Abend wird sie sich zurücknehmen. Oder wir füllen sie einfach ab. Ein Daiquiri dürfte reichen.
Sie kommt mit einer grünen Jute-Einkaufstasche herein. »Na, ist das nicht toll?«, bemerkt sie mit einer Begeisterung, die nicht einmal dem mildesten Kreuzverhör standhalten könnte. »Längst überfällig, dass wir mal wieder zusammenkommen«, zwitschert sie. »Ich kann nur leider nicht allzu lang bleiben. Morgen muss ich früh raus. Kieran hat ein Schachturnier – neulich haben sie ihn in eine höhere Gruppe versetzt, zu den Kindern bis zehn. Einige Mütter der Kinder in seiner Altersgruppe haben sich beklagt, dass ihre Kinder jegliches Selbstvertrauen verlieren, weil er sie immer in drei Zügen schlägt.«
Helen und ich ziehen die Brauen in die Höhe. »Beeindruckend«, sagt Helen. »Ein richtiges kleines Genie, dein Kieran.«
Tam lächelt. »Ich will nur, dass er glücklich ist«, sagt sie und betont das Wort »glücklich«, als sei es erst kürzlich in unsere Sprache aufgenommen worden, und sie wolle mal ausprobieren, wie es klingt. »Überflieger sind selten glücklich.«
Ich würde ihr gern sagen, dass da nichts weiter dabei ist – lass dem armen Kind ein bisschen Raum zum Atmen, und es wird sehr glücklich sein. Sie holt eine parfümfreie Handcreme aus ihrer Tasche und drückt etwas davon auf ihren linken Handrücken, bevor sie Helen und mir die Tube anbietet. Wir lehnen beide ab.
»Ach, ich weiß nicht«, sage ich. »Ich hatte immer den Eindruck, dass Einstein und Goethe ganz glückliche Menschen waren.«
»Ja, aber hatten sie Freunde?« Tam sieht uns mit großen Augen an, zieht ihren Ehering ab und massiert die Creme in ihre gepflegten Hände – kurze Nägel, kein weiterer Schmuck.
»Genien brauchen keine Freunde. Sie sind genug mit dem beschäftigt, was in ihrem Kopf vorgeht«, sagte Helen und holt Besteck aus der obersten Schublade.
»Genies«, korrigiere ich sie, »du Genie.«
»Schon klar«, schnaubt sie. »Nicht alle von uns können so schlau sein. Manche müssen sich eben mit ihrer Schönheit zufriedengeben.« Sie zwinkert Tam zu. Tam lacht sogar leise, während sie ihren Ehering wieder an den Ringfinger steckt.
»Wie viele sind wir eigentlich?«, fragt Helen mich.
»Acht, dich eingeschlossen«, sage ich. Sie reicht mir eine Handvoll Messer und Gabeln.
Aus Tams Einkaufstasche kommen drei Dips zum Vorschein, einer mit Auberginen (ah, die Königin aller Gemüse), einer mit Oliven und Tomaten, und ein Töpfchen Zaziki. Alle drei sind Knoblauchbomben. In seltenen Augenblicken müßiger Reflektion habe ich mich manchmal gefragt, ob die sinnlichen Freuden des Lebens nicht exponentiell verringert würden ohne diese prächtige kleine Knolle in ihren gedrängten Nestern, geschmückt mit fedrigen weißen Hüllen. Knoblauch. Es gibt tatsächlich drei grundlegende Zutaten der wirklich guten Küche. Helen und ich sind uns nur über zwei davon uneins. Bei Knoblauch sind wir uns einig. Für mich bildet er mit Chili und Zitrone die Heilige Dreifaltigkeit, Helen zählt Ingwer und Basilikum dazu. Das ist eine ständige Quelle unterschwelliger Spannung in unserer Freundschaft.
Tam hat außerdem ein Paket Tiefkühl-Beeren und einen Block weiße Schokolade mitgebracht. »Für die weiße Schokoladensauce, die über die Beeren gegossen wird«, sagt sie. Das hat sie nur als Geschenk für uns mitgebracht, denn sie wird selbstverständlich nichts davon essen – zu viel Fett. Zu viel Zucker. Zu viel Spaß am Leben, wenn du mich fragst.
Tam verkörpert die fragwürdige Güte mütterlicher Selbstlosigkeit, die eine übertriebene persönliche Erfüllung darin findet, nur vom Rand aus zuzusehen. Es kann einem davon schlecht werden. Ich gehöre nicht zu diesen Müttern, die nur durch ihre Kinder leben. Sieben Jahre in der erbarmungslosen Sonne der endlosen Wüste »Gebe!« als Mutter haben mich spröde gebacken. Wenn Tams Gehirn auch nur für fünf Minuten aufhören würde, alles zu überprüfen, würde der pure Spaß sie umbringen.
»O Gott …« Helen schnappt nach Luft bei der Vorstellung von eisigen kleinen Beerenkieseln, angeschmolzen, aber nur ganz leicht, von der heißen, süßen, weißen Schokosauce.
»Von Schokolade bekommt man Pickel«, sage ich zu Helen mit einem Blick auf den kleinen roten Vulkan an ihrem Kinn, der demnächst ausbrechen dürfte.
»Tatsächlich?«, erwidert sie. »Vielen Dank, dass du mich darauf aufmerksam machst. Und ich nehme an, in diesem Top sehe ich dick aus …« Dann sagt sie zu Tam: »Ich mache gern die Sauce«, als es gerade wieder klingelt. »Machst du auf?«, bittet sie mich.
»Gerne«, sage ich. Ich lasse Tam und Helen in der Küche zurück, wo sie über das Dessert diskutieren, und überlasse es Helen, die hundert Fragen darüber zu beantworten, welche Speisen des heutigen Abends Gluten enthalten, oder mögliche Spuren von Gluten enthalten könnten.
Gluten. Die Geißel der Menschheit. Wenn man Tam ein paar Drinks einflößt, da bin ich sicher, könnte man sie dazu bringen, Gluten für alles Mögliche die Schuld zu geben, von der Klimaerwärmung bis hin zum Rassismus. Ich wünschte, ich könnte mit derselben Gewissheit »das eine« Element im Leben finden, das alles schiefgehen lässt – und wenn man es eliminiert hätte, würden sich sofort Harmonie und Gleichgewicht einstellen. Tams Überzeugung hat mich früher ganz aus der Fassung gebracht. Nach jeder Unterhaltung mit ihr war ich zutiefst verunsichert über die Art, wie ich meine Kinder großziehe. Es ist ja nicht so, als würde sie diese Bandwürmer der Angst absichtlich in meinen Bauch einschleusen, sie kann einfach nicht anders. Helen und ich sind zu der Erkenntnis gelangt, dass Tam eine Welt braucht, die aus Ursache und Wirkung besteht. Wo Erklärungen überall unter der Oberfläche treiben wie unsichtbare, aber lebensrettende Planken, die sich jeder angeln kann, wenn er sich nur genug Mühe gibt. Und Mühe gibt sie sich, sie liest und recherchiert mit unendlicher Geduld, bis sie die Lösung oder das Heilmittel am Haken hat.
Tam hat aus ihren Kindern praktisch einen Beruf gemacht. Sie ist zwar ausgebildete Heilpädagogin (und war eine verdammt gute, nach allem, was man so hört), hat jetzt aber einen erbärmlichen, unbedeutenden Job als Büroangestellte bei einer kleinen Buchhaltungssoftware-Firma in der Stadt. Sie gibt bereitwillig zu, dass ihre Arbeit langweilig ist und sie nur ein Minimum ihrer Gehirnkapazität dabei einsetzen kann, aber die Arbeitszeiten sind ja so praktisch – sie kann die Kinder zur Schule fahren und abholen. Ganz ohne Stress. Und über diese Stunden im Büro hinaus verlangt ihr der Job keinerlei Zeit oder Energie ab. Das ist auch besser so, denn das meiste davon geht beim Naturheilpraktiker, der Kinesiologin und all den anderen alternativen Ärzten drauf, deren Praxen sie tatkräftig unterstützt, indem sie sie wegen allem aufsucht, von einem schlechten Traum bis hin zu einer ausgewachsenen Lungenentzündung. Wir übrigen halten uns einfach sorgfältig an den Impfplan, den man vom Kinderarzt bekommt, und knallen unseren Kindern Antibiotika rein, wenn der Arzt sie verordnet. Nicht so Tam. Es ist faszinierend, wie vielfältig sich mangelndes Vertrauen in andere Menschen äußert – Tam glaubt niemandem einfach so, und wenn er vier akademische Titel vor dem Namen stehen hat. Sie erforscht jedes Thema, auf das sie als Mutter stößt, selbst, und bildet sich dann eine eigene Meinung. Dafür gebührt ihr wirklich Hochachtung. Ich hingegen bin einfach nur müde dankbar, wenn jemand im weißen Kittel mir sagt, was »in diesem Fall das Richtige« ist. Ich will es nur irgendwie erledigt haben. Es auch noch unbedingt richtig machen zu wollen, ist etwas für Leute, die sonst nichts zu tun haben.
An manchen Tagen, wenn mir das Muttersein einfach zu schwer vorkommt, tröste ich mich damit, dass ich schließlich Anfängerin bin. Ich wurde in diesen Job hineingeworfen, ohne Ausbildung, Seminare oder eine einzige bestandene Prüfung. Ich habe kein Mutterschaftsdiplom. Wenn man daran denkt, wie gründlich potenzielle Adoptiveltern unter die Lupe genommen werden – alles, von ihren Körperpflege-gewohnheiten bis hin zu ihren Ansichten über körperliche Züchtigung, kann dem Okay der Behörden im Wege stehen –, kommen diejenigen von uns, die unbekümmert vom Petting zur Dilatation des Geburtskanals voranschlendern, noch geradezu leicht davon. Ich bin nicht dafür, künftige Eltern einem verpflichtenden Test zu unterziehen. Auf der anderen Seite kann man kaum leugnen, dass einige von uns viel zu neurotisch und kaputt sind, um sich vermehren zu dürfen. Manche von uns bekommen ja kaum das eigene Leben auf die Reihe, von Verantwortung für andere Menschen ganz zu schweigen.
Tam jedoch hat zweifellos ihr Diplom als Mutter erworben und sich zudem auf richtige Ernährung, Immunisierung, Erziehung und Sozialisation spezialisiert. Ständig steckt sie die Nase in ein Buch, forscht in der Bibliothek oder im Internet, durchkämmt alles nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und hat es geschafft, das Mäntelchen der Mutterschaft zu einem wahren Prachtgewand in Technicolor auszuschmücken. Ungefragt hält sie Vorträge über die jüngsten Theorien zu Disziplin, Sensibilität, emotionalem Wohlergehen, Gehirnentwicklung, ADHS, kindlichem Übergewicht und der Frage, wie man effektiv Grenzen setzt.
Ich höre ihr immer zu, obwohl sich mir innerlich bei diesem leicht überheblichen Tonfall, den sie dann anschlägt, die Haare sträuben. Wenn man ihren Vortrag in seine semantischen Bestandteile zerlegen würde, käme dabei heraus, dass sie uns für einen Haufen Versager hält, was die bestmögliche Förderung unserer Kinder angeht. Unserer Art der Kindererziehung – geistesabwesend, zwischen Tür und Angel, immer nur reagierend – begegnet sie stets mit leiser Kritik. In meinen persönlich weniger gereiften Momenten denke ich mir dann aber: »Hey, ich füttere meine Kinder vielleicht mit Zeug von McDonald’s und werde manchmal laut, aber wer von uns hat hier einen Bettnässer zu Hause? Hm? Ich nicht.«
Anscheinend kommt es recht häufig vor, dass Jungen mit sieben Jahren nachts noch ins Bett pieseln. Behauptet jedenfalls die Forschung. Aber Helens Ansicht nach ist Michael ein »regressives Muttersöhnchen, das am liebsten noch gewickelt werden möchte«. Da er durch seine Bettnässerei so viel Aufmerksamkeit bekommt, hat er es auch bestimmt nicht eilig, damit aufzuhören. Tam hat dieses arme Kind zur Musiktherapie, zur Kinesiologie und Craniosacraltherapie geschleift und ihn sogar zur Akupunktur überredet, »indem ich ihm die positive Wirkung erklärt und natürlich seine Ängste beschwichtigt und ihm eine Belohnung versprochen habe«. Wenn er vorher keinen Grund hatte, sich in die Hose zu machen, dann hat er jetzt ganz sicher einen.
Tams Söhne Kieran und Michael sind, oberflächlich betrachtet, geradezu Anne-Geddes-Engel. Meine Kinder kreischen und jammern, ihre hören still zu. Meine beschimpfen sich (und manchmal auch mich) als Blödmann und Arschgesicht, ihre sagen »Vielen Dank für die Einladung« und »Darf ich aufstehen?«, wenn sie den Tisch verlassen. Meine rümpfen die Nase, wenn sie irgendetwas pflanzlich Anmutendes auf dem Teller entdecken, ihre essen brav ihren Brokkoli auf und bitten sogar noch um einen Nachschlag. Kieran und Michael verstehen unter »etwas zu Naschen« Reiscracker mit Aufstrich. Bio-Erdbeeren mit Naturjoghurt. Selleriestangen mit Hummus. Während ich meinen Kindern lebenslängliches Fernsehverbot androhen muss, damit sie ihren Schwimmkurs machen, ohne der Lehrerin Wasser ins Gesicht zu spucken, absolvieren ihre einen vollen Terminplan mit Cricket, Fußball, Judo und Taekwondo – alles völlig freiwillig, versteht sich.
Das sind die langweiligsten Kinder, die ich kenne – das heißt, solange Tam in der Nähe ist. Einmal hatte ich ihre Kinder bei mir zu Hause, während Tam bei einer Elternsprechstunde war. Sie haben meinen Lutschervorrat geplündert, und Kieran hat Aarons Schmetterlingsnetz kaputt gemacht und dabei vor befriedigter Schadenfreude so über das ganze Gesicht gestrahlt, dass ich nicht wusste, wie ich es Tam sagen sollte. Ich würde wetten, dass die beiden mit sechzehn zu Adrenalinjunkies mutieren, sobald das Testosteron die Ketten von Tams eifriger Überwachung sprengt. Nur im Fall, dass Tam nicht irgendeine Studie entdeckt, die beweist, dass ein Extra-Löffel Sonnenblumenkerne im morgendlichen Müsli das Einsetzen der Teenager-Rebellion wirksam hinauszögert.
Tam spricht mit ruhiger, beherrschter Stimme mit ihren Söhnen und achtet sehr darauf, sie gleichzubehandeln. Grade so, als wären beide sehr begabt. Aber nur Kieran ist (nachdem Tam ihn auf glutenfreie Ernährung umgestellt hat) als »hochbegabt« eingestuft worden, von welchem Gremium auch immer solche Einschätzungen getroffen werden. Seitdem, Gott steh uns bei, widmet sich Tam in jeder wachen Sekunde der Mission, »sein Entwicklungspotenzial zu maximieren«. Er darf sich im Unterricht niemals langweilen. Jegliches gereizte oder unpassende Verhalten ist ein Alarmsignal und bedeutet, dass er unterfordert sein muss.
Tam fängt jeden Tag nach der Schule seine Lehrerin ab, die arme Ms. Kramer. (Sie ist ungefähr zwanzig Jahre alt, und ihr Pädagogendiplom wird vermutlich gerade noch gerahmt.) Tam verlangt von ihr eine kurze Zusammenfassung von Kierans Schultag und ist schrecklich besorgt, wenn ihr Sohn »ruhig« war, »ein bisschen überdreht« oder »verschlossen«. Zur Abholzeit erscheint Tam gerüstet mit einem Stapel kopierter Artikel über hochbegabte Kinder, die Ms. Kramer lesen soll – Ms. Kramer versenkt sie wahrscheinlich auf dem Weg zum Parkplatz im nächsten Mülleimer. Doch sie lächelt tapfer weiter und hat offenbar trotz ihrer Jugend Mitleid mit Müttern, die das Bedürfnis haben, immer noch die treibende Kraft im Leben ihrer Kinder zu sein.
Helen und ich winden uns innerlich, aber Tam lässt sich von unserer kritischen Beurteilung nicht so leicht unterkriegen. Wenn es um ihre Jungs geht, zeigt sie angesichts unseres unzureichend unterdrückten Spotts erstaunlichen Mut. CJ hat einmal hinter ihrem Rücken gesagt: »Ich finde es gut, dass sie Stellung bezieht und sich so für ihre Kinder einsetzt.« Doch darauf folgte sofort: »Aber sie sollte es wirklich lockerer angehen und Kieran zur Abwechslung mal ein ganz normales Kind sein lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm das schaden würde.«
»Wer weiß, vielleicht entwickelt er dann sogar so etwas wie eine eigene Persönlichkeit?«, fügte ich hinzu. Aber bitte, mein Urteil ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich bin keine weise Seherin, was Kindererziehung betrifft. Ich habe gerade erst damit angefangen, schlecht informiert und unvorbereitet. Für mich nimmt Mutterschaft oft die Dimension einer endlosen Autobahn an, die sich bis weit hinter den sichtbaren Horizont erstreckt. Ohne irgendwelche Straßenschilder, die mir sagen könnten, wie weit ich schon gekommen bin oder wie viel ich noch vor mir habe. Ich kann mir nicht einmal sicher sein, dass ich genug Treibstoff habe, um die Strecke zu bewältigen, vor allem, weil ich keine Ahnung habe, wo ich eigentlich hinfahre. Ich fahre einfach nur. Wenn ich angekommen bin, werde ich es wohl merken. Inzwischen glaube ich, dass wir alle zwar die besten Absichten haben, aber dennoch alle so ziemlich auf demselben Weg sind und unseren Kindern schweren psychologischen Schaden zufügen. Sobald man diese Tatsache einfach akzeptiert, fühlt man eine ungeheure Erleichterung – fast wie bei Valium. Nicht, dass ich wüsste, wie sich Valium anfühlt.
Wenn es irgendeine von uns schafft, diese Einbahnstraße zum elterlichen Versagen zu umgehen, dann wird es Tam sein. Und ich will fair sein, sie verdient diesen Erfolg. Sie ist das kleine rote Huhn unter uns, das fragt: »Wer kommt mit zu einem Vortrag vom Ministerium für Sport und Freizeit über aktive Kinder?« »Ich nicht!«, sage ich. »Ich nicht!«, sagt Helen. »Dann gehe ich eben allein.« Und schon trabt sie mit ihrem Notizbuch los. Wenn sie zurückkommt, ist sie stets bis an die Zähne mit neuen Theorien bewaffnet: Fernsehen verursacht das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Impfungen verursachen Autismus. Zucker verursacht Hyperaktivität. Und Gluten ist einfach an allem schuld, von Depressionen bis zur Schizophrenie. Aber anscheinend ist es gerade fürs Bettnässen nicht verantwortlich.
Helen und ich haben früher unter vier Augen gewitzelt, dass Tams Mann Kevin, einer der besten plastischen Chirurgen in Sydney, der fickenswerteste aller unserer Männer sei. Er hat diesen mageren, hungrigen Sexappeal und verströmt die Arroganz von Männern, die an den Gesichtszügen von Frauen herumwerkeln und Details ausschneiden oder einsetzen, wie andere es in einem unordentlichen Word-Dokument machen. Er spricht von sich selbst in der dritten Person als »Der Doktor«, hörbar groß geschrieben – ich meine, kann man so einen Kerl überhaupt ernst nehmen? Die Tatsache, dass man sechs Monate im Voraus einen Termin vereinbaren muss, um auf seine Operationsliste für Brustimplantate oder Liftings zu kommen, fördert bei ihm wohl die Einbildung, er sei Gottes Gabe an die Frauen. Einmal hat er mich angebaggert. Zugegeben, er war betrunken und ich habe, ganz harmlos, ein bisschen mit ihm geflirtet. Aber ich hätte mich beinahe an meinem Wodka verschluckt, als er sich vorbeugte und mir ins Ohr flüsterte: »Der Doktor würde deine Brüste ganz umsonst untersuchen.« Kevin ist sexy, wenn man auf das Gefühl steht, als Beute gejagt zu werden. Aber wenn der Ehemann einer Freundin in deren Hörweite versucht, dich anzumachen, wird es höchste Zeit, sich ein anderes Ziel für den Cocktailparty-Flirt auszusuchen. Ich will auf keinen Fall, dass Tam denkt, ich stehe auf ihren Mann. Denn das tue ich nicht. Ich mag zwar selber gelegentlich Phantasien von anderen Männern haben – das ist völlig normal, oder? –, aber ich würde sie nie in die Wirklichkeit umsetzen. Ich habe Helen von der Anmache erzählt. Wir waren uns einig, dass er ein Fiesling ist. Trotzdem machen wir keine Witze mehr über Kevin. Nicht, seit Tam vor zwei Jahren diesen (inoffiziellen) Nervenzusammenbruch hatte. Helen zufolge ging das Gerücht um, dass Kevin sie betrügt. Wer weiß? Vielleicht hat er das, aber es spielt keine Rolle. Tam jedenfalls war fix und fertig.
Seitdem nimmt sie Prozac und hat viel abgenommen. Ereka witzelt immer, dass sie es auch mal damit versuchen sollte – sie kämpft gegen überflüssige Pfunde im Wert von sechs Neugeborenen. Aber sie wird kein Prozac nehmen. Sie ist entschlossen, sich dem Leben in seiner ganzen scheußlichen Realität zu stellen und ihren Frieden damit zu machen. Tam, die sonst immer so gegen Medikamente wettert, sieht den scheinheiligen Widerspruch nicht einmal. Das gehört alles zu ihrer altruistischen Rolle – sie wirft die Pillen ja nur ein, weil sie dadurch zu einer besseren Mutter wird. Das Motto ihrer Erziehung im Pfadfinderinnen-Stil lautet, »für ihre Jungs da zu sein«.
Ich erreiche die Haustür, als es zum zweiten Mal klingelt. »Ich komme schon«, sage ich und kichere beim Gedanken daran, was mir als Motto für Helens und meine Art des Mutterseins einfallen würde: »Mami geht jetzt, seid brav.«
2Der Klettstreifen der Mutterschaft
Vor der Tür steht Liz. Sie sieht müde, aber glamourös aus. »Wie geht es dir?«, fragt sie und küsst mich auf die Wange, ohne meine Antwort abzuwarten. Sie hält eine riesige vegetarische Lasagne in den Händen. Hausgemacht, aber nicht von ihr. Unter ihrem Arm klemmt eine Flasche Rotwein. »Umwerfender Jahrgang«, sagt sie beiläufig und deutet mir an, ihr die Flasche abzunehmen. Liz zieht einen schicken, kleinen braunen Koffer auf Rädern hinter sich her. Sie stolziert in einem veritablen Outfit herein: Keine Trainingshose, keine Jeans, sondern ein Hosenanzug aus klassischem Seidenchiffon, der an mir »Grau« wäre, an ihr jedoch »Anthrazit« ist. Um ihren Hals baumelt eine teure Kette aus Perlen in Hellrosa, Pfauenblau und Schneeweiß. Ich war zuletzt schick angezogen, als der Sohn einer Verwandten vor einem Jahr seine Bar-Mizwa feierte. Liz kleidet sich immer, als rechne sie damit, dass die Paparazzi jeden Moment auftauchen könnten. Neben ihr komme ich mir in Jeans und Pulli ziemlich schäbig vor.
Liz ist die Karrierefrau unter uns – eine Anomalie in dieser Gruppe von Vollzeit- oder zumindest Teilzeit-Müttern. Während wir uns mit dem Lebenszweck zufriedengeben müssen, erfolgreich unseren Haushalt zu leiten, leitet Liz ihre eigene Werbeagentur. Leute nennen sie »Chefin«, sie heuert und feuert. Sie ist eine der klügsten Frauen, die ich kenne. Sie und Fiona sind seit ihrer Kindheit befreundet, und Liz wird hauptsächlich Fi zuliebe zu diesen Zusammenkünften eingeladen. Ich bin immer wieder überrascht, wenn Liz dann tatsächlich auftaucht – eine so wichtige Geschäftsfrau wie sie findet unsere Gespräche doch wahrscheinlich so spannend wie ein Mensch-ärgere-dich-nicht-Turnier. Aber interessanterweise kommt Liz sogar sehr oft, außer sie ist geschäftlich verreist. Und sie ist eigentlich eine angenehme Person, wenn auch ein bisschen rechthaberisch. Ich respektiere ihre Meinung zu so ziemlich jedem Thema, sei es der Stand des Aktienmarktes oder die Frage, ob es tatsächlich die Presse ist, die Prinzessin Diana auf dem Gewissen hat. Kindererziehung ist das einzige Thema, bei dem ich mich ihren knallharten Urteilen nicht anschließe. »Jonglieren, um Kinder und Beruf zu vereinbaren?«, hat sie einmal zu mir gesagt. »Nur Clowns jonglieren. Willst du der Clown sein, oder die Zirkusdirektorin? Das ist ganz einfach – wenn du Karriere machen willst, mach Karriere. Wenn du außerdem Mutter sein willst, such dir jemanden, der den Job für dich macht.«
Liz hat uns erzählt, dass sie nur deshalb Kinder bekommen hat, weil Carl welche wollte – vermutlich die einzige Ausnahme in ihrer sonst so makellos egozentrischen Existenz. Ich habe selbst gehört, wie sie den Mutterinstinkt als »frauenfeindliche Propaganda, durch den die Frauen ans Haus gefesselt werden sollen« bezeichnet hat. Sie behandelt ihre Kinder Chloe und Brandon wie mürrische Angestellte, die gemanagt und geführt werden müssen. Sie verlangt von ihnen, einen minimalen Kodex von Verhaltensregeln zu befolgen, den sie ausgedruckt, laminiert und innen an der Badezimmertür befestigt hat. Als Mutter hält sie sich an das in der Geschäftswelt erprobte Prinzip, dass zu große Vertrautheit nur Verachtung erzeugt. Ihre Kinder haben die Botschaft verstanden (sie sind schließlich nicht zurückgeblieben): Sei unabhängig. Chloe und Brandon können sich selbst etwas zu essen machen, sich anziehen, sich beschäftigen und auch allein schlafen legen, wenn es nötig ist. Aber Liz hat eine besondere Versicherung.
Wie die heißt? Ein Wort, vier wunderschöne Buchstaben: Lily. Lily ist aus Korea und hat ein Herz (und einen Bauch) so groß wie ein Wal. Alle Kinder blühen in ihrer Gegenwart auf, obwohl sie gebrochen Englisch spricht und man sie manchmal nicht ganz versteht – bietet sie einem gerade »Tee« an, oder fragt sie, ob einem der große »Zeh« wehtut? Ich habe Lily einmal gefragt, ob sie selbst Kinder hat. Und musste mich dann abwenden, damit sie die Tränen in meinen Augen nicht sieht, als sie mir erzählte, dass sie zwei Kinder mit fünf und sieben Jahren in Korea hat (»schöne, schöne Babys – meine«), um die sich ihre Mutter kümmert. Lilys Mann hat sich während der zweiten Schwangerschaft aus dem Staub gemacht, und sie musste ihre drei Monate alte Tochter und den zweijährigen Sohn zurücklassen, um nach Australien zu gehen und Geld zu verdienen, das sie nach Hause schickt. Seitdem hat sie ihre Kinder nicht mehr gesehen. Als sie mir das erzählte, zog sie stolz das zerknitterte Foto eines Neugeborenen aus ihrer Brusttasche. »Sehen Sie, aber sie schon groß jetzt.« In diesem Moment habe ich Liz verabscheut.
Lily wohnt bei Liz und Carl, weil deren Lifestyle das erforderlich macht. Sie steht ihnen vierundzwanzig Stunden am Tag zur Verfügung. Helen hat mir allerdings erzählt, dass Liz sie sehr gut bezahlt. Liz hat darauf bestanden, dass Lily das Autofahren lernt, hat ihre Fahrstunden und die Prüfung bezahlt, und dann noch einmal, weil Lily in der Führerscheinprüfung durchgefallen ist, und als Lily beim vierten Versuch endlich bestanden hat, hat Liz einen nagelneuen Drittwagen gekauft, mit Airbags und sämtlichen anderen Sicherheitsvorrichtungen, die man sich vorstellen kann. Jetzt fährt Lily die Kinder zu all ihren außerschulischen Aktivitäten: Cricket, Ballett, Musikstunden, Schach und Schwimmen. Ich vermute, dass nicht der gesamte Lohn heim nach Korea fließt – einmal habe ich Lily mit einer Louis-Vuitton-Handtasche gesehen, aber vielleicht war das eine abgelegte von Liz. Lily hängt mit einer blinden Loyalität an Liz, auf die schmeichlerische Art von Sklaven, die glauben, dass sie ihrem Herrn alles verdanken und ihm die Sonne aus dem Arsch scheint. Das könnte sogar stimmen. Liz ist einer dieser beneidenswerten, super-erfolgreichen Menschen, die alles haben. Aber bei ihr möchte ich nicht Kind sein.
Liz arbeitet wie besessen. Meistens kommt sie so spät von der Arbeit nach Hause, dass sie ihre Kinder nicht mehr sieht, zumindest nicht wach. Aber Carl springt für Liz ein, und Lily springt für alle beide ein. Liz lässt keinen Zweifel daran, dass ihre erfolgreiche Karriere der Dreh- und Angelpunkt für ihr Wohlbefinden und ihr Selbstverständnis ist. »Ich lebe meiner Tochter vor, was eine Frau alles erreichen kann«, sagt sie. Helen und ich wetten oft scherzhaft, dass Chloe höchstwahrscheinlich mit achtzehn heiraten, sechs Kinder bekommen und Hausfrau und Mutter werden wird. Ich bin überzeugt davon, dass Kinder unsere tiefste Unsicherheit aufnehmen und in Treibstoff für die gnadenlose Rache umwandeln, die sie früher oder später an uns üben werden. Liz wird eine unschöne Überraschung erleben, wenn die Endabrechnung ihrer Elternschaft keinen nennenswerten Ertrag bringt, wie bei einer Bilanz, für die man einen Bonus bekommen kann. Doch man muss Liz zugutehalten, dass sie brutal ehrlich ist. Die meisten von uns sind zu sehr mit Windelwechseln beschäftigt, als dass wir uns einer eigenen Karriere widmen würden. Schon gar nicht mit solch einer Energie, wie sie es tut – Liz könnte damit eine Mondrakete abheben lassen. Aber sie sagt immer: »Ich habe zehn Jahre meines Lebens darauf verwendet, mein Unternehmen aufzubauen und mir meinen Platz in der Welt zu schaffen, und darauf bin ich stolz. Ich wollte, dass auch Kinder zu meinem Leben gehören, aber ich war nicht bereit, alles aufzugeben, um Mutter zu sein. Die Kinder müssen sich meinem Leben anpassen, nicht umgekehrt.«