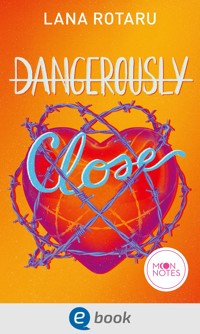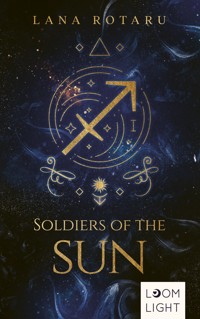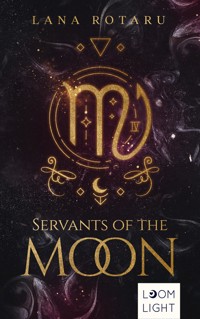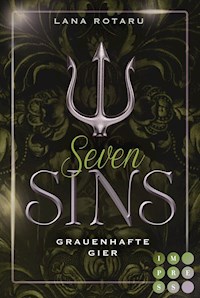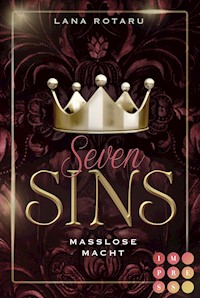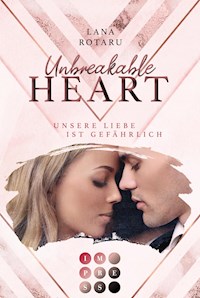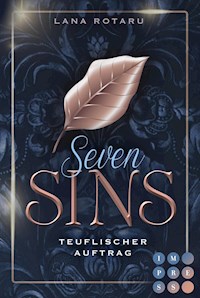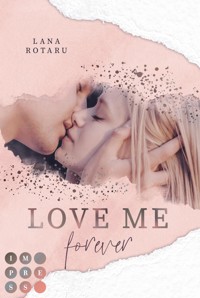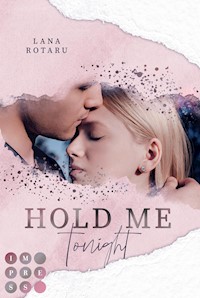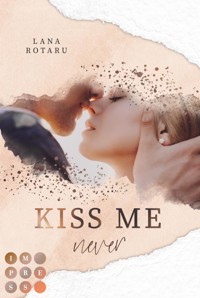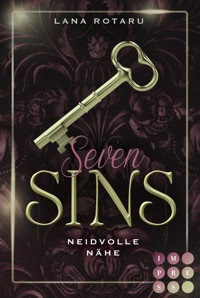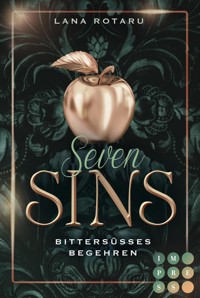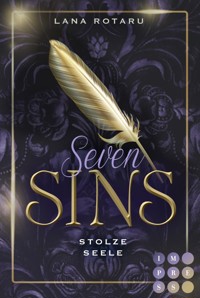5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
**Ein Weihnachtsmann zum Verlieben** Cathy hasst die Adventszeit. Alles daran. Das Wetter, die künstliche Fröhlichkeit und allem voran den Zwang, Geschenke für Leute kaufen zu müssen, die sie nicht leiden kann. Diese Einstellung ändert sich auch nicht, als sie Nick Claus kennenlernt, der von sich selbst behauptet, der Sohn des Weihnachtsmanns zu sein. Sie ist sich sicher, der Typ muss verrückt sein. Doch obwohl sie sich die größte Mühe gibt, ihm aus dem Weg zu gehen, gelingt es Nick immer wieder, sich in Cathys Leben zu schleichen. Und sie muss sich eingestehen, dass sie an seiner Seite immer wieder Momente erlebt, für die sie keine anderen Worte findet als »einfach magisch«. Aber trotzdem: Den Weihnachtsmann kann es nicht geben … oder doch?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Lana Rotaru
Weihnachtswunder von Manhatten
**Ein Weihnachtsmann zum Verlieben** Cathy hasst die Adventszeit. Alles daran. Das Wetter, die künstliche Fröhlichkeit und allem voran den Zwang, Geschenke für Leute kaufen zu müssen, die sie nicht leiden kann. Diese Einstellung ändert sich auch nicht, als sie Nick Claus kennenlernt, der von sich selbst behauptet, der Sohn des Weihnachtsmanns zu sein. Sie ist sich sicher, der Typ muss verrückt sein. Doch obwohl sie sich die größte Mühe gibt, ihm aus dem Weg zu gehen, gelingt es Nick immer wieder, sich in Cathys Leben zu schleichen. Und sie muss sich eingestehen, dass sie an seiner Seite immer wieder Momente erlebt, für die sie keine anderen Worte findet als »einfach magisch«. Aber trotzdem: Den Weihnachtsmann kann es nicht geben … oder doch?
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Danksagung
Das könnte dir auch gefallen
© privat
Lana Rotaru lebt zur Zeit mit ihrem Ehemann in Aachen. Der Lesewahnsinn begann bei ihr bereits in früher Jugend, die sie Stunde um Stunde in einer öffentlichen Leihbibliothek verbrachte. Nun füllen Hunderte von Büchern und E-Books ihre Wohnzimmer- und E-Reader-Regale und ein Ende ist nicht in Sicht. Eine Lesepause legt sie nur ein, wenn sie gerade selbst an einem neuen Roman schreibt.
Für meinen Sohn, der mich durch die Suche nach seinem Namen zu dieser Geschichte inspiriert hat.
Prolog
Acht Wochen bis Heiligabend
Es gibt Begegnungen, die können dein Leben für immer verändern. Klar, auf die meisten trifft das nicht zu, vor allem wenn diese Begegnungen im Supermarkt an der Kasse stattfinden, im Central Park, den man auf dem Weg zur Arbeit durchquert, oder in der Pizzeria, in der man nach der Schule jobbt.
Aber es gibt auch jene Art von Begegnungen, die einen unglaublichen Einfluss auf dein Leben haben, und das obwohl du dich mit Händen und Füßen dagegen wehrst.
Genau von so einer Begegnung handelt diese Geschichte.
***
»Hallo, ich heiße Cathy und bin heute Abend deine Kellnerin.« Ich wusste nicht, wie oft ich diesen Satz inzwischen aufgesagt hatte, aber es musste eindeutig zu oft gewesen sein, denn in meinen Ohren klang er eher so: »Beeil dich mit deiner Bestellung, ich habe noch andere Kunden und will pünktlich Feierabend machen!« Ich konnte nur hoffen, dass das künstliche Lächeln, das standardmäßig zu meiner Kellneruniform gehörte und daher automatisch in meinem Gesicht haftete, über meine fehlende Motivation hinwegtäuschte.
Mein Gast, ein junger Typ mit hellblonden, ja beinah weiß-silbrigen Haaren, saß an einem der heiß begehrten Fenstertische und sah mich aus dunkelblauen Augen an. Dabei lächelte er, als würde er für das Cover eines Hochglanzmagazins posieren und nicht in einer kleinen Pizzeria am Rockefeller Center sitzen.
»Hallo Cathy, ich bin Nick. Freut mich dich kennenzulernen.« Passend zu seinem Äußeren klang auch seine Stimme sympathisch.
Ätzend.
Seine Worte hatten mich derart überrumpelt, dass ich, anstatt wie geplant mit den Augen zu rollen, mein Gegenüber nur mit leicht geöffnetem Mund anstarren konnte. Okay, diese Reaktion mochte vielleicht etwas übertrieben erscheinen, aber dieser Typ hier war der erste Gast, der sich nicht nur meinen Namen gemerkt, sondern sich auch noch selbst vorgestellt hatte. Das war als säße ein pink-glitzerndes Einhorn vor mir. Man hörte zwar immer wieder von solchen Gästen, aber man glaubte nicht daran, selbst einem zu begegnen. Besonders nicht, wenn man in den acht Monaten, die ich inzwischen als Kellnerin jobbte, normalerweise mit »Miss« oder »Entschuldigung« angesprochen wurde. Am schlimmsten waren Gäste, die einen gleich mit der Geldbörse heranwinkten.
Da ich mir meine Verblüffung nicht anmerken lassen wollte, räusperte ich mich, zückte meinen Notizblock samt Kugelschreiber aus der schwarzen Schürze, die gemeinsam mit der dunklen Stoffhose, der weißen Bluse und dem roten Halstuch mein Arbeitsoutfit darstellte, und fixierte meinen Blick auf das weiße Papier.
»Was darf ich dir bringen?« Erneut war meinen Worten deutlich anzuhören, wie genervt ich war. Aber wenn man bedachte, wie ätzend der heutige Tag bisher verlaufen war, konnte man mir meine schlechte Laune nicht wirklich verübeln. Abgesehen von einer Vier in der Mathezwischenprüfung hatte ich meine U-Bahn verpasst und musste fünf Blocks zu Fuß laufen, um nicht zu spät zum Schichtbeginn zu kommen. Hinzukam, dass wir momentan keinen Barkeeper hatten, sodass ich mich neben den bestellten Speisen auch noch um das Zapfen der Getränke kümmern musste.
Super ätzend! Als ob das nicht schon genug Qual gewesen wäre, musste sich dieser nervige Touri ausgerechnet an einem meiner Tische vor dem nasskalten Herbstwetter verstecken. Vermutlich kam er geradewegs von einer dieser überteuerten und schlecht geführten Sightseeing-Touren, die überall in Manhattan angeboten wurden, nur damit er bei seiner Rückkehr vor Familie und Freunden angeben konnte, dass er die bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Welt live und in Farbe gesehen hatte.
Mal ehrlich, gab es nirgendwo anders auf der Welt große, hässliche Betonbauten, die man für viel Geld besichtigen konnte? Wieso war Manhattan nur so beliebt?
Überraschenderweise schwieg mein Gegenüber – wie hieß er gleich noch mal? – was mich dazu veranlasste, doch den Kopf zu heben und ihn mit einem unterdrückten Seufzen anzusehen. Dabei fiel mir auf, dass er auf den ersten Blick nicht wie ein typischer Tourist aussah. Weder hatte er einen auffällig großen Rucksack dabei noch hing ihm eine Hightech-Kamera um den Hals. Und trotzdem war ich mir sicher, dass er kein Einheimischer war. Kein echter New Yorker würde dem lächerlichen Rat folgen, den es vermutlich in jedem Reiseführer gab: »Bitte stellen Sie sich Ihrer Restaurantbedienung vor. Das ist höflich und wird gerne gesehen.«
So ein Blödsinn!
Als würde mich interessieren, wie meine Gäste hießen!
Während ich meinen Gedanken nachging, sah mich der blonde Typ immer noch lächelnd an. Ich wusste nicht, wieso er das tat, aber es missfiel mir gehörig. Er weckte mit diesem Blick ein Gefühl in mir, das ich nicht genauer beschreiben konnte, mir aber eine unangenehme Gänsehaut bescherte.
Um mir die aufkommende Unsicherheit nicht anmerken zu lassen, räusperte ich mich erneut und übernahm das Reden. Ich hatte schließlich nicht ewig Zeit, hier rumzustehen und mich anglotzen zu lassen.
»Weißt du schon, was du bestellen möchtest oder brauchst du noch etwas Zeit?« Je länger ich mein Gegenüber ansah, umso stärker wurde der Wunsch, mich von ihm zu entfernen. Er mochte zwar augenscheinlich nett, ja richtiggehend vertrauenswürdig sein, aber ich hatte zu viele Geschichten gehört, um nicht auf diese Art Typen reinzufallen. Schließlich wollte ich nicht wie meine Ex-Kollegin Mandy enden, die sich auf eine solche Geschichte eingelassen hatte und anschließend ohne Geld, Wohnung und Würde auf der Straße gelandet war.
Um die wachsende Spannung in meinem Inneren einzudämmen, warf ich einen kurzen Blick über meine Schulter. Meine anderen Gäste wurden bereits unruhig und wenn ich mich nicht beeilte, würden sie bei meiner Kollegin Sue abrechnen, was mich um mein Trinkgeld bringen würde.
Gerade, als ich beschloss meinem Gast den Rücken zu kehren, entdeckte ich meine Chefin Adriana Russo, die aus ihrem Büro trat. Ihr Blick war zwar auf einen Stapel Papiere in ihrer Hand gerichtet, aber ich wusste es besser. Sie hatte ihre Augen überall und wäre sicherlich nicht erfreut, wenn ich meinem Gast ohne die perfekt einstudierte Höflichkeit begegnete, die hier von allen Mitarbeitern verlangt wurde.
Das unterdrückte Seufzen, das mir bereits seit drei Tischen auf der Zunge lag, entglitt mir, als ich mich wieder dem blonden Typen zuwandte. Mein Schicksal war besiegelt und ich musste mich beugen. Ob es mir passte oder nicht.
»Kennst du schon unsere Pizza des Tages?«, fragte ich daher mit übertrieben guter Laune, wobei ich darauf achtete, weiteren Blickkontakt zu vermeiden. »Salame deluxe. Sie ist mit drei verschiedenen Salamisorten belegt. Wenn du jedoch experimentierfreudig bist und es exotisch magst, wäre vielleicht die Halloweenpizza etwas für dich. Der Belag besteht aus Kürbisfleisch, das über Nacht in Rotwein mariniert und mit einer pikanten Mischung aus Nüssen und Chili gewürzt wurde.« Nur dank großer Anstrengung gelang es mir, meine Mundwinkel an Ort und Stelle zu halten, damit sie nicht herabsackten und verrieten, was ich in Wahrheit von der eben genannten Saisonkreation hielt. Dabei sprach ich leider aus persönlicher Erfahrung. Die Pizza klang nicht nur ekelhaft, sie schmeckte auch genauso und das, obwohl Adriana ihre Kreationen stets mit den Worten »Es schmeckt wie ein glückliches Familienfest« anpries. Immer wenn ich diesen Satz hörte, fragte ich mich, ob meine Chefin ihre Familie hasste oder ob Italiener unter einem glücklichen Familienfest etwas anderes verstanden als wir Amerikaner. So oder so, die Gäste konnten von Glück reden, dass Adrianas Ehemann Diego der wahre Pizzabäcker war und seine Frau sich nur gelegentlich vor den Ofen verirrte.
Zum ersten Mal, seit ich an diesen Tisch gekommen war, wich das Lächeln aus dem Gesicht meines Gastes. Nun glich seine Miene einem Typen, dem man vorgeschlagen hatte eine Pizza mit dem Fleisch seines Haustieres zu belegen.
»Also?«, startete ich einen weiteren Versuch, meinem Gast eine Bestellung zu entlocken, während ich gleichzeitig versuchte ein Grinsen zu unterdrücken. »Was darf ich dir bringen?«
Es dauerte zwar noch ein paar Sekunden, doch dann kam endlich Bewegung in seine Mimik. Als wäre er eben aus einer Art Trance erwacht, blinzelte er ein paar Mal, ehe er mir erneut sein eintausend-Watt-Lächeln präsentierte.
»Ähm, ja, danke für die Empfehlungen, aber ich nehme eine einfache Pizza mit extra Käse. Dazu ein großes Glas Milch mit einer Zimtstange, wenn ihr welche habt, und als Nachtisch einen Kürbis-Bier-Cupcake.« Als würde der Duft des viel zu süßen Küchleins durch das Lokal wehen, schloss der Typ die Augen und drehte seinen Kopf in Richtung Küche.
Anstatt seine Geste zu kommentieren, notierte ich die Bestellung und achtete darauf, meine ausdruckslose Miene zu bewahren. Zwar klang seine Bestellung nicht weniger fragwürdig als die Halloweenpizza, aber ich musste das Zeug ja auch nicht essen beziehungsweise trinken.
Noch bevor ich den letzten Buchstaben zu Papier gebracht hatte, wandte ich mich zum Gehen, doch mein Gast hielt mich mit einer unvorhergesehenen Frage zurück. »Sag mal, Cathy, glaubst du an Magie?«
Automatisch blieb ich stehen und drehte mich wieder meinem Gast zu. Dabei huschte mein Blick reflexartig hoch zu seinen Augen, was ich umgehend bereute. Da war es wieder. Dieses merkwürdige Gefühl.
»Wie bitte?«, brachte ich verdutzt hervor. Ich hoffte mich verhört zu haben. Denn egal welche Richtung dieses Gespräch einschlug, es würde mir ganz sicher nicht gefallen.
Von meiner Irritation kein bisschen beeindruckt, lächelte der blonde Typ unbesonnen weiter. Er meinte seine Frage anscheinend ernst. »Ich fragte, ob du an Magie glaubst.«
Ein paar Sekunden stand ich einfach nur da und wusste keine Antwort auf seine Frage. Doch zum Glück überwand ich meine Sprachlosigkeit nach ein paar Herzschlägen. Schnell war die künstliche Höflichkeit aus meiner Stimme verbannt. Um meinen Worten mehr Gewicht zu verleihen, stützte ich mich mit gestreckten Armen auf der Tischplatte ab und lehnte mich dem fremden Typen entgegen.
»Wieso fragst du? Weil ich so schön bin, dass ich nicht von dieser Welt sein kann? Oder weil mein Lächeln so bezaubernd ist und jeden Mann hier im Laden in seinen Bann zieht?« Auch wenn mein Handeln einen Rauswurf bedeuten könnte, sollte mich ausgerechnet jetzt jemand aus der Chefetage erwischen, wollte ich diese billige Anmache nicht einfach so unkommentiert lassen. »Weißt du was, Mr Zahnpasta-Werbe-Lächeln? Spar dir deinen Charme. Ich bin keins dieser Mädchen, das auf schöne Augen oder nette Worte reinfällt. Also am besten verschwindest du ganz schnell, ehe ich die Security hole und du Hausverbot bekommst.« Mit einem letzten Blick, der klarmachen sollte, dass meine Worte kein Bluff waren, richtete ich mich auf und wandte meinem Gast den Rücken zu.
»Was? Wovon redest du? Ich wollte dich nicht … Du hast mich missverstanden!«, ereiferte sich mein vermeintlicher Gast, doch ich entfernte mich bereits von seinem Platz, ohne auf ihn oder seine Erklärungen einzugehen. »Hey, bitte geh nicht weg! Ich muss mit dir über ein wichtiges Thema reden!«
Augenrollend erreichte ich die Bar, hinter der ich mich umgehend verschanzte, um die von meinen richtigen Gästen bestellten Getränkte zu zapfen. Ich hatte bereits genug Zeit mit diesem Vollidioten verloren und wollte nicht noch seinetwegen auf wertvolles Trinkgeld verzichten müssen.
Während ich das zweite Glas mit Orangenlimonade füllte, überkam mich ein Gefühl, als würde mich jemand beobachten. Und obwohl ich mir sicher war, dass mir der blonde Quälgeist gefolgt war und nun vor mir an der Bar stand, konnte ich nicht verhindern, dass sich mein Kopf hob. Doch anstatt in mitternachtsblaue Augen blickte ich in dunkelgrüne, die meiner Chefin gehörten.
»Was ist los, Cathy? Gibt es Ärger?« Wie nicht anders zu erwarten war, hatte sie meine Auseinandersetzung mit dem blonden Typen mitbekommen. Jetzt musste ich Ruhe bewahren und eine plausible Erklärung parat haben, wieso ich einen Gast derart behandelt hatte. Sonst wäre das heute mein letzter Tag in diesem Lokal.
Ohne mit dem Zapfen aufzuhören, zuckte ich mit den Schultern und zwang mich zu einem lockeren Lächeln. »Ach nichts Besonders. Da ist nur wieder einer dieser Touristen, der denkt gleich zwei Mal in Manhattan landen zu können.«
Einen Augenblick lang sah Adriana mich mit geweiteten Augen an, dann zuckten ihre Mundwinkel und ein Funkeln erschien in ihrem Blick. »Wirklich?« Ihr Kopf ruckte nach hinten in Richtung Ladenlokal. »Wer ist es denn?« Ihre Neugier war nicht zu überhören. Denn auch wenn meine Chefin weit über vierzig war, benahm sie sich dennoch manchmal wie ein Teenager, stets auf der Suche nach neuem Tratsch.
Da ich jedoch überhaupt keine Lust auf diese Art von Gespräch hatte, und schon gar nicht mit meiner Chefin, zuckte ich nur mit den Schultern und konzentrierte mich wieder auf meine Arbeit.
Es dauerte nicht lange, da sprach Adriana bereits weiter. »Ah, ich sehe schon, wen du meinst. Schade aber auch, dass er so ein Arsch ist. Er ist wirklich niedlich.«
Verblüfft hob ich den Kopf. Mir waren zwar Adrianas besondere Fähigkeiten was das andere Geschlecht anging sehr wohl bekannt, dennoch konnte ich mir nicht vorstellen, dass sie in einem vollen Restaurant einen Typen ausfindig machen konnte, ohne auch nur einen einzigen Hinweis zu haben. Doch als ich ihrem Blick folgte, war klar, weshalb sie den blonden Idioten so schnell erkannt hatte. Wie ein begossener Pudel stand er mit hängenden Schultern neben der Tür. Eine Hand auf der Klinke sah er mit traurigem Blick in unsere Richtung. Mit dem passenden Soundtrack im Hintergrund wäre sein Abgang perfekt gewesen.
Ungewollt überkam mich ein schlechtes Gewissen. Hatte ich ihm vielleicht unrecht getan und er vielleicht einfach nur einen schlechten Gesprächseinstieg gewählt?
Umgehend schämte ich mich für diese Überlegung.
Natürlich nicht! Selbst wenn er wider Erwarten die Wahrheit gesagt hatte und mich tatsächlich nicht angraben wollte, verströmte er dennoch irgendwie eine unheimliche Aura und ich verspürte kein Bedürfnis, ihm ein zweites Mal zu begegnen.
Adrianas herzerweichendes Seufzen riss mich aus meinen Gedanken und katapultierte mich zurück in die Gegenwart, wo ich mit Schrecken feststellte, dass mir Organgenlimonade über die Finger floss.
Ich unterdrückte ein Fluchen und ließ mit einem verärgerten Grunzen den Zapfhahn los, bevor ich das übervolle Glas zur Seite stellte und begann mit einem Lappen die klebrige Flüssigkeit vom Tresen zu wischen. Ich wusste nicht, über wen ich mich mehr ärgerte. Über den Typen, weil er nicht einfach abhaute, oder mich selbst, weil ich mich von ihm hatte ablenken lassen.
Bevor ich jedoch darauf eine Antwort fand, hörte ich mit einem Mal die Stimme des blonden Typens so deutlich und klar in meinem Ohr, als stände er direkt neben mir. Und das, obwohl er sich keinen Zentimeter von der Tür entfernt hatte, wie ich mit einem schnellen Blick feststellte.
»Ich brauche deine Hilfe, Cathy. Ohne dich ist Weihnachten verloren!«
1.
01. Dezember
»Stiiieeehhhiiile Nacht, haaaeeeiiillliiige Nacht.« Der Weihnachtsklassiker erklang aus den Lautsprechern, die in den Ecken des Ladenlokals angebracht waren. Leider handelte es sich dabei nicht um die Originalversion, sondern um das Cover einer Pop-Prinzessin, die sich ohne Playback anhörte, als würde man einen Kater kastrieren. Die Musik sollte vermutlich die weihnachtliche Deko unterstreichen, die an Decke, Wänden und Fenstern angebracht war. Aber leider lag die Betonung auf dem Wort sollte. Denn wegen des erhöhten Lärmpegels, der dank der vielen Gäste herrschte, ging das Lied ebenso unbemerkt unter wie der verzweifelte Comebackversuch seiner Sängerin.
Leider war mir nicht das Glück vergönnt, den Song zu ignorieren. Genau hinter dem Bartresen, an dem ich stand und auf die bestellten Getränke meiner Gäste wartete, befand sich eine der Soundboxen und gab das Lied in all seiner Schrecklichkeit wieder. Natürlich hätte ich nicht hier rumstehen und mir diese auditive Folter antun müssen, aber meine Schicht dauerte bereits sechs Stunden und das jetzt war die erste Gelegenheit, etwas zu verschnaufen.
»Ich kann diesen Mist nicht mehr hören!« Motzend rollte ich die Augen, während ich meine verschränkten Arme auf das dunkle Holz ablegte und meinen Hintern auf einen der Barhocker hievte. Meine Füße brannten, meine Waden schmerzten und ich war mir nicht sicher, ob ich meinen Rücken jemals wieder richtig bewegen könnte.
Elsas Mundwinkel zuckten, doch sie sagte nichts. Vielleicht wollte sie nichts erwidern, vielleicht hatte sie mich auch einfach nicht verstanden. Elsa war, wenn ich Adriana richtig verstanden hatte, eine Studentin aus Schweden, die in den Staaten ein Auslandssemester absolvierte und hier während der Adventszeit ein wenig aushalf. Zwar war ihr Englisch mehr schlecht als recht, aber sie war eine geübte Barkeeperin und damit genau die Richtige für diesen Job. Vor allem nachdem Jayden, der sich im Oktober wegen einer Erkältung krankgemeldet hatte, nie wiedergekommen war und wir seinen Job seitdem mit erledigen mussten.
»Last Christmas schön«, gab Elsa nach einigen Sekunden zu und hob ihren Kopf. Auf ihren Lippen lag ein verschmitztes Grinsen, was ihre von Sommersprossen übersäte Nase zum Kräuseln brachte und zwei Grübchen hervorzauberte. Mit ihrer hellen Haut, den strohblonden Haaren und ebenso farblosen Wimpern erinnerte sie mich an eine Schauspielerin, deren Name mir aber nicht einfallen wollte.
»Last Christmas? Ernsthaft?!« Mit angewiderter Miene schüttelte ich den Kopf. »Das ist das schlimmste Lied von allen!«
Elsa runzelte die Stirn und ich konnte nicht genau sagen, ob es an meiner Aussage per se oder an der Sprachbarriere lag. Als sie jedoch schweigend den Kopf senkte und sich wieder ihrem Job widmete, nutzte ich die Chance und ließ meinem Weihnachtsfrust freien Lauf – egal ob sie mich verstand oder nicht.
»Wenn es nach mir ginge, könnte dieser ganze Weihnachtsscheiß sogar völlig ausfallen! Dann gäbe es keine blöde, kitschige Musik, keine leuchtende, glitzernde oder sprechende Deko und vor allem keine peinlichen und nutzlosen Geschenke mehr!« Eigentlich hätte mein Monolog an dieser Stelle enden sollen, aber ohne mein Zutun öffneten sich meine Lippen weiter und entließen noch mehr Silben. »Ich meine, ist das wirklich der Sinn von Weihnachten? Sich selbst in Geldnöte zu begeben, nur um jemand anderem etwas zu schenken, was dieser wiederum gar nicht will oder braucht?! Und das nur, weil man sich wegen irgendwelchen gesellschaftlichen Konventionen verpflichtet fühlt?«
Erneut sah Elsa auf und ihr Blick, der sowohl Überraschung als auch Verständnis und eine Spur Mitleid zeigte, ließ mich annehmen, dass ihre Sprachkenntnisse vielleicht nicht gut genug waren, um zu antworten, jedoch ausreichten, um mein Gemotzte zu verstehen.
»Ja, Weihnachten kommerziell. Nicht mehr Fest von Jesus. Hässliche Socken mit …« Da ihr offenbar nicht einfiel, wie das Wort hieß, welches sie suchte, nahm sie beide Hände an den Kopf, spreizte die Finger und muhte auf einmal lauthals los, während sie die Augen verdrehte.
Ich wusste zwar nicht, welches arme Tier meine Kollegin gerade nachgeahmt hatte, aber Elsas Darstellung lenkte mich von meinem Weihnachtsverdruss ab. Während ich noch vor mich hin kicherte, wurde meine Kollegin auf einmal wieder ernst und sah mich erneut mit diesem speziellen Blick an. »Nicht alle Familien teure Geschenke, Cathy. Geld nicht Wichtigste.«
Mit ihren unbeholfenen Worten hatte Elsa genau das bestätigt, was ich befürchtet hatte. Die junge Schwedin verstand mehr, als ich anfangs angenommen hatte. Leider war das in diesem Fall kein Grund zur Freude. Ganz im Gegenteil sogar. Ich hatte Elsa oft als Beichtstuhl missbraucht und ihr Dinge anvertraut, die niemand Fremdes über mich oder meine Familie jemals hätte erfahren sollen. Dabei hatte ich das stets in dem Glauben getan, dass sie mich sowieso nicht verstand. Es hatte einfach gutgetan, sich den ganzen Mist von der Seele zu reden. Doch jetzt war davon auszugehen, dass Elsa mehr über mich wusste, als sonst irgendjemand auf der Welt.
Verdammter Dreck!
Um die katastrophale Lage, in der ich mich nun befand, zu kaschieren, zwang ich mich zu einem lockeren, unverbindlichen Lächeln, das sich jedoch eher wie die Fratze von Pennywise, dem tanzenden Clown aus dem Buch »Es« von Stephen King anfühlte.
»Ach, Elsa, du hast mich falsch verstanden. Ich habe keine Geldprobleme. Nein, ganz ehrlich nicht. Es ist eher so, dass ich aus freiwilligen Stücken beschlossen habe diesen ganzen gesellschaftlichen Quatsch nicht länger mitzumachen.« Die Scham über diese Lüge saß mir im Hals und ich schluckte hart.
Elsa, der ich ab heute nicht nur aus dem Weg gehen, sondern die ab sofort auch den Zusatznamen Lügendetektor von mir erhalten würde, bedachte mich mit einer neuen Art von Blick, der mir deutlich zu verstehen gab: Wenn du reden willst, ich kann gut zuhören.
Da ich die unangenehme Spannung nicht länger aushielt, schnappte ich mir einen Teil der fertigen Getränke und platzierte sie auf meinem Tablett. Ich wollte nur noch so schnell wie möglich von hier weg. Doch ehe ich mich Elsa ab- und dem restlichen Ladenlokal zuwenden konnte, sagte meine Kollegin etwas, das mich nicht nur überraschte, sondern mir auch nie wieder aus dem Sinn gehen würde.
»Liebe und Freundschaft wertvollste Geschenke, Cathy. Kein Geld. Nur warmes Herz.«
***
Seit Mitte November wurden meine Schichten in der Russo-Pizzeria immer länger. Früher hatte ich während der Woche nur an zwei oder drei Nachmittagen für ein paar Stunden arbeiten können, doch inzwischen gehörte ich zum festen Team und kam jeden Tag her. An Schultagen schaffte ich zeitlich zwar nur die Abendschicht, aber selbst die dauerte, je nachdem wie voll der Laden war, bis zu fünf oder sechs Stunden. An den Wochenenden hingegen durfte ich sowohl die Früh- als auch die Abendschicht übernehmen und erreichte so zwischen zehn und zwölf Stunden am Tag. Klar, anfangs war dieses Pensum ziemlich hart, aber nachdem ich meine Prioritäten geordnet hatte – da ich mir unter keinen Umständen ein College würde leisten können, musste ich mir auch keine Gedanken über einen Schulabschluss machen – hatte ich mich schnell an die Arbeitszeiten und den damit verbundenen Lohn gewöhnt. Aus diesem Grund hoffte ich auch in wenigen Monaten endlich Vollzeit bei Adriana und Diego arbeiten zu dürfen. Schließlich wurde ich im März volljährig und würde dann meine Zeit nicht länger in der Highschool vertrödeln müssen. Und mit dem Mehrverdienst würde ich meiner Mutter noch besser bei der Begleichung ihrer Schulden helfen können. Vielleicht, wenn alles so klappte, wie ich es mir vorstellte, würde ich mir irgendwann sogar eine eigene kleine Mietwohnung leisten können. Aber so weit in die Zukunft wollte ich lieber nicht planen. Denn wenn ich eins gelernt hatte, dann dass das Schicksal einen Heidenspaß dabei hatte, geschmiedete Pläne auf grausamste Art zu durchkreuzen.
Anstatt mich also länger mit irgendwelchen Zukunftsfantasien abzulenken, widmete ich mich lieber wieder der Arbeit. Dabei war heute wieder einer dieser Tage, an denen ich meinen Job hasste. Es machte einfach keinen Spaß, Gäste zu bedienen, die sich über die hohen Preise im Laden beschwerten und dies mit minimalem oder auch fehlendem Trinkgeld deutlich machten, während sie gleichzeitig in ihren Designertaschen (bevorzugt Louis Vuitton natürlich) nach ein paar losen Dollarscheinen kramten, die nicht mehr in das überquellende Portmonee passten und vermutlich die Überreste der vorangegangenen Shoppingtour waren.
Aus diesem Grund war ich am Samstagnachmittag auch dermaßen genervt, dass ich kurz davor stand, Adriana um eine extra Pause zu bitten. Doch ehe ich Gelegenheit dazu bekam, öffnete sich die Ladentür und Rosie, meine fünfjährige Schwester, stürmte herein.
»Cathy! Cathy! Cathy! Schau mal, was ich hier habe!« In einer Euphorie, die nur Kindergartenkinder versprühen konnten, wedelte sie mit einem Blatt Papier und lief gleichzeitig auf mich zu. Dabei übersprang sie die im Weg stehenden Hindernisse, als wäre sie ein trainiertes Springpferd.
Nur wenige Sekunden später betrat auch meine Mutter das Restaurant. Leider sah sie kein bisschen so überschwänglich und glücklich aus wie ihre jüngste Tochter. Ihr Blick hatte etwas Abwesendes, ihre Augen waren wie immer von tiefblauen Ringen umrandet und ihre Haut wirkte kalkig.
»Was hast du denn da, Rosie?«, fragte ich und ging in die Hocke, um meiner Schwester ins Gesicht sehen zu können und mich gleichzeitig vor Adrianas wachsamen Augen zu verstecken. Zwar hatte meine Chefin einen Narren an meiner Schwester gefressen und freute sich stets, wenn sie vorbeischaute, doch ich war mir sicher, dass sich Adrianas Freude über Rosies Besuch in Grenzen halten würde, wenn der Laden wie heute derart überfüllt war.
Meine Schwester strahlte mich aus ihren babyblauen Augen an. Sie hatte ein niedliches Mondgesicht mit einer kleinen Stupsnase und rosafarbenen Lippen. Ihre Wangen waren von der winterlichen Kälte gerötet und unter ihrer pinken Pudelmütze lugten ein paar dunkelbraune Strähnen hervor, die ihr mittlerweile bis über die Augenbrauen reichten. Ihr Pony musste dringend nachgeschnitten werden, aber da ich mich immer darum kümmerte, meine Schwester in letzter Zeit jedoch kaum im wachen Zustand zu Gesicht bekommen hatte, war mir dieser Umstand entgangen.
»Wir waren in dem riesen Spielzeugladen und ich durfte meinen Wunschzettel für den Weihnachtsmann schreiben!« Zur Unterstreichung ihrer Worte wedelte Rosie erneut mit ihrem ziemlich verknitterten Zettel.
»Jetzt halte doch mal still, sonst sehe ich gar nichts.« Geschickt schnappte ich mir das Blatt Papier und betrachtete es eingehend. Auf der gesamten Fläche waren bunte Sticker von farbenfrohen Spielsachen aufgeklebt, die sofort verdeutlichten in welchem Laden meine Mutter und Schwester gewesen waren.
»Ihr wart im FAO Schwarz?«, fragte ich an meine Mutter gewandt, die zwei Schritte hinter Rosie stand und uns mit beschämtem Gesichtsausdruck ansah. Sie wusste genau, was ich davon hielt, dass sie meine Schwester in solche Läden mitnahm. »Wieso hast du das getan?« Dabei meinte ich nicht nur den Ausflug in einen Laden voller Spielsachen, von denen wir uns nicht einmal eine einzige Murmel leisten konnten. Nein, mein eisiger Vorwurf galt auch dem leidigen Thema Santa Claus.
Als Antwort zuckte meine Mutter nur wortlos mit den Schultern. Aber was hätte sie auch erwidern sollen?! Sie wusste ganz genau, dass ich Rosie immer wieder klarzumachen versuchte, dass es keinen Mann mit weißem Bart und rotem Mantel gab, der Kindern auf der ganzen Welt Geschenke brachte. Leider glichen meine Bemühungen in diesem Fall einem Kampf gegen Windmühlen. Denn sobald die Weihnachtszeit näher rückte, fiel mir meine Mutter jedes Mal aufs Neue in den Rücken.
Ebenso wie heute.
Mit einem Seufzen wandte ich mich wieder an meine Schwester. Es hatte keinen Zweck, weiter mit meiner Mutter zu reden. In diesem Punkt würden wir uns niemals einig werden. Außerdem sah sie so fertig aus, dass ich beinah Mitleid mit ihr bekam. Aber nur beinah. Denn um ehrlich zu sein, war ich inzwischen an ihren Zombielook gewöhnt. Früher hatte sie ihre hellbraunen Strähnen immer in einem ordentlichen Zopf geflochten, aber mittlerweile standen ihr die zerzausten Strähnen wirr vom Kopf ab. Auch der verschlissene Wintermantel war mir leider mehr als vertraut, weshalb ich ehrlich froh war, dass ihre Arbeitskleidung vom Krankenhaus gestellt wurde und sie ihren Dienst als Kinderkrankenschwester nicht als Vogelscheuche absolvieren musste. Trotzdem versetzte mir ihr Anblick jedes Mal aufs Neue einen dumpfen Stich in der Brust. Denn ihr Äußeres war nicht das Einzige, das sich in den letzten drei Jahren verändert hatte. Nein, ihre gesamte Persönlichkeit hatte sich gewandelt, sodass von der sonst so taffen und lebensfrohen Frau, die meine Mutter einst gewesen war, nichts mehr zu erkennen war.
»Rosie-Rose, wir haben doch schon oft darüber gesprochen. Den Weihnachtsmann gibt es nicht. Deine Geschenke bekommst du von Oma und Opa aus Florida.«
So oft, wie ich inzwischen dieses Gespräch geführt hatte, hätte man meinen können, dass ich wusste, wann ich gefahrlos reden und wann besser schweigen sollte. Doch nach einem Tag wie heute fehlte es mir an Empathie, was mich Rosie auch umgehend spüren ließ. Wie eine Alarmsirene begann sie zu schreien. Dabei erreichte ihre Stimme eine Tonlage, die anatomisch jenseits sämtlicher Möglichkeiten liegen musste, bei Kleinkindern jedoch zur Standartausstattung gehörte.
»Nein! Das stimmt nicht! Meine Schneekugel ist vom Weihnachtsmann. Das weiß ich genau! Ich habe ihn gesehen!« Mit leuchtend rotem Kopf, feuchten Augen und einem Schmollmund, der von Spuckebläschen begleitet wurde, als hätte sie Tollwut, verschränkte Rosie ihre Arme vor der Brust. »Außerdem haben Oma und Opa uns nicht mehr lieb, weil Daddy jetzt im Himmel ist!«
Ihre Worte trafen mich unvorbereitet, was mir ein hilfloses Seufzen entlockte. Die Versuchung, meiner Mutter einen Daran-bist-nur-du-schuld-Blick zuzuwerfen, war immens, doch das hätte auch nichts an der Situation geändert. Aber genau das war jetzt meine oberste Priorität: Ich musste meine Schwester beruhigen, ehe Adriana und Diego das Geschrei mitbekamen und ich anschließend größere Probleme hatte als eine gekränkte Fünfjährige.
Um Rosie zu beschwichtigen, legte ich ihr meine Hände auf die Schultern und bemühte mich ihr tief in die Augen zu sehen. Meistens half das bereits, um ihre Aufmerksamkeit zurückzuerlangen.
»Hör Mal, Schwesterherz. Du weißt doch, dass Oma und Opa in Florida leben. Das ist dort, wo Mickey Mouse lebt. Es liegt also nicht daran, dass sie uns nicht mehr lieb haben. Sie haben einfach keine Zeit, uns zu besuchen, weil sie so oft bei Mickey sind.« Ich hoffte, dass der Themenwechsel half. Es gab nur wenige Dinge auf der Welt, die Rosie mehr liebte als Mickey Mouse. Eins davon war ihre eben genannte Schneekugel, die sie letztes Weihnachten von unseren Großeltern bekommen hatte und seitdem wie ein Fabergé-Ei schützte. Niemand außer ihr selbst durfte es berühren.
Mein Vorhaben funktionierte, denn Rosies Miene wechselte von bockig zu unsicher. Ich konnte mir genau vorstellen, was gerade in ihrem Kopf los war. Einerseits wollte sie weiterhin böse auf mich sein, andererseits überlegte sie, wie wenig Zeit sie selbst haben würde, wenn sie Tür an Tür mit Mickey Mouse wohnen würde. Daher fiel es ihr auch so leicht, die Begründung zu akzeptieren, weshalb ihre Großeltern sich seit der Beerdigung zu Beginn dieses Jahres kein einziges Mal mehr bei uns gemeldet hatten, abgesehen von den einfallslosen Geschenken zu unseren Geburtstagen.
Da Rosie mich noch immer verunsichert ansah, nutzte ich die Gelegenheit für einen weiteren Versuch, ihr die Wahrheit über den Weihnachtsmann zu erklären.
»Siehst du, Rosie, genauso wie mit Oma und Opa hast du das auch mit dem Weihnachtsmann falsch verstanden. Zwar gibt es viele Männer, die sich zur Adventszeit verkleiden, um bei der Parade mitzufahren, oder in Kaufhäusern mit Kindern zu reden, aber das machen sie nur, weil es ihr Job ist. Verstehst du, was ich sagen möchte, Rosie-Rose? Den echten, wahren Weihnachtsmann gibt es nicht.«
Bei jeder Unterhaltung mit einem Kindergartenkind gab es eine magische unsichtbare Grenze, die über den Erfolg oder Misserfolg des Gespräches entschied. Blieb man auf der einen Seite dieser Grenze hatte man eine reelle Chance, dass man Verständnis erntete. Sollte man jedoch den Fehler begehen und diese Grenze überschreiten, hatte man verloren.
Genau wie ich in diesem Moment.
»Nein! Du lügst! Den Weihnachtsmann gibt es wohl! Ich habe ihn gesehen und mit ihm gesprochen! Du bist nur eifersüchtig, weil du nie Geschenke bekommst! Aber weißt du warum? Weil du gemein bist, lügst und nie Zeit für Mama und mich hast!« Sie streckte sie mir die Zunge raus und drehte sich anschließend mit quietschen Gummistiefelsohlen von mir weg, um Zuflucht bei unserer Mutter zu suchen, die uns mit immer länger werdendem Gesicht beobachtet hatte.
In diesem Moment überforderten mich meine Gefühle. Ich war erschöpft, hungrig und vor allem wütend auf meine Mutter, die Rosie überhaupt erst diesen Floh ins Ohr gesetzt und mich damit erneut zur bösen Hexe aus dem Osten gemacht hatte.
Mit einem Ächzen erhob ich mich aus meiner Kauerhaltung und schob meine Hände in die Hosentasche. Dabei achtete ich darauf, die bohrenden Blicke der Gäste, die das Ganze hautnah miterlebt hatten, zu ignorieren.
»Ich muss jetzt weiterarbeiten«, sagte ich mit leiser Stimme und senkte den Kopf. Momentan konnte und wollte ich meine Mutter nicht ansehen.
»Tut mir leid, Cathrin.« Die ebenso leise gemurmelten Worte meiner Mutter waren kaum zu hören und das, obwohl der Geräuschpegel im gesamten Restaurant drastisch zurückgegangen war.
Ungewollt sah ich auf. Ihr Blick spiegelte meine Gefühle wider.
Schuld. Scham. Bedauern.
Gerne hätte ich meine Mutter gefragt, wofür sie sich entschuldigte. Für den Ausflug in den Spielwarenladen? Für die erneute Lüge mit dem Weihnachtsmann? Oder dafür, dass sie nach Dads Tod zu einem Schatten ihrer Selbst geworden war und mich damit automatisch in die Position einer Erwachsenen gepresst hatte, die sich um finanzielle Sorgen und die Erziehung einer Fünfjährigen kümmern musste?
Ich wusste es wirklich nicht, aber eigentlich war es mir auch egal. Denn für keines dieser Dinge war ihre Entschuldigung ausreichend.
2.
01. Dezember
Um zwanzig Uhr durfte ich endlich meine Schürze an den Haken hängen, mein Trinkgeld kassieren und die Pizzeria verlassen. Im Laden war zwar noch einiges los, aber Adriana wollte, dass ich Schluss machte. Vermutlich lag das an der katastrophalen Stimmung, die nach dem Abgang meine Familie geherrscht hatte. Denn wie ich bereits vermutet hatte, hatte wirklich jeder Gast im Laden mitbekommen, wie ich einer Fünfjährigen klarzumachen versuchte, dass es den Weihnachtsmann nicht gab. Und dieses Vorhaben wurde in einer Stadt, die von Illusionen lebte, mit einer der sieben Todsünden gleichgestellt.
Natürlich ließen mich das die Gäste auch spüren. Sei es, indem sie mir kein Trinkgeld gaben oder mich mit bösen Blicken straften, wenn ich an ihnen vorbeiging.
Deshalb war ich Adriana sogar dankbar, als sie mich zwei Stunden früher gehen ließ, als eigentlich auf dem Dienstplan stand. Heute hätte ich sowieso nichts mehr reißen können.
Kaum hatte ich die Ladentür geöffnet und war über die Schwelle getreten, peitschte mir sogleich der frostige Dezemberwind ins Gesicht. Nach Stunden, die ich in der überheizten, von Backöfen und Menschen erwärmten Pizzeria verbracht hatte, war der Umschwung noch heftiger, als ich befürchtet hatte und ich sehnte mich umgehend in die nach geschmolzenem Käse, Tomatensauce und Oregano riechende Räumlichkeit zurück. Da das aber keine Option war, schlang ich Arme und Handtasche um meinen Oberkörper. Da meine Winterjacke schon ziemlich in die Jahre gekommen war und keinen ausreichenden Schutz vor der Kälte bot, hatte ich mir bereits vor Wochen einen dicken dunkelroten Wollschall organisiert, den ich mir nun wie eine Boa constrictor um den Hals wickelte. Nur leider kam dieser auch nicht wirklich gegen die beißenden Windböen an.
Erneut kochte der Ärger über meine Familie in mir hoch. Nicht nur, dass ich wegen ihrem Besuch Lohn- und Trinkgeldeinbußen hatte, nein, ich musste in dieser eisigen Kälte auch noch alleine und per U-Bahn nach Hause fahren, anstatt mich wie sonst von meiner Kollegin Sue mitnehmen zu lassen.
Mit hochgezogenen Schultern und deutlich sichtbarer schlechter Laune reihte ich mich in die Fußgängermassen auf dem Bürgersteig ein. Die Leute trugen ihre vollen Shoppingtüten vor dem Körper als wären es Airbags.
Normalerweise hätte ich jetzt die erstbeste U-Bahn in Richtung Brooklyn genommen, aber dann wäre ich vor neun Uhr zu Hause gewesen und würde unweigerlich meiner Mutter begegnen. Und genau das wollte ich nach einem Tag wie heute unter allen Umständen vermeiden. Lieber nahm ich einen Fußmarsch mit garantierter Unterkühlung in Kauf.
Bereits nach ungefähr einer Meile hatte mich die Stadt mit all ihren Reizen gefangen genommen. Die lauten Hupgeräusche, die blinkenden Lichter in den Schaufenstern, die wütenden Rufe der anderen Fußgänger. All das gehörte zu New York wie das Empire State Building oder der Trump Tower. Und genau das liebte ich an der Stadt, die nie schlief. Nirgendwo sonst auf der Welt konnte man sich so einfach selbst verlieren und anschließend neu wiederfinden.
Als könnte ich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder befreit durchatmen, blieb ich mitten im Weg stehen, streckte meine Arme zu beiden Seiten aus, legte den Kopf in den Nacken und sog mit geschlossenen Augen gierig Sauerstoff, gemischt mit einer Menge Abgasen in meine Lungen.
Vielleicht waren meine familiären Probleme doch nicht so unlösbar? Vielleicht konnte ich mit meiner Mutter reden und ihr begreiflich machen, dass sie Rosie keinen Gefallen tat, wenn sie sie mit einer Lüge aufwachsen ließ.
Gerade, als sich ein winziger Hoffnungsschimmer in mir zu entflammen versuchte, spürte ich einen Ruck an meinem Arm. Erst dachte ich, ein anderer Fußgänger hätte mich angerempelt, doch bereits eine Sekunde später spürte ich das fehlende Gewicht meiner Handtasche.
»Was zum Henker?« Schlagartig war das schöne Gefühl in meinem Inneren vergessen und ich blickte mit aufgerissenen Augen an mir herab.
Tatsächlich.
Jemand hatte meine Tasche geklaut.
Von Panik erfasst ruckte mein Kopf von links nach rechts. Das alte Ding war mir völlig egal, aber dort befand sich mein Portmonee samt heutigem Tageslohn! Ich hegte zwar keine Hoffnung, den Dieb zu finden, dennoch konnte ich nicht anders.
Es vergingen ein paar Herzschläge doch dann entdeckte ich einen kleinen Jungen mit moosgrünem Kapuzenpulli, der versuchte zwischen den anderen Fußgängern abzutauchen und sich dabei verdächtig oft nach hinten umsah.
Instinktiv wusste ich, dass er meine Tasche hatte.
»Hey! Bleib stehen! Hilfe! Taschendieb!« Mit diesem Ruf setzte ich dem Jungen nach, kam jedoch nur schleppend vorwärts, weil mich der Strom der entgegenkommenden Fußgänger immer wieder abbremste. Der kleine Kerl hingegen hatte den Vorteil, zwischen den Beinen der anderen Leute verschwinden zu können.
Nein! Nicht mit mir!, schrie ich mir immer wieder gedanklich zu und biss die Zähne fest zusammen. Ich würde nicht zulassen, dass man mich bestahl. Nicht heute!
Mit eisernem Willen, viel Ellbogenaktivität und stetig sinkender Muskelkraft gelang es mir, die Distanz zu dem flinken Dieb auf eine Armlänge zu verkürzen. Aber leider schaffte es der Junge, sich in eine unbeleuchtete Seitengasse zu retten, ehe ich ihn packen konnte.
Meine Instinkte rieten mir dem Knirps nicht zu folgen. Es bestand immerhin die Gefahr, dass er einer Bande von Kriminellen angehörte, deren Masche es war, junge Frauen in diese Gasse zu locken. Aber ich war viel zu wütend, um auf diese Stimme zu hören. Sobald sich mir eine Gelegenheit bot, schlüpfte auch ich in den schmalen Zwischenraum. Die ersten paar Meter waren noch von der Hauptstraße beleuchtet, doch bereits nach wenigen Schritten konnte ich kaum noch etwas erkennen.
»Du blödes Arschloch!«, schrie ich lauthals und meine Stimme wurde von den hohen Wänden zurückgeworfen. »Kannst du dir kein anderes Opfer suchen?«, fluchte ich weiter und ging tiefer in die nach Urin stinkende Gasse hinein. Langsam gewöhnten sich meine Augen an die Finsternis, sodass ich zumindest schemenhafte Konturen erkennen konnte.
Das Scheppern einer umgeworfenen Mülltonne ließ mich erschrocken zusammenfahren, doch dann sah ich etwas Helles aufblitzen. Der Taschendieb hatte ein Handy aufleuchten lassen.
»Das war ein Fehler!«, murmelte ich und setzte dem Dieb erneut nach. Leider kam ich dank fehlender Kondition bereits nach wenigen Metern an meine Grenzen. Meine Beinmuskeln verkrampften sich, meine Lungen brannten und ich wurde von qualvollen Seitenstichen heimgesucht, die meine Verfolgung erschwerten. »Bleib stehen, du bösartiger Zwerg!« Dass dieser Ausruf politisch unkorrekt war, war mir in diesem Moment völlig egal. Der Blödmann hatte meine Sachen und ich wollte sie zurück.
Offenbar hatte ich den Dieb mit meinen Worten gekränkt, denn er verlangsamte seine Schritte und drehte sich zu mir um. Im Schein des künstlichen Lichts erkannte ich, dass es sich bei dem vermeintlichen Jungen gar nicht um ein Kind handelte, sondern um einen kleinwüchsigen Mann, dessen untere Gesichtshälfte komplett von einem buschigen Bart verdeckt war.
Mir blieb keine Zeit, über diese überraschende Wendung nachzudenken, denn in der gleichen Sekunde erklang eine fremde Stimme direkt hinter mir. »Hey! Stehen geblieben!« Ehe ich überhaupt die Gelegenheit bekam, mich nach der Quelle umzudrehen, schoss der unbekannte Jemand bereits wie ein Blitz an mir vorbei und eilte auf den Dieb zu.
Ich war so verdutzt, dass ich meine eigenen Verfolgungsversuche einstellte und dem hellblonden Schopf nachsah, bis er Sekunden später wieder von der Dunkelheit verschlungen wurde.
Mein viel zu schneller und viel zu lauter Herzschlag übertönte sämtliche anderen Geräusche, was die ganze Situation wie eine Ewigkeit erscheinen ließ. In Wirklichkeit waren jedoch nur wenige Sekunden vergangen bis die hellen Haarsträhnen im Lichtkegel des Diebes zu sehen waren, ehe sie mit der Lichtquelle erneut verschwanden.
Wieder war die Gasse von zäher, undurchdringlicher Finsternis umgeben. Doch dieses Mal wurde die Dunkelheit nicht von Schritten, sondern von Geräuschen begleitet, die eindeutig nach einem Kampf klangen.
Unschlüssig stand ich da und wusste nicht, was ich tun sollte. Wäre es klug, mich ebenfalls einzumischen? Oder sollte ich lieber zurück zur Hauptstraße laufen und nach Hilfe rufen? Immerhin bestand die Möglichkeit, dass der Dieb bewaffnet und gefährlich war.
Ein Schmerzensschrei, gefolgt von Totenstille, nahm mir die Entscheidung ab. In einer unsteten Pirouette drehte ich mich dem Ausgang der Gasse zu und wollte bereits zurück zur Hauptstraße laufen, als Schritte zu hören waren, die eindeutig aus der anderen Richtung kamen und sich mir näherten.
Ungewollt fuhr ich wieder herum und entdeckte nur wenige Meter von mir entfernt den unbekannten Blondschopf, der mit wankendem Lichtschein auf mich zu eilte. Zwar war der Großteil seines Körpers noch in Dunkelheit gehüllt, aber die hellen Haare sowie das offene Lächeln waren nicht zu übersehen. Vermutlich war das der Grund, weshalb ich mich nicht von der Stelle rührte.
»Hier, ich denke, die gehört dir.« Einen halben Meter vor mir kam der Unbekannte zum Stehen und streckte mir seinen Arm entgegen. Erst auf den zweiten Blick erkannte ich, dass er tatsächlich meine abgewetzte Kunst-Leder-Second-Hand-Tasche in der Hand hielt.
»Ähm, danke«, brachte ich kleinlaut hervor, immer noch von Luftmangel und Überraschung gepeinigt. Dennoch ließ ich keine Zeit verstreichen und griff schnell nach meiner Habseligkeit und drückte sie fest an meine Brust.
Mein Gegenüber nickte lächelnd, ohne mich aus den Augen zu lassen, während er selbst durch geöffnete Lippen ein- und wieder ausatmete. Sein Atmen bildete dabei kleine weiße Wölkchen und mir wurde klar, wie sehr ihn die Rettungsaktion beansprucht haben musste.
Das Schweigen zwischen uns dehnte sich mit jeder Sekunde weiter aus, doch überraschenderweise fühlte es sich nicht unangenehm an. Ich schob diesen irritierenden Umstand auf mein überfordertes Nervenkostüm, um das Gefühl zu kaschieren, dass mir diese stechend blauen Augen bekannt vorkamen. Immerhin konnte ich nicht einmal sagen, wie ich auf diesen Eindruck kam.
Nach einigen Sekunden des stummen Anblickens drehte mein Gegenüber seinen Kopf in Richtung Gasse, als wollte er sichergehen, dass ihn niemand von hinten angriff. Als er sich wieder an mich wandte, wirkte er verlegen.
»Tut mir leid, dass der Dieb entkommen ist. Aber für seine Größe kann er ziemlich schmerzhaft zutreten und beißen«, meinte er kleinlaut.
»Ähm, ja, kein Problem, denke ich. Und danke noch mal«, antwortete ich ebenfalls verlegen.
»Gern geschehen, ich konnte deine Hilferufe ja unmöglich ignorieren.« Mit jedem Wort wanderten seine Mundwinkel bis ein strahlendes Zahnpasta-Lächeln zu sehen war. »Du solltest aber lieber nachschauen, ob noch alles da ist und der Typ nichts herausgenommen hat.« Als hätte mein Gegenüber alle Zeit der Welt, schob er seine Hände in die Taschen seines Wintermantels und sah mich auffordernd an. Ich hingegen stand stocksteif da und wusste nicht, was ich sagen oder tun sollte. Mein erster Gedanke war, mich einfach auf dem Absatz umzudrehen und abzuhauen. Aber natürlich konnte ich das nicht machen. Irgendwie musste ich mich bei meinem Retter erkenntlich zeigen.
Aber wie?
Jeder Dollar, den ich ihm geben würde, war für mich ein grober Verlust, besonders nach einem Tag, an dem ich sowieso bereits weniger Geld verdient hatte als gedacht. Zudem trug der Blondschopf einen dieser überteuerten Designermäntel, die gerade in waren. Das Wort Geldsorge kannte er also vermutlich nicht.
Erneut entstand Schweigen, doch dieses Mal fühlte es sich äußerst unangenehm an und ich wünschte mich einfach nur weg. Leider machte mein unbekannter Retter nicht den Eindruck, als würde er mich einfach so gehen lassen. Da mir also nichts anderes übrig blieb, brachte ich es schnell hinter mich.
»Hör mal … also ich bin dir echt dankbar für deine Hilfe, aber ich habe leider nichts, was ich dir als Gegenleistung geben kann. Es sei denn, du stehst auf Lippenpflegestifte mit Ananas- und Kokosgeschmack.« Mein Versuch, die Situation mit einem lahmen Witz zu lockern, hinderte meine Wangen nicht daran, erneut warm zu werden. Vermutlich leuchteten sie auch wie Feuerwehrsirenen.
Super ätzend!
Mein Gegenüber runzelte die Stirn und blickte mich irritiert an. »Was? Ich erwarte doch keine Gegenleistung, Cathy. Ich wollte dir einfach nur helfen. Nicht mehr.« Nun schüttelte er den Kopf, als hätte ich ihn mit meinen Worten beleidigt. Als er jedoch wieder aufsah, wirkte er nicht verletzt, sondern lächelte charmant. »Aber wenn du dich unbedingt bei mir erkenntlich zeigen willst, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ich dich auf einen Kaffee einladen darf.«
Seine Antwort verblüffte und überraschte mich derart, dass ich ganz vergaß mich darüber zu wundern, dass er meinen Namen kannte.
»Du willst mich auf einen Kaffee einladen? Als Dankeschön dafür, dass du mir meine Tasche wiedergebracht hast?« Selbst nachdem ich die Worte wiederholt hatte, ergaben sie für mich keinen Sinn. Ich musste mich verhört haben!
Doch mein Gegenüber nickte nur.
»Ja, wieso denn nicht? Offenbar möchtest du dich unbedingt bei mir bedanken, Geld nehme ich aber nicht an. Was ist also die Lösung?« Der Blondschopf wartete keine Antwort ab, sondern sprach selbst weiter. »Richtig, du gibst mir etwas, das dir nicht weh tut, mir aber eine Freude macht. So wären wir quitt und hätten beide etwas davon. Was meinst du?«
Ich spürte, wie mein Mund sich einen Spalt öffnete, während ich mein Gegenüber ansah, als hätte er den Verstand verloren.
Vielleicht hatte er das auch.
Oder war ich hier diejenige, deren Gehirnwindungen durchgeschmort waren?
Egal! Das hier konnte nur …
Ruckartig kam mir ein Gedanke, der mich stutzen ließ. Natürlich! Wieso war ich nicht früher darauf gekommen?! Am liebsten würde ich meinen Kopf gegen eine Wand schlagen. Es gab nur einen Grund, wieso jemand wie er – gutaussehend, vermögend, hilfsbereit und charmant – mit jemandem wie mir einen Kaffee trinken gehen wollte. Und dieser Grund reichte von einem harmlosen Flirt bis hin zu einer Vergewaltigung mit anschließendem Mord.
So oder so, ich war nicht so dumm sein Angebot anzunehmen.
»Jaaa, das würde ich wirklich gerne, aber ich muss jetzt nach Hause. Mein Freund wartet auf mich. Er … er ist schrecklich eifersüchtig, seit er bei der Polizei arbeitet.« Zögerlich trat ich einen ersten Schritt zurück, während ich den Griff um meine Tasche verstärkte. »Aber danke noch mal für deine Hilfe.« Ich wagte einen weiteren Schritt zurück. »Hoffentlich hast du nicht lange Schmerzen.« Mit dem nächsten Schritt nach hinten drehte ich mich herum und lief zurück in Richtung Hauptstraße, wo die immer lauter werdende Geräuschkulisse die Rufe meines unbekannten Helden schluckte und ich mir nicht mehr sicher sein konnte, ob er wirklich meinen Namen gerufen hatte.