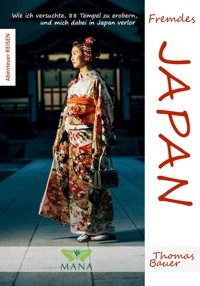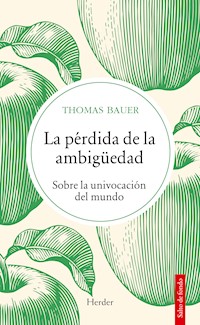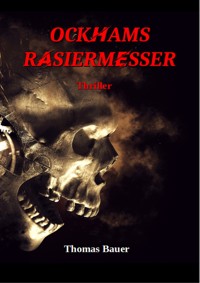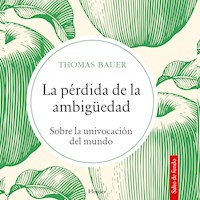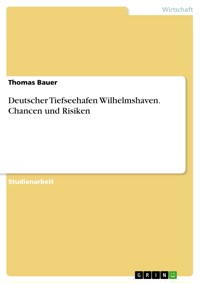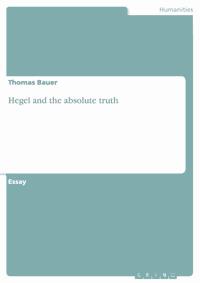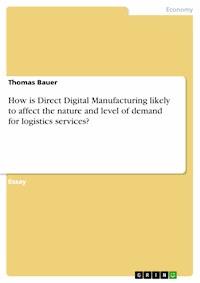15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Konrad Theiss Verlag GmbH
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Was den jüdischen, christlichen und islamischen Glauben verbindet: Gott spricht Der Glaube von Juden, Christen und Muslimen setzt voraus, dass Gott spricht und sich offenbart. Doch wie stellen sich die drei monotheistischen Religionen ein Sprechen Gottes und die göttliche Offenbarung vor? Und welche Sprache sprechen wir, wenn wir über und mit Gott sprechen - sei es im Gebet, im Gottesdienst oder in Diskussionen? Der Judaist Alfred Bodenheimer, der katholische Theologe Michael Seewald und der Islamwissenschaftler Thomas Bauer denken über die Kommunikation zwischen Gott und den Menschen nach. Jeder der drei Autoren setzt dabei seine eigenen Akzente - literaturwissenschaftlich, kulturgeschichtlich, theologisch - so dass ein interreligiöses wie interdisziplinäres Kaleidoskop entsteht. - Kann es sein, dass wir Gott verstehen? Drei Essays - Gesetz, Geist und Geschichte: Die drei Sprachen Gottes im Judentum - Die Sprache Gottes als Thema christlicher Theologie - Die »undeutlich-deutliche« Sprache Gottes im Islam - Das Verhältnis zwischen Offenbarung und kanonischen Texten Im Anfang war das Wort: können wir Gott verstehen? Der Frage nach der Sprache Gottes geht ein Erstaunen voraus. Der transzendente Gott, das große Andere, spricht - und dies auch noch in einer Weise, die Menschen zu verstehen glauben. Wie ist das möglich? Welche Instanzen beanspruchen für sich, Dolmetscher Gottes zu sein? Was bedeutet es, wenn Gott schweigt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Prof. Dr. Thomas Bauer lehrt Islamwissenschaft undArabistik an der Universität Münster.
Prof. Dr. Alfred Bodenheimer lehrt Religionsgeschichteund Literatur des Judentums an der Universität Basel.
Prof. Dr. Michael Seewald lehrt Dogmatik undDogmengeschichte an der Universität Münster.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überwww.dnb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitungdurch elektronische Systeme.
wbg Theiss ist ein Imprint der wbg.
© 2022 by wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt
Die Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der wbg ermöglicht.
Layout und Satz: Arnold & Domnick, Leipzig
Umschlagabbildung: Byzantinische Buchmalerei, © Bibliothéque Nationale Paris/akg-images; erster Absatz des Esterbuchs, © Israel Talby/akg-images; Ausblendung aus Sure 9, Vers 5-9.
Umschlaggestaltung: Finken & Bumiller, Stuttgart
Gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem Papier
Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de
ISBN 978-3-8062-4494-6
Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:
eBook (PDF): ISBN 978-3-8062-4495-3
eBook (epub): ISBN 978-3-8062-4497-7
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Impressum
Inhalt
Warum wir drei Essays über die Sprache Gottes geschrieben haben
Thomas Bauer, Alfred Bodenheimer, Michael Seewald
Die drei Sprachen Gottes im Judentum: Gesetz, Geist und Geschichte
Alfred Bodenheimer
„Eines hat Gott gesprochen, zweierlei habe ich gehört.“ Über die Sprache Gottes als Thema christlicher Theologie
Michael Seewald
Die undeutlich-deutliche Sprache Gottes im Islam
Thomas Bauer
Warum wir drei Essays über die Sprache Gottes geschrieben haben
Thomas Bauer, Alfred Bodenheimer, Michael Seewald
Judentum, Christentum und Islam setzen voraus, dass Gott spricht. Ihren Ursprung, ihre Legitimation und ihre letzte Wahrheit führen sie auf eine höhere Macht zurück, die menschlichem Zugriff entzogen bleibt, aber sich den Menschen dennoch mitteilt. Der Hinweis, dieses oder jenes sei geoffenbart, lässt sich einerseits benutzen, um den eigenen Geltungsansprüchen Vorrang gegenüber anderen Glaubens- und Denkweisen einzuräumen. Andererseits kann ein Begriff wie „Offenbarungsreligion“1, zumal seit der Aufklärung, aber auch in eine Dualität eingebettet werden, in der er eine negative Bedeutung annimmt. Das geschieht dort, wo Offenbarungs- und Vernunftreligion einander gegenübergestellt werden.2 Das Prädikat „Offenbarungsreligion“ wäre dann keine Auszeichnung einer von höherer Wahrheit beseelten Glaubensgemeinschaft mehr, sondern Ausdruck mangelnden Vernunftgebrauchs.
Positiv gewendet drückt der Begriff der Offenbarung jedoch drei Aspekte aus, die für das Judentum, das Christentum und den Islam gleichermaßen, wenn auch nicht in derselben Weise, von Bedeutung sind.
Er setzt erstens voraus, dass Gott transzendent, jenseitig ist. Wie diese Transzendenz genau zu denken sei, ist nicht nur zwischen den Religionen, sondern auch innerhalb der denkerischen Vielfalt umstritten, die die drei Religionen in ihrem Inneren prägt. Die erkenntnismäßigen Folgen der Transzendenz Gottes sind es hingegen weniger: Das natürliche Erkenntnisvermögen des Menschen mag ausreichen, um sich einen Begriff von Gott zu bilden und diesen Begriff mit bestimmten Eigenschaften (Allmacht, Allwissenheit oder Ewigkeit) zu versehen. Das Erkenntnisvermögen allein reicht jedoch nicht aus, um Gott im personalen Sinne als ein in den Gang seiner Schöpfung involviertes Wesen zu erfassen.
Deshalb, so die zweite Annahme, die Judentum, Christentum und Islam teilen, gibt Gott sich über das hinaus, was die Vernunft des Menschen kraft eigener Anstrengung von ihm erfassen kann, selbst zu erkennen. Dieser Akt des Sich-zu-Erkennen-Gebens Gottes wird als Offenbarung bezeichnet. Nicht ohne Verlegenheit greifen die drei Religionen dort, wo sie versuchen, die Frage zu beantworten, wie man sich das Geschehen der Offenbarung vorstellen solle, auf Analogien der zwischenmenschlichen Kommunikation zurück, vor allem auf den Akt der Rede, die Tätigkeit des Sprechens und das Phänomen der Sprache.
Die Verlegenheit, die dem Satz „Gott spricht“ zu eigen ist, deutet einen dritten Aspekt an: Offenbarung wird in Judentum, Christentum und Islam nicht so verstanden, als trete Gott der Dunkelheit des menschlichen Geistes im Lichtkegel des Glaubens in restloser Klarheit entgegen. Die Entzogenheit und die Zugänglichkeit Gottes durchdringen sich wechselseitig und werden auch dort, wo von Offenbarung die Rede ist, nicht aufgehoben. So haben Offenbarungsreligionen sich einerseits mit dem zu befassen, was etwa im Rahmen einer philosophischen Gotteslehre auch außerhalb des Bezugs auf Offenbarung an Sinnvollem über Gott gesagt werden kann. Sie haben andererseits damit umzugehen, dass zum Glauben an einen redenden Gott die Erfahrung des schweigenden Gottes gehört.
Diese Gleichzeitigkeit zwischen einem verborgenen Gott, einem offenbaren Gott und einem Gott, der sich in seiner Offenbarkeit verbirgt (und sich vielleicht auch in seiner Verborgenheit enthüllt), ist eine Triebfeder religiöser Gelehrsamkeit. Die intellektuellen Leistungen dieser Gelehrsamkeit sind beeindruckend – und zwar über die je eigene Glaubensgemeinschaft hinausgehend und wahrscheinlich auch jenseits der Frage, ob man selbst an Gott glaubt oder nicht. Um die Versuche jüdischen Denkens, den Glauben an die Treue Gottes auch im Angesicht des Katastrophischen zu vertreten, um die Wortspekulationen christlicher Logostheologie und die ausgefeilte Linguistik islamischer Sprachphilosophie wertschätzen zu können, braucht man vermutlich, um ein viel zitiertes Wort Max Webers abzuwandeln, ein wenig an religiöser Musikalität; ein religiöser Virtuose, der, wie Weber sagen würde, „seelische Bauwerke religiösen Charakters“3 errichtet, muss man dazu jedoch nicht sein.
Die folgenden drei Beiträge sind Essays. Essays sind tentativ, assoziativ und subjektiv. Sie bleiben tentativ in dem Sinne, dass sie ein Problem nicht erschöpfend behandeln und erst recht nicht abschließend lösen. Essays werfen vielmehr Schlaglichter auf Themen, die eigentlich zu groß sind, um im Rahmen eines Aufsatzes behandelt zu werden, aber auch zu interessant erscheinen, um nicht über sie zu schreiben. Diesem Dilemma begegnen sie, indem sie assoziativ voranschreiten. Assoziativ bedeutet nicht beliebig, sondern bezeichnet ein Vorgehen, bei dem Dinge verbunden werden, deren Verbindung (zumindest auf engem Raum) nicht zwingend erscheint, aber dennoch nachvollziehbar und sinnvoll ist. Essays sind daher subjektiv. Sie erschließen ein breit gefasstes Problem, indem sie es durch den Filter der Beschränktheit einer einzelnen Person tröpfeln lassen. Der tentative, assoziative und subjektive Charakter der drei in diesem Band vorgelegten Essays schließt aus, dass wir das jeweils Gesagte zu einer höheren Synthese vereinen. Zu versuchen, den Reichtum der in Judentum, Christentum und Islam zu findenden Vorstellungen über die Sprache(n) Gottes auf den gemeinsamen Nenner einer Idealsprache zu bringen, wäre töricht. Gleichwohl prägt diesen Band bei aller Unterschiedlichkeit der in ihm vereinten Beiträge die Absicht, die beiden eingangs genannten Schwierigkeiten zu meiden, welche mit Offenbarungsreligionen verbunden sein können: Offenbarung als Chiffre eigener Überlegenheit zulasten anderer Religionen und Offenbarung als Chiffre eines sich der Vernunft entziehenden religiösen Denkens.
Beide Ziele bedingen einander. Wo Angehörige verschiedener Religionen die Differenziertheit wahrnehmen, in der in ihren eigenen und in anderen religiösen Traditionen über Gott nachgedacht wird, besteht zumindest die Hoffnung, dass das Staunen über den hohen Komplexitätsgrad die Neigung zum schnellen Urteilen hemmt. In dieser Komplexität zeigt sich gerade dort, wo Judentum, Christentum und Islam den Glutkern ihres Glaubens verorten – in der Vorstellung eines sprechenden Gottes – eine intellektuelle Kreativität, die einen der Reize dieser Religionen als Objekte aufmerksamen Studierens ausmacht. Deshalb erscheint es uns lohnend zu fragen: Welche Sprache spricht Gott?
Anmerkungen
1 Zur Entwicklung dieses Begriffs vgl. Max Seckler: Was heißt Offenbarungsreligion? Eine semantische Orientierung. In: Ders., Glaubenswissenschaft und Glaube. Beiträge zur Fundamentaltheologie und zur Katholischen Tübinger Schule (Band 2: Im Spannungsfeld von Offenbarung und Religion. Zur Katholischen Tübinger Schule und zu Johann Sebastian Drey). Tübingen 2013, S. 115–130.
2 Vgl. Gottfried von Fellenberg: Ueber das Verhältniß von Offenbarungs- und Vernunftreligion bei Kant und Lessing. Erlangen 1883, S. 8f.
3 Max Weber: Brief an Ferdinand Tönnies vom 19. Februar 1909. In: Max Weber Gesamtausgabe (Abteilung 2: Briefe, Band 6). Tübingen 1994, S. 63–66, hier S. 65: „Denn ich bin zwar religiös absolut ‚unmusikalisch‘ und habe weder Bedürfnis noch Fähigkeit, irgendwelche seelischen ‚Bauwerke‘ religiösen Charakters in mir zu errichten – das geht einfach nicht, resp. ich lehne es ab.“
Illuminierte Titelseite einer Handschrift aus dem Jahr 1400 des „Sefer Ahava“ (Buch der Liebe), des zweiten Bands der vierzehnbändigen Halachasammlung und -erörterung Mischne Tora des Maimonides (zw. 1235 und 1238–1204). Das über den Text gestellte Motto ist ein Zitat aus Psalm 119, Vers 97 und bedeutet: „Wie lieb ich deine Lehre! Meine Rede ist sie den ganzen Tag.“ (Bildnachweis: Universitätsbibliothek Jerusalem/akg-images)
Die drei Sprachen Gottes im Judentum: Gesetz, Geist und Geschichte
Alfred Bodenheimer
Einleitung
Wer selbst keine Macht hat, braucht einen umso mächtigeren Gott. Und er braucht einen Gott, dessen Macht, da sie in territorialer Konzentration und Ausbreitung oder kriegerischen Erfolgserlebnissen seiner Anhängerinnen und Anhänger nicht festzumachen ist, umso deutlicher einerseits den Kosmos, andererseits das Leben der Gläubigen umfasst, sowohl der Individuen wie des Kollektivs. Das war über weite Strecken der Geschichte die Realität, unter der die jüdische Gemeinschaft lebte.
Die Sprache dieses Gottes, so vielfältig sie in der jüdischen Geschichte auftritt, ist immer mit einer Vielzahl von Eigenschaften aufgeladen. Sie ist allumfassend und intim, entzogen und bis ins Detail lebensbestimmend, stumm und unüberhörbar laut. Es ist die Stimme eines Gottes, der erst zum Gott der Juden wird, als die Juden selbst zu Juden werden. Diesen Termin zu bestimmen, ist auf das Jahr genau möglich. Es ist das Jahr 586 v. u. Z., in dem der Salomonische Tempel in Jerusalem zerstört wird und eine Massendeportation vor allem der Eliten Judäas in das Babylonische Reich stattfindet, während andere Gruppen in den Süden nach Ägypten emigrieren. Was zuvor eine territorial homogene Bevölkerung mit einem kultischen Zentrum war, einem unsichtbaren Gott verbunden, dessen Präsenz vom Volk und seinen Herrschern oft verdrängt und von Propheten wieder beschworen wurde und dessen Wirken in der Welt vor allem mit Bezug auf Wohl und Wehe des eigenen Landes definiert war, wandelte sich nun – und für immer – in eine weithin zerstreute Gemeinschaft, die überall, wo sie lebte, unter fremder Herrschaft stand, meist selbst im Land ihrer Herkunft. Entsprechend fragil und prekär war ihre Existenz – und dies gar nicht immer primär des Antijudaismus wegen, sondern weil der Sog umgebender Gesellschaften und ihrer Kultur oft beträchtlich war, während die Konversion zum Judentum kaum je Dimensionen annahm, die die Verhältnisse nachhaltig hätten verändern können.
Die Entstehung des Judentums in der Form, die seither seinen Namen und seine Identität ausmacht, ist also untrennbar verbunden mit dem konstanten Einwirken einer mächtigen Zentrifugalkraft der möglichen Auflösung, der es sich entgegenstemmt, um überhaupt weiterzubestehen. Um die dafür entsprechende Kohäsion zu schaffen, war es von allerhöchster Bedeutung, der Defizienz empirischer Realität ein göttliches Gegenwicht der Sinnhaftigkeit gegenüberzustellen. Die Präsenz Gottes nicht nur in der Welt, sondern im eigenen Leben, Handeln und Hoffen, als Individuum wie als Gemeinschaft, war deshalb die Grundlage jüdischer Existenz. In der Folge soll gezeigt werden, dass es im Wesentlichen drei Ansätze gab, sich Gottes Gegenwart und Wirken zu versichern, drei Äußerungsformen oder eben „Sprachen“ Gottes, aus denen die richtigen Schlüsse zu ziehen Aufgabe der Menschen, bzw. ganz spezifisch der jüdischen Gemeinschaft, war. Diese drei Sprachen können keinesfalls hermetisch voneinander abgegrenzt werden, sie interagieren und interferieren vielmehr stark, wie auch jüdische Religionsgeschichte nie frei vom Austausch mit der jeweiligen zeitgenössischen und örtlichen Umgebung war, was zu gegenseitiger Beeinflussung oder bewusster Abgrenzung führte.
Dennoch – oder gerade deshalb – bietet eine Benennung und Betrachtung der drei Sprachen Gottes im Judentum einen Anhaltspunkt, um Konstanten und Brüche im jüdischen Denken und letztlich in der jüdischen Geschichte, nicht zuletzt auch die Gegenwart des Judentums, insgesamt besser verstehen und einordnen zu können.
Die drei Sprachen Gottes lassen sich unter den Begrifflichkeiten Gesetz, Geist (bzw. Kosmos) und Geschichte einordnen. In sich sind diese Sprachen jeweils auch Objekt der Interpretation – ja, die Interpretationen sind es erst, die sie zum Klingen bringen. Dabei geht es der Rezeptions- und Interpretationsgemeinschaft mitnichten immer vorrangig darum, Gott zu „verstehen“, sondern oft genug auch darum, selbst zu einer Art Resonanzraum des göttlichen Sprechens zu werden – ein Auftrag, der weit mehr als ein passives Anerkennen göttlicher Autorität auslöst. Vielmehr stellt er die Gemeinschaft der Gläubigen in den stetigen Dienst Gottes – indem faktisch nur sie selbst die Erfüllung der in Gottes Sprechen enthaltenen Botschaften leisten können.
Die Entwicklung dieser drei Sprachen nach der Zerstörung des Ersten Tempels ist ein komplexer, lange andauernder Prozess, der von der Loslösung der bis dahin bekannten Modelle jüdischen (oder judäischen) Selbstverständnisses zu ersten Ansätzen einer neuen Auslegeordnung führt. Ihre Spuren sind in der Bibel in den Büchern Esra sowie bei den Propheten Haggai, Secharja und Maleachi und im 2. Chronikbuch zu finden. In den Jahrzehnten nach der Deportation besiegter Judäerinnnen und Judäer nach Babel wird das babylonische Weltreich vom persischen besiegt, und dessen Herrscher sind einer Rückkehr der Verschleppten in ihre Heimat gegenüber aufgeschlossen. In der Folge ist es ein direkter Nachkomme des Davidischen Königshauses, Zerubavel, der – als vom persischen König eingesetzter Gouverneur – eine Gruppe von Juden mobilisiert, nach Jerusalem kommt und die Wiedererrichtung des Tempels anstößt, der (nach einigen Verzögerungen und Verwerfungen) auch fertiggebaut und im Jahr 516 v. u. Z. eingeweiht wird.
Mit dem Buch des Propheten Maleachi, der in der Zeit nach dem Wiederaufbau des Zweiten Tempels wirkt, endet aus jüdischer Sicht die Epoche des Prophetentums, also des unmittelbar von Gott inspirierten menschlichen Sprechens. Wie es der Name Maleachi sagt (auf Hebräisch: mein Bote), spricht er im Namen Gottes, beklagt Missstände, fordert zu moralischem Handeln auf, wie wir es aus den Reden früherer Propheten kennen. Mit ihm tritt noch einmal der Prophet als „Sprachrohr“ Gottes auf. Doch er operiert auf einer Zeitschwelle, in der einer unmittelbaren Offenbarungsrede keine Zukunft beschert ist. Der vollständige Verlust jüdischer Reichsautonomie und die Herrschaft fremder Mächte über Wohl und Wehe auch der heiligen Stätten sowie über die jüdische Bevölkerung weltweit, das offenbar dauerhafte Ausbleiben einer Verbindung von Tempel und politischer Reichsbildung rüttelte am Grundverständnis von Prophetie. Gefragt sein würde auf Dauer ein Konzept, das ein Überleben der Gemeinschaft sowohl in ihren lokalen Zellen wie in ihrer globalen Zerstreuung auf den Zielpunkt eines als messianisch umschriebenen Zeitpunkts hin sichern konnte.
Aufschlussreich wird die Gestalt des Maleachi vor allem dann, wenn man die Diskussionen in Betracht zieht, die einige Jahrhunderte später im Babylonischen Talmud (Traktat Megilla 15a) die Rabbinen über dessen Identität geführt haben. Der gar sehr funktional anmutende Name dieses Propheten und der Umstand, dass von ihm weder Herkunftsfamilie noch Vaterhaus erwähnt werden, führte zur Vermutung, es handle sich um das Pseudonym einer anderen biblischen Persönlichkeit. Ein Gelehrter meint, Maleachi sei Mordechai gewesen, eine der zentralen Gestalten aus dem Estherbuch, in dem (unter der Herrschaft eines Perserkönigs) das Volk der Juden aufgrund des Komplotts eines angesehenen Höflings von der Gefahr der Ausrottung bedroht ist und schließlich durch das beherzte Eingreifen der jüdischen Königin Esther gerettet wird. In diesem Buch, dem einzigen der Hebräischen Bibel, das keinerlei unmittelbaren Bezug zu Gott aufweist, wird Mordechai mit dem Attribut „hajehudi“ (der Jude) bezeichnet – ein Begriff, der auf die Nichtbeheimatung in der persischen Diaspora verweist. Indem das Estherbuch damit beginnt, dass der Perserkönig an einem Bankett aus den einst von den Babyloniern erbeuteten Gefäßen des Jerusalemer Tempels trinkt und indem Mordechai als Exilierter bezeichnet wird, ist die ganze Fremdheit und Preisgegebenheit, die in der Bezeichnung „hajehudi“ steckt, offensichtlich.
Ein anderer Gelehrter des Talmud identifiziert Maleachi als Esra. Dieser aus dem Priestergeschlecht stammende Satrap des persischen Königs, der nach Vollendung des Tempels nach Jerusalem geschickt wird, trägt in der jüdischen Überlieferung den Titel „hassofer“ (der Schreiber). Er gilt als Schlüsselfigur für die Verlagerung der Gesetzesauslegung von der schriftlichen Tora (also den fünf Büchern Moses) in die mündliche, also die Durchsetzung des Primats jener Überlieferung, die dann, gestützt auf die Autorität Gottes als unmittelbarer Quelle, zur Basis des pharisäischen und später rabbinischen Diskurses wird. Ein Schreiber (man könnte wohl auch sagen: Kopist) verbreitet das bereits bekannte Material, er spricht nicht inspiriert, sondern interpretativ.
Die Mehrheit der Rabbinen erklärt hingegen in dieser talmudischen Diskussion lakonisch: „Sein Name ist Maleachi“, d. h. er ist eine eigenständige prophetische Persönlichkeit.
Diese drei Zuordnungsvarianten für den letzten kanonisierten Propheten der Hebräischen Bibel verweisen auf einen Paradigmenwechsel in der Zeit des sich neu formierenden Judentums. Mordechai und Esra gelten in den jeweiligen biblischen Büchern, in denen sie auftreten, nicht als Propheten. Ihnen wird also gewissermaßen durch die Identifizierung mit Maleachi eine doppelte Funktion zugemessen. Auch stehen sie beide für jene Sprachen Gottes, deren Wirkungsweise sich in dieser Zeit auszubilden beginnt. Mordechais Name ist mit der verdeckten historischen Wirkweise Gottes im Estherbuch verbunden. Die Juden werden aus der Not gerettet und zu einem Sieg über ihre Feinde geführt, der mit dem Purimfest dokumentiert wird. Ein offenes Eingreifen oder auch nur Nennen Gottes unterbleibt jedoch.
Esra demgegenüber verfügt, anders als alle kanonisierten Propheten seit der Königszeit, über politische Macht, wenn auch vom persischen König verliehene. Er ist eine Führergestalt, die das jüdische Gesetz interpretiert und zugleich implementiert, allem voran die Verfügung, dass sich jüdische Männer in der Provinz Yehud (dem früheren Judäa) von ihren nicht jüdischen Frauen zu trennen hätten. Interessanterweise beruht die Argumentation nicht auf Götzendienst oder anderweitigen schlechten Einflüssen der Frauen, sondern auf einer Ideologie, die schon stark von Esras Herkunft aus der gefährdeten Minderheitendiaspora gefärbt scheint: dem Erhalt eines jüdischen Volkstums. Die Einführung der matrilinearen Vererbung des Judentums, als deren Begründer Esra lange Zeit galt, wird aber inzwischen in der Forschung später verortet.1
Dass schließlich Maleachi auch als eigenständiger Prophet bezeichnet wird, der in der Zeit Esras gewirkt haben dürfte, weist darauf hin, dass hier zwar das Auslaufen eines prophetischen Strangs beschrieben wird, dass aber grundsätzlich die Weiterexistenz inspirierten Sprechens neben dem gesetzlichen vorausgesetzt wurde. Wenn auch nicht in Form der Prophetie, so blieb Inspiration auch künftighin eine konstante Bezugsweise zum Göttlichen.
Schrieb der Talmud dem letzten der Propheten Israels also drei mögliche Identitäten und damit drei potenzielle Funktionsweisen zu, so hat die jüngere Forschung vor allem jüdischer Gelehrter zu Jesus herausgearbeitet, dass die jüdische Sicht auf die Wirkungsgeschichte Jesu mit der Frage verbunden werden muss, in welcher Funktion die Jüdinnen und Juden seiner Zeit ihn gesehen haben. War die Bergpredigt ein rebellisches Widerwort gegen das biblische Gesetz mit prophetischem Anspruch, oder war es ein persönliches Interpretationsangebot nach pharisäischer Art, wie wir sie in den rabbinischen Schriften zu Tausenden finden. War der messianische Anspruch für seine Gegner deshalb irreführend, weil nur ein historischer Befreiungsakt den wahren Messias auszeichnen konnte, während der Rückzug in das Innerlich-Jenseitige den Anspruch in sich widerlegte? Kurzum: Ist die Entfremdung von Christentum und Judentum (auch) ein Vorgang, der mit einem Paradigmenwechsel von Gottes Sprache zu tun hat?
Die drei Sprachen lassen sich in ihrer schwerpunktmäßigen Relevanz innerhalb des Judentums in Epochen verordnen, auch wenn am Beispiel der talmudischen Diskussion um die Identität des Propheten Maleachi ihre Gleichzeitigkeit und Interferenz gezeigt werden können und sie immer nebeneinander existiert haben. So wird die Epoche zwischen der Zeitenwende und dem frühen 7. Jahrhundert, aus der die Textbasis und Redaktion der unterschiedlichen rabbinischen Sammelwerke (insbesondere Mischna und Talmud) hervorgeht, hier mit dem Schwerpunkt des Gesetzes (Halacha) verbunden. Das Mittelalter und die frühe Neuzeit werden als Zeit des Geistes (Philosophie und Kabbala) behandelt, während die Moderne der Geschichte als zentraler Äußerungsform des Göttlichen zugeordnet wird. Wie schematisch auch immer dieser Zugang erscheint, erlaubt er einen Einblick in die komplexen, wechselhaften und ineinanderwirkenden Perzeptionen der göttlichen Sprachen im Judentum.
1. Halacha – die Sprache des Gesetzes
Die Halacha (ein Begriff, der mit der Übersetzung „jüdisches Religionsgesetz“ noch am ehesten, aber wie zu zeigen ist, nur sehr unvollständig wiedergegeben ist) unterscheidet sich in ihrem Selbstverständnis profund von anderen Gesetzeskorpora. Von Gesellschaften oder Herrschaftssystemen aufgestellte Gesetze orientieren sich an Realitäten, die sie normativ, im Sinne einer funktionierenden Gesellschaft, zu organisieren versuchen. Demgegenüber gilt die Tora (die fünf Bücher Mose) im klassischen Judentum als gottgegeben – wobei das 5. Buch Moses (Deuteronomium) weitestgehend aus als göttlich inspiriert verstandenen Reden des Moses besteht.
Der gesetzgeberische Charakter der fünf Bücher Moses war der zentrale Streitpunkt, der zu Zeiten des zweiten Jerusalemer Tempels Sadduzäer und Pharisäer entzweite. Die Sadduzäer begriffen den Text der Tora als positivistisch und unmittelbar anwendungsbezogen zu lesenden Gesetzestext, während die Pharisäer und später, nach der Tempelzerstörung im späten 1. und im 2. Jahrhundert n. u. Z., die als Nachfolger der Pharisäer sich verstehenden Rabbinen die Tora als zu dechiffrierendes Zeichensystem verstanden, in dem der reine Textinhalt nur einen sehr begrenzten und zuweilen im konkreten Gesetz stark zu modifizierenden Aussagewert hatte. Besonders klar äußert sich das in unterschiedlichen Varianten einer Aufzählung von „Verfahren, nach denen die Tora gedeutet wird“. Die berühmteste dieser Aufzählungen ist diejenige von Rabbi Ischmaels dreizehn Deutungsverfahren, die in die Liturgie des täglichen Morgengebets aufgenommen wurden. Feinheiten der Textanalyse verdichten sich hier zu einer subtextuell anzuwendenden Induktionsform, die gesetzesrelevante Schlussfolgerungen zulässt. Das Identifizieren gleichlautender Formulierungen an unterschiedlichen Textstellen, aus denen gesetzliche Vergleichbarkeit zweier eigentlich weit auseinanderliegenden Rechtsfragen erklärt wird, die textliche Nähe zweier Begriffe, die juristisch aufeinander bezogen werden, oder die Form von Aufzählungen unterschiedlicher Begriffe bei einer Gesetzesformulierung im Text der Tora und ihre juristisch ablesbare Interrelation wurden als Entschlüsselungstechnik mindestens so wichtig wie der Wortlaut einer Referenzstelle. In der Mischna, dem sechsteiligen rabbinischen Gesetzeswerk, das um das Jahr 200 n. u. Z. fertiggestellt und nach Sachthemen geordnet wurde und die Diskussionen aus zwei Jahrhunderten aufnimmt, sowie in dem darauf aufbauenden Palästinischen Talmud (Redaktion ca. um das Jahr 400) und dem Babylonischen Talmud (Redaktion ca. um 600) wird dies erkennbar. Halacha, wie sie dort angewandt und als Begriff eingeführt wird, ist das oft aus konkurrenzierenden Meinungen ermittelte Recht, zugleich aber auch der sich selbst erklärende Diskursrahmen. Der entscheidende Begriff, der die pharisäische und rabbinische von der sadduzäischen und später karäischen (wörtlichen) Gesetzesrezeption der Tora unterscheidet, ist derjenige der „mündlichen Tora“ (die hebräische Formulierung ließe auch die Übersetzung „auswendige gekannte Tora“ zu). Dieser Begriff fokussiert die zentrale Funktion von Überlieferung von einer Generation auf die nächste, die als dynamischer zwischenmenschlicher Prozess des Lehrens und Lernens verstanden werden muss, im Gegensatz zum statischen, unveränderlichen Zustand der „schriftlichen Tora“, die in der unverbrüchlichen Form des Pentateuchs auf den Pergamentrollen in den Synagogen gebannt ist.
Ein Beispiel dafür liefert die halachische Umsetzung der Formulierung „Wenn ein Mann eine Frau nimmt“ (Deut 24,1) im jüdischen Ehegesetz. Der Begriff „nehmen“ ließe sehr unterschiedliche Interpretationen zu. Mit Verweis auf Gen 23,13, wo es um einen Grundstückskauf des Abraham geht und wo er dem Verkäufer sagt: „nimm das Geld für das Feld von mir“, wird „nehmen“ als Akt einer Transaktion interpretiert. Indem also die Frau den Ehering des Mannes (oder theoretisch auch einen anderen Wertgegenstand) im Bewusstsein der Absicht der Eheschließung akzeptiert, „nimmt“ der Mann sie damit zu seiner Ehefrau. Darauf beruht der jüdische Trauungsakt, bei dem folglich Ringe auch nicht getauscht werden, sondern einseitig der Bräutigam der Braut einen solchen ansteckt. Die beiden biblischen Textstellen haben inhaltlich keinen Bezug zueinander, allein die durch Tradition gefestigte Referenz über den Gebrauch desselben Verbs verbindet die eine mit der anderen Stelle in halachisch relevanter Form.
Die Rabbinen haben die Dialektik von hermeneutischer Selbstermächtigung und deklarierter Rückbindung an die grundlegende Autorität der schriftlichen Tora durchaus reflektiert. Kein anderer Text vermag das so bildhaft auszudrücken wie folgende berühmte Erzählung, die der Babylonische Talmud im Traktat Menachot (29b) berichtet:
Rav Jehuda sagte in Ravs Namen: Zur Stunde, da Moses in die Höhe aufstieg, fand er den Heiligen Gelobt sei Er, der dasaß und Kronen [d. h. Ornamente] an den Buchstaben [der Tora] befestigte.
Er sprach vor ihm: Herr der Welt, wer hält deine Hand [mit diesen Verzierungen] zurück [so dass du ihretwegen die Übergabe verzögerst]?
Er sprach zu ihm: Es gibt einen Menschen, der am Ende vieler Generationen kommen wird, und sein Name ist Akiva ben Josef, der wird in Zukunft von jedem Schnörkel Unmengen von Halachot lernen.
Er sagte vor ihm: Herr der Welt, zeig ihn mir.
Er sagte ihm: Drehe dich um.
Er ging und saß in der hintersten von acht Reihen, und er verstand nicht, was sie sagten. Seine Kraft erlahmte. Als sie zu einer bestimmten Sache kamen, sagten ihm [dem Lehrer Rabbi Akiva] seine Schüler: Rabbi, woher hast du diese [Auslegung]? Er sagte ihnen: Es ist eine Halacha, die Moses am Sinai erhalten hat. Da beruhigte er [Moses] sich.
Mit Bezug auf die schon in der Antike eingeführte speziell mit Krönchen versehene Schrift der Torarollen wird hier Moses als Zeuge eines Deutungsprozesses aufgeboten, der als von Gott schon bei der Übergabe der Tora intendierter dargestellt wird. Moses selbst ist ausdrücklich nicht der finale Ausdeuter des Tora-Textes, er kann die Deutungen späterer Generationen nicht einmal verstehen. Wichtig ist nur, dass die Interpretationslinie immer auf Gottes Wort an ihn und somit an das Urmoment der Offenbarung rückgebunden wird.
Die Verselbstständigung des rabbinischen Diskurses, der konsequent auf die Tora als Bezugsgröße verweist und zugleich ein