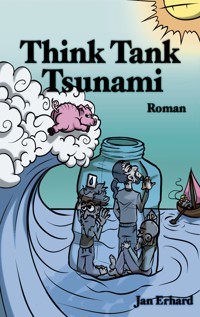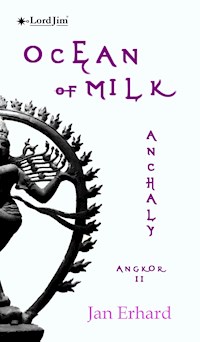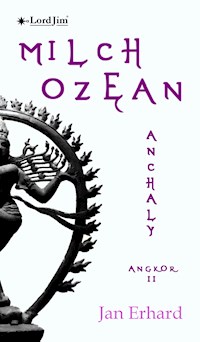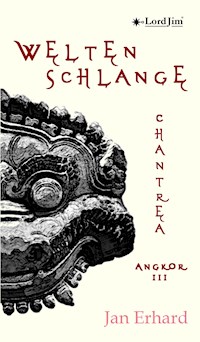
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Angkor
- Sprache: Deutsch
Ein Sklave der Khmer bricht alle heiligen Regeln der Vorsehung und niemand darf es wissen. Jeden Tag betrügt er die Götter, aber wer die Unsterblichen verhöhnt, muss ihre Rache fürchten: Arun opfert einem wahnsinnigen Herrscher seinen Stolz und zahlt den Preis für das Geheimnis seiner Liebe. Er will aufgeben, wenn da nicht Chantrea wäre, sein kleiner Sohn. Der dritte historische Abenteuerroman über das legendäre Weltwunder und die Fortsetzung einer unsterblichen Geschichte in neuer Ausgabe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Weltenschlange
Weltenschlange - ChantreaReiheWidmungDankEcksteinQuersteinGeweihter WahnsinnPfeilerDie Umarmung der SchlangeDie Zitadelle der FrauenErste GalerieDer Krieg und der WegVater und SohnAnhang I - PersonenAnhang II - ZeittafelAnhang III - GlossarAnhang IV - Angkors HerrscherAnhang V - KartenImpressumWeltenschlange - Chantrea
Jan Erhard
WELTENSCHLANGE – CHANTREA
Historischer Abenteuerroman
in zwei Teilen
Das Buch
Ein Sklave der Khmer bricht alle heiligen Regeln der Vorsehung und niemand darf es wissen. Jeden Tag betrügt er die Götter, aber wer die Unsterblichen verhöhnt, muss ihre Rache fürchten: Arun opfert einem wahnsinnigen Herrscher seinen Stolz und zahlt den Preis für das Geheimnis seiner Liebe. Er will aufgeben, wenn da nicht Chantrea wäre, sein kleiner Sohn.
Der dritte historische Abenteuerroman über das legendäre Weltwunder und die Fortsetzung einer unsterblichen Geschichte in neuer Ausgabe.
Der Autor
Jan Erhard wurde 1969 in Bochum geboren, wuchs in Rüsselsheim auf und studierte Philosophie und Geschichte in Berlin. Zur Entstehung Angkors, des Weltwunders in Kambodscha, arbeitet er seit 2003 an historischen Abenteuerromanen, die nun in einer neuen Ausgabe erscheinen.
Jan Erhard lebt mit seiner Familie im brandenburgischen Teltow.
Reihe
Widmung
Für Luisa Anjuli
Dank
Wieder danke ich Menschen, die mir Mut machten. Ich danke Allen,
die sich durch verschiedene Fassungen kämpften und nicht mit Kritik sparten.
Beate, Lea, Anne, Katharina, Kay, Detlef, Lena, Luisa – ohne Euch wäre dieses Buch Stückwerk geblieben.
Ich danke den Angestellten der Berliner S-Bahn, in deren Zügen ich viele Stunden arbeiten konnte.
Tatsächlich entstand ein wesentlicher Teil dieses Romans auf Schienen.
Ich danke meiner Frau und unseren Kindern
für ihre liebevolle Unterstützung.
Eckstein
»Nicht die Großen sind mächtig, sondern die Mächtigen sind groß.« Suryavarman II.
An die ehrenwerten Gentlemen, die der Royal Geographical Society anzugehören belieben,
vor zwei Jahren kam die honorige Gesellschaft auf ihren Beschluss hin einem kollegialen Anliegen meinerseits entgegen. Wenn Sie sich freundlichst daran erinnern wollen: Auf wohlwollende Weise unterstützen Sie seitdem meinen Schützling, Mr. Henri Mouhot, in seinem hehren Wunsch, die siamesische Fauna und Flora zu erforschen. Nicht zuletzt taten Sie dies im Andenken an den Onkel seiner Frau, den Heroen, der mit der Nigerfrage das größte Rätsel seiner Zeit löste, unseren unvergessenen Mitstreiter Mungo Park. Für Ihre generöse Gunst haben Sie meinen verbindlichsten Dank verdient und können sich meiner fortwährenden höchsten Wertschätzung gewiss sein. Nun gereicht es mir zur Ehre, Ihnen mit diesen Zeilen einen ersten, wenn auch leider nicht in allen Belangen erfreulichen Bericht geben zu dürfen.
Henri Mouhot ließ seine Familie, Freunde und jeden Vorteil der Zivilisation hinter sich, um dem südostasiatischen Dschungel seine Geheimnisse zu entlocken. Im Dienste der Forschung erkundet er seit nunmehr vierzehn Monaten unbekannte Regionen der Wildnis und gedenkt, diese wertvolle Arbeit auf noch unbestimmte Zeit fortzusetzen. Seine ausgezeichnete Konstitution, seine unleugbaren wissenschaftlichen und künstlerischen Fertigkeiten haben sich bewährt, soviel kann ich sagen. Allerdings geben mir seine intellektuellen und moralischen Qualitäten, die ich zuerst als durchaus erfolgsversprechend einschätzte, nun Grund zur Sorge. Aber verzeihen Sie, ich greife vor.
In Kampuchea angekommen erhielt er – sicher aufgrund seiner gewinnenden Art – erfreulich rasch die Unterstützung des einheimischen Königs. Sodann konnte er mit Ihrer unschätzbaren Hilfe eine Expedition ausrüsten, die er mit Erfolg in die zentrale Provinz des Landes führte. Ungeachtet aller beträchtlichen Widrigkeiten, der feuchten Schwüle und dem stets drohenden Fieber, gelang die Vermessung zahlreicher Flüsse, Berge und anderer topografischer Besonderheiten. Selbstredend wird Mr. Mouhot auch nicht müde, jede unbekannte Art präzise zu beschreiben und mit seiner Feder festzuhalten. Kopien dieser detailreichen Zeichnungen liegen den Briefen bei, die er trotz denkbar schwieriger Umstände in regelmäßigen Abständen an mich schreibt.
Nun jedoch zu der gegenwärtigen Verwicklung: Vor zwei Monaten überquerte das Unternehmen den Tonle Sap, einen enormen See im Herzen des Königreiches, und erreichte den Mekong. Dort, in der Nähe des Stroms kam es zu jener letztlich unverständlichen Verzögerung, die bis zum heutigen Tage anhält. Mein Schützling entdeckte nämlich im Dschungel die alten Ruinen einer Tempelstadt, deren Schönheit ihn nachdrücklich fasziniert. Zugegeben, die angefertigten Skizzen von diesem sogenannten Ongcor Vat beeindrucken durchaus. Allerdings vergleicht Mr. Mouhot seine Entdeckung mit den Pyramiden und zeigt damit eine Begeisterung, die wohl seinem noch recht jungen Alter geschuldet ist. Auch wirken seine Angaben übertrieben. So will er nur im zentralen Heiligtum über eintausendfünfhundert Säulen gezählt haben – man stelle sich das vor! Dagegen erschiene sogar die große Säulenhalle in Karnak geradezu als Lappalie. Immerhin – dieser infantile Überschwang ließ sich überprüfen. Ein ortsansässiger Abbé und Landsmann von Mr. Mouhot erzählte nämlich von dem Bericht eines chinesischen Gesandten, der bereits Ende des dreizehnten Jahrhunderts im Dienste der Mongolenkaiser Ongcor besucht hatte. Dieses Büchlein wurde schon vor fast fünfzig Jahren ins Französische übersetzt und in Paris veröffentlicht, doch offenbar kaum gelesen. Ich habe die Schrift inzwischen eingesehen, muss aber sagen, dass dieser Chou Ta-Kuan die Tempelanlagen ungleich nüchterner beschreibt als mein Protegé. Leider bleibt vollkommen ungewiss, von wem und wann diese sicherlich beachtenswerte Stadt – das will ich zugeben – errichtet worden sein könnte. Die regionale Überlieferung besagt, dass der Vorfahre von Kopfjägern, zum Gottkönig aufgestiegen, das zentrale Heiligtum erbauen ließ und heutzutage blutrünstige Nachkommen sein Erbe bewachen. Natürlich verwirft Mr. Mouhot diese krude Legende und beweist damit einen Rest gesunden Menschenverstands, auch wenn seine letzten Briefe ansonsten nur befremden können. Der Duktus schwankt zwischen Überschwang und ratlosen Einlassungen, manche Passagen geben gar mystische Verweise. In Teilen sind die Zeilen kaum zu entziffern, was hoffentlich nur an den widrigen Bedingungen im Dschungel liegt, denen er sich ausgesetzt sieht.
Was die Zivilisation anbelangt, die jene Überreste hinterlassen hat, scheint festzustehen, dass sie irgendwann vor Beginn der Renaissance untergegangen sein muss. Welches fraglos traurige Dasein die imposanten Bauten seitdem fristeten, hüllt sich zwar in die Schleier der Äonen, aber Mr. Mouhot glaubt zumindest nicht, dass er als erster Kulturmensch diese Ruinen entdeckte. Nach Auskunft des Missionars besuchten bereits vor Jahrhunderten verschiedene Portugiesen den Ort, wofür es eine sekundäre Affirmation gibt: Gegenwärtig wird die Tempelstadt von buddhistischen Mönchen bewohnt, deren Abt Mr. Mouhot die Tempelaufzeichnungen studieren ließ. Und tatsächlich finden sich in den Urkunden des Klosters Hinweise auf frühere Besucher von unserem auserwählten Kontinent. So fand mein Schützling einen kryptischen Eintrag, der die Ankunft eines gewissen d´Albuquerque bezeugen soll. Ja, Sie lesen richtig! Welcher Sohn des großen Afonso, des Herrn des Indischen Ozeans, das gewesen sein könnte, vermag Mr. Mouhot allerdings nicht zu sagen. Die bekannten Nachkommen des Admirals hielten sich jedenfalls nie in diesen Gefilden auf. Aber damit nicht genug: Mr. Mouhot hält es für wahrscheinlich, dass dieser ominöse Unbekannte zusammen mit dem berühmten Dichter Luís de Camões die Überreste von Ongcor entdeckte. Tatsächlich erlitt der Schöpfer der Lusiaden im Golf von Siam Schiffbruch und blieb einige Jahre an diesen Gestaden verschollen. Nur leider stützt sich die Hypothese meines Protegés allein auf diesen dürftigen Beleg. Das darf ich behaupten, nachdem ich das schwülstige Epos erneut gründlich studierte und auf keine einzige Stelle stieß, die auf eine solche Begebenheit verweisen könnte. Inzwischen bezeichne ich diese Theorie daher als verstiegenes Konstrukt und bin mir in meinem Urteil Ihrer geschätzten und sachkundigen Zustimmung sicher. Aber sogar, falls diese Hirngespinste trotz aller berechtigten Skepsis der Wirklichkeit entsprechen mögen, bleibt umso unverständlicher, warum Mr. Mouhot immer noch an diesem Ort verharrt, wenn er doch gar nicht den geringsten Anspruch auf seine Entdeckung erheben kann oder will.
Unerfreuliche Nachrichten, meine verehrten Kollegen! Ich allein überzeugte Sie im Sinne Mungo Parks, unseres unvergessenen Ahnen im Geiste, von diesem Engagement und zeige mich jetzt irritiert und enttäuscht. Obwohl mir Mr. Charles Mouhot versichert, dass sein Bruder bei bester Gesundheit sei, müssen die Tropen und die belastende Einsamkeit unweigerlich am Verstand zehren. Aus diesem Grund und in ernster Sorge forderte ich ihn auf, fürderhin auf schmückendes Beiwerk oder gar Fantasiegebilde zu verzichten. Zumindest zeigt er sich zutiefst dankbar für die Zuwendungen der Gesellschaft. Aber um ehrlich zu sein, kann ich derzeit nicht guten Gewissens voraussagen, ob unsere noble Investition Früchte tragen mag.
Samuel Stevens, Esq., 1860
- - -
Ongcor, 1860
Mein werter Bruder, lieber Charles,
wie ergeht es Euch auf meinem geliebten Jersey? In Annettes Briefen lese ich, wie rührend Du Dich um Deine Schwägerin sorgst. Ich danke Dir dafür und hoffe, Ihr genießt ein friedvolles, harmonisches Jahr. Mir ist das leider nicht vergönnt, wobei ich natürlich mein Schicksal selbst wählte und dies auch bisher zu keinem Augenblick bereuen musste.
Erinnerst Du Dich an unsere gemeinsamen Reisen über den Kontinent nach meiner Rückkehr aus Russland? Jeden Tag besuchten wir eine andere Sammlung und fotografierten mit Daguerres Erfindung die alten Meister. Ich denke in diesen Tagen oft an jene schöne Zeit zurück, täte mir doch ein solcher Apparat gegenwärtig gute Dienste. In der Tat wüsste ich gar nicht, welche lebensechte Tänzerinnen, zum Himmel aufragenden Tempel oder Ehrfurcht gebietende Götterskulpturen ich zuerst ablichten sollte. So muss ich all diese Wunder leider mit der Feder festhalten, eine mühsame Plackerei, die mich täglich einige Stunden in Anspruch nimmt. Allerdings würde keine noch so widerstandsfähige Maschine in der hiesigen Witterung zuverlässig funktionieren. Der feuchte, schwüle Urwald gibt sich als ein wahrlich seltsamer Gastgeber. In unfasslicher Fülle gebiert er das Leben und droht es doch wie ein mächtiger unbarmherziger Strom jederzeit mit sich fortzureißen. Jedenfalls kann ich unseren Eltern nicht genug für die zähe Konstitution ihrer Söhne danken.
Ich weiß nicht, was Du von Annette bereits erfahren hast. Die wichtigste und erfolgreichste Entscheidung traf ich schon in Chantaboun, wo ich den Ältesten eines chinesischen Pfefferpflanzers anheuerte. Dieser Phrai, obwohl gerade einmal achtzehn Jahre alt, war mir bislang ein fantastischer Kamerad. Treu und gewissenhaft führte er mich den Mekong entlang und meinem Geschick entgegen. Täusche ich mich oder sehe ich Dich schmunzeln, Charles? Du denkst vielleicht, dass sich Dein großer Bruder vom Überschwang leiten lässt, aber ich meine es durchaus ernst. Hier liegt meine Bestimmung, davon bin ich inzwischen überzeugt! Ich muss dafür geboren worden sein, dem Abendland von diesen unsterblichen, allen Zeiten trotzenden Wundern zu berichten. Erinnere Dich an Mungos Zeilen, als er endlich am 21. Juli 1796 sein Schicksal erfüllte:
›Ich schaute nach vorn und sah mit unendlicher Freude das großartige Ziel meiner Mission; der lang gesuchte majestätische Niger, glitzernd in der Morgensonne, so breit wie die Themse bei Westminster, und langsam in östlicher Richtung fließend.‹
Heute erst kann ich seine Gefühle nachempfinden. Denn auch jetzt noch, nach einigen Tagen, lässt mich Ongcor Vats erhabene Vollendung staunen und wie der Onkel unserer Frauen fühle ich diese ›unendliche Freude‹. Die fünf herrlichen Türme bewahren eine ewige Harmonie, ihre äußere Form mag wahrlich betören und Worte reichen nicht aus, diese überirdische Schönheit zu beschreiben. Betrachte meine Skizzen und sei versichert, dass meine kümmerlichen Federstriche die berückende Wirklichkeit kaum erfassen können. Sobald sich am Morgen die Sonne über die Urwaldriesen erhebt, schwindet jeder Zweifel an der menschlichen Rasse im Angesicht ihres glorreichen Schaffens.
Weniger anmutig, dafür umso imposanter ist das gewaltige Ongcor Thom ganz in der Nähe. Obwohl ich die vom Dschungel vereinnahmten Überreste der ›großen Stadt‹ sorgfältig erkundet habe, überschaue ich ihren riesigen Umfang immer noch nicht. Das zentrale Heiligtum besteht aus einer komplizierten Verbindung aus Tempeln und Galerien und mündet in immensen Köpfen. Auf meiner Zeichnung findest Du einen Maßstab, doch verstehe mich richtig: Sogar diese erstaunlichen Zahlen können nicht im Ansatz die tiefe Ehrfurcht vermitteln, die ich vor diesen Zeugnissen einer überlegenen Zivilisation verspüre. Die Gesichter zeigen das gutmütige Lächeln des Buddha, so wie in Ongcor Vat Skulpturen von Vishnu oder anderen Figuren aus dem hinduistischen Götterhimmel allgegenwärtig scheinen. Aber gleichgültig, welchem Glauben die Erbauer nachhingen, die Heiligtümer eint ihre handwerkliche Vollendung. Wie du meinen dürftigen Fingerübungen hoffentlich entnimmst, ähnelt die gesamte Oberfläche poliertem Marmor. Weder Mörtelreste noch Spuren eines Meißels! Viele Tausend Menschen müssen all diese prächtigen Kunstwerke ausgeführt haben, und zwar – stell´ Dir das vor! – nachdem der Bau vollendet war!
Zu diesem Zeugnis ruhmreicher Zeiten steht die triste Gegenwart in einem fast unwirklich erscheinenden Widerspruch. Die Tempelstadt liegt vergessen im alles verschlingenden Urwald und bietet bloß einigen Mönchen Obdach. In unregelmäßigen Abständen tauchen deren dottergelbe Kutten zwischen den herrlichen Relikten auf und verschwinden dann wieder ohne ersichtlichen Grund. Ihr Vorsteher heißt Pay Mak, ein seltsam junger, ausgemergelter Mann, der mein Siamesisch versteht. Nach ihm war Ongcor die Hauptstadt eines vergangenen Imperiums, das früher weit über Indochinas Grenzen hinaus gerühmt worden sei. Nebenbei – dieser Abt sucht mich vehement davon zu überzeugen, dass die Vorfahren der Eingeborenen all diese Pracht errichteten. Der Sohn eines Sklaven soll wann auch immer zum König aufgestiegen sein und sich dieses Denkmal gesetzt haben. Ongcor Vat sei ihm jedoch so gut gelungen, dass die Khmer den Neid der Unsterblichen fürchteten. Und so würdigten sie das Heiligtum noch heute zum ›Stall des himmlischen Ochsens‹ herab, um ihre Götter nicht zu erzürnen.
Ja, das bleibt natürlich Unfug und ich höre Dich lachen, lieber Bruder, als Naturalisten lehnen wir die Existenz von übernatürlichen Wesen selbstredend ab. Wieso sollten Kambodschas Menschen heutzutage im Elend leben, wenn ihre Vorfahren in früheren Zeiten solche Werke verrichten konnten? Das fragte ich den Abt, doch ich befürchte, dass dem Mönchlein seine Religion im Weg steht, denn ich erhielt nur unverständliches Zeug zur Antwort. Wie auch immer, ich stehe vor den Spuren einer anderen, einer überlegenen Kultur. Bloß welcher? Ich verfolge eine gewagte Theorie, nur mag ich davon jetzt noch nicht schreiben.
In der zivilisierten Welt weiß niemand von diesen fantastischen Bauten und dennoch weile ich keineswegs als erster Europäer an diesem Ort. So lebt Abbé Silvestre in der Nähe, ein Priester aus der Heimat, der mir mit seinen reichen Kenntnissen gerne hilft. Seine eigentliche Aufgabe, nämlich die Bekehrung der Wilden, halte ich hingegen für aussichtslos. Als ich ihn darauf ansprach, zitierte er erstaunlicherweise Mungo: ›Wie sehr ist zu wünschen,‹ schrieb er über die Schwarzen in Afrika, ›dass die Gemüter eines Volks von solchen Gesinnungen durch die wohltätigen Wirkungen des Christentums gemildert und zivilisiert werden!‹
Nun gut. Ich hätte erwidern können, dass Mungo sich zeitlebens auch völlig davon überzeugt zeigte, dass uns eine gemeinsame Natur mit den Eingeborenen verbindet. Erinnerst Du Dich?
›Wie verschieden Neger und Europäer in Hinblick auf die Gestalt der Nase oder der Farbe der Haut sein mögen, so gleichen sich dennoch unsere charakteristischen Gefühle.‹
Doch Silvestre besitzt eine gute Seele, entschuldige den Begriff, und ich schwieg trotz besseren Wissens. Allein – ich schreibe eben nicht aus Afrika, sondern aus einem Land, das dem Licht der Aufklärung ferner scheint als der Mond. Hier erdulden die Menschen ein Leben, das nicht primitiver sein könnte, von garstiger Witterung in der Barbarei gefesselt. Kannst Du Dir vorstellen, dass außerhalb der Ruinen ein Stamm von Kopfjägern sein Unwesen treibt? Aber so ist es, ich habe die blutigen Überreste ihrer armen Opfer selbst gesehen.
Erzähle Annette bitte nichts davon!
Diese Khond sollen übrigens die Nachfahren jenes legendären Gottkönigs sein, von dem ich dir oben bereits erzählte. Ja, solche Geschichten muss ich mir anhören.
Jedenfalls gelangten nach Silvestres Worten in den letzten Jahrhunderten schon einige Portugiesen nach Ongcor. Die erstaunlichen Aufzeichnungen des Klosters, schwarz eingefärbte und mit Kreide beschriebene Pergamente, scheinen diese Vermutung zu beweisen. Warum sich die Kunde von diesen unfassbaren Relikten nie in Europa verbreitete, kann ich nur mit unglücklichen Umständen oder Ignoranz erklären. Ich werde diesen Fehler nicht wiederholen. Die Welt muss von diesem formidablen asiatischen Athen erfahren, einer Stadt, die mir größer erscheint, als es Rom je war.
Unter diesen Gegebenheiten wirst du sicher verstehen, dass ich noch länger in diesen Gefilden bleibe. Allerdings bin ich nicht alleiniger Herr meiner Entscheidungen. Die Society finanziert einen wesentlichen Anteil dieser Unternehmung und kommt auch für Annettes Lebensunterhalt auf. Nur leider stellt mein Gönner Stevens die Ongcors Bedeutung infrage und bezichtigt mich offen der Schwärmerei. Welche Engstirnigkeit! Und diese Kleingeisterei mag mich teuer zu stehen kommen: Die Gesellschaft könnte ihre monatlichen Zuwendungen kürzen und schließlich ganz einstellen, wenn ich nicht bald einige Erfolge aufweisen kann, will sagen: Pflanzen oder Tiere. Es versteht sich von selbst, dass ich jede unbekannte Art aus Fauna und Flora mit nach Hause bringen werde, doch vor allem brauche ich mehr Zeit! Bitte, Charles, interveniere in meinem Sinne!
Ich weiß meine Zukunft in den besten Händen und verbleibe in ewiger Treue
Henri
- - -
Januar 1860, sieben Tage nach Ankunft – Morgen
Ich konnte meine Enttäuschung überwinden. Ja, ich bin nicht Ongcors Entdecker, aber ich teile dieses Schicksal mit Annettes Onkel. Jeden Abend lese ich einige Seiten aus seinem Werk, das mir zuverlässigen Trost schenkt. Vermutlich war er gar nicht der erste Weiße am Ufer des Nigers. Zwei portugiesische Gesandtschaften hatten bereits ungefähr zweihundert Jahre zuvor das westafrikanische Binnenland erkundet. Eigentlich müssten sie auf den Strom gestoßen sein, allerdings ist wenig über ihren Erfolg bekannt geworden. Demnach erreichte Mungo den großen Fluss zumindest als erster Europäer, von dem dies heute bewiesen ist. Wenn er mit dem kleinen Ruhm leben konnte, kann ich das auch. Vielleicht ähnlich einem Marco Polo werde ich der Welt von den Schätzen des Dschungels berichten.
Wem mag das nicht genügen?
Bedauerlicherweise dient das generöse Engagement der Society nicht zuerst meiner Unternehmung, sondern Mungos Andenken. Immerhin bin ich ja Franzose und Indochina gilt als ein – wie soll ich es ausdrücken? – etwas abseitiges Forschungsgebiet. Ja, die Dankbarkeit der werten Kollegen ist beachtlich, ihre Kurzsichtigkeit allerdings ebenfalls und ich verdanke die großzügige Unterstützung allein Annettes illustrem Onkel. Dennoch – es kann nicht allzu schwerfallen, noch einmal in dasselbe Horn zu stoßen. Stevens muss begreifen, dass Asien gefälligst unsere Beachtung verdient, denn dort begann auch die Karriere des Mannes, der ... etc.
Anmerkung des Autors:
Tatsächlich fuhr Mungo Park zur See und durchquerte als Assistenzarzt den Indischen Ozean. Während des Krieges mit Frankreich segelte er 1793 an Bord des Ostindienfahrers Worcester mit militärischem Geleit für ein Jahr nach Sumatra. Nach seiner Rückkehr hielt er dann einen Vortrag über acht kleine Fische, darunter einige Arten, die er persönlich entdeckt hatte. Seine anschließende Publikation erweckte die Aufmerksamkeit von Sir Joseph Banks, dem damaligen Präsidenten der Royal Society, der später Gründungsmitglied der Afrikagesellschaft wurde.
- - -
Ongcor, 1860
Teuerste Annette,
bitte verzeih´ mir, dass ich so selten schreibe, und befürchte nicht, ich hätte Dich und die Kinder vergessen! Nein, ich versinke bloß in Arbeit, den Mühen eines Archäologen, der kein geringeres Werk vor sich sieht als Mariette im Land der Pharaonen. Nur leider steht mir keine Kohorte Assistenten, sondern allein mein treuer Phrai zur Seite. Und so scheinen die Tage viel zu kurz für die Erkundung, das Skizzieren und Vermessen der gewaltigen Bauten.
Ja, ich fand meine Sphinx im Dschungel! Wenn ich meine Faszination für Ongcors wahrlich außerordentliche Relikte nicht verhehle, wirst Du mir gewiss Glauben schenken. Du kennst mich als ernsthaften Mann, der nicht an Hirngespinsten festhält. Überdies vertraue ich in größter Gelassenheit auf den liebevollen Langmut, den Du in unserer Ehe notgedrungen entwickeln musstest. Obwohl uns eine Welt trennt, Geliebte, bist Du mir doch nah. Jeden Abend lese ich in Deinen Briefen, nehme Anteil an Eurem beschaulichen Leben – und dennoch: Sogar die herzlichsten Zeilen bleiben bloß ein kümmerlicher Ersatz für Deine vertraute Gesellschaft.
Gerade heute Morgen hätte ich – verzeih´ das Pathos – ein Königreich dafür gegeben, Dich an meiner Seite zu wissen. Ich folgte Silvestres Rat – ich schrieb Dir von dem Abbé –, stand noch vor dem Morgengrauen auf und stieg im Frühnebel auf eine nahe Erhebung. Von dort, hatte mir mein Freund versichert, könne man einen herrlichen Blick auf die verwunschenen Ruinen genießen. Und tatsächlich – oben angekommen hielt ich den Atem an. Was soll ich sagen? Vor meinen Augen wallte ein weißer Ozean, nach den Legenden der Hindus das Sinnbild der Schöpfung, wie du dich erinnern wirst. Und mitten aus dem Schemenmeer erhoben sich die fünf ewigen Türme. Ich wusste schon, dass der in Terrassen aufsteigende Tempel den Berg Meru nachempfinden soll, aber erst in diesem Augenblick begriff ich seine wirkliche Bedeutung. Ongcor Vat symbolisiert nicht nur die Genesis, sondern verwandelt sich im Morgengrauen stets zu ihrem metaphorischen Spiegel. Silvestre meint, dass in früheren Zeiten die bewässerten Reisfelder der Umgebung einem riesigen See geglichen hätten. So sahen die namenlosen Erbauer ihr Wunder am Beginn jeden Tages aus den weißen Fluten ragen – das nenne ich das wahre Heiligtum einer Religion. Ich zeigte mich derart ergriffen, dass ich doch tatsächlich einen Moment lang nach Göttern und Dämonen Ausschau hielt. Wann mochten sie eintreffen? Im Mythos folgen die Unsterblichen Vishnus Rat, legen gemeinsam mit ihren Feinden die Weltenschlange um den Gipfel und drehen ihn auf den Meeresgrund. So entstand nach den Hindus das Leben und an diesem Ort nimmt ihr Glauben Gestalt an. Ich genoss noch den herrlichen Anblick, da flammte das Morgenlicht im weißen Ozean auf. Ein purpurner Schimmer durchzog den Schleier, bis der erste Sonnenstrahl über den Himmel blitzte und eine goldene Lotosblüte auf der Spitze des mittleren Turms traf. Ein kleiner Stern erglühte und spiegelte sich tausendfach auf den Wellen des Nebels. Auch jetzt finde ich keine passenden Worte für diese überirdische Schönheit.
Dein begeisterter Ehemann, der morgen den nächsten Brief beginnt, in Liebe
Henri
- - -
Januar 1860, sieben Tage nach Ankunft
Eine nervöse Spannung hält mich gefangen. Zu nichts finde ich genügend Zeit, weder für meine Arbeit noch für die in der Heimat ersehnten Briefe. Gestern Nacht schrieb ich zumindest an Charles und rang mir einige dürre Zeilen an Annette ab – immerhin. Aber ehe die Tinte getrocknet war, verließen mich schon die Kräfte und ich sank erschöpft in einen dämmrigen Halbschlaf. Nein, nicht die feuchte Schwüle zieht mir das Mark aus den Knochen, vielmehr lässt mich die schiere Größe der vor mir liegenden Aufgabe zaudern. Jeden Tag entdecke ich weitere gewaltige Überreste dieser versunkenen Kultur, tatsächlich scheint es sich um verschiedene Städte zu handeln, die nebeneinander errichtet wurden. Mich bestürmen einfach zu viele Impressionen, als dass ich mir bisher wenigstens einen groben Überblick verschaffen konnte. Als ich erkannte, dass mir gerade diese verwirrende Fülle an Eindrücken zusetzt, traf ich in den Morgenstunden eine Entscheidung. Ich beschloss, zuvorderst Ongcor Vat zu erforschen und finde dafür eigentlich keinen entscheidenden Grund. Vielleicht, weil ich den Tempel früher entdeckte als die riesigen Köpfe oder mich seine Schönheit berauscht? Ich weiß es nicht. Aber mein angegriffener Verstand kann gegenwärtig nur eine überschaubare Aufgabe bewältigen, das steht fest.
Bloß ein irritierender Zufall? Jedenfalls stürmte Phrai noch vor dem Frühstück in mein Zelt und berichtete aufgeregt von seinem Gespräch mit einem der Mönche. Seltsam, mit mir wechseln die Kuttenträger kein Wort und überlassen das Reden ihrem Vorsteher, doch mit dem Jungen sprechen sie. Allerdings mag das auch daran liegen, dass Phrai die Zunge seines neuen Freundes mit einem Geschenk lockerte. Tatsächlich scheint die Glaskette aus unserem Vorrat ein billiger Preis für durchaus beachtliche Erkenntnisse. Wie ich vermutet hatte, errichteten Hindus die herrlichen Türme Ongcor Vats – zumindest, wenn man dem Bruder Glauben schenken kann. In früheren Zeiten soll der Tempel als Vishnuloka bekannt gewesen sein, die Heimstatt des Herrn der Vorsehung. Warum ist dieses Wort heute nicht mehr gebräuchlich, weshalb spricht man bloß von Ongcor Vat, der ›Heiligen Klosterstadt‹? Das wusste der Mönch leider nicht zu sagen und verwies auf seinen Abt. Dennoch ermutigte mich Phrais Bericht – ein wahrhaft glückliches Zusammentreffen! Mein Ziel hat nun einen Namen! Ohne Verzug begann ich daher mit der genaueren Erkundung des Heiligtums und nahm den Jungen mit, der offensichtlich mit den Einheimischen leichter ins Gespräch kommt. Ich entschloss mich zu einem systematischen Vorgehen und wollte das gesamte Terrain zunächst einmal umrunden, da ich auch dazu bisher nicht gekommen war. Also schlugen wir uns durch den Dschungel und liefen an dem beeindruckenden Graben entlang, der die Tempelstadt umgibt. Große Stufen führen zu der fast zweihundert Meter breiten Vertiefung hinunter, die ein naher Fluss speist. Der Zweck dieses enormen Kanals scheint augenfällig: Gewiss treidelten einst Lastkähne auf dem Wasser und versorgten die Stadt mit schweren Gütern. Bis zum Mittag umrundeten wir Vishnus ehemalige Heimstatt, verglichen unsere Ergebnisse und einigten uns auf einen Mittelwert: Die gesamte Anlage steht auf einem Rechteck, das von Ost nach West eintausendfünfhundert und von Nord nach Süd eintausenddreihundert Meter misst. Also ungefähr zwei Kilometer zum Quadrat! Auch wenn Ongcor Thom noch ungleich weitläufiger ist, setzen mich schon Vishnulokas Ausmaße in Erstaunen.
– Nebenbei: Ich entschloss mich der Einfachheit halber, das in meinem Vaterland gebräuchliche metrische System zu benutzen. Dies mag der Royal Society zwar nicht gefallen, aber ich bin es müde, jede Zahl mühsam umzurechnen. –
Als wir unseren Ausgangspunkt wieder erreichten, begegneten wir unversehens dem Abt. Hatte das dürre Männlein auf uns gewartet? Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen, nehme es jedoch an. Auf Siamesisch konfrontierte ich Pay Mak mit dem alten, dem hinduistischen Namen der Tempelstadt, allein – ich hätte auch mit einem Steingötzen sprechen können. Dieser dreiste Mensch lächelte bloß und stritt alles ab, wobei die Tiefe seiner Stimme mich erneut überraschte, sie will einfach nicht zu ihm passen. Er erzählte von einem berühmten indischen Mönch, der mit der Lehre des Erleuchteten aus Ceylon zurückgekehrt sei und das Volk der Khmer bekehrt habe. Ein vergessener König hätte diesem Buddhagosha dafür Ongcor zum Geschenk gemacht, weshalb die gesamte Anlage jünger sein müsse als der alte Hindu-Aberglaube.
Ich verstand jedes Wort und glaubte ihm kein Einziges. Dennoch behielt ich meinen Argwohn für mich, immerhin sind wir nur Gäste in seinem Kloster. Ich verabschiedete mich mit verbindlicher Geste und überquerte zusammen mit Phrai den äußeren Graben. Man kann auf zwei Deichen zur äußersten Mauer des Heiligtums gelangen. Der Östliche ist aus gestampfter Erde und wurde wahrscheinlich für die Sklaven errichtet. Wir wählten den westlichen Damm, auf dem eine zwölf Meter breite gepflasterte Straße verläuft, die eine Balustrade aus großen Schlangen säumt. Auf halber Strecke liegt eine kreuzförmige Plattform mit Treppen, die zum Wasser hinunter führen. Unten bewachen eindrucksvolle steinerne Löwen die Anlegestellen.
Auf dem Weg hörte ich übrigens von meinem treuen Phrai noch eine andere Legende um den Bau der Stadt: Sie handelt von einem ›Prinzen des blühenden Lichts‹, das Kind einer Khmerprinzessin und des Gottes Indra. Dieser Name sagte mir wenig, bis mich mein junger Freund aufklärte. Indra findet nämlich als Herr der Atmosphäre in den Veden Erwähnung, den ältesten Hinduschriften, in denen kosmische Phänomene göttliche Formen annehmen. Nach diesen Texten befanden sich die Unsterblichen im ständigen Kampf gegen die Dämonen und beschützten die Menschen. Jedenfalls holte Indra seinen Sprössling ab, als dieser erwachsen war, und führte ihn in den Götterhimmel ein. Aber Indras Brüder und Schwestern rümpften ihre unsterblichen Nasen ob des unangenehmen ›menschlichen Geruches‹ und wiesen den Halbgott zurück. Dessen gedemütigter Vater war gebrochen und in seiner Verzweiflung wollte er seinen Sohn für das entgangene Erbe entschädigen. Daher beauftragte er den Baumeister der Götter mit der Errichtung eines Palastes, den die Welt niemals zuvor gesehen hatte. Und natürlich brauchte dieser Vishvakarman nur eine Nacht, bis Ongcor Vat oder Vishnuloka den himmlischen Heimstätten glich. Der Mönch, mit dem mein junger Freund gesprochen hat, wusste noch von einer Variation dieser Legende. In dieser Version durfte der Prinz zwischen den Gebäuden im Himmel wählen und entschied sich für die Ochsenställe, da er die Unsterblichen nicht erzürnen wollte. Diese Geschichte erinnert an den Mythos, den ich schon kannte.
Von einer völlig anderen Überlieferung weiß übrigens Chou Ta-Kuan, der Mann, der im Auftrag der Mongolenkaiser vor vielen Jahrhunderten die Könige der Khmer besuchte. Silvestre konnte mir in der Tat die in Paris veröffentlichte Schrift des Diplomaten beschaffen, weshalb ich höchst Amüsantes in dem dünnen Bändchen lesen durfte: Ongcor Vat sei nämlich die Ruhestätte von Lou Pan, Chinas Gott der Baumeister. Ein lächerliches und dreistes Beispiel für kulturellen Diebstahl, hier findet sich nichts Chinesisches weit und breit! Aber ist es nicht immer so? Wahrhaft Großes ertragen die Menschen nicht, stets vermuten sie göttliches Werk hinter heroischer Leistung.
In der Mittagshitze schwirrte mir schon der Kopf von den albernen Legenden und ich beschloss, mich vorerst nur mit Tatsachen zu beschäftigen! Wir überquerten den Graben und stießen am Ende der Deichstraße auf die Vorderseite der äußeren Einfriedung, die aus nicht viel mehr als vorgetäuschten Wölbungen besteht. Dann liefen wir an dieser äußersten, der vierten inneren Mauer entlang und umrundeten Vishnuloka noch einmal. Der Backsteinwall misst von Ost nach West eintausendunddreißig, von Nord nach Süd achthundertvierzig Meter. Zeit und Urwald nagen an dem Mauerwerk und ich kann die Mönche nur verachten, die dem Verfall in ihrer fatalistischen Verblendung nicht Einhalt gebieten. Vor den vier Ecken entdeckten wir jeweils kleinere Eingänge für Karren oder Elefanten, was bedeutet, dass früher Holzbrücken über den Kanal geführt haben. Zumindest erscheint das als eine naheliegende Hypothese. Wieder am Ausgangspunkt eingetroffen, ließ ich Phrai zurück, der aus der Ferne die zahllosen Steinskulpturen am Heiligtum zählen sollte. Ich brauche solche Fakten, wenn ich die Royal Society von der Bedeutung dieser Relikte überzeugen will. Die werten Kollegen sollen mich schon der Lüge bezichtigen müssen, falls sie meinen Angaben nicht glauben. Während mein junger Freund also seine Strichliste anlegte, ging ich selbst weiter in Richtung des großen Tores. Langsam lief ich eine Straße entlang, die sich auf eine elegante Säulenreihe stützt, und bestaunte die Balustraden aus riesigen Steinschlangen. Dann passierte ich eine Gebäuderuine, die bis auf einige Halbsäulen fast vollkommen vom Dschungel verschlungen ist, ehe ich einen zweihundertdreißig Meter langen Laubengang betrat. In dessen Mitte und vor dem dritten Wall erhebt sich der grandiose Haupteingang, den die Mönche anscheinend in regelmäßigen Abständen von allen Schlingpflanzen säubern. Immerhin. Die drei kreuzförmigen Gewölbe sind durch Räume miteinander verbunden, der mittlere besitzt einen doppelten gedeckten Säulengang. An den Enden der Galerien fand ich zwei ebenerdige Durchgänge für Tiere und Karren, zumindest nehme ich das an. Das gesamte Portal krönen enorme turmartige Bauten, deren Zweck sich mir allerdings noch nicht erschließt. Ein wahrlich eindrucksvoller Auftakt.
Als ich Vishnulokas Inneres betrat, sah ich eine weitere fast zehn Schritte breite Straße vor mir, die zum eigentlichen Heiligtum führt. Der gepflasterte Weg liegt eineinhalb Meter höher als das umliegende Gelände und scheint mindestens dreihundert Meter lang zu sein. Auch ihn bewachen große siebenköpfige Schlangen, die ihre steinernen Köpfe wie Kobras erheben. An beiden Seiten führen in regelmäßigen Abständen Treppen zu dem tiefer gelegenen Areal hinab. Die gesamte Fläche ist von Elefantengras und kleineren Sträuchern bewachsen, Bäume konnte ich nicht entdecken. Wenigstens scheinen die Mönche halbwegs zu wissen, was sie der Geschichte schulden.
Ich blieb stehen, ließ meinen Blick umherschweifen und nahm mir etliche Minuten Zeit, um die vorhandenen Gebäude zu überschauen. Sorgfältig vermaß ich jedes einzelne Bauwerk mit den Augen und überschlug die jeweiligen Summen. Ich schätze die insgesamt verbaute Steinmenge auf deutlich über dreihunderttausend Kubikmeter. Unfassbar!
Dennoch nehmen die erhaltenen Bauten nur einen geringen Teil des riesigen Terrains ein und zuerst verstand ich das nicht.
Welchem Zweck diente solch eine gigantische Freifläche? Dann schlug ich mir an die Stirn: Nichts anderes blieb übrig, die Zeit überwindet alles! Ehedem müssen sich Holzhäuser vor und in den Mauern gedrängt haben – wie im alten Rom, ehe es nach Neros Brand in Stein wiedererrichtet wurde. Vishnuloka war eine Großstadt, die heute verrottet ist. Wie viele Menschen lebten hier? Einhunderttausend Seelen, gar eine Million, noch mehr? Wahrlich – die Metropole eines Imperiums.
Ich konzentrierte mich wieder auf mein eigentliches Ziel und schaute nach vorn: Das Heiligtum erhebt sich auf einer dreistufigen Pyramide und sein zentraler Turm ragt inmitten seiner vier Brüder mindestens sechzig Meter über der Ebene auf. War dieses großartige Bauwerk tatsächlich eine Kultstätte oder doch der Palast eines Herrschers, vielleicht sogar sein Mausoleum? Als ich den Tempel näher in Augenschein nahm, stutzte ich und konnte zunächst gar nicht sagen, was mich befremdete. Dann begriff ich: Ongcor Vat richtet sich nach Westen aus! In dieser Sekunde hörte ich ein Husten in meinem Rücken und wandte mich um. Der Abt war mir offenbar gefolgt und schien meine Gedanken erraten zu haben. Der junge Mann wies mit überlegenem Grinsen auf das Heiligtum und fragte mich, ob ich nun die Wahrheit erkenne. Ongcor Vat könne nicht von Hindus gebaut worden sein, da sich deren barbarische Kultstätten ausnahmslos nach Osten wendeten. Das stimmt und daher sparte ich mir eine Erwiderung. Erst jetzt, Stunden später und nach Rücksprache mit Silvestre, kann ich verschiedene Erklärungen für diesen seltsamen Umstand geben. Zunächst sollte man wissen, dass die meisten hinduistischen Tempel nicht dem Herrn der Vorsehung, sondern Shiva geweiht sind. Vielleicht muss also Vishnus Heimstatt nach Westen schauen, weil der Gott diesen Quadranten des Alls beherrscht. Oder es liegt daran, dass Ongcor Vat zugleich das Mausoleum eines Königs diente, denn die Verstorbenen wohnen im Westen. Ich weiß es nicht, dem Abt schenkte ich jedenfalls bloß ein Lächeln und ging weiter, um endlich auch das Innere des Heiligtums zu erkunden. Doch da stellte sich mir Pay Mak in den Weg und redete höchst erregt auf mich ein. Zuerst verstand ich nicht viel von seinem gebrochenen Siamesisch, dann erfasste ich, dass er sich über die üblen Machenschaften der Europäer ausließ. In den vergangenen Jahrhunderten hätten Schatzräuber und andere zwielichtige Gestalten immer wieder die Ruhe seines Klosters gestört. Das klang hochinteressant. Wen meinte er? Vielleicht den mysteriösen Portugiesen, dessen Name fast vollständig aus den Klosteraufzeichnungen getilgt worden ist? Aber meine Frage nach d´Albuquerque versetzte ihn erst recht in Rage. Blass vor Zorn drückte er den Zeigefinger auf meine Stirn und spuckte mir vor die Füße – eine schwere Beleidigung in diesen Gefilden.
»Das Innere ist Euch versperrt!«, schrie der Mann mit überschnappender Stimme.
Verblüfft und beeindruckt von diesem Wutausbruch hob ich die Hände und suchte ihn zu beruhigen – vergebens. Plötzlich standen drei, dann fünf Kuttenträger hinter ihrem Vorsteher und starrten mich mit grimmigen Mienen an. Da ich nicht mehr uneingeschränkt auf die sprichwörtliche Friedfertigkeit der Mönche vertraute, zog ich mich einigermaßen hastig zurück. Am Ausgang traf ich Phrai wieder und erzählte ihm von dem seltsamen Verhalten, doch der Junge zuckte nur mit den Schultern. So sollte ich eben morgen unseren Glasschmuck mitnehmen und es erneut probieren, meinte er lakonisch. Immerhin hatte mein fleißiger Gehilfe seinen Auftrag vorbildlich erledigt und mindestens eintausend Frauenfiguren an dem Tempel gezählt, von der keine den übrigen zu gleichen scheint. Faszinierend!
Wie komme ich an dem Abt vorbei? Lässt er sich tatsächlich bestechen? Phrai rät dazu, aber könnte das nicht bloß Pay Maks Unwillen steigern? Wie auch immer, ich werde einen Weg finden müssen, um in das Innere vorzudringen. Nur dort kann ich das Rätsel der Entstehung dieses Wunders klären, da bin ich mir sicher. Bis dahin bleiben mir nur die verschiedenen Legenden, eine widersinniger als die andere. Der Mythos vom Sohn eines Sklaven, der zum König aufstieg, erscheint da noch am glaubhaftesten, Silvestre liegt schon richtig. Dennoch – bis es nichts Greifbareres gibt, verfolge ich weiterhin meine Theorie von Mu. Menschen vom verschwundenen Kontinent hinterließen ihre Spuren auf der Welt, ob in Südamerika oder eben hier. Vishnulokas atemberaubende Schönheit kann nur einer großartigen, einer überlegenen Zivilisation entstammen. Doch solange ich nicht einmal weiß, in welcher Epoche die Relikte entstanden, werde ich den sprichwörtlichen Teufel tun und meine These veröffentlichen.
Anmerkung des Autors:
Wie auch bei der Bestimmung der Säulenzahl übertrieb Henri Mouhot in keiner Weise: Die Siedlung, die Angkor Vat umgab, erstreckte sich auf einer Fläche von mindestens einhunderttausend Hektar. Damit war diese Weltstadt um ein Fünftel größer als New York, wenn man dessen Wasserflächen nicht berücksichtigt. Und der ›Stall des himmlischen Ochsens‹ war nur einer von vielen, sehr vielen Tempeln.
― ― ―
Querstein
»Hört meine Geschichte vom Tag der Rache und gebt mir ein paar Münzen, ja? Es herrschte wieder einmal Krieg zwischen den Taifas, doch die Legende meines Herrn hätte auch auf dem Mond beginnen können. Ihr kennt die Taifas nicht mehr? So nannten wir die kleinen Königreiche und Fürstentümer in al-Andalus, die aus dem Zerfall des großen Kalifats von Córdoba entstanden waren. In diesem besonderen Fall ging es um die Emirate von Sevilla und Granada. Und die Schlacht fand in der Nähe von Egabro statt, einem Ort an der Grenze, aber die Männer sprechen längst nur noch von ›Cabra‹. Wein, wenigsten einen Schluck, hm? Wen kümmern die Kriege der Ungläubigen, wollt ihr fragen? Schon recht. Nur hielten sich zu dieser Zeit Ritter des wahren Glaubens an den Höfen der beiden Widersacher auf. Die Edelmänner sollten für ihren König Alfons von Kastilien Tribute einfordern. Mein Schwurherr war bei dem Mauren Muhammad von Sevilla, dem mächtigsten der Taifas in al-Andalus. Und der Emir, begeistert von dem Mut und der Kraft meines Gebieters, warb ihn als Führer seiner Truppen an, für gutes Gold, versteht sich. Heute meinen alle meinen Herrn zu kennen, aber ich war dabei. Leider muss ich schweigen, meine Kehle ... Danke, mein Bester. Damals stand er im sechsunddreißigsten Jahr. Für Fremde hieß er Rodrigo Díaz de Vivar, für Freunde Ruy und für mich Sidi, denn ich war sein Knappe.
Sidis Leben bis zu diesem Tag ist schnell erzählt: Der Vater, ein kastilischer Edler, hatte sich im Krieg gegen Navarra Verdienste erworben. Nach dem Tod seines Gevatters kam der Junge als Halbwaise an Ferdinands Hof und wurde dort zusammen mit dessen Erben Sancho erzogen. Doch auch der König starb und die drei Söhne teilten das Reich unter sich auf. Mein Herr blieb in Sanchos Gefolge, der als neuer Gebieter von Kastilien die Hand nach Galicien und León ausstreckte, den Ländern seiner Brüder. Ein mächtiger Mann und dennoch vergaß er nicht den Freund seiner Jugend. Er ernannte ihn zu seinem Bannerträger und bald hatte Sidi so viele Zweikämpfe bestanden, dass er den Beinamen ›el Campeador‹ tragen durfte. Ein paar Münzen? Danke, Gott möge es vergelten! Leider fiel der Herrscher Meuchlern zum Opfer – sieben Jahre vor dem Tag von Cabra. Das geschah während einer Belagerung und sein Bruder Alfons, das heimtückische Schwein, glaubte nicht ´mal selbst an seine Unschuld. Jedenfalls bestieg dieser Bastard den Thron, entriss meinem Herrn sein ehrenvolles Amt und belohnte den Mann, der Sancho auf dem Gewissen hatte, wie manche munkelten. Er erhob den Mörder sogar zum Grafen und legte ihm seine Fahne in die blutigen Hände: Ich rede von Ordóñez. Zeigt Erbarmen, edle Frau. Ein alter Krüppel verdient euer Mitleid. García Ordóñez. Genau derselbe stand uns an diesem Tag auf dem Feld der Ehre gegenüber. Wie das kam? Ich sagte es schon, oder? Sidi war in den Dienst des Emirs von Sevilla getreten, denn mit dem neuen Gebieter von Kastilien hatte er nichts mehr zu schaffen. Das Gold Ungläubiger war nicht schlechter als das von Christen. Ordóñez besuchte zu dieser Zeit Muhammads Feind, den Berber Abdallah von Granada. Als der Schweinehund hörte, dass mein Herr für einen fremden Fürsten kämpfte, schickte er König Alfons Nachricht. Prompt fiel Sidi in Ungnade und Ordóñez zog für den Berber in den Krieg gegen ihn. Wollt ihr das Ende der Geschichte hören? Dann gebt mir Wein, ich bitte euch! Die Schlacht ging für Sanchos Mörder verloren und Sevilla gewann. Aber nicht das Gefecht machte Sidi zum Helden aller guten Menschen, sondern eine Geste! Wisst, er nahm den Meuchler auf der Flucht gefangen. Nur anstatt ihn zu richten, schnitt er ihm bloß den Bart ab, so verachtete er ihn. Wer kann sich größere Schande vorstellen? Ich lache noch heute, wenn ich daran denke! Natürlich rächte sich der falsche König und verbannte meinen Gebieter aus Kastilien. Umsonst! Unser Land ist reich, Söldner verhungern niemals und so folgten Sidi bald viele kampferprobte Recken. Sie nannten ihn einfach nur den ›Herrn‹, doch ich blieb sein Knappe und durch meinen Mund mag er unsterblich werden.«
Man schrieb das Jahr 1079 und die Schlacht von Cabra gebar den Mythos von El Cid.
Auch in Kambuja wurde zu dieser Zeit der Grundstein für eine Legende gelegt. Drei Sommer zuvor hatte ein Sklave dort Leben und Namen eines Fürsten genommen und dieser unverfrorene Kui betrog immer noch die Götter. Zwei Jahre nach García Ordóñez unfreiwilliger Rasur finden wir Arun wieder.
― ― ―
Geweihter Wahnsinn
»Die ganze Kriegskunst basiert auf List und Tücke. [...] Greife den Feind da an, wo er unvorbereitet ist. Schlage zu, wo er es nicht erwartet.« Sun Tsu
Am Ufer des Menam schnitten die Soldaten Bambusstangen für Flöße, dann ließen sie einige Wachen bei den Pferden zurück und setzten über. Noch vor dem Abend erreichten sie die andere Seite, wo ein verdingter Überläufer wartete, um die Truppen in die unwegsamen Berge des Westens zu führen. Da sie kein Feuer machen durften, marschierten die Männer blind bis zum nächsten Morgen.
Es wurde eine harte Nacht, in der sie stundenlang durch den ansteigenden Dschungel stolperten, bis der Verräter endlich die Hand hob.
Der Mon zeigte auf die schmale Senke, die sich im fahlen Schein der frühen Sonne vor ihnen auftat. »Da liegt Moks Dorf, Gebieter,« flüsterte er in stockendem Khmer.
Arun kniff die Augen zusammen. Da war eine Lichtung, und nach einer Weile entdeckte er einen Zaun aus Prügelholz, der etliche Häuser aus geschlagenem Bambus umgab.
»Da lebt Moks Familie? Du wirst sterben, wenn es nicht wahr ist.«
Der Mon nickte nur, man konnte seine Angst riechen.
Arun wandte sich an den Sanjak. »Gut, du weißt, was ihr tun müsst. Verteilt die Schützen, macht Feuer und brennt alles nieder. Jeder Mann wird getötet. Frauen und Kinder nehmen wir mit.«
»So soll es geschehen und so geschieht es, Herr.«
Blicklos starrte Arun auf die noch schlafende Siedlung und rang mit seinen Skrupeln. Ja, er führte Krieg, konsequent und erfolgreich. Dennoch brachte er diesen Menschen das gleiche mitleidlose Schicksal, das sein früheres Leben bestimmt hatte.
Seit fünf Jahren hieß er nun Viseth Nandamarveda, hatte siebenundzwanzig Sommer gesehen und war doch älter als die meisten Männer. Sein Dorf, die Eltern, ein Teil der Zunge, seine Schwester, ein Auge, der Ziehvater, seine Würde und schließlich die erste Liebe – alles vertilgt von einem unbarmherzigen Karma. ›Ein Sklave wird zu den Höchsten aufsteigen und einen Herrscher zeugen, einen König, der den Tod in Stein zu überwinden trachtet.‹ Thom und der Vrah Guru sahen es, Chanlina las es in meinen Händen – und dennoch waren es nur leere Worte. Die dreifache gleichlautende Vorhersage hatte nicht ihm gegolten. Das wusste er seit dem Feldzug nach Annam, wo er Anchaly wiedergefunden hatte, die namenlose Freundin aus seiner Kindheit in Yasodharapura.
In Gedanken zog er seine Geliebte in die Arme und versank in diesen großen warmen Augen, die ihn stets alles vergessen ließen. Gierig drückte er ihre schlanke und feingliedrige Gestalt an sich.
›Grober Kui!‹, flüsterte sie atemlos, ›du zerdrückst mich!‹
Er lachte leise. Nur bei ihr und Narith konnte er ganz er selbst sein, musste sich nicht verstellen.
›Warum liebst du mich?‹, hatte er sie gefragt, denn darüber wunderte er sich immer noch.
›Früher wegen deiner Augen, sogar Shiva kann keine helleren Augen haben.‹
›Und heute?‹
Sie wich seinem Blick aus, wirkte plötzlich unsicher. ›Du bist ein mutiger Mann, du stellst dich gegen die gesamte Welt und dein Schicksal.‹
›Ich betrüge doch bloß die Khmer.‹
›Diesen Mut meine ich nicht. Nein, du nimmst eine furchtbare Wiedergeburt in kauf. Du brichst die Dhamastras jeden Tag und ich kann nur dafür beten, dass dir die Unsterblichen Gnade erweisen. Ich besitze diese Kraft nicht, das weißt du.‹
›Immerhin liebst du einen schmutzigen Khond ...‹
›... ja, nur darf ich nicht die Mutter seiner Söhne sein. So feige bin ich ...‹
Er küsste ihre Tränen, nahm sie in die Arme und spürte noch ihre Lippen, als die Erinnerung verflog.
Ja, Diavakaras Enkelin war zu seiner lebenden Göttin erblüht, nur trug sie weiterhin die Strafe für die Verfehlungen ihrer Mutter. Sie durfte ihm kein Kind schenken, darauf bestand ihr Großvater. Notgedrungen hatten sie sich gefügt und er bedauerte es zutiefst. Aber Anchaly blieb Anfang und Ende seines Daseins, mehr sollte ein Kui, der die Unsterblichen täuschte, nicht erwarten. Er würde also keinen König zeugen und deshalb erschienen ihm die Wunden, die sein grausames Schicksal geschlagen hatte, in der Rückschau umso bitterer. Die Verluste waren jedoch nicht sinnlos gewesen, hatten vielmehr sein Selbst entblößt und dessen Kern mit flüssigem Eisen ausgegossen. Allein aufgrund dieser Härte konnte er die Lüge leben, jeden Tag eine Maske tragen und als Sklave einen Herrn spielen. Auch jetzt biss er die Zähne zusammen, bis seine Kiefer knackten, und sah den Brandpfeilen hinterher, die den Tod in den grauen Morgen trugen. Die dünnen Rauchfahnen zeichneten seine Schuld in den Himmel, aber solche Gedanken quälten sein Gewissen schon lange nicht mehr. Das redete er sich zumindest ein. Der Kui ist gestorben und Mitleid mit den Schwachen wird mich verraten. Diesen Satz wiederholte er an vielen Tagen wie ein Mantra, bis sich der Druck auf seiner Brust löste und er Luft bekam. Heute schien er jedoch gegen Messer zu atmen, also musste er sich ablenken. Immerhin, er hatte seine Befehle gegeben und durfte sich einen Blick zurück gönnen.
Aber in der Vergangenheit warteten bloß Wehmut und Trauer, als er an seine Gefährtin in Sambor Prei Kuk dachte. Chanlina riss mich aus der Trostlosigkeit, lehrte mich wieder hoffen.Sie schenkte mir den Sommer auf dem Turm der Sterne ... Dennoch waren sie Werkzeuge der Khmer geblieben, wertlos und ersetzbar. Und als Feinde Yasodharapura erobert und Harshavarman als Marionette auf dem Thron belassen hatten, war die Chinesin den Schlächtern zum Opfer gefallen. Oh Vishnu, warum? Auch nach so langer Zeit verging kaum ein Tag, an dem er nicht ihre geschändete Leiche vor sich sah und ein Würgen unterdrücken musste. Ihn selbst hatten die Sieger mit vielen anderen in Ketten gelegt und nach Misön gebracht, in Champas überfüllte und fieberverseuchte Stadt der Sklaven. Dort war eine zweite Frau in sein Leben getreten, Suostej, und nur sie hatte ihn den Hunger überleben lassen. Ich gab ihr mein Wort – und ließ sie trotzdem zurück.
Das schlechte Gewissen wühlte noch immer in seinen Eingeweiden, doch er kämpfte es nieder – wie schon so oft.
Ja, ihr Reis rettete mich, aber sie war unzuverlässig. Sie verkaufte ihren Körper.Ich war ein Kui und sie wusste es. Ich wäre auf ewig in ihrer Hand geblieben.
Zweihundert brennende Pfeile schlugen in Dächer und Wände der Hütten und verwandelten die schlafende Siedlung in wenigen Atemzügen in ein glühendes Inferno. Arun sah ein anderes Dorf, das vor sechzehn Jahren in Flammen aufgegangen war, und eine Träne löste sich aus seinem Auge. Wütend wischte er sie weg. Du bist Viseth!
Das war eine Lüge und doch sein Leben. Viseths Vater Sri Nandamarveda, der übergangene Bastard des alten Herrschers, hatte gegen seine reinblütigen Brüder ein halbes Menschenalter lang Intrigen gesponnen. Sein Ehrgeiz hatte zur Rebellion geführt, seine spätere Herrschaft in Harshavarmans Namen das Reich in den Abgrund gerissen. Aber erst, als die Cham Kambuja erobert und den König als ihren Statthalter auf dem Thron belassen hatten, war die Macht des Fürsten gebrochen worden: Der Kamrateng hatte den verräterischen Halbbruder enteignet und ihn und seinen Sohn als Geiseln nach Champa geschickt. Dort waren die beiden auf einen Mann getroffen, der nur noch von bitterem Hass lebte – Arun. Seine ganze Welt war Nandamarvedas Ränken zum Opfer gefallen und der Hunger hatte ihn schließlich alle heiligen Regeln brechen lassen. Ja, er hatte den Bastard des alten Herrschers getötet und die Sommer der Verzweiflung waren zu Ende gegangen. Und als er Viseth, dem Erben, der ihm so verblüffend ähnelte, Namen, Siegelring und Leben gestohlen hatte, war sein Durst nach Rache erloschen. Sri Nandamarvedas vermeintlicher Sohn war der Gefangenschaft in Champa entkommen und auf wundersame Weise nach Kambuja zurückgelangt. Ein Sklave war zum Fürsten aufgestiegen, der sein Geheimnis tief in sich verbarg, und die Götter hatten den Frevel nicht bestraft, im Gegenteil: Inzwischen galt der neue Viseth, der sich von seinem niederträchtigen Vater losgesagt hatte, als bester Bogenschütze seit Suryavarman, als harter Kämpfer und begnadeter Anführer.
Spitze Schreie zerschnitten Aruns Gedanken. Die Mon rannten aus ihren Hütten und versuchten das Feuer zu löschen. Aber es waren zu viele Brandherde, und als sie das Menschenwerk erkannten, griffen sie nach ihren Kindern und flohen in den Urwald. Doch auch dort warteten bereits Soldaten auf sie.
Damals war es ähnlich ... Vor seinem verbliebenen Auge brannten die Pfahlbauten der Kui und die Erinnerungsfetzen ließen ihn schaudern. Der fette Mann beugte sich über eine missbrauchte Frau und durchtrennte ihr grinsend die Kehle. Mutter ... Er schüttelte den Kopf, zwang sein Bewusstsein zurück in sein neues Leben.
Das Klagen begann. Jungen und Mädchen weinten um ihre Großväter, als die Alten des Dorfes einer nach dem anderen unter den Messern seiner Krieger starben. Unwillkürlich spürte Arun wieder die bebende Nuon an der Brust, die bei ihrem Bruder Trost suchte. Aber was hätte ich sagen können? Alle wurden zu Tode geschändet – was soll da ein Kind sagen? Er seufzte und wandte sich ab. Denk an gestern!
Die Soldaten verbeugten sich vor ihm, als er seine Gemächer verließ, den Hof überquerte und auf den höchsten Wachturm von Mahidharapura stieg. Im Vergleich zu den Herrschersitzen in Yasodharapura und Sambor Prei Kuk enttäuschte Narin Soks Residenz, die aus nicht viel mehr als einem ständigen Militärlager bestand. Immerhin lagen wohlgenährte Krokodile in den entsandeten Gräben vor der Stadtmauer und breite Straßen führten an den Häuserfluchten vorbei bis zum zentralen Aufmarschplatz. An dessen Stirnseite lag der bescheidene Palast des Herrn von Kambujas Norden.
Narin Sok hatte den Sohn des Fürsten – Arun – zuerst freigekauft, dann in seinen Haushalt aufgenommen und schließlich zum obersten General befördert. Und kaum jemand hatte gewagt, diese Entscheidungen infrage zu stellen. In Yasodharapura herrschte hingegen weiterhin Viseths Onkel und der Herrscher wollte den Nachkommen seines verräterischen Halbbruders aus naheliegenden Gründen tot sehen. Vor Harshavarmans Nachstellungen konnte Arun allein Narin Sok schützen, weshalb er dem gelähmten Mann die Treue geschworen hatte. Dabei verfolgte der Statthalter durchaus eigennützige Interessen: Da der Kamrateng bisher keinen Erben gezeugt hatte, galt der junge Nandamarveda nach dem Tod des Kevs als Yuvaraja, als wenig geschätzter Kronprinz. Und wem ein künftiger König etwas schuldete, der besaß ein Versprechen auf die Zukunft. Also hatte sein Schwurherr eine Schuld bei dem neuen Viseth erworben, bei dem Menschen, der vielleicht eines Tages herrschen mochte.
Ein Kui auf dem Thron! Lächelnd drehte Arun sich um und erstarrte.
Vor hochschlagenden Lohen eilte ein alter Mon mit einem Mädchen an der Hand in seine Richtung. Seine Enkelin ... Plötzlich brach der Großvater zusammen – mit einem Pfeil in der Brust. Schluchzer schüttelten den mageren Körper des Kindes. Nuon. Wieder sah er seine Schwester, ihre Leiche lag neben ihm im Graben einer längst zugeschütteten Latrine und gebrochene Augen sahen zu ihm auf. So ist der Krieg nun einmal! Glaub´ mir, letztlich rette ich Leben! Aber der vorwurfsvolle Blick wollte nicht von ihm weichen. Wieso bin ich hier?Was unterscheidet die Mon von den Kui? Wütend stampfte er mit dem Fuß auf und ignorierte die verwunderte Frage des Sanjaks an seiner Seite. Es gibt einen Grund. Denk an gestern!
Arun schaute vom Wachturm über Mahidharapuras Mauern hinweg. Narin Sok unterstand das Land im Norden der Dangrekberge und im Gegensatz zum König herrschte der fähige und ehrgeizige Beamte mit Weitsicht und harter Hand. Vor allem Sandstein und Ton wurden in den kargen Hügeln geschlagen, Steine für die heiligen Bauwerke. Allerdings lag die eigentliche Bedeutung der Provinz im Erz, dem Metall, aus dem die Khmer ihre Waffen schmiedeten. Auf den Höhen der schmalen Bergkette lagen die tief in den Fels getriebenen Minen, aus denen Sklaven Eisenklumpen an die Oberfläche schleppten. Doch nur ein großes Volk ernährt genug Menschen, um sie in Bergwerken und Steinbrüchen arbeiten zu lassen. So lag hier wie überall die Quelle des Wohlstands im Reis. Suryavarman, der Vater des Königs, war also nur ein geringes Risiko eingegangen, als er Narin Sok in diesem Landesteil als Statthalter eingesetzt hatte. Obwohl der mächtige Herr von Mahidharapura nicht der herrschenden Dynastie entstammte und deshalb seine Treue fragwürdig war, blieb er vom Kamrateng abhängig. Ohne die Ernten aus dem Süden konnte er seine Leute nicht versorgen und über die Reisfelder, Kanäle und Barays wachte Yasodharapuras Herrscher. Zumindest sollte er das.
Ein Batzen Schlamm traf ihn im Gesicht und Arun fand sich in der Gegenwart wieder.
Das Mon-Mädchen stand vor der Leiche seines Großvaters und funkelte ihn an, ihn, der die Vernichtung in ihr Leben gebracht hatte. Er sah seinen alten Zorn in ihren Augen und ihm fehlten die Worte.
Der Sanjak zog seinen Dolch. »Verzeiht, Herr, ich töte die Unwürdige.«
»Tu ihr nichts!« Arun befühlte den Schmutz auf seiner Wange. Sie sah vielleicht zehn, elf Sommer, nicht mehr als ich damals und sie kann sich nicht wehren – sonst unterscheidet uns wenig. Verdrängte Erinnerungen erwachten: Wieder saß er auf dem Baum und zielte mit Sri Nandamarvedas eigenem Bogen auf den ahnungslosen Fürsten. Dieser Mann hatte seine Welt zerstört und allein wegen ihm rutsche jetzt sein Vater irgendwo abseits des Gemetzels auf einem Pfahl in den Tod. Die Schlacht war für die Aufrührer verloren, die Rebellion gescheitert, doch dieser Unmensch, der die Schuld an all dem Grauen trug, würde seinen Hals retten! In Gedanken schoss er und traf, aber in Wirklichkeit hatte er nur Kamvau getötet, ein anderes Opfer von Nandamarvedas verschlungenen Intrigen. Der Bastard selbst hatte diesen Tag überlebt und alle getäuscht, auch seinen Halbbruder auf dem Thron. Nur Sangrama, Kambujas Stratege, hatte die Ränke des Fürsten durchschaut und dem jungen Kui das Leben geschenkt. Später hatte der alte Mann das Vertrauen des Knaben gewonnen, sogar seine Liebe – und war letztlich dem Gift des Verräters erlegen. Ich war allein wie dieses Mädchen ...
»Du tust ihr nichts!«, flüsterte er noch einmal. Was ist von damals geblieben? Tränen liefen an seiner Wange herunter und er packte das edle Holz von Nandamarvedas Bogen, der wie immer an seiner Schulter hing. Alles, aber du bist jetzt Viseth!Und falls dir das gleichgültig sein sollte, denk´ an Anchaly! Er musste sich ablenken und sprach das Mantra, bis ihm endlich seine Gedanken gehorchten und ihn auf Mahidharapuras Wachturm zurücktrugen.
Der Vortag. Noch bevor die Glocke Alarm schlug, sah er auf dem Hügel im Norden einen gleißenden Fleck.
»Die Mon besuchen uns wieder einmal. Ruf die Männer zusammen!«, befahl er dem Posten. »Wir reiten in einer halben Stunde.«
Narin Soks Provinz war von Feinden umgeben. Daher meldete ein ausgeklügeltes Warnsystem jeden Übergriff der Mon, Cham oder der Annamesen von den Außengrenzen mit Leuchtsignalen über etliche Etappen nach Mahidharapura. Dort standen stets Soldaten zum Abmarsch bereit, die in den betroffenen Grenzmarken von schnell einberufenen Milizverbänden ergänzt wurden.
Die Augen des Veteranen strahlten. »Sehr wohl, Gebieter.«
Seit er die Armee während des missratenen Feldzuges in Annam vor der Vernichtung bewahrt hatte, galt er bei den Truppen als Zauberer. Fünf Jahre und viele kleine Siege gegen die Mon waren gefolgt. Der wilde Bergstamm im Westen nutzte die Schwäche des Kamratengs und verletzte fortwährend Kambujas Grenzen, plünderte, brandschatzte und raubte die Ernten. Einzig Narin Soks Khet blieb weitgehend verschont und das lag im Wesentlichen an Arun. Statt die eindringenden Horden zu stellen, umgingen seine Männer die Mon und trugen den Krieg in deren Dörfer. Daher attackierten die Bergmenschen inzwischen vornehmlich den Süden des Reiches, sodass Arun sich in den letzten Monden nur mit Sklavenfängern aus Champa hatte herumschlagen müssen. Aber heute bekam er endlich wieder einen richtigen Gegner. Er suchte die unweigerlichen Rauchfahnen am Horizont, konnte allerdings nichts entdecken. Vielleicht waren die Mon noch zu weit entfernt oder sie hatten eine andere Taktik gewählt und legten diesmal kein Feuer auf den Feldern. Von seinem Spitzel wusste er, dass es einen neuen Häuptling gab, jung und gierig. Er sollte Mok heißen und nach den Berichten plünderten seine Horden bereits Kambujas Kernland, das dem Kamrateng unterstand. So wirkte sich die Schwäche des Herrschers zum ersten Mal direkt auf den Norden aus: Der König vernachlässigte seine Pflichten und es war nur eine Frage der Zeit gewesen, bis den Räubern der Süden nicht mehr genügen würde. Doch Narin Sok schaut zu, der Alte beherrscht ja nicht einmal seinen Erben, er wird nichts tun.
Als ob die Götter ihn verhöhnen wollten, wartete Rithipol auf dem Hof. Er war der hübsche Jüngling geworden, den das verwöhnte Kind versprochen hatte. Mit ebenmäßigen Zügen und großen braunen Augen galt er als der heimliche oder auch offene Schwarm vieler freier und unfreier Frauen in Mahidharapura. Er war nicht der Erstgeborene des Statthalters, aber der älteste, den man vorzeigen konnte. Der eigentliche Stammhalter Sothiya, die ›reine Seele‹, machte seinem Namen alle Ehre. ›Er folgt den Lehren des Buddha und lächelt so dümmlich wie der Erleuchtete,‹ flüsterten die Höflinge. Und da Narin Sok sich für diesen Sohn schämte und ihn versteckt hielt, hatte Arun ihn noch nie gesehen.
Der Posten, den er zu den Mannschaftsquartieren geschickt hatte, erstattete Meldung. »Die Schützen sind abmarschbereit, Gebieter.« Als er den Erben ihres Herrn bemerkte, verdüsterte sich die Miene des Veteranen.
Ich kann es ihm nicht verdenken. Früher, als Junge, war Rithipol bei den Soldaten beliebt gewesen, hatte sogar als ihr Glücksbringer gedient. Aber inzwischen war seine Launenhaftigkeit berüchtigt. Ständig suchte er nach neuen, auch verrufenen Ablenkungen, galt als verlogen und spielte mit Menschen. In den letzten Sommern hatte seine Selbstherrlichkeit ein Ausmaß angenommen, das selbst für Narin Soks ausersehenen Nachfolger nicht gesund sein konnte.
»Viseth, ich hörte, du bekommst etwas zu tun?«
Weder die helle, schmeichelnde Stimme noch die vertrauliche Anrede täuschten Arun. Rithipol bewunderte ihn nicht mehr wie in früheren Jahren, sondern fürchtete den mit Abstand mächtigsten General des Nordens. Fürst Nandamarveda schützte die Heimat der Soldaten, dafür liebten sie ihn und das gefiel dem Sohn des Statthalters nicht.
»Willst du mitreiten?« Er zwang sich zu einem verbindlichen Lächeln.
»Ach, nein.« Der junge Mann, der am nächsten Tag seine Volljährigkeit feiern würde, winkte ab. »Solche simplen Gemetzel überlasse ich gerne unserem Waffenträger.«
Der Veteran schnaubte vor unterdrückter Wut, klang doch ›Waffenträger‹ aus dem Mund des Erben wie ›Wasserträger‹.
Arun dachte hingegen an seinen ermordeten Ziehvater, der als Kambujas größter General einen legendären Ruf bei den Soldaten genoss, und verkniff sich ein Lachen. Wenn der kleine Mistkerl wüsste, welcher Kaste Sangramas Ahnen entstammten ...
»Aber du brauchst nicht allein reiten, sicher mag dich der Zwerg begleiten.« Voller Geringschätzung deutete Rithipol zum Eingang der Residenz, wo sein jüngerer Bruder sehnsüchtig darauf wartete, dass er sich zurückzog.
Vor fünf Jahren war Leap noch ein fröhliches Kind gewesen, bevorzugt von seinem Vater und geschützt vor Hänseleien. Seitdem allerdings Narin Sok aus unerfindlichen Gründen das Interesse an seinem Nesthäkchen verloren hatte, verhielt sich Rithipol nur umso garstiger. So war aus dem unbeschwerten Kleinen ein ernsthafter, nicht selten trauriger Knabe geworden. Der Junge fand gegen die Verschlagenheit und Heimtücke seines Bruders einfach kein Mittel und war Arun gerade deshalb ans Herz gewachsen. So wandte er sich auch an diesem Morgen mit einem herzlichen Lächeln an seinen Schützling.
Rithipol packte seinen Arm. »Vergiss nicht, wem du Treue schuldest!«
»Deinem Vater, sonst niemandem. Und jetzt sollte ich Mon jagen gehen.« Er schüttelte die Hand mit einer harschen Geste ab. Das verräterische Glitzern in den Augen des jungen Mannes sah er nicht mehr. Mahidharapuras Erbe wirkte wie ein verzogenes Kind, dem sein Spielzeug weggenommen worden war.
Leap wartete bei den Pferden. »Wohin reiten wir?«, fragte er aufgeregt.
»Nach Westen.«
»Aber das Signal kam aus dem Norden!«
»Tatsächlich?« Arun wusste, dass der Knabe den Unterricht von Anchalys Großvater schwänzte, und zuerst wollte er ihn in die Residenz zurückscheuchen, doch dann entschied er sich anders. Der Junge leidet schon jeden Tag und der Alte mag es verzeihen.
Diavakara war Kambujas oberster Priester, dessen Kaste Shivas Segen auf die Herrschaft des Königs lenkte. Am Hof in Yasodharapura war er allerdings nicht mehr wohlgelitten, nachdem er dem Gebieter halsstarrig dessen Schwächen vor Augen geführt hatte. Seit fünf Jahren weilte der Purohita deshalb im Norden und erzog die Söhne des mächtigen Statthalters. Somit kümmerte sich der Brahmane also zugleich um Harshavarmans möglichen Nachfolger, denn als solcher wurde Rithipol gehandelt – zumindest, bis der Kamrateng endlich seine Konkubinen schwängerte. Aber all das erschien Arun schon lange nicht mehr allzu wichtig. Er hatte vor dem Guru auf seinen Thronanspruch als Nandamarvedas Erbe verzichtet und er ertrug sogar Diavakaras Launen geduldig, wenn er nur Anchaly sehen konnte.
Leap trieb seine Stute neben ihn. »Wirst du wieder alle Toten dreifach vergelten?«
Arun verdrängte die Geliebte aus seinen Gedanken, schüttelte den Kopf und gab seinem Pferd die Sporen. Tatsächlich hatte er sich bisher darauf beschränkt, die Überfälle blutig zu rächen und für jede geplünderte Hütte zwei Siedlungen der Bergmenschen niederzubrennen. Für einige Zeit waren die Mon abgeschreckt worden, doch nun musste er sich etwas Anderes einfallen lassen. Dieser Mok wollte Beute machen und ließ sich nicht vertreiben, nur weil sie irgendwelche Dörfer vernichteten. Als sein Blick auf den teuer bezahlten Mon-Krieger fiel, der sie führen würde, lächelte er schmal.
Nein, wir reiten nicht in den Norden.
Zweihundert Bogenschützen folgten ihm über die westliche Grenze zum Menam und in die unwegsame Wildnis, in der die Familie des jungen Häuptlings leben sollte.
»Ein Erfolg, Viseth!« Leap strahlte, als ob ihn die Grausamkeiten in seiner Nähe nicht kümmerten. »Mein Vater wird dich ehren. Die Wilden wissen jetzt, welchen Preis sie bezahlen müssen, wenn sie plündern wollen.« Da bemerkte er das düstere Gesicht seines Helden und zögerte. »Was ist mit dir? Machst du dir Sorgen? Erreichen wir den Fluss nicht mehr rechtzeitig?«
Arun riss sich zusammen. »Nein, es ist nur noch nicht vorbei.«
Moks Dorf glich einer rauchenden Ruinenlandschaft, die alten Männer lagen in ihrem Blut. Spitze Schreie klangen auf, als Soldaten die ersten Frauen zu Boden zogen, um ihren billigen Sieg zu feiern. Das Mädchen, das den fremden Heerführer mit Schlamm beworfen hatte, ging vor Verzweiflung in die Knie und krümmte sich in seiner Qual.
Da sah er wieder das Ende der eigenen Welt, sah Tante und Mutter als Beute der Mörder und widerte sich an.
»Sanjak!«
»Gebieter?« Der Offizier eilte an seine Seite und verbeugte sich.
»Du kennst deine Befehle. Die Männer können sich Huren in der Stadt kaufen, wir müssen jetzt abziehen, sofort!«
»Sicher, Herr, aber ein rasches Vergnügen ...«
»Gehorche gefälligst! Jeder, der ein Weib oder ein Kind schändet, landet auf dem Pfahl.«
Angesichts der fürchterlichen Drohung musste der Veteran schlucken. »So soll es geschehen und so geschieht es.« Hastig trieb er die Hauptleute an.
Einer der Soldaten spuckte erbittert in den Schlamm, als ihn Offiziere von seiner Beute wegzogen, andere wehrten sich halbherzig und wurden geschlagen. Insgesamt jedoch gehorchten die Männer und folgten ihrem Herrn, der so seltsame Befehle gab. Die Schützen formierten sich und scheuchten die Gefangenen, mehr als dreihundert Frauen und Kinder, zurück durch den Urwald.
Bis zum Nachmittag erreichten sie wieder das westliche Ufer des Menam, wo der großzügig entlohnte Verräter vor der Rache seines Stammes in den Dschungel floh. Die Khmer setzten über den Fluss, doch als sie die Kameraden begrüßten, die sie bei den Pferden zurückgelassen hatten, überraschte Arun alle.
»Wir bleiben dort.« Er deutete auf die nächste Anhöhe. »Schlagt eine Schneise um den Hügel und legt an den Bäumen in der Mitte Feuer.« Er wusste nicht, ob die Soldaten den Sinn des Befehls verstanden oder es einfach nicht wagten, ihn zu hinterfragen, aber zumindest gehorchten sie.
»Warum?«, begehrte Leap auf. »Du forderst unser Schicksal heraus! Hier werden uns die Wilden finden. Sie müssen diesen Weg zurücknehmen.«
»Das hoffe ich.«
Arun stand im Widerschein der Flammen am Fuß des Hügels. In der Dunkelheit glichen die Urwaldriesen in seinem Rücken riesigen Fackeln. Vor Stunden waren die Klagen der Gefangenen verstummt und die meisten schliefen inzwischen. Das täte ich auch gern. Aber die Sorgen ließen ihn nicht zur Ruhe kommen: Wo blieb dieser Mok? Nahm er einen anderen Weg oder hielt er sich länger als gewöhnlich in Kambuja auf? Fast hätte er erneut nach den Spähern gefragt, doch weil er das schon viel zu oft getan hatte, winkte er den Sanjak zu sich. »Finde Moks Frauen und Kinder! Zur Not ziehen wir nur mit ihnen nach Hause.«
»Verzeiht, Herr, die Wilden sagen nichts.«
Dann foltere sie gefälligst! Rechtzeitig biss er sich auf die Zunge. Verzeih, kleine Schwester. »Gut, wir warten noch bis zum Morgen.«
»Vorher eure Köpfe abschneiden,« rief eine tiefe und vor allem wütende Stimme in gebrochenem Khmer, »werfe zu diesen.«
Zwei blutige Kugeln flogen aus dem Dickicht, rollten bis vor ihre Füße und ließen Leap und den Sanjak zusammenzucken. Die Späher hatten versagt.
Nach einigen Atemzügen überwand Arun seine Überraschung. »Sag den Schützen, sie sollen ruhig bleiben,« zischte er dem Offizier zu und spähte in die Dunkelheit. »Tritt vor, Mok! Lass uns reden.«
»Nicht reden. Ich fünfmal hundert starke Krieger. Beute wollen.«
Er lachte. »Du Aufschneider besitzt höchstens hundert Männer. Ich sah dein jämmerlich kleines Nest.«
»Du uns nicht angreifen, Lüge!«
»Bringt ein paar Gefangene!«
Als die Khmer einige der Mon nach vorn trieben, schallten Arun unflätige Flüche aus dem Dickicht entgegen.
»Abschaum! Du überfallen Kinder?!«
»Ich wandte nur deine Taktik an, Häuptling. Wer fremde Dörfer plündert, sollte sein Zuhause besser bewachen. So und jetzt schone meine Geduld. Ihr tragt bloß Schleuderbögen und Speere, mir dagegen folgen zweihundert ausgesuchte Schützen. Ich will nichts als reden, also tritt endlich vor.«
Fast bereute er seine Worte, als ein krummbeiniger Riese aus dem Dschungel trat und auf ihn zustapfte. Moks muskelbepackter Brustkorb war ungewöhnlich behaart. Er sieht aus wie ein Affe! Zwei Soldaten wollten sich schützend vor ihn stellen, doch er schüttelte nur leicht den Kopf. Der Wilde wird es nicht wagen. Unsere Pfeile zielen auf die Familien seiner Krieger.
Tatsächlich blieb Mok einen Schritt vor ihm stehen. »Wo Verräter, die Khmer führten?«
»Weg.« Arun lächelte. »Und die Alten sind tot.« Als er die Wut in den Augen des Mon sah, hob er rasch die Hände. »Aber die Übrigen leben noch, unbeschadet. Allein du bestimmst über ihr Schicksal.«
Mok überlegte kurz, ehe er sich zu voller Größe aufrichtete. »Feigling! Lass´ kämpfen, nur wir.«
»Nein, Häuptling, dazu ist es zu spät. Du musst dich fügen, wenn du dein Dorf retten willst. Ihr gebt uns jeden Gefangenen und die gesamte Beute, die ihr gemacht habt. Dafür bekommt ihr die Frauen zurück. Die Kinder bleiben bei uns als Pfand. Ihr werdet Kambujas Norden nie wieder betreten.«
»Wir töten alle!«
Er muss sein Gesicht wahren. »Ich bin Viseth Nandamarveda, der Enkel des göttlichen Suryavarman, der euch unterwarf. Ihr schuldet seinem Erben Treue.«
Mok kniff die Augen zusammen. »Du nicht Kamrateng,« entschied er nach einer Weile, »Kamrateng schwach und dumm.«
Damit hast du leider recht.
»Wenn Kinder lassen, du einen Gefallen gut. Nur dir, wann du wollen, und ich nur Süden plündern.« Der Häuptling zog ein gekrümmtes Messer und schnitt sich ein Büschel seiner fettigen Haare vom Kopf. Er hielt ihm die Strähne entgegen. »Pfand für Versprechen, Fürst.«
Fürst? Der Wilde wusste mehr, als er gedacht hatte. Arun wog die Vorteile des Angebots. Warum sollte er für Harshavarman den Frieden sichern? Ich schulde ihm nichts. Dann sah er seinen Ziehvater vor sich.