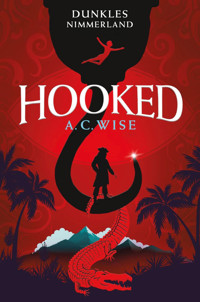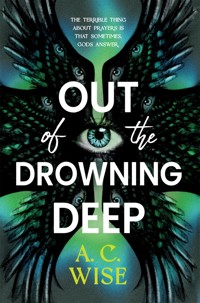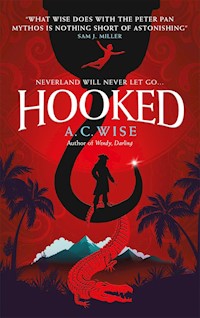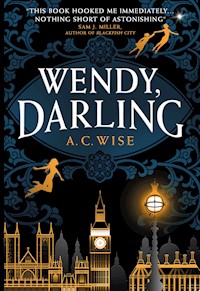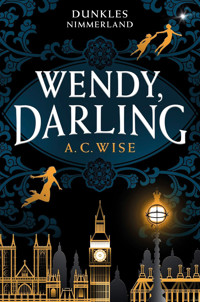
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cross Cult
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Dunkles Nimmerland
- Sprache: Deutsch
Eine feministische Neuinterpretation dessen, was mit Wendy nach Neverland geschah. Nimmerland ist ein Paradies für Kinder. Keine Regeln, keine Erwachsenen, nur endlose Abenteuer und verwunschene Wälder – alles angeführt von dem charismatischen Jungen, der nie alt werden würde. Doch Wendy Darling wurde erwachsen. Sie verließ Nimmerland und wurde eine Frau, eine Mutter und eine Überlebenskünstlerin. Und jetzt ist Peter Pan zurückgekehrt, um eine neue Wendy für seine verlorenen Jungs zu holen – Wendys Tochter! Sie muss Peter zurück nach Nimmerland folgen, um ihre Tochter zu retten und sich endlich der Dunkelheit im Herzen der Insel zu stellen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
1 DARLING
2 NIE UND NIMMER
3 DER ZWEITE STERN VON RECHTS
4 VERLORENE JUNGS
5 IMMER GERADEAUS BIS ZUM MORGEN
6 VERSTECKSPIEL
7 LASST UNS KRIEG SPIELEN
8 DIE JAGD
9 DAS GEFRORENE MÄDCHEN
10 ILLUSIONEN
11 DER VERBOTENE PFAD
12 PETERS GEHEIMNIS
13 HIER GIBT ES MONSTER
14 SCHATTENSPIEL
15 ZU HAUSE
DANKSAGUNG
DARLING
LONDON 1931
Da ist ein Junge vor dem Fenster ihrer Tochter.
Wendy spürt es wie ein Rinnsal aus Sternenlicht, das durch eine Ritze hereinsickert, eine Veränderung im Druck und der Zusammensetzung der Luft. Sie weiß es mit derselben Sicherheit, mit der sie ihr eigenes Fleisch und Blut kennt, und weil sie es weiß, rennt sie los. Hinter ihr fällt klappernd ihre Haarbürste zu Boden; ihre bloßen Füße fliegen über hochflorige Läufer und klatschen auf Holzdielen, am Zimmer ihres Mannes vorbei zur Tür ihrer Tochter.
Das ist nicht einfach irgendein Junge, es ist der Junge. Peter.
Jeder Zentimeter ihrer Haut kribbelt alarmiert; die feinen Härchen in ihrem Nacken sind aufgerichtet – der jahrelang zwischen ihren Rippen verborgene Sturm bricht sich Bahn. Peter. Hier. Jetzt. Nach so langer Zeit.
Sie will rufen, aber sie weiß nicht, was, und als Wendy schlitternd zum Stehen kommt, sind ihre Zähne gebleckt. Es ist keine Grimasse, kein Grinsen, sondern ein animalisches Hecheln, panisch und wild.
Janes Tür steht ein Stückchen offen. Ein schmaler Streifen Mondlicht – unnatürlich hell, als würde er aus Nimmerland nach London geleitet – ergießt sich über den Boden. Er berührt Wendys Zehen, als sie – einen Moment lang unfähig einzutreten – durch den Spalt späht.
Obwohl sie reglos dasteht, rast ihr Puls. Vor jenem zu hellen Licht hebt sich die vertraute Silhouette ab: ein schmächtiger Junge mit in die Hüften gestemmten Fäusten, stolzgeschwellter Brust und hochgerecktem Kinn, die Haare zerrauft. Das ist unverkennbar Peter, wie er direkt vor dem Fenster im ersten Stock schwebt. Sie blinzelt, doch das Bild bleibt bestehen, verschwindet nicht wie jeder andere Traum zwischen heute und damals. Zwischen dem Mädchen, das sie war, und der Frau, die aus ihr geworden ist.
Natürlich, denkt Wendy, denn das hier mag zwar nicht das Haus sein, in dem sie aufgewachsen ist, doch trotzdem ist es ihr Heim. Natürlich hat er sie gefunden, und natürlich hat er sie jetzt gefunden. Dem Gedanken folgt Verbitterung – hier und jetzt, nach so langer Zeit.
Nein, nein, bitte nicht, denkt sie gleichzeitig, doch schon klopfen überlange Finger an die Scheibe. Ohne ihre Erlaubnis abzuwarten, schwingt das Fenster auf. Peter kommt herein und Wendys Herz stürzt ins Bodenlose.
Einmal eingeladen, stets willkommen – das ist sein Motto.
Peter bemerkt Wendy nicht, als sie die Tür zum Flur ganz aufstößt. Er fliegt eine Runde an der Decke und sie versucht mit schierer Willenskraft, ihre Tochter zum Weiterschlafen zu bringen, ihre Zunge zu zwingen, sich vom Gaumen zu lösen. Ihre Beine zittern, halten sie auf der Türschwelle fest, wollen einknicken und sie fallen lassen. Er kommt einfach ungeniert herein, ihr eigener Körper hingegen verrät sie, weigert sich in ihrem eigenen Haus, einen Schritt ins Zimmer ihrer Tochter zu tun.
Das ist unfair. So war es immer bei allem, was Peter betraf, und nichts hat sich daran geändert. Nach Jahren des Wünschens und Wartens, der Lügen und Hoffnungen ist er schließlich hier.
Und nicht ihretwegen.
Peter landet am Fußende von Janes Bett. Die Decken verformen sich kaum unter seinem Gewicht; die Hülle eines Jungen, doch inwendig leer. Vielleicht liegt es an der Bewegung oder dem Licht, das aus dem Flur hinter Wendy hereindringt, aber Jane kommt halb zu sich, reibt sich die Augen. Wendy bleibt ein Warnruf im Hals stecken.
»Wendy«, sagt Peter.
Als sie ihn ihren Namen aussprechen hört, wird Wendy wieder zum Kind, ihre Zehen heben sich vom Boden, setzen zum Flug an, drauf und dran, ein grandioses, glanzvolles Abenteuer anzutreten. Nur dass er nicht sie ansieht, sein Blick ruht auf Jane. Wendy beißt sich auf die Wange, beißt zu, statt zu schreien. Hat er überhaupt eine Ahnung, wie lange das her ist? Der rot-salzige Geschmack ihres Blutes löst ihr endlich die zugeschnürte Kehle.
»Peter. Ich bin hier.« Sie schreit nicht, wie sie es sich wünscht, bringt bloß ein halb geflüstertes, abgehacktes Etwas hervor.
Peter dreht sich um, seine Augen so hell wie das Mondlicht hinter ihm. Sie verengen sich. Zuerst Misstrauen, dann ein Stirnrunzeln.
»Lügnerin«, sagt er, dreist und selbstbewusst. »Du bist nicht Wendy.«
Er macht Anstalten, zum Beweis auf Jane zu zeigen, aber Wendys Antwort lässt ihn innehalten.
»Doch, ich bin’s.« Hört er das Beben darin, sosehr sie sich auch bemüht, ihre Stimme fest klingen zu lassen?
Sie sollte Ned rufen, ihren Mann, der unten in seinem Arbeitszimmer entweder in seinen Büchern versunken oder über ihnen eingeschlafen ist, sodass er gar nicht mitbekommen hat, wie sie den Flur entlanggerannt ist. Es ist das, was ein vernünftiger Mensch täte. Ein Eindringling ist in ihrem Zuhause, im Zimmer ihrer Tochter. Jane ist in Gefahr. Wendy schluckt, sie steht Peter allein gegenüber.
»Ich bin es, Peter. Ich bin erwachsen geworden.«
Peters Miene verwandelt sich in ein höhnisches Grinsen. Jane ist vergessen, seine gesamte Aufmerksamkeit gilt nun Wendy. Jane schaut verwirrt zwischen ihnen beiden hin und her. Wendy will ihrer Tochter sagen, sie solle weglaufen. Sie möchte ihr sagen, sie solle weiterschlafen: dass es nur ein Traum sei. Doch die bissige Schärfe in Peters Stimme ärgert sie, lenkt sie ab.
»Warum hast du das gemacht?«
Wieder überläuft es Wendy heiß und kalt. Sein wie immer hochmütig verzogener Mund, seine lodernden Augen fordern sie heraus, etwas zu riskieren, provozieren sie, sich seinem Wort zu widersetzen, das doch Gesetz ist.
»Das passiert eben.« Wendys Stimme wird fester, der Zorn triumphiert über die Angst. »Jedenfalls den meisten von uns.«
Peter. Hier. Real. Kein wilder Traum, bewahrt als Schutzpanzer gegen die Welt. Als Wendy es endlich fertigbringt, ganz ins Zimmer ihrer Tochter zu treten, ziehen die Jahre an ihr vorbei. Und jener Schutzpanzer, poliert und geflickt und im Laufe der Zeit dicht geschlossen, bekommt einen Sprung. Einen schrecklichen Augenblick lang ist Jane vergessen. Wendy wird zu einem Geschöpf, das vollkommen aus Wünschen besteht, sie sehnt sich danach, dass der kalte Ausdruck auf Peters Gesicht schmilzt, verzehrt sich danach, dass ihr Freund ihre Hand nimmt und sie bittet, mit ihm davonzufliegen.
Doch seine Hand bleibt fest in seine Hüfte gestemmt, das Kinn gereckt, damit er von seinem Platz auf dem Bett auf sie herabschauen kann. Wendy macht einen zweiten Schritt und ihr Panzer ist wieder da, wo er hingehört. Beim dritten brodelt der Zorn stärker als die Sehnsucht – wie dunkles Wasser, das unter einer dicken Eisschicht gefangen ist.
Wendy presst die Arme an ihre Seiten, um zu verhindern, dass einer davon zum Verräter wird und sich nach Peter ausstreckt. Sie ist nicht mehr das einsame Mädchen mit dem gebrochenen Herzen. Sie ist das, was sie im Laufe der Jahre aus sich gemacht hat. Selbst als Michael und John alles vergaßen, hielt sie an der Wahrheit fest. Sie wurde wegen ihrer Wahnvorstellungen weggesperrt und hat es überlebt, die Spritzen, Beruhigungsmittel und Wasserkuren überstanden, die sie vor sich selbst retten sollten. Sie hat gekämpft, nie klein beigegeben: Sie hat Nimmerland nicht losgelassen.
Elf Jahre ist das her, St. Bernadette mit seinen Eisenzäunen und hohen Mauern voll stirnrunzelnder Schwestern und brutaler Aufseher. Ein Ort, der dafür sorgen sollte, dass es ihr besser ging, dass sie geheilt wurde, obwohl Wendy weiß, dass sie überhaupt nie krank war. Und hier vor ihr steht der Beweis, am Bettende ihrer Tochter.
Wendy richtet sich auf, ihre Kieferpartie verhärtet sich und sie sieht Peter in die Augen. In den vergangenen elf Jahren hat sie für sich, ihren Mann und ihre Tochter ein Leben aufgebaut. Sie ist nicht mehr jenes verlorene, verletzte Mädchen und über die Wendy, zu der sie geworden ist, hat Peter keine Macht.
»Peter …«, hört Wendy ihre eigene Stimme, streng, mahnend. Die Stimme einer Mutter, aber nicht von der Art, die sie für Peter immer sein sollte.
Ehe sie noch irgendetwas sagen kann, schüttelt er schon den Kopf. Ein einzelner abrupter Ruck, der ihre Worte vertreibt wie eine ihn umkreisende, surrende Mücke. Sein Gesichtsausdruck wirkt gleichzeitig gelangweilt und ärgerlich.
»Du bist eine Spielverderberin.« Damit dreht er sich um, eine flüssige, elegante Bewegung. Peter verschwimmt und Wendy glaubt schon, dass er gehen will, doch stattdessen packt er Janes Hand. »Macht nichts. Nehm ich halt dafür diese Wendy.«
Peter springt, zerrt Jane in die Luft. Die stößt einen erschrockenen Schrei aus und aus Wendys Kehle hallt sein Echo wider – eine verstümmelte Lautexplosion. Sie ist nicht schnell genug, als Peter mit Jane im Schlepptau zum Fenster hechtet. Stattdessen fällt Wendy vornüber, stößt sich schmerzhaft das Knie und fängt sich am Fensterbrett ab.
Wendys Fingerspitzen streifen Janes Ferse und greifen ins Leere. Peter steigt in die Nacht auf, ein Krähen begleitet seinen Weg, so vertraut, so schrecklich, dass es sie schier erschlägt. Ob ihre Tochter nach ihr schreit, hört Wendy nicht: Als zwei kindliche Gestalten in einem Sternenfeld verschwinden, ist der dröhnende Nachhall von Peters Ruf das einzige Geräusch auf der Welt.
LONDON 1917
»Wo sind wir hier?«, fragt Wendy, als der Mietwagen vor einem schweren Eisentor zum Stehen kommt, das von einer dichten grünen Hecke umgeben ist, zu hoch, um darüber zu schauen.
Durch das Tor ist ein langer Kiesweg zu sehen, der zu einem imposanten Gebäude führt. Die Backsteinfassade und leere Fenster starren ihnen entgegen. John seufzt, seine Stimme klingt angespannt.
»Das ist St. Bernadette, Wendy.«
John wartet nicht auf den Fahrer. Er macht seine Tür auf und kommt herum, um Wendy aussteigen zu lassen. Dann nimmt er sie am Arm, entweder um sie zu stützen oder um sie am Davonlaufen zu hindern.
»Wir haben doch darüber gesprochen, und über Dr. Harrington, weißt du noch? Er wird dir helfen, gesund zu werden.«
Wendy beißt sich auf die Wange; natürlich weiß sie das noch. Ihre Brüder sind die Vergesslichen, aber sie kann nicht umhin, sich zu erinnern. Doch der verbitterte, gehässige Teil von ihr will John das hier so schwer wie möglich machen. Sie will ihn zwingen, ihr immer wieder seinen Plan zu erklären, sie hier zurückzulassen, die Verantwortung für seine verrückte Schwester abzugeben. Was würden wohl ihre Eltern denken? Wären Mama und Papa nie an Bord dieses verfluchten Schiffes gegangen, jenes einen, das als unsinkbar galt, bis es auf einen Eisberg traf – würden sie John und Michael gestatten, sie so zu behandeln? Genau diese Frage schleuderte sie ihm mehr als einmal entgegen, sah zu, wie sich sein Gesicht verzerrte, und ergötzte sich daran. Dennoch, trotz alledem geriet die Entschlossenheit ihres Bruders nie ins Wanken.
Um Johns Mund herum sammeln sich Fältchen, derselbe Gesichtsausdruck, den er als Kind hatte, wenn er immerzu versuchte, so ernsthaft und erwachsen zu sein. Einzig in Nimmerland erlebte Wendy ihn jemals wirklich als kleinen Jungen. Da spielte er »Folgt dem Anführer«, jagte Peter im Flug zwischen den Baumwipfeln hinterher. Warum hätte er das je vergessen und hinter sich lassen wollen?
Auf dem Weg zum Tor studiert sie Johns Profil. Die Art, wie die Sonne seinen stolzen Nasenrücken und seine feste Kieferpartie betont, sich in seiner Brille fängt und seine Augen auslöscht. Sein schlechtes Sehvermögen hatte ihn vor dem Krieg bewahrt, doch dafür wurden ihm so viele andere Bürden auferlegt – sie selbst eingeschlossen. Er ist immer noch jung, einundzwanzig, geht inzwischen gerade so als Mann durch, aber sein Rücken krümmt sich schon unter der Last der Jahre, als wäre er doppelt so alt.
Er muss spüren, dass sie ihn beobachtet, nur schaut er nicht in ihre Richtung. Der erste Anflug von Panik löst den Schmerz in Wendys Brust ab. John hat tatsächlich vor, sie einweisen zu lassen.
Als sich das Tor scheppernd öffnet, mit stoischer Miene geführt von einem Mann in einer weißen Uniform, unterdrückt sie das aufgeregte Flattern in ihrem Inneren. Einen Augenblick lang macht John einen gequälten Eindruck und Wendy denkt flüchtig daran einzulenken. Zumindest hat er den Anstand, selbst mit anzusehen, wie sie eingesperrt wird. Michael hat sich geweigert, sie zu begleiten. Und warum sollte er auch? Die Art und Weise, wie sie mit ihm umgesprungen ist, war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, der John zu seinem Tun gezwungen hat. Sie hat ihren kleinen Bruder angeschrien, ihn verletzt, als er schon so geschwächt war, nachdem er aus dem Krieg nach Hause gekommen ist, körperlich und seelisch gebrochen. John blieb keine Wahl – er schickt sie zu ihrem eigenen Schutz fort, und noch mehr zu Michaels.
Wendy wendet den Blick von ihrem Bruder ab, von dem Mann in Weiß, sie hat plötzlich einen Kloß im Hals. Wenn sie John noch länger anschaut, bricht sie zusammen, und sie ist fest entschlossen, ihre Gefangenschaft hocherhobenen Hauptes anzutreten.
Um sich abzulenken, konzentriert sie sich auf die Anlage. Einst war dieses Anwesen wohl ein vornehmes Landgut und so sieht es nach wie vor aus. Links und rechts des Weges erstrecken sich bis hin zu den mit Eisenzäunen durchsetzten Hecken vorn und hohen Steinmauern auf den drei anderen Seiten leuchtend smaragdgrüne Rasenflächen. Es gibt Blumenbeete und schattenspendende Bäume, Krockettore im Gras und kleine Sitzgruppen mit Tischen. Beinah schon idyllisch. Hier könnte sie vergessen, dass sich der Rest der Welt im Krieg befindet. Sie könnte – sollte sie es sich gestatten – vergessen, dass St. Bernadette ein Käfig ist, aber das wird sie nicht tun.
All ihren Bemühungen zum Trotz breitet sich die Panik aus, das Blut unter ihrer Haut verwandelt sich in einen blauen Fleck. Soll sie noch ein letztes Mal versuchen, sich zu erklären? Wenn sie überzeugend genug lügt, lässt John sie vielleicht zu Hause bleiben und ihm mit Michael helfen. Dessen Bein bereitet ihm immer noch Schmerzen, eine bleibende Folge des Schrapnells, das es zerfetzt hat, aber schlimmer sind die Träume. Sie beide, Wendy und John, schreckten von Michaels Schreien hoch, wann immer er sich in seinem unruhigen Schlaf wieder in den Schützengräben oder im Lazarett wähnte, wo er auf eine weitere Operation wartete, bevor sie ihn endlich nach Hause schickten. Wenn sie ihn bei seiner Therapie unterstützen und für ihn da sein könnte, um ihn über die Erinnerungen und Traumbilder hinwegzutrösten, würde ihr mit der Zeit vielleicht sogar Michael selbst verzeihen.
Doch nein, sie hat keine Chance mehr. John und Michael mögen es zwar nicht erkennen, aber sie hat es versucht. Und sie ist gescheitert. Nach dem Tod ihrer Eltern bemühte sie sich, eine Mutter zu sein, dafür zu sorgen, dass alle etwas zu essen und anzuziehen hatten. Ein gleichgültiger Onkel, nur dem Namen nach ein Vormund, zog zu ihnen. Der Bruder ihrer Mutter, ein Mann, dem Wendy nur ein einziges Mal begegnet war, als ganz kleines Kind. Er tat bloß das absolute Minimum dessen, was erforderlich war, kümmerte sich gerade so um ihr Wohlergehen; alles andere blieb an Wendy, John und Michael selbst hängen. Der stets so ernste John gab sein Bestes, um der Mann im Haus zu sein, nahm alles an Verantwortung auf sich, was er konnte, und verlor dabei noch mehr von seiner Kindheit. Falls noch irgendein Stückchen Nimmerland in seiner Seele geblieben war, verschwand es damals. Noch so jung und doch zu alt für alberne Geschichten und Spiele, für die Fantasie.
Keiner von ihnen nahm sich Zeit, um zu trauern. Das wurde ihnen nicht gegönnt. Natürlich hatte ihr Onkel kein Interesse daran, ihrem Kummer Raum zu geben; jede Gefühlsäußerung wurde als ungehörig betrachtet. Dann wurde Michael zum Kriegsdienst eingezogen und kam als gebrochener Mann nach Hause. Und das Schweigen, das sich zwischen ihr und John, zwischen ihnen allen ausbreitete, wurde schlimmer.
Sie hätte dieses Schweigen wahren sollen, doch die Wahrheit brach aus ihr heraus. Als sie mit ansehen musste, wie ihre Brüder litten – John mit der Last der Welt auf seinen Schultern, Michael mit seinem von Gespenstern erfüllten Blick –, konnte Wendy ihre Zunge nicht im Zaum halten. Kaum volljährig, wurde John zum wahren Herrn des Hauses und ihr Onkel verschwand endlich, da wollte sie sie an glücklichere Zeiten erinnern, zumindest redete sie sich das ein. Nur dass sie schrie, statt vernünftig mit ihnen zu reden. Sie ging auf sie los, verlangte, dass sie die Welt mit ihren Augen sahen, weigerte sich zuzuhören. Je mehr sie sich ihr widersetzten, desto mehr brüllte sie herum. Bis sie zu verblendet war, um damit aufhören zu können, bis sie zu keinem gemeinsamen Nenner mehr zurückfand.
Ihre Wut wurde zur Gewohnheit, Nimmerland zu ihrer Rüstung. Je mehr sie versuchten, sie herauszuzerren, umso weiter zog sie sich in ihre gemeinsame Vergangenheit zurück, um sich vor ihrer Ablehnung zu schützen, Nimmerland zu schützen, ebenso besessen davon, sich zu erinnern, wie John und Michael um jeden Preis vergessen wollten. Nein, John könnte sie genauso gut bitten, sich einen Arm oder ein Bein abzuschneiden; das brächte sie ebenso wenig fertig. Sie kann und will Nimmerland nicht verleugnen. Selbst jetzt nicht.
Wendy erstarrt, als Dr. Harrington – wie immer tadellos gekleidet – den Weg herunterkommt, um sie in Empfang zu nehmen. Sie heftet den Blick auf seine polierten Schuhe, passt ihren Atem seinen Schritten an. Der weiße Kies knirscht unter seinen Sohlen; seine Uhrkette hüpft und glitzert bei jeder Bewegung. Alles, um zu vermeiden, dass sie ihm in die Augen sehen muss, ins Gesicht des Mannes, der wer weiß für wie lange ihr Gefängnisaufseher wird.
Selbst als die Schritte aufhören, presst Wendy ihr Kinn weiter an die Brust. Der Uniformierte, der das Tor geöffnet hat, pflanzt seine – erheblich abgewetzteren und gewöhnlicheren – Schuhe direkt neben die glänzenden von Dr. Harrington. Dass er Schulter an Schulter mit Dr. Harrington Position bezieht, kommt einer unterschwelligen Drohung gleich, und Wendy blickt unfreiwillig auf. Der Uniformierte ist gut einen Kopf größer als Dr. Harrington. Er hat etwas Kantiges an sich, seine Schultern sind breit, die Haare ordentlich geschnitten und kurz. Sie fragt sich, warum er nicht in Übersee kämpft.
Auf der Brusttasche des Mannes ist ein Name eingestickt – Jamieson. Er fängt ihren Blick auf und verzieht gehässig seinen Mund. Wendy erschrickt, aufs Neue durchfährt sie ein Angstschauer. Sie hat diesem Mann nichts getan, und doch sieht Jamieson sie an, als wolle er ihr etwas zuleide tun. In Nimmerland lernte sie Jungen wie ihn kennen, Raufbolde, die Peter folgten, doch der Glanz seiner Spiele hielt sie im Zaum. Für Jamieson ist sie ein wildes Tier, dem man beim kleinsten Anlass einen Maulkorb verpassen und das man an die Kette legen muss. Ein Jährling, der gebrochen werden muss, falls er den Sattel verweigert.
»Mr. Darling.« Dr. Harrington streckt John die Hand entgegen und reißt Wendy aus ihren finsteren Gedanken.
Wieder steigt die Verbitterung in ihr auf, einen Augenblick lang ist die Angst vergessen. Dr. Harrington und John schütteln einander die Hand, so kultiviert – keiner von beiden würdigt sie eines Blickes –, als wäre sie Gegenstand einer reinen Geschäftsbeziehung, keine Patientin oder geliebte Schwester. Und die ganze Zeit liegt Johns andere Hand um ihren Arm. Grob reißt sie sich los.
»Ich bin durchaus in der Lage, allein zu laufen.« Die Worte klingen bissig und sie geht einen Schritt von ihrem Bruder weg: ein weiterer feiner Nadelstich. Alle drei Männer beobachten sie, als könnte sie sich in einen Vogel verwandeln und ihnen davonfliegen.
Wendy reckt das Kinn, sieht aber keinen von ihnen an. Sie will sich nicht mal verabschieden. Soll John ruhig ein schlechtes Gewissen haben. Ohne um Erlaubnis zu fragen, läuft sie an Dr. Harrington vorbei auf die Eingangstüren von St. Bernadette zu. Wenn das ihr Schicksal sein soll, wird sie ihm aus eigenem Antrieb begegnen und ihm nicht entgegengeschleift oder zugeführt werden. Die Absätze ihrer Stiefel treten hart auf den Kies, obwohl ihr unter dem Kleid die Knie zittern, doch sie weigert sich, langsamer zu werden oder einzulenken.
»Wendy!« Hinter ihr schlurfen Johns Schritte über den Weg.
Das verleiht den ihren nur noch mehr Entschlossenheit und Wendy läuft schneller. Sie dreht sich nicht um, bleibt nicht stehen, und hört Dr. Harrington ihren Bruder abfangen, seine Stimme ist sanft und versiert, geübt darin, Patienten zu beschwichtigen.
»Vielleicht ist es so besser, Mr. Darling. Ihre Schwester ist hier in guten Händen. Sobald sie Gelegenheit hatte, sich einzugewöhnen, dürfen Sie sie selbstverständlich besuchen.« Was stillschweigend voraussetzt, dass Wendy dann fügsamer ist. In Dr. Harringtons Stimme liegt nicht der Hauch eines Zweifels – er wird für ihre Heilung sorgen.
Unwillkürlich ziehen sich Wendys Schultern zusammen. Dr. Harringtons Worte setzen ihr zu, sein Tonfall nagt an ihr, frisst sich durch ihr Fleisch bis auf die Knochen. Nur zu gern würde sie herumwirbeln und mit geballten Fäusten auf seine Brust einprügeln, doch sie zwingt ihre Arme, locker an den Seiten herunterzubaumeln. In ihrer Wut auf Michael und John hat sie mehr Porzellan zerschlagen, als ihr lieb ist. Dieses eine Mal muss sie ihr Temperament zügeln.
»Miss Darling.« Dr. Harrington holt sie ein, Jamieson klebt noch immer an ihm wie ein Schatten. Wendy dreht sich nicht um, um nachzusehen, ob John vom Weg aus noch alles beobachtet. »Gestatten Sie mir, Ihnen Ihr Zimmer zu zeigen.«
Dr. Harrington redet mit ihr, als sei sie hier Gast, als könne sie gehen, wann immer sie will.
»Ich denke, Sie werden es hier äußerst angenehm finden. Unser Personal und die Ausstattung sind hervorragend. In dieser Welt wollen wir alle nur eins: Sie gesund machen.«
Wendys Mund öffnet sich, aber kein Ton kommt heraus. Irgendwie haben sie das Ende des Weges erreicht, sind die Treppe hinaufgestiegen. Sie stehen im Türrahmen. Dr. Harrington nimmt sie am Arm. Hinter ihm ragt Jamieson auf. Selbst wenn sie es schaffen würde, sich loszureißen, sie kann nirgendwohin.
»Hier entlang.«
Vor lauter Verbissenheit und Stolz ist sie direkt in die Falle gelaufen, und die wird jeden Moment hinter ihr zuschnappen. Es ist zu spät. Noch ein Schritt und Wendy überquert die Schwelle. Augenblicklich verändert sich die Luft, sie wird schwer und muffig. Wendy hat das Gefühl, der Verlust des freien Himmels über ihr raube ihr den Atem. Bis eben war ihr gar nicht bewusst, wie viel Trost ihr dieses perfekt Stück Blau gespendet hat.
Sie wirft einen Blick auf die Zinndecke, von der ein Kronleuchter hängt. Üppige Teppiche mit Mustern in satten Farben bedecken den Boden des Eingangsbereichs, schön, aber abgenutzt. Ein paar Meter weiter gibt die Decke einen hohen, offenen Raum frei. Geschwungene Treppen an beiden Enden des Foyers wölben sich zu einer Galerie hinauf, von der aus man das Erdgeschoss überblickt. Durch eine Buntglasscheibe fällt Licht herein, dessen Beschaffenheit Wendy allerdings verrät, dass das Fenster nicht nach draußen führt. Hier ist alles abgeriegelt und gesichert, denn der Schein soll gewahrt bleiben.
Dr. Harrington dirigiert sie an einem Anmeldetresen vorbei, ohne der Frau in Schwesterntracht, die dort sitzt, auch nur einen flüchtigen Blick zu schenken. Die Frau schaut auch nicht auf und Wendy unterdrückt angesichts dieser allumfassenden Kälte einen Schauder. Sie ist bloß ein Vorgang, eine von so vielen Patientinnen, die durch diese Türen marschiert sind, weil sie ihren Familien lästig waren oder schlimmer noch wirklich krank. Gibt es in dieser Einrichtung irgendetwas, das sie heilen kann?
Wendy versucht mehr von ihrer Umgebung in sich aufzunehmen, doch Dr. Harrington beschleunigt seine Schritte, führt sie an einem Gemeinschaftsraum mit großen, zum Garten gelegenen Fenstern und einem Zimmer vorbei, das den Schwestern vorbehalten ist, damit sie ihre Füße ausruhen können. Sie biegen um eine Ecke. Erneut verändert sich die Atmosphäre und Wendy spürt es sofort – ein Übergang von dem alten Gutshaus in einen Neubauflügel.
Wieder überfällt sie die Panik und diesmal will sie sich nicht mehr unterdrücken lassen. Vor ihr erstreckt sich ein gewöhnlicher Flur und der hat nichts Gastfreundliches an sich – all der Glanz ist verflogen. Das hier ist kein Landsitz, kein Ort, an den Menschen kommen, um sich zu erholen und gesund zu werden. Es ist eine Irrenanstalt, in die Menschen weggesperrt werden. Wo Patienten schreien und niemand antwortet.
Türen mit kleinen Glasfenstern darin säumen den Korridor. Weitere Biegungen und Kurven tragen sie über schimmernde Schachbrettfliesen. Wendy fühlt sich wie betäubt, ihr ist schwindelig. Sie kommen an breiteren Türen vorbei, die weiter auseinanderliegen. Medizinische Einrichtungen, Behandlungsräume. Die Größe des Gebäudes entzieht sich ihr; sie kann sich kein Gesamtbild davon machen.
»Bitte, Dr. Harrington …« Wendys Stimme klingt kurzatmig, eine Schwäche, die sie sich nur ungern eingesteht, aber sie kann nichts daran ändern. Irgendetwas hier bedrückt sie und sie ringt nach Luft.
Und dann bleibt sie abrupt wie angenagelt stehen, trotz Dr. Harringtons Hand an ihrem Arm. Ein Mädchen mit langen dunklen Haaren kommt ihnen entgegen, mit gesenktem Kopf, sodass Wendy sein Gesicht nicht richtig sehen kann. Trotzdem trifft sie der Anblick wie ein Schlag in die Magengrube und ihr liegt ein Name auf den Lippen, so schnell, dass sie ihn beinah laut ausspricht: Tiger Lily.
Sie hat sich geschworen, hier kein Wort über das Geheimnis von Nimmerland zu verlieren, es komplett für sich zu behalten. Was auch immer John Dr. Harrington erzählt hat, kann bestenfalls nur die halbe Wahrheit sein. Sollte ihm Wendy irgendwelche Tatsachen berichten, würde Dr. Harrington doch nur mit Mikroskop und Skalpell darangehen und sie in etwas Hässliches verwandeln. Also schluckt sie Tiger Lilys Namen hinunter, obwohl er ihr auf der Zunge brennt, und schaut weg, als das Mädchen vorbeigeht.
Doch sosehr sie sich auch wünschen mag, es wäre anders, ihr Geist rebelliert. Sie kann nichts dagegen tun, dass ihr eine mit smaragdgrünem Gras bewachsene Böschung unter herabhängenden silbernen Ruten einer Weide in den Sinn kommt. Fernab der ganzen Welt flochten sie und Tiger Lily dort Kronen aus Schilf, verschränkten ihre Hände ineinander – braun und weiß – und krönten einander zu Königinnen.
Die Erinnerung schmerzt. Sie kann es nicht lassen, immer wieder aufzuschauen, aber das Mädchen ist schon um eine Ecke gebogen. Das Gefühl des Verlusts, das es in ihr hinterlässt, macht Wendy das Atmen schwer, doch sie zwingt sich weiterzugehen. Dr. Harrington wirft ihr einen Blick zu, ein missbilligendes Stirnrunzeln, weil sie die naturgegebene Ordnung erschüttert hat.
Das Mädchen ist nicht Tiger Lily. Sie weiß das, und um sich abzulenken, versucht Wendy aus dem flüchtigen Blick sein wahres Aussehen zu rekonstruieren und überzeugt sich nach einem kurzen Moment, dass es Tiger Lily überhaupt nicht ähnlich sieht. Ihr Verstand hat ihr nur einen Streich gespielt, aus dem Wunsch nach etwas Vertrautem an diesem Ort des Grauens heraus, nach etwas, das ihr ein wenig Geborgenheit vermittelt.
»Da sind wir.« Dr. Harringtons Stimme, aufgesetzt fröhlich und mit einem scharfen Unterton, holt sie aus ihren Gedanken.
Er öffnet eine Tür so flink und lässt den Schlüssel so hurtig in seine Hosentasche gleiten, als sollte Wendy es nicht mitbekommen. Die offene Tür gibt den Blick auf ein spartanisches zellenähnliches Zimmer frei. Ein rein zweckmäßiger Raum mit weiß gestrichenen Wänden, einem schmalen Bett und einem einzigen Stuhl. Am Fenster gibt es keine Gardinen und außen sind Gitterstäbe angebracht.
»Hier haben wir etwas, das wir gern als Uniformen für die Patientinnen sehen.« Dr. Harrington grinst. Es wirkt wie eine seltsame Grimasse, so als lasse er Wendy an einem Witz teilhaben, den nur Eingeweihte verstehen. »Hier sind alle gleich, egal wer sie früher waren. Sie sind alle hier, um gesund zu werden.«
Er deutet auf ein zusammengelegtes schlichtes Baumwollkleid auf dem Bett, beinah von demselben Hellgrau wie die Decke, auf der es liegt. Das Mädchen, an dem sie auf dem Flur vorbeigegangen sind, das nicht Tiger Lily ist, hatte das gleiche an.
Bei seinen nächsten Worten verändert sich Dr. Harringtons Ton, ganz auf Effektivität bedacht, und der bei der Begrüßung erweckte Anschein, Wendy sei hier nur Gast, verschwindet. Er redet rein mechanisch, spricht eine Patientin an, über deren individuelle Wünsche und Bedenken er sich ohnedies hinwegzusetzen gedenkt, und lässt Wendy keinerlei Raum, darauf einzugehen.
»In Kürze kommt eine Schwester vorbei, die Ihnen beim Umziehen hilft und Ihre eigene Kleidung einlagert. Bis Sie sich eingewöhnt haben, wird Ihre Tür abends abgeschlossen. Selbstverständlich dient das nur Ihrer Sicherheit. Die Mahlzeiten werden im Speisesaal serviert, es sei denn, mildernde Umstände gebieten etwas anderes. Während der ersten paar Tage wird Ihnen das Essen aufs Zimmer gebracht, auch das gilt, bis Sie sich eingelebt haben.«
Ehe sie fragen kann, was denn mildernde Umstände sein könnten, tätschelt Dr. Harrington Wendys Hand und seine Miene wird wieder herzlich und väterlich. Sie nimmt an, die Geste soll beruhigend wirken. Sie ist alles andere als das.
Sie presst die Lippen aufeinander, damit sie nicht die Zähne fletscht. Am liebsten würde sie knurren. Davonlaufen. Sie möchte zerspringen und in sich zusammenfallen – im Stich gelassen, angezweifelt, verleugnet. Sie tut nichts von alledem, steht reglos mit gefalteten Händen da, als sich Dr. Harrington zurückzieht. Die Tür schließt sich und sie hört das verräterische Klirren eines Schlüssels im Schloss.
Schweigen erfüllt die Ecken des Zimmers, der Druck lastet auf ihrer Haut. Wendy setzt sich auf die Bettkante. Sprungfedern bohren sich durch die dünne Matratze. Die Stille hat etwas Endgültiges.
Ihr liegt nicht sonderlich viel an dem Kleid, das sie trägt, aber bei der Vorstellung, dass sie zugunsten der plumpen grauen Uniform darauf wird verzichten müssen, steigt ein Schrei in ihrer Kehle auf. Noch schlimmer ist die Tatsache, dass man ihr – wie einem widerspenstigen Kind – nicht einmal zutraut, sich selbst umzuziehen. Sie betastet die Bündchen an ihren Ärmeln, streicht in dem Versuch, sich vom bloßen Gefühl des Stoffes erden zu lassen, über die grobe Wolldecke. Es ändert nichts.
Sie atmet tief ein, konzentriert sich auf die Bewegung ihrer Rippen, darauf, wie sich die Luft in ihrer Lunge ausbreitet. Das Ganze ist nur eine Bewährungsprobe. Morgen holen John und Michael sie nach Hause. Sie wird lernen, sich zu benehmen. Keine zerbrochenen Teller mehr. Keine Wutanfälle mehr.
Tief in ihrem Inneren weiß Wendy, dass John und Michael sie nicht abholen werden. Zumindest nicht, bis sie bewiesen hat, dass sie sich anständig aufführen kann, bis Dr. Harrington sie für gesund erachtet. Und falls das nie geschieht? Falls John entscheidet, dass es bequemer ist, noch einen weiteren Teil seiner Kindheit zu vergessen und sie sicher verwahrt zu wissen? Die Gitterstäbe am Fenster malträtieren den Himmel, zerstückeln ihn in akkurate Rechtecke. Niemand wird sie abholen. Gar niemand. Nicht einmal …
Das ist zu viel. Wendy reißt das Kissen vom Bett und presst es an ihren Mund. Sie hechelt in flachen Zügen, die zunehmend abgehackter werden, bis ihre Lunge zu bersten droht.
In diesem Moment schreit Wendy durch das Kissen gedämpft ihre Angst und ihre Wut in die grauenhafte Stille um sie herum.
LONDON 1931
Wendy kehrt an Janes Fenster zurück. Die Inspektoren von Scotland Yard sind gekommen und wieder gegangen. Stundenlang war ihr Haus von Männerstimmen erfüllt – von ihrem rauen Gelächter, wenn ihnen nicht bewusst war, dass sie sie hörte, von ihren Fragen, auf die sie keine Antworten hat, von Tabakgestank, der in ihren Uniformen und an ihrer Haut hängt. Sie hasst sie alle miteinander. Jetzt ist nur noch ihr Schwiegervater übrig und ihn hasst sie am allermeisten.
Neds Vater traf gleichzeitig mit den Polizisten ein, ohne dass Wendy oder Ned mit ihm darüber gesprochen hätten, was geschehen war. Für Wendy war offensichtlich, dass ihr Schwiegervater mit dem leitenden Kommissar – einem persönlichen Freund – vereinbart hatte, dass er umgehend kontaktiert wurde, falls ein Notruf aus ihrem Haus einging. Unter ihrer Erschöpfung brodelt die Wut, noch verstärkt durch die Tatsache, dass sie nichts von alledem laut aussprechen darf. Im Stillen verflucht sie ihren Schwiegervater und verwünscht Scotland Yard für seine rückgratlose Feigheit. Als ob sie und Ned unfähig wären, selbst dafür zu sorgen, dass ihr Haus sicher ist. Bei dem Gedanken steigt ein bitteres Lachen in ihr auf, doch sie sperrt es hinter ihren Lippen ein. Ach, aber sie ist ja unfähig. Wie eine scharfe Klinge bohrt sich die Erkenntnis in sie und nimmt ihr den Atem. Sie hat Jane verloren. Sie hat zugelassen, dass sich Peter mit ihrer Tochter davonmacht.
Wendy verknotet ihre Finger und starrt aus Janes Fenster auf die dunklen Straßen. Sie ist todmüde und gleichzeitig ist Schlaf das Letzte, woran sie jetzt denkt. Die Inspektoren und ihr Schwiegervater haben ihr Dutzende Fragen gestellt und Ned danach genau dasselbe noch mal gefragt. Als müsste er aufgrund seines Geschlechts mehr wissen, als sie es je könnte. Und die ganze Zeit, ob sie verhört wurden oder schwiegen, blitzte ihr Schwiegervater sie beide wütend an.
Wendy schlingt die Arme um ihren Oberkörper und umklammert ihre Ellbogen, damit es sie nicht zerreißt.
Sie hat sie angelogen. Die Männer von Scotland Yard. Ihren Schwiegervater. Sogar Ned. Sie hat ihnen erzählt, sie sei plötzlich aufgewacht – mütterlicher Instinkt –, ins Zimmer ihrer Tochter gegangen und habe festgestellt, dass sie verschwunden war. Der Nachgeschmack der Unaufrichtigkeit liegt ihr noch deutlich auf der Zunge. Aber was hätte sie denn sonst sagen sollen?
Seit Jahren belügt sie Ned, verschweigt ihm jenen entscheidenden Teil der Wahrheit. Seit elf Jahren spielt sie eine gute Ehefrau, eine gute Mutter; es gab Tage, da schaffte sie es sogar, sich selbst zu überzeugen. Doch nun fällt alles auseinander, dieselbe Täuschung wie ihre Bemutterei bei Peter und den Jungs in Nimmerland.
Sie hat sich hierfür entschieden, sie hat es versucht und trotzdem versagt. Nicht loszuschreien, nicht alles zu werfen, was ihr in die Finger kommt, und die Wahrheit hinauszubrüllen, bis ihre Kehle blutet, verlangt Wendy jedes Quäntchen Kraft ab. Sie taugt zu nichts und wird auch nie zu irgendetwas anderem taugen als Lügen und Illusionen.
Sie geht vom Fenster weg und läuft in Janes Zimmer auf und ab. Ihre Finger streichen über sorgfältig mit Nadeln befestigte Schmetterlinge hinter Glas, über Sammlungen von Steinen und Muschelschalen und Blättern, die alle in eigenen Etuis aufbewahrt werden. Janes Bücher. Der Globus oben auf ihrem Regal, auf dem Stecknadeln sämtliche Orte markieren, die ihre Tochter besuchen will. Trotz ihrer Träume von all jenen fernen Ländern hätte sich Jane Nimmerland nicht einmal vorstellen können. Wendy hätte sie warnen müssen. Sie hätte …
Wendy hebt einen Schmetterlingskasten auf. Das Etikett ist mit Janes ordentlicher Handschrift versehen – ordentlicher, als Wendys in ihrem Alter je war. Faulbaum-Bläuling, Celastrina argiolus. Jane hat ihn während der Ferien gefangen, die sie in Northumberland verbrachten, sie war so begeistert, dass sie das Glas auf dem gesamten Heimweg wie einen Schatz an die Brust drückte.
Die Erinnerung schnürt Wendy die Kehle zu, droht sie in Tränen ausbrechen zu lassen. Am liebsten möchte sie den Kasten kaputt schlagen, alles im Zimmer zertrümmern. Stattdessen legt sie den Schmetterling so sanft ab, wie sie kann.
»Komm hier raus, Darling.« Ned berührt sie an der Schulter.
Wendy fährt zusammen. Sie hat ihn nicht hereinkommen hören. Wie lange hat sie hier gestanden und gestarrt? Seine Hand liegt warm und stark auf ihrer Schulter und sie will sie abschütteln, doch sie zwingt sich, sich umzudrehen.
Feine rote Äderchen in Neds Augen zeugen von seiner eigenen Qual und seine angespannte Haltung ist unmissverständlich. Seine Lippen unter dem akkurat gestutzten Schnurrbart sind zu einem dünnen Strich zusammengepresst. Er hat genauso große Angst um Jane wie sie, vielleicht sogar größere, weil er noch weniger versteht, was vorgeht. Sie muss es ihm sagen. Das sollte sie, aber sie wird es nicht tun.
»Wo ist Mary?« Scharfe Worte anstelle von tröstenden.
Wendy hasst sich dafür, aber sie kann dennoch nicht umhin, an Neds Schulter vorbeizuschauen, als würde Mary womöglich mit einem Tablett voll Tee im Türrahmen erscheinen. Ihr Puls beschleunigt sich. Stattdessen steht ihr Schwiegervater dort, das Licht aus dem Flur verwandelt ihn in einen bedrohlich aufragenden Schatten.
»Ich habe die Köchin nach Hause geschickt.« Ned unterstreicht Marys Berufsbezeichnung, er klingt ebenso hart wie sie selbst gerade eben.
Wendy hört den spröden Unterton heraus, doch sie strafft sich und weicht ein paar Zentimeter zurück, als wäre zu große Nähe in einem Moment wie diesem sogar zwischen Eheleuten irgendwie unangemessen. Wegen der Lampe hinter ihm kann sie das Gesicht ihres Schwiegervaters nicht erkennen, aber sie sieht im Geiste seine finstere Miene vor sich. Wendy kennt seine Meinung über Mary und sie weiß, dass Ned sie nicht teilt. Unter normalen Umständen hätte er sie niemals nach Hause geschickt. Vielmehr hätte er sie Mary genannt statt »die Köchin« und womöglich wäre er derjenige, der für sie alle drei in ihrer gemeinsamen Sorge um Jane Tee machen würde. Doch solang Neds Vater hier ist, spielt das alles keine Rolle.
Für ihren Schwiegervater ist Mary dieses Mädchen – dieses Wort betont er immer. Ein schlechter Einfluss auf euren Hausstand und Wendy weiß, damit meint er einen schlechten Einfluss auf sie. Und das sind nur die Sachen, die er sagt, wenn sie in Hörweite ist. Ned gegenüber benutzt er weit schlimmere Ausdrücke, das weiß Wendy, er nennt Mary Wilde und Heidin, gefährlich und nicht vertrauenswürdig. Einzig Neds Fingerspitzengefühl und seine Besonnenheit haben sie davon abgehalten, ihren Schwiegervater zu kritisieren und ihm zu verbieten, je wieder einen Fuß in ihr Zuhause zu setzen. Nicht dass sie das könnte. Trotz allem, was sie sich in den letzten elf Jahren aufgebaut hat, ist so viel von Wendys Leben allein der Gnade ihres Schwiegervaters geschuldet.
Er ist nämlich nicht nur Neds Vater, sondern auch sein und Johns Arbeitgeber. Obwohl ihr Bruder sich weigert, offen mit ihr darüber zu sprechen, hat sie den Verdacht, dass John ihm Geld schuldet. Ehe er anfing, für Neds Vater zu arbeiten, gab es eine Zeit, in der John sein Vertrauen in jemand Falschen gesetzt und das Erbe ihrer Eltern in etwas investiert hat, das ihm als Erfolg versprechendes Unternehmen erschien. In der er sich für erwachsen hielt, wo er doch noch so jung war.
Das meiste davon hat Wendy herausgefunden, indem sie zufällig Gesprächsfetzen aufgeschnappt, herumgeschnüffelt und eigene Nachforschungen angestellt hat. Wenn sie direkt danach fragte, lenkte ihr Bruder die Konversation jedes Mal in eine andere Richtung und teilte ihr mit, eine Frau habe sich nicht um die Geschäfte zu kümmern.
Aber es ist mehr als das. Zwischen Ned und seinem Vater existiert ein empfindliches Gleichgewicht, das dadurch auch für sie und Neds Vater und sogar für sie und Ned gilt – eins, das sie immer noch zu begreifen versucht. Ned fürchtet die Missbilligung seines Vaters und sehnt sich nach dessen Anerkennung, verzehrt sich mit jedem Mal, da sie ihm vorenthalten wird, umso heftiger danach. Wendy weiß, dass ein Teil von Ned in seinem tiefsten Inneren trotz alledem immer noch das Verlangen hat, dem Bild zu entsprechen, das sein Vater von einem richtigen Mann hat. Darum sein Gepolter in Gegenwart von Scotland Yard, darum seine Ergebenheit gegenüber sämtlichen Grundsätzen seines Vaters. Die Ironie darin scheint Ned nicht wahrzunehmen. Sein Vater weiß nur Stärke zu schätzen, und doch verharrt Ned in diesem eingeschüchterten Zustand. Sie fragt sich, was wohl passieren würde, wenn er für sich selbst einstehen, Respekt einfordern würde für das, was er ist, und nicht für das, was sein Vater aus ihm machen will.
»Natürlich«, sagt Wendy. »Durchaus angemessen.«
Sie hört die Kälte in ihrer Stimme, schluckt darum herum wie um einen Eisklumpen in ihrer Kehle. Ned zuckt kaum merklich zusammen. Ihretwegen oder weil er sich dagegen wehrt, seinen Vater anzusehen? Seine Augen suchen Wendys Blick, flehen sie um Geduld an, selbst jetzt, da ihre Tochter vermisst wird.
Er leidet, ist ebenso unglücklich über die Anwesenheit seines Vaters wie Wendy, doch sie müssen den Schein wahren. Wendy kennt das. Sie versteht es. Aber ihre Tochter ist verschwunden. Peter hat Jane aus ihrem eigenen Bett entführt und jeden Moment, den ihr Schwiegervater hier zubringt, jeden Augenblick, in dem sie ihre Rollen spielen, könnte sie da draußen sein, um Jane zu retten.
Wendy legt beinah ihre Hand auf Neds Brust. Es wäre eine kleine Geste der Wertschätzung, eine Brücke zwischen ihnen – geteiltes Leid ist halbes Leid –, doch sie kann nichts daran ändern, dass der Zorn in ihr wogt wie eine Flut. Sie lässt ihre Hand sinken. Es ist ihr Schwiegervater, den sie hasst, aber Ned ist näher. Und obgleich er sich nur dem Druck seines Vaters beugt, ist letztlich Ned derjenige, der Mary weggeschickt hat.
Sie malt sich aus, wie Mary protestiert, wie Ned mit schmerzerfüllten Augen darauf bestanden hat, und Mary nun allein in ihrem winzigen gemieteten Zimmer sitzt. Mary ist der einzige Mensch, der es vielleicht verstehen würde. Mit John oder Michael kann Wendy nicht reden, und selbst wenn sie die jahrelangen Lügen ungeschehen machen und Ned sagen könnte, wo Jane ist … würde er ihr denn glauben?
Ihre Finger krallen sich in den Stoff ihres Rocks, ballen sich zur Faust, ehe sie sich zwingt, loszulassen. Sie wird Ned nicht die Hand an die Brust legen, um ihn zu trösten, aber sie wird auch nicht handgreiflich werden. Mehr kann sie im Augenblick nicht tun.
Eine Bewegung lenkt Wendys Blick auf sich, Neds Vater schüttelt den Kopf, bevor er sich zurückzieht. Schritte hallen auf dem Flur wider, werden demonstrativ lauter, als er die Treppe hinuntergeht. Wendy senkt den Kopf, wahrt weiter die Distanz zwischen sich und ihrem Mann. Neds Schultern sacken nach vorn. Jeder Schritt ein Stirnrunzeln, ein barsch ausgestoßenes Wort. Dann geht endlich die Haustür auf, fällt wieder zu, und sie sinken beide in sich zusammen, ohne sich näher aufeinander zuzubewegen.
Als Wendy doch aufblickt, stellt sie fest, dass Ned sie beobachtet, als könnte sie jeden Moment zerspringen und als würden sich ihre Scherben in seine Haut bohren. Wendy presst die Lippen zu einem schmalen Strich zusammen. Wenn sie spricht, wenn sie irgendetwas sagt, platzt sie womöglich mit der Wahrheit heraus. Sie weiß, dass das Imponiergehabe, das Ned vor den Männern von Scotland Yard an den Tag gelegt hat, ausschließlich der Wirkung auf seinen Vater geschuldet war. Deshalb hat er den gebieterischen Haushaltsvorstand gespielt, der keine Zeit für Weibergeschwätz hat. Das sollte sie ihm nicht übel nehmen, aber ganz verzeihen kann sie es ihm auch nicht. Da Vertrauen und Unterstützung von ihm zu erwarten, wo sie beides nicht erwidert hat, ist unfair. Doch sie kann diese Brücke nicht schlagen. Nicht jetzt. Nicht solang ihre Tochter verschwunden ist. Das Freundlichste, wozu sie imstande ist, ist, sich zurückzuziehen.
»Ich bin müde«, murmelt sie mit gesenktem Blick.
Wenn sie aufschaut, wird sie den Schmerz in seinen Augen sehen, all die Wahrheiten, die sie ihm nie erzählt hat. Ned antwortet mit gepresster Stimme, als ob er immer noch für ihren Schwiegervater schauspielert.
»Natürlich, Darling. Du solltest dich ausruhen.«
Wendy lässt den Kopf hängen. Sie hat nicht vor, ihn zu heben, als sie an ihm vorbeigeht, aber Ned greift nach ihrem Arm.
»Die Polizei tut, was sie kann. Sie werden Jane finden und nach Hause bringen.«
Wider besseres Wissen schaut Wendy ihrem Mann in die Augen. Der Verlust, der darin zu lesen ist, lässt sie schwindeln, droht aufs Neue sie zu zerbrechen. Auf einmal ist sein Stottern wiederaufgetaucht – in den elf Jahren, die sie ihn kennt, war es beinah verschwunden: ein Zeichen seiner Erschöpfung. Sie sollte irgendetwas Nettes sagen, ihm Mut machen, nur hat sie schon zu viel Zeit verschwendet. Sie muss hinter Jane her und das kann sie nicht, solang Ned über sie wacht. Wendy kneift in die Innenseiten ihrer Arme, damit sie verschränkt bleiben.
»Gewiss doch.« Ihr Kiefer schmerzt von den Worten, die sie zurückhält. »Du hast ja recht. Die Polizei wird sich um alles kümmern. Ich lege mich hin. Holst du mich, wenn du etwas hörst?«
Sie sagt es in der Gewissheit, dass es nichts zu hören geben wird. Scotland Yard wird Jane nicht finden. Das kann nur Wendy. Bis Ned kommt, um nach ihr zu sehen, wird sie längst fort sein.
»Ja, Darling. Selbstverständlich mache ich das.« Ned gibt ihr einen Kuss auf die Stirn. Wendy steht vollkommen reglos da; seine Lippen brennen auf ihrer Haut.
Darling, Darling, Darling. Sie weiß, dass es ein Ausdruck der Zuneigung ist, ihr ist bewusst, dass sich Ned nichts dabei denkt, doch sie kann nichts daran ändern, dass sie das Wort zutiefst verabscheut. Es ist zu einer Waffe geworden, nicht aus Neds Mund, nicht absichtlich, aber es diente jahrelang nur dazu, sie zu beschwichtigen, sie abzutun, sie zum Schweigen zu bringen. Man beraubte sie ihres eigenen Namens und verwendete ihn gegen sie – als Knebel, als Kette. Sie wäre heilfroh, wenn sie ihn nie wieder hören müsste.
Als sich Wendy von Schuldgefühlen gequält in ihr Zimmer zurückzieht, folgt ihr Neds Blick immer noch.
Sie gestattet sich einen Augenblick lang, sich gehen zu lassen, sich dem Schmerz darüber hinzugeben, dass sie Jane verloren hat. Dabei taucht aus dem Nichts eine Erinnerung auf, schrill und unvermittelt. Sie rennt, Hand in Hand mit Peter, der Boden bebt, die Erde brüllt.
Alles ist so real, so gegenwärtig, dass sich Wendy am Bettpfosten abstützen muss, um sich ins Gedächtnis zu rufen, dass sie eine erwachsene Frau ist, die in London lebt. Sie ist kein Kind mehr, das an Peters Fersen klebt. Ein ganzes Leben unterscheidet diejenige, die sie damals war, von derjenigen, die sie jetzt ist.
Und dennoch hat sie sich im Laufe der Jahre, in den stillsten Momenten, den Luxus gegönnt, sich daran zu erinnern, wie es sich anfühlt zu fliegen, »Folgt dem Anführer« zu spielen, Peter auf den verschlungenen Pfaden der Wälder von Nimmerland nachzujagen. Das wünscht sie sich jetzt, die Unschuld, die Unbeschwertheit, die Freiheit.
Aber das hier ist etwas anderes. Sie laufen nicht aus Spaß – sie laufen vor etwas fort. Vor etwas Schrecklichem.
Sie kann es beinah greifen. Ihre tastenden Finger stoßen auf massives Holz, eine Tür, die Erinnerung ist dahinter eingesperrt. Ein Geheimnis. Eins von unermesslicher Bedeutung.
Sie verdrängt es. Jetzt ist nicht die Zeit, darüber nachzudenken, was sie verloren hat. Sie muss sich auf das konzentrieren, was sie hat, wie sie Jane befreien wird. Peter hat sie bestohlen; nun wird sie wiederum ihn bestehlen. Sie hat eine Menge gelernt, seit er sie zum letzten Mal gesehen hat, und sie wird alles gegen ihn einsetzen, um ihre Tochter heimzuholen.
Peter hat ihr einst erzählt, Mädchen dürften nicht in den Krieg ziehen. Damals fand sie das entsetzlich ungerecht, aber in gewisser Weise hatte er recht. Wendy ist keine Soldatin. Sie blieb zu Hause, während ihr kleiner Bruder wegging, um sich Gewehren und Schützengräben, Gas und Granaten zu stellen – aber das bedeutet nicht, dass sie keine Kämpferin ist. Mehr als das, sie ist auch eine Überlebenskünstlerin.
Sie hat St. Bernadette überlebt, indem sie die erste Fertigkeit einsetzte, durch die sie für Peter überhaupt wertvoll war. Das muss doch auch zählen. Als Kind war sie ungeschickt im Nähen, doch dank Marys geduldiger Unterweisung ist sie inzwischen so viel besser darin. In jenem weiß gestrichenen Gefängnis hatte sie drei Jahre lang nichts anderes zu tun, als unter Marys Anleitung zu üben, ihre Stiche sauber und dicht zu setzen.
Hier in der Außenwelt dienen Taschen der Bequemlichkeit, sie sind Luxus; in der Irrenanstalt waren sie indessen ein Muss. Mary brachte ihr bei, kleine Geheimfächer in die Säume und Ärmel ihrer unförmigen Einheitskleidung zu nähen, mit flotten Stichen, die fest genug waren, um zu halten, aber auch locker genug, um die Fäden wieder herauszuziehen, damit sie in der Wäscherei nicht entdeckt wurden. Von außen unsichtbar, dicht an ihre Haut geschmiegt. Manchmal reichte es schon, sie zu berühren, selbst wenn sie leer waren, zu wissen, dass sie da waren, um Wendy Halt zu geben.
John glaubte, eine private Einrichtung bedeute eine bessere Betreuung. Aber Dr. Harrington war dort als einziger Arzt beschäftigt und bei der wenigen Kontrolle war es leicht für die Aufseher, beiläufige Grausamkeiten zu begehen. Besonders für Jamieson.
War Dr. Harringtons Aufmerksamkeit abgelenkt, tat sich Jamieson mit seinen Kollegen gegen Wendy zusammen. Sie stellten ihr auf dem Weg durch die Flure ein Bein, versuchten sie dazu zu bringen, dass sie die Beherrschung verlor, sie »hysterisch« zu machen, damit ihr Dr. Harrington Bromid verordnete oder sie in ihrem Zimmer einsperren ließ. Dort »vergaßen« sie dann vielleicht, ihr die Mahlzeiten zu bringen, oder wenn ihr Essen kam, waren Holzsplitter oder winzige Glasscherben darin versteckt. Es gab auch noch andere Vorfälle. Grundlose Bestrafungen. Folter.
Doch Wendy hatte sich für jede Quälerei revanchiert. Sie stahl unbedeutende Kleinigkeiten. Knöpfe. Schnürsenkel. Eine halbe Dose Tabak, ein Päckchen Zigarettenpapier. Alles wanderte in ihre versteckten Taschen, während sie ihr Lächeln verbarg und zusah, wie die Wärter schimpften und vergeblich danach suchten. Tage später legte sie die stibitzten Sachen woanders wieder hin und ließ die Aufseher damit genauso an ihrem Verstand zweifeln, wie diese es bei ihr versuchten.
Und sie wurde kein einziges Mal erwischt. Das sind die anderen Fähigkeiten, die ihr St. Bernadette verliehen hat. List, Stillschweigen, das Geschick, sich unbemerkt zu bewegen. Sie musste nur so tun, als würde sie ihre Medizin einnehmen. Brav sein, ruhig bleiben. Sich erinnern. Lügen. Vergessen vortäuschen.
Aber natürlich konnte sie nicht vergessen. Peter hatte sich unter ihrer Haut festgesetzt wie ein Splitter. Nicht einmal während ihrer absoluten Tiefpunkte – wenn sie versucht war, aufzugeben und loszulassen, wie John und Michael es taten – bekam sie ihn heraus. Peter war und ist ein Teil von ihr; Nimmerland ist ein Teil von ihr. Peters scharf geschnittene Gesichtszüge, sein flammendes Haar, das Strahlen seiner Augen … Sie sind ihr so vertraut wie ihr eigenes Äußeres, wie das von Ned und Jane. Auch das wird sie zu ihrem Vorteil nutzen.
Selbst jetzt kann sich Wendy die Unschuld in Peters Augen in jener Nacht ihrer ersten Begegnung perfekt ins Gedächtnis rufen. Wie sein Schatten gleich dem Fell irgendeines Tieres über seinen Armen lag, wie die Hoffnung sein Gesicht zum Leuchten brachte, wie er sie bat, ihn wieder heil zu machen. Der Schatten, den er ihr reichte, fühlte sich in ihren Händen so seidig und kühl an wie der feinste Stoff und sie nahm ihn, als wäre es die natürlichste Sache der Welt. Selbstverständlich mochte ein Junge womöglich von seinem Schatten getrennt werden und gewiss würde ein Mädchen ihn wieder annähen können.
Damals kam ihr das gar nicht seltsam vor. Nicht einmal, als er bei der ersten Berührung ihrer Nadel aufschrie, als hätte sie ihn mit einem heißen Schürhaken gestochen. Hinterher stolzierte er herum und prahlte, als wäre ihm ein genialer Streich gelungen. Als hätte Wendy überhaupt keinen Anteil daran gehabt, und sie nahm auch das hin.
Bis zu ihrer Ankunft in Nimmerland franste der angenähte Schatten aus, löste sich auf, verwelkte wie eine vom Strauch geschnittene Rose. Sie landeten in der grellen Mittagssonne am Strand und Peter stand mit den Händen in den Hüften da, der kaputte Zeiger im Zentrum einer Sonnenuhr. Seine Verlorenen Jungs versammelten sich im Kreis um ihn, um die Darling-Kinder zu begrüßen, und eindeutig folgte jedem ein Schatten auf dem weißen Sand. Einzig Peter warf keinen.
Damals hätte sie es erkennen müssen, doch sie sah nur die Verheißung eines Abenteuers, einen Jungen, der sie zu fliegen lehrte.
Wendy kniet sich hin und holt ihr Nähkörbchen unter dem Bett hervor. Nähnadeln, Stecknadeln, Garnrollen. Ihre kleine Schere, bösartig, scharf und glänzend. Nähen mag zwar keine heldenhafte Fähigkeit sein, aber es ist ihre. Allein diese Sachen dabeizuhaben wird sie in Nimmerland beruhigen und ihr inneres Gleichgewicht wahren, ein Stückchen Zuhause, das sie daran erinnert, was sie zurückgelassen hat, an den Preis, den sie für ihren ersten Besuch dort bezahlt hat.
Wendy schließt die Augen, legt die Hände auf ihre Oberschenkel und atmet aus. Die Verbindung zwischen ihr und Peter ist immer noch da, tief unter ihrer Haut begraben, ob sie ihn nun dort haben will oder nicht. Sie hat Jahre mit dem Versuch zugebracht, ihn loszuwerden, und versagt. Nun klammert sie sich an diese Verbundenheit wie an einen realen Faden, der sie beide zusammenhält. Vor ihr kann er sich nicht verstecken, sie wird jenem Faden den gesamten Weg nach Nimmerland folgen.
Einmal eingeladen, stets willkommen. Ist das nicht sein Motto?
NIE UND NIMMER
Ein Rauschen wie von fließendem Wasser oder einem aufziehenden Sturm. Sie dreht den Kopf in Richtung des Geräuschs und merkt, dass ihre Augenlider verklebt sind. Hat sie geschlafen? Geträumt? Sie hat geträumt, sie würde fallen. Nein. Fliegen.
Es riecht nach Algen. Das erinnert sie an Kensington Gardens. Dort pflegte sie mit ihren Eltern spazieren zu gehen, als sie noch ganz klein war, und jetzt, da sie älter ist, begleitet ihr Vater sie immer noch manchmal, um nach Blättern und Blumen und Insekten für ihre Sammlungen zu suchen. Ihr Lieblingsplatz ist der Teich mit den großen weiß-goldenen Fischen, die mit zuckenden Schwänzen an die Oberfläche kommen, um an den Brotkrumen zu knabbern, und ihre Mäuler zu kleinen Os formen.
Ihre Gedanken schweifen ab, schwerfällig – klebrig wie ihre Augen – und fröhlich zugleich. Sie war doch gerade im Park, nicht wahr? Oder sie ist jetzt dort und streckt die Hand aus, um mit ihren Patschefingerchen einen der weiß-goldenen Fische zu fangen? Nein, das stimmt nicht. Das liegt Jahre zurück. Da war sie vier und wollte einen Fisch fangen, um ihn ihrem Papa zu zeigen, doch ihre Mama zog mit einem scharfen »Nein!« ihre Hand weg.
»Du darfst nie so ins Wasser greifen, _______, sonst fällst du womöglich hinein. Das ist eine wichtige Regel, so wie die, dass du nie mit Fremden mitgehen darfst und immer dort bleiben musst, wo dein Papa und ich dich sehen können. Verstehst du das?«
Jetzt ist sie nicht mehr so klein oder unbedarft genug, um die Belehrungen ihrer Mutter zu brauchen. Nur ist sie irgendwohin gegangen, wo ihre Mama sie nicht sehen kann, und irgendetwas stimmt nicht. Wo ihr Name sein sollte, klafft eine gähnende Lücke in ihrem Gedächtnis. Wenn sie sich stark genug konzentriert, kann sie sehen, wie sich die Lippen ihrer Mutter bewegen, um die Laute zu formen, aber da ist nichts. Nur _______! Wie kann sie denn bloß ihren eigenen Namen vergessen haben?
Sie muss ihn doch wissen, irgendwo muss er sein, aber irgendetwas steht ihr im Weg. Sie versucht ihn im Stillen zu denken, öffnet ihren ausgetrockneten Mund, um ihn laut zu rufen, doch stattdessen kommt »Mama!« heraus.
Sie zwingt sich, die Augen weit aufzumachen, es tut weh, fühlt sich an, als würden ihr die Wimpern ausgerissen. Da war ein Junge. Er hat ihre Hand genommen und sie sind in den Himmel gestürzt. Ihr Körper zuckt panisch, als fiele sie wieder, doch auf ihrer Brust und den Beinen liegt ein Seil, das sie festhält. Es ist schwer, feucht und verströmt diesen Geruch nach Salz und Algen, den sie irrtümlich Fischteichen zugeschrieben hat.
Sie versucht sich aufzusetzen, aber als sie sich abmüht, das Seil von sich zu schieben, sind ihre Arme und Beine taub und schlenkern nutzlos herum. Ist sie krank? Liegt es daran, dass sie so schwach ist? Vielleicht war der Junge an ihrem Fenster ja nur ein Fiebertraum.
Ruhig. Sie muss ruhig bleiben und die Dinge der Reihe nach angehen. Ihre Umgebung erforschen. Das ist das, was eine gute Wissenschaftlerin täte, und sie hat die Absicht, eines Tages Wissenschaftlerin zu werden. So viel weiß sie, selbst wenn sie sich nicht einmal an ihren eigenen Namen erinnern kann. Sie atmet ein und konzentriert sich darauf, welche Informationen sie im Liegen sammeln kann.
Der Boden unter ihr ist leicht klamm und gibt seltsam nach. Sie ist mit Sicherheit nicht in ihrem Zimmer. Ihre Sachen sind nicht da – weder der Globus, den ihr Papa zum letzten Geburtstag geschenkt hat, noch die Lupe, die sie benutzt, um die filigranen Schuppen auf Schmetterlingsflügeln und die Adern in den Blättern zu studieren.
Ihre Mama hat sie davor gewarnt, mit Fremden mitzugehen, aber das ist sie ja nicht. Nicht absichtlich. Ihre Brust schnürt sich zu, erschwert ihr das Luftholen, treibt ihr die Tränen in die Augen.
Das Geräusch ihres unwillkürlich stockenden Atems macht sie wütend und sie schiebt die Angst mit aller Macht in den Hintergrund. Panik wird ihr nichts nützen. Sie muss ihren Verstand einsetzen. Ihre Lage einschätzen, Anhaltspunkte suchen.
Da sie schon auf dem Rücken liegt, ist es am einfachsten, ihre Aufmerksamkeit direkt nach oben zu richten, also tut sie das. Licht schimmert zwischen wahllos übereinandergelegten Ästen durch, die ein schützendes Dach bilden. Irgendetwas Großes dient ihnen als Stütze. Sie kann den Kopf gerade weit genug in den Nacken legen, um das gewölbte Massiv einer Holzkonstruktion zu erkennen, bloß ist sie außerstande, sie gänzlich auszumachen.
Das heisere Gelächter, mit dem sich Möwen untereinander verständigen, erklärt das Geräusch von Wasser. Es ist das stete Rauschen der Wellen. Sie muss an einem Strand sein. Aber wie ist das möglich? Ihre Eltern hätten ihr doch davon erzählt, wenn sie einen Urlaub geplant hätten, und natürlich hätten sie sie auch nicht mitten in der Nacht verschwinden lassen. Sie hätte entsprechend gepackt, ihre Netze und Sammelgläser mitgebracht. Außerdem war da immer noch dieser Junge, und ihre Mama hat nach ihr gegriffen. Sie ist gewiss nicht im Urlaub und irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht.
Unter Aufbietung all ihrer Kraft wälzt sie sich auf die Seite und die Schlingen des Seils rutschen lose herunter – es war nicht einmal um sie gewickelt, sondern nur willkürlich aufgehäuft, als habe jemand vorgehabt, sie zu fesseln, und es dann vergessen. Sie setzt sich auf, dreht sich und kann so nun sehen, dass es sich bei der hölzernen Wölbung, die die Äste oben hält, um den Rumpf eines Schiffes handelt. Der Sand unter ihr ist nass, die Feuchtigkeit dringt durch ihr Nachthemd und sie friert.
»Wendy! Du bist wach!« Die Äste rascheln und der Junge, der an ihrem Fenster war, streckt grinsend den Kopf zwischen ihnen hindurch.
Wendy. So heißt ihre Mutter. Und sie ist … Jane. Urplötzlich ist der Name da, immer noch halb verhüllt wie etwas, das aus dem Nebel auftaucht, sodass sie sich nicht sicher ist, ob er ihr wirklich so vertraut ist. Ist sie das? Ihre Gedanken bewegen sich langsam, wie die Fäden aus beinah verbranntem Zucker, aus denen die Köchin Karamellbonbons wickelt. Sie hilft ihr manchmal in der Küche. Die genauen Maßangaben gefallen ihr und dass geringste Abweichungen zu verschiedenen Ergebnissen führen können, ist ganz so wie bei einem wissenschaftlichen Experiment. Aber noch schöner ist, dass geduldiges Rühren am Ende mit einer Kostprobe belohnt wird.
Beinah kann sie die rauchige Süße auf der Zunge spüren, die Zuckermasse, die an ihren Backenzähnen klebt. Sie schüttelt heftig den Kopf, um ihre Gedanken ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Normalerweise ist sie nicht so zerstreut; ihre Eltern haben ihr oft gesagt, dass sie ein sehr vernünftiges Mädchen ist. Gerade fühlt sich ihr Kopf allerdings aufgedunsen und benebelt an und es fällt ihr schwer, sich zu konzentrieren.
»Wer bist du?« Sie presst sich mit dem Rücken an den Schiffsrumpf, zieht die Knie an und schlingt die Arme darum.
Er sieht aus wie ein Junge, nicht viel älter als sie. Wenn er sie allerdings hierhergebracht hat, wenn er sie aus ihrem Zimmer entführt hat, könnte er etwas weit Gefährlicheres sein.
»Ich bin Peter, Dummerchen.« Der Junge zwängt sich in den Unterstand.
Sie besinnt sich darauf, wie sie gelandet sind, wie Panik sie erfasste und er ihr etwas in die Hand drückte und sagte, danach würde sie sich besser fühlen. War es Medizin? Die Einzelheiten fallen ihr nicht mehr ein, ihre Erinnerung ist unvollständig, bruchstückhaft. Ein abgebrochener Splitter vom Himmel im freien Flug, der Strand unter ihren Füßen kippt, der heftige Sternenregen. Dunkelheit. Als sie landeten, war es Nacht, und jetzt ist es Morgen oder sogar Nachmittag. Wie lange ist sie schon fort? Ihre Eltern müssen krank sein vor Sorge um sie.
»Ich muss …« Sie setzt zu der Forderung an, nach Hause gebracht zu werden, wobei sie Peter wütend anfunkelt, doch ihre Zunge klebt am Gaumen fest. Ihr Hals ist wie ausgedorrt und die Worte gehen auf dem Weg zu ihren Lippen verloren. Sie wirbeln durch ihren Verstand und sie kann sie nicht mehr in die richtige Reihenfolge bringen, nicht einmal in Gedanken.
Frustriert klappt sie den Mund zu und starrt Peter an. Er hat irgendetwas mit ihr gemacht, sie verzaubert wie in einem der Märchen, die ihre Mama früher erzählt hat. Womöglich könnte er sogar ein Wesen aus einer dieser Geschichten sein. Er riecht wild und ursprünglich, wie der grüne Teich, aber auch nach Honig. Sie sind aus der Welt gefallen, so wie ein Ritter ins Feenreich fällt, und nun ist sie hier, wo auch immer »hier« sein mag. Sonnenlicht blinzelt herein und spielt in Peters Haar – ein Feuer, das alles verschlingt, was sich ihm in den Weg stellt.
Er beobachtet sie ebenfalls, mit schief gelegtem Kopf, als wäre er angesichts ihrer Reglosigkeit und ihres Schweigens verblüfft. Als wäre sie das seltsame Wesen aus einer anderen Welt, was nach allem, was sie weiß, durchaus zutreffen könnte. Seine Hände baumeln locker zwischen den Knien; durch die Art, wie er im Sand hockt, stehen sie in einem