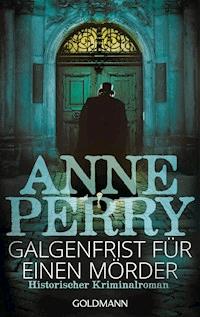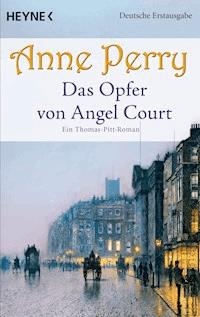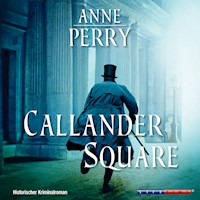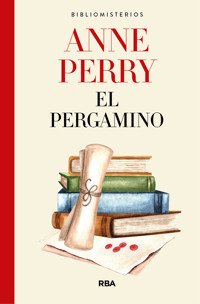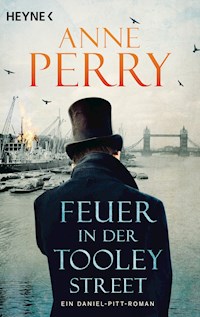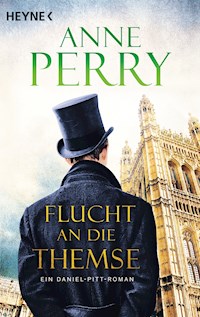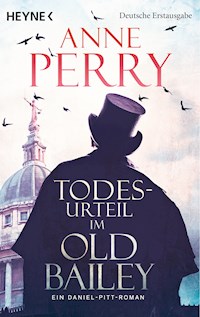8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Krimi
- Serie: William Monk
- Sprache: Deutsch
London, 1879: In der Themse treibt die Leiche eines Mannes, eine Pistolenkugel steckt in seinem Rücken. Die Identität des Toten ist rasch geklärt: Es handelt sich um einen kürzlich aus dem Gefängnis entflohenen Kriminellen. Wie Inspector William Monk jedoch bald feststellt, starb das Opfer nicht durch das Projektil, sondern muss bereits Stunden zuvor ertrunken sein. Warum also der postmortale Schuss? Fast zu spät erkennt Monk, dass der Schlüssel zu dem Fall in seiner eigenen Vergangenheit liegt – und dass ein alter Feind zurückgekehrt ist, um mörderische Rache zu üben ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
London, 1879: In der Themse treibt die Leiche eines Mannes, eine Pistolenkugel steckt in seinem Rücken. Die Identität des Toten ist rasch geklärt: Es handelt sich um einen kürzlich aus dem Gefängnis entflohenen Kriminellen. Wie Inspector William Monk, Kommandant der Londoner Wasserpolizei, jedoch bald feststellt, starb das Opfer nicht durch das Projektil, sondern muss bereits Stunden zuvor ertrunken sein. Warum also der postmortale Schuss? Monk beschleicht das Gefühl, dass ein Kollege ihn unbedingt in diesen Fall verwickeln wollte, und er befürchtet, geradewegs in eine Falle zu laufen. Er kann auf die Unterstützung seiner Frau Hester und seines Freundes Sir Oliver Rathbone zählen. Doch als sie erkennen, dass der Schlüssel zu dem Fall in Monks Vergangenheit liegt und dass ein alter Feind zurückgekehrt ist, um mörderische Rache zu üben, ist es fast zu spät …
Weitere Informationen zu Anne Perry
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
ANNE PERRY
Wer auf Rache
sinnt
Roman
Aus dem Englischen
von Peter Pfaffinger
1
Monk stieg aus dem Boot und erklomm die Steinstufen zum Kai. Das Vertäuen überließ er Hooper, der ihm gleich darauf folgte. Obwohl es ein klarer, sonniger Tag war, schlug Monk ein eisiger Novemberwind entgegen. Oder war er sich der Kälte deshalb so eindringlich bewusst, weil der Zollpolizist McNab mit einem seiner Untergebenen oben auf ihn wartete?
Wie lange kannten sie einander schon? Monk hatte nicht die leiseste Ahnung. Bei seinem Unfall vor dreizehn Jahren, als er 1856 von einer Kutsche überfahren worden war, hatte sich sein ganzes Leben bis zu jenem Zeitpunkt schlagartig in Nichts aufgelöst. Was er später darüber in Erfahrung gebracht hatte, verdankte er einzig seinen eigenen Schlussfolgerungen und den Erinnerungen anderer. Seine Gedächtnislücken hatte er immer meisterhaft überspielt, und nur eine Handvoll enger Vertrauter wusste Bescheid. Von diesen wenigen hielt also gewissermaßen jeder Einzelne sein Leben in Händen.
McNab hasste ihn. Warum, das war Monk nicht klar. Sehr wohl wusste er dagegen, weshalb er diesen Mann verabscheute. McNab steckte hinter dem Fehlschlag der Razzia gegen die Gewehrschmuggler, die zu einem Kampf an Deck des Schiffs der Bande ausgeartet war und Orme das Leben gekostet hatte. Leider wusste er nicht genug darüber, wie weit McNab sich mit den Schmugglern eingelassen hatte, um irgendetwas zu beweisen. Das Ganze lag nun schon Monate zurück, doch er trauerte immer noch um Orme, der seit dem Tag, da Monk zum Kommandanten der Thames River Police ernannt worden war, ihm als sein Mentor, seine rechte Hand und vor allem als Freund zur Seite gestanden hatte.
Und jetzt wartete McNab hier auf ihn, ein schwerer Mann, der breitbeinig dastand, während der Wind an seinem schweren Mantel zerrte. Sobald er Monk bemerkte, wandte er sich ihm zu, und sein stumpfes Gesicht nahm einen gespannten Ausdruck an.
»Morgen, Mr Monk«, sagte er laut genug, um das Rasseln von Ketten, die eingeholt wurden, das Klatschen der gegen die Stufen schwappenden Wellen sowie die Rufe der Lastkahnführer und Leichterschiffer auf dem Fluss draußen zu übertönen. »Ich hab einen für Sie!«
»Guten Morgen, Mr McNab.« Monk stellte sich neben ihn und senkte den Blick auf einen von einer Plane bedeckten Klumpen zu seinen Füßen. Das war der Grund, warum er gekommen war. Ihn hatte die Nachricht erreicht, dass die hereinströmende Flut einen Toten angespült hatte.
Monk schlug die Plane über dem Oberkörper der Leiche zurück. Es handelte sich um einen Mann mittleren Alters in abgetragener Arbeitskleidung. Er war nur wenig vom Wasser aufgebläht und hatte nach Monks Schätzung höchstens ein paar Stunden im Fluss gelegen. Sein Gesicht wirkte leer, war aber – abgesehen von ein, zwei Blutergüssen und geringfügigen Schwellungen – nicht weiter entstellt. Offenbar waren ihm diese Verletzungen vor seinem Tod zugefügt worden. Um das zu erkennen, brauchte Monk keinen Polizeiarzt. Wenn das Herz aufhörte zu schlagen, floss kein Blut mehr, auch nicht in die Prellungen.
Monk beugte sich über den Toten und befühlte das triefend nasse, dichte Haar. Langsam tasteten sich seine Finger über den Kopf, auf der Suche nach einer Wunde, die sich als Beule oder als weiche Vertiefung bemerkbar machen konnte, falls der Schädelknochen gebrochen war. Ohne Erfolg. Dann öffnete er eines der Lider. Der weiße Augapfel wies winzige rote Punkte auf, ein Hinweis auf Ersticken.
Schließlich blickte Monk zu McNab auf. Hatte dieser die Einblutungen ebenfalls bemerkt? Einen Moment lang verriet ihm McNabs Miene unverhüllte Genugtuung, bevor sie wieder glatt und ausdruckslos wurde.
Erdrosselt also? An der Kehle fehlten jegliche Würgemale. Der Kehlkopf war weder gebrochen noch gequetscht. Ertrunken? Das war in der Themse nichts Ungewöhnliches. Das Wasser war tief, schmutzig und eiskalt, die Strömung schnell und tückisch.
»Warum bin ich hergerufen worden, Mr McNab?«, fragte Monk. »Wer ist das überhaupt?«
»Weiß nicht«, erwiderte McNab mit leicht schnarrender Stimme. »Noch nicht. Hab mir bloß gedacht, dass Sie ihn sehen sollten, bevor wir tätig werden. Würde doch nicht wollen, dass Beweismittel beschädigt …« Er ließ die Bemerkung unvollendet. Schließlich bedachte er Monk mit einem kleinen, zufriedenen Lächeln. »Wollte Ihnen so etwas wie einen Blick aus der Nähe gönnen.«
Jetzt begriff Monk, dass hinter dieser Sache mehr steckte, als er geahnt hatte. McNab wartete darauf, dass er es herausfand oder – besser noch – darauf aufmerksam gemacht werden musste.
Er zog die Plane vollständig von dem Toten herunter. Seine Augen wanderten über Hände und Füße des Mannes. Die unverletzten, weichen Hände waren frei von Schwielen, die Fingernägel säuberlich geschnitten. Demnach kein Handwerker oder Lastenträger. Durch das Wollhemd hindurch befühlte er die Oberarme. Keine ausgeprägten Muskeln.
Die Stiefel des Toten waren aus gewöhnlichem braunem Leder, billig, aber durchaus zweckdienlich. Keine Risse in der Hose. Der Mantel schien zu fehlen – oder vielleicht hatte der Mann in dem Moment, da er ins Wasser gefallen war, keinen getragen.
Um McNabs Lippen spielte immer noch ein winziges, lauerndes Lächeln. Sein Anblick weckte in Monk eine lange zurückliegende Erinnerung an Bussarde, die auf hohen Zaunpfosten hockten und kleines Getier im Gras beobachteten.
Was war Monk entgangen? Ein Ertrunkener mit weichen Händen … Ohne dass McNab oder dessen Kollege ihm halfen, drehte er den Mann mühsam um, bis er mit dem Gesicht nach unten zu liegen kam. Und da endlich bemerkte er es: das Einschussloch im Rücken. Sollte es Blut oder Verbrennungen durch das Schießpulver gegeben haben, hatte der Fluss alle Spuren weggewaschen. War das die Wunde, die zu seinem Tod geführt hatte? Nein, denn die winzigen roten Einblutungen in den Augen zeugten davon, dass er um Luft gerungen hatte. Hatte man ihn schon beinahe erstickt, und war er dann doch noch entkommen und schließlich erschossen worden, als er sich am Ufer der Themse oder darin befand?
Monk blickte zu McNab auf. »Interessant«, murmelte er mit einem zustimmenden Nicken. »Dann sollten Sie am besten rasch herausfinden, wer das ist.«
»Allerdings«, bestätigte der Zollpolizist. »Nachdem das kein schlichter Unfall war, liegt hier offensichtlich Mord vor. Und für Mord sind Sie zuständig. Ich würde Ihnen natürlich helfen, wenn ich könnte. Kooperation, nicht wahr? Nur leider habe ich nicht die geringste Ahnung.« Er zuckte kaum merklich mit den Schultern. »Für Mord sind Sie zuständig. Ihr Fall, nicht meiner.« Damit wandte er sich ab und ließ Monk stehen.
Hooper hatte inzwischen das Boot, in dem er und Monk gekommen waren, gesichert und wartete am Rande des Kais. Nun beobachtete er die beiden Zollpolizisten, bis sie um die Ecke einer Lagerhalle verschwanden und er mit Monk allein war. Von den Docks in ihrer Nähe drang der Lärm der mit Be- und Entladen beschäftigten Schauermänner herüber. Sie schrien einander Anweisungen zu, Ankerketten schepperten, und über dem leisen Schmatzen des Wassers hörte man das dumpfe Knallen der Warenballen, die auf die Steinplatten aufschlugen, und das Poltern rollender Holzfässer.
»Ich traue diesem Hurensohn kein Stück weit über den Weg«, knurrte Hooper und senkte dann den Blick auf den Toten.
Nach Ormes Tod hatte Hooper dessen Funktion als Monks rechte Hand übernommen. Freilich war er in vielerlei Hinsicht das Gegenteil seines Vorgängers. Orme mit seinem weißen Haar war von gedrungener Statur gewesen und hatte außer im Hochsommer stets eine hüftlange Seemannsjacke getragen. Von Natur aus ein Mann der leisen Töne und gutmütig, hatte er den Fluss besser gekannt, als die meisten seiner Kollegen ihre Westentasche. Seine Tochter und sein neues Enkelkind liebte er hingebungsvoll und hatte kurz davorgestanden, aus dem Arbeitsleben auszuscheiden und sich in ein Haus am Flussufer zurückzuziehen, um seine letzten Jahre mit seinen Angehörigen zu verbringen, mit alten Freunden das eine oder andere Pint Ale zu genießen und wilde Vögel bei ihrem Flug in Richtung Themse-Mündung zu beobachten.
Hooper hingegen war groß und schlaksig und hatte einen Hang zur Unordnung. Dem Aussehen nach war er mindestens dreißig Jahre jünger als Orme. Auch er war ruhig, meistens jedenfalls, besaß aber einen erfrischenden Sinn für Humor. Orme hatte Monk einst unter seine Fittiche genommen, als er erkannte, dass Monk als Anfänger keinerlei Erfahrung mit dem Fluss hatte und viel lernen musste. Auch Hooper war loyal – sogar bis zum Tod, wie sich in einer gefährlichen Auseinandersetzung erwiesen hatte –, doch dass er sich keineswegs kritiklos unterordnete, hatte Monk erst vor Kurzem am eigenen Leib erfahren.
Nachdem sie den Toten gemeinsam wieder auf den Rücken gelegt hatten, betrachtete Hooper dessen Hände und untersuchte sie näher. Vor allem die Finger schienen ihn zu interessieren.
Unterdessen bemerkte Monk, der ihn bei seiner Totenschau beobachtete, einen Fleck auf der Hand des Toten, der sich so tief in die Haut gegraben hatte, dass ihn das Wasser nicht hatte wegwaschen können. »Tinte?«, fragte er neugierig.
»Nun, Schwerarbeit hat er gewiss nicht verrichtet«, brummte Hooper. »Und seinen Kleidern nach zu urteilen war er auch nicht unbedingt ein Schreiber oder Geschäftsinhaber.«
»Wie auch immer, wir sollten zusehen, dass wir denjenigen ausfindig machen, der ihn aus dem Wasser gezogen hat.« Monk wandte sich ab und spähte angestrengt stromabwärts und -aufwärts den schier endlos breiten, von vielen Booten bevölkerten Fluss entlang. In ihrer Nähe lagen Drei- und Viermaster mit eingeholten Segeln vor Anker, die darauf warteten, entladen zu werden. Weiter draußen glitt ein Verband von Frachtkähnen den Fluss hinauf. Dazwischen hindurch schlängelten sich Fähren von Ufer zu Ufer.
»Ich nehme an, dass McNab sich nicht dazu herablassen wollte, uns auf diesen Umstand hinzuweisen«, murmelte Hooper düster. Er äußerte sich nur selten darüber, aber auch er hielt McNab für denjenigen, der die Schießerei auf dem Schmuggelschiff und damit auch Ormes Tod zu verantworten hatte. Allerdings hatte er die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es ihnen eines Tages gelingen würde, das zu beweisen. Um private Rache ging es ihm ebenso wenig wie Monk, doch sehr wohl um Gerechtigkeit. Orme war mehr als nur ein guter Mann gewesen, der praktisch sein ganzes Erwachsenenleben bei der Wasserpolizei gedient hatte. So einem Mann wahrte man die Treue – auch über den Tod hinaus.
»Bestimmt nicht«, bestätigte Monk verdrießlich. »Aber immerhin hat er nach dem Polizeichirurgen geschickt. Schauen Sie, der Mann, der da über den Kai auf uns zukommt, könnte es sein.« Grüßend nickte er dem sich ihnen nähernden Mann zu. »Ich werde mit ihm sprechen. Sie kümmern sich in der Zwischenzeit um die Hafenarbeiter auf den Kaistufen dort drüben. Vielleicht können Sie ihnen etwas aus der Nase ziehen.«
»Jawohl, Sir.« Mit erstaunlicher Geschwindigkeit trabte Hooper los und erreichte die Gruppe von Schauermännern und Leichterschiffern, noch bevor der Leichenbeschauer bei Monk angekommen war.
»Was haben Sie denn diesmal?«, fragte er mit einem beiläufigen Blick auf den Toten. Der Polizeichirurg, ein gewisser Hyde, war ein Mann in den Sechzigern, von gedrungener Statur und mit blondem Haar, das sich über der Stirn allmählich lichtete. Monk, der bereits öfter mit ihm zusammengearbeitet hatte, mochte seinen schwarzen Humor.
»Ein Mann mit weichen Händen, der erstickt ist und einen Schuss in den Rücken abbekommen hat«, erwiderte Monk mit einem schiefen Grinsen.
Hyde starrte ihn, die Augenbrauen hochgezogen, an. Dann nickte er bedächtig. »Kurz und bündig. Kennen Sie schon seinen Namen?«
»Fragen Sie mich was Leichteres. Er wurde aus dem Wasser gefischt, nachdem ihn die Flut angespült hat. Falls einer der Bootsmänner etwas gesehen hat, hält er sich bedeckt. Hooper ist unterwegs und versucht, jemanden aufzutreiben, der bereit ist zu sprechen.«
Hyde kniete sich neben die Leiche und untersuchte sie behutsam. Nachdem er Kopf, Hals, Hände und Füße und die Handgelenke eingehend betrachtet hatte, drehte er den Mann um und nahm sich wie schon Monk die Schusswunde im Rücken vor.
»Es war McNab von der Zollpolizei, der nach mir geschickt hat«, erklärte Hyde und richtete sich mit einem leisen Stöhnen auf. Wieder einmal erinnerten ihn seine entzündeten Gelenke daran, dass er ihnen nicht zu viel zumuten sollte. »Darf ich annehmen, dass er Ihnen nichts Brauchbares mitgeteilt hat, Mr Monk?«
Hyde wusste also von der gegenseitigen Abneigung zwischen McNab und Monk.
»Vielleicht weiß er wirklich noch nichts«, erwiderte Monk diplomatisch.
Hyde bedachte ihn mit einem scharfen, wissenden Blick. »Vielleicht. Und vielleicht kommt die Flut heute dreimal herein, statt wie sonst immer zweimal.«
Offensichtlich konnte Hyde McNab auch nicht leiden.
»Eines steht fest«, fuhr Hyde fort. »Das Zollamt kennt den Mann nicht. Sonst hätte McNab Sie nicht geholt. Und er hat nicht am Fluss gearbeitet, denn er hat Hände wie ein Künstler. Aber ich würde eine Flasche besten Single Malt darauf wetten, dass seine Kunst, worin sie auch immer bestand, illegal war.«
Eine Frage beschäftigte Monk noch: »Wurde der Schuss auf ihn abgegeben, bevor er im Wasser landete, oder danach?«
»Keine Ahnung, aber ich werde Ihnen meine Erkenntnisse mitteilen, sobald ich welche habe«, antwortete Hyde fröhlich. Damit marschierte er zum Ende des Kais und signalisierte seinen Männern, mit einer Bahre für den Toten nach oben zu kommen. Die Leichenhalle befand sich am Ufer gegenüber und war mit dem Boot am einfachsten zu erreichen.
Monk wartete, bis sie losgerudert waren, dann lief er zu Hooper hinüber, um sich nach den Ergebnissen seiner Befragung zu erkundigen. Der Wind frischte auf, und er fröstelte.
Mehrere Stunden lang führten die beiden Männer Vernehmungen durch, doch eine in sich schlüssige Geschichte ergab das nicht. Ein Leichterschiffer hatte die Leiche früh am Morgen beim Verlassen seiner Anlegestelle entdeckt. Sie hatte sich in einem Gewirr aus verknäulten Seilen und verfaulten Holztrümmern in der Nähe einer der vielen Treppen verfangen, die vom Wasser zu den Kais führten und bisweilen zum Be- und Entladen benutzt wurden. Wesentlich öfter nahmen die vielen zwischen den Ufern hin und her pendelnden Fähren dort allerdings Passagiere auf oder setzten sie ab.
Nach dem Fund des Toten hatte der Leichterschiffer die nächste Fähre abgewartet, die binnen weniger Minuten vorbeikam. Da er selbst seinen Verband von Kähnen nicht verlassen konnte, hatte er den Kapitän gebeten, die Behörden zu benachrichtigen. Kurz darauf trafen zwei völlig unfähige Zollbeamte ein, die gerade damit beschäftigt gewesen waren, die Fracht eines in der Nähe vor Anker liegenden Schoners zu inspizieren. Um diese Jahreszeit durfte keine Minute Tageslicht vergeudet werden. Und da niemand anders von ausreichend hohem Rang erreichbar war, musste McNab sich mit der Sache befassen.
Trotz aufwendiger Befragungen fand sich kein Einziger, der den Toten kannte. Offenbar handelte es sich nicht um einen Kahnführer, Fährschiffer oder Hafenarbeiter welcher Art auch immer. Keine dieser Erkenntnisse überraschte Monk. Das alles hatte er schon aus dem Äußeren des Toten geschlossen.
Die Abenddämmerung kündigte sich an; er und Hooper saßen im hinteren Bereich ihres Hauptquartiers, der Wache der Wasserpolizei in Wapping, als die Meldung eintraf, dass ein, zwei Meilen stromabwärts am Südufer ein Boot gestohlen worden war. Laut Auskunft der örtlichen Polizei handelte es sich um ein Ruderboot, das problemlos von einer Einzelperson benutzt werden konnte. Diese Information brachten sie sofort mit einem anderen Vorfall in Zusammenhang: Während eines Verhörs durch die Zollpolizei war ein Insasse des Zuchthauses von Plaistow geflohen, ein Meisterfälscher namens Blount, dessen Beschreibung exakt mit dem Toten im Fluss übereinstimmte.
»Ach ja?«, fragte Hooper sarkastisch. »Und McNab wusste nichts davon?«
»Ich könnte mir vorstellen, dass er genau das behaupten wird«, brummte Monk. »Der Mann ist gestern getürmt, heißt es.«
Hooper fuhr zu ihm herum, doch im Schatten der Gaslampe war Monks Gesichtsausdruck kaum zu erkennen. »Ich würde McNab nicht einmal dann glauben, wenn er mir sagte, welcher Tag heute ist.«
»Ich fahre morgen früh zum Gefängnis hinaus«, erklärte Monk. »Mal sehen, was sich über diesen Blount in Erfahrung bringen lässt.«
»Soll ich mit den Männern vom Zollamt sprechen, die ihn haben entkommen lassen?«, erbot sich Hooper.
Monk dachte einen Moment nach. »Nein, das erledige ich. Es wird leichter sein, sobald ich etwas über den Mann weiß. Ich frage mich, wer wohl den Schuss auf ihn abgegeben hat …«
Hooper grunzte, erwiderte aber nichts.
Bei einer Tasse heißem Tee mit einem Schuss Whiskey fertigte Monk einen Bericht über seine Arbeit am heutigen Tag an. Darin ging es nicht nur um die Leiche, sondern auch um mehrere Diebstähle und einen Fall von Schmuggel. Schreibarbeiten waren der Teil seiner Aufgaben, den er am wenigsten mochte, aber er hatte gelernt, dass es ihm umso schwerer fiel, sich an möglicherweise wichtige Details zu erinnern, je länger er das Schreiben der Protokolle hinausschob. Schlampige Notizen und unleserliches Geschmier hatten mehr als einmal Ermittlungen zunichtegemacht.
Zwei Stunden später wünschte er dem diensthabenden Beamten eine gute Nacht und stapfte über den dunklen, vom Wind umtosten Kai, um die Fähre nach Hause zu erreichen, wo Hester ihm erzählen würde, was sie heute alles erlebt hatte. Das war immer die schönste Zeit des Tages: wenn er heimkam.
Das Zuchthaus von Plaistow am Rande der Stadt lag fast genau nördlich gegenüber dem Albert Dock. Da es von dort nur ein Katzensprung zur Eisenbahnlinie war, benötigte Monk weniger als eine Stunde für den Weg. Dem Direktor, Elias Stockwell, hatte der Ausbruch von Blount die Laune gründlich verhagelt. Da konnte sogar die Meldung, dass Blounts Leiche entdeckt und identifiziert worden war, seine Stimmung nur geringfügig aufhellen.
»Schön, dass dieser Nichtsnutz tot ist«, erklärte Stockwell freimütig, als Monk sich in seinem kleinen, sehr ordentlichen Büro einfand. »War erst seit ein paar Wochen bei uns. Verdammt guter Fälscher, aber ein Kerl von der übelsten Sorte. Und gerissen obendrein.«
Monk machte es sich auf dem Stuhl, der ihm angeboten worden war, so bequem wie möglich. Damit gab er zu verstehen, dass er so lange zu bleiben beabsichtigte, wie es eben erforderlich war, bis er die benötigten Antworten erhalten hatte.
»Beim Fälschen oder ganz allgemein?«, hakte Monk nach. Hinsichtlich der Frage, wer auf Blount geschossen hatte, bot sich eine Vielzahl an Möglichkeiten. Es konnte sich um eine persönliche Angelegenheit handeln – in den meisten Fällen Rache – oder um ein Zerwürfnis bei einem geplanten Verbrechen oder bei der Verteilung der Beute nach einem bereits erfolgreich durchgeführten Coup. Vielleicht hatte die Sache auch mit dem Zollamt zu tun, mit dem Verrat von Informationen oder mit einem früheren oder neuen Streit.
Stockwell seufzte. »Beides. Er war einer der besten Fälscher, denen ich je begegnet bin, und das nicht nur bei Dokumenten. Er konnte einen Fünf-Pfund-Schein fabrizieren, der den meisten nicht einmal bei näherem Hinschauen aufgefallen wäre.«
»Na ja, wer weiß denn schon, wie ein Fünf-Pfund-Schein aussieht?«, wandte Monk ein. Das war mehr, als ein Arbeiter durchschnittlich im Monat verdiente!
»Gutes Argument«, räumte Stockwell ein. »Aber er verstand sich auch auf Lieferscheine, Zollbescheinigungen und Ladungsverzeichnisse. Das ist auch der Grund, warum das Zollamt so erpicht darauf war, ihn dingfest zu machen.«
»Komplizen?« Monk hoffte, diese Frage würde zu jemandem führen, der ein Interesse daran hatte, Blount zum Schweigen zu bringen.
»Gewiss«, bestätigte Stockwell. »Aber es ist nie einer verhaftet worden. Er verstand es, den Mund zu halten.« Er zog leicht die Augenbrauen hoch. »Glauben Sie, dass einer von denen ihn ermordet hat, um dafür zu sorgen, dass er sich nicht verplappert? Das wäre zumindest vorstellbar.«
»Wofür wurde er verurteilt?«, fragte Monk.
Stockwell schilderte ihm Blounts Betrug mit gefälschten Frachtbriefen und entsprechend geringeren Zollgebühren.
Monk hörte gespannt zu.
»Demnach war der Kapitän des Schiffs fast mit Sicherheit daran beteiligt«, schlussfolgerte er.
Stockwell nickte. »Zweifellos. Aber als sie Blount schnappten, war der Kapitän längst über alle Berge. Außerdem war er Ausländer. Spanier, Korse oder etwas in dieser Art.«
»Und der Importeur?«
»Bestritt, irgendetwas von Änderungen an den Papieren gewusst zu haben. Stellte es so dar, als hätte Blount selbst den Gewinn eingesteckt. Elender Lügner. Doch sie konnten ihm nichts nachweisen. Hatte sich gründlich abgesichert.«
»Aber Blount wusste, dass er am Betrug beteiligt war, und hätte ihn jederzeit verraten können?«
»Er muss es gewusst haben, hielt allerdings den Mund. Ich wage zu behaupten, dass später eine hübsche Belohnung auf ihn gewartet hätte. Er musste ja nur für fünf Jahre hinter Gitter.«
»Wann wurde er verurteilt?«
»September.«
»Name des Importeurs?«
»Haskell & Sons. Haskell war derjenige, über den sie Blount ausquetschen wollten. Sie sind schon seit Jahren hinter ihm her.«
»Sie? Das Zollamt?«
»Ja.« Stockwells Miene verriet Interesse. »Sie sagen, sie konnten nichts aus Blount herauskriegen.«
»Da ich schon mal hier bin, verraten Sie mir doch bitte, was Sie über Blount wissen. Kennen Sie seine Freunde, Feinde, irgendwen, der ihn lieber tot gesehen hätte? Oder der ihn gefürchtet hat, als er noch lebte?«
»Er war gerissen«, wiederholte Stockwell nach reiflichem Überlegen. »Im Gefängnis war die Rede davon, dass er einer ganzen Reihe von Insassen einen Gefallen erwiesen hat. Nicht dass er das kostenlos machte, wohlgemerkt. Aber wenn jemand darauf angewiesen war, dass für ihn ein Brief geschrieben, eine Erlaubnis gefälscht oder ein Dokument erstellt und von einem Anwalt oder Aufseher nach draußen geschmuggelt wurde – gegen eine kleine Aufmerksamkeit natürlich …« Er verzog das Gesicht. »Blount brauchte nichts außer Papier, und damit fabrizierte er Dokumente, die die meisten für echt hielten. Auf diese Weise schuf er sich ein ganz hübsches Netz aus Personen, die ihm Gefälligkeiten schuldeten oder ihn eines Tages vielleicht wieder brauchen würden. Ja, gerissen, das war er unbedingt. Tat nie etwas, ohne abzuwägen, was es ihm einbringen würde.«
Monk musste an die glatten Hände des Toten denken; es fiel ihm leicht, Stockwell zu glauben. »Ging es dabei vor allem um Schmuggel?«, fragte er.
»Bei dem, wovon ich gehört habe, ja. Aber es könnte auch haufenweise andere Sachen gegeben haben – Verkaufsurkunden, eidesstattliche Erklärungen, was weiß ich.«
»Wer hat ihn zu der Stelle gebracht, wo ihn die Leute befragten und von wo er dann entkam? Warum wurde das Verhör nicht hier durchgeführt? Weniger Fluchtgefahr.«
»Wir glaubten doch nicht, dass die Möglichkeit dazu bestand!«, blaffte Stockwell. »Er trug die ganze Zeit Handfesseln und wurde von zwei Aufsehern bewacht.«
»Aber wieso diese Fahrt an einen anderen Ort? Wozu auch nur den Hauch eines Risikos eingehen?«
»Weil es dort Dokumente und bestimmte Gegenstände in einer großen Kiste gab, die man nicht hierherbringen konnte. Geräte, die er hätte identifizieren können.«
Monk nickte. »Ich verstehe. Wie hießen die Aufseher, die ihn begleiteten?«
»Clerk und Chapman. Beide wurden während der Flucht verletzt. Clerk kam glimpflich davon. Nur ein paar Prellungen. Chapman dagegen wird eine Weile außer Gefecht sein. Ein Mann mit gebrochenem Arm ist hier nicht von großem Nutzen.«
»Na, Blount wird sich nicht mehr bei ihnen bedanken können«, bemerkte Monk trocken. »Erschossen und ertrunken. Fällt Ihnen dazu etwas ein?«
Blount schnitt eine Grimasse, die Resignation und Abscheu verriet. »Da wollte jemand ganz sichergehen.«
»Wie lange war das Verhör außerhalb Ihrer Anstalt vorbereitet worden?«, wollte Monk wissen.
»Nur einen Tag.« Stockwell richtete sich auf. »Interessant. Sie glauben, jemand witterte eine Gelegenheit und ergriff sie beim Schopf?«
»Das, oder jemand wusste von dem geplanten Verhör und hat die Sache in die Wege geleitet.«
Stockwell blickte Monk nachdenklich an. »Denken Sie an das Zollamt? Oder an Haskell selbst? Wollen Sie am Ende überprüfen, ob es eine Verbindung zu jemandem bei uns gab?«
»Allerdings«, knurrte Monk. »Und ich werde ganz gewiss die betroffenen Zollpolizisten aufsuchen und ermitteln, was genau geschehen ist, wer Blounts Überstellung beantragt hat und wer darüber informiert war.«
»Gut. Ich werde unser gesamtes Wissen mit Ihnen teilen.« Stockwell erhob sich. »Ein übler Patron, dieser Blount, aber wir können nicht dulden, dass Häftlinge umgebracht werden – genauso wenig wie wir es dulden, wenn sie ausbrechen.«
»Das ist ja nicht hier passiert.«
Stockwell starrte Monk aufgebracht an. »Er ist meinen verdammten Männern entkommen, Sir!«
Darin stimmte Monk ihm so taktvoll zu, wie er konnte.
Es war vier Uhr, und die bereits tief am Horizont stehende Sonne sandte lange Schatten auf das Wasser hinaus, als Monk Wapping erneut verließ und beschloss, die verhältnismäßig kurze Strecke zum Zollamt in der Thames Street zu Fuß zurückzulegen. Es war nur knapp über eine Meile, und er brauchte trotz der Kälte frische Luft und auch etwas Zeit, um sich genau zurechtzulegen, was er sagen wollte. Von der Art und Weise, wie er die Zollpolizisten, denen Blount entkommen war, behandelte, würde abhängen, was er von ihnen erfuhr.
Monk benötigte Informationen von ihnen. Es stand ihm nicht zu, sie zur Rechenschaft zu ziehen, nicht einmal dann, wenn sie einen Fehler begangen hatten, was aber noch gar nicht sicher war.
Weil dichter Verkehr herrschte und auch der Bürgersteig von Menschen wimmelte, dauerte der Marsch etwas länger, als er erwartet hatte. Doch als er das nach dem Brand von 1825 in seiner alten Pracht wiederhergestellte Gebäude erreichte, war er bereit, den Männern gegenüber einen geduldigen Ton anzuschlagen, in der Hoffnung, er würde so auf freiwilliger Basis erhalten, was er nicht erzwingen konnte.
Nach einer zurückhaltenden Begrüßung wurde Monk in einen kleinen Privatraum – leider ohne Blick auf die Themse – geführt, den man ihm freundlicherweise zur Verfügung stellte. Es dauerte nur wenige Augenblicke, bis ein junger Mann zu ihm gebracht und ihm als Edward Worth vorgestellt wurde. Dies war einer der zwei Zollpolizisten, die Blount vernommen hatten. Der andere namens Logan, der bei Blounts Flucht schwer verletzt worden war, lag noch im Krankenhaus.
»Setzen Sie sich, Worth.« Monk deutete auf den Stuhl an der anderen Seite des Schreibtischs. »Blount ist tot. Das bedeutet keinen großen Verlust – außer wenn er tatsächlich gegen Haskell aussagen wollte. Das trifft doch zu, nicht wahr?«
Worth ließ sich auf der Stuhlkante nieder. Er sah aus wie höchstens fünfundzwanzig und wirkte äußerst verlegen, weil er und sein Kollege es irgendwie zugelassen hatten, dass ein Gefangener entkam und – schlimmer noch – getötet wurde. Er schien immer noch unter Schock zu stehen.
Monk konnte sich nicht mehr an die Zeit erinnern, als er so jung gewesen war. Sie gehörte zu seinen verlorenen Jahren. Hatte er sich seinen Vorgesetzten gegenüber jemals so verletzlich gezeigt? Nach allem, was er sich aus einigen Hinweisen zusammengereimt hatte, musste er ziemlich arrogant und in jedem Fall selbstbewusster gewirkt haben, als er tatsächlich gewesen war.
»Eigentlich nicht, Sir, nicht nach dem, was ich mitbekommen habe«, murmelte Worth. »Die ganze Angelegenheit war im Grunde Zeitverschwendung.« Er errötete und sah zu Boden. »Verzeihung, Sir.«
»Wer hat Sie beauftragt, ihn zu verhören?«, wollte Monk wissen.
»Befehle, Sir.«
»Das bezweifle ich nicht, Worth. Von wem?«
»Mr Gilles, Sir. Er ist mein Vorgesetzter, muss aber seine Anweisungen ebenfalls von höherer Stelle erhalten haben.« Worth blickte bekümmert drein – wie ein Schuljunge, den man zwang, einen Kameraden zu verpetzen.
»Ich verstehe. Hatten Sie den ausdrücklichen Befehl, Blount dazu zu bringen, Ihnen von Haskell zu erzählen, oder sollten Sie aufs Geratewohl herumstochern und sehen, was dabei herauskommt?«
»Wir sollten rausfinden, wer ihn bezahlte, Sir. Und dann gab es eine ganze Kiste voll mit Fälscherwerkzeug und bestimmten Dokumenten, die er identifizieren sollte … wenn er dazu bereit war.«
»Und tat er das? Ich meine, identifizierte er sie?«
»Nein, Sir, nicht wirklich. Er sagte bloß, das sei die richtige Sorte für Frachtbriefe … solche aus dem Ausland.«
Monk war klar, dass er Worth weder zu sehr in Verlegenheit bringen noch sich seine Vorbehalte gegen die Zollpolizei anmerken lassen durfte, sonst bekam er gar nichts aus dem jungen Mann heraus. Ein solches Verhalten wäre nicht nur hart, sondern vor allem zwecklos. Wenn Worth Fehler begangen oder weniger als sein Bestes gegeben hatte, würde er darauf brennen, den Schaden wiedergutzumachen. Und ein guter Vorgesetzter würde ihm das auch ermöglichen. Monk selbst lernte diese Lektion gerade, wenn auch langsam. In dem Maße, in dem er Fortschritte machte, taten ihm die Officer leid, die es mit ihm zu tun bekommen hatten, als er jung, neunmalklug und von rascher Auffassungsgabe gewesen war. Solche Jungspunde waren der Prüfstein eines jeden Kommandanten. Teilweise waren gerade sie diejenigen, deren Entwicklung den größten Erfolg versprach, wenn man ihnen ein guter Lehrer war und sich ihren Respekt verdiente. Ihre guten Eigenschaften konnten sich jedoch auch ins Gegenteil verkehren, wenn sie Opfer der persönlichen Schwäche ihres Kommandanten wurden.
»Beschreiben Sie mir genau, was geschehen ist, so weit Sie es in Erinnerung haben«, wies Monk den Zollpolizisten an.
Gehorsam schilderte Worth Blounts Ankunft und die zwei Gefängniswärter, die ihn eskortiert hatten.
»Sind die beiden mit Blount bis in den Verhörraum gekommen?«, hakte Monk nach.
»Nein, Sir. Sie blieben draußen. Es gab ja nur eine einzige Tür, und mein Kollege und ich waren mit ihm in dem Zimmer. Die anderen haben nebenan gewartet.«
»Klingt eigentlich sicher genug«, sagte Monk. »War Blount während des Verhörs gefesselt?«
»Mit dem linken Handgelenk an den Stuhl, Sir. War ein ziemlich kalter Tag. Hab ihm eine Tasse Tee besorgt.« Blount senkte verlegen den Blick, als hätte er mit seiner kleinen freundlichen Geste einen entscheidenden Fehler begangen.
»Und dann haben Sie ihn vernommen?«
»Ja, Sir.«
»Sagen Sie mir …« Monk wählte seine Worte vorsichtig. »Haben Sie den Eindruck gewonnen, dass Blount auf diese Fragen gefasst oder in irgendeiner Form darauf vorbereitet war?«
Worth überlegte einen Moment lang. »Nein, Sir.« Nun sah er Monk direkt an. »Ich glaube nicht, dass er wusste, warum er vor Ort war. Zumindest wirkte er völlig überrascht. Damals nahm ich an, dass er mir was vormacht, aber im Nachhinein glaube ich eher, dass er wirklich völlig ahnungslos war.«
»Interessant. Fahren Sie fort.«
»Wir redeten ungefähr eine halbe Stunde miteinander, ohne dass dabei irgendetwas herausgekommen wäre, was wir vom Zoll nicht schon vorher in Erfahrung gebracht hatten. Dann wurden wir auf einmal unterbrochen. Ein Mann platzte herein und erklärte, er sei Mr Blounts Anwalt. Wir hätten kein Recht, ohne sein Beisein weiterzumachen. Daran ließ sich nichts ändern, und wir mussten den Anwalt hereinlassen … sofern er das wirklich war …«
»Warum zweifeln Sie daran?«
Worth war die Sache sichtlich peinlich. Er lief feuerrot an. »Weil in dem Moment die Probleme anfingen. Draußen war auf einmal die Hölle los. Zwei weitere Männer drangen ein und griffen den Gefängniswärter an, der vor der Tür stand …«
»Nur einer?« Monk beugte sich weit vor. »Sie haben gesagt, es wären zwei gewesen.«
»Einer war rausgegangen, weil er ein menschliches Bedürfnis verspürt hatte, Sir.« Worth’ Miene wurde immer trübseliger.
»Und die zwei Eindringlinge nutzten das aus?« Monk konnte sich das gut vorstellen. Eine interessante Entwicklung. Das klang nach einer Mischung aus Planung und günstigen Umständen.
Worth nickte. »Ja, Sir. Das haben sie allerdings.«
»Waren sie bewaffnet?«
»O ja, Sir, mit dicken, schweren Knüppeln. Damit haben sie dem Wärter den Arm gebrochen.«
»Beide Männer haben angegriffen?«
»Ja, Sir, und mich haben sie am Kopf getroffen. Was sie mit Logan angestellt haben, weiß ich nicht, aber als ich wieder zu mir kam, lag er auf dem Boden. Und der Stuhl, an den wir Blount gefesselt hatten, war zertrümmert, als hätte einer mit der Axt darauf eingeschlagen.«
»Und Blount war verschwunden?«
»Ja, Sir.«
»Hat noch jemand diese Vorgänge beobachtet, oder wenigstens einen Teil davon? Entweder die zwei Männer beim Hereinstürmen oder bei ihrer Flucht mit Blount?«
»Ja, Sir. Blount wurde gesehen, als er mit einem von ihnen davonlief. Leider hatten sie aber die gleiche Größe und Statur wie die Gefängnisaufseher, und weil sie sich wegen dem Regen in ihre Mäntel gehüllt hatten, dachten alle, das wäre bloß wieder die Eskorte. Der zweite Mann hatte sich offenbar aus dem Staub gemacht.« Worth rutschte unbehaglich auf dem Stuhl hin und her.
»Und der Mann, der sich als Anwalt ausgegeben hatte?«, fragte Monk ruhig.
»Behauptete, er sei auch niedergeschlagen worden, Sir.«
»Behauptete? Hatten Sie Zweifel daran?«
»Wenn ich es recht bedenke, ja, Sir. Ich weiß genau, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe. Und er sah ganz und gar nicht nach einem Advokaten aus.«
Monk nickte. »Sehr gut. Jetzt denken Sie bitte noch einmal scharf nach. Ich bitte Sie nur um Ihre Eindrücke. Glauben Sie, dass Blount damit gerechnet hatte, gerettet zu werden? Versuchte er während der Vernehmung, Zeit zu schinden? Wirkte er nervös, als würde er etwas erwarten? Hatte er Angst?«
Worth blinzelte, sichtlich darum bemüht, Monk eine hilfreiche Antwort zu geben.
»Er saß bereits im Gefängnis«, half Monk nach. »Haben Sie ihm mit irgendetwas gedroht? Bitte seien Sie ganz aufrichtig, Mr Worth. War er in irgendeiner Weise erregt?«
»Nein. Er war sogar ziemlich frech«, antwortete Worth vorsichtig. »Als wüsste er, dass wir ihm nichts anhaben konnten. Um ehrlich zu sein, ich hielt das Ganze ja selber für Zeitverschwendung. Dieser Blount war gerissen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass wir was aus ihm rauskriegen würden.«
»Aber er war nicht gerissen genug, um sich nicht erschießen und ertränken zu lassen!«, erwiderte Monk düster. »Danke, Mr Worth. Sie haben mir sehr geholfen. Ich nehme an, dass Sie keine Vorstellung davon haben, welcher Ihrer Vorgesetzten glaubte, Blount würde Mr Haskell verraten? Oder wer es gewesen sein könnte, der ihn bezahlte?«
»Nein, Sir. Es tut mir leid, Sir.«
»Das hatte ich auch nicht angenommen.« Monk erhob sich. »Das ist alles. Vielen Dank.«
»Jawohl, Sir.« Worth sprang auf und salutierte. »Danke, Sir.«
Ein guter Mann, dachte Monk. Vielleicht würde er ihn eines Tages von McNab abziehen. Er würde eine fähige Verstärkung der Wasserpolizei abgeben. Und sie brauchten neue Rekruten.
Auf dem Heimweg durch die dunkler werdenden Straßen ließ sich Monk noch einmal alles durch den Kopf gehen, was Worth ihm erzählt hatte. Als er den Anlegesteg von Greenwich erreichte und den von Lampen beleuchteten Hügel erklomm, hinter dem sein Haus in der Paradise Place lag, hatte er bereits mehrere Schlussfolgerungen gezogen. Für eine ganz bestimmte Person stellte Blount eine Gefahr dar. Und die musste derjenige sein, der ihn für sich hatte arbeiten lassen. Vermutlich Haskell. Blount war ein Mann, bei dem das eigene Wohlergehen immer an erster Stelle stand, aber er hatte einfach zu viel gewusst.
Seine Ermordung war mit einiger Raffinesse betrieben worden. Dabei hatte man sich geschickt der Zollbeamten und des Anwalts bedient. Es musste allerdings noch einen anderen Helfer geben, einen, der möglicherweise von Haskell als Gegenleistung für die eine oder andere Gefälligkeit schon seit einiger Zeit – wenn nicht sogar seit Jahren – Geld erhielt.
Es war McNab, der Monk in den Fall hineingezogen hatte. War er schuld an Blounts Ausbruch und möglicherweise auch an seinem Tod und verwischte nun seine Spuren? Das war ein Umstand, den Monk unbedingt klären wollte. McNab war gefährlich. In jenem kurzen Moment, als McNab sich nicht unter Kontrolle gehabt hatte, hatte Monk diesen gewissen Ausdruck in seinen Augen bemerkt. Was zwischen ihnen herrschte, war mehr als berufliche Rivalität, mehr als gegenseitige Abneigung. Es war Hass, ein tiefer, giftiger Hass.
Er hatte nur eine Möglichkeit, und zwar, McNab zur Rede zu stellen, was er gleich am nächsten Tag tun wollte. Monk widerstrebte diese Befragung zutiefst, denn er wusste schon jetzt, dass McNab aggressiv reagieren würde. Vor allem widerstrebte dieser Schritt Monk aber deshalb, weil er ahnte, dass er von vornherein im Nachteil sein würde: Er wusste einfach nicht, was die Ursache der Feindseligkeit zwischen ihnen war. McNab hingegen schien den Grund sehr wohl zu kennen, und das versetzte ihn in die Lage, immer einen Schritt voraus zu sein. McNab agierte, und Monk reagierte. Das war ihm zuwider.
Doch wenn er mit dem, was er von Worth erfahren hatte, nicht zu McNab ginge, würde er durch sein Schweigen nur dessen Vorteil untermauern und allen vor Augen führen, dass er es nicht wagte, sich mit ihm anzulegen. Das wäre erst recht unerträglich!
Untragbar wurde die Situation allerdings ohnehin, als er am nächsten Tag ins Zollamt zurückkehrte und man ihn warten ließ, bis McNab an einem der Docks eine geschäftliche Angelegenheit erledigt hatte. Immerhin dauerte das eine halbe Stunde, die Monk für sich zu nutzen wusste. Er las mehrere Mitteilungen über Haskell & Sons und konnte sein Wissen über die Größe und Geschichte dieses Unternehmens erweitern.
Er saß noch in dem engen, kahlen Wartezimmer, als McNab hereinstolziert kam. Als er Monk erkannte, verdüsterte sich seine Miene sofort. Einen Moment lang baute er sich vor Monk auf, kaum in der Lage, seine Gefühle zu beherrschen, ehe es ihm schließlich gelang, einen einigermaßen gleichgültigen Ton anzuschlagen.
»Was ist es denn, Monk?«, fragte er, die Augenbrauen hochgezogen. »Sie können uns den Fall nicht zurückgeben, bloß weil er ein einziges Durcheinander ist! Oder ist es ein Freundschaftsbesuch, und Sie wollen uns nur mitteilen, was geschehen ist? Nun denn: Wer hat Blount umgebracht?«
Geschickt verbarg Monk seine Überraschung über McNabs Offenheit, sofern es das denn war. Er stand nicht auf, sondern sah stattdessen zu, wie McNab ihm gegenüber Platz nahm, ohne ihn auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen.
Blitzartig beschloss Monk, seine Strategie zu wechseln, und begann ganz anders, als er es sich vorgenommen hatte.
»Wahrscheinlich nicht Haskell selbst«, antwortete er. »Aber mit einiger Sicherheit jemand, der für ihn gearbeitet hat.« Zu seiner Genugtuung huschte ein Ausdruck der Verblüffung über McNabs Gesicht, bevor der Mann im nächsten Augenblick wieder seine Maske aufsetzte.
»Da könnten Sie recht haben«, gestand McNab ihm zu. »Wir haben ihn nie auf frischer Tat ertappt, und er hat Freunde …« Bedeutungsvoll verstummte er.
»Kunden vielleicht«, korrigierte Monk ihn. »Mit Sicherheit Verbündete oder Angestellte. Nicht das Gleiche wie Freunde.«
»Ach, Loyalität, die gekauft und bezahlt wird, ist das Zuverlässigste überhaupt.« McNab lockerte die zur Faust geballte Hand. »Sie wissen, wer die Zügel in Händen hält?«
»Haskell?«, fragte Monk.
McNab verzog spöttisch den Mund. »Ihr Fall, Monk. Blount wurde erschossen, ermordet. Selbstmord ist ausgeschlossen. Einen Unfall müssten Sie nachweisen. Wer schießt schon jemandem versehentlich eine Kugel in den Rücken, hm?« Er wahrte eine ernste Miene.
»Jemand, der will, dass er zum Schweigen gebracht wird«, erwiderte Monk. »Möglicherweise ist er um seiner Sicherheit willen darauf angewiesen.«
McNab nickte zufrieden. »Möglicherweise.«
Monk beugte sich etwas weiter vor. »Wie nahe waren Sie dran, Haskell zu schnappen?«
»Für den Mord an Blount?«, fragte McNab in verwundertem Ton. »Gar nicht. Wie gesagt, das ist Ihr Fall, Commander Monk.«
»Natürlich würden Sie nie in meinem Fall herumpfuschen, McNab«, entgegnete Monk sarkastisch. »Nein, ich meinte: wegen Schmuggels oder wegen gefälschter Dokumente. Das sind doch die Gründe, warum Sie hinter ihm her sind, nicht wahr?«
Schweigend überlegte sich McNab seine Antwort.
Plötzlich wurde Monk klar, dass der andere Mann nicht wusste, was Worth ihm gestern Abend berichtet hatte. Und so sollte es auch bleiben. Monk wollte Worth nicht in Schwierigkeiten bringen, indem er McNab aufklärte. Er blickte den Zollbeamten an und wartete geduldig.
»Nun, da Blount tot ist, bin ich etwas von der Spur abgekommen«, ließ McNab ihn schließlich wissen. »Es sei denn natürlich, Sie können diese Geschichte einem von Haskells Männern anhängen, und der fängt dann an zu reden … was nicht sehr wahrscheinlich ist.« Um seine Lippen spielte ein dünnes Lächeln, das offen ließ, ob er Monks Erfolg auf der Jagd nach Blounts Mörder meinte oder den Mann, der bereit war auszusagen. Er atmete tief ein und hob den Blick zu Monks Augen. »Ich denke, ein solcher Mann würde Ihnen eine gute Jagd liefern, Monk. Am Ende hätte der arme Teufel nur noch die Wahl, entweder auf der Stelle von Haskell umgebracht oder langsam von Ihnen gefoltert zu werden.«
Monk stand auf und streckte den Rücken durch. »Dann ist es ja ein Jammer, dass Sie Blount haben entwischen lassen. Es wäre so viel leichter gewesen, wenn Ihr Mann die Wahrheit aus ihm herausgeholt hätte. Aber dafür ist es jetzt zu spät.« Er erwiderte McNabs Lächeln nicht minder schmallippig. Dann, sobald er den Zorn im Gesicht des anderen Mannes registriert hatte, marschierte er zur Tür hinaus und schloss sie wortlos.
2
Beata York dankte ihrer Zofe freundlich. Sobald sie allein war, stellte sie sich vor den Spiegel und musterte nachdenklich ihr Gesicht. Was sie sah, war eine Frau in den Fünfzigern, die in ihrer Jugend wunderschön gewesen war und jetzt, da die Zeit nicht sehr freundlich mit ihr umgesprungen war, einen komplexeren charaktervollen Ausdruck angenommen hatte. Um die Schlacht gegen die von außen in ihr Leben brechenden Turbulenzen überstehen zu können, hatte sie sich bewusst um inneren Frieden bemühen müssen.
Natürlich hatte sie all die wirklich schrecklichen Ereignisse in ihrem Leben für sich behalten, und so musste es auch bleiben. Alle kannten sie als heitere Frau, die sich und ihre Emotionen unter Kontrolle hatte. Ihre Haut glich makellosem Porzellan. Die vereinzelten silbernen Fäden, von denen sie wusste, dass sie existierten, waren in den blassgolden schimmernden Wellen ihres Haars nicht auszumachen.
Das Kleid, das sie trug, wies eine dunkle Grünschattierung auf und war ganz schlicht, weder mit Pelz verbrämt noch mit Schmuck geziert. Sie war im Begriff, zu einem Besuch aufzubrechen, zu dem die Pflicht sie zwang und vor dem ihr graute. Ihn zu vermeiden war jedoch nicht möglich, und ihn ständig aufzuschieben hätte die Sache nur noch schlimmer gemacht. Außerdem war diesmal nach ihr geschickt worden.
Sie wandte sich vom Spiegel ab, dankte noch einmal dem Dienstmädchen, verließ dann das Zimmer, überquerte den Treppenabsatz und stieg die eleganten Mahagonistufen hinunter. Der Diener wartete im Foyer auf sie, den Rücken durchgestreckt, die Haltung respektvoll. Seine Schuhe waren blitzblank poliert. Bestimmt stand die Kutsche längst abfahrbereit vor der Tür. Sie würde niemandem Anweisungen erteilen müssen.
Den Butler hatte sie schon wissen lassen, dass sie ihren Mann besuchen wollte. Ingram York lebte jetzt in einer Nervenheilanstalt. Vielleicht würde er sie erkennen, wenn sie sein Zimmer betrat, aber sicher war das nicht. Offenbar hatten seine Ärzte den Eindruck, dass sein Befinden sich verschlechterte; sie sollte ihn noch einmal besuchen, bevor er in einen komatösen Zustand verfiel, in dem er sie überhaupt nicht mehr wahrnahm.
Beim letzten Mal, vor zwei Wochen, hatte er sie zunächst nicht erkannt, nur um sich plötzlich doch noch zu erinnern. Die Situation war schrecklich gewesen. Und welche Worte er benutzt hatte! Allein schon beim Gedanken daran errötete sie beschämt.
Ingram hatte auf Kissen gestützt halb aufrecht im Bett gelegen, als der leere Ausdruck in seinem fleischigen Gesicht jäh blankem Hass gewichen war.
»Hure!«, hatte er gezischt. »Du bist gekommen, um dich an meinem Zustand zu weiden, gib’s zu! Nun, sosehr du dich auch bemüht hast, noch bin ich nicht tot!« Er war aschfahl, die Wangen hingen schlaff herunter, und die Augen waren tief in die Höhlen eingesunken, während groteskerweise das weiße Haar immer noch üppig um das gespenstische Gesicht wucherte.
Dann war der Moment ebenso plötzlich, wie er entstanden war, vorüber. Dem Arzt, der Beata hereingeführt hatte und im Zimmer geblieben war, um sie nach bestem Wissen aufzuklären, war das alles fürchterlich peinlich gewesen.
»Er meint es nicht so«, murmelte er hastig. »Er … deliriert. Ich versichere Ihnen …«
Aber sie hörte nicht hin. Ingram hatte jedes Wort so gemeint. Sie wusste es, denn sie war seit über zwanzig Jahre mit ihm verheiratet. Dieser Angriff war kein zusammenhangloses Gerede eines Unzurechnungsfähigen gewesen, wie der Arzt sich das vorgestellt hatte.
Bei der Erinnerung an diese Szene überlief sie ein Schauder. Dann hielt ihr der Diener die Tür auf, und sie trat ins Freie. Draußen herrschte bittere Kälte. Noch vor Anbruch der Nacht würden alle Straßen vereisen. Aber sie hätte ebenso gezittert, wenn es warm gewesen wäre – es war einfach der Gedanke an das, was ihr bevorstand, der sie regelrecht in Panik versetzte.
Immer noch überlegte sie, ob es nicht eine Möglichkeit gab, sich der Verantwortung zu entziehen. Ein Spaziergang im Park? Ein Besuch bei einer Freundin, ein Gespräch am Kamin bei Tee und Gebäck und Lachen statt trüber Gedanken? Aber natürlich würde sie das nicht tun! Nachdem sie all die Jahre bei Ingram geblieben war, würde sie auch nicht in diesen letzten Tagen weglaufen. Sie hatte eine Pflicht, und die würde sie bis zum Schluss erfüllen.
Der Diener hielt ihr die Kutschentür auf. Sie ergriff die ihr dargebotene Hand und ließ sich hinaufhelfen.
Insgeheim fragte sie sich, wie viele der Bediensteten von den Tobsuchtsanfällen des hohen Richters York wussten, von den üblen Beschimpfungen, mit denen er sie überzogen hatte. Vielleicht hatten sie sogar das Blut auf den Laken und bisweilen auch auf ihren Handtüchern bemerkt. Es waren Dinge vorgefallen, die ihr sogar bei der Erinnerung daran noch die Fassung raubten. Wie konnte sie so ruhig am Esstisch sitzen, während der Butler ihre Suppe auftrug und ihr nur allzu klar war, dass er sehr wohl wusste, wie brutal York sie missbrauchte, sobald er die Schlafzimmertür hinter ihnen zugesperrt hatte?
Es hatte binnen Wochen nach ihrer Hochzeit begonnen. Zunächst hatte er auf einer gewissen Grobheit bestanden, die ihr Schmerzen bereitete. Mit der Zeit war es schlimmer geworden, die Erniedrigungen immer widerlicher und demütigender, die Beschimpfungen hässlicher und die Gewalt von Mal zu Mal unberechenbarer.
So war es jahrelang weitergegangen. Zwischendurch hatte es Zeiten gegeben, in denen er monatelang nichts von ihr wollte und sie schon zu hoffen gewagt hatte, ihre Qual wäre vorbei.
Wie naiv von ihr! Freilich zeigte er sich in diesen Phasen des Aufschubs charmant, ja, geistreich und behandelte sie – zumindest in der Öffentlichkeit – respektvoll, so als hätte er die Grausamkeiten gegen sie in Momenten der Geistesverwirrung begangen. Wenn dann all das Schreckliche doch wieder über sie hereinbrach, war es umso grausamer und schwerer zu ertragen.
An dem Tag, als Oliver Rathbone bei ihnen zu Gast war, fanden Beatas Qualen schließlich ein Ende. Ingram hatte die Kontrolle über sich verloren und blindwütig mit seinem Spazierstock auf Oliver eingeschlagen. Hätte er ihn an der Schläfe getroffen, wäre Oliver tot gewesen. Zum Glück hatte Ingram in seiner Raserei einen Schwächeanfall erlitten und war besinnungslos zu Boden gestürzt. Ihm hatte buchstäblich der Schaum vor dem Mund gestanden.
Als die Kutsche mit dem Arzt eintraf, um ihn in eine Nervenheilanstalt zu bringen, hatte er das Bewusstsein immer noch nicht wiedererlangt. Es wäre eine Gnade gewesen, wenn er damals einfach ins Koma gefallen und gestorben wäre. Leider war es nicht so gekommen. In den langen Monaten danach hatte York irgendwo zwischen Bewusstsein und Wachkoma geschwebt, unterbrochen lediglich von flüchtigen Momenten geistiger Klarheit. Und so ging das nun schon seit bald einem Jahr.
Damit war Beata praktisch in jeder Hinsicht Witwe, nur in einer nicht: Zu heiraten war nicht möglich. Sie trug immer noch Yorks Namen, lebte in seinem Haus und zwang sich pflichtbewusst zu Besuchen bei ihm, wenn ihr Gewissen sie nicht mehr in Ruhe ließ oder der Arzt nach ihr sandte.
Geistesabwesend starrte sie aus dem Fenster, betrachtete die anderen Kutschen und die Damen mit Pelzkrägen und Capes, die darin saßen.
Es war keine lange Fahrt, aber der Weg führte am Regent’s Park vorbei. Die kahlen Bäume dort erschienen Beata wie ein schwarzes Flechtwerk. Heute hätte man dort gut spazieren gehen können. Doch schon hielten sie vor dem Krankenhaus. Der Diener sprang leichtfüßig vom Kutschbock herab und hielt ihr die Tür auf. Da die Luft schrecklich kalt war, wünschte sie sich für eine Sekunde, sie hätte ihren Pelz mitgenommen. Dann fiel ihr wieder ein, dass Ingram ihn ihr einmal zu Weihnachten geschenkt hatte, und sofort verbot sie sich jedes Bedauern. Lieber wollte sie frieren! Entschlossen überquerte sie den Bürgersteig und stieg die breite Treppe zum Haupteingang der Anstalt hinauf.
Der für York zuständige Arzt erwartete sie bereits. Sie hatte den Ruf, pünktlich zu sein, sodass er sie gleich hinter der Tür in Empfang nahm. Mit einem ernsten Lächeln trat er ihr entgegen und begrüßte sie mit einer angedeuteten Verbeugung. Das war sie als Frau eines angesehenen Richters am High Court gewöhnt. Und in stillschweigendem Einverständnis bezeichnete keiner von ihnen Yorks veränderte Umstände als unumkehrbar.
»Guten Tag, Lady York«, begrüßte der Arzt sie. »Wie kalt es geworden ist!«
»Allerdings«, bestätigte Beata. Natürlich bedeutete ihnen das Wetter nicht das Geringste; es war nur wesentlich leichter, sich an das Ritual zu halten, als sich ein echtes Gesprächsthema ausdenken zu müssen.
»Wie geht es meinem Mann?« Diese Frage stellte sie auch jedes Mal.
»Leider hat es eine geringfügige Veränderung gegeben.« Der Arzt drehte sich um und schritt voran zu dem inzwischen vertrauten Zimmer, das Ingram, soweit Beata wusste, seit seiner Einlieferung nicht mehr verlassen hatte. »Es tut mir sehr leid … aber vielleicht wird er bald weniger leiden«, fügte er in bemüht zuversichtlichem Ton hinzu.
Er konnte nicht wissen, wie inständig Beata sich Ingrams Tod wünschte. Nicht nur um ihretwillen, sondern auch seinetwegen. Sie hatte ihn nie geliebt, obschon sie sich das vor Jahren eine Zeit lang eingebildet hatte. Damals hatte er noch eine gewisse Würde besessen und hohe Intelligenz. Allein schon deswegen hätte sie niemandem gewünscht, dass er das erleiden musste, was Ingram widerfahren war – der Absturz aus den geistigen Höhen in die Abgründe der Unzurechnungsfähigkeit und zu den verzweifelten Versuchen, dorthin zurückzuklettern, wo er einmal gewesen war. Da konnte sie bei allem Bedürfnis nach Rache keine Schadenfreude empfinden.
Sie erreichten sein Zimmer, Gott sei Dank ohne weitere bedeutungslose Konversation. Der Arzt öffnete die Tür und hielt sie ihr auf.
Sie atmete tief durch, gab sich einen Ruck und trat ein.
Wie immer war der Geruch das Erste, was sie bemerkte. Eine Mischung aus menschlichen Ausdünstungen, ätzend stinkender Waschlauge und Desinfektionsmitteln. Wie immer war alles zu weiß, zu zweckmäßig.
Ingram war gegen die Kissen gelehnt worden. Auf den ersten Blick wirkte alles unverändert, als wäre sie erst gestern hier gewesen; dabei war ihr letzter Besuch schon Wochen her.
Dann, im Nähertreten, konnte sie seine Augen erkennen. Sie lagen tiefer in den Höhlen als beim letzten Mal und wirkten umwölkt, er schien sie nicht mehr sehen zu können.
»Guten Tag, Ingram«, sagte sie sanft. »Wie geht es dir?«
Er reagierte nicht. Hatte er sie nicht gehört? Eigentlich war sie sicher, dass er bei Bewusstsein war.
Sie berührte die auf der Bettdecke ruhende Hand mit den dicken Fingern. Halb erwartete sie, dass sie kalt sein würde, doch sie war wärmer als ihre eigene.
»Wie geht es dir?«, wiederholte sie, jetzt etwas lauter.
Plötzlich schloss sich seine Hand um die ihre und drückte fest zu. Sie schnappte nach Luft. Für einen kurzen Moment dachte sie daran, ihre Hand wegzuziehen, entspannte sich dann aber mit einer gewaltigen Anstrengung und ließ ihn gewähren.
»Du siehst etwas besser aus«, log sie. In Wahrheit machte er einen verheerenden Eindruck.
Er starrte sie weiter aus umwölkten Augen an. Man hätte meinen können, zwischen ihnen befände sich ein Milchglasfenster, durch das keiner hindurchschauen konnte.
»Bist du wiedergekommen, Beata?« Seine Stimme war nicht mehr als ein Flüstern, doch der Zorn darin war unüberhörbar. »Das musst du ja auch, solange ich am Leben bin, nicht wahr? Und das bin ich! Noch bist du nicht frei …«
»Das weiß ich, Ingram.« Sie starrte ihn an. »Aber du bist es ebenso wenig.« Die Worte waren kaum über die Lippen geschlüpft, als sie sie auch schon bereute. Wie hatte sie damals so blind sein und ihn heiraten können? Niemand hatte sie dazu gezwungen. Sie war schon einmal verheiratet gewesen, doch ihr erster Mann war nach ein paar Jahren gestorben. Irgendwann schien es an der Zeit zu sein, sich noch einmal für eine Ehe zu entscheiden. Sie hatte gesehen, was sie hatte sehen wollen, so wie vielleicht auch er. Sie waren beide nicht mehr ganz jung gewesen. Einen Unterschied gab es allerdings: Er hatte ihr etwas bedeutet, sie ihm dagegen überhaupt nichts. Womöglich hatte er überhaupt nie etwas für andere empfunden. Seiner Laufbahn zuliebe war es ratsam erschienen, eine Frau an seiner Seite zu haben. Und sie brachte eine gute Mitgift mit in die Ehe, die ihre Freunde für sie gesammelt hatten, nachdem ihr Vater in Ungnade gefallen war. Zum Glück war San Francisco weit entfernt, sodass diese Nachricht sich nicht bis nach England verbreitet hatte.
Ingrams Gesicht verzerrte sich geringfügig. Versuchte er, in einem Moment von Wärme oder Bedauern zu lächeln? Oder war das ein höhnisches Feixen, weil sie ebenso Gefangene war wie er, zumindest bis auf Weiteres? Vielleicht klammerte er sich deshalb an sein Leben, so erbärmlich es auch war: wegen des Drangs, sie ebenfalls leiden zu lassen?
Sie hatte etwas wiedergutzumachen. Darum wollte sie ihn nicht verurteilen. Sie drückte seine Finger etwas fester.
Zur Antwort schloss sich seine Hand wie ein Schraubstock um die ihre, und das tat weh.
»Schlampe!«, knurrte er deutlich vernehmbar, nur um gleich darauf an dem Wort schier zu ersticken. Er keuchte, und aus seinem Mund drang ein Rasseln. Der Griff um ihre Hand lockerte sich, gab sie jedoch nicht frei.
Beata zog und zerrte, doch ihre Kraft reichte nicht aus. Gleichzeitig war sie sich dessen bewusst, dass der Arzt sie beobachtete; gewiss nahm er an, ihre von Anstrengung verzerrte Miene zeuge von Liebe und Kummer. Nun, sie musste den Schein wahren. Also beherrschte sie sich und ließ die Hand wieder schlaff in Ingrams ruhen.
Seine Fingernägel bohrten sich in ihre Haut. Er war immer noch stark genug, um ihr Schmerzen zuzufügen.
Dann plötzlich öffnete er die Augen und starrte sie mit überraschend klarem Blick an. Und atmen konnte er auch wieder.
»Es hat dir gefallen, nicht wahr?«, zischte er. »Das weiß ich doch, so wie du geheult hast. Hure! Billige Dreckshure!«
Ihr lag schon ein Schimpfwort auf der Zunge, aber in der Gegenwart des Arztes konnte sie sich nicht gehenlassen! Sein Mitleid war schlimm genug, aber noch ärger wäre ihr seine Abscheu gewesen! So zwang sie sich – so schwer es ihr auch fiel – Ingram anzulächeln.
Jedes Wort betonend sagte sie: »Zu mehr warst du offenbar nicht imstande.« Jetzt konnte sie ihm das endlich entgegenschleudern. Er war hilflos und nicht mehr in der Lage, sie zu schlagen.
Er begriff sofort. Sein Gesicht lief vor Wut rot an, und er schien zu einem Schlag ausholen zu wollen, zuckte jedoch nur. Seine Augen traten hervor, er bekam erneut keine Luft mehr, keuchte und würgte immer verzweifelter. Vergeblich versuchte er, mit den Armen zu rudern, er konnte sie jedoch nicht einmal heben. Noch einmal überlief ihn ein Zucken, seine Zähne schnappten über der Zunge zusammen, dann erstarrte er, und aus seinem Mund rannen Speichel und Blut.
Auf einen Schlag war alles vorbei. Regungslos lag er da. Seine Hand, die Beata nicht losgelassen hatte, erschlaffte und glitt endlich zur Seite.
Der Arzt trat vor und legte die Finger an Yorks Hals. Beata blickte ihrem Mann in die verhangenen Augen und verstand: Er sah nichts mehr, weder sie noch sonst etwas.
»Lady York«, murmelte der Arzt, »er ist nicht mehr. Es … tut mir leid.«
»Danke«, sagte sie leise. »Sie waren … sehr freundlich.«
»Es tut mir so leid«, wiederholte er in sanftem Tonfall, wohl aus Sorge, sie könnte hysterisch reagieren. Das hätte in der Tat geschehen können. Und doch war seine Vermutung grundfalsch. Am liebsten wäre sie in Lachen ausgebrochen, in ein wildes, verrücktes Lachen, das nicht mehr aufhörte. Ingram war tot! Sie war frei!
Aber sie musste sich zügeln, durfte jetzt keinen Skandal heraufbeschwören. Sie konnte doch nicht neben ihrem toten Mann sitzen und lachen!
Sie schlug sich die Hände vors Gesicht. Den Arzt musste sie glauben machen, sie stehe unter Schock, verzweifelt, alles – nur nicht unendlich erleichtert. An ihren Händen haftete immer noch der Geruch seiner Finger. Der penetrante Krankenhausgeruch, der in ihr einen Brechreiz auslöste. Ihr Magen verkrampfte sich, und einen Moment lang glaubte sie, sich auf der Stelle übergeben zu müssen.
Langsam ließ sie die Hände wieder sinken und atmete mehrmals tief durch.
»Danke, Herr Doktor«, flüsterte sie mit zitternder Stimme. »Sie brauchen sich nicht zu sorgen. Mir … mir geht es trotz der Umstände durchaus gut. Wenn Sie im Moment nichts weiter von mir benötigen, würde ich gern heimgehen. Natürlich stehe ich zur Verfügung, falls Sie …« Sie wusste nicht, wie sie den Satz vollenden sollte. Monatelang hatte sie sich auf diese Situation vorbereitet, doch jetzt, da sie eingetreten war, hatte sie alles, was sie sich zurechtgelegt hatte, wieder vergessen.
»Natürlich«, sagte er sanft. »So gut man auch darauf vorbereitet sein mag, ist es dann doch ein entsetzlicher Schock. Möchten Sie sich eine Weile im Arztzimmer erholen? Ich kann nach einer Schwester schicken, die …«
Sie fiel ihm ins Wort. »Nein, danke. Ich werde viele Freunde und Bekannte in Kenntnis setzen müssen. Und dann gilt es wohl auch, einen Gedenkgottesdienst zu organisieren. Es wird … ich muss das Hohe Gericht informieren … die Anwälte … seine Kollegen.«
Der Arzt nickte. »Natürlich.« Sie hörte die Erleichterung in seiner Stimme. Er musste sich heute noch um andere Patienten kümmern, die auf ihn warteten. Und für Ingram York konnte er nichts mehr tun.
Unbegleitet verließ Beata das Krankenhaus. Am Straßenrand wartete immer noch der Kutscher bei seiner Droschke. Sie vermied es, ihm in die Agen zu schauen. Er sollte ihren Gesichtsausdruck nicht lesen können, wenn sie ihm sagte, dass Ingram York tot war. Vielleicht war das feige von ihr, aber ihre Gefühle waren nun mal ein einziger Wirrwarr aus Erleichterung und Betroffenheit, denn trotz seiner hässlichen Worte war Ingram zum Schluss erbarmungswürdig gewesen. Wenn die letzten Worte eines Menschen auf Erden sich in einer Hasstirade erschöpften, konnte man nur noch Mitleid mit ihm haben. Zugleich war ihr Innerstes durchsetzt mit brodelndem Zorn wegen all der Jahre mit ihm – und mit grenzenloser Freude, da es ihr zu guter Letzt gelungen war, eine Last abzuwerfen, die sie bedrückt und bisweilen regelrecht gelähmt hatte. Ihre neue Freiheit war berauschend – herrlich und beängstigend! Was würde sie damit anfangen, nun, da sie keine Ausrede mehr hatte, um einfach das auszuprobieren, was sie schon immer tun wollte? Es gab niemanden mehr, der sie hindern oder zurückhalten konnte. Von jetzt an war sie für alle Fehler selbst verantwortlich. Ingram war nicht mehr da.
Der Diener hielt ihr die Tür auf.
»Sir Ingram ist verstorben«, erklärte sie ihm. »Friedlich eingeschlafen.« Das war natürlich eine Lüge. Sie hatte immer noch seine hasserfüllte Stimme im Ohr.
Kurz trat Schweigen ein.
Sie hatte dem Diener nicht ins Gesicht schauen wollen, tat das jetzt aber doch. Und was sie darin erkannte, bevor sich das angemessene Mitgefühl ausbreitete, war Erleichterung.
»Das tut mir sehr leid, Mylady. Kann ich irgendetwas für Sie tun?« Sein Ton verriet Sorge um sie.
»Nein, danke, John.« Sie bedachte ihn mit einem äußerst knappen Lächeln. »Es gilt, sehr viele Personen in Kenntnis zu setzen, Briefe zu schreiben und so weiter. Ich muss sofort damit anfangen.«
»Sehr wohl, Mylady.« Er reichte ihr die Hand, um sie beim Einsteigen zu stützen.
Die Heimfahrt nutzte sie, um über die Beerdigung nachzudenken. Die Entscheidung lag allein bei ihr. Ingram war unter Umständen gestorben, die man der Öffentlichkeit nicht preisgab. Denjenigen, die sich nach ihm erkundigt hatten, hatte sie gesagt, dass er in einer Klinik lag. Wenn jemand die Vermutung geäußert hatte, er könnte einen Schlaganfall erlitten haben, hatte sie ihn das glauben lassen. Niemand aus ihrem Bekanntenkreis hatte jemals spekuliert, er könne den Verstand verloren haben. Und Oliver Rathbone hatte gewiss niemandem erzählt, dass York auf ihn losgegangen war, außer vielleicht seinem Freund Monk.
Log man bei der Todesursache einer bedeutenden Persönlichkeit? Oder ließ man stillschweigend zu, dass die Leute falsche Schlüsse zogen? Manche Menschen starben in der Tat unter höchst peinlichen Umständen wie zum Beispiel in einem fremden Bett neben der falschen Person! Nun, Ingram war wenigstens in einer Klinik verschieden.
Wenn er keine große Beerdigung bekam, würde das Spekulationen über die Umstände seines Todes Vorschub leisten. Als hoher Richter am High Court hatte Ingram immer im Blickfeld der Öffentlichkeit gestanden. Da erwartete man ein feierliches Begräbnis. Sie hatte keine andere Wahl.