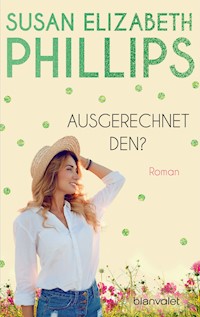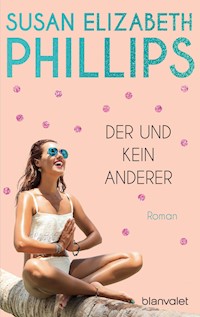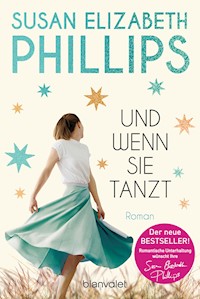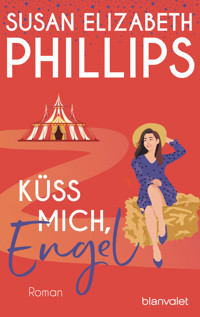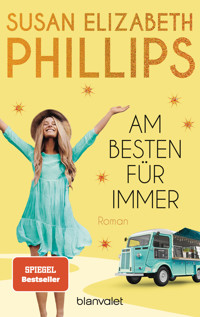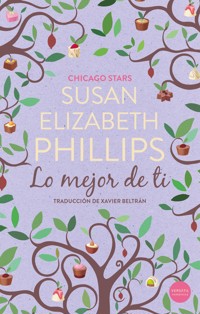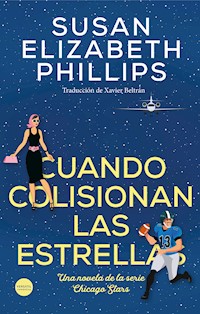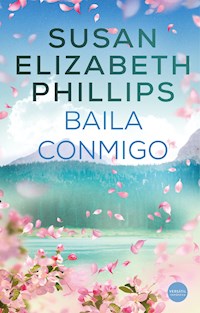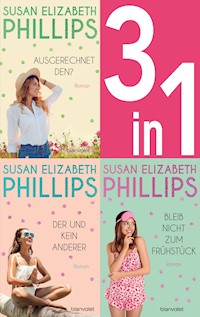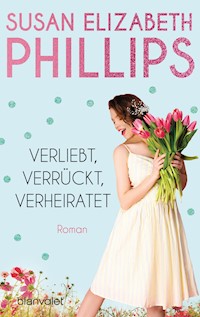8,99 €
8,99 €
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Wynette-Texas-Romane
- Sprache: Deutsch
Vom Leben im goldenen Käfig hat Cornelia Litchfield Case die Nase voll. Trickreich gelingt der jungen, schönen Witwe des amerikanischen Präsidenten die Flucht in die Anonymität. Mat Jorik, als Witwer mit seinen beiden Töchtern auf der Fahrt zur Großmutter unterwegs, nimmt die Anhalterin mit. Spontan verliebt Cornelia sich in die beiden Kinder, ehe sie den unverschämt gut aussehenden Vater unter die Lupe nimmt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2010
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Buch
Autorin
Titel
Lob
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6.
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Epilog
Copyright
Buch
Von ihrem Leben im goldenen Käfig hat Cornelia Litchfield Case die Nase gründlich voll. Als Kind eines mächtigen Politikers und später als beliebte Gattin des Präsidenten stand sie ununterbrochen im Licht der Öffentlichkeit. Nun, nach dem Tod ihres Mannes, weigert sie sich schlichtweg, als junge Witwe weitere medienwirksame Repräsentationspflichten zu übernehmen. Trickreich gelingt ihr die Flucht aus dem Weißen Haus in die Anonymität.
Mat Jorik, dessen Anblick schon so mancher Frau weiche Knie beschert hat, kann nicht anders: Sein ritterliches Herz schmilzt, wenn er eine Frau in Not sieht. Obwohl er als Witwer mit zwei kleinen Töchtern genügend Probleme hat, nimmt er die traurig wirkende Cornelia nach einer Autopanne als Anhalterin mit – wenn sie als Gegenleistung seine beiden Töchter auf der Fahrt zur Großmutter beaufsichtigt. Cornelia akzeptiert – und verliebt sich spontan in die beiden pfiffigen Mädchen. Dann erst nimmt sie den Vater genauer unter die Lupe …
Autorin
Susan Elizabeth Phillips’ Romane erobern jedes Mal auf Anhieb die Bestsellerlisten in den USA. Die Autorin lebt mit Mann und zwei Söhnen in der Nähe von Chicago.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »First Lady« bei Avon Books, Inc., New York.
Deutsche Erstveröffentlichung März 2001© der Originalausgabe 2000 by Susan Elizabeth Phillips© der deutschsprachigen Ausgabe 2001 byWilhelm Goldmann Verlag, München, in derPenguin Random House Verlagsgruppe GmbHNeumarkter Str. 28, 81673 MünchenUmschlaggestaltung:www.buerosued.deUmschlagmotiv: Getty Images/Digital Vision/CompassionateEye Foundation/Getty Images Staff PhotographerVerlagsnummer: 35394Lektorat: SKHerstellung: Heidrun NawrotISBN: 978-3-641-04368-1V003
www.blanvalet-verlag.de
www.penguinrandomhouse.de
Man muss das anpacken, was man für unmöglich hält.
Eleanor Roosevelt
1
Cornelia Litchfield Case kitzelte es an der Nase. Im Übrigen eine sehr elegante Nase. Perfekte Form, diskret, damenhaft. Ihre Stirn war aristokratisch, ihre Wangenknochen anmutig geschwungen, aber nicht zu hervortretend, denn das hätte man für ordinär gehalten. Was Cornelia absolut fern lag. Tatsächlich stammten ihre Vorfahren in direkter Linie von den Pilgervätern der Mayflower ab, was bedeutete, dass ihr Stammbaum den von Jacqueline Kennedy, einer ihrer berühmtesten Amtsvorgängerinnen, an Vornehmheit noch übertraf.
Ihr langes blondes Haar, das sie schon vor Jahren hätte abschneiden lassen, wäre ihr Vater nicht dagegen gewesen, war zu einem tiefen Nackenknoten geschlungen. Später hatte dann ihr Mann sie auf seine unnachahmlich sanfte Weise – er ging immer nur sanft mit ihr um – gebeten, sie möge es doch beim Alten belassen. Und hier war sie also, eine amerikanische Aristokratin mit einer Haartracht, die sie hasste, und einer Nase, die sie nicht kratzen durfte, weil Millionen von Menschen auf der ganzen Welt sie auf dem Fernsehschirm beobachteten.
Seinen toten Gatten begraben zu müssen konnte einem wahrhaftig den ganzen Tag verderben.
Sie erschauderte, versuchte jedoch tapfer, die aufsteigende Hysterie hinunterzuschlucken – doch ihre Beherrschung hing nur mehr an einem seidenen Faden. Lady Case zwang sich, ihre Aufmerksamkeit auf den wunderschönen Oktobertag zu richten und darauf, wie herrlich die Sonne auf den gleichförmigen Grabsteinen des Arlington National Cemetery funkelte; aber der Himmel hing zu tief, die Sonne war viel zu nahe. Selbst die Erde schien näher zu kommen und sie erdrücken zu wollen.
Die beiden rechts und links von ihr stehenden Männer rückten dichter an sie heran. Der neue Präsident der Vereinigten Staaten ergriff sie beim Arm. Ihr Vater nahm ihren Ellbogen. Direkt hinter ihr stand Terry Ackerman, der engste Freund und Berater ihres Mannes, und sein Kummer schien sie wie eine große, finstere Welle zu überrollen. Diese Herrengruppe erdrückte sie, nahm ihr die Luft zum Atmen.
Cornelia hielt den Schrei, der sich aus ihrer Kehle lösen wollte, zurück, indem sie die Zehen in ihren schwarzen Lederpumps krümmte, sich in die Innenseite ihrer Unterlippe biss und an den Song »Goodbye Yellow Brick Road« dachte. Dieser Elton-John-Song erinnerte sie daran, dass er noch ein anderes Lied geschrieben hatte, eins für eine tote Prinzessin. Ob er nun auch ein Lied für den ermordeten Präsidenten schreiben würde?
Nein! Nicht daran denken! An ihre Haare konnte sie denken, an ihre juckende Nase. Daran, dass sie kaum mehr einen Bissen herunterbrachte, seit ihr ihre Sekretärin die Nachricht überbracht hatte, dass Dennis drei Blocks vom Weißen Haus entfernt von einem fanatischen Waffenbesitzer, der glaubte, sein Recht auf das Tragen von Waffen beinhalte auch das Recht, den Präsidenten als Zielscheibe zu benützen, niedergestreckt worden war. Den Mörder hatte noch am Tatort ein Polizeibeamter erschossen; aber das änderte nichts an der Tatsache, dass der Mann, den sie einmal geliebt hatte, nun in einem schimmernden schwarzen Sarg vor ihr lag.
Da sie die kleine Emaillebrosche in Form der amerikanischen Flagge, die sie sich auf das Revers ihres schwarzen Kostüms geheftet hatte, berühren wollte, entzog sie ihrem Vater den Arm. Es war der Anhänger, den Dennis so oft getragen hatte. Sie würde ihn Terry schenken. Am liebsten würde sie sich jetzt gleich zu ihm umdrehen und sie ihm geben, um seinen Kummer vielleicht ein wenig zu lindern.
Sie brauchte Hoffnung – etwas Positives, an das sie sich klammern konnte -, aber das war nicht leicht zu finden, nicht einmal für eine so überzeugte Optimistin wie sie. Doch dann kam ihr der rettende Gedanke …
Wenigstens war sie nicht mehr die First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika.
Vierundzwanzig Stunden später wurde ihr jedoch selbst dieser Trost von Lester Vandervort, dem neuen US-Präsidenten, wieder genommen. Er stand im Oval Office und blickte sie über Dennis Case’s alten Schreibtisch hinweg an. Die Schachtel mit den Mini-Milky-Ways, die ihr Mann immer in Teddy Roosevelts Frischhaltebox aufbewahrt hatte, war ebenso verschwunden wie seine Fotosammlung. Vandervort hatte noch nichts Persönliches hereingebracht, nicht einmal ein Foto von seiner verstorbenen Frau; doch sie wusste, dass sein Mitarbeiterstab dieses Versehen rasch korrigieren würde.
Vandervort war ein dünner, asketisch wirkender Mann mit einem äußerst scharfen Verstand, aber wenig Humor. Und die Arbeit stellte seinen Lebensinhalt dar. Der vierundsechzigjährige Witwer galt nun seit vorgestern als die begehrteste Partie der Welt. Zum ersten Mal seit Edith Wilsons Tod, achtzehn Monate nach Woodrow Wilsons Amtsantritt, gab es in den Vereinigten Staaten keine First Lady.
Die Oval-Office-Räume waren vollklimatisiert, die drei Stockwerke hohen Fenster hinter dem Schreibtisch kugelsicher, und sie hatte das Gefühl, gleich ersticken zu müssen. Sie stand beim Kamin und starrte blind auf Rembrandt Peales Porträt von Washington. Die Stimme des neuen Präsidenten drang wie aus weiter Ferne zu ihr: »… möchte nicht unsensibel sein und weiß, was Sie im Moment durchmachen, aber leider bleibt mir keine Wahl. Ich habe nicht vor, noch einmal zu heiraten, und unter meinen weiblichen Angehörigen ist keine, die auch nur andeutungsweise in der Lage wäre, das Amt einer First Lady auszufüllen. Es käme mir sehr gelegen, wenn Sie weitermachten!«
Ihre Nägel gruben sich in ihre Handflächen, als sie sich zu ihm umwandte. »Unmöglich. Ich kann nicht.« Am liebsten hätte sie ihn angebrüllt, dass sie noch nicht einmal Zeit gehabt hatte, sich seit der Beerdigung umzuziehen; doch Gefühlsausbrüche dieser Art hatte sie sich schon lange vor ihrer Zeit im Weißen Haus abgewöhnt.
Ihr distinguierter Vater erhob sich von einem der beiden damastbespannten Sofas und nahm seine Prinz-Philip-Haltung ein – Hände hinter dem Rücken gefaltet, mit den Füßen nach hinten wippend. »Selbstverständlich war das ein sehr schwerer Tag für dich, Cornelia. Morgen werden dir die Dinge viel klarer erscheinen.«
Cornelia! Jeder, der ihr etwas bedeutete, nannte sie Nealy, bloß ihr Vater nicht. »Ich werde meine Meinung nicht ändern.«
»Aber natürlich wirst du«, widersprach er. »Diese Regierung braucht eine kompetente First Lady. Der Präsident und ich haben das Problem rundum erörtert, und wir beide halten dies für die ideale Lösung.«
Normalerweise war sie eine durchaus selbstbewusste Frau – nur nicht, wenn es um ihren Vater ging, und sie bereitete sich auf einen Kampf vor. »Ideal für wen? Nicht für mich!«
James Litchfield musterte sie auf diese herablassende Art, mit der er die Leute einschüchterte, seit sie denken konnte. Ironischerweise verfügte er jetzt als Parteivorsitzender über mehr Macht als in den acht Jahren seiner Vizepräsidentschaft der Vereinigten Staaten. Als Erster hatte ihr Vater das Potenzial von Dennis Case, dem gut aussehenden, ledigen Gouverneur von Virginia, erkannt. Sein Ruf als Königsmacher fand dann vor vier Jahren seinen Höhepunkt, als er seine Tochter zum Altar führte – als Braut eben jenen Mannes.
»Besser als jeder andere weiß ich, wie traumatisch das Ganze für dich sein muss«, fuhr er fort, »aber du bist nun mal das herausragendste und wichtigste Bindeglied zwischen der Case- und der Vandervort-Administration. Das Land braucht dich.«
»Du meinst wohl eher die Partei, nicht wahr?« Alle wussten, dass es Lester mit seinem fehlenden Charisma schwer haben würde, die nächsten Wahlen im Alleingang zu gewinnen. Er mochte ja ein fähiger Politiker sein, doch besaß er nicht einmal ein Quäntchen von Dennis Case’s Starqualitäten.
»Wir denken dabei nicht nur an die Wiederwahl«, log ihr Vater aalglatt, »sondern auch an das amerikanische Volk. Du bist ein wichtiges Symbol für Stabilität und Kontinuität.«
Vandervort meldete sich forsch zu Wort. »Sie behalten natürlich Ihr altes Büro und Ihren bisherigen Mitarbeiterstab. Ich sorge dafür, dass Sie alles bekommen, was Sie brauchen. Nehmen Sie sich einen Monat Zeit, um sich im Landhaus Ihres Vaters in Nantucket ein wenig zu erholen, und dann kehren Sie allmählich wieder zu Ihren Aufgaben als First Lady zurück. Wir können ja mit dem Empfang für das diplomatische Corps anfangen. Und Mitte Januar sollten Sie sich für den G-8-Gipfel freihalten – auch der Südamerikabesuch ist äußerst wichtig. Aber das wird kein allzu großes Problem für Sie sein, da diese Termine ja ohnehin in Ihrem Kalender stehen.«
An dieser Stelle schien ihm endlich einzufallen, dass sie nur deshalb in ihrem Kalender standen, weil sie sie an der Seite ihres goldblonden, strahlenden Gatten hatte absolvieren wollen. Mit leiserer Stimme fügte er verspätet hinzu: »Natürlich fällt Ihnen momentan das alles sehr schwer, Cornelia, aber der Präsident hätte gewollt, dass Sie weitermachen – außerdem wird Ihnen die Arbeit helfen, besser mit Ihrem Kummer fertig zu werden.«
Bastard! Sie hätte ihm dieses Wort von Herzen gern ins Gesicht geschrien; doch war sie als Tochter ihres Vaters von Geburt an dazu erzogen worden, ihre Emotionen nicht zu zeigen – also tat sie es auch nicht. Stattdessen musterte sie ihre beiden Gegenüber mit festem Blick. »Es ist unmöglich. Ich will mein Leben wieder zurückhaben. Das steht mir zu!«
Ihr Vater kam über den ovalen Teppich mit dem Präsidentensiegel auf sie zugeschritten und nahm ihr noch mehr von der kostbaren Luft, die sie zum Atmen brauchte. Sie fühlte sich wie eingekerkert und musste daran denken, dass Bill Clinton das Weiße Haus einmal das Kronjuwel im föderalen Strafvollzugssystem der Vereinigten Staaten genannt hatte.
»Du hast weder Kinder noch einen Beruf«, erinnerte ihr Vater sie. »Du bist kein selbstsüchtiger Mensch, Cornelia, und hast gelernt, deine Pflicht zu tun. Wenn du dich ein wenig auf der Insel erholt hast, geht es dir sicher wieder besser. Das amerikanische Volk zählt auf dich.«
Wie war das nur passiert?, fragte sie sich. Wie war sie zu einer so populären First Lady geworden? Ihr Vater schrieb es dem Umstand zu, dass die Leute sie hatten aufwachsen sehen; aber ihrer Meinung nach war es eher darauf zurückzuführen, dass sie von klein auf gelernt hatte, sich ohne größere Fehltritte in der Öffentlichkeit zu bewegen.
»Mir fehlt der Zugang zu den Menschen und das Geschick dafür«, schaltete sich nun Vandervort ein mit der brutalen Offenheit, die sie so oft an ihm bewunderte, obwohl sie ihn immer wieder Stimmen kostete. »Sie können das ausgleichen.«
Vage fragte sie sich, was Jacqueline Kennedy wohl gesagt hätte, wenn LBJ mit einem derartigen Vorschlag an sie herangetreten wäre. Aber Lyndon B. Johnson hatte keine Ersatz-First-Lady gebraucht. Er war mit einer der besten verheiratet gewesen.
Nealy hatte ebenfalls geglaubt, einen der Besten an ihrer Seite zu haben, doch es war anders gekommen. »Nein, das kann ich nicht. Ich möchte wieder ein Privatleben haben.«
»Dein Recht auf ein Privatleben ist durch deine Heirat mit Dennis hinfällig geworden.«
Da irrte sich ihr Vater. Sie hatte es schon an dem Tag verloren, als sie als James Litchfields Tochter auf die Welt kam.
Über die siebenjährige Nealy – lange bevor ihr Vater Vizepräsident wurde – hatten die nationalen Zeitungen eine Geschichte gebracht: wie sie ihr Osternest, das auf dem Rasen des Weißen Hauses versteckt gewesen war, einem behinderten Kind schenkte. Nicht jedoch stand in der Zeitung, dass ihr Vater, damals noch Senator, ihr flüsternd befohlen hatte, das Nest herauszurücken, und dass sie hinterher bitterlich geweint hatte über diese angeordnete Nächstenliebe.
Mit zwölf und einer schimmernden Zahnspange im Mund war sie fotografiert worden, wie sie gerade Suppe in einer Washingtoner Obdachlosenküche austeilte. Und die Dreizehnjährige zierte grüne Farbe auf der Nase, weil sie bei der Renovierung eines Altersheims mithalf. Doch ihre Popularität wurde für immer besiegelt, als man sie in Äthiopien fotografierte, wie sie ein verhungerndes Baby in ihren Armen hielt, während ihr Tränen der Wut und Verzweiflung über die Wangen liefen. Dieses Bild, das auf dem Cover der Times erschien, brachte ihr für alle Zeiten den Ruf als die Verkörperung des menschenfreundlichen Amerikas ein.
Die blassblauen Wände drohten auf sie zu fallen. »Ich habe meinen Mann vor weniger als acht Stunden zu Grabe getragen und will jetzt nicht darüber reden.«
»Selbstverständlich, meine Liebe. Wir können den Rest auch morgen besprechen.«
Am Ende vermochte sie sich sechs Wochen Schonzeit zu erkämpfen, bevor sie wieder ihre Arbeit aufnahm: die Aufgabe, zu der sie von Geburt an erzogen worden war und die Amerika von ihr erwartete. First Lady zu sein.
2
Im Laufe der nächsten sechseinhalb Monate wurde Nealy so dünn, dass die Zeitungen zu vermuten begannen, sie wäre möglicherweise magersüchtig. Mahlzeiten waren die reinste Tortur für sie. Nachts konnte sie nicht schlafen, und ihre akute Atemnot verschwand nie. Trotzdem diente sie dem Land gut als Lester Vandervorts First Lady … bis ein kleines Ereignis das fragile Kartenhaus zusammenbrechen ließ.
An einem Nachmittag im Juni stand sie in der Reha einer Kinderstation in Phoenix, Arizona, und sah einem kleinen lockigen, rothaarigen Mädchen, dessen dicke Beinchen in zwei Schienen steckten, bei ihrem Gehversuch auf Krücken zu.
»Guck her!«, rief der pummelige Rotschopf strahlend, stützte sich auf ihre Krücken und schickte sich an, den unglaublich mühsamen Schritt zu tun. Was für ein Mut!
Nealy hatte noch nicht oft Scham verspürt, doch nun wurde sie geradezu davon überwältigt. Dieses Kind hier kämpfte so tapfer darum, sein Leben zurückzubekommen, während Nealy ihr eigenes an sich vorbeigehen ließ.
Sie war weder feige noch unfähig, für sich selbst einzutreten; dennoch hatte sie das alles mitgemacht, weil ihr kein vernünftiger Grund eingefallen war, der ihrem Vater oder dem Präsidenten klar gemacht hätte, warum sie die ihr von Kind an zugedachte Rolle nicht mehr spielen wollte.
Genau in diesem Augenblick traf sie eine Entscheidung. Sie wusste nicht, wie oder wann, aber sie würde sich befreien. Selbst wenn diese Freiheit bloß einen Tag – eine Stunde! – dauern sollte; zumindest würde sie es auf einen Versuch ankommen lassen.
Nealy wusste ganz genau, was sie wollte. Sie wollte einmal wie ein normaler Mensch leben: einkaufen gehen, ohne angestarrt zu werden, mit einem Eis in der Hand durch eine Kleinstadt bummeln und lächeln, einfach, weil ihr danach zumute war, nicht weil sie musste. Einmal wollte sie sagen können, was sie dachte, einmal einen Fehler machen. Sie wollte sehen, wie die Welt wirklich war, nicht herausgeputzt für einen offiziellen Besuch. Vielleicht würde sie dann ja herausfinden, was sie mit dem Rest ihres Lebens anfangen sollte.
Nealy Case, was willst du einmal werden, wenn du groß bist? Als sie noch ganz klein war, hatte sie immer geantwortet: Präsident, aber jetzt hatte sie keine Ahnung mehr.
Aber wie konnte die berühmteste Frau Amerikas auf einmal ein ganz normaler Mensch werden?
Ein Hindernis nach dem anderen durchkreuzte ihren Sinn. Es kam nicht in Frage. Die First Lady konnte nicht einfach verschwinden. Oder doch?
Personenschutz setzte Kooperation voraus, und im Gegensatz zu dem, was die meisten Leute dachten, war es durchaus möglich, dem Secret Service zu entschlüpfen. Bill und Hillary Clinton hatten sich in der Anfangszeit seiner Regierung einmal davongestohlen, waren jedoch unmissverständlich ermahnt worden, dass sie sich diese Art von Freiheit nun nicht mehr leisten konnten. Kennedy trieb den Secret Service mit seinem dauernden Verschwinden in den Wahnsinn. Ja, irgendwie wollte sie ihre Fesseln abwerfen – aber es hätte keinen Sinn, wenn sie sich nicht frei bewegen könnte. Jetzt kam es darauf an, einen Plan auszuhecken.
Einen Monat später war es so weit.
An einem Vormittag im Juli, etwa gegen zehn Uhr, gesellte sich eine ältere Dame zu einer Besuchergruppe, die soeben durch die Räume des Weißen Hauses geführt wurde. Sie hatte weißes, dauergewelltes Haar mit Korkenzieherlöckchen, trug ein grün-gelb kariertes Kleid und eine große Plastiktasche. Ihre knochigen Schultern beugte sie nach vorn, ihre dünnen Stelzen steckten in Stützstrümpfen und ihre Füße in einem Paar bequemer brauner Schnürschuhe. Durch eine große Brille mit einem Perlmuttrahmen und einer Falschgoldverzierung an den Rändern spähte sie suchend in ihre Begleitbroschüre. Ihre Stirn war aristokratisch, die Nase klassisch, und ihre Augen leuchteten so blau wie der Himmel über Amerika.
Nealy schluckte krampfhaft und widerstand dem Drang, an der Perücke, die sie sich über ein Versandhaus hatte schicken lassen, zu zupfen. Auch das Polyesterkleid, die Schuhe und die Strümpfe waren per Katalog eingetroffen. Sie machte das immer so, weil sie sich damit ein Stückchen Privatsphäre bewahrte. Auch benutzte sie stets den Namen ihrer Stabschefin, Maureen Watts, plus der falschen Mittelinitiale C, sodass Maureen wusste, diese Bestellung stammte von Nealy. Ihre Mitarbeiterin hatte keine Ahnung, was sich in den Paketen befand, die sie kürzlich im Weißen Haus abgegeben hatte.
Nealy blieb bei dem Grüppchen, das nun vom Roten Zimmer in den State Dining Room mit seiner Einrichtung im amerikanischen Empire-Stil weiterrückte. Überall waren Videokameras installiert, die alles aufnahmen, und Nealys Hände fühlten sich feucht und eiskalt an. Sie versuchte, aus dem Porträt von Lincoln Kraft zu schöpfen, das über dem Kamin hing. Darunter prangten die Worte John Adams’, die sie schon so oft gelesen hatte: Möge Gott dieses Haus segnen und alle, die dereinst darin wohnen. Mögen nur ehrenhafte und weise Männer unter seinem Dach regieren.
Die Führerin der Gruppe stand beim Kamin und beantwortete höflich eine Frage. Nealy war wahrscheinlich die Einzige im Raum, die wusste, dass alle Führer von Besuchergruppen dem Secret Service angehörten. Sie erwartete jeden Moment, dass die Frau sie entdeckte und Alarm schlüge, aber die Agentin schaute kaum einmal in ihre Richtung.
Wie viele Secret-Service-Agenten hatte sie im Lauf der Jahre schon erlebt? Sie hatten sie zur Highschool begleitet und danach zum College. Sie waren bei ihrer ersten Verabredung dabei gewesen und auch beim ersten Rausch ihres Lebens. Ein Secret-Service-Agent hatte ihr das Autofahren beigebracht, und ein anderer war Zeuge ihrer Tränen geworden, als der erste Junge, an dem ihr wirklich etwas lag, ihr eine Abfuhr erteilte. Eine Agentin hatte ihr sogar beim Aussuchen eines Kleids für die Graduationsparty geholfen, als ihre Stiefmutter wegen einer Erkältung unpässlich war.
Die Gruppe machte sich auf den Weg durch einen Quergang zum North Portico. Es war schwül und heiß, ein typischer Washingtoner Julitag eben. Nealy blinzelte in die grelle Julisonne und fragte sich, wie lange es wohl noch dauern mochte, bis die Wachen merkten, dass sie keine ältliche Touristin war, sondern die First Lady.
Ihr Herz klopfte schneller. Neben ihr fauchte eine Mutter ihren kleinen Sohn an. Nealy ging weiter, mit jedem Schritt nervöser werdend. In den dunklen Tagen von Watergate hatte sich eine vollkommen verzweifelte Pat Nixon in Kopftuch und Sonnenbrille, mit nur einer Agentin als Begleitung, aus dem Weißen Haus geschlichen, um durch die Straßen von Washington zu bummeln, in Schaufenster zu schauen und von dem Tag zu träumen, an dem alles vorbei war. Aber mit der zunehmenden Wut der Welt waren die Zeiten, in denen First Ladys sich diesen Luxus leisten konnten, untergegangen.
Nach Luft ringend erreichte sie den Ausgang. Der Codename des Secret Service für das Weiße Haus war Crown, Krone, aber er hätte eher Fortress, also Festung, lauten sollen. Die meisten Touristen, die am Zaun entlangschlenderten, wussten nicht, dass dort Mikrofone installiert waren und dass die Sicherheitskräfte im Haus alles mitanhören konnten, was in dieser Bannmeile gesprochen wurde. Und immer wenn der Präsident das Gebäude betrat oder verließ, lag ein SWAT-Team mit Maschinengewehren auf dem Dach bereit. Überall auf dem Grundstück befanden sich versteckte Videokameras, Bewegungsdetektoren, Drucksensoren und Infrarotgeräte.
Wenn es doch bloß einen einfacheren Weg gäbe! Sie hatte überlegt, ob sie nicht eine Pressekonferenz abhalten und verkünden sollte, dass sie sich aus dem öffentlichen Leben zurückzog – doch dann wäre ihr die Presse auf Schritt und Tritt gefolgt. Das hätte sie vom Regen in die Traufe befördert. Nein, dies war ihre einzige Chance.
Lady Cornelia erreichte die Pennsylvania Avenue. Mit bebender Hand schob sie ihre Begleitbroschüre in die große Plastiktasche, wo sie an einen Umschlag stieß, in dem Tausende von Dollars Bargeld steckten. Starr geradeaus blickend, marschierte sie dann am Lafayette Park vorbei und auf die Metro zu.
Da sah sie, dass ein Polizist auf sie zukam, und ein dicker Tropfen Schweiß rann ihr zwischen den Brüsten abwärts. Wenn er sie nun erkannte? Ihr blieb fast das Herz stehen, als er ihr zunickte und sich danach abwandte. Der gute Mann hatte keine Ahnung, dass er soeben der First Lady der Vereinigten Staaten gegenübergestanden hatte.
Ihr hektischer Atem beruhigte sich ein wenig. Alle Mitglieder der First Family trugen winzige Geräte bei sich, mit deren Hilfe man sie im Falle einer Entführung ausfindig machen konnte. Ihres, so dünn wie eine Kreditkarte, lag unter ihrem Kissen im Schlafzimmer ihres privaten Apartments im vierten Stock des Weißen Hauses. Mit sehr viel Glück blieben ihr vielleicht zwei Stunden, bevor ihr Verschwinden bemerkt würde. Nealy hatte zwar Maureen Watts, ihrer Stabschefin, erklärt, es gehe ihr nicht gut und sie müsse sich für ein paar Stunden hinlegen: Doch sie zweifelte nicht daran, dass Maureen sie wecken würde, wenn es ihrer Meinung nach wichtig war. Dann würden sie den Brief finden, den Nealy hinterlassen hatte, und auch das kleine Gerät unter ihrem Kopfkissen und – ach, du liebe Güte!
Nealy zwang sich, nicht zu rennen, als sie die Metrostation betrat. Sie ging zu einem der Ticketautomaten, von deren Existenz sie erst erfahren hatte, als sich zwei ihrer Sekretärinnen darüber unterhielten. Einmal musste sie umsteigen, wofür sie den Fahrpreis berechnete. Nachdem sie Geld eingeworfen hatte, drückte sie auf die richtigen Knöpfe und bekam ihr Ticket.
Danach schaffte sie es glücklich durch das Drehkreuz und zur Zugplattform. Mit heftig klopfendem Herzen, den Kopf nervös in ihre Lektüre vergraben, wartete sie auf die U-Bahn, die sie in die Außenbezirke von Washington bringen würde. Wenn sie Rockville erreicht hatte, wollte sie sich ein Taxi nehmen und einen der zahlreichen Gebrauchtwagenhändler an der Route 355 aufsuchen. Hoffentlich fand sie einen Verkäufer, der gierig genug war, einer alten Dame ein Auto zu verkaufen, auch ohne ihren Führerschein zu kontrollieren.
Drei Stunden später saß sie hinterm Steuer eines unauffälligen, vier Jahre alten blauen Chevy Corsica und fuhr auf der Interstate 270 in Richtung Frederick, Maryland. Tatsächlich, sie hatte es geschafft! Sie war raus aus Washington. Für den Wagen hatte sie zwar einen gesalzenen Preis bezahlt; aber das war ihr egal, da niemand ihn mit Cornelia Case in Verbindung bringen würde.
Sie versuchte ihre um das Lenkrad verkrampften Finger zu entspannen, schaffte es aber nicht. Im Weißen Haus schrillten inzwischen sicher die Alarmglocken, und es war Zeit, ihren Anruf zu tätigen. Während sie die nächste Interstate-Ausfahrt nahm, überlegte sie, wann sie zum letzten Mal Autobahn gefahren war. Manchmal steuerte sie selbst, wenn sie auf Nantucket oder in Camp David war – ansonsten jedoch fast nie.
Auf der linken Straßenseite tauchte ein kleiner Supermarkt auf, dort bog sie ab, stieg aus dem Wagen und ging zu der Telefonzelle, die etwas an der Seite stand. Bevor sie den Hörer abnahm, musste sie die Anweisungen sorgfältig lesen, da sie an die Effizienz der White-House-Operators gewöhnt war. Schließlich wählte sie die Nummer des privatesten Anschlusses aller Oval-Office-Anschlüsse, der definitiv nicht abgehört werden konnte.
Nach dem zweiten Klingeln nahm der Präsident persönlich ab. »Ja?«
»Hier ist Nealy.«
»Um Gottes willen, wo sind Sie? Ist alles in Ordnung?«
Die Aufregung in seiner Stimme verriet ihr, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hatte. Den Anruf hätte sie nicht länger hinauszögern dürfen. Ihr Brief war offenbar gefunden worden – aber niemand hätte mit Sicherheit sagen können, ob sie ihn nicht unter Druck geschrieben hatte; schließlich wollte sie nicht mehr Staub aufwirbeln als unbedingt nötig.
»Es geht mir gut. Ausgezeichnet. Und der Brief ist echt, Mr. President. Niemand hat mir eine Pistole an den Kopf gehalten.«
»John ist furchtbar in Sorge. Wie konnten Sie ihm das antun?«
Das hatte sie erwartet. Jeder, der zur Familie des Präsidenten gehörte, musste sich einen Codenamen merken, der in einem Entführungsfall zu benutzen war. Wenn sie einen Satz mit dem Namen John North darin erwähnte, würde der Präsident wissen, dass man sie gegen ihren Willen festhielt.
»Es hat nichts mit ihm zu tun«, antwortete sie.
»Mit wem?« Er gab ihr eine weitere Chance.
»Man hat mich nicht entführt«, gestand sie.
Endlich schien er zu begreifen, dass sie das alles aus freiem Willen unternahm, und seine Wut war ihm deutlich anzumerken. »In Ihrem Brief steht kompletter Blödsinn! Ihr Vater ist außer sich!«
»Richten Sie ihm bitte nur aus, dass ich ein wenig Zeit für mich selbst brauche. Ich werde gelegentlich anrufen, damit Sie wissen, wie es um mich steht.«
»Das können Sie nicht machen! Sie können nicht einfach verschwinden. Hören Sie mir zu, Cornelia! Sie haben Verpflichtungen und brauchen den Schutz des Secret Service. Sie sind die First Lady.«
Es war zwecklos, mit ihm zu streiten. Seit Monaten sagte sie ihm und ihrem Vater, dass sie eine Pause nötig hatte und einmal weg musste von allem – aber keiner der beiden wollte ihr zuhören. »Maureen soll der Presse sagen, dass ich eine Erkältung habe. Das wird sie für eine Weile beruhigen. In ein paar Tagen rufe ich wieder an.«
»Warten Sie! Das ist gefährlich! Sie brauchen unbedingt Schutz. Sie können unmöglich …«
»Auf Wiedersehen, Mr. President!«
Damit hängte sie auf und schnitt somit dem mächtigsten Mann der freien Welt das Wort ab.
Auf dem Rückweg zu ihrem Auto musste sie sich zwingen, nicht zu rennen. Das Polyesterkleid klebte ihr am Leib, und ihre Beine unter den heißen Stützstrümpfen fühlten sich an, als gehörten sie ihr nicht mehr. Tief durchatmen, befahl sie sich. Tief durchatmen. Es gab zu viel zu tun, um jetzt zusammenzubrechen.
Ihre Kopfhaut juckte unerträglich, als sie wieder auf die Schnellstraße hinausfuhr. Wie gerne hätte sie ihre Perücke abgenommen. Aber das musste warten, bis sie ihre Einkäufe erledigt und sich eine neue Tarnung zugelegt hatte.
Es dauerte nicht lange, bis sie den Wal-Mart fand, den sie letzte Woche aus den Gelben Seiten des Internets herausgesucht hatte. Da nur wenige Dinge in ihre Tasche passten, brauchte sie dringend noch eine Grundausstattung.
Ihr Gesicht war so bekannt, dass sie nicht einmal als Kind unbemerkt hatte einkaufen gehen können; deshalb war sie viel zu nervös, um ihre neue Freiheit richtig schätzen zu können. Rasch erledigte sie ihre Einkäufe, stellte sich an der Kasse an und eilte dann zu ihrem Auto zurück. Nachdem alles sicher im Kofferraum verstaut war, fuhr sie auf den Freeway zurück.
Bei Einbruch der Nacht wollte sie längst in Pennsylvania sein, und irgendwann im Verlaufe des morgigen Tages würde sie die Autobahn gänzlich verlassen. Dann wollte sie herumfahren und sich das Land ansehen, über das sie so viel und dennoch so wenig wusste. Sie wollte vagabundieren, bis ihr das Geld ausging oder bis man sie wieder einfing. Je nachdem, was eher eintrat.
Das Ausmaß ihres Entschlusses begann ihr allmählich zu dämmern. Niemand, der ihr andauernd über die Schulter blickte. Keine Termine, kein Händeschütteln. Zum ersten Mal in ihrem Leben fühlte sie sich frei.
3
Mat Jorik reckte sich unbehaglich auf seinem Stuhl und stieß dabei mit dem Ellbogen an den Schreibtisch des Anwalts in Harrisburg, Pennsylvania. Er stieß sich öfters irgendwo. Nicht weil Mat etwa ein Trampel wäre, sondern weil seine riesenhafte Gestalt einfach nicht in die Maße dieser Welt passte.
Der Holzstuhl, auf dem er saß, wirkte geradezu zwergenhaft unter seiner gestandenen Zwei-Meter-zwei-Größe und dem Hundert-Kilo-Gewicht. Doch Mat war an Winzstühle gewöhnt und an Waschbecken, die ihm gerade mal bis zu den Knien reichten. Er duckte sich ganz automatisch, wenn er eine Kellertreppe hinunterstieg, und die zweite Klasse im Flugzeug war das, was er persönlich unter Hölle verstand. Und die Rücksitze praktisch aller Automarken konnte er ohnehin vergessen.
»Sie sind auf beiden Geburtsurkunden als Kindsvater aufgeführt, Mr. Jorik. Das heißt, dass Sie für sie verantwortlich sind.«
Der Anwalt war ein humorloser Spießer, der Typ also, den Mat Jorik am allerwenigsten mochte; also streckte er vorübergehend kurz ein baumlanges Bein aus, um diesen Wurm ein wenig einzuschüchtern. Warum sollte seine Größe nicht auch mal zu was gut sein? »Dann will ich’s noch mal wiederholen. Sie sind nicht von mir.«
Der Anwalt zuckte ein wenig zusammen. »Das sagen Sie. Aber die Mutter hat Sie als Vormund eingesetzt.«
Mat funkelte ihn an. »Dankend abgelehnt!«
Obwohl Mat lange in Chicago und L. A. gelebt hatte, klebte ihm seine Herkunft aus der Stahlarbeiterstadt Pittsburgh, in der er in einem Arbeiterviertel seine Kindheit verbrachte, noch wie Fabriksmog am Leib. Er war ein vierunddreißigjähriger Bursche mit großen Pranken, einer dröhnenden Stimme und einem Talent für Wortgefechte. Eine Exfreundin hatte ihn einmal als einen der letzten wahren Männer Amerikas bezeichnet, doch weil sie ihm dabei gleichzeitig das Bride Magazine an den Kopf warf, hatte er es nicht als Kompliment aufgefasst.
Erneut raffte sich der Rechtsverdreher auf. »Sie sagen, sie wären nicht von Ihnen – aber Sie waren mit der Kindsmutter verheiratet.«
»Ja, mit einundzwanzig.« Ein Anfall jugendlicher Panik, den Mat nie wiederholt hatte.
Ihre Unterhaltung wurde vom Auftauchen einer Sekretärin mit einem großen Umschlag unterbrochen. Sie war der echte Typ Vorzimmerdrachen, doch ihre Blicke tasteten ihn ab wie eine Videokamera. Er wusste, dass er der holden Weiblichkeit gefiel; trotz seiner sieben Schwestern war ihm der Grund dafür bis heute ein Rätsel. Er sah doch wie ein ganz normaler Kerl aus.
Die Sekretärin schien jedoch anderer Meinung zu sein. Als er im Büro auftauchte und sich als Mathias Jorik vorstellte, hatte sie sofort bemerkt, dass er breite Schultern, große Hände und schmale Hüften besaß. Und Muskeln an genau den richtigen Stellen. Jetzt fiel ihr eine leicht schiefe Nase auf, ein Killermund und aggressiv hervortretende Wangenknochen. Sein dichtes, welliges braunes Haar wurde durch den straffen Kurzhaarschnitt nur mäßig gebändigt, und das kräftige, eckige Kinn schien zu sagen: »Hau mir ruhig eine rein, wenn du dich traust.« Da sie übermäßig maskuline Männer eher irritierend als attraktiv fand, merkte sie erst, nachdem sie ihrem Boss den angeforderten Umschlag übergeben und in ihr Vorzimmer zurückgekehrt war, was ihr an diesem Exemplar so angenehm auffiel. In diesem scharfen, schiefergrauen Blick leuchtete eine beunruhigend wache Intelligenz.
Der Anwalt musterte kurz den Inhalt des Umschlags und sah dann wieder zu Mat auf. »Sie geben zu, dass Ihre Ex-Frau mit dem älteren Mädchen schwanger war, als Sie sie heirateten.«
»Muss ich’s wirklich noch mal sagen? Sandy hat mir weisgemacht, dass es mein Kind ist, und ich hab ihr geglaubt, bis eine ihrer Freundinnen ein paar Wochen nach der Heirat mit der Wahrheit herausrückte. Daraufhin hab ich Sandy zur Rede gestellt, und sie hat zugegeben, dass alles gelogen war. Ich bin zu’nem Anwalt gegangen und fertig!« Er konnte sich noch gut erinnern, wie erleichtert er gewesen war, noch einmal mit heiler Haut davongekommen zu sein.
Der Wurm warf den nächsten Blick in seine Unterlagen. »Sie haben ihr jahrelang Geld überwiesen.«
So sehr Mat auch den Bösen markierte, die Leute fanden immer früher oder später heraus, was für ein weiches Herz er hatte; außerdem gefiel es ihm nicht, dass ein Kind für das schlechte Urteilsvermögen seiner Mutter büßen sollte. »Reine Sentimentalität. Sandy hatte’n gutes Herz; sie war bloß nicht sehr wählerisch, was ihre Bettgenossen betraf.«
»Und Sie behaupten, Sie hätten sie seit der Scheidung nicht mehr gesehen?«
»Ich behaupte es nicht nur, es stimmt. Seit fast fünfzehn Jahren nicht mehr. Kaum möglich also, dass ich der Vater des zweiten Kindes sein soll, das sie letztes Jahr bekommen hat.« Wieder ein Mädchen. Sein ganzes Leben bestand aus einer einzigen Weiberwirtschaft.
»Warum steht dann Ihr Name auf beiden Geburtsurkunden?«
»Das müssten Sie schon Sandy fragen.« Aber Sandy würde niemand mehr was fragen. Vor sechs Wochen war sie mit ihrem Freund bei einem Autounfall umgekommen – beide in betrunkenem Zustand. Da Mat sich auf Reisen befand, hatte er erst vor drei Tagen davon erfahren, als er endlich auf den Gedanken gekommen war, mal seine Mailbox abzuhören.
Es waren noch andere Nachrichten drauf gewesen. Eine von einer Ex-Flamme, eine andere von einem Bekannten, der sich Geld von ihm borgen wollte. Ein Kumpel aus Chicago rief an, um zu fragen, ob Mat wieder in die Windy City zurückzuziehen gedachte, damit er ihn bei seinem alten Eishockeyverein anmelden könnte. Vier seiner sieben Schwestern wollten mit ihm reden, was nichts Neues war, da er sich schon seit seiner Kindheit in diesem rauen Slowakenviertel um sie kümmerte.
Mat war das einzig verbliebene männliche Wesen, nachdem sich sein Vater aus dem Staub gemacht hatte. Die Großmutter kümmerte sich um den Haushalt, während seine Mutter fünfzig Stunden pro Woche als Buchhalterin arbeitete. Das bedeutete, dass der neunjährige Mat für seine sieben jüngeren Schwestern zuständig war, darunter ein Zwillingspärchen. Aber er kämpfte sich durch und hasste seinen Vater dafür, dass er das getan hatte, was Mat nicht konnte – einem Horrorleben voller Weiber den Rücken kehren.
Die letzten Jahre, die er in diesem Tollhaus zubringen musste, gestalteten sich besonders schlimm. Sein Vater war nämlich inzwischen verstorben und hatte ihm somit jede Hoffnung auf eine Rückkehr und Entlastung von den verhassten Pflichten genommen. Die Mädchen wurden größer und immer unberechenbarer. Ständig bekam eine ihre Periode oder hatte sie gerade oder musste sich davon erholen. Oder kam nachts schluchzend zu ihm ins Zimmer, weil ihre Periode ausgeblieben war und er ihr nun sagen sollte, was, zum Teufel, zu tun sei. Zwar liebte er seine Schwestern, aber die Verantwortung für sie empfand er dennoch wie einen Strick um den Hals. Er schwor sich, sobald er das alles hinter sich gelassen hatte, würde er dem Familienleben ewiglich den Rücken kehren. Und bis auf den blöden Ausrutscher mit Sandy hatte er sich bis jetzt auch daran gehalten.
Die letzte Nachricht in seiner Mailbox stammte von Sid Giles, dem Produzenten von Byline, mit der nochmaligen dringenden Bitte, doch zu der Klatsch-und-Tratsch-Sendung nach L. A. zurückzukommen, der er vor einem Monat entronnen war. Doch Mat Jorik hatte seine Glaubwürdigkeit als Journalist einmal verkauft und würde es nie wieder tun.
»… als Erstes müssten Sie mir eine Kopie Ihrer Scheidungsurkunde übersenden. Ich brauche einen Nachweis für Ihre Scheidung.«
Nun wandte er seine Aufmerksamkeit wieder dem Anwalt zu. »Den Nachweis habe ich, aber es wird’n Weilchen dauern, bis Sie ihn kriegen.« Vor lauter Eile, Los Angeles zu verlassen, hatte er sogar vergessen, sein Schließfach zu leeren. »Ein Bluttest geht schneller. Ich erledige das noch heute Nachmittag.«
»DNA-Testergebnisse liegen erst nach mehreren Wochen vor. Im Übrigen brauchen Sie eine behördliche Erlaubnis, um die Kinder einem solchen Test zu unterziehen.«
Vergiss es! Mat hatte nicht die Absicht, sich von diesen Geburtsurkunden in den Arsch beißen zu lassen. Obwohl es ihm ein Leichtes war, die Scheidung zu beweisen, wollte er das Ganze dennoch durch die Bluttests untermauert wissen. »Die Erlaubnis erteile ich.«
»Sie können nicht beides haben, Mr. Jorik. Entweder es sind Ihre Kinder oder nicht.«
Mat beschloss, auf der Stelle in die Offensive zu gehen. »Erklären Sie mir doch bitte mal, wieso es überhaupt zu diesem Schlamassel kommen konnte. Sandy ist seit sechs Wochen tot – wieso machen Sie mir erst jetzt davon Mitteilung?«
»Weil ich’s selbst erst vor ein paar Tagen erfahren habe. Ich bin mit ein paar Urkunden in den Fotoladen gegangen, in dem sie arbeitete, und erst dort kam heraus, was mit ihr passiert ist. Man hat mich, obwohl ich ihr Anwalt bin, nicht informiert.«
Für Mat war es schon ein Wunder, dass Sandy überhaupt einen Anwalt gehabt, geschweige denn sich die Mühe gemacht und ein Testament aufgesetzt hatte.
»Ich bin sofort zu ihrem Haus gefahren und habe mit dem älteren Mädchen gesprochen. Sie sagte, eine Nachbarin würde sich um sie kümmern, aber von einer Nachbarin war keine Spur. Seitdem war ich noch zweimal dort und habe nie einen Erwachsenen gesehen, der sich mit den Kindern befasst hätte.« Er trommelte auf seine gelbe Schreibunterlage und schien nachzudenken. »Wenn Sie sie auch nicht übernehmen wollen, dann werde ich wohl oder übel das Jugendamt einschalten müssen, damit die Mädchen in eine Pflegefamilie kommen.«
Alte Erinnerungen senkten sich auf Mat wie die Rußwolken der Stahlfabrik, in deren Nähe er aufgewachsen war. Nein, hielt er sich vor Augen, es gab viele wundervolle Pflegefamilien – warum also sollten Sandys Töchter bei Bestien wie den Havlovs landen? Die Havlovs hatten nebenan gewohnt, als Mat klein war. Der Vater hatte praktisch permanent keine Arbeit, und die Familie schlug sich durch, indem sie Pflegekinder aufnahmen, die sie so sehr vernachlässigten und misshandelten, dass sich Mats Großmutter und ihre Freunde gezwungen sahen, sie immer wieder durchzufüttern und zusammenzuflicken.
Nein, er musste jetzt an seine eigenen Probleme denken und durfte sich nicht durch die Vergangenheit beeinflussen lassen. Wenn er nicht von vornherein klarstellte, dass er nicht der Vater der beiden Mädchen war, konnte ihm das Ganze eventuell monatelang oder noch länger wie ein Klotz am Bein hängen. »Warten Sie noch ein paar Stunden mit dem Anruf! Ich möchte erst mal die Lage checken.«
Der Anwalt schien erleichtert zu sein; aber Mat hatte lediglich vor, sich die Kids zu schnappen und mit ihnen ins nächste Labor zu kutschieren, bevor das Jugendamt sie unter seine Fittiche nahm und er durch eine Flut von Anträgen waten musste.
Erst als er bereits zu Sandys Haus unterwegs war – der Anwalt hatte ihm den Weg dorthin beschrieben – kam ihm der Gedanke an die Mutter seiner Ex-Frau. Sie war, soweit er sich erinnern konnte, noch relativ jung gewesen und außerdem verwitwet. Er war ihr nur einmal begegnet, aber sehr beeindruckt von ihr gewesen – eine Professorin an einem College in Missouri oder sonstwo, die kaum etwas mit ihrer wilden, ungebärdigen Tochter gemein zu haben schien.
Er griff nach seinem Handy, um den Anwalt anzurufen, doch da tauchte die gesuchte Straße vor ihm auf, und er legte das Telefon wieder weg. Ein paar Minuten später stellte er seinen Mercedes SL 600, ein Zweisitzer-Sportcoupé, das er sich von seinen Silberlingen gekauft hatte, vor einem schäbigen kleinen Bungalow ab, der in einer ebenso schäbigen Gegend lag. Der Wagen war viel zu klein für ihn – aber er hatte sich zu der Zeit nicht nur diesbezüglich etwas vorgemacht – also hatte er den Scheck ausgeschrieben und sich in die Karre hineingezwängt. Die Kiste wieder loszuwerden stand als Nächstes auf seiner Liste.
Während er auf das Haus zuschritt, nahm er die abblätternde Fassade, den rissigen Zugang und das heruntergekommene gelbe Wohnmobil wahr, das neben dem unkrautüberwucherten Vorgarten parkte. Typisch Sandy, ihr Geld für ein Wohnmobil auszugeben, wo das Haus um sie herum zusammenfiel!
Er stakste auf sein Ziel zu, stieg eine schiefe Treppe zur Veranda hinauf und schlug dann ohne Federlesens mit der Faust an die Tür. Eine mürrisch dreinblickende, sehr junge Version von Winona Ryder erschien. »Yeah?«
»Ich bin Mat Jorik.«
Sie verschränkte die Arme und lehnte sich an den Türknauf. »Na, wenn das nich der gute alte Paps is!«
So stand die Sache also.
Ihr Gesicht unter dem pfundweisen Make-up war feinknochig und zart. Brauner Lippenstift verkleisterte ihren jungen Mund. Ihre Wimpern waren derart stark getuscht, dass es aussah, als wären schwarze Tausendfüßler darauf gelandet, und ihr kurzes braunes Haar glänzte am Oberkopf von lila Spray. Alte abgewetzte Jeans hingen tief an ihren schmalen Hüften und gaben mehr von ihren hervortretenden Rippen und ihrem Bauch frei, als ihm lieb war; ihre mickrigen, vierzehnjährigen Brüste brauchten den schwarzen BH eigentlich nicht, der unter dem tiefen Ausschnitt ihres kurzen, engen Oberteils hervorblitzte.
»Wir müssen reden.«
»Es gibt nichts zu reden.«
Mat blickte in ihr kleines, trotziges Gesicht hinunter. Winona wusste es nicht, aber sie konnte nichts sagen, was er nicht bereits von seinen Schwestern kannte. Er musterte sie mit dem Blick, mit dem er Ann Elizabeth, die Schlimmste seiner Angehörigen, immer zur Räson gebracht hatte. »Lass mich sofort rein.«
Er sah, wie sie versuchte, ihren Mut zu mobilisieren, um sich ihm entgegenzustellen, aber dann gab sie doch auf und trat beiseite. An ihr vorbei rauschte er ins Wohnzimmer. Es war heruntergekommen, aber sauber. Auf einem Tisch lag aufgeschlagen ein eselsohriges Exemplar eines Säuglingspflegeratgebers. »Hab gehört, ihr seid schon’ne Weile auf euch allein gestellt …«
»Sind wir nich! Connie is bloß kurz einkaufen gegangen. Sie is die Nachbarin, die sich um uns kümmert.«
»Dass ich nicht lache!«
»Willst du damit sagen, dass ich lüge?«
»Yep.«
Das gefiel ihr mitnichten, aber was sollte sie schon dagegen tun?
»Wo ist das Baby?«
»Mittagsschläfchen.«
Sie sah Sandy überhaupt nicht ähnlich, bis auf die Augen vielleicht. Sandy war alles andere als zierlich gewesen, robust und kurvig, mit einem überschwänglichen Lachen, einem großen Herzen und einem beachtlichen Verstand, den sie von ihrer Mutter geerbt haben musste, aber leider kaum benutzte.
»Was ist mit deiner Oma? Warum passt sie nicht auf euch auf?«
Die Kleine begann an einem abgekauten Daumennagel zu knabbern. »Sie is in Australien und studiert die Aborigines. Is’ne Collegeprofessorin.«
»Sie ist nach Australien gereist, obwohl sie wusste, dass ihre Enkelinnen ganz auf sich allein gestellt sind?« Er gab sich keine Mühe, seine Skepsis zu verbergen.
»Connie hat sich …«
»Hör auf mit dem Unsinn! Es gibt keine Connie, und wenn du mich dauernd weiter anlügst, dann telefonier ich mit dem Jugendamt, die holen euch innerhalb einer Stunde ab.«
Sie rang mit den Tränen. »Wir brauchen niemanden, der sich hier reinmischt! Uns geht’s prima. Wieso kümmerst du dich nicht um deinen eigenen Scheißdreck?«
Als er in ihr trotziges kleines Gesicht blickte, musste er an all die Kinder denken, die sich damals bei den Nachbarn die Klinke in die Hand gegeben hatten. Ein paar von ihnen waren entschlossen gewesen, der Welt ins Gesicht zu spucken, nur um ein paar Ohrfeigen für ihre Mühen zu kassieren. Seine Stimme klang etwas sanfter, als er nun sagte: »Erzähl mir von deiner Oma.«
Schulterzuckend begann sie: »Sandy und sie sind nich gut miteinander ausgekommen. Weil Sandy immer gesoffen hat und so. Die Oma weiß nix von dem Autounfall.«
Irgendwie überraschte es ihn nicht, dass sie Sandy bei ihrem Vornamen nannte. Das war genau das, was er von seiner Ex-Frau erwartet hätte, aus der tatsächlich eine Alkoholikerin geworden zu sein schien. Nun, die Ansätze konnte man damals schon kaum übersehen. »Willst du damit sagen, dass deine Oma keine Ahnung hat, was mit Sandy passiert ist?«
»Jetzt schon. Ich hatte ihre Telefonnummer nich und konnte sie also nich anrufen, aber vor ein paar Wochen hat sie mir’nen Brief mit einem Foto vom Outback geschickt. Also hab ich ihr zurückgeschrieben und ihr von Sandy, dem Autounfall und von Trent erzählt.«
»Wer ist Trent?«
»Der Vater meiner kleinen Schwester. Er is’n Arschloch … na, jedenfalls auch bei dem Unfall gestorben, und es tut mir kein bisschen Leid!«
Ja, richtig, Sandys Freund war bei dem Unfall dabei gewesen – und offensichtlich der Vater des Babys. Sandy musste sich alles andere als sicher gewesen sein, oder Trents Name wäre auf der Geburtsurkunde des Babys aufgetaucht … statt seines eigenen. »Hatte dieser Trent irgendwelche Angehörigen?«
»Nö. Er kam aus Kalifornien und ist in Pflegefamilien groß geworden.« Trotzig reckte sie ihr kleines Kinn. »Und er hat mir alles darüber erzählt, und meine Schwester und ich gehen da nich hin, also vergiss es! Außerdem müssen wir gar nich, weil ich ja diesen Brief von meiner Oma gekriegt hab und sie bald wieder da sein wird.«
Misstrauisch musterte er die Göre. »Zeig mir diesen Brief!«
»Glaubst du mir nich?«
»Nun ja, ein kleiner Beweis könnte nicht schaden.«
Sie betrachtete ihn mürrisch und verschwand dann in der Küche. Seiner Ansicht nach log sie, und es überraschte ihn daher, als sie kurz darauf mit einem Brief, auf dem das Siegel des Laurents College in Willow Grove, Iowa, prangte, zurückkam. Er musterte die saubere Handschrift.
Habe Deinen Brief soeben erhalten, mein Schatz. Es tut mir so Leid. Ich fliege am fünfzehnten oder sechzehnten Juli nach Iowa zurück, je nachdem, welchen Flug ich bekomme. Sobald ich da bin, melde ich mich und werde alles Nötige veranlassen. Macht Euch keine Sorgen. Das kommt schon in Ordnung.
Love, Granny Joanne
Mat runzelte die Stirn. Heute war Dienstag, der elfte. Wieso hatte Granny Joanne nicht sofort ihre Aufzeichnungen zusammengepackt und den nächsten Heimflug genommen?
Nun, es war schließlich nicht sein Problem. Er wollte nur diese Bluttests, ohne dabei für irgendeinen Bürohengst durch endlose Reifen springen zu müssen. »Pass auf. Jetzt hol mal deine Schwester. Ich kauf euch beiden ein Eis. Wir halten bloß kurz bei einem Labor an.«
Ein Paar intelligenter brauner Augen blickten ihn durchdringend an. »Was für ein Labor?«
Er versuchte, es möglichst beiläufig klingen zu lassen. »Wir drei werden uns ein bisschen Blut abnehmen lassen, das ist alles.«
»Mit einer Spritze?«
»Ich weiß nicht, wie sie’s machen«, log er. »Jetzt hol schon die Kleine.«
»Fick dich ins Knie! Ich lass mir von keinem’ne Spritze reinjagen.«
»Halt dein freches Mundwerk!«
Sofort bedachte sie ihn mit einem sowohl herablassenden als auch verächtlichen Blick, als wäre er ein absoluter Trottel und der Allerletzte, der das Recht hatte, ihre Ausdrucksweise zu kritisieren. »Du hast mir nichts vorzuschreiben.«
»Los, hol das Baby!«
»Kannste vergessen!«
Das Ganze war den Streit nicht wert, also machte er sich selbst auf den Weg durch einen mit einem abgetretenen grauen Teppich ausgelegten Gang, von dem aus auf jeder Seite eine Tür in ein Schlafzimmer führte. Das eine war offensichtlich Sandys gewesen. Im anderen befand sich eine ungemachte Liege und ein Gitterbettchen. Ein Wimmern ertönte.
Das Bettchen war zwar alt, aber sauber. Auf dem Teppich lag keinerlei Staub, und in einem blauen Wäschekorb befanden sich einige Spielsachen. Auf einem wackeligen Wickeltisch lag adrett gefaltet ein Stapel Babykleidung, daneben eine Tüte mit Einwegwindeln.
Aus dem Wimmern wurde ein ausgewachsener Protest. Er trat näher und sah einen rosa Hosenboden aus den Decken in die Luft ragen. Dann tauchte plötzlich ein Köpfchen mit einem kurzen, glatten blonden Haarschopf auf. Er blickte in ein wütendes, rotwangiges Gesicht mit einem nassen, offenen Mündchen, aus dem zornige Schreie hervorquollen. Wie in seiner Kindheit …
»Reg dich ab, Püppchen!«
Die Schreie des Babys hörten abrupt auf, und ein Paar himmelblauer Augen blickten ihn misstrauisch an. Gleichzeitig nahm er einen penetranten Geruch wahr, und ihm wurde klar, dass ein Tag, der seiner Meinung nach nicht schlimmer werden konnte, offenbar doch noch so einiges in petto hatte.
In seinem Rücken bewegte sich etwas, und er sah das Winona-Double, an einem weiteren Fingernagel kauend, im Türrahmen stehen. Sie verfolgte jede seiner Bewegungen, und die Blicke, mit denen sie das Kinderbettchen bedachte, verrieten ihren starken Beschützerinstinkt. Die Kleine war nicht halb so tough, wie sie tat.
Mit einer ruckartigen Kopfbewegung wies er auf das Baby. »Sie braucht’ne frische Windel. Ich warte im Wohnzimmer auf dich.«
»Spinnst du? Ich fass doch keine vollgeschissene Windel an!«
Da sie sich schon seit Wochen um das Baby kümmerte, war das eine glatte Lüge – aber falls sie von ihm erwartete, das zu übernehmen, hatte sie sich geschnitten. Als er damals dem Weibertollhaus entkommen war, hatte er sich geschworen, nie wieder eine Windel zu wechseln, sich keine einzige Barbiepuppe mehr anzusehen und auch keine verdammte Haarschleife mehr zu binden. Aber das Mädel hatte Mumm, also wollte er ihr’s ein wenig leichter machen. »Ich geb dir fünf Piepen.«
»Zehn. Im Voraus!«
Wenn er nicht in einer so üblen Laune gewesen wäre, hätte er vielleicht gelacht. Nun, sie hatte nicht nur Mumm, sondern war obendrein nicht auf den Kopf gefallen. Er holte seine Brieftasche heraus und reichte ihr das Geld. »Komm raus zu meinem Auto, wenn du fertig bist. Und bring sie mit.«
Mit ihrer gerunzelten Stirn glich sie einen Augenblick lang eher einer besorgten Fußballermama als einem mürrischen weiblichen Teenager. »Haste’nen Kindersitz?«
»Seh ich so aus, als würd ich mit einem Kindersitz rumgondeln?«
»Babys müssen in Kindersitze. Das ist Vorschrift!«
»Biste’n Bulle?«
Sie legte den Kopf schief. »Ihr Sitz is in Mabel. Dem Wohnmobil. Sandy hat es Mabel genannt.«
»Hatte deine Mutter denn kein Auto?«
»Der Händler hat’s ihr ein paar Monate vor ihrem Unfall wieder weggenommen, also ist sie mit Mabel gefahren.«
»Na toll!« Er wollte gar nicht wissen, wie sie in den Besitz des heruntergekommenen Wohnmobils gelangt war. Lieber zerbrach er sich den Kopf darüber, wie er einen Teenager, ein Baby und einen Autositz in sein Sportcoupé kriegen sollte. Antwort: gar nicht.
»Gib mir die Wagenschlüssel.«
Er sah, dass sie ihm gerne noch mal frech gekommen wäre, es sich in letzter Sekunde aber anders überlegte. Sehr weise.
Mit den Wagenschlüsseln in der Hand marschierte er hinaus, um sich mit Mabel vertraut zu machen. Auf dem Weg dorthin holte er sein Handy und die Zeitung aus dem Auto, die zu lesen er bis jetzt noch nicht eine Sekunde Zeit hatte.
Er musste sich bücken, um in das Wohnmobil reinzukommen, das zwar geräumig war, aber nicht geräumig genug für einen Zwei-Meter-zwei-Mann. Sobald er hinterm Steuer saß, rief er einen befreundeten Arzt in Pittsburgh an, um von ihm den Namen eines nahen Labors und die nötige Genehmigung zu erhalten. Während er am Telefon wartete, schlug er die Zeitung auf.
Wie die meisten Journalisten war er auf Sensationen aus, aber nichts Ungewöhnliches stach ihm ins Auge. Ein Erdbeben in China, eine Autobombe im Mittleren Osten, Budget-Gezänk im Kongress, noch mehr Probleme im Balkan. Ganz unten stieß er auf ein Bild von Cornelia Case, die wieder einmal ein krankes Baby auf dem Arm hielt.
Obwohl er nie zur Fanschar von Cornelia gehört hatte, stellte er fest, dass sie auf jedem Foto dünner aussah. Die First Lady hatte spitzenmäßige blaue Augen, die aber allmählich zu groß für ihr dünnes Gesichtchen wurden und die Tatsache, dass sich keine richtige Frau dahinter verbarg, bloß eine äußerst clevere Politikerin und Marionette ihres Vaters, nicht mehr verbergen konnten.
In seiner Zeit bei Byline hatten sie ein paar Sendungen über Cornelia gemacht – ihr Friseur, ihr Modestil, wie sie das Vermächtnis ihres ermordeten Gatten ehrte – all so blöder Kitschkram. Trotzdem tat sie ihm Leid. Wenn einem der Mann vor der Nase über den Haufen geschossen wird, ist es schwer, eine souveräne Fassade aufrechtzuerhalten.
Mit einem Stirnrunzeln dachte er an sein Jahr beim Klatsch-und -Tratsch-Fernsehen. Davor war er ein seriöser Zeitungsjournalist gewesen, einer der am meisten geschätzten Reporter Chicagos; aber er hatte seinen guten Ruf wegen eines Haufens Geld im Klo runtergespült, Geld, an dem er, wie er feststellte, gar keinen Spaß hatte. Jetzt interessierte es ihn nur noch, seinen Ruf wieder reinzuwaschen.
Mats Idole waren nicht Ivy-League-Journalisten, sondern Kerle, die ihre solide recherchierten Storys mit zwei Fingern in ihre Remington-Schreibmaschinen hackten. Kerle, die ebenso rau um die Kanten waren wie er. Seine Arbeit beim Chicago Standard hatte nichts Glamouröses gehabt. Mit kurzen Worten und einfachen Sätzen beschrieb er die Leute, denen er begegnete, ihre Träume und Sorgen. Die Leser wussten, dass er ihnen nichts vormachte. Und jetzt hatte er sich auf einen Kreuzzug begeben, um zu beweisen, dass er wieder der Alte war.
Ein Kreuzzug! Das Wort besaß etwas geradezu Archaisches. Auf einen Kreuzzug brachen Ritter in schimmernden Rüstungen auf, nicht ein Proletarierbursche aus einer Stahlarbeiterstadt, der eine Zeit lang vergessen hatte, was im Leben wirklich zählte.
Sein alter Boss beim Standard meinte, Mat könne seinen ehemaligen Job wiederhaben, aber das Angebot war widerwillig erfolgt, und Mat weigerte sich, mit dem Hut in der Hand zurückzukommen. Also fuhr er kreuz und quer durchs Land, auf der Suche nach etwas, mit dem er aufwarten konnte. Wann immer er anhielt – ob Kleinstadt oder Großstadt -, er kaufte sich eine Zeitung, redete mit den Leuten und schnüffelte ein bisschen herum. Auch wenn er sie noch nicht gefunden hatte, er wusste genau, wonach er suchte – den Anfang einer Story, die groß genug werden konnte, um sich damit seinen einstigen Ruf zurückzuerobern.
Gerade war er fertig mit Telefonieren, als die Tür aufging und Winona mit dem Baby auf dem Arm ins Wohnmobil kletterte. Es war barfuß und trug einen gelben Strampler mit Lämmchen drauf. An seinem molligen kleinen Fußgelenk prangte das Peace-Zeichen.
»Sandy hat das Püppchen tätowieren lassen?«
Winona maß ihn mit einem Blick, der sagte, dass er zu blöd war, um auf der Welt zu sein. »Es ist’n Abziehbild. Hast du denn von überhaupt nichts’ne Ahnung?«
Seine Schwestern waren glücklicherweise schon groß, als es mit dem Tätowieren und Piercen losging. »Ich wusste, dass es ein Abziehbild ist«, log er. »Aber meiner Ansicht nach ist so was nichts für ein Baby.«
»Es gefällt ihr. Sie findet, dass sie damit cool aussieht.« Winona platzierte das Baby vorsichtig im Kindersitz, schnallte es fest und ließ sich dann auf den Beifahrersitz neben Mat plumpsen.
Nach ein paar vergeblichen Versuchen sprang das Gefährt stotternd an. Angewidert schüttelte er den Kopf. »Was für ein Schrotthaufen!«
»Was de nich sagst!« Sie legte ihre Füße, die in Sandalen mit diesen dicken Sohlen steckten, aufs Armaturenbrett.
Er warf einen Blick in Mabels Seitenspiegel und stieß rückwärts aus dem Grundstück. »Du weißt hoffentlich, dass ich nicht dein richtiger Vater bin.«
»Als ob ich einen wie dich haben will!«
Soviel zu seiner Sorge, sie könnte sich ein paar sentimentale Fantasien über ihn zusammengesponnen haben. Während er dahinfuhr, kam ihm der Gedanke, dass er weder ihren noch den Namen des Babys wusste. Er hatte die Kopien ihrer Geburtsurkunden zwar gesehen, doch sein Blick war an der Zeile mit seinem Namen hängengeblieben. Wahrscheinlich wäre sie nicht gerade erfreut, wenn er sie Winona nennen würde. »Wie heißt du?«
Es folgte eine Pause, während sie überlegte. »Natascha.« Beinahe hätte er gelacht. Seine Schwester Sharon war ihnen mal drei Monate lang damit auf die Nerven gegangen, dass sie »Silver« genannt werden wollte. »Na, klaro!«
»So will ich aber heißen«, fauchte sie.
»Ich hab dich nicht gefragt, wie du heißen willst, sondern wie du heißt.«
»Lucy, okay? Und ich hasse den Namen.«
»Finde ich aber ganz in Ordnung.« Er warf einen Blick auf die Wegbeschreibung, die ihm die Labor-Rezeptionistin gegeben hatte, und fuhr erneut auf den Highway. »Wie alt bist du eigentlich?«
»Achtzehn.«
Er spießte sie wieder mit seinem Mörderblick auf.
»Also gut, sechzehn.«
»Du bist vierzehn und hast’ne Klappe wie eine Dreißigjährige!«
»Wieso fragst du, wenn du’s schon weißt? Und ich bin bei Sandy aufgewachsen. Was erwartest du also?«
Mitleid durchfuhr ihn beim heiseren Klang ihrer Stimme. »Na ja, tut mir Leid. Deine Mutter war …« Sandy war lebenslustig gewesen, sexy, klug, aber total unvernünftig und außerdem vollkommen verantwortungslos. »… einzigartig«, beendete er ein wenig lahm seinen Satz.
Lucy schnaubte. »Sie hat gesoffen!«
Das Baby hinten begann zu wimmern.
»Sie muss bald was zu essen kriegen, und wir haben nichts mehr.«
Na toll! Das hatte ihm gerade noch gefehlt. »Was isst sie denn so?«
»Na, sie kriegt ihr Fläschchen mit Milchbrei und isst auch schon so Zeug aus dem Gläschen.«
»Wir besorgen was, wenn wir im Labor waren.« Die Laute aus dem Wagenrückteil wurden zunehmend unglücklicher. »Wie heißt sie?«
Eine neuerliche Pause. »Butt.«
»Du bist’n richtiger Spaßvogel, stimmt’s?«
»Ich hab ihr den Namen nich gegeben.«
Er warf einen Blick in den Rückspiegel auf den rotwangigen kleinen Wonneproppen mit den Bonbonaugen und dem engelsgleichen Mündchen. Dann blickte er wieder Lucy an. »Du willst mir weismachen, dass Sandy ihr Baby Butt, also Hintern, genannt hat?«
»Is mir egal, ob du’s glaubst oder nicht.« Sie zog ihre Füße vom Armaturenbrett. »Und ich lass mir nich von irgendeinem Arschloch’ne Spritze reinjagen, also vergiss diesen blöden Bluttest.«
»Du tust, was ich dir sage.«
»Bullshit!«
»Jetzt pass mal auf, du Schandmaul! Deine Mutter hat meinen Namen auf beiden Geburtsurkunden als Kindsvater angegeben, das muss korrigiert werden, und die einzige Möglichkeit ist ein Bluttest.« Eigentlich wollte er sagen, dass sich das Jugendamt bis zum Auftauchen ihrer Großmutter um sie kümmern würde, was er aber nicht übers Herz brachte. Dafür war der Anwalt zuständig.
Den Rest des Wegs zum Labor absolvierten sie schweigend, begleitet nur vom immer wütender werdenden Plärren des kleinen Balgs. Er hielt vor einem zweistöckigen Gebäude an und wandte sich dann Lucy zu. Sie starrte auf den Eingang, als wäre er das Tor zur Hölle.
»Ich geb dir zwanzig Piepen, wenn du den Test machst«, sagte er rasch.
Sie schüttelte den Kopf. »Keine Spritzen! Ich hasse Spritzen. Mir wird schon schlecht, wenn ich bloß dran denke.«
Gerade überlegte er, wie er zwei brüllende Kinder ins Labor schleppen sollte, als ihn zum ersten Mal an diesem Tag das Glück ereilte.
Lucy schaffte es aus dem Wohnmobil, bevor sie sich draußen erbrach.
4
Sie war unsichtbar! Herrlich, himmlisch unsichtbar! Laut lachend warf Nealy den Kopf zurück und drehte das Radio auf, um zusammen mit Billy Joel in den Refrain von »Uptown Girl« einzustimmen. Der neue Tag war einfach atemberaubend. Zarte weiße Schleierwolken zierten einen Georgia-O’Keeffe-blauen Himmel, und ihr Magen knurrte, trotz der großen Portion Rührei auf Toast, die sie in dem kleinen Restaurant nicht weit von ihrem Übernachtungsmotel zum Frühstück verschlungen hatte. Die fettigen Eier, der lasche Toast und der schlammige Kaffee erschienen ihr das köstlichste Mahl seit langer Zeit. Jeder Bissen war spielend ihre Kehle hinuntergerutscht, und niemand hatte ihr auch nur einen zweiten Blick geschenkt.
Sie war schlau, raffiniert und überaus zufrieden mit sich selbst. Alle hatte sie sie hinters Licht geführt: den Präsidenten der Vereinigten Staaten, den Secret Service und sogar ihren Vater. Ein Hoch auf die große Feldherrin!
Entzückt lachte sie über ihre eigene Unverschämtheit – schon seit langem war ihr nicht mehr so zumute gewesen. Nealy wühlte in ihrer Tasche auf dem Beifahrersitz nach dem Snickers, das sie gekauft hatte, bis ihr einfiel, dass ja auch das bereits nicht mehr existierte. Ihr Hunger brachte sie zum Lachen. Ein Leben lang hatte sie von einer kurvenreichen Figur geträumt. Vielleicht würde sie sie ja nun kriegen.
Im Rückspiegel sah sie ihr Konterfei. Auch ohne die grauhaarige Perücke hatte niemand sie erkannt. Sie hatte sich in eine ganz normale Person verwandelt. Eine herrlich, paradiesisch normale Person!
Im Radio kam Werbung. Sie drehte die Lautstärke herunter und begann zu summen. Den ganzen Vormittag bummelte sie bereits über die Landstraße westlich von York, Pennsylvania, das zufälligerweise die erste Hauptstadt der Nation und auch der Ort gewesen war, an dem die Verfassung geschrieben wurde. Wann immer es ihr in den Sinn kam, fuhr sie von der Landstraße ab und erkundete die idyllischen Ortschaften. Einmal fuhr sie an den Straßenrand, um ein Sojabohnenfeld zu bewundern, obwohl sie, während sie am Zaun lehnte und ihre Blicke schweifen ließ, nicht anders konnte, als über das komplexe landwirtschaftliche Subventionssystem und seine Auswirkungen nachzudenken. Danach hielt sie an einem ärmlichen Farmhaus an, an dem ein Schild mit der Aufschrift ANTIQUITÄTEN hing, und stöberte eine wundervolle Stunde lang in all dem Staub und Kitsch herum. Folglich war sie noch nicht sehr weit gekommen. Aber es erwartete sie ja auch niemand, und sie fand es herrlich, so absolut ziellos herumzugondeln.
Wahrscheinlich gaukelte sie sich ihr Glück nur vor, wo doch der Präsident zweifellos die ganze ihm zur Verfügung stehende Macht des Regierungsapparates einsetzte, um sie aufzuspüren – aber sie konnte einfach nicht anders. Nealy war nicht so naiv zu glauben, sie könnte ihnen auf ewig entschlüpfen … aber das machte jeden Augenblick nur umso kostbarer.