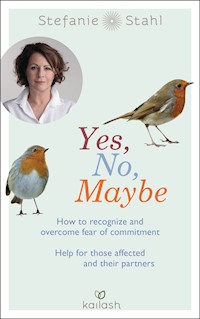17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
Bauplan für die Seele
Wie funktioniert der Mensch? Gibt es einen Bauplan für die Psyche, ein geistiges Grundgerüst, das alle Menschen teilen? Bestseller-Autorin Stefanie Stahl liefert faszinierende Einblicke in das Zusammenspiel von Wahrnehmung, Bewusstsein und Verhalten. Leichtfüßig und fundiert erklärt sie, warum Glücksgefühle unsere Lebensdroge sind, wie subjektiv die Wahrnehmung von der Welt ist und wie sich durch Erziehung und Erfahrungen das Selbstbild formt.
Spannende Protokolle aus der Therapiepraxis sowie wertvolle Impulse zur Lösung seelischer Konflikte machen diese Reise in unser Innerstes zu einem wahren Erlebnis.
Ein umfassender Einblick in unsere innere Schaltzentrale von Deutschlands Psychologin Nr. 1.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zum Buch
Wie funktioniert der Mensch? Gibt es einen Bauplan für die Psyche, ein geistiges Grundgerüst, das alle Menschen teilen? Bestseller-Autorin Stefanie Stahl liefert faszinierende Einblicke in das Zusammenspiel von Wahrnehmung, Bewusstsein und Verhalten. Leichtfüßig und fundiert erklärt sie, warum Glücksgefühle unsere Lebensdroge sind, wie subjektiv die Wahrnehmung von der Welt ist und wie sich durch Erziehung und Erfahrungen das Selbstbild formt.
Protokolle aus der Therapiepraxis und viele Impulse für Lösungen bei seelischen Konflikten machen diese Reise in unser Innerstes erleb- und umsetzbar.
Ein umfassender Einblick in unsere innere Schaltzentrale von Deutschlands Psychologin Nr. 1.
Zur Autorin
Stefanie Stahl, Diplom-Psychologin und Buchautorin in freier Praxis in Trier, ist Deutschlands bekannteste Psychotherapeutin. Sie hält regelmäßig Vorträge und Seminare zu ihren Spezialgebieten Beziehungen, Selbstwertgefühl und praxisnaher Psychologie. Mit ihrem Modell vom Sonnen- und Schattenkind hat sie eine besonders bildhafte Methode zur Arbeit mit dem inneren Kind erschaffen, die über die Grenzen Deutschlands hinaus auf große Resonanz stößt. Stefanie Stahls Bücher, allen voran »Das Kind in dir muss Heimat finden«, stehen seit Jahren auf den Top-Rängen der Bestsellerlisten und haben sich millionenfach verkauft.
Die Autorin ist eine begehrte Keynote Speakerin, hostet zwei Podcasts und wird regelmäßig als Expertin für Presse und Talkshows angefragt.
Weitere Informationen unter www.stefaniestahl.de
Wer wir sind
Wie wir wahrnehmen, fühlen und lieben
Alles, was Sie über Psychologie wissen sollten
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
© 2022 Kailash Verlag, München
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktionelle Mitarbeit: Julia Meyer-Hermann
Lektorat: Judith Mark
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
Covergestaltung: Daniela Hofner, ki 36 Editorial Design, München
Autorinnenfotos: © Susanne Wysocki
ISBN 978-3-641-29559-2V006
www.kailash-verlag.de
Gewidmet
Klaus Grawe (1943–2005), dem großartigen Psychotherapieforscher und Helena Muser, der großartigen Psychotherapeutin und Freundin
Inhalt
Der Bauplan der Psyche
Teil I: Wie wir »funktionieren« und was die Psychologie darüber weiß
Der Sinn des Lebens
Glücksgefühle sind unsere Lebensdroge
Das Konsistenzprinzip
Die Wahrnehmung
Wir sind unsere Erinnerung
Lernen und Erinnerung
Unser Selbstbild bestimmt, was wir wahrnehmen
Zusammenfassung: Unsere psychische Grundstruktur
Die vier psychischen Grundbedürfnisse
Es geht immer um Kontrolle
Wenn Kontrolle das Problem ist
Ich bin dem Leben gewachsen. Die internale Kontrollüberzeugung
Bindung: Die Basis des Lebens
Die mentale Landkarte und kindliche Bindungstypen
Unsichere Bindungsstile
Die unsicher-vermeidende Bindung: »Ich muss mich auf mich selbst verlassen«
Die unsicher-anklammernde Bindung: »Ich muss für Zuwendung kämpfen«
Auswirkungen der Bindungsstile
Bindung und Stressregulation
Die gute Balance zwischen Bindung und Autonomie
Fähigkeiten für die Bindung
Fähigkeiten für die Autonomie und Kontrolle
Zusammenfassung: Bindung und Autonomie als dynamisches System
Der Selbstwert – das Epizentrum unserer Psyche
Festhalten am geringen Selbstwert
Geringer Selbstwert und die Opferrolle
Ein geringer Selbstwert zum Schutz der Elternbindung
Geringer Selbstwert und dysfunktionale Beziehungen
Verlustangst und Bindungsangst
Lustgewinn und Unlustvermeidung
Die frühe Prägung von Annäherungs- und Vermeidungsverhalten
Motivation und Gene
Unsere Gefühle
Gefühl versus Verstand
Angst: ein wichtiges und ungeliebtes Gefühl
Die psychischen Abwehrmechanismen
Abwehr im Dienste der Bindung: Idealisieren und Schönreden
Abwehr im Dienste der Autonomie: Abwerten und Rationalisieren
Introjektion und Projektion
Die Selbstschutzstrategien
Selbstschutz im Dienste der Bindung
Selbstschutz im Dienste der Autonomie
Teil II: Fallgeschichten aus der psychotherapeutischen Praxis
Erklärung der Vorgehensweise
Alexa hält sich lieber klein
Hanna wechselt bei kleinsten Schwierigkeiten den Job
Torsten kann sich nicht zwischen zwei Frauen entscheiden
Anna kämpft mit ihrem Selbstwert und einer Essstörung
Charlotte ist superwütend auf ihre Mutter
Elisa macht Beziehungen kaputt
Stefan hat Angst, als Vater zu versagen
Birgit leidet an Panikattacken
Philipp wählt die falschen Partner aus
Sara lehnt ihr Kind ab
Christoph will Harmonie um jeden Preis
Elke leidet unter Wutausbrüchen
Harry verweigert »Gehorsam«
Teil III: Die wichtigsten Lösungsansätze der Psychotherapie
Die psychotherapeutische Beziehung
Erster Schritt: die vergangene von der gegenwärtigen Realität trennen
Die alte Prägung identifizieren
Das Erwachsenen-Ich stärken
Selbstannahme
Neue Glaubenssätze und ein neues Lebensgefühl
Zweiter Schritt: Zugang zu den Gefühlen schaffen
Gefühle wahrnehmen
Primäre und sekundäre Gefühle
Adaptive und maladaptive Emotionen
Emotionale Problemanalyse
Gefühle regulieren
Gefühle annehmen
Dritter Schritt: Metastrategien finden
Metastrategien für Überangepasste
Metastrategien für Autonome
Vierter Schritt: sich aus der Verstrickung lösen und dem Leben Sinn verleihen
Die drei Positionen der Wahrnehmung
Dem Leben Sinn geben
Schlusswort: Werde ein Teil der Gemeinschaft
Literaturverzeichnis
Danke!
Sachregister
Personenregister
Der Bauplan der Psyche
Es hat bei mir ganz früh angefangen. Schon als Kind habe ich öfter darüber nachgedacht, wie der Mensch wohl »funktioniert«. Warum regt die eine etwas auf, was den anderen völlig kaltlässt? Warum handelt der eine so und die andere so? Warum gibt es in meiner Klasse Streber und Faulpelze? Warum bin ich manchmal ohne erkennbaren Grund schlecht drauf? Und wie kann ich es schaffen, am besten immer gut gelaunt zu sein?
Ich wusste damals nicht, dass ich mir grundlegende psychologische Fragen stellte: Fragen dazu, wie wir uns selbst und andere Menschen wahrnehmen. Wonach wir streben und wovor wir Angst haben. Was wir meinen, wer wir sind und was wir tun müssen, um geliebt zu werden. Was uns motiviert und was uns hemmt. Ob wir morgens Lust auf einen neuen Tag haben oder uns lieber verkriechen würden. Was wir uns zutrauen oder auch nicht zutrauen. Wie wir uns selbst gestalten, unsere Beziehungen und unser Leben. Im Grunde genommen ist alles Psychologie – oder, wenn unser Ansatz bei diesen Fragen etwas abstrakter ist, dann ist alles auch Philosophie. Vielen erscheint diese alte denkerische Disziplin womöglich als wenig alltagstauglich oder sogar weltfremd. Tatsächlich beschäftigt sich die Philosophie aber seit jeher damit, Menschen bei der Lösung schwieriger Lebenssituationen zu helfen. Der Philosoph Wilhelm Schmid1, bekannt durch seine Besteller »Gelassenheit« oder »Selbstfreundschaft«, hat beispielsweise einen Ansatz, der sich mit meiner psychotherapeutischen Vorgehensweise vergleichen lässt: Er will dabei helfen, »ein Verständnis des Lebens zu gewinnen, das ermöglicht, die Situation einzuordnen und eine Haltung dazu zu finden«.
Wo fängt man da an? Ich beginne mit: Woraus besteht der Mensch denn eigentlich? Aus Körper und Geist. Bei Geist muss ich unwillkürlich an die doppelte Bedeutung des Wortes denken: Geist bedeutet auch Gespenst. Vielleicht ist das kein Zufall, beides lässt sich materiell schwer erfassen. Wenn ich jetzt einfach das Wort Geist durch Psyche ersetze – ohne mich in semantischen Erörterungen zu verlieren –, dann kann man sagen: Der Mensch besteht aus Körper und Psyche. Das Gehirn ist die materielle Substanz der Psyche.
Mich beschäftigt die Frage, wie wir psychisch strukturiert sind. Was ist der Bauplan der Psyche? Gibt es ein geistiges Grundgerüst, das alle Menschen teilen? Und aus welchen Komponenten besteht es?
Die wissenschaftliche Datenlage ist sehr komplex und vermittelt (noch) kein in sich geschlossenes Bild. Es gibt ein riesiges Spektrum an psychologischen Begriffen, Modellen, Theorien und Forschungsergebnissen. Diese Komplexität ergibt sich sowohl aus dem Umstand, dass die Psychologie sehr viele Teildisziplinen und somit sehr viele Forschungsfelder aufweist, als auch aus dem Umstand, dass sich im Verlauf ihrer Geschichte verschiedene psychologische Schulen ausgebildet haben. Diese Schulen vertreten unterschiedliche Lehrmeinungen über das grundsätzliche Bild des Menschen und bestimmen mithin auch wesentlich über die Forschungsinhalte und Methoden. Zu den bekanntesten Schulen gehören:
die Psychoanalysedie kognitive Psychologie, deren Erkenntnisse unter anderem in die sogenannte Verhaltenstherapie einfließendie humanistische Psychologie, aus der sich die Gesprächspsychotherapie entwickelt hatDie systemischen oder auch familientherapeutischen Modelle entwickelten sich später aus diesen drei Grundrichtungen.
Seit den 1990er Jahren gewinnt die neurowissenschaftliche Forschung immer mehr an Bedeutung, was auch mit der Weiterentwicklung medizinischer Untersuchungsmethoden einhergeht. Hierdurch kann man Gehirnprozesse viel genauer untersuchen. Wie funktioniert die menschliche Wahrnehmung? Wo entstehen Emotionen und wie werden sie verarbeitet? Welche Abläufe verfolgen Denkprozesse? Wie entsteht Motivation? Wie interagieren all diese Vorgänge miteinander? Die Neurowissenschaften haben uns viele Erkenntnisse zu den Abläufen im Gehirn geliefert. Allerdings können sie nur die Prozesse beschreiben, aber nicht die Bedeutung, die sie für die jeweilige Versuchsperson haben. Was denkt die Person gerade, was empfindet sie, wenn sie Musik hört, welche Erfahrungen haben sie geprägt?
Auch wurde bis heute kein Gehirnareal entdeckt, in dem unser Selbstwertempfinden verankert ist. Ebenso wenig lassen sich unsere psychischen Grundbedürfnisse nach Bindung und Autonomie bislang präzise im Gehirn verorten.
Kleiner Exkurs: Selbstbewusstsein und das Gehirn
Neurowissenschaftliche Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren gingen lange davon aus, dass drei Areale im Gehirn vorrangig am Selbstbewusstsein beteiligt sind: der insuläre, der vordere zinguläre und der mediale präfrontale Kortex. Die Forschung von US-Neurowissenschaftlern hat aber inzwischen gezeigt, dass auch diese Lokalisierung noch zu einfach scheint. Bei einem Patienten, dessen vermeintliche »Selbstbewusstseins-Areale« durch eine Erkrankung weitgehend zerstört waren, übernahmen andere Hirnregionen die Funktionen. Aus diesen Untersuchungen lässt sich schließen, dass Selbstbewusstsein ein Patchwork-Produkt aus vielen Arealen ist.
Für mich persönlich bahnbrechend sind die Arbeiten des Psychotherapieforschers Klaus Grawe, der postulierte, dass die Erkenntnisse der Neuropsychologie viel stärkeren Eingang in die Psychotherapie finden sollten. Zudem plädierte Grawe für einen schulenübergreifenden Ansatz in der Psychotherapie. Grawes Forschungsarbeiten fokussierten darauf, in welcher Art und Weise die Evolution unsere psychische Struktur herausgebildet hat. Dieser Ansatz erscheint mir einleuchtend. Auch stimme ich mit Grawe überein, dass wir das Schulen-Denken überwinden und stattdessen einen allgemeingültigen Plan zur Behandlung psychologischer Probleme finden sollten. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Psychotherapie in manchen Bereichen nur eine Übergangslösung darstellt und wir in ganz ferner Zukunft, wenn das Gehirn noch viel besser erforscht ist und die entsprechende medizinische Technik zur Verfügung steht, psychologische Störungen wie beispielsweise Panikattacken, Depressionen oder Verhaltenszwänge direkt in den Köpfen der Betroffenen »verlöten« können.
Das bedeutet natürlich nicht, dass wir auf diese Weise alles seelische Leid einfach ausknipsen können! Schließlich sind die Ursachen von Kummer, Wut oder Angst nicht nur genetisch und durch neuronale Fehlverbindungen bedingt, sondern lassen sich oft auf unsere Lebensumstände und unsere Erfahrungen zurückführen. Der Tod eines geliebten Menschen etwa oder eine schlimme Kindheit hinterlassen Spuren. Wie viel Zeit wir brauchen, um mit bestimmten Prägungen oder Schicksalsschlägen umgehen zu können, ist hochindividuell. Ich widerspreche daher jedes Mal massiv, wenn es vonseiten der Krankenkassen oder Gesetzgeber Vorschläge gibt, die Behandlungsdauer eines psychischen Problems konkret vorab festzulegen. Das entspricht der menschlichen Psyche nicht.
1WilhelmSchmid:DasLebenverstehen.VondenErfahrungeneinesphilosophischenSeelsorgers,Suhrkamp2016
Teil I
Wie wir »funktionieren« und was die Psychologie darüber weiß
Der Sinn des Lebens
Was also prägt die menschliche Psyche? Die Antwort von Neurobiologen darauf klingt erschreckend nüchtern: Unser Gehirn hat sich über die Evolution weiterentwickelt. Es ist sozusagen ein Ergebnis der Evolution, und somit sind auch wir Menschen in unseren Vorlieben und unserem Verhalten ein Ergebnis der Evolution. Der Bauplan unserer Psyche richtet sich nach den Interessen der Evolution. Welchen Plan verfolgt jedoch die Evolution, was ist ihr Hauptinteresse, was ist der übergeordnete Zweck dieser ganzen Daseinsveranstaltung? Eine Antwort des heutigen Forschungsstands lautet: Der evolutionäre Sinn des Lebens ist, dass wir unsere Gene verbreiten. Es geht bei dieser These nicht einmal um die Erhaltung der Art. Die Art kann demnach aussterben oder sich verändern. Es geht allein um die Weitergabe unserer Gene. Diese Theorie hat der britische Biologe Richard Dawkins2 vor über 40 Jahren in seinem wohl bekanntesten Buch »Das egoistische Gen« ausgeführt. Er erklärt auch, dass die Gene sich um jeden Preis durchzusetzen versuchen und Rücksichtnahme nur dann erfolgt, wenn sie sich einen Vorteil davon versprechen. Hilfsbereitschaft zum Beispiel ist aus diesem Blickwinkel betrachtet nur deshalb sinnvoll, weil der Mensch seine Gene in Kooperation mit anderen besser weitergeben und sichern kann. Eigentlich, so die Meinung diverser Naturforscher, sind wir auf Konkurrenz angelegt. Die Darwinisten, die Nachfolger Charles Darwins3, folgen der Theorie, dass der Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Arten, Formen und Genen entscheidet, wer überlebt und sich weiter fortpflanzen kann. Die Schlussfolgerung daraus könnte lauten: Auch der Mensch ist diesem Wettbewerb unterworfen. Wenn er ausnahmsweise kooperiert und nicht konkurriert, dann dient auch das letztendlich seinem Siegeswillen.
Diese Sicht auf das menschliche Dasein entbehrt allerdings allem, was wir eigentlich unter dem »Sinn des Lebens« verstehen. Sie klingt empathielos, unromantisch und unidealistisch. Sie widerspricht im Übrigen auch konkreten Erfahrungen, die wir immer wieder in unserem Alltag machen: Warum riskieren beispielsweise Menschen ihr Leben, um andere zu retten – obwohl es dabei nicht einmal um ihre eigenen Nachkommen geht? Und obwohl klar ist, dass dieser Einsatz nicht der Weitergabe ihrer Gene helfen kann? Im Gegenteil: Solche »Helden im Alltag« riskieren durch ihren möglichen Tod sogar, ihre Gene zugunsten ihrer Hilfsbereitschaft und Mitmenschlichkeit zu »verschwenden«. Wir alle kennen die Berichte von solchen Ereignissen aus den Medien: Ein junger Mann springt während einer Flutkatastrophe in den reißenden Strom, um einem alten, ihm vollkommen unbekannten Paar zu helfen, das hilflos davongetrieben wird. Er ertrinkt dabei selbst fast, schafft es dann aber, sich und die anderen zu retten. Müssten wir nicht aufgrund unserer biologischen Konditionierung so eine lebensgefährliche Aktion als dumm verurteilen? Das Gegenteil ist aber der Fall: Wir lieben diese Menschen für ihr selbstloses Verhalten.
Unser Gefühl sagt uns, dass der »Sinn des Lebens« nicht nur darin liegen kann, unsere Gene weiterzugeben und mit anderen zu konkurrieren. Tatsächlich erfasst diese Definition – aus Sicht von philosophischen und psychologischen Wissenschaftlern – auch nur einen Bruchteil dessen, was das Menschsein eigentlich ausmacht. Auch der berühmte Biologe, Hirnforscher und Bestsellerautor Gerald Hüther stimmt damit nicht überein. Selbst wenn sich aus astrophysischer Sicht vielleicht nichts ausmachen ließe, was unserem Verständnis von Sinn entspricht, könnten wir, so Hüther, gar nicht leben, ohne unserem Dasein einen (subjektiven) Sinn zu verleihen. Wir brauchen eine über unser individuelles Dasein hinausreichende Orientierung. Wir brauchen eine Vorstellung davon, was für ein Mensch wir sein wollen und wozu wir unser Leben nutzen wollen. Sonst verlieren wir uns über kurz oder lang in Orientierungslosigkeit.
»Der Mensch ist ein Wesen, das darüber nachdenkt, was ein Mensch ist. Kein anderes Wesen macht so etwas«, meint der Philosoph Wilhelm Schmid. »Schon der Blick in die Sterne, den Menschen in allen Kulturen und zu allen Zeiten pflegten, lässt darauf schließen, dass es sie fasziniert über das hinauszublicken, was vor ihren Füßen liegt, um sich in einem größeren Horizont wahrzunehmen.« 4
Die großen Religionen geben seit jeher Antworten auf diese grundlegenden Fragen, gaben vielen Menschen Orientierung in Form eines festen Regelwerks. Auch heute würde jemand, der gläubig ist, der Theorie vom »egoistischen Gen« und dem bloßen Erhalt der Art sicherlich heftig widersprechen. Aber viele Menschen wollen heute keine theologischen Antworten mehr auf ihre Fragen. Das liegt auch daran, dass etliche mit Religion menschenfeindliche Dogmen verbinden, dass das Christentum lange gegen das »Selbst« und das »Ich« gepredigt hat. Das ist keine gute Vertrauensbasis, wenn es um sehr persönliche Fragen geht.
Viele Menschen suchen inzwischen nach Antworten und Orientierung außerhalb der großen Weltreligionen. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt beispielsweise, dass die Religiosität in Deutschland zwar abnimmt, aber durch verschiedene Formen von Spiritualität ersetzt wird. Diese Umorientierung ist unabhängig von der Bildungsschicht: Der Wunsch nach einem großen Gesamtzusammenhang, einem göttlichen Plan, einem Universum, das vollkommen jenseits unserer physikalisch messbaren Realität zu verorten ist, existiert nicht nur in Akademikerkreisen. Es gibt bei vielen Menschen ein angeborenes – womöglich auch ein genetisches – Bedürfnis, nach einem Sinnzusammenhang zu suchen. Gerald Hüther beschreibt in »Die Evolution der Liebe«5, dass die Botschaft von Jesus und einer die Menschheit verbindenden Nächstenliebe nach wie vor unsere tiefsten Sehnsüchte anspricht. Der Wunsch nach Mitmenschlichkeit und die Orientierung an dazugehörigen Werten wie etwa Hilfsbereitschaft, Uneigennützigkeit, Loyalität oder Warmherzigkeit sind ungebrochen. Wir Menschen brauchen ganz offensichtlich Gefühle, um einen Lebenswert zu erkennen. Wenn man Gefühle nicht mehr spüren kann – wie es beispielsweise bei schwer Depressiven der Fall ist –, verliert das Leben seinen Wert und damit auch seinen Sinn.
Exkurs: Warum wir mehr Mitgefühl und Selbstreflexion brauchen
An dieser Stelle möchte ich offenlegen, was für mich persönlich den Sinn des Lebens ausmacht. Für mich sind Mitgefühl und Selbstreflexion die Werte, die uns Menschen auszeichnen (sollten). Mitfühlend zu handeln, mich selbst zu reflektieren und außerdem andere Menschen zu mehr Mitgefühl und Selbstreflexion anzuregen, stellt für mich einen wichtigen Teil meines persönlichen Lebenssinns dar. Vondieser altruistischen Haltung abgesehen denke ich außerdem, dass man sein Leben auch einfach genießen sollte. (Das löst aber leider nicht die Probleme in der Welt, sondern trägt erst einmal nur zu unserem persönlichen Wohlbefinden bei.) Ich denke, dass viele Probleme, die wir in der Welt haben, entstehen und fortbestehen, weil es Menschen an Selbstreflexion und Mitgefühl mangelt. Die ungeheure Wut und Aggression, die uns täglich umgibt und mit der einige Menschen andere Menschen verbal abwerten, kränken, demütigen, ihnen Gewalt antun, sie foltern, ermorden und Kriege führen, lässt sich im Kern auf einen Mangel an Mitgefühl und Selbstreflexion zurückführen. Ich bin oft fassungslos über den Fremdenhass, den so viele Menschen offenkundig oder versteckt hegen. Ich finde es schlimm, wie Menschen aufgrund ihrer Religion, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihres Geschlechts, ihrer Figur oder ihres Aussehens angefeindet oder gar getötet werden. Ich erschrecke mich immer wieder über die vielen Grobheiten und Anfeindungen, die tagtäglich stattfinden. Es ist auch unfassbar, welches Leid wir Tieren und der Umwelt zufügen. Ich bin überzeugt: Wenn wir es schaffen würden, mehr Mitgefühl zu empfinden und die wahren Ursachen unserer Aggressionen zu ergründen, dann wären wir viel friedlicher. Menschen, denen es schwerfällt mitzufühlen, haben zumeist selbst wenig Mitgefühl erfahren. Wenn Eltern wenig Empathie für ihre Kinder aufbringen, dann übernehmen ihre Kinder diese Haltung in gewisser Weise: Es fällt ihnen schwer, ihre eigenen Emotionen wahrzunehmen und damit umzugehen. Ein Mangel an Mitgefühl entsteht aus blockierten Gefühlen: Um nämlich mitfühlen zu können, benötige ich einen Zugang zu meinen eigenen Gefühlen. Ein Mangel an Mitgefühl kann auch aus Traumatisierungen entstehen. Viele Kinder weltweit werden traumatisiert und laufen als Erwachsene Gefahr, selbst zu Tätern zu werden. Wut entsteht aus Angst, Ohnmacht und gefühlter Minderwertigkeit. Mit Selbstreflexion kann man diese inneren Prozesse hingegen erkennen und auflösen. Deswegen ist die persönliche Selbstreflexion meiner Meinung nach eine politische Notwendigkeit. Je reflektierter ein Mensch ist, desto mehr ist er sich seiner Muster und auch seiner Werte (siehe dazu auch »Dem Leben Sinn geben«, sowie das Schlusswort,) bewusst. Je stärker er diese Koordinaten berücksichtigt, desto weiser ist er. Und der weise Mensch handelt mit jenem Mitgefühl, das unsere Gesellschaft so dringend benötigt.
Wie aber können wir uns besser reflektieren und mehr Mitgefühl aufbringen? Hierfür müssten wir die Struktur der menschlichen Psyche besser verstehen, damit wir leichter erkennen können, was in uns vorgeht.
Unsere Psyche hat sich mit der menschlichen Evolution entwickelt, deswegen schwenke ich noch einmal zu ihr zurück. Nach dem aktuellen Stand der Naturwissenschaften legt die Evolution es darauf an, dass wir unsere Gene verbreiten. Ich möchte diese Sicht einmal tröstlicher formulieren: Die Evolution will, dass wir leben. Sie stimmt also für das Leben an sich, einfach so. Wenn das Leben an sich das übergeordnete Ziel ist, also der Sinn des Lebens aus evolutionärer Sicht, dann ist es nur logisch, dass unsere Psyche diesem Zweck dient. Und so wie unser Körper und alles Leben auf dieser Erde sich in Millionen von Jahren immer weiter angepasst haben, um dem übergeordneten Zweck des Überlebens zu dienen, so hat sich auch unsere Psyche nach diesem Plan der Natur ausgerichtet. Unsere psychische Grundstruktur hat eine klare, evolutionäre Architektur, die für alle Menschen über alle Kulturen gleichermaßen gültig ist. Genau wie der menschliche Körper über alle Kulturen denselben Bauplan aufweist. Individuelle Unterschiede sind lediglich kleine Variationen dieses Plans. Dies gilt auf körperlicher Ebene wie auch auf psychischer. Das Wissen darüber, wie unser Körper aufgebaut ist und funktioniert, ist weit verbreitet. Das Wissen über unsere psychologische Konstitution hingegen nicht. Das liegt in dem Umstand begründet, dass unsere Psyche, wenn sie auch im Gehirn verankert ist, immaterieller Natur ist, sich also wesentlich schlechter beschreiben und erfassen lässt als der Körper. Die Psyche ist nicht vermessbar, und man kann ihr auch nur bedingt beim Arbeiten zugucken. Man kann zwar Hirnareale sichtbar machen, in denen Neurone feuern, aber die subjektive, gedankliche und gefühlte Bedeutung dieser Gehirnprozesse kann man nicht messen. Sie kann nur durch den Inhaber des jeweiligen Gehirns verbalisiert werden. So kann man beispielsweise per Hirnscan sehen, dass bestimmte Gehirnareale feuern, wenn die Versuchsperson Tschaikowsky hört; was die Musik für sie aber persönlich bedeutet, könnte sie uns nur mit Worten erklären. Und so ist es auch höchst individuell, welchen Sinn ein Mensch braucht, um leben zu können.
In meiner Arbeit als Psychologin und Psychotherapeutin beschäftige ich mich ständig mit drei Konstanten: den genetischen Voraussetzungen, den Strukturen unserer Psyche und dem individuellen Suchen nach Sinn und Lebensglück.
Der Mensch will sich begreifen. Und er erkundet sich gerne. Er ist »ein Wesen der Möglichkeiten«. Diese Feststellung trifft der philosophische Seelsorger Wilhelm Schmid in seinem Buch »Dem Leben Sinn geben« – und sie entspricht mir sehr. Jeder von uns kann sich immer wieder erproben und neu erfinden, Versuche anstellen, Experimente wagen.
Wir Menschen überschreiten oft verschiedene Normen, Formen und Grenzen. Wir wollen die Möglichkeiten des Lebens entdecken, auch die Unmöglichkeiten. Wir wollen dabei herausfinden, wer wir sind. Und wie wir werden können, was wir sein wollen und können.
Letztendlich ist es so: Wer die Grundlagen der eigenen Psyche begreift, seine Prägungen und Verhaltensmuster erkennt, dem wird es leichter fallen, seinen persönlichen Sinn zu finden.
Glücksgefühle sind unsere Lebensdroge
Damit wir motiviert sind, zu leben und unsere Gene fortzupflanzen, benötigen wir einen Lebenswillen. Die Natur hat uns einen gewaltigen Überlebensinstinkt eingepflanzt und eine Heidenangst vor dem Tod. Aber die Angst vor dem Tod allein hält uns nicht am Leben. Sie existiert, weil wir leben wollen. Menschen, die des Lebens müde sind, haben weniger Probleme mit dem Tod. Es sind die schönen Gefühle, die uns am Leben erhalten, allen voran das Glück. Die schönen Gefühle geben uns einen Lebenswert. Wenn sie über einen langen Zeitraum ausbleiben oder wenn man, schlimmer noch, gar nichts mehr fühlt, dann hängt man nicht mehr am Leben. Schwer Depressive leiden unter einem völligen Mangel an Gefühlen. Totale Leere und damit einhergehend ein tiefes Gefühl der Sinnlosigkeit quartieren sich in den Betroffenen ein, die sich deswegen häufig den Tod herbeiwünschen und ihn leider auch manchmal herbeiführen.
Zentrales Element unseres psychischen Bauplans ist also, dass wir fühlen. Und zwar am liebsten gut! Wir streben nach Glück wie nach einer Droge. Glücksgefühle motivieren uns zu leben. Die Ersatzdroge für das Glück ist die Hoffnung. Wenn wir uns in einer unglücklichen Lebenssituation befinden, kann uns die Hoffnung auf Besserung am Leben erhalten. Die Hoffnung auf Besserung geht bei Depressiven übrigens auch gen null, ein weiterer Grund, warum diese Erkrankung so ungeheuer lebensmüde macht.
Aber auch die weniger angenehmen Gefühle erinnern uns ständig daran, dass das Leben kostbar ist. Die Angst ermahnt uns, unser Selbst vor körperlicher oder psychischer Verletzung zu bewahren. Die Trauer klärt uns darüber auf, dass wir etwas Wichtiges verloren haben. Der Ekel warnt uns vor Ansteckung und Vergiftung. Die Scham bewirkt, dass wir uns an gesellschaftliche Normen anpassen und somit ein Mitglied der Gemeinschaft bleiben, ohne die wir nicht überleben könnten. Schuldgefühle sind die Konsequenz, wenn wir uns selbst oder einem anderen Menschen einen Schaden zugefügt haben. Neid kann uns anspornen und Eifersucht motiviert uns, an wichtigen Beziehungen festzuhalten. Ohne unsere Gefühle hätten wir keinerlei Motivation, am Leben zu bleiben oder überhaupt irgendetwas zu tun. Deswegen sind Depressive ja nicht nur von innerer Leere und Sinnlosigkeit geplagt, sondern leiden auch unter einem massiven Antriebsmangel. In schweren Fällen können sie sich deswegen noch nicht einmal mehr zum Freitod aufraffen. Deswegen achten Ärztinnen und Ärzte sorgfältig darauf, dass die Antidepressiva in der ersten Behandlungsphase stärker die Stimmung aufhellen, als dass sie den Antrieb steigern. Andersherum könnte ihre Wirkung fatale Folgen haben.
Wenn wir also so gierig auf gute Gefühle sind, dann wäre es doch eigentlich am effizientesten, wenn wir uns ganz unmittelbar auf das Glücksgefühl als solches konzentrieren würden. Damit meine ich Folgendes: Wir suchen unser Glück ja normalerweise in äußeren Dingen, wie einer glücklichen Liebesbeziehung, beruflichem Erfolg, der Anhäufung von Geld und den schönen Dingen, die man sich damit kaufen kann. Genauso ziehen uns äußere Widrigkeiten oft runter: schlechtes Wetter, Stau, Stress bei der Arbeit, ein muffliger Ehepartner. Ungute Gefühle stellen sich immer dann ein, wenn wir nicht das bekommen, was wir gerne hätten. Wenn es uns aber gelingen würde, unser Gehirn so zu beeinflussen, dass wir mit dem, was gerade ist – was auch immer es ist –, zufrieden wären, dann hätten wir keine Probleme mehr.
Der Psychologe und Buchautor Jens Corssen spricht in diesem Zusammenhang von »gehobener Gestimmtheit«. Er sagt richtigerweise, dass vieles im Leben eine Frage der persönlichen Entscheidung ist. Wenn ich mich also entschieden habe, Auto zu fahren, dann muss ich in Kauf nehmen, dass ich in einen Stau gerate. Anstatt mich also darüber zu ärgern, sollte ich mir sagen: Ich habe mich für das Auto entschieden. Also will ich Auto fahren. Ergo will ich auch im Stau stehen! Ebenso: Ich habe diesen Partner ausgewählt. Er ist ständig schlecht gelaunt. Ergo will ich diesen schlecht gelaunten Partner. Das Corssen-Prinzip ist so einfach wie genial. Es geht um die radikale Annahme der eigenen Lebensentscheidungen oder eben darum, eine neue Entscheidung zu treffen. Die Grundidee ist, dass man seine Emotion kontrolliert und weniger die äußeren Umstände, auf die wir häufig nicht viel Einfluss nehmen können, wie beispielsweise auf den Stau oder den muffligen Partner. Also Emotions-Coping anstatt Situations-Coping. Coping ist ein psychologischer Fachbegriff, der aus dem Englischen übernommen wurde, und meint, dass man mit etwas fertigwird, also klarkommt.
Kleiner Exkurs: Eine buddhistische Form des Erwartungsmanagements
Auch Buddhisten verfolgen das Ziel, die Wirklichkeit so anzunehmen, wie sie ist, und sich von Anhaftungen zu lösen. Unter »Anhaftung« wird ein sehnsüchtiges Verlangen, eine Bindung an glücksversprechende andere Menschen, Objekte und Zustände verstanden, wie beispielsweise materieller Besitz, Ruhm, Status und auch eine zu starke Bezogenheit auf andere Menschen. Je weniger ich anhafte, desto gelassener und gleichmütiger kann ich das Leben annehmen und in letzter Konsequenz auch den Tod, weil ich auch mein Selbst loslassen kann. Je weniger ich anhafte, desto weniger Erwartungen oder gar Gier können entstehen. Im Grunde genommen praktizieren erfolgreiche Buddhisten ein effizientes Erwartungsmanagement, das sie vor starken Gefühlsausschlägen in die eine oder andere Richtung beschützt und sie somit in den Zustand äußerster Gelassenheit versetzt.
Angenehme Gefühle entstehen, wenn im Außen das geschieht, was ich innerlich anstrebe. Glücksgefühle stellen sich ein, wenn ich mehr bekomme als erwartet. Unglücklich und sogar regelrecht krank kann es uns hingegen machen, wenn das, was im Außen passiert, stark von dem abweicht, was wir uns wünschen und erwarten. Dieser simple Erwartungsabgleich wird in der Psychologie als das Konsistenzprinzip bezeichnet.
Das Konsistenzprinzip
Wenn ich mich morgens auf eine Tasse Kaffee freue und dann feststelle, dass die Kaffeemaschine kaputt ist, dann stellt sich bei mir Verdruss ein. Wenn ich mir zum Geburtstag eine Halskette gewünscht habe und bekomme stattdessen ein Bügeleisen, dann bin ich enttäuscht. Wenn ich unerwartet ein sehr nettes Kompliment erhalte, dann freue ich mich. Klingt banal? Dennoch kann man aus diesen Beobachtungen etwas Wesentliches ableiten: Unser Gefühlsleben wird stark von unseren Erwartungen und Wünschen auf der einen Seite und der Wahrnehmung der Realität auf der anderen Seite bestimmt. Kurz gesagt fühlen wir uns mies, wenn etwas schlechter kommt, als wir es erwartet oder uns gewünscht hätten.
Dabei sind die nicht erhaltene Halskette oder die kaputte Kaffeemaschine noch Ereignisse, die wir psychisch ganz gut verwalten können. Eine Zurückweisung in Liebesdingen hat hingegen schon ein ganz anderes Schmerzpotenzial.
Wenn unsere inneren Erwartungen und Wünsche von der Realität abweichen, dann entsteht Inkonsistenz. Auf der Gefühlsebene erleben wir Inkonsistenz als eine Form der inneren Anspannung. Man kann das mit einem Gummiband vergleichen: Der Wunsch zieht in die eine Richtung, die Realität in die andere. Je stärker hierbei der Wunsch und je größer die Abweichung von der Realität, desto mehr Spannung entsteht.
Exkurs: Wie zeigt sich Inkonsistenz?
Laut der Konsistenztheorie von Klaus Grawe strebt jeder Mensch nach Konsistenz: nach einer Übereinstimmung und Vereinbarkeit zwischen den inneren Bedürfnissen (psychischen Prozessen) und dem Erleben in der Realität. Je höher die Konsistenz ist, desto gesünder und zufriedener ist der Mensch. Der gegenteilige Zustand wird als Inkonsistenz bezeichnet und ist für Menschen unangenehm.
Es gibt zwei Unterformen von Inkonsistenz:
Von einer kognitiven Dissonanz spricht man, wenn mindestens zwei schwer oder sogar unvereinbare Ziele beziehungsweise Wünsche vorliegen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn sich eine überzeugte Veganerin in einen Mann verliebt, der sehr gerne Fleisch isst. Es entsteht dann eine Dissonanz zwischen ihrer Einstellung zum Fleischkonsum und ihrer Beziehung zu dem Mann. Bei der Inkongruenz kann ein Mensch seine Ziele nicht erreichen oder hat das Gefühl, seine Ziele nicht erreichen zu können. Die Wahrnehmung der Realität stimmt dann nicht mit den Zielen überein. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn wir unglücklich verliebt sind und unserem Bedürfnis nach Nähe nicht entsprochen wird.Der Zustand der Inkonsistenz im psychischen Geschehen kann zu Veränderungen anregen und deshalb auch eine Quelle der Motivation sein. Andererseits kann der Umgang mit Inkonsistenz auch stark hemmend sein.
Unser Gehirn bewertet von morgens bis abends, ob wir das bekommen, was wir wollen. Permanent produziert es dabei Erwartungen, wie es weitergehen wird und wie die nächsten Schritte aussehen könnten. Die neuropsychologische Instanz, die dabei arbeitet und wirkt, wird als der sogenannte Komparator bezeichnet. Dies ist ein Begriff aus der Digitaltechnik, den auch Klaus Grawe verwendet.6 Hören wir beispielsweise eine bekannte Melodie und plötzlich wird ein Ton falsch gespielt, dann erzeugt das Inkonsistenz, eine kleine innere Anspannung, ein »Aua«. Beim Autofahren, Einkaufen, bei der Arbeit oder bei einem Spaziergang: Permanent überprüft der Komparator die aktuelle Situation und entwirft den nächsten Handlungsschritt.
Wenn alles nach Plan läuft und der Komparator keine Abweichungen vom Plan anzeigt, sind wir entspannt. Zeigt der Komparator stärkere Abweichungen an, empfinden wir Stress. Das Ausmaß unseres Stressempfindens ist extrem eng verknüpft mit unserer subjektiven Einschätzung, ob wir die Situation bewältigen können. Je besser wir uns der Situation gewachsen fühlen, desto weniger Stress empfinden wir.
Läuft hingegen immer alles nach Plan, dann sind wir unterfordert, und es stellt sich Langeweile ein. Sprich: Wir benötigen auch gewisse Herausforderungen im Leben, um uns stimuliert zu fühlen. Damit wir von den Herausforderungen jedoch nicht überwältigt werden, müssen wir die Erwartung hegen, dass wir sie, wenn vielleicht auch mit Anstrengung, bewältigen können (darauf gehe ich im Abschnitt »Ich bin dem Leben gewachsen. Die internale Kontrollüberzeugung« noch ein).
Der berühmte Pawlow’sche Hund hat durchlitten, was es mit uns Lebewesen macht, wenn wir dauerhafter Inkonsistenz ausgesetzt sind. Der russische Mediziner Iwan Petrowitsch Pawlow hat Anfang des 20. Jahrhunderts zu konditionierten (also erlernten) Reflexen geforscht. Pawlow brachte seinem Hund bei, dass er sich auf Futter freuen durfte, wenn er ihm eine Lichtprojektion zeigte, die einen Kreis darstellte. Wenn er hingegen eine Ellipse sah, gab es nichts zu essen. Der Hund hatte das im Nu begriffen, und die Vorfreude war jedes Mal groß, wenn er einen Kreis sah. Der Hund hatte also gelernt, den Kreis mit dem Erhalt von Futter zu verbinden. Der Anblick des Kreises allein genügte dann schon, dass er vor Vorfreude sabberte. Solche Reiz-Reaktions-Verknüpfungen bezeichnet man als Konditionierung. Auch wir Menschen lernen durch Konditionierung. Den Prozessen in unserem Gehirn ist es hierbei egal, ob sie sich gute oder schlechte Konditionierungen zulegen. So können wir durch eine Reiz-Reaktion-Verbindung »lernen«, dass zu einer Tasse Kaffee (das wäre ein ähnlicher Stimulus wie beim Hund der Lichtkreis) eine Zigarette gehört. Oder dass es beim Besuch der Großeltern immer Kuchen gibt. Vielleicht auch, dass es nach einem langen Kuss zu Sex kommt.
Kommen wir noch mal zurück zum Pawlow’schen Hund, dessen Herrchen nämlich ein bisschen fies wurde: Der Forscher zeigte seinem Hund Kreise und Ellipsen, die einander immer ähnlicher wurden. Der Hund war verunsichert. Durfte er sich nun freuen oder nicht? Gab es Futter oder nicht? Der Hund wurde immer verzweifelter. Er erlitt maximale Inkonsistenz. Schließlich legte er sich in die Ecke und machte gar nichts mehr. Er hatte also die Hoffnung aufgegeben, dass er die Situation noch bewältigen konnte. Diesen Zustand nennt man Resignation. Auch bei uns Menschen stellt sich Resignation ein, wenn wir uns über einen längeren Zeitraum nicht richtig verhalten können – wenn alle unsere Anstrengungen ins Leere laufen. Depression und Burnout kann man in gewisser Weise als eine Form der Resignation bezeichnen.
Inkonsistenz und der damit einhergehende Stress sind die Grundlage für psychische Probleme und Störungsbilder. Inkonsistenz entsteht immer dann, wenn meine Wünsche im Konflikt zur Realität stehen oder im Konflikt zu anderen Werten und Wünschen, die ich mir selbst auferlege. Ein Beispiel dafür wäre, wenn ich einerseits ein guter Ehemann sein möchte und gleichzeitig fremdgehen will. Typische Konflikte, die Inkonsistenz und Stress in uns erzeugen können, sind:
• Ich will etwas und bekomme es nicht.
(Beispiel: Ich hätte gern einen Partner und finde keinen.)
• Ich bekomme etwas, das ich nicht will.
(Beispiel: Mein Nachbar beschimpft mich.)
• Ich kann eine Situation nicht einschätzen.
(Beispiel: Ich kann mir keinen Reim auf das Verhalten meiner Vorgesetzten machen bzw. der Pawlow’sche Hund.)
• Ich habe Wünsche, die sich nicht gut vereinbaren lassen.
(Beispiel: Ich möchte gesund leben und regelmäßig Alkohol trinken.)
• Ich wünsche mir etwas und habe gleichzeitig Angst davor.
(Beispiel: Ich möchte gern eine Beziehung eingehen, habe aber große Angst, enttäuscht zu werden.)
• Ich möchte ein Ziel erreichen und habe Angst, es nicht zu schaffen.
(Beispiel: Ich möchte meine Ausbildung abschließen und habe Angst, die Prüfung nicht zu bestehen.)
Es liegt auf der Hand, dass es individuell höchst verschieden ist, wer sich durch was gestresst fühlt. Dabei gibt es einen großen Unterschied zu physikalischen Stressoren wie Lärm, Kälte, übermäßige Hitze, Unfälle usw. Physikalische Stressoren gelten für jeden Menschen, auch wenn der eine etwas mehr und der andere etwas weniger empfindlich sein mag. Der Grund, warum physikalische Stressoren bei allen Menschen ein gewisses Maß an Stress auslösen, besteht darin, dass sie objektiv existieren. Was wir jedoch als psychischen Stress empfinden, ist sehr stark abhängig von der subjektiven Bedeutung, die wir einem Ereignis beimessen. Während physikalischer Stress durch messbare Veränderungen in der äußeren Welt (z.B. durch übermäßige Hitze) ausgelöst wird, so entsteht psychischer Stress innerhalb unseres Gehirns, also in unserer Gedankenwelt. Für nicht wenige ist es eine Horrorvorstellung, eine öffentliche Rede zu halten, für andere ein großer Spaß. Für den einen ist eine persönliche Kritik ein wichtiges Feedback, für den anderen eine Kränkung. Für den einen bedeutet der neue Job eine freudige Herausforderung, der andere quält sich mit Versagensängsten.
Die Frage ist nun, auf welche Art und Weise sich diese subjektiven Bedeutungen in unseren Gehirnen herausbilden. Welche psychischen und physiologischen Prozesse sind beteiligt, die unsere Gefühle, Gedanken, Motive und Handlungen individuell prägen und formen?
Die Wahrnehmung
Wenn wir so in die Welt gucken, so wie ich es jetzt gerade von meinem Schreibtisch aus tue, dann erscheint uns das, was wir sehen, ungeheuer real. Tatsächlich findet die Realität aber fast ausschließlich in unserem Kopf statt. Das fängt schon mit dem Farbsehen an. Die wahre Welt da draußen besteht nur aus elektromagnetischen Wellen in unterschiedlichen Intensitäten und Wellenlängen. Es gibt da draußen keine Farben. (Diesen Gedanken finde ich übrigens total gruselig, spiegelt er für mich doch eindrücklich die Kälte des Universums wider.) Die Farbillusion entsteht auf unserer Netzhaut. Andere Spektren an elektromagnetischer Strahlung, wie zum Beispiel Infrarot oder Röntgenstrahlen, können wir nicht sehen. Aber auch sie sind nachweislich vorhanden. Tiere hingegen können manche Dinge viel besser wahrnehmen als wir, beispielsweise Ultraschall. Unsere menschliche Wahrnehmung von der Realität ist vermutlich so weit von der Realität entfernt, dass wir uns noch nicht einmal vorstellen können, wie die Realität tatsächlich aussehen könnte. Es scheint jedoch einen evolutionären Sinn zu haben, dass die menschliche Wahrnehmung begrenzt ist, weil hierdurch viele, für das Überleben irrelevante Informationen schon im Vorfeld ausgefiltert werden und somit gar nicht erst unser Gehirn beanspruchen. Um als Mensch klarzukommen, müssen wir also von vielem, was vor sich geht, gar nichts wissen.
Unsere begrenzte menschliche Wahrnehmung ist also schon einmal ein Grund, warum unsere Sicht auf die Realität eingeschränkt und verzerrt ist. Auf der Ebene der rein sinnlichen Wahrnehmung scheinen wir Menschen allerdings so ziemlich alle das Gleiche zu sehen. Wir sind uns einig, was rund und was eckig ist, wie ein Baum oder ein Tisch aussehen.
Kleiner Exkurs: Die Wahrheit und die Philosophie
In der Philosophie wird angezweifelt, inwiefern wir auch bei solchen simplen Dingen überhaupt in der Lage sind, »die Wahrheit« zu sehen. Ende des 18. Jahrhunderts kam der berühmte Philosoph Immanuel Kant zu der Erkenntnis, dass alles Wissen über die Welt aus einer trügerischen Sinneswahrnehmung der Menschen entsteht. Auf diese philosophische Ebene möchte ich mich jetzt aber nicht begeben.
Ich gehe im Folgenden davon aus, dass die gehirntechnische Informationsverarbeitung bei allen Menschen gleich ist, mal abgesehen von Abweichungen wie Farbenblindheit oder veränderten Wahrnehmungen, die sich bei manchen neurologischen Schädigungen einstellen können.
Entscheidend für die Individualität unserer Wahrnehmung ist die subjektive Bedeutung, die wir dem Gesehenen beimessen. Diese Bedeutung entscheidet nicht nur darüber, wie wir wahrnehmen, sondern auch darüber, was wir wahrnehmen. Unsere Wahrnehmung richtet sich nur geringfügig nach dem aus, was da draußen in der Welt los ist, sondern vielmehr nach unseren eigenen Wünschen, Bedürfnissen und Mangelzuständen. Unsere aktuelle Befindlichkeit hat also einen erheblichen Einfluss auf unsere Wahrnehmung. Wenn ich Hunger habe, fokussiere ich auf Essen. Wenn ich unter Langeweile leide, spiele ich mit dem Handy. Wenn ich traurig bin, ist die Welt »grau«. Bin ich verliebt, erscheinen mir meine Mitmenschen viel netter als sonst. Hege ich einen starken Kinderwunsch, fallen mir lauter Schwangere auf.
Ein zweites Kriterium, das unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist die Auffälligkeit einer Wahrnehmung. Wenn mir in der Trierer Fußgängerzone plötzlich ein Kamel entgegenkäme, würde ich das auf jeden Fall sehen, egal wie gedankenversunken oder bedürfnisgesteuert ich gerade bin. Dass wir Reize aufnehmen, die besonders auffällig sind, ist unserem Überlebenswunsch geschuldet, schließlich müssen wir merken, wenn plötzlich eine Bedrohung auftaucht.
Wenn aber nichts auffällig oder von subjektiver Bedeutung für uns ist, dann gelangt es nicht in unser Kurzzeitgedächtnis. Und was unser Kurzzeitgedächtnis nicht erreicht, ist nicht passiert. Unser Auge kann zwar Wahrnehmungsbilder registrieren, solange dieses Bild aber nicht an das Kurzzeitgedächtnis weitergereicht wird, existiert es in unserem Bewusstsein nicht. Das Kurzzeitgedächtnis wird auch als Arbeitsgedächtnis bezeichnet und ist quasi mit unserem Bewusstsein gleichzusetzen. Die Beurteilung, was wichtig und was unwichtig ist, was also bewusst wahrgenommen wird und was im »schwarzen Loch« verbleibt, erfolgt nicht über unsere Sinnesorgane, sondern über unser Gehirn. Man kann unsere bewusste Wahrnehmung mit einer Taschenlampe in der Dunkelheit vergleichen. Auf was sich dieser Aufmerksamkeitsstrahl richtet, hängt von unseren inneren Bedürfnissen und unseren früheren Erfahrungen ab. Alles, was wir sehen, landet nicht einfach im Gehirn, sondern wird durch unsere früheren Erfahrungen gefiltert. Wenn wir hingegen etwas sehen, das wir zuvor noch nie gesehen haben, dann können wir das Gesehene nicht einordnen, nicht in seiner Bedeutung erfassen. Denn jedes Bild der äußeren Realität, das auf unsere Netzhaut trifft, wird mit vergangenen Erfahrungen verglichen. Das geht natürlich so schnell, dass wir das gar nicht bemerken. Ein Sinneseindruck aus der Außenwelt landet auf dem primären Hirnrindenfeld, das ist das Bild von draußen, die Realität . Dieses Bild wird jedoch mit Erinnerungen aus dem sekundären Hirnrindenfeld , das auch Assoziationsgebiet genannt wird, verglichen und vermischt. Erst hierdurch erlangt das Bild seine subjektive und persönliche Bedeutung. Insofern ist das, was wir sehen, immer eine Mischung aus der Realität und unseren subjektiven Erfahrungen. Unsere Wahrnehmung wird also sehr stark von unserer Erinnerung bestimmt. Dieses Prinzip, also die Verknüpfung von Sinneseindruck und unserer persönlichen Erfahrung, gilt übrigens auch für andere Wahrnehmungsorgane, also auch die Ohren, die Nase, die Zunge und unsere Haut.
Wichtig ist, dass unsere Wahrnehmung Empfindungen in uns auslöst. Es ist unmöglich, eine Empfindung ohne subjektive Tönung und Bedeutung zu erleben. So löst der Geruch, den eine Tasse Kaffee verströmt, bei einem Kleinkind ganz andere Empfindungen aus als bei einem Erwachsenen, der sie dringend nach dem morgendlichen Aufstehen benötigt. Der Kaffeegeruch löst beim Erwachsenen ganz andere Assoziationen und somit auch andere Empfindungen aus.
Evolutionär ergibt diese enge Verknüpfung von Wahrnehmung und Erfahrung Sinn. Hierdurch können wir nämlich blitzschnell Gefahren einschätzen, etwa das kleine, süße Kuschelkätzchen von der giftigen Schlange unterscheiden. Durch die Verknüpfung von Wahrnehmung, Erfahrung und Empfindung findet Lernen statt. Wie ich weiter oben schon ausgeführt hatte, sind unsere Emotionen in diesem Zusammenhang überlebenswichtig – würde der Anblick der giftigen Schlange nämlich nicht sofort Angst in uns auslösen, dann hätten wir keine klare Vorstellung davon, wie wir uns richtig verhalten sollen. Die Angst treibt uns entweder zur Flucht an oder rät uns zum Angriff – je nachdem, wie die subjektiv bewerteten Chancen stehen.
Zusammenfassend nehmen wir also nur einen Bruchteil der uns umgebenden Realität wahr, und zwar im Wesentlichen das, was für uns von subjektiver Bedeutung ist. Wir reagieren auch weniger auf die Realität, sondern auf die Bedeutung, die wir ihr durch unsere subjektiven Lernerfahrungen beimessen. Streng genommen reagieren wir also auf unsere eigenen Gedanken und Interpretationen, die sich vor allem aus unseren persönlichen Erinnerungen ergeben.
Wir sind unsere Erinnerung
Wenn wir das Licht der Welt erblicken, ist unser Gehirn nur zu circa 25 Prozent ausgebildet. Diese 25 Prozent betreffen basale Überlebensfunktionen wie beispielsweise die Regulation von Hunger und Sättigung. Auch unser Gefühlsleben ist noch rudimentär entwickelt und kann im Wesentlichen nur zwischen Lust und Unlust unterscheiden. Die Funktionseinheit des Gehirns, die schon bei unserer Geburt ausgebildet ist, bezeichnet man als das Stammhirn oder Reptiliengehirn. Dieser Teil des Gehirns macht bei niederen Wirbeltieren fast das gesamte Gehirn aus. Das heißt, wir sind in dieser Phase unseres Lebens so funktionsfähig wie ein Reptil. Alle höheren Gehirnregionen, wie das limbische System, das für unsere emotionalen Interaktionen und unsere Erwartungen zuständig ist, sowie der präfrontale Kortex, in dem komplexe Denk- und Entscheidungsprozesse verarbeitet werden, entwickeln sich erst während der und durch die Interaktion mit anderen Menschen.
Hinsichtlich dieser »Hardware«, also der funktionalen Eigenschaften wie der Struktur des Nervensystems, stellt unser Gehirn bei unserer Geburt ein großes Spektrum an Möglichkeiten bereit. Wie sich unsere »Software«, also unsere Gedanken und Gefühle, jedoch letztlich formatiert und wie der Informationsfluss im Gehirn vonstattengeht, hängt entscheidend davon ab, welche Erfahrungen wir im Laufe unseres Heranwachsens sammeln. Ganz besonders rasant entwickelt sich unser Gehirn in den ersten sechs Lebensjahren, weswegen diese für unsere psychische Prägung auch so wichtig sind. Ganz fertiggestellt ist das Gehirn im Normalfall im zwanzigsten Lebensjahr. Allerdings ist es bis an unser Lebensende lernfähig. Wir können in höheren Lebensjahren sowohl noch neue Fähigkeiten erlernen als auch unsere psychische Software verändern. Allein, was wir in den ersten zwei Lebensjahren erfahren, kann im Erwachsenenalter nicht mehr gelöscht werden. Während der ersten zwei Lebensjahre bildet sich unser Urvertrauen oder auch Urmisstrauen in uns selbst und in die Welt aus. Diese Prägung ist irreversibel. Allerdings kann man als Erwachsener durch Selbstreflexion und die Aneignung neuer innerer Einstellungen und das Erlernen neuer Verhaltensweisen einen möglichen »Programmierschaden« ganz gut kompensieren.
Bevor man anfängt, seine frühen Kindheitserlebnisse bewusst zu reflektieren und somit einen gewissen Abstand zu ihnen zu erlangen, fungieren diese frühen Prägungen wie eine Brille, durch die man die Wirklichkeit wahrnimmt. In der neuropsychologischen Wissenschaft wird diese Brille auch als mentale Landkarte (englisch: Mindmap) bezeichnet. Unsere frühen Prägungen bestimmen unser Selbstbild und unser Selbstwertgefühl, und beide entscheiden maßgeblich darüber, wie wir andere Menschen wahrnehmen und was wir von ihnen erwarten. Und weil wir ohne andere Menschen und ohne die Gemeinschaft nicht überlebensfähig wären, ist die Art und Weise, wie wir unsere Beziehungen wahrnehmen und gestalten, die Grundlage unseres psychischen Lebens und Überlebens.
Wenn ein kleines Kind wiederholt die Erfahrung macht, dass seine Bedürfnisse nach Nähe und Geborgenheit von seinen Eltern nicht erfüllt werden, dann speichert sein Gehirn ab, dass es generell wenig Beachtung bekommt und sich auf Menschen nicht verlassen kann. Weil das Gehirn dieses Kindes jedoch viel zu wenig entwickelt ist, als dass es verstehen könnte, dass die Eltern überfordert sind und eventuell eine Bindungsstörung aufweisen, gibt sich das Kind an diesem Mangelzustand selbst die Schuld. Es meint und fühlt, es sei nicht liebenswert genug und habe Fürsorge nicht verdient. Das ist sozusagen der Spiegel, den ihm seine Eltern vorhalten, wenn das auch in den meisten Fällen nicht intendiert ist. Dieser Prozess wird in der Psychologie als das gespiegelte Selbstwertempfinden bezeichnet und ist eine Konditionierung, die uns ein Leben lang erhalten bleibt – hierauf werde ich noch öfter zu sprechen kommen. Durch das lieblose Verhalten seiner Eltern verinnerlicht das Kind ein Gefühl von Minderwertigkeit und eine gewisse Skepsis gegenüber anderen Menschen und deren Verlässlichkeit. So ist sein Gehirn nun synaptisch verknüpft, mit diesem Gehirn wird es groß und mit diesen Erinnerungen aus seiner Kindheit vergleicht der spätere Erwachsene alle weiteren Erfahrungen, die er mit anderen Menschen macht. Durch die Prägung seines Gehirns sammelt er jedoch keine objektiven Erfahrungen, sondern diese werden durch den ständigen Abgleich mit alten Erinnerungen subjektiv verzerrt. Das geht allen Menschen so, auch denen, die vorrangig schöne Erinnerungen abgespeichert haben. Sie haben dadurch viele positive Vorannahmen. Die Erfahrungen, die wir mit unseren Eltern machen, entscheiden also darüber, ob wir ein eher positives Selbst- und Menschenbild in uns tragen oder eher ein negatives.
Lernen und Erinnerung
Wenn wir uns bewusst machen, dass unsere Erfahrungen und Erinnerungen unsere Wahrnehmung beeinflussen, folgt daraus natürlich, dass wir auch alle neuen Informationen unter bestimmten – also unseren individuellen – Voraussetzungen aufnehmen. Lernen und Erinnern sind untrennbar miteinander verknüpft. Indem wir Informationen in unserem Gedächtnis abspeichern, lernen wir. Alles neu Erlernte prägt und verändert gegebenenfalls unsere zukünftigen Reaktionen. Ein alltägliches Beispiel: Wenn ich erfahre, dass der Mann meiner Arbeitskollegin schwer erkrankt ist, dann verhalte ich mich ihr gegenüber etwas aufmerksamer und rücksichtsvoller als ohne dieses Wissen.
Nun stellt sich jedoch die Frage, welche von den unzähligen Informationen, mit denen wir ständig konfrontiert werden, in unser Langzeitgedächtnis gelangt. Was hält unser Gehirn für speicherungswürdig? Da ist zunächst einmal das Kriterium der Wiederholung zu nennen. Je öfter wir eine bestimmte Information dargeboten bekommen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie uns merken. Durch sture Wiederholung können wir auch emotional total uninteressante Dinge lernen, wie beispielsweise die Wiedergabe einer Telefonnummer. Sehr eingängige und einfache Informationen können jedoch auch ohne Wiederholung sofort in unserem Langzeitgedächtnis landen. Kürzlich bin ich zum Beispiel über das englische Wort für Zecke gestolpert, nämlich »tick«. Ich fand das so eingängig, dass ich es mir nach nur »einmaliger Darbietung« gemerkt habe (es wäre zu schön, wenn das bei allen Vokabeln so wäre).
Ein zweites Kriterium, welches Lernen enorm erleichtert, sind Emotionen. Erlebnisse, die entweder ganz besonders schön oder ganz besonders schrecklich sind, merken wir uns am besten. Deswegen geraten die normalen Tage, die wir erleben, schneller in Vergessenheit als die außergewöhnlichen. Extrem gut abgespeichert werden zum Beispiel Erlebnisse, die uns in Angst versetzen. Angst sorgt dafür, dass wir uns in Sicherheit bringen, im äußersten Fall unser Leben retten. Angst hat deswegen in unserem Gehirn die höchste Priorität, sie ist sozusagen die VIP unter den Emotionen. Starke Angst blockiert die Vernunft. Im Zweifelsfall laufe ich nämlich lieber sofort davon, als lange darüber nachzudenken, ob das raschelnde Ding, das sich da auf dem Waldboden bewegt, ein morscher Zweig oder eine gefährliche Schlange ist. Angst sorgt dafür, dass wir sofort handeln – flüchten, angreifen oder uns tot stellen. Auf jeden Fall merken wir uns die Situation und den Ort, wo wir das Angsterlebnis hatten.
Das Gehirn von traumatisierten Menschen, die katastrophale Angsterlebnisse hatten, ist sogar in seiner Struktur verändert. Ihr Gehirn schlägt bereits bei Kleinigkeiten Alarm, auch wenn sie nur ganz entfernt mit der traumatischen Situation assoziiert sind. Eine Klientin von mir, die auf offener Straße einen Überfall überlebt hatte, litt in der Folge unter krassen Angstattacken, die durch laute Schritte ausgelöst wurden. Die lauten Schritte des Täters waren die Sinneserfahrung, die dem Überfall unmittelbar vorausging. Diese Schritte hatten sich als Gefahrensignal quasi in ihr Gehirn eingebrannt. Das Angstzentrum im Gehirn wird Amygdala (Mandelkern) genannt, sie ist ein wichtiger Bestandteil des limbischen Systems, dem Sitz unserer Gefühle. Man kann sich die Amygdala dieser Klientin wie einen rechtschaffenen Wächter vorstellen, der es einmal versäumt hatte, sie rechtzeitig vor der Gefahr des Überfalls zu schützen und nun, um diesen Fehler niemals zu wiederholen, bei jeder Kleinigkeit Alarm schlug. Einen ganz gravierenden und nachhaltigen Effekt auf unser Gehirn haben natürlich auch Kindheitstraumata. Hierauf werde ich in diesem Buch noch an anderen Stellen vertiefend eingehen.
Aber mal abgesehen von den traumatischen Erfahrungen, die uns das Leben leider bescheren kann, hat unser Gehirn grundsätzlich die schlechte Angewohnheit, sich auf die Probleme und Baustellen in unserem Leben zu konzentrieren und weniger auf die Dinge, die gut laufen. Leben wir beispielsweise in einer langjährigen, harmonischen Beziehung, so können wir uns wunderbar auf unsere Arbeit und andere Dinge konzentrieren, weil unser Gehirn die Beziehung sozusagen unter »läuft« abgehakt hat und sich nicht weiter mit ihr beschäftigt. Menschen, die hingegen in einer Achterbahn-Beziehung gefangen sind, leiden darunter, dass sie sich ganz schlecht auf andere Dinge konzentrieren können. Ich habe mit unzähligen Betroffenen gesprochen, die in eine Beziehung mit einem bindungsängstlichen Partner verstrickt sind. Bindungsängstliche verhalten sich in der Partnerschaft hochgradig ambivalent: Mal stellen sie ganz viel Nähe her, dann laufen sie wieder davon. Die Partner wissen überhaupt nicht, woran sie sind, und können sich keinen Reim auf das widersprüchliche Verhalten machen. Wie der arme Pawlow’sche Hund, den ich unter »Das Konsistenzprinzip« erwähnt hatte, erhalten sie extrem uneindeutige Signale und leiden unter hochgradiger Inkonsistenz. Ihre Gehirne drehen fast durch bei dem Bemühen, das Verhalten ihres Partners unter Kontrolle zu bekommen. Alle äußern sinngemäß das Folgende: »Ich kann an nichts anderes mehr denken. Gäbe es eine Pille zum Abschalten – ich würde sie sofort einnehmen!«
Es ist also kein Wunder, dass wir mit dieser Konfiguration unseres Gehirns schnell schlechter Stimmung sind und die von Jens Corssen beschriebene »gehobene Gestimmtheit« sich bestenfalls sporadisch einstellt. Würden wir unser Augenmerk hingegen mehr auf erfreuliche Dinge lenken und im Augenblick verweilen können, so hätten wir unsere Stimmung viel besser im Griff. Stattdessen kreisen unsere Gedanken oftmals um Situationen, die bereits in der Vergangenheit liegen, die also gar nicht mehr existieren, außer eben in unserer Erinnerung. Da hilft es, sich bewusst zu machen, dass es eigentlich nicht mehr die Situation an sich ist, die einen runterzieht, sondern nur unsere Gedanken an sie, also elektromagnetische Impulse im Gehirn. Das gleiche Prinzip gilt für unsere Zukunftsängste. Die meisten Szenarien, vor denen wir uns ängstigen, treten ohnehin nie ein.
Um diesem Negativ-Drall unseres Gehirns entgegenzuwirken, gibt es eine sehr einfache und wirksame Maßnahme, die heute auch oft empfohlen wird: Man beginnt, ein sogenanntes »Dankbarkeits-Tagebuch« zu führen. Man notiert sich jeden Abend, wofür man den Tag über dankbar sein durfte. Hierdurch ruft man sich vieles ins Gedächtnis, das im Alltag ansonsten als »selbstverständlich« untergeht. Dazu kann beispielsweise die warme Wohnung gehören, in der man lebt, die freundliche Kollegin, ein leckeres Mittagessen und so weiter. Der Effekt beim Dankbarkeitstagebuch liegt darin, dass man bereits nach wenigen Tagen des fleißigen Notierens viel aufmerksamer registriert, worüber man sich im Alltag freuen kann und hierdurch dem Gehirn ein Schnippchen schlägt.
Unser Selbstbild bestimmt, was wir wahrnehmen
Ob wir anderen gefallen und Bindung erhalten oder ob wir auf Ablehnung stoßen und im schlimmsten Fall von der Gemeinschaft ausgeschlossen werden, hängt davon ab, wie andere Menschen uns wahrnehmen. Dass wir positiv wahrgenommen werden, dass wir gut ankommen, ist essenziell für uns. Nicht wenige Menschen behaupten, dass es ihnen gleichgültig sei, was andere von ihnen denken. Zuerst einmal zeigt diese Aussage aber, dass die betreffenden Menschen sich große Mühe geben, nicht von der Anerkennung anderer abhängig zu sein – was irgendwie paradox ist: Denn dass man sich große Mühe gibt, beweist ja, dass die Anerkennung anderer eben doch wichtig ist.
Das Bedürfnis nach menschlicher Anerkennung hat nichts mit übertriebener Eitelkeit zu tun; wir werden mit diesem Bedürfnis geboren. Das liegt zum einen daran, dass wir Menschen ohne die Gemeinschaft nicht überlebensfähig sind. Ohne Beziehungen gäbe es keine Verteilung der Gene, ohne diese keine Verbreitung der Menschheit. Die Gene sind quasi die Währung der menschlichen Evolution, so wie Geld die Währung einer Firma ist. Hat die Firma kein Geld mehr, geht sie pleite und ihre Existenz löst sich auf. So verhält es sich auch mit den Genen und der Menschheit. Deswegen legt uns die Evolution so unheimlich viel Motivation in die Wiege, uns an andere Menschen zu binden. Gleichzeitig ist es so, dass sehr viele Menschen den oben angesprochenen »Sinn des Lebens« aus ihren Beziehungen zu anderen bekommen. Die größte Sinnlosigkeit erleben wir, wenn wir wichtige Beziehungen verlieren – wenn ein geliebter Mensch oder auch ein geliebtes Tier stirbt, wenn eine Liebesbeziehung oder eine Freundschaft zerbricht. Dass es bei unseren Beziehungen nicht nur um die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse oder um Glücksgefühle geht, zeigt unser Umgang mit Streit oder Differenzen in unseren Verbindungen. Wie auch der bekannte Lebenskunst Philosoph Wilhelm Schmid in einem Interview sagte: »Der Geliebte oder Freund macht einen nicht jeden Tag und jede Nacht glücklich, trotzdem trennt man sich nicht sofort – aus dem einfachen Grund, dass man einen tieferen Sinn in diesem Zusammenhalt erkennt«7.
Damit wir aber solche Bindungen überhaupt knüpfen können, müssen wir gefallen. Wenn wir keinem anderen Menschen gefallen, bekommen wir keine Bindung. Also versuchen wir alle, anderen zu gefallen. Mit welchen Mitteln wir das angehen, hängt dabei von unserem kulturellen Umfeld und unserer Zielgruppe ab. Ein Gangsta Rapper findet andere Maßnahmen als eine Ordensschwester.
Unser Gehirn rechnet also ständig Chancen und Risiken aus, womit wir wohl auf Zustimmung oder auf Ablehnung stoßen. Wie diese Kalkulation ausfällt, hängt ganz wesentlich davon ab, wie wir uns selbst wahrnehmen, also von unserem Selbstbild. Finden wir uns im Großen und Ganzen okay, gehen wir davon aus, dass die meisten anderen Menschen uns mögen oder uns zumindest nicht ablehnen. Wir projizieren unser positives Selbstbild in die Köpfe der anderen: »Ich bin doch okay, so wie ich bin. Warum sollte jemand etwas gegen mich haben?« Diese innere Überzeugung ist kaum zu erschüttern. Wenn wir uns dagegen selbst nicht genügen, haben wir ständig das Gefühl, uns furchtbar anstrengen zu müssen, um akzeptiert zu werden. Gleichzeitig zweifeln wir an, dass unsere Bemühungen erfolgreich sind. Wir gehen dann davon aus, dass auch unser Gegenüber unsere vermeintlichen Mängel bemerkt. Unser Selbstbild entscheidet also darüber, wie wir die Chancen für unser soziales Überleben berechnen.
Ein Fallbeispiel: Maja (37 Jahre) wurde sehr streng erzogen. Ihre Eltern verfolgten die an sich gute Absicht, sie bestmöglich zu fördern. Sie haben dabei jedoch etwas zu viel des Guten getan. In ihrer Kindheit und Jugend hat Maja viel Drill erfahren, die Kernbotschaft ihrer Eltern lautete: Es geht immer noch besser! Was Majas kindliches Gehirn jedoch aus dieser Erziehung zog, ist ein tief verinnerlichtes Lebensgefühl, das sich zusammenfassen lässt mit: »Ich bin nicht gut genug!« Dieses Lebensgefühl ist auch als ein Glaubenssatz zu bezeichnen. Majas Gehirn wurde durch die zwar gut gemeinten, aber schlecht umgesetzten Absichten ihrer Eltern hinsichtlich ihres Selbstbildes und ihres Selbstwertgefühls negativ geprägt. Diese Prägung hat weitreichende Auswirkungen auf ihre Selbstwahrnehmung und somit auf die Art und Weise, wie sie andere Menschen wahrnimmt. In Majas Fall führt ihr negatives Selbstbild dazu, dass sie davon ausgeht, dass andere Menschen sie kritisch wahrnehmen. Unbewusst unterstellt sie also anderen, dass sie genauso über sie denken, wie sie selbst über sich denkt.
Jeder Mensch verinnerlicht durch seine persönliche Erziehung Glaubenssätze, die seinen Selbstwert und sein Selbstbild ausdrücken. Im Guten wie im Schlechten. Wären Majas Eltern einfühlsamer gewesen und hätten sie gefördert, ohne sie hierbei zu überfordern, dann hätte Maja ein anderes Selbstbild mit anderen Glaubenssätzen verinnerlicht. In diesem Fall hätte sie höchstwahrscheinlich ein positives Selbstbild verinnerlicht, das sich in Glaubenssätzen wie »Ich bin gut!« Und: »Ich kann viel erreichen!« ausdrücken würde. Dieser Vorgang – also wie wir verinnerlichen, was uns unsere Eltern über unseren Wert spiegeln – wird in der Psychologie als Introjektion bezeichnet. (Wie gesagt, dieser Prozess läuft auf Elternseite meistens unbewusst und somit unbeabsichtigt ab.) Der Begriff der Introjektion stammt ursprünglich aus der Psychoanalyse und bezieht sich auf die Verinnerlichung negativer Einstellungen zu sich selbst und der Welt. Ein Introjekt ist sozusagen wie ein »Fremdkörper«, der sich im Gehirn eingenistet hat und die psychischen Funktionen der Wahrnehmung, der Emotion, der Kognition und schließlich des Verhaltens störend beeinflusst. Diese Introjektionen, die ein Kind durch negative Einflüsse und Spiegelungen seiner Eltern (und anderer Personen) in sich aufnimmt, bezeichne ich als »Schattenkind«. Im Prinzip sind natürlich auch die positiven Einstellungen zu uns selbst und der Welt Introjekte, auch wenn der Begriff sich in der Psychoanalyse nur auf negative Überzeugungen bezieht.
Kleiner Exkurs: Inneres Kind, Schattenkind und Sonnenkind
Die Prägungen unseres Gehirns, die in unserer Kindheit entstehen, werden in der Psychologie als das »innere Kind« bezeichnet. Das innere Kind ist eine Art Metapher für die psychischen Programme, die sich durch die Interaktion des Kindes mit seiner Umwelt herausbilden. Der Terminus »das innere Kind« (oder auch: das Kindheits-Ich) bezieht sich allerdings nicht nur auf die problematischen Introjektionen, die wie ein Fremdkörper in uns wirken, sondern auch auf psychisch gesunde Anteile, also ein positives Selbstbild und einen stabilen Selbstwert. Wir alle tragen sowohl problematische als auch gesunde und stärkende Prägungen in uns. Für Letztere verwende ich den Begriff des »Sonnenkindes«. Wobei das Sonnenkind in meinem Ansatz nicht nur für unsere psychisch gesunden Anteile steht, sondern auch für die Veränderungsmöglichkeiten, über die wir als Erwachsene verfügen. Das Sonnenkind beinhaltet somit auch die psychischen Selbstheilungskräfte, die wir in uns entfalten können.
Majas negatives Selbstbild, das sie unwissentlich und – von ihren Eltern unbeabsichtigt – übernommen hat, ist ihre Introjektion, ihr Schattenkind. Solange sie dies nicht reflektiert und für sich auflöst, wird sie sich mit diesem negativen Programm identifizieren, was bedeutet, dass sie von ihrer gefühlten Minderwertigkeit überzeugt ist und daran glaubt. Ihre Selbstwahrnehmung bestimmt, wie sie andere Menschen wahrnimmt. Weil sie sich als minderwertig empfindet, projiziert sie in andere Menschen häufig eine gewisse Überlegenheit. Die meisten anderen Menschen sind in ihrer Wahrnehmung, in ihren »Schattenkind-Augen«, potenzielle Angreifer und keine ihr wohlgesonnenen Mitmenschen.
Der Begriff der Projektion bedeutet, dass man Inhalte, die eigentlich zu einem selbst gehören, auf andere Menschen überträgt und diese hierdurch verzerrt wahrnimmt. Maja projiziert also durch ihre Schattenkind-Augen – deren subjektiven Blickwinkel nur sie hat – eine gewisse Überlegenheit und somit potenzielle Bedrohlichkeit auf andere Menschen.
Grundsätzlich läuft alles, was wir wahrnehmen, durch den subjektiven Filter unserer persönlichen Erinnerungen und unseres Selbstbildes. Reize, die wir aus der Außenwelt empfangen, werden immer subjektiv interpretiert. Die Interpretation der Wirklichkeit bestimmt unsere Gedanken, Gefühle und unser Verhalten. Und umgekehrt beeinflussen unsere Gedanken und Gefühle unsere Wahrnehmung der »Wirklichkeit«. Ich empfange also einen Reiz aus der Außenwelt – zum Beispiel zieht mein Gegenüber die Mundwinkel nach oben –, dann interpretiere ich diesen Reiz (blitzschnell und unbewusst) entweder als ein Lächeln oder als ein »blödes Grinsen«. Aus dieser Interpretation ergibt sich ein angenehmes Gefühl (Freude) oder ein unangenehmes (Ärger), das wiederum einen Verhaltensimpuls auslöst: Ich lächle beispielsweise zurück oder ich mustere mein Gegenüber mit genervtem Gesichtsausdruck. »Auf Reiz folgt Interpretation, folgt Emotion, folgt Verhalten« lautet die kurze Formel, welche die Art und Weise beschreibt, wie wir unseren Mitmenschen begegnen. Allerdings hängen unsere Interpretationen auch von unseren tagesaktuellen Emotionen ab. Habe ich sowieso schlechte Laune, bin ich eher geneigt, die hochgezogenen Mundwinkel als blödes Grinsen zu interpretieren. Habe ich gute Laune, sehe ich ein Lächeln. Habe ich ein Schattenkind introjiziert, das sich minderwertig fühlt, so wie Maja, dann bin ich grundsätzlich geneigt, meine Mitmenschen negativ verzerrt wahrzunehmen.
Kurz gefasst kann man sagen, dass die allermeisten Kommunikationsprobleme und somit Störfaktoren eines friedlichen sozialen Miteinanders durch den Zusammenhang zwischen Introjektion und Projektion erklärt werden können beziehungsweise durch die Wahrnehmungsverzerrungen, die durch unsere persönliche Interpretation äußerer Ereignisse (Reize) stattfinden. Das gilt sowohl für den Konflikt zwischen zwei Nachbarn als auch für jenen zwischen zwei Staaten. Permanent geschieht es, dass man aufgrund seiner eigenen, subjektiven Ängste andere Menschen, Menschengruppen und Staaten als potenzielle Aggressoren wahrnimmt. Sie werden damit aufgrund der eigenen verzerrten Wahrnehmung zu einer Art Erweiterung unseres Selbst. Deswegen ist es außerordentlich wichtig, diese Prozesse zu reflektieren und sie letztlich aufzulösen.
Zusammenfassung: Unsere psychische Grundstruktur
Ich möchte an dieser Stelle die wesentlichen psychischen Funktionsweisen, die ich bisher beschrieben habe, noch einmal zusammenfassen.
Die Evolution verfolgt den Zweck, dass wir unsere Gene verbreiten. Anders formuliert: Sie verfolgt den Zweck, dass wir leben. Diese rein evolutionsbiologische Sicht auf das menschliche Dasein ist allerdings zu kurz gegriffen für das, was wir unter dem »Sinn des Lebens« verstehen. Es gehört zur menschlichen Spezies dazu, dass der Mensch mehr möchte, als nur seine Gene weiterzugeben und mit anderen zu konkurrieren. Wir Menschen brauchen einen (subjektiven) Sinn. Wir brauchen Werte und eine Vorstellung davon, wozu wir unser Leben nutzen wollen. Sonst verlieren wir uns über kurz oder lang in Orientierungslosigkeit.