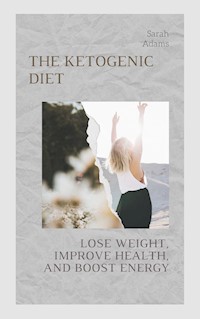6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Rome Lovestory
- Sprache: Deutsch
Romantisch, verträumt – eine zuckersüße Small-Town-Romance von der SPIEGEL-Bestsellerautorin Sarah Adams Amelia ist der helle Stern am Pophimmel, aber sie ist einsam und ausgebrannt. Kurzerhand steigt sie in ihren Wagen, um aus ihrem Leben auszubrechen. Ihr Ziel ist die Kleinstadt Rome, doch es läuft nicht ganz wie geplant: Sie landet im Vorgarten des mürrischen Kuchenbäckers Noah Walker. Da die Reparatur des Autos dauert, kommt sie in Noahs Gästezimmer unter, der nicht allzu begeistert davon ist. Doch mit jedem neuen Tag gelingt es Amelia mehr, hinter Noahs harte Schale zu schauen. Was sie dort entdeckt, lässt ihr Herz höherschlagen. In seiner Nähe fühlt sie sich geborgen und bei der herzlichen Walker-Familie wie zu Hause. Aber Amelias Auszeit endet bald. Dann muss sie sich von Rome verabschieden – und auch von Noah … Eine erfolgreiche Popsängerin, ein grummeliger Kleinstadt-Bäcker und romantische Verwicklungen »Eines der besten Bücher des Jahres.« NPR<
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Sarah Adams
When in Rome
Roman
Über dieses Buch
Noah ist nicht davon angetan, dass eine Fremde mit ihrem Auto nachts in seinem Vorgarten landet. Widerwillig lässt er Amelia in seinem Gästezimmer übernachten. Aber weil die Reparatur des Wagens dauert und seltsamerweise das einzige Bed & Breakfast im Ort ausgebucht ist, muss Amelia auf unbestimmte Zeit bei ihm wohnen. Obwohl Noah sich zu Amelia hingezogen fühlt, ist er entschlossen, sich nicht zu verlieben. Zu tief sitzt der Schmerz der Vergangenheit. Außerdem hätte eine Beziehung zwischen einem Kleinstadtbäcker und einem Popstar nie eine Chance, da ist sich Noah sicher. Allerdings sind seine Familie und die Bewohner von Rome da ganz anderer Meinung.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Schon als Kind träumte Sarah Adams davon, Schriftstellerin zu werden. Sie hat zwei Töchter, ist mit ihrem besten Freund verheiratet, hat ein Faible für Geschichte und ist süchtig nach Kaffee. Ihren ersten Roman schrieb sie, als ihre Kinder schliefen und sie keine Ausrede mehr hatte, es länger aufzuschieben. Mit ihren Geschichten möchte sie die Leserinnen und Leser zum Lachen, vielleicht sogar zum Weinen bringen – ihnen aber immer glückliche Lesestunden schenken.
Nicole Hölsken arbeitet seit mehr als zwei Jahrzehnten als Übersetzerin aus dem Englischen und ist für zahlreiche Verlage tätig. Neben der Arbeit an Texten interessiert sie sich fürs Fotografieren, Laufen, Tanzen, Windsurfen, vegane Ernährung und Meditation.
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
Amelia
Noah
Amelia
Noah
Amelia
Noah
Amelia
Amelia
Noah
Amelia
Amelia
Noah
Amelia
Amelia
Noah
Noah
Amelia
Noah
Amelia
Noah
Amelia
Noah
Amelia
Amelia
Noah
Amelia
Amelia
Amelia
Noah
Amelia
Amelia
Noah
Amelia
Amelia
Amelia
Noah
Amelia
Danksagung
Für meine Grandma Betty.
Ich wünschte, du hättest das hier lesen können, denn Mabel hätte dir gefallen. Ich vermisse dich, dein Lächeln und deinen Santa-Claus-Pulli.
Seit meiner Geburt sehne ich mich nicht nur von ganzem Herzen nach Zuneigung, sondern verspüre auch das innige Bedürfnis, sie anderen zu schenken.
Audrey Hepburn
1
Amelia
Das hier ist okay, oder? Es geht mir gut?
Ich hole tief Luft und umklammere das Lenkrad etwas fester.
»Ja, Amelia, dir geht es gut. Sogar phantastisch. Du bist genau wie Audrey Hepburn, nimmst dein Leben in die Hand, uuuund … du führst Selbstgespräche … so ganz in Ordnung bist du also doch nicht, aber in Anbetracht der Umstände semiokay«, sage ich und spähe mit zusammengekniffenen Augen auf die dunkle Straße vor meiner Windschutzscheibe. »Ja. Semiokay passt.«
Nur dass es draußen stockdunkel ist und mein Auto klingt wie ein Wäschetrockner, in dem jemand ein paar Münzen vergessen hat. Obwohl ich nicht viel von Autos verstehe, weiß ich, dass diese Geräusche nichts Gutes verheißen. Mein kleiner Toyota Corolla, der mich seit der Highschool begleitet, in dem ich saß, als ich mit achtzehn Jahren zum ersten Mal meinen eigenen Song im Radio hörte, in dem ich vor zehn Jahren zu Phantom Records fuhr, um meinen Plattenvertrag zu unterschreiben, jenes Auto, das mir seither so sehr ans Herz gewachsen ist, gibt wahrscheinlich bald den Geist auf. Das macht mich umso trauriger, da die Sitzpolster immer noch nach meinen alten Volleyball-Knieschonern riechen.
Nicht heute, Satan.
Wie wild streichele ich das Armaturenbrett, als hoffte ich, damit den dort verborgenen Dschinn herbeirufen zu können, der mir drei Wünsche gewährt. Statt der Wünsche erreicht mich jedoch nur ein Funkloch. Die Musik, die ich gerade streame, bricht ab, und der Google-Maps-Pfeil verschwindet. Dabei kann nur er mich aus diesem dunklen Wald mitten im Nirgendwo herausführen, um potenziellen, dort lauernden Serienkillern zu entgehen.
Auweia, das ist ja wie im Horrorfilm! Und ich bin wie die Frau, der die Leute im Kino ein »Du naive Kuh!« entgegenschleudern, während sie sich Popcorn in ihre gierig grinsenden Mündern stopfen. War diese ganze Aktion etwa ein Fehler? Womöglich habe ich meinen Verstand zu Hause in Nashville gelassen, genau wie mein schmiedeeisernes Tor und mein Security-System, das Fort Knox alle Ehre machen würde. Und Will, meinen phantastischen Sicherheitsmann, der getreulich vor meinem Haus Stellung bezogen hat und Fremde daran hindert, sich auf mein Grundstück zu schleichen.
Vorhin sind meine Managerin Susan und ihre Assistentin Claire meinen knallvollen Terminkalender für die nächsten drei Wochen mit mir durchgegangen. Danach steht eine neunmonatige Tournee an. Das Problem ist nur, dass ich gerade den letzten Tag der mörderischen, dreimonatigen Proben für diese Tournee hinter mir habe. Beinahe jeder einzelne Tag ist für das Erlernen der Choreographie, das Stage Blocking, das Festlegen der Setlist, ein rigoroses Trainingsprogramm und das Proben der Songs draufgegangen. Und die ganze Zeit über musste ich lächeln und so tun, als fühlte ich mich innerlich nicht wie ein verfaulender Komposthaufen.
Schweigend habe ich dagesessen, während Susan unaufhörlich geredet hat und den langen, schlanken, perfekt manikürten Finger immer wieder über den Bildschirm ihres Tablets hat gleiten lassen, um mir die Termine vorzulesen. Termine, über die ich mich eigentlich hätte freuen sollen. Derentwegen ich mich sogar geehrt fühlen sollte! Aber irgendwann mittendrin … habe ich abgeschaltet. Ihre Stimme ist zu einem Charlie-Brown-ähnlichen wah-wah-wah verblasst, bis ich nur noch das Pochen meines Herzens gehört habe. Laut und schmerzhaft. Mein ganzer Körper war taub. Am meisten hat mich jedoch schockiert, dass Susan es nicht mal zu bemerken schien.
Vielleicht bin ich auch einfach nur allzu gut darin, meine Gefühle zu verbergen. Meine Tage laufen folgendermaßen ab: Ich lächele irgendwem zu meiner Linken zu und nicke. Ja, danke. Dann lächele ich jemandem zu meiner Rechten zu und nicke wieder. Ja, natürlich kann ich das machen. Susan reicht mir ein perfekt von meinem PR-Team zusammengestelltes Script, und ich lerne es auswendig. Meine Lieblingsfarbe ist Blau, etwa jene Farbe, die mein Givenchy-Kleid haben wird, das ich bei der Verleihung der Grammys tragen werde. Aber ja, den Großteil meines Erfolgs verdanke ich meiner liebe- und hingebungsvollen Mom. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht voller Dankbarkeit für meine Karriere und meine großartigen Fans bin.
Höflich, höflich, höflich.
Erst als heiße Tränen auf meinem Oberschenkel landen, wird mir klar, dass ich weine. Eigentlich sollte ich beim Gedanken an all das nicht weinen. Ich bin eine zweifache Grammy-Gewinnerin und habe einen Neunzig-Millionen-Dollar-Vertrag mit dem Top-Musiklabel in dieser Branche in der Tasche, also sollte ich ganz gewiss nicht in Tränen ausbrechen. Es steht mir nicht zu, zu weinen. Und definitiv sollte ich nicht mitten in der Nacht in meinem alten Auto sitzen und überstürzt die Flucht ergreifen.
Vor meinem geistigen Auge sehe ich die Menschen, die ich im Stich lasse, und das schlechte Gewissen ist kaum zu ertragen.
Nie zuvor bin ich zu einem Interview nicht erschienen. Menschen zu enttäuschen oder mich zu verhalten, als sei meine Zeit wertvoller als die ihre, ist mir ein Gräuel. Zu Beginn meiner Karriere hatte ich mir geschworen, mir niemals etwas auf meinen Erfolg einzubilden. Es ist mir wichtig, so entgegenkommend wie möglich zu sein – auch wenn es weh tut.
Aber irgendetwas an den Worten, mit denen Susan sich heute Abend von mir verabschiedet hat, hat mich fertiggemacht. »Rae« – sie spricht mich lieber mit meinem Künstlernamen an statt mit meinem richtigen, der Amelia lautet – »Du siehst total erschöpft aus. Schau, dass du heute genug Schlaf kriegst. Bei dem morgigen Vogue-Interview werden Fotos hinter den Kulissen gemacht. Wäre doch eine Schande, wenn du dann Augenringe hättest. Obwohl … andererseits liegt der Erschöpft-Look voll im Trend …« Nachdenklich hat sie zur Decke empor geschaut, und beinahe habe ich erwartet, dass Gott selbst ihr eine Antwort auf die Frage geben würde, ob ich mit geschwollenen Augen nun akzeptabel war oder nicht. »Ach, vergiss, was ich gesagt habe! Das weckt Mitgefühl bei deinen Fans und verleiht dem Ganzen mehr Pepp.«
Dann hat sie sich abgewandt und den Raum verlassen. Ihre Assistentin Claire hat noch einen Moment gezögert, mir einen widerstrebenden Blick zugeworfen und dann den Mund geöffnet, als wollte sie etwas sagen. Ich habe mich dabei ertappt, mir genau das sogar inständig zu wünschen. Sieh doch, was mit mir los ist.
»Gute Nacht«, war alles, was sie schließlich gesagt hat, dann ist sie ebenfalls gegangen.
Viel zu lange habe ich in der dröhnenden Stille gesessen und mich gefragt, wie es so weit hatte kommen können. Und wie ich aus diesem Käfig wieder ausbrechen sollte, den ich mir versehentlich selbst geschaffen hatte?
Dieses Gefühl innerer Leere hatte mich zum ersten Mal vor ein paar Jahren heimgesucht. Ich hatte damals gehofft, dass es nur daran lag, dass ich den L.A.-Lifestyle satthatte und eine Veränderung brauchte. Also hatte ich meine Siebensachen zusammengepackt und war nach Nashville, Tennessee, gezogen, wo ich der Musikszene immer noch nah bin, aber nicht mehr ganz so im Fokus der Öffentlichkeit stehe. Doch ohne Erfolg. Die Leere ist mir gefolgt.
Die meisten Menschen wenden sich bei derlei Problemen an ihre Familie, manche an Freunde und manche an die orakelhaften Magic-8-Balls. Ich hingegen wende mich an den einen Menschen, der mich niemals im Stich lässt: Audrey Hepburn.
Heute Abend habe ich mit geschlossenen Augen den Finger über meine DVD-Sammlung von Audrey Hepburn – ja, ich besitze immer noch einen DVD-Player – wandern lassen und mit Hilfe von ene, mene muh Ein Herz und eine Krone ausgewählt. Eine katastrophale Entscheidung. Audrey schlüpft darin in die Rolle von Prinzessin Ann, die sich wie ich fühlt, nämlich einsam und überfordert, weshalb sie nachts aus dem Palast flieht, um Rom zu erkunden. Oder vielmehr torkelt sie in die Nacht hinaus, weil sie ein Beruhigungsmittel intus hat, aber das spielt keine Rolle.
Und plötzlich habe ich es vor mir gesehen. Das war die Antwort, die ich gesucht hatte. Ich musste fort aus diesem Haus, von Susan, von meinen Pflichten, einfach von allem und nach Rom flüchten.
Allerdings würde ich in drei Wochen auf Tournee gehen, weshalb Italien viel zu weit weg war. Also habe ich mich mit dem nächstgelegenen Rom begnügt, das Google Maps mir vorgeschlagen hat. Rome in Kentucky. Eine zweistündige Autofahrt von meinem Haus entfernt und Google zufolge ausgestattet mit einem hübschen, kleinen Bed and Breakfast mitten in der Stadt. Der perfekte Ort, um mich zu sammeln und meine Nerven zu beruhigen.
Also bin ich in die Garage mit den drei Autos gegangen, habe die beiden teuren Fahrzeuge aus meinem Fuhrpark ignoriert und die Abdeckplane von dem liebgewonnenen alten Gefährt gezogen, das ich während der letzten zehn Jahre hier versteckt hatte. Ich habe den Motor angelassen und bin davongefahren, um mich auf die Suche nach Rome zu machen.
Und jetzt stehe ich auf dieser unheimlichen Nebenstraße und glaube, dass meine emotionale Taubheit ein wenig nachlässt, denn ich erkenne so langsam, wie lächerlich mein Verhalten ist. Irgendwo im Himmel sieht Audrey auf mich herab und schüttelt den Kopf mitsamt Heiligenschein.
Ich werfe einen Blick auf mein Handy. Wo sonst die Signalbalken sind, prangen nun die Worte Kein Netz. Ich könnte schwören, dass sie mir zuzwinkern. Mich verhöhnen. Das war ja wohl eine Schnapsidee. Jetzt bist du ein gefundenes Fressen fürs nächste True-Crime-Format.
Kein Problem. Alles ist in Ordnung. »Hör auf zu heulen und gib dieser düsteren Stimmung einen Tritt in den Hintern, Amelia!«, sage ich laut zu mir selbst, denn mit wem soll man sonst reden, wenn man während eines Nervenzusammenbruchs allein im Auto sitzt.
Mein Auto muss nur noch zehn Minuten durchhalten, dann bin ich von dieser supergruseligen Straße runter und im Bed and Breakfast der kleinen Stadt angelangt. Danach kann ich meinem Wagen den würdigen Tod gönnen, den er verdient hat – denn dort gibt es Straßenlaternen und hoffentlich keinen mordlüsternen Landei-Joe, der nur darauf wartet, meinen Leichnam in irgendeinen Graben zu werfen.
Aber, o je, was ist das? Mein Auto fängt an zu stottern und hüpft – und zwar buchstäblich, als befände ich mich Anfang der 2000er und hätte ein Hydraulikfahrwerk nachrüsten lassen. Fehlt nur noch die lilafarbene Unterbodenbeleuchtung, und fertig ist die Zeitreise!
»Nein, nein, nein«, flehe ich meinen Wagen an. »Tu mir das jetzt nicht an!«
Aber er tut es doch.
Stotternd und alles andere als würdevoll kommt er am Rand der stockdunklen Straße zum Stehen. Verzweifelt versuche ich, den Motor wieder zum Laufen zu kriegen, doch davon will er nichts wissen. Mehr als ein leises Klicken kann ich ihm nicht mehr entlocken. Immer noch umklammern meine Hände das Lenkrad, während ich in die reglose Nacht hinausschaue und mir eine Erkenntnis kommt. Ich habe versucht, mich ohne Susans Hilfe auf ein Abenteuer einzulassen, und bin schon am ersten Abend nach zwei Stunden gescheitert. Wenn das nicht das Erbärmlichste ist, das man je gehört hat, dann weiß ich auch nicht. Ich kann zwar vor Tausenden von Leuten auf der Bühne stehen und singen, bin aber nicht in der Lage, von einem Bundesstaat in den nächsten zu fahren.
Mir bleibt nichts anderes übrig, als in meinem Auto sitzen zu bleiben und bis zum Morgen zu warten, damit ich im Sonnenlicht erkennen kann, ob mir jemand eine blutige Kettensäge entgegenstreckt oder nicht. Also gebe ich mich geschlagen, lehne den Kopf zurück und schließe die Augen. Morgen früh werde ich eine Möglichkeit finden, Susan anzurufen. Ich werde sie bitten, mir einen Wagen zu schicken, und dann werde ich mich, wenn nötig mit Gewalt, an den eigenen Haaren aus dieser melancholischen Stimmung ziehen.
Tock, tock, tock.
Mit einem Aufschrei fahre ich so heftig auf meinem Sitz in die Höhe, dass ich mir den Kopf am Autodach stoße. Ich blicke aus dem Fenster, und – so ein Mist – da steht doch tatsächlich jemand vor meinem Auto! Das war’s. Gleich werde ich ermordet, und sobald E Hollywood News die wahre Geschichte meines Ablebens ausgestrahlt hat, bleibt nichts von mir übrig als die Erinnerung an mein grausiges Ende auf einem Acker.
»Alles in Ordnung? Brauchen Sie Hilfe?«, dringt die gedämpfte Stimme eines Mannes zu mir herein. Er leuchtet mit einer Taschenlampe ins Auto, wodurch ich kurz geblendet bin.
Ich halte die Hände hoch, nicht nur um meine Augen vor der Helligkeit zu schützen, sondern auch damit er mich nicht erkennt. »Nein, danke!«, schreie ich durch das geschlossene Fenster, während mir das Herz heftig gegen die Rippen pocht. »Alles bestens! Ich … Ich brauche keine Hilfe!« Schon gar nicht mitten in der Nacht von einem fremden Mann.
»Sind Sie sicher?«, fragt er, und endlich geht ihm auf, dass er mir mit seiner Taschenlampe genau in die Augen leuchtet, weshalb er sie von meinem Gesicht abwendet. Zugegeben, er hat eine angenehme Stimme. Ein wenig rau und gleichzeitig weich.
»Ich bin sicher!«, antworte ich in heiterem Ton, denn Frohsinn zu verbreiten ist meine Spezialität, auch wenn die Welt um mich in Scherben zerbricht. »Alles unter Kontrolle!« Ich gebe ihm das Okay-Zeichen, um meine Antwort zu unterstreichen.
»Sieht aus, als hätte Ihr Auto den Geist aufgegeben.«
Das darf ich keinesfalls zugeben. Damit würde ich ihm im Grunde gleich zu verstehen geben, dass ich leichte Beute bin. Außerdem hat mein Handy keinen Empfang. Soll ich lieber gleich aussteigen, damit Sie mich verschleppen können, oder würde es Ihnen mehr Spaß machen, selbst die Fensterscheibe einzuschlagen? Sie haben die Wahl!
»Nope. Ich … mache nur eine kleine Pause.« Ich lächle angespannt, wende aber den Großteil meines Gesichts ab in der Hoffnung, dass er die millionenschwere Künstlerin in diesem zerbeulten Corolla nicht erkennt.
»Ihr Motor qualmt.« Er richtet die Taschenlampe auf die dichte Rauchwolke, die unter der Motorhaube hervorquillt. Kein gutes Zeichen.
»Ach … das«, antworte ich so lässig wie möglich. »Das kommt schon mal vor.«
»Ihr Motor qualmt häufiger?«
»Mmh-hmm.«
»Ich kann Sie nicht verstehen.«
»Mmh-hmm«, wiederhole ich lauter und selbstbewusster als vorher.
»Na gut.« Offensichtlich kauft er mir das nicht ab. »Also meiner Meinung nach sollten Sie aussteigen. Es ist nicht sicher, in einem qualmenden Fahrzeug sitzen zu bleiben.«
Ha! Das würde ihm so passen, was? Um keinen Preis der Welt werde ich dieses Auto verlassen. Da kann seine Stimme noch so nett klingen.
»Nein, danke.«
»Ich werde Sie schon nicht ermorden, falls Sie das denken.«
Ich schnappe nach Luft und blicke zu der Silhouette des Mannes auf. »Warum sagen Sie so was? Jetzt denke ich tatsächlich, dass Sie mich umbringen werden.«
»Dachte ich mir«, erwidert er genervt. »Wie kann ich Ihnen beweisen, dass ich kein Mörder bin?«
Nachdenklich runzele ich die Stirn. »Gar nicht. So was kann man nicht beweisen.«
Er seufzt leise, begibt sich zur Vorderseite meines Wagens und bleibt im Licht der Scheinwerfer stehen. Jetzt kann ich ihn deutlich sehen, und wow. Der Typ ist eher ein Naturburschen-Ken als ein Landei-Joe. Er trägt Jeans und ein schlichtes, weißes T-Shirt. Sein sandblondes Haar ist an den Seiten kurz geschnitten, am Oberkopf jedoch wuschelig. Ein verstrubbelter, kurzer Bart ziert sein markantes Kinn, das wirklich super zu den breiten Schultern, dem schlanken Körper und dem Bizeps passt, der verführerisch zuckt, als er auf meine Motorhaube klopft. Der Gesamteindruck ist so … heiß, so dass ich mir plötzlich wünsche, meine Klimaanlage würde funktionieren.
»Könnten Sie die Motorhaube öffnen, damit ich mich überzeugen kann, dass dadrin nichts brennt?«
Oh-oh. Sorry, aber nein. Sexy oder nicht, keinesfalls werde ich diese Motorhaube öffnen. Was wenn er … na ja, ehrlich gesagt verstehe ich nichts von Autos und habe keine Ahnung, was er tun könnte, um meine Situation noch zu verschlimmern, doch sicher wird ihm irgendwas einfallen.
»Danke, aber ich brauche Ihre Hilfe nicht! Ich warte bis zum Morgen, und dann rufe ich einen Abschleppwagen«, schreie ich laut genug, dass er mich hört.
Er verschränkt die Arme vor der Brust. »Und wie wollen Sie einen Abschleppwagen rufen? Hier draußen gibt es kein Netz.«
Erwischt! So ein Mist!
»Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Mir fällt schon was ein. Sie können jetzt dorthin zurückkehren, wo auch immer sie herkommen.« Wahrscheinlich aus einem Busch am Straßenrand, hinter dem er nur darauf warten wird, dass ich mein sicheres Fahrzeug verlasse, damit er sich auf mich stürzen kann. Und ja, mir ist klar, dass ich es mit meiner Paranoia ein wenig übertreibe, aber wenn man daran gewöhnt ist, dass Stalker versuchen, über den Zaun des eigenen Grundstücks zu klettern oder sich als Klempner ausgeben, um an den Sicherheitsleuten vorbeizukommen und/oder einem Haarlocken schicken, die man sich nachts unters Kopfkissen legen soll, neigt man nun mal zu einem gewissen Verfolgungswahn gegenüber Fremden. Was der Grund dafür ist, warum ich das Haus niemals allein hätte verlassen dürfen. Ich muss einfach akzeptieren, dass ich nicht mehr ich selbst bin und es auch nie wieder sein werde.
Naturburschen-Ken denkt gar nicht daran, sich zu verziehen. Er kehrt zu meinem Fenster zurück, beugt sich wieder vor und legt dabei eine Hand fest auf die Oberseite meiner Tür, was mir einen hervorragenden Blick auf seine langen, muskulösen Arme gewährt.
»Ein qualmender Motor ist kein gutes Zeichen. Sie müssen aussteigen. Ich selbst werde Ihnen nichts tun, versprochen. Aber wenn dieses Auto in Flammen aufgeht, wird Ihnen durchaus etwas zustoßen. Ich versichere Ihnen, dass ich durch und durch ein vertrauenswürdiger Mensch bin.«
»Das sagen alle Mörder …, bevor sie jemanden ermorden.«
»Haben Sie schon viele Mörder kennengelernt?«
Ein Punkt für Naturburschen-Ken.
Ich lächle und versuche, möglichst freundlich zu antworten. »Sorry, aber … könnten Sie bitte gehen? Ich will wirklich nicht unhöflich sein, aber … Sie machen mich irgendwie nervös.«
»Steigen Sie aus, wenn ich mich verziehe?«
Ich stoße ein ersticktes Lachen aus. »Ganz sicher nicht! Wo kommen Sie überhaupt her?«
Mit einem Kopfnicken deutet der Mann auf die andere Seite meines Wagens und klingt alles andere als begeistert, als er erklärt: »Sie befinden sich in meinem Vorgarten.«
Oh.
Ich wende den Kopf, und tatsächlich: Ich stehe in einem Vorgarten. Seinem Vorgarten, wie es scheint. Beim Anblick des hübschen Hauses muss ich unwillkürlich lächeln. Klein. Weiß. Schwarze Fensterläden. Zwei Lampen neben der Eingangstür und eine Hollywoodschaukel auf der Veranda. Drum herum jede Menge Land. Es wirkt heimelig.
»Ich glaube, ich weiß bereits, was Sie auf die nächste Frage antworten werden«, sagt er. »Aber ich stelle Sie trotzdem: Wollen Sie reinkommen und jemanden anrufen? Ich habe einen Festnetzanschluss.«
Ich lache so laut über seinen Vorschlag, dass er zusammenzuckt. Herrje, das war nun wirklich unhöflich. Ich räuspere mich. »Sorry. Nein. Danke … Aber nein«, erkläre ich feierlich.
»Na gut. Wie Sie meinen. Wenn Sie irgendetwas brauchen oder zu dem Schluss kommen, dass ich kein Killer bin, finden Sie mich dadrinnen.« Er deutet auf das Haus und richtet sich wieder zu voller Größe auf. Ich schaue ihm hinterher, wie er seinen Vorgarten durchquert und sein Schatten im Haus verschwindet.
Nachdem er die Tür hinter sich geschlossen hat, stoße ich einen erleichterten Seufzer aus und lasse mich in meinen Sitz sinken. Ich versuche, mir keine Sorgen über den Rauch zu machen, der immer noch aus der Motorhaube hervorquillt, und nicht darüber nachzudenken, wie verdammt heiß es hier drin ist, dass ich Hunger habe und dringend auf die Toilette müsste, oder darüber, wie enttäuscht Susan von mir sein wird, wenn ihr klarwird, dass ich am Morgen nicht zu dem Interview auftauchen werde.
Nein, es geht mir nicht gut. Meine Lage ist definitiv alles andere als okay.
2
Noah
Sie sitzt immer noch da draußen. Jetzt schon zwanzig Minuten, ohne die Tür auch nur einen Spaltbreit geöffnet zu haben. Und ja, ich beobachte sie von meinem Fenster aus und verhalte mich genau wie der gruselige Psychopath, für den sie mich hält. Nur fürs Protokoll: Ich bin natürlich keiner, obwohl meine Meinung momentan wohl kaum zählt. Jedenfalls mache ich mir Sorgen. Draußen sind es sechsundzwanzig Grad, und sie hat keinerlei Luftzirkulation in ihrem Wagen. Wenn sie so weitermacht, wird sie dadrin ersticken.
Egal, ist nicht mein Problem.
Ich lasse die Jalousien zuschnappen und entferne mich vom Fenster. Nur um gleich darauf wieder zurückzukehren und erneut nach draußen zu schauen.
Verdammt, steig aus dem Auto aus.
Ich schaue auf die Uhr. 23:30 Uhr. Ich schicke ein Stoßgebet zu wem auch immer da oben hinauf, dass Mabel nicht zu sauer sein wird, wenn ich sie durch einen Anruf aufwecke. Nachdem ich ihre Nummer gewählt habe, muss ich sechs Klingeltöne abwarten, bis ich ihre heisere Stimme höre. Sie hat das Rauchen zwar kürzlich aufgegeben, aber nach vierzig Jahren Tabaksucht klingt sie nun mal nach wie vor kratzig. »Wer ist da?«
»Mabel, ich bin’s, Noah.«
Sie räuspert sich leise. »Was willst du, mein Sohn? Ich sitze schon dösend in meinem Sessel und wollte gleich ins Bett. Du weißt, wie schlecht ich schlafe. Du hast also hoffentlich einen guten Grund, mich aufzuscheuchen.«
Ich lächele. »Glaub mir, Mabel, um keinen Preis würde ich deinen Schönheitsschlaf stören, wenn es sich nicht um einen Notfall handeln würde.«
Sie tut immer so tough, aber eigentlich hat sie in Bezug auf mich ein butterweiches Herz. Mabel und meine Grandma waren beste Freundinnen – eigentlich sogar eher so was wie Schwestern. Mabel hat auch uns Kinder immer als Familie betrachtet, und wir sind uns vom Charakter sehr ähnlich. Mabel ist schwarz, ich bin weiß – wir haben beide nichts für Leute übrig, die ihre Nasen in unsere Angelegenheiten stecken. Sie selbst mischt sich allerdings leidenschaftlich gern in mein Leben ein.
»Ein Notfall? Nun spann mich nicht auf die Folter. Steht dein Haus in Flammen, Sohn?« Sie hat mich schon »Sohn« genannt, seit ich in den Windeln lag, und will sich das auch nach zweiunddreißig Jahren nicht abgewöhnen. Mir ist es egal. Im Gegenteil: Es ist sogar tröstlich.
»Nein, Ma’am. Du musst für mich mit einer Frau sprechen.«
Ungläubig hüstelt sie. »Mit einer Frau? Ich freue mich natürlich, dass du wieder nach einer Ausschau hältst, Schatz, aber nur weil du dich mitten in der Nacht einsam fühlst, habe ich noch lange keine Liste von abrufbereiten Ladys da, die …«
»Nein«, unterbreche ich sie energisch, bevor sich ihr ungebetener Wortschwall über mich ergießen kann. »Die Frau ist in meinem Vorgarten.«
Ich höre ein vertrautes Quietschen und stelle mir vor, wie Mabel in ihrem großen Fernsehsessel hochfährt. »Sei ehrlich, Noah, bist du betrunken? Das wäre durchaus in Ordnung, und ich würde dich nie verurteilen, das weißt du. Viele meiner besten Gebete zum Herrgott habe ich nach einer Nacht mit Jack Daniel’s gesprochen, aber ich möchte, dass du James oder eine deiner Schwestern anrufst, wenn du getrunken hast, nicht …«
Wenn ich sie jetzt nicht unterbreche, wird sie endlos weiterschwadronieren. »Mabel, der Wagen einer Frau hat in meinem Vorgarten den Geist aufgegeben. Der Motor qualmt, aber sie hat Angst, aus dem Auto auszusteigen, weil sie befürchtet, dass ich ihr etwas antun könnte. Du musst ihr versichern, dass ich harmlos bin, damit sie ihren Hintern aus der Karre schwingt.« Ich könnte natürlich auch meine Schwestern anrufen, doch die würden definitiv sofort irgendeine anzügliche Bemerkung darüber fallenlassen, wie lang es her ist, dass ich das letzte Mal Sex hatte, und die Frau anschließend fragen, ob sie in einer festen Beziehung ist. Deshalb sind meine Schwestern definitiv keine Option. Und genauso definitiv ist mir der Beziehungsstatus dieser Frau egal.
»Oh, warum hast du das nicht gleich gesagt, Baby! Geh nach draußen und lass mich mit dem armen Mädchen reden!« Ich höre einen Funken Aufregung in Mabels Stimme, der mir gar nicht passt und den ich nicht ermutigen will. Die ganze Stadt liegt mir in letzter Zeit damit in den Ohren, dass ich wieder eine Frau brauche, aber ich habe kein Interesse. Ich wünschte, man würde mich in Ruhe und einfach mein Leben leben lassen, doch so sind die Leute hier nicht. Wenn ich es recht bedenke, bin ich mir gar nicht so sicher, dass Mabel nicht etwas Ähnliches sagen wird wie meine Schwestern.
Wieder spähe ich durch die Jalousien und sehe, wie die Frau sich hektisch mit der Hand Luft zufächelt. Sicher muss ich gleich den Notarzt rufen und dann eine schlaflose Nacht im Krankenhaus mit ihr verbringen, weil sie sich da draußen einen Hitzschlag eingehandelt hat. Falls es so weit kommt, werde ich nie wieder meine Haustür öffnen. Wenn mir noch mal eine Frau das Leben versaut, nagle ich meine Fenster mit Brettern zu und verwandle mich in einen Einsiedler, der Sternsinger beschimpft.
»Komm nicht auf falsche Gedanken, Mabel. Hier geht es nicht um Romantik. Ich will nur verhindern, dass sie in dieser Hitze da draußen den Löffel abgibt.«
»Mmh-hmm. Ist sie hübsch?«
Ich massiere mir die Nasenwurzel und schließe die Augen, um die Verärgerung zu vertreiben, die mir die Wirbelsäule hinaufkriecht. »Da draußen ist es stockdunkel. Woher soll ich das wissen?«
»Oh, bitte. Ich habe dir eine Frage gestellt. Ich erwarte eine Antwort.«
Ich stöhne. »Ja.« Und zwar verdammt hübsch. Mit der Taschenlampe konnte ich nur einen kurzen Blick auf sie erhaschen, aber dann musste ich gleich zweimal hinsehen. Das dunkle Haar hatte sie am Hinterkopf zu einem Knoten zusammengefasst. Dazu ein hübsches Lächeln, dichte Wimpern und kluge, blaue Augen. Seltsamerweise habe ich das Gefühl, ihr schon einmal begegnet zu sein, obwohl ich ihr Auto hier in der Stadt noch nie gesehen habe. Wahrscheinlich eine Art Déjà-vu.
»Na dann«, sagt sie, wobei sie erfreut klingt. »Bring mich mal zu deiner holden Schönheit.«
»Mabel …«, erwidere ich warnend, während ich die Haustür öffne und nach draußen gehe. Die Sommerhitze droht mich sofort zu ersticken, und ich frage mich, wie die Frau so lange in ihrem Auto hat überleben können. Immerhin hat sie die Fenster geschlossen und keine Klimaanlage.
»Ach, sei still! Kommt schließlich nicht jeden Tag vor, dass dir eine Frau einfach so in den Schoß fällt. Also halt den Mund und gib ihr das Telefon.« Das ist der Preis dafür, dass ich den Großteil meines Lebens in Rome, Kentucky, verbracht habe. Meine Nachbarn behandeln mich immer noch wie den Jungen, der in seiner Superman-Unterhose durch die Stadt gerannt ist.
Ich lasse die Tür einen Spalt offen, um das Telefonkabel nicht einzuklemmen, und durchquere den Garten, um zu dem weißen Kleinwagen zu gelangen. Es ist zu dunkel, um ohne Taschenlampe ihren Gesichtsausdruck zu erkennen, aber an ihrer Silhouette kann ich sehen, dass sie mir den Kopf zuwendet. Sofort klappt sie ihren Sitz nach hinten. Sie versucht, mir weiszumachen, dass sie nicht mehr drinsitzt. Ich verkneife mir über diese lächerliche Aktion ein Grinsen.
Als ich ans Fenster klopfe, stößt sie einen Schrei aus. Mann, ist die schreckhaft.
»Hey …« Hallo? Miss? Lady, die gerade das Gras in meinem Vorgarten zerstört? »Äh … Hier. Ich habe eine Freundin von mir am Telefon. Sie wird sich für meinen Charakter verbürgen, damit Sie keine Angst mehr haben müssen, aus dem Auto zu steigen.«
Die Lady zieht am Hebel ihres Sitzes, so dass die Rückenlehne wieder nach oben schnellt. Sie schreit erneut auf, und ich muss mir auf die Innenseite meiner Wangen beißen. Aus großen Augen sieht sie durch das Fenster zu mir hoch, aber leider ist das Licht zu spärlich, um sie genau mustern zu können. Trotzdem bin ich jetzt überzeugt, dass ich sie kenne.
Sie runzelt die Stirn. »Haben Sie jetzt doch Netzempfang?«
»Nein.« Ich halte das Festnetztelefon hoch, damit sie es sehen kann.
Sie senkt den Blick darauf hinab und lacht. »Was ist denn das?!«
So wie sie das Ding anstarrt und darüber lacht, könnte man meinen, ich hielte eine seltene Tierart in der Hand. »Das bezeichnet man gemeinhin als Telefon.«
»Schon, aber …« Sie verstummt und lacht noch einmal amüsiert auf, ein Laut, der mich umweht wie eine kühle Brise. »Haben Sie das im Museum der fünfziger Jahre gestohlen? Jetzt kann das Mannequin mit dem blau karierten Kleid und dem passenden Haarband ja gar nicht mehr den Anruf ihres Ehemannes entgegennehmen, in dem er ihr mitteilt, dass er zu spät zum Abendessen kommt! Ach du meine Güte, dieses Kabel ist ja mindestens fünfzehn Meter lang!«
Ich kneife die Augen zusammen. »Werden Sie jetzt Ihr Fenster herunterkurbeln oder nicht, Sie Klugscheißerin?«
Sie zieht die Augenbrauen hoch. »Haben Sie mich gerade … Klugscheißerin genannt?«
»Ja.« Und ich werde mich nicht dafür entschuldigen. Schließlich habe ich nicht vor, mich mit ihr anzufreunden oder es ihr besonders schön zu machen – außerdem hat sie mein Telefon beleidigt. Ich liebe mein Telefon. Es ist ein gutes Gerät.
Seltsamerweise breitet sich ein strahlendes, atemberaubendes Lächeln auf ihrem Gesicht aus. Dann lacht sie. Mein Magen zieht sich zusammen, mein Herz pocht wie wild. Ich befehle beiden, den Mund zu halten und sich zu benehmen. Ganz sicher werde ich mich kein zweites Mal von einer Frau einwickeln lassen, die in unserer Stadt strandet. Ich werde ihr heute Abend helfen, weil es erstens das Richtige ist, sie zweitens nicht in meinem Vorgarten sterben soll, damit ich sie drittens so schnell wie möglich wieder loswerde.
»Na gut.« Sie kurbelt das Fenster nur etwa fünf Zentimeter herunter, so dass ich das Telefon hineinschieben kann. Unsere Finger berühren sich, und mein gesamter Körper reagiert darauf, denn anscheinend habe ich meiner Standpauke von eben nicht zugehört. Hektisch zieht die Frau das Telefon ins Auto und lässt das Fenster wieder hoch, bevor ich eine Mistgabel hineinstoßen und sie aufspießen kann.
Misstrauisch beäugt sie das Gerät, dann hält sie es sich ans Ohr. »Hallo?«
Mir ist klar, dass Mabel sofort das Kommando übernimmt, denn die Augen der Frau sind schon bald doppelt so groß wie zuvor, und sie lauscht hingerissen und aufmerksam. Fünf Minuten später rinnen mir Schweißperlen den Nacken hinab, während ich mit verschränkten Armen an ihrer Motorhaube lehne und darauf warte, dass diese Klugscheißerin aufhört, sich mit Mabel halb totzulachen.
»Hat er nicht!«, ruft sie beinahe johlend. Höchste Zeit, dieses Gespräch zu unterbrechen. Ich gehe also wieder zu ihrer Tür und klopfe ans Fenster. »Die Zeit ist um. Steigen Sie jetzt aus oder nicht?«
Sie hält einen Finger in die Höhe und beendet das Gespräch mit Mabel. »Aha … aha … ja. Okay, ich fand es auch schön, mit Ihnen zu reden!«
Ich muss einen Schritt zurücktreten, als – Überraschung, Überraschung – die Frau die Autotür öffnet und aussteigt, um mir mein Telefon zurückzugeben. Sie reicht mir nur bis zum Kinn, aber ihr unordentlicher, brünetter Dutt ragt mir bis zum Scheitel. Ich will es mir nicht eingestehen, doch sie ist süß – und sie hat Stil. Sie trägt ein blau-weiß gestreiftes T-Shirt, das sie in eine weiße Retro-Shorts gesteckt hat. Diese reicht bis zu ihrer winzigen Taille, umschmiegt die Kurven ihrer Hüften und endet ziemlich weit oben an ihrem Oberschenkel. In diesem Aufzug gehört sie samt Segelboot auf ein Schwarz-Weiß-Foto, aber ganz sicher nicht hierher. Innerhalb eines Wimperschlags wird sie wieder verschwunden sein, weshalb es keinen Zweck hat, ihr Aussehen zu bewundern.
Sie sieht zu mir auf, lässt dann jedoch den Blick nervös zwischen mir und meinem Haus hin und her wandern. »Ihre Freundin, Mrs. Mabel, hat Ihnen ein hervorragendes Leumundszeugnis ausgestellt, Noah Walker.« Meinen Namen spricht sie mit besonderer Betonung aus, triumphierend, weil sie meinen Namen kennt, ich den ihren jedoch nicht.
»Super. Da bin ich aber erleichtert.« Mein Ton ist trocken wie die Sahara. Ich verschränke die Arme vor der Brust. »Und Sie sind?«
Sofort ist es mit ihrer Ungezwungenheit vorbei, und sie weicht einen großen Schritt vor mir zurück, als wolle sie geradewegs wieder in ihre Todesfalle steigen. »Was interessiert Sie mein Name?«
»Ich will doch wissen, wem ich die Rechnung für den Rasensamen schicken soll.« Eigentlich sollte das weder freundlich noch scherzhaft klingen, aber sie scheint es trotzdem so zu verstehen.
Also lächelt sie und entspannt sich wieder. So ganz recht ist mir Letzteres nicht. Tatsächlich habe ich große Lust, ihr zu sagen, dass sie gar nicht erst anfangen soll, sich zu entspannen.
»Ich sag Ihnen was«, verkündet sie mit einem strahlenden Lächeln, das ich nicht erwidere. »Ich lasse morgen früh ein wenig Geld für Sie auf dem Küchentisch liegen.« In dem tiefen Schweigen, das dieser Äußerung folgt, hebe ich eine Augenbraue, bis ihr aufgeht, was sie da gerade gesagt hat. »Oh! Nein. Ich meinte damit nicht … ich halte Sie nicht für einen … Callboy.« Sie zuckt zusammen. »Schließlich können Sie gar kein Callboy sein, wenn Sie …«
Ich halte die Hand hoch. »Nicht weiterreden.«
»Gott sei Dank«, flüstert sie, lässt den Blick sinken und massiert sich die Schläfen.
Wer zum Teufel ist diese Frau? Warum fährt sie mitten in der Nacht durch mein Provinzkaff? Sie ist schreckhaft. Sie plappert nervös vor sich hin und scheint auf der Flucht zu sein.
»Wenn Sie wollen, können Sie heute Nacht in meinem Gästezimmer verbringen. Die Tür ist abschließbar, weshalb Sie sich im Schlaf sicher fühlen können … Es sei denn, Sie möchten irgendwen anrufen, der Sie noch abholen könnte?«
»Nein«, antwortet sie hastig. Ich kann ihre Miene nicht deuten. Wachsam und gleichzeitig trotzig, und verdammt, ich wünschte, es gäbe mehr Licht hier draußen. Ich zermartere mir das Hirn, woher ich sie kenne, komme aber immer noch nicht darauf.
»Ich …« Sie zögert, als suche sie nach den richtigen Worten. »Ich wollte eigentlich einige Zeit Urlaub in einem Bed and Breakfast hier in der Nähe machen. So seltsam es also sein mag, ich werde Ihr Angebot annehmen und heute Nacht in Ihrem Gästezimmer schlafen. Morgen kann ich dann den Abschleppdienst anrufen und den Wagen in die Werkstatt bringen lassen?« Warum klingt das wie eine Frage? Als warte sie darauf, dass ich dieses Vorgehen billige.
»Klar«, sage ich achselzuckend und lasse keinen Zweifel darüber, wie egal mir ihre Pläne sind, solange sie mich in Ruhe lässt.
Kurz nickt sie. »Okay, also. Ja … dann … zeigen Sie mir mal Ihr Haus, Noah Walker.«
Ein paar Minuten später habe ich ihr geholfen, die Reisetasche aus dem Kofferraum zu hieven und zur Haustür zu tragen. Ich betrete mein Haus und halte ihr die Tür auf. Als sie an mir vorübergeht, steigt mir ihr sanfter, süßer Duft in die Nase. Er unterscheidet sich deutlich vom Geruch meines nur nach mir riechenden Zuhauses, was mich für eine Sekunde ganz aus dem Konzept bringt. Ihr Duft ist wie ein Riesenradiergummi, der meine normalen Ich-bin-glücklich-allein-Gedanken auslöscht und widerwärtige kleine Herzchen darüberkritzelt.
Mit dem Rücken zu mir bleibt sie stehen und betrachtet mein Wohnzimmer. Es ist zwar schlicht, aber keineswegs eine Junggesellenbude. Meine Schwestern haben mir nach der Renovierung beim Einrichten geholfen. Sie haben mir einen traditionellen Landhausstil empfohlen, was immer das verdammt nochmal heißt. Ich weiß nur, dass ich jetzt ein paar Bauernmöbel aus Holz besitze, die mich viel Geld gekostet haben, sowie eine riesige, weiße, gemütliche Couch, die ich selten nutze, weil ich den Ledersessel in meinem Zimmer vorziehe. Doch es sieht wohnlich aus. Ich bin froh, dass sie mich dazu überredet und nicht zugelassen haben, dass ich weiter wie ein unglücklicher Single lebe, als ich wieder hergezogen bin.
Mein Blick wandert von dem Sofa zu den kleinen, dunklen Haarsträhnen, die schweißnass in ihrem Nacken kleben. Und als ob sie es gespürt hätte, wirbelt sie zu mir herum. Unsere Blicke treffen sich, und mein Magen zieht sich zusammen. Jetzt verstehe ich, warum sie mir ihren Namen nicht verraten wollte. Warum sie nicht aus ihrem Auto aussteigen wollte. Warum sie die ganze Zeit wie auf heißen Kohlen zu sitzen scheint. Ich weiß genau, wer diese Klugscheißerin ist, und jegliche Gebete, die Mabel momentan zum Himmel schickt, sind umsonst, denn mit dieser Frau werde ich mich auf gar keinen Fall in irgendeiner Form einlassen.
»Sie sind Rae Rose.«
3
Amelia
»Nein, bin ich nicht!«, widerspreche ich hastig – geradezu panisch – und blicke mich hektisch um, so dass ich vermutlich aussehe wie ein Eichhörnchen, das versucht, seine kostbaren, heimlich zusammengeklaubten Nüsse zu beschützen. Am liebsten würde ich mein Geheimnis in die Backen stopfen und damit die Flucht ergreifen.
Er zeigt keine Regung. »Doch, sind Sie wohl.«
»Nope.« Energisch schüttle ich den Kopf. »Ich weiß nicht mal – ich kenne diese Sängerin nicht mal.« Bei diesen Worten kann ich ihm nicht in die Augen sehen. Ich bin zwar kein Feigling, aber sonderlich mutig bin ich auch nicht gerade.
»Hab nie gesagt, dass es eine Sängerin ist.«
Ich ziehe die Nase kraus. Naturburschen-Ken hat mich in die Ecke getrieben.
»Okay. Sie haben recht. Ich bin es«, bekenne ich, hebe die Hände und lasse sie wieder sinken. Ich verkneife mir ein entmutigtes und ängstliches Ja und? Was wollen Sie jetzt von mir? So darf ich keinesfalls reagieren, denn Rae Rose ist niemals unhöflich zu ihren Fans.
Eben noch war ich froh, weil er nicht zu wissen schien, wer ich bin. Ich hatte an eine Glückssträhne geglaubt und das Gefühl gehabt, dass dieses Abenteuer vielleicht doch keine totale Schnapsidee war. Doch nun bin ich wieder zurück in meiner üblichen Höllengrube aus Trübsinn, Düsternis und Schrecken. Nicht falsch verstehen, ich liebe Fans, und ich liebe es auch, sie kennenzulernen. Ich ziehe es nur vor, dabei mein Security-Team um mich zu haben. Allein und mitten in der Nacht diesem deutlich über eins achtzig großen Kerl gegenüberzustehen, entspricht so gar nicht meinen Vorstellungen.
Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem es normalerweise zwei Möglichkeiten gibt. Entweder tun meine Fans so, als würden sie mich gar nicht kennen, obwohl ich sie dauernd dabei ertappe, wie sie mich anstarren, oder sie flippen aus, brechen vor Begeisterung in Tränen aus und wollen unbedingt – auf welchem Untergrund auch immer – ein Autogramm von mir. Manch einer bittet mich sogar, seine Mom oder Freundin anzurufen. Oder man will ein Selfie mit mir machen. Hauptsache, man kann den Freunden beweisen, dass man mich tatsächlich getroffen hat. Vielleicht sollte ich einfach die Initiative ergreifen und ihm vorsorglich einen Handel vorschlagen: ein VIP-Ticket dafür, dass er mich heute Nacht nicht umbringt? Scheint doch ein guter Deal zu sein.
Ich schlüpfe also wieder in meine Rae-Rose-Haut. Sie ist weicher, sanfter – königlicher als meine eigene. Rae Rose ist jedermanns beste Freundin. Sie ist nachgiebig und liebenswert. »Nun ja, da die Katze jetzt aus dem Sack ist, würde ich Ihnen dafür, dass Sie mich hier übernachten lassen, gern ein VIP-Backstage-Ticket für eines meiner bevorstehenden Konzerte anbieten. Außerdem werde ich Ihnen den Aufenthalt natürlich vergüten.«
Ich blicke Noah in die Augen. Sie sind leuchtend grün. Verblüffend scharfsinnig und beinahe schon unnatürlich intensiv. Sie haben fast die gleiche Farbe wie die Streifen dieser Wintergreen-Peppermint-Bonbons. Dazu noch dieses markante, bärtige Kinn und die strengen, zusammengezogenen Augenbrauen – die Wirkung ist … intensiv. Aber seltsamerweise nicht furchteinflößend.
Mit immer noch vor der Brust verschränkten Armen zuckt er mit einer Schulter. »Warum sollte ich ein VIP-Ticket wollen?«
Diese Frage habe ich nicht erwartet. Ich verhaspele mich und kann nur noch herumstottern. »Ähm … weil Sie … ein Fan sind?«
»Ich hab nie gesagt, dass ich ein Fan bin.«
Stimmt. Wow. Okay.
Die Stille schlägt ein wie ein Donnerhall. Er scheint sich nicht bemüßigt zu fühlen, sonst noch etwas zu sagen, und mir fehlen sowieso die Worte, weshalb wir uns nur anstarren. Eigentlich sollte ich jetzt verstimmt sein. Vielleicht sogar beleidigt. Seltsamerweise bin ich das überhaupt nicht. Tatsächlich spüre ich ein leichtes Flattern im Bauch. Am liebsten würde ich loslachen.
Lange schauen wir einander an, wobei unsere Brustkörbe sich in perfekt abgestimmtem Rhythmus heben und senken. Warum ich so misstrauisch bin, weiß ich durchaus, kann mir aber nicht denken, warum auch er besorgt aussieht. Als ob ich mir jeden Moment seine Sofakissen und Lampen schnappen und mit ihnen in die Nacht entkommen wollte. Der Kissen-Räuber auf der Flucht.
Okay, er will also nicht zu meinem Konzert kommen, aber ihm ist doch sicher klar, dass ich mir eigene Sofakissen leisten kann, oder?
Je länger ich dastehe und beobachte, wie die Muskeln in seinem Kiefer arbeiten, umso deutlicher beschleicht mich das Gefühl, dass er nicht nur kein Fan, sondern vielmehr sogar das Gegenteil ist. Statt der gewöhnlichen glühenden Verehrung, die sonst in den Augen meines Gegenübers steht, lese ich in seinen nur Ärger. Man betrachte nur diese tiefe Falte zwischen seinen Augenbrauen. Mürrisch. Verdrießlich. Wütend.
Ich nehme zwar nicht an, dass er mir etwas tun wird, trotzdem scheint er keine besonders hohe Meinung von mir zu haben. Vielleicht, weil ich auf seinem Rasen geparkt habe. Aber womöglich auch aus einem anderen Grund. Jedenfalls ist dieses Gefühl absolut und auf wunderbare Weise neu für mich, und weil es schon spät ist und ich ein wenig hysterisch bin, beschließe ich, ihn aus der Reserve zu locken.
Ich stelle mich also genauso hin wie er. »Verstehe. Ein Ticket ist also nicht gut genug für Sie?« Dann lächele ich, als sei das unser beider Geheimnis. »Sie wollen auch ein signiertes Poster dabei herausschlagen, was?« Ich wackele mit den Augenbrauen. Natürlich habe ich nicht den geringsten Zweifel daran, dass er ganz sicher kein Poster will.
Er blinzelt.
»ZweiVIP-Tickets und ein signiertes Poster? Wow. Sie verhandeln aber ganz schön hart. Aber für meinen größten Fan gebe ich gern nach.«
Seine Miene bleibt vollkommen unbewegt, aber in seinen grimmigen Augen blitzt ein Funke auf. Er scheint sich ein Grinsen verkneifen zu müssen. Manchmal beschließen Menschen aus den willkürlichsten Gründen, mich nicht zu mögen. Zuweilen einfach, weil ich berühmt bin und sie sich unwohl in der Gesellschaft erfolgreicher Menschen fühlen. Oft aber auch, weil ich anders gewählt habe als sie. Und der ein oder andere sogar, weil ich vor seinem Lieblings-Joghurt-Shop die Stirn gerunzelt habe. Sie verbannen mich aus ihrem Leben, weil sie glauben, dass ich etwas gegen Joghurt habe. Unwillkürlich frage ich mich, ob dieses Exemplar hier zu letzterer Kategorie gehört. Normalerweise ist mein gut organisiertes Team aus Sicherheitsleuten immer um mich herum, um mich zu schützen, aber zwischen Noah und mir steht momentan niemand. Wobei ich keineswegs sagen kann, dass diese Situation mir unangenehm ist. Im Gegenteil: Ich finde sie aufregend.
Noah schüttelt sacht den Kopf und blickt hinab, um erneut nach meiner Reisetasche zu greifen. Für ihn ist diese Unterhaltung beendet.
»Folgen Sie mir«, sagt er.
Drei Worte. Ein Befehl. Heutzutage erteilt mir niemand mehr Befehle – oh, natürlich sagt man mir immer noch, was ich zu tun habe, aber mein Umfeld formuliert es so, dass es klingt, als sei es meine eigene Idee. Rae, du musst doch total erschöpft sein. Das Gästezimmer ist hier am Ende des Flurs. Vielleicht würde es dir guttun, jetzt ins Bett zu gehen und dich ein wenig auszuruhen?
Noah Walker ist zu selbstbewusst, um andere zu manipulieren. Folgen Sie mir.
Mit meiner Reisetasche in der Hand geht er einen Flur entlang, der vom Eingangsbereich fortführt, und verschwindet in einem Schlafzimmer. Ich hätte mich gern noch ein wenig umgesehen, aber ein Großteil des Hauses liegt im Dunkeln. Wahrscheinlich sähe es ziemlich merkwürdig aus, wenn ich sämtliche Zimmer inspizieren, die Lichter einschalten und womöglich sogar noch ein paar Schränke öffnen und herumschnüffeln würde. Also gebe ich mich damit zufrieden, Noah wie befohlen zu folgen: Folgen Sie mir.
Vor zwei Zimmertüren, die an dem Flur genau gegenüber liegen, bleibe ich stehen. Eine Tür ist verschlossen, die andere nicht. In dem offenen Raum entdecke ich meine Reisetasche auf dem Boden. Noah ist bereits dabei, ein frisches, weißes Betttuch auf einem Queensize-Bett auszubreiten.
Eine Minute lang bleibe ich im Türrahmen stehen und beobachte ihn. Alles kommt mir vor wie ein Traum. Heute bin ich vor meinem Leben in Ruhm und Glamour geflüchtet. Und jetzt stehe ich im Haus dieses merkwürdigen Mannes und sehe zu, wie er das Bett für mich überzieht, obwohl er mich nicht mag. Sein Verhalten ist ebenso widersprüchlich wie die weiche Bettwäsche es zu seinem rauen Kinn ist. Susan würde mir jetzt zweifellos raten, dieses Haus schleunigst zu verlassen und mir einen sichereren Unterschlupf zu suchen.
»Noah«, sage ich und lehne mich mit der Schulter an den Türrahmen. »Was halten Sie von Joghurt?«
Er hält inne und sieht sich nach mir um. »Joghurt?«
»Mmm-hmm. Essen Sie ihn gern?«
Wieder wendet er sich dem Bett zu. »Warum? Wollen Sie mir zusätzlich zu Tickets, Poster und Geld auch noch einen Eimer Joghurt spendieren, wenn ich ja sage?«
Aha! Unter all dem Ärger lauert ein Fünkchen Humor. Dachte ich’s mir doch.
»Vielleicht.« Ich lächele, auch wenn er mich gar nicht ansieht.
»Na, lassen Sie das lieber. Ich will weder Joghurt noch das ganze andere Zeug.«
Im Geiste nehme ich einen dicken, fetten Edding zur Hand und streiche die Option Wütend wegen des Fotos vor dem Joghurt-Shop durch.
Noah breitet einen verwaschenen Patchwork-Quilt auf dem Bett aus. Er sieht aus, als habe er schon mehrere Generationen liebender Familienmitglieder erlebt. Mein Herz wehrt sich gegen die Gefühle, die bei diesem Anblick in mir aufsteigen. Ich frage mich, ob meine Mom meine Textnachricht von vorhin überhaupt gelesen hat.
»Kann ich Ihnen helfen?«, frage ich und mache einen wagemutigen Schritt in die Höhle des Löwen.
Wieder sieht er sich nach mir um, und seine Miene wird sogar noch grimmiger. Wortlos wendet er sich abermals dem Bett zu und fängt an, die obere Decke unter die Matratze zu stopfen. Ich verschweige ihm, dass ich sie sofort wieder rauszupfen werde, bevor ich ins Bett steige. »Nope.«
Gerade will ich nach einer Ecke des Quilts greifen, aber als er mir seine einsilbige Antwort entgegenblafft, hebe ich beschwichtigend die Hände in die Höhe und trete einen Schritt zurück. »Okay.«
Noahs Augen huschen zu meinen Händen empor, und für den Bruchteil einer Sekunde wird sein Ausdruck weicher. »Danke, aber nein.« Dann verfallen wir wieder in Schweigen.
In den letzten zehn Jahren habe ich Hunderte von Pressekonferenzen hinter mich gebracht, habe während der Meet and Greets mit Tausenden und Abertausenden von Fans zu tun gehabt. War erst letzten Monat live bei Jimmy Fallon, wo ich vor dem Studiopublikum einen improvisierten Song zum Besten gegeben habe, ohne auch nur einen Augenblick zu zögern. Aber jetzt – bei Noah Walker – weiß ich nicht, was ich sagen soll. Doch ich habe keine Lust, höflich zu sein. Oder freundlich. Es hat mich gepackt. Ach, ist das aufregend.
Zögernd bleibe ich irgendwo zwischen Tür und Bett stehen, um ihm nicht im Weg zu sein, und sehe zu, wie er schweigend ein Kissen herausholt und es mit einem Kissenbezug versieht. Das alles ist so normal, so häuslich, und es fühlt sich völlig unangebracht an, diese Erfahrung mit einem Fremden zu teilen, der mich nicht mal mag.
Ich sehe mich im Zimmer um, dann schaue ich über die Schulter und bemerke die geschlossene Tür auf der gegenüberliegenden Seite des Flurs. Plötzlich kommt mir ein Gedanke. Ist Noah verheiratet? Vielleicht ist er deshalb so kratzbürstig und abweisend? Er will nicht, dass ich auf irgendwelche seltsamen Ideen komme. Aus Filmen oder den Geschichten in Illustrierten schließt er, dass Prominente allesamt liebestolle Ehezerstörer sind.
Ich räuspere mich in dem Versuch und überlege, wie ich ihm am besten vermitteln kann, dass ich ihn heute Abend nicht bespringen werde. »Also, äh – Noah. Haben Sie eine … bessere Hälfte?«
Wieder huscht sein Blick zu mir hinüber, und jetzt sieht er wirklich stinksauer aus. »Ist das Ihre Art, mich um ein Date zu bitten?«
Ich tue so, als ob ich mich verschlucke. »Was? Nein! Ich habe nur …« Mittlerweile bin ich total von der Rolle! Eigentlich wollte ich ihn beruhigen, mache aber alles nur noch schlimmer. Und habe offensichtlich keine Ahnung, was ich mit meinen Händen anstellen soll. Ich fuchtele wild in der Gegend herum wie ein desorientierter T. Rex bei dem Versucht, ein Flugzeug zu fangen. »Nein. Bevor ich die Nacht hier verbringe, wollte ich nur sichergehen, dass ich niemandem auf die Füße trete.« Ich ziehe eine Grimasse. Das wird ja immer schlimmer. »Oh jeee! Ich meinte damit nicht, dass ich jemandem auf die Füße trete, indem ich die Nacht mit Ihnen verbringe. Ich weiß, dass ich hier drin allein schlafen werde. Ich stehe sowieso nicht auf One-Night-Stands, denn hinterher ist es immer so peinlich …«
Oh nein. Ich rede zu viel. Jetzt habe ich offiziell schon zum zweiten Mal Sex zur Sprache gebracht, und zwar in einer Unterhaltung mit einem Fremden, der mich nicht leiden kann. Ich hab’s absolut vermasselt, dabei vermassele ich es sonst nie.
Noah legt das frisch überzogene Kissen aufs Bett und wendet sich mir endlich zu. Wortlos kommt er näher. Ich muss das Kinn immer weiter nach oben, oben, oben recken, um ihn anzusehen. Er lächelt nicht, runzelt aber auch nicht die Stirn. Seine Miene ist unergründlich. »Ich bin Single, aber dennoch nicht auf dem Markt.«
Er bleibt vor mir stehen, während mein Gesicht so heiß wie Lava wird und mir geradewegs von den Wangenknochen herunterzuschmelzen droht. Das war die sanfteste, höflichste Abfuhr meines gesamten Lebens, dabei habe ich ihn noch nicht mal um ein Date gebeten.
Wie gut, dass das alles eigentlich keine Rolle spielt. Morgen früh reise ich wieder ab, suche mir das Bed and Breakfast, und Naturburschen-Ken wird nie wieder sauer auf mich sein müssen.
Aber warum bleibt er weiter reglos vor mir stehen? Warum fühle ich mich ihm dermaßen verbunden? Irgendetwas in meinem Innern zwingt mich näher, beschwört mich, eine Hand auf seine Brust zu legen und sie über sein weiches Baumwoll-T-Shirt gleiten zu lassen. Er bewegt sich nicht, ich mich ebenso wenig.
Dann macht er plötzlich ein verlegenes Gesicht und deutet auf die Tür, an die ich mich mittlerweile – ohne es bemerkt zu haben – lehne. »Ich kann nicht durch, solange Sie dort stehen.«
Oh.
OH!
Höflich, höflich, höflich. »Ja! Tut mir ja so leid! Ich mache Ihnen einfach … Platz.« Er verzieht keine Miene, als ich beiseitetrete und mit dramatischer Geste auf den Ausgang deute.
»Falls Sie Wasser brauchen, finden Sie Trinkgläser im Schrank neben dem Spülbecken in der Küche. Das Bad ist am Ende des Flurs. Ich gehe jetzt ins Bett. Schließen Sie ruhig die Tür ab. Ich jedenfalls tue das bestimmt.«
»Klug von Ihnen. Wir wollen doch nicht, dass der Kissen-Räuber zuschlägt«, sage ich und spüre, wie die Aufregung erneut in mir emporbrandet, nachdem ich genau das gesagt habe, was ich will – ungezügelt und ohne Filter.
Vielleicht … nur vielleicht war dieses Abenteuer ja doch kein Fehler.
4
Noah
Wütend setze ich Sonnenbrille und Baseballcap auf und halte den Kaffee wie einen Schild vor mich. Für den Weg vom öffentlichen Parkplatz bis zum Geschäft brauche ich offenbar zusätzlichen Schutz. Es ist nur ein fünfminütiger Spaziergang die Main Street entlang, aber das ist mehr als genug Zeit, um jeden einzelnen Bewohner dieser verdammten Stadt zu treffen. Dabei spielt es keine Rolle, dass Rae Rose nur neun Stunden lang in meinem Haus war. Denn es sind ziemlich genau acht Stunden mehr, als Mabel benötigt, um jeden anzurufen, den sie kennt, und damit die unglaublichste Telefonkette der Welt in Gang zu setzen. Zumindest wird es das Geschäft ankurbeln. Jeder wird einen Kuchen mit einem saftigen Stück Klatsch abhaben wollen.
Das ist das Problem, wenn man seit seiner Kindheit in der gleichen Stadt lebt. Alle erinnern sich noch daran, wie man im Alter von sieben Jahren in einem potthässlichen Pullunder im Kirchenchor Weihnachtslieder gesungen hat. Oder daran, wie der Sheriff gerufen wurde, weil man mit der damaligen Highschool-Freundin am See so lange im Pick-up herumgemacht hat, bis die Fenster beschlagen waren. Das Gerücht, dass eine – obendrein hübsche – Frau in meinem Haus geschlafen hat, wird also erst recht für Aufruhr sorgen. Hier gerät nun mal nichts in Vergessenheit, und die Leute interessieren sich noch mehr für mein Liebesleben als für eine romantische Nachmittagsserie im Fernsehen.
Vielleicht sollte ich meinen Laden heute besser schließen und angeln gehen, statt mich geradewegs in die Höhle der Löwen – mit anderen Worten auf den Marktplatz – zu begeben. Aber ausgerechnet heute Morgen ist nun mal Liefertag. James, ein Freund, dem ein Bauernhof in der Nähe gehört und der alle meine frischen Zutaten liefert, wird mehrere Kisten mit Gemüse, Eiern und Milch bei mir absetzen, und ich muss vor Ort sein, um alles in Empfang zu nehmen.
Wenn mir jemand früher gesagt hätte, dass ich mit zweiunddreißig einmal in dieser Stadt leben und den Pie Shop führen würde, der kreativerweise den Namen The Pie Shop trägt und den meine Großmutter mir hinterlassen hat, hätte ich dem Betreffenden einen Vogel gezeigt. Insbesondere nachdem ich mit Sack und Pack zu Merritt nach New York gezogen war. Dort hatten wir uns ein gemeinsames Leben aufbauen wollen. Also hatte ich versucht, in dieser Großstadt Fuß zu fassen, und mich doch ein ganzes Jahr lang wie ein Stück Treibholz im Meer gefühlt. Aber jetzt bin ich wieder hier – zu Hause – und führe ein Leben, das ich nie habe kommen sehen, das ich aber heiß und innig liebe.
Na ja, meistens jedenfalls. Auf die neugierigen Nachbarn, die ihre Nase in meine Angelegenheiten stecken, könnte ich nun wirklich verzichten.
Und los geht’s. Schon nähert sich Hindernis Nummer eins: Phil’s Hardware, der ansässige Baumarkt. Im Näherkommen kann ich erkennen, dass Phil und sein Geschäftspartner Todd draußen so tun, als würden sie den Gehsteig fegen und die Schaufensterscheibe putzen, obwohl Phils Enkel nach der Schule regelmäßig vorbeikommt, um beides zu erledigen.
Als ich beinahe bei ihnen bin, halten sie inne, murmeln erst unverständliches Zeug vor sich hin und heucheln dann bei meinem Anblick Überraschung, obwohl ich genau zu dieser Tageszeit jeden Tag hier vorbeikomme.
»Wow! Ganz schön heiß heute, was, Noah?«
»Genauso heiß wie gestern, Phil«, antworte ich und nippe an meinem Kaffee, ohne stehen zu bleiben.
Phil blinzelt hektisch, offensichtlich auf der Suche nach einem Geistesblitz, mit dem er mich ins Gespräch ziehen könnte. Doch ihm fällt nichts ein, weshalb Todd einspringt. »Vielleicht bringt dir die Hitze ja sogar ein paar neue Kunden ein? Einige Ausflügler, die nicht aus der Gegend sind, vielleicht?«
»Bei Hitze bekommst du ausgerechnet Heißhunger auf Pie, Todd? Vielleicht solltest du deshalb mal zum Arzt gehen. Merkwürdig.« Unbeirrt setze ich meinen Weg fort, hebe statt eines Abschiedsgrußes die Hand und winke ihnen über die Schulter zu. Die beiden können von Glück sagen, dass ich ihnen nicht den Mittelfinger zeige.
Schon nähere ich mich Hindernis Nummer zwei: Harriets Market, dem kleinen Supermarkt. Ich ziehe meine Baseballcap ein wenig tiefer in die Augen, denn wenn es einen Menschen gibt, den ich heute nun wirklich nicht sehen will, dann ist es Harriet. Diese Frau kennt kein Erbarmen. Ich gehe unter ihrer blau-weiß gestreiften Markise hindurch und glaube schon, dass die Luft rein ist. Doch dann höre ich die Klingel über der Tür zu ihrem Laden. Ich zucke zusammen und erwäge, einen Zahn zuzulegen, aber es ist zu spät. Ich sitze in der Falle.
Sie redet nicht lange um den heißen Brei. »Noah Walker, glaub nicht, dass ich nicht von der Frau gehört habe, die letzte Nacht bei dir verbracht hat.« Mir bleibt keine Wahl. Also hole ich tief Luft, wappne mich und wende mich zu Harriet um. Sie hat die Hände in die schlanken Hüften gestemmt und ein strenges Funkeln in den Augen. Ein Stirnrunzeln steigert die ohnehin beträchtliche Faltenanzahl in ihrem Gesicht. Das fröhliche gelbe Sommerkleid passt so gar nicht zu ihrer Persönlichkeit. Das von weißen Strähnen durchzogene Haar hat sie zu einem festen Knoten zusammengefasst. Harriet ist nicht deshalb so grantig, weil sie andere nicht mag, sondern weil sie sich beinahe hundertprozentig sicher ist, dass sie besser ist als die meisten ihrer Mitmenschen. Und wer weiß, vielleicht ist sie das ja sogar.
»Zu meiner Zeit gingen Männer und Frauen vor der Ehe nicht dermaßen intim miteinander um. Da blieb noch ein wenig mehr für die Phantasie übrig. Für Wünsche und Träume.« Sie neigt ein wenig den Kopf, so dass sie gleichzeitig die Lippen schürzen und die Augenbrauen hochziehen kann. »Nun, wer ist diese Frau, mit der du die Nacht verbracht hast, und hast du vor, sie zu heiraten?«
Na, das ging ja schnell.
»Äh – nein, Ma’am. Und ich habe die Nacht nicht mit ihr verbracht. Ihr Wagen hat in meinem Garten den Geist aufgegeben, weshalb ich ihr mein Gästezimmer angeboten habe.« Nicht dass es dich etwas anginge, möchte ich am liebsten hinzufügen, aber ich bin nun mal ein Feigling und habe eine Heidenangst vor dieser Frau. Mit Mabel zanke ich mich gern, aber bei Harriet ziehe ich immer den Schwanz ein.
Sie droht mir mit dem Finger. »Dann rühr sie bloß nicht an. Wenn du sie nicht zum Altar führen willst, dann halt dich zurück und tauch deine Zehen nicht in ihren Teich.«
Ich ziehe eine Grimasse. Keine Ahnung, ob sie das als sexuelle Anspielung verstanden wissen will oder nicht, aber widerlich finde ich es in jedem Fall.
»Keine Sorge. Ich habe kein Interesse an ihrem … Teich.«
Ja. Es auszusprechen, fühlt sich genauso abscheulich an wie erwartet. Na toll. Jetzt habe ich meine liebe Not, das Bild wieder aus dem Kopf zu kriegen. Wieder ein Grund, warum ich mich, wenn überhaupt, höchstens außerhalb dieser Stadt mit einer Frau einlassen könnte. Was ich allerdings ehrlich gesagt schon lange nicht mehr getan habe. Ich habe nichts übrig für One-Night-Stands, denn in diesem Punkt hatte Rae Rose gestern Abend recht: Hinterher ist es immer peinlich. Und auch währenddessen finde ich keinen Gefallen daran. Wenn ich mit einer Frau schlafe, habe ich lieber eine emotionale Verbindung zu ihr.
Mit anderen Worten: Ich bringe sowieso keine Frauen mit nach Hause, denn in dieser Stadt liegt immer irgendjemand mit dem Fernglas auf der Lauer und geiert nach Klatschgeschichten. Und sobald es Harriet zu Ohren käme, würde sie mir den freikirchlichen Prediger aus der Kirche des Nazareners auf den Hals hetzen, damit der mir ins Gedächtnis ruft, dass Lust eine der sieben Todsünden ist. Zu allem Überfluss liebt Pastor Barton meine Pies. Während seiner Predigt würde er also bestimmt drei Stücke verputzen, so dass der ganze Nachmittag dabei draufginge.
Harriet nickt, wobei immer noch eine steile Falte zwischen ihren Brauen aufragt. »Nun ja, gut. Dann sorg dafür, dass es so bleibt.«
Super, das habe ich also schon mal hinter mir.
»Kurz vor Feierabend wartet deine Pfirsichpie auf dich.« Es ist Mittwoch, weshalb sie sie wie immer auf dem Weg zu ihrem Strickkreis abholen wird. Stumm proste ich ihr mit meinem Kaffee zu und gehe weiter.
Ich erhöhe das Tempo und treffe wundersamerweise auf niemanden mehr, weder am Diner noch am Blumenladen. Letzterer gehört meiner jüngsten Schwester, die mit Sicherheit sofort herausplatzen und mich mit Fragen bestürmen würde. Glücklicherweise ist sie aber gerade mit meinen beiden anderen Schwestern außerhalb der Stadt unterwegs.
Endlich bin ich am Eingang zu The Pie Shop angelangt. Ich stecke den Schlüssel ins Schloss, obwohl ich den Laden sogar nachts vermutlich weit offen stehen lassen könnte, ohne dass jemand auch nur in Betracht ziehen würde, ihn zu verwüsten oder irgendetwas zu stehlen. Tatsächlich würde vermutlich sogar Phil vorbeikommen, den wackligen Barhocker reparieren und anschließend gewissenhaft für mich abschließen.