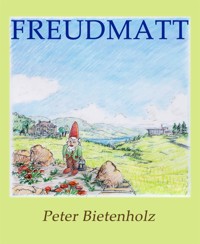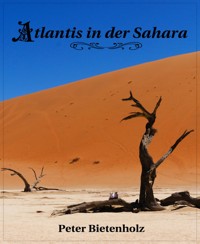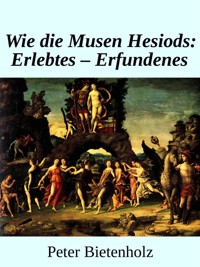
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Hesiod hat zusammen mit Homer die epische Dichtung der alten Griechen begründet. Die Musen, Gefährtinnen des Gottes Apollo, lässt er sagen, dass sie zwar oft schwindelten; jedoch, sofern sie das wollten, auch die Wahrheit sprechen könnten. Ob sie jetzt gerade das eine oder das andere tun, sagen sie aber nicht. Ich habe es ebenso gehalten. Erinnerung an willkürlich herausgegriffene Episoden meines langen Lebens sind bunt gemischt mit frei erfundenen Einfällen. Begegnungen mit Menschen, die mich beeindruckten, bringt mein Gewährsmann, Daniel, zur Sprache zusammen mit Gedanken über einzelne Bücher und Bilder. Geschichten erzählen: den Musen macht es Spass, mir auch, und du, lieber Leser, kommst hoffentlich auch auf deine Rechnung. Bitte nimm zur Kenntnis, dass dieses eBuch ohne die Hilfe meines Sohnes Michael nicht zustande gekommen wäre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Wie Die Musen Hesiods: Erlebtes - Erfundenes
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenTitelei
Peter Bietenholz
Wie die Musen Hesiods: Erlebtes – Erfundenes
Titelbild: Andrea Mantegna, Parnassus (die neun Musen beim Tanz), 1496-97, Louvre
© Peter Gerhard Bietenholz (2014)
Einleitung
„Vielerlei wissen wir zu erzählen, das man für wahr hält, und ist doch geschwindelt. Aber ebenso wissen wir, sofern wir das wollen, die Wahrheit zu sagen.“ Also sprachen die redegewandten Töchter des allmächtigen Zeus (Theogonie, 27-9).
Ich muss wohl vorne beginnen, denkt Daniel, aber was heisst ‚vorne’? Wohin ich gucke, alles ist übersät mit Anfängen wie im Frühling das Gras mit Kirschenblüten. Er bückt sich und liest einen auf. Er schaut links, schaut rechts, vorwärts, zurück über die Schulter. Überall fängt es neu an, und doch hängt alles zusammen: Erinnertes? Erfundenes? ‚Musensohn’ pflegte man zu sagen, wie wenn den neun züchtigen Jungfern so etwas hätte passieren können. Immerhin, was die rosigen Gespielinnen Apollos dürfen, soll einem alten Mann nicht versagt sein. Die Erinnerung darf auch mal trügen, und die Phantasie darf betteln und borgen gehn.
Alter Mann, 81 Jahre alt bin ich. Den Schreibblock auf dem Schoss, sitz ich in meinem Schaukelstuhl. Eigentlich ist es Evas Stuhl; sie hat ihn vor vielen Jahren gefunden und gekauft. „Ein Still-Stuhl“, erklärte der Antiquitätenhändler. Er ist niedriger als gewöhnliche Schaukelstühle. So kann die stillende Frau ihren Säugling bequem auf den Boden legen, während sie die eine Brust freimacht oder wieder einpackt. Bei mir steht eine Flasche Metaxa 7 auf dem Boden. Ein besonderer Tropfen für einen besonderen Tag, den Tag, wo...? On verra. Nicht Brandy ist in der halbleeren Flasche, sondern Nektar. Die Flasche war einmal ganz oben auf dem Gipfel des Olympus, und dort hat sich ein Rest ihres Inhalt mit purem Nektar, dem Trunk der Olympischen Götter, vermischt. Wie das zuging, soll noch erzählt werden; später, falls ich soweit komme mit meiner Schreiberei. Durch die gläsernen Türflügel sickert die Abenddämmerung und füllt langsam den Raum. Die Kanten der Büchergestelle kommen ins Schwimmen, jetzt auch die Bilderrahmen. Ich schalte die Tischlampe ein. Ein scharf begrenzter Lichtkegel fällt auf den Lehnstuhl, genau auf den Schoss der Person, die dort liest oder schreibt. Der Lichtkegel lässt sich richten: hierhin dorthin in der langen, wackeligen Erinnerung eines alten Mannes, aber er bleibt scharf begrenzt. Rund umher das Dunkel – soll dunkel bleiben.
1 // Das Dreirad
Ich nehme an, es war im Oktober 1938 oder kurz nachher. Die Lage der Juden in Hitlers Reich wurde immer prekärer; auch die Schweiz hatte für deutsche Staatsangehörige jüdischer Abstammung, deren Pässe mit dem ominösen J gestempelt waren, die Visumspflicht eingeführt. Unser grosser Garten grenzte an das weitläufige Rangiergelände vor dem Badischen Bahnhof in Basel. Rundum war Schweiz; aber die Geleiseanlagen und der Bahnhof waren gemäss Staatsvertrag deutscher Boden. Für Reisende aus Deutschland erfolgte die Polizei- und Zollkontrolle erst, wenn sie den Bahnhof verlassen wollten. Etwa zwanzig Meter entfernt vom östlichen Ende der Bahnsteige gab es eine Unterführung. Dort wurde die Strasse nach dem Grenzort Riehen rechtwinklig unter den Geleisen der Reichsbahn durchgezogeen. Weiter östlich zogen sich Schrebergärten dem Bahndamm entlang, und dann, nach fünfhundert Metern, kam unser Haus mit seinem grossen Garten. Zurück nun zur Riehenstrasse. Es was kurz nach sechs Uhr morgens – schon hell, einigermassen. Alle zehn Minuten fuhr das Tram, aber sonst gab es noch wenig Verkehr. Bei der Unterführung warteten mein Vater und ich. Ich war fünf und hatte mein Dreirad dabei. In Kürze sollte der erste Zug aus Frankfurt eintreffen. Ein Mann sollte unauffällig warten, bis die anderen Passagiere weg waren und dann die paar Schritte vom Ende des Bahnsteigs bis zur Unterführung gehen und hinuntergucken. Wenn er mich auf dem Dreirad vorbeikreuzen sähe, war dies das ausgemachte Zeichen, dass alles ruhig sei. Dann würde der Mann sein Reiseköfferchen aufklappen, ein Seil auspacken, am eisernen Geländer festmachen und sich abseilen auf die Riehenstrasse und in die Schweiz.
Wir warteten; der Zug kam. Ich fuhr hin-und-her, viermal, fünfmal. Der Mann kam nicht. Aber andere Menschen auf der Flucht vor Hitler waren damals regelmässig zu finden in unserem grossen Haus. Die Quaker underground railway lief auf Volldampf und machte bei uns zuhause Station. Von Zeit zu Zeit besuchte uns eine Kriminalbeamtin aus Berlin. Sie stand in der Küche und holte ihren Reiseproviant, bestehend aus Semmeln, hervor. Wenn sie die aufmachte, fielen mit Butter verschmierte Diamantringe heraus, die so den Weg zu ihren geflüchteten Besitzern zurückfanden. Zwei junge Frauen wohnten fast den ganzen Weltkrieg durch bei uns. Lore war väterlicherseits jüdischer Abstammung, zart, fast zerbrechlich und schöngeistig fromm. Grete war fesch, energisch, eine unerschöpfliche Quelle von Fröhlichkeit in jener dunklen Zeit. Nach dem Krieg kamen zuweilen beschädigte Kinder vom befreiten Elsass. Ein etwas zurückgebliebener Junge aus dem Colmarer Waisenhaus – „I hoiss Kaiser, Arthür“ – lehrte mich singen:
Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen, SA marschiert mit sicher festem Tritt.
2 // Irmeli
Wir wohnten im Erdgeschoss; über uns wohnte die Familie von Irmeli – niemand sagte ‚Irmingard’; die waren Heilsarmee. Im Untergeschoss wohnte niemand. Da war Platz für meine weitspurige, ausschliesslich mit Muskelkraft betriebene Modelleisenbahn und für anderes mehr. Wir Kinder waren dort vogelfrei. „Willst du die Striemen sehen?“ fragte Irmeli; es war sechs, ein Jahr jünger als ich. „Ich habe gelogen, und sie haben es gemerkt. Auf den Küchentisch haben sie mich gelegt. Mutter hielt mich fest; Vater zog mir das Höschen herunter, und dann ging’s los.“ – „Hast du geschrien?“ – „Willst du die Striemen sehen?“ Natürlich wollte ich die Striemen sehen. Das WC dort unten war sonst unsere Arztpraxis. Wir spielten ‚Dökterlis’, wobei es vor allem um die Untersuchung der gegenseitigen Unterleibsmündungen und ihrer Produkte ging. Die Striemen, oder was Irmeli so nannte, waren auf seinem weissen Hintern zu sehen, wenn man sie sehen wollte. Ich war enttäuscht, aber das sagte ich ihm nicht. Kurz nach Kriegsende zog die Heilsarmeefamilie weg in ein Eigenheim. Später im Leben habe ich Irmingard nur noch einmal getroffen und mich an ihrem rechten Oberschenkel bis zum Strumpfhalterknopf hochgetastet. ‚Allzeit bereit’, sagte man von ihr in unserem Studentenkreis. Sie soll dann einen Ingenieur – Milizoffizier und später Gemeinderat – in der Ostschweiz geheiratet haben.
3 // Admiral Darlan und Tante Bée
Der Krieg bescherte mir längere Aufenthalte im schönsten Haus meines Lebens: riesige Räume, getäfelte Wände und Decken aus Balken so lang wie der ganze Raum. Alle Wohn- und Schlafräume waren hell dank grosszügiger, nach Süden gerichteter Fenster. Die spärliche Möblierung, Bauernstil und Biedermeier, liess weite Freiräume offen. Bilder gab es nicht mehr – vielleicht waren sie wertvoll und deshalb in Sicherheit gebracht; aber umso mehr wirkte das Edeltannenholz der kahlen Wände. Nur im mächtigen Treppenhaus hingen handkolorierte Stiche von den alten Werk- und Feiertagstrachten verschiedener Gegenden und Berufe. Heutzutage, wenn ich nachts wach liege, wandere ich gerne von Raum zu Raum: das Esszimmer mit dem dreistöckigen grünen Kachelofen und dem Schiefertafeltisch, die ‚Kapelle’, das war ein Raum an der Westseite, der erkerartig zwischen den zwei Geschossen hing. Man öffnete im Obergeschoss die Zimmertüre und stieg dann auf einer eigenen Treppe in den Raum hinunter. Und dann mein Schlafzimmer: ein kleiner runder Tisch mit drei gepolsterten Stühlen, eine Kommode, das Bett, zu breit und zu hoch für mich, sonst nichts mehr; der freie Raum hätte für drei Pingpongtische ausgereicht. Im Dunkel war es zum Angsthaben, und ich hätte mich noch öfter gefürchtet, wenn nicht durch die grossen Fenster freigiebig Mondlicht und Morgensonne geflutet wären. Und dann das Wohnzimmer mit Kamin und Bücherregalen. Der zierliche Goethe, Cotta 1864, in 36 Bändchen steht jetzt bei mir. Mit Wonne vertiefte sich der kleine Junge in die grosse Brockhaus Enzyklopädie vom Ende des neunzehnten Jahrhunderts mit Farbtafeln von operettagerechten Uniformen, von Dampfeisenbahnen, Kriegsschiffen mit hochragenden Schornsteinen und den frühesten Automobilen. Ruhe und Ausgewogenheit umhüllten die Bewohner jenes Hauses aller Häuser; man bewegte sich schwerelos wie die Weltraumpiloten.
Das war das Chalet Frey, gelegen am Südhang oberhalb Zweisimmen im Berner Oberland, mit Aussicht auf das Wildstrubelmassiv. Im Krieg war das Objekt unverkäuflich, und eine in verschiedene Städte verstreute Erbgemeinschaft vertraute es meiner ältesten Tante an, die es mit Hilfe einer Putzfrau vom Dorf in Ordnung hielt. Frau Kunz brachte ihren Dackel mit herauf; er hiess Phylax. Ich wurde immer wieder zu Tante Bée geschickt; vorerst evakuiert aus der Grenzstadt Basel; später während aller Schulferien. Ich sammelte Pilze, auch Tannzapfen für die darbende Zentralheizung zuhause. Beim Pächter Erb durfte ich helfen den Stall ausmisten. An den Bauch der nächsten Kuh gelehnt, schaute ich zu, wie er melkte. Im Sommer gab es ein altmodisches Dorfschwimmbad mit einladenden Astlöchern in den Wänden zwischen zwei Kabinen. Im Winter unternahm ich unbeholfene Hantierungen mit vorsintflutlichen Schiern. An manchen Tagen war mir langweilig. Ein solcher Tag drohte es zu werden; aber dann kam der Mord an Admiral Darlan dazwischen.
Meine Erinnerung ist monolithisch, ein Ayers Rock im flachen Bewusstseinsgelände. Der Briefträger kam nicht zu uns herauf; wir holten die Post am Schalter. An jenem Tag durfte ich allein ins Dorf hinunter, um das zu tun. Das Postamt lag direkt beim Bahnhof; man konnte also bequem die Züge studieren. Händigte man mir Briefe aus am Postschalter? Ich weiss es nicht mehr; aber da war die Tageszeitung – für Tante Bée die liberal-konservative Basler Nachrichten; die kam per Post, gesteckt in ein Streifband mit der Adresse. Unter dem Band hervor guckte geheimnisvoll der obere Rand einer überdimensionierten Schlagzeile. Ich riss das Band weg und las: ADMIRAL DARLAN IN ALGIER ERMORDET. Ich zitterte vor Aufregung. Hier geschah Weltgeschichte, und ich war mit dabei. Beflügelter Schicksalsbote. Den Berg hinauf rannte ich den ganzen Weg; kam atemlos an. An diesem Punkt schaltet meine Erinnerung ab. Nicht einmal den Schnee sehe ich noch, der jedenfalls auf dem Weg lag, denn François Darlan starb am 24. Dezember 1942. Warum gerade dieser Fetzen Geschichte in meinem Bewusstsein hängen blieb, ist nicht leicht zu sagen. Vom Artikel, der zur der Schlagzeile gehörte, von den Mutmassungen über die Motive des Attentats, weiss ich nichts mehr, obgleich ich damals eine rudimentäre Vorstellung hatte von der Lage Französich-Afrikas im clench zwischen Pétain und De Gaulle, den Alliierten in Marokko und Algerien, und den Deutschen in Tunesien. Durch den ganzen Krieg ist mir keine andere Schlagzeile so im Gedächtnis geblieben. Das halbstündige Rennen bergauf im Schnee wird mitgespielt haben. Das musste Tante Bée sofort erfahren. Wie würde sie es nehmen? Der ermordete Admiral war Franzose, und französisches Militär war wichtig für die Bewohner des Chalet Frey.
In Zweisimmen befand sich ein Lager französischer Internierter – Truppenteile, die sich bei der Niederlage Frankreichs im Sommer 1940 auf Schweizerboden abgesetzt hatten und dort gemäss den Rotkreuzkonventionen entwaffnet und in Lager gesteckt wurden. Der ranghöchste Offizier war ein Oberst mit feinen Falten um Mund und Augen und leicht angegrauten Schläfen. Auch in seiner schmucklosen Uniform wirkte er elegant, nicht schneidig wie ein Berufsoffizier, sondern besinnlich und diskret wie ein Versicherungs- oder Finanzmann. Gern und oft nahm er den halbstündigen Aufstieg zum Chalet Frey unter die Füsse, zuweilen begleitet von seiner Nummer Zwei, einem etwas jüngeren Hauptmann. Dann servierte man Tee unter dem Bergmorellenbaum bei prächtiger Aussicht aufs Tal und die gegenüberliegenden Berge. Man sprach von Kultur und Familie. Tante Bée, mager und etwas grösser als ihre zwei jüngeren Schwestern, liess ihr geläufiges Französisch spielen. Elegant war sie in meinen Kinderaugen, vornehm, anders als sonst. Ein Flirt war es trotzdem nicht; zuviel Schweres lastete auf den Seelen der zwei Menschen, die sich da gegenüber sassen. Seine Sorgen waren offenkundig: der verlorene Krieg, die gefährdete Existenz, die Familie im besetzten Paris. Auf einem Foto stehe ich neben seinem Gartenstuhl; sein rechter Arm ruht auf meiner Schulter. Ruhen? Fühlt der Neunjährige im Gewicht des Armes die ganze Last eines unwirschen Schicksals? Das andere Schicksal, das meiner Tante, kam fast sicher nicht zur Sprache, doch mochte ihr sensibler Gast manches ahnen, was mir, dem Kind, naturgemäss damals entging, mich aber heute umso mehr beschäftigt, als es in meiner Gegenwart auch später niemals angerührt wurde.
Bée, die älteste der drei Schwestern, hatte jahrelang erst die sterbende Mutter, dann den sterbenden Vater gepflegt. Danach tat sie sich mit ihrer jüngeren, berufstätigen Schwester zusammen und besorgte den gemeinsamen Haushalt. Von einem Mann war im Leben beider nie die Rede gewesen. In ihrem Haus stand ein Konzertflügel und ihm gegenüber ein Klavier. Bée hatte eine hochgradige Pianistenausbildung absolviert und hatte anfänglich Stunden gegeben. Solange ich sie kannte, hat sie aber weder am Flügel noch am Klavier je eine Taste gedrückt. Man scherzte in der Familie, der Ärger mit zwei widerspenstigen Schülern, nämlich meinen zwei älteren Geschwistern, habe ihr das Stundengeben ein für allemal verleidet. Jedenfalls kam ich dann nicht mehr an die Reihe; nie hat mich jemand mit Klavierstunden bedroht. Aber Bées Absturz in gnaden- und pausenlose Hausfrauenarbeit – nur in Zweisimmen, wenn sie allein war, gönnte sie sich etwas Erholung – lässt sich so nicht erklären. Bei anderen alten Jungfern könnte man an eine unglückliche Liebe, ein erdrosseltes Verlöbnis denken, nicht so bei Bée. Ich vermute heute, dass es in der Tat ein Schüler, genauer eine Schülerin, war, die den Kurzschluss verursachte. Zwölfjährig vielleicht, die erste Wölbung von Brüsten unter Bluse sich abzeichnend, langes blondes Haar und ein nicht mehr ganz kindliches Lächeln – eine Hand, die reichte, wohin sie nicht hätte reichen sollen, die griff, wo sie nicht hätte greifen dürfen. Man war kalvinistisch. Natur zählte nicht. Sünde war unabdingbar. Nur vom Verzicht konnte man Rettung erhoffen.
4 // Marie Antoinette
Dass das Schicksal Darlans mich erschüttert hat, kann ich nicht sagen. Mit Marie Antoinette war das anders. Sie war Mensch; Darlan war Uniform und ein Stück Weltgeschichte. Beider Bekanntschaft verdankte ich dem Blätterwald. In Marie Antoinettes Fall war es die zweite Oktobernummer eines illustrierten Wochenblattes, das in erster Linie Leserinnen ins Visier nahm. Dort stiess ich auf eine Doppelseite über das Ende Marie Antoinettes. Den Anlass gab die 150. Wiederkehr ihres Todestages. Die veuve Capet, vormals Königin von Frankreich, starb am 16. Oktober 1793 unter dem Fallbeil, das seinen Namen der noblen Initiative des Bürgers Guillotin verdankt. Dem lag am Herzen, dass bei Exekutionen alle Privilegien abgestellt würden. Ohne Ansehen von Stand und Geschlecht sollten alle Verurteilten in den Genuss des gleichen, im Vergleich mit anderen Hinrichtungsformen, humanen Todes kommen. Der Journalist des Wochenblattes war wohl von Vichy-Frankreich inspiriert, wo die Monarchie wieder hoch im Kurs stand. Mehr als den Text beschäftigten mich die beigegebenen Bilder. Da war Jacques-Louis Davids atemraubende Bleistiftskizze der 38-Jährigen, wie sie auf dem Karren sass, der sie zum Schafott gleich neben der Place de la Concorde brachte: die Hände auf den Rücken gefesselt, ungeschminkt, ungekämmt unter der Jakobinermütze, die man ihr aufgestülpt hatte, achtlos der lärmenden Menge, gefasst, scheinbar gleichgültig, unnahbar, noch immer eine Herrscherin. Neben Davids Skizze war einer der vielen zeitgenössischen Stiche abgebildet, die Doktor Guillotins Erfindung in Betrieb zeigen. Am Rand des Schafottgerüstes steht der Henker und präsentiert mit erhobenem Arm der Menge den soeben abgehauenen Kopf. Ob der nun Marie Antoinette gehört hatte oder einem anderen Opfer, lässt sich nicht ausmachen, ist ja auch gleich.
Ich hatte damals einen Schulfreund, der hiess Thomas. Er war feingliedrig, hübsch, etwas ängstlich, ein Jasager, ein Mittuer. Das Bild der Guillotine beschäftigte ihn so intensiv wie mich die Skizze Davids. Immer wieder schaute er es an. Da kam ihm eine Idee: „Wir bauen eine Guillotine; dann köpfen wir meine Teddybären. Ich bin zu alt für Teddybären. Oder eine Maus; mein Vater hat im Keller bei der Kartoffelhurde eine Falle aufgestellt, eine von denen, die Mäuse lebendig fängt.“ Eine Guillotine bauen? So etwas von Thomas! Es war kaum zu fassen, und natürlich war der Plan unmöglich. Oder? Mir kam der Gertel in den Sinn, der bei unserem Gartenwerkzeug lag und nie gebraucht wurde: Der Gertel war eine Art von Beil, 25 cm lang und 10 cm hoch, mit seitlichem Griff, alles solid aus einem Guss, fast zwei Kilo schwer, zum Kleinhacken von Reisig bestimmt. In unserem Untergeschoss stand eine Reihe einfacher Holzstühle, geradbeinig, mit aufrechter Rückenlehne. Sie stammten aus einer Zeit, wo dort unten Mütterabende für die Frauen der angrenzenden Arbeiterviertel abgehalten worden waren. Wenn man einen dieser Stühle umgekehrt auf einen zweiten stellte, müsste der Gertel doch zwischen die Beine des umgekehrten Stuhls passen. Dann bräuchte es zwei Kleiderbügel aus Draht. An einem würde der Gertel festgemacht und der Kleiderbügel selbst mit zwei Schnurenden an den Vorderbeinen so befestigt, dass er auf- und abgleiten könnte. Der andere Kleiderbügel würde oben an den Hinterbeinen fixiert, und zwischen beiden würde eine längere Schnur angebracht, die über den fixierten Kleiderbügel gezogen, bis zur Stuhllehne hinunter reichen und dort angebunden werden müsste. Voilà, die Guilllotine steht bereit. Wenn man die Schnur anzog und dann losliess, würde der Gertel alias Fallbeil dank der zwei Kilo Gewicht über die ganze Länge der Stuhlbeine heruntersausen und auf der Sitzkante aufschlagen. Gedacht, getan. Der Apparat war genial ausgedacht, aber die Schneide des Gertels war nicht scharf genug. Die Teddybären litten keinen sichtbaren Schaden. Wir gaben auf. Nach dem Krieg gelangten Bilder der Guillotinen, die in Hitlers Gefängnissen zur Vollstreckung von Todesurteilen Verwendung fanden, an die Öffentlichkeit: eine Erinnerung, die ich nicht loswerde.
5 // Marienbad
Ich war sechzehn und hatte Goethes Marienbader Elegie so oft gelesen, dass ich sie in der ganzen Länge und üppigen Fülle ihrer Verse auswendig konnte. Darunter hatte ein Mädchen namens Marianne zu leiden, das, als ich drauflos rezitierte, gar nicht fühlte, dass ihr „ein Gott die Gunst des Augenblicks“ gegeben habe und mich auch nur zögernd als „Günstling des Geschicks“ an ihrer „holden Seite“ haben wollte, zumal sie glaubte, der Dichter wäre ich selbst. Marianne wurde später Pfarrerin und Katzenmutter. Was war es, das mich Musensohn dazu bewog, mir in Marienbad mein sechzehnjähriges Gemüt gesund zu baden? Banal erklärt, zeigt das Gedicht, wie ein hübsches achtzehnjähriges Geschöpf dem vierundsiebzigjährigen Löwen den Kopf verdrehte. Ulrike von Levetzow war nicht in Marienbad, um Gicht zu lindern und Konstipation zu kurieren. Ganze Tage lang flirtet sie mit dem alten Freund ihrer Mutter, räkelt sich wohllüstig im Abglanz seines Ruhmes. Auf Spaziergängen erklärt er ihr die verschiedenen Gesteine, und zu jeder Probe, die sie in ihr Körbchen legt, tut er ein Schokoladebonbon hinzu. „Nur wo du bist, sei alles, immer kindlich / so bist du alles, bist unüberwindlich.“ Wenn es Zeit wird, zu Bett zu gehen, verabschiedet sie ihn: „ein letztester Kuss.“ Ein artiger kleiner Planet ist sie, der um seine Sonne kreist, aber näher kommt man sich nicht. Die Ehrfurcht der ganzen Familie für Goethe ist echt. Das Lächerliche an der Situation wird übersehen; Goethes Heiratsantrag wird mit diskretem Schweigen beantwortet.