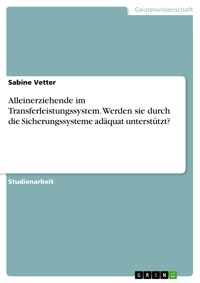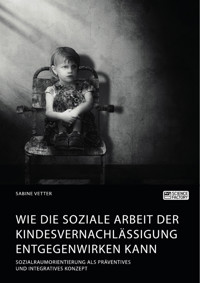
Wie die Soziale Arbeit der Kindesvernachlässigung entgegenwirken kann. Sozialraumorientierung als präventives und integratives Konzept E-Book
Sabine Vetter
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Science Factory
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Von Vernachlässigung betroffen sind Kinder aller Altersstufen, genaue Fallzahlen für Deutschland gibt es aber derzeit nicht. Zudem ist die Forschungslage zum Geschehen unzureichend. Alle bisherigen Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass sich Vernachlässigung durch ein Zusammenspiel von persönlichen Faktoren und gesellschaftlichen Bedingungen entwickelt. Zu deren Vermeidung müssen Eltern möglichst früh erreicht werden. Das Konzept der Sozialraumorientierung ist ein vielversprechender Ansatz in der Sozialen Arbeit, da hierbei der Mensch und sein Wille im Fokus stehen. Welche konzeptionellen und methodischen Möglichkeiten Sozialraumorientierung bietet, untersucht Sabine Vetter in ihrer Publikation. Sie geht insbesondere der Frage nach, wie die Soziale Arbeit Zugänge und Angebote gestalten muss, um der Vernachlässigung von Kindern vorzubeugen. Aus dem Inhalt: - Lebensweltorientierung; - Empowerment; - Kinder- und Jugendhilfe; - Soziale Isolation; - Kindeswohl; - Familienhilfe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 80
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1... Einleitung
2... Vernachlässigung
2.1 Begriffsklärung, Definition und Abgrenzung
2.2 Vernachlässigungsformen und Folgen
2.3 Ursachen von Vernachlässigung
2.3.1 Elterliche Ressourcenverluste
2.3.2 Gesundheitliche Faktoren
2.3.3 Ökonomische und soziale Faktoren
2.4 Wissenschaftliche Meinungen und praktische Problemstellungen
3... Fachkonzept Sozialraumorientierung
3.1 Begiffsklärung
3.2 Theoretische Grundkonzeptionen
3.2.1 Konzept der Lebensweltorienierung
3.2.2 Gemeinwesenarbeit
3.2.3 Organisationsentwicklung
3.2.4 Empowerment
3.2.5 Soziales Kapital
3.3 Handlungsfelder
3.3.1 Handlungsfeld Individuum
3.3.2 Handlungsfeld Sozialstruktur
3.3.3 Handlungsfeld Netzwerk
3.3.4 Handlungsfeld Organisation
3.4 Spezifika der sozialräumlichen Arbeitsorganisation
4... Prävention von Vernachlässigung über den sozialen Raum
4.1 Ausgangslage und Anforderungen
4.2 Sozialraumorientierung als präventiver und integrativer Ansatz
4.2.1 Passungsherstellung und Veränderung der Nutzungsmerkmale
4.2.2 Angebotsadaption
4.2.3 Gesundheit - Casemanagement und Selbsthilfegruppen
4.2.4
1. Einleitung
Die Zahl der Kinder, die in Deutschland von Vernachlässigung betroffen sind, kann nicht beziffert werden (Kindler 2015, 11). Es gibt derzeit keine empirisch abgesicherten Erkenntnisse, insgesamt mangelt es diesbezüglich an wiederkehrenden Erhebungen (Fendrich/Pothmann 2010, 1009). Würden internationale Studien auf Deutschland übertragen, dann wäre davon auszugehen, dass die Anzahl „vernachlässigter Kinder auf hohem Niveau stagniert“ (Kindler 2015, 11). Bekannt ist die Zahl der Verfahren zur Kindeswohlgefährdung. Diese sind von 2014 bis 2015 um 4,2 Prozent angestiegen (Destatis 2016). Bei den akuten oder latenten Kindeswohlgefährdungen gab es in 63,7 Prozent der Fälle Anzeichen von Vernachlässigung (ebd.). Demnach sind circa 28 665 Kinder durch die Kinder- und Jugendhilfe erfasst worden.
Betroffen von Vernachlässigung sind Kinder aller Altersstufen, am häufigsten kommen Säuglinge und Kleinkinder im ersten Lebensjahr ums Leben (Hofacker 2012, 97). Vernachlässigungsfälle mit Todesfolge und insbesondere Fälle, die innerhalb von Hilfeprozessen geschehen, lösen mediale Diskurse aus und lassen die Mitarbeiter sozialpädagogischer Berufsfelder betroffen zurück (Fegert/Ziegenhain/Fangerau 2010, 10).
Zudem ist die Forschungslage zum Geschehen unzureichend. Es gibt das Schlagwort von der „Vernachlässigung der Vernachlässigung“ (Wolock/Horowitz 1984 zit. n. Galm/ Hess/Kindler 2010, 7). Alle bisherigen Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass sich Vernachlässigung durch ein Zusammenspiel von persönlichen Faktoren und gesellschaftlichen Bedingungen entwickelt. Zu deren Vermeidung müssten Eltern möglichst früh erreicht werden.
In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie Zugänge und Angebote gestaltet werden müssten, um der Vernachlässigung von Kindern präventiv zu begegnen. Dazu findet im ersten Teil der vorliegenden Arbeit eine Betrachtung der wissenschaftlichen Erkenntnisse statt. Im zweiten Teil wird das Konzept der Sozialraumorientierung vorgestellt. Anders als der Name es vermuten lässt, ist Sozialraumorientierung auch ein „hochgradig personenbezogener Ansatz“ (Hinte 2006, 11). Denn der Mensch und sein Wille stehen im Fokus der sozialarbeiterischen Tätigkeiten, allerdings werden die sozialen und ökologischen Verhältnisse dabei einbezogen und beeinflusst.
Im Dritten Teil werden die Erkenntnisse, die sich aus der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Vernachlässigung und der Betrachtung des Fachkonzeptes ergeben haben, zusammengeführt. Hierbei soll dargestellt werden, welche konzeptionellen und methodischen Möglichkeiten Sozialraumorientierung bezüglich der Fragestellung bietet.
2. Vernachlässigung
In diesem Kapitel erfolgt eine Betrachtung des wissenschaftlichen Standes bezüglich der Vernachlässigung von Kindern. Da der Begriff Vernachlässigung von Fachkräften verschiedener Berufsgruppen häufig mit einem unterschiedlichen Verständnis verwendet wird, soll hierbei mit dem Terminus, der Definition und den Möglichkeiten einer fachlichen Abgrenzung begonnen werden (Galm et al. 2010, 24). Anschließend werden die Formen und Folgen der Vernachlässigung dargestellt, um daraus Rückschlüsse auf Angebote und Zugänge zu ziehen. Um weitere Möglichkeiten eines präventives Vorgehen zu erkennen, werden die bisher bekannten Ursachen betrachtet. Als ursächlich gilt hierbei die Bindungsstörung. Zudem wird vermutet, dass eine angesprannte finanzielle Situation sowie ein belastendes Wohnumfeld, soziale Isolation und Überforderung aufgrund mangelnder Unterstützung als Faktoren am Geschehen beteiligt sind. Dabei wird die derzeitige gesellschaftliche Situation einbezogen und auf mögliche reziproke Wechselwirkungen innerhalb der Faktoren hingewiesen. Abschließend werden einige wissenschaftliche Meinungen und praktische Problemstellungen benannt, denn es scheint sinnvoll daraus ableitbare Lehren in präventive Überlegung einfließen zu lassen.
2.1 Begriffsklärung, Definition und Abgrenzung
Bei Vernachlässigung sind die Übergänge von einer normalen Versorgung zur Unterversorgung fließend (Gitter 2012, 130). Was aber ist unter einer normalen Versorgung zu verstehen und wann kann die Versorgung eines Kindes als schlecht bezeichnet werden? Eine Festlegung des Normalen an kindlicher Versorgung als allgemein gültiger Standard ist bislang nicht realisiert. Bereits Maslow (1979, 364) hat sich mit dem Begriff des »Normalen« und dessen Pendant, dem »Unnormalen« beschäftigt und bemerkt, dass diese so viele verschiedene Bedeutungen haben können, dass sie nutzlos geworden sind. Maslow (ebd.) schreibt, dass diese Frage für viele Menschen, demnach auch für Professionelle, im Wesentlichen eine „Wertefrage“ ist.
Würde das Normale als das »durchschnittlich Gute« verstanden, dann kann angenommen werden, es wäre qua Definiton festlegbar. Daraus ergibt sich folglich die Frage, wer die Definitionshoheit diesbezüglich besitzt. Welche gesellschaftlichen Gruppen definieren dies? Sind es der Staat und seine Institutionen, die Wissenschaft und Forschung, ist es die Bevölkerung eines bestimmten Quartiers beziehungsweise Sozialraums oder die einzelne Familie? Jedes der genannten Systeme wird dem durchschnittlich Guten als Norm höchstwahrscheinlich ein anderes Verständnis zu Grunde legen und es anders definieren. Daraus ergibt sich, dass eine normale Versorgung als allgemeingültiger Standard schwer festzulegen ist. Ebenso ist dies mit der nicht mehr guten, somit nicht normalen Versorgung, der Vernachlässigung. Sie ist in diesem Sinn nicht allgemein festlegbar.
Es stellt sich also weiterhin die Frage nach der Möglichkeit einer Orientierung, vielleicht an »anderen Gesellschaften« oder an »anderen Zeiten«. Wären dies Referenzpunkte zur Konkretisierung einer nomalen und guten Versorgung? Nun sind andere Gesellschaften bezüglich ihres Lebenstandards und ihrer Gesellschaftssysteme von anderer Ausstattung, und die Zeit unterliegt dem Wandel und der Veränderung (Schone/Gitzel/ Jordan/Kalscheuer/Münder 1997, 25). Deshalb kann gesagt werden, „was ein Kind zum Aufwachsen braucht ist in höchstem Maße geschichts- und gesellschaftsabhängig“ (ebd.). Folglich ist Vernachlässigung zum einen als Norm nicht festlegbar, zum anderen kann sie nicht anhand von Referenzpunkten wie »andere Gesellschaften« oder »dem Früher« betrachtet werden.
Frank (2008, 84) bezeichnet Vernachlässigung als „schwammiges Konstrukt“. Er sieht in der Vernachlässigung einen „tatsächlichen oder vermeintlichen Mangel in der Versorgung eines Kindes“ (ebd.). Aber können Eltern immer und zu jeder Tages- und Nachtzeit hundertprozentig und vollumfänglich für ein Kind sorgen? Wann beginnt die Vernachlässigung? Schone et al. (1997, 21) haben den Begriff wie folgt definiert:
„Vernachlässigung ist die andauernde oder wiederholte Unterlassung fürsorglichen Handelns sorgeverantwortlicher Personen (Eltern oder andere von ihnen autorisierte Betreuungspersonen), welches zur Sicherstellung der physischen und psychischen Versorgung des Kindes notwendig wäre. Diese Unterlassung kann aktiv oder passiv (unbewußt), aufgrund unzureichender Einsicht oder unzureichenden Wissens erfolgen. Die durch Vernachlässigung bewirkte chronische Unterversorgung des Kindes durch die nachhaltige Nichtberücksichtigung, Mißachtung oder Versagung seiner Lebensbedürfnisse hemmt, beeinträchtigt oder schädigt seine körperliche, geistige und seelische Entwicklung und kann zu gravierenden bleibenden Schäden oder gar zum Tode des Kindes führen.“
Demnach muss das Geschehen dauerhaft sein, die Handlungen müssen sich wiederholen und Bereiche betreffen, die für das Kind derart wichtig sind, dass bei Nichtversorgung ein Mangel entsteht, der es schädigen kann. Enthalten ist zudem eine Differenzierung in die Handlungsmodi aktiv und passiv. Für Schone et al. (1997, 22) geschieht die aktive Vernachlässigung wissentlich, weil die sorgeberechtigten Personen den Bedarf des Kindes erkennen könnten und die Erfüllung von ihnen auch leistbar wäre. Die passive Vernachlässigung ist für Schone et al. (ebd.) eine Folge unbewusster elterlicher Unterlassungen aufgrund mangelnden Wissens und Einsicht, aber auch die mögliche Folge elterlicher Fehlhandlungen. Sie können demnach über entsprechendes Wissen verfügen und überfordert sein oder bei der Versorgung Fehler machen. Zudem werden Versorgungshandlungen von diesen Eltern mitunter auch schlicht vergessen. Schone et al. (ebd.) schreiben, dass trotz einer Unterscheidung der Handlungsmodi „scharfe Grenzziehungen“ zwischen aktiver und passiver Vernachlässigung nicht möglich sind. Nach Galm et al. (2010, 24) sollte der Begriff Vernachlässigung zudem nicht für familiäre Situationen verwendet werden, in denen Kinder nicht gefährdet sind. Sie müssten von Fachkräften als „distanzierte, unzureichende oder unengagierte Fürsorge“ (ebd.; Hervorh. im Orig. fett) bezeichnet werden.
2.2 Vernachlässigungsformen und Folgen
Bei Vernachlässigungsprozessen werden die Bedürfnisse des Kindes teilweise oder vollumfänglich nicht erfüllt. Maslow (1979, 74ff.) beschreibt die Bedürfnisse des Menschen in der Theorie der menschlichen Motivation. Eine Befriedigung derer sei notwendig, damit sich der Mensch psychisch und physisch gut entwickeln kann. Er beschreibt grundlegende Bedürfnisse des Menschen und zählt Nahrung, Sicherheit, Zugehörigkeit und Liebe, Achtung und Wertschätzung sowie Selbstverwirklichung zu den existenziellen Bedürfnissen des Menschen. Die Bedürfnisse von Kindern können anhand der Maslowschen Bedürfnispyramide Hierarchiestufen zugeordnet werden (Hofacker 2012, 97). Fegert (1997, 69) beschreibt kindliche Bedürfnisse genauer, er bezeichnet diese als
Basic Needs. Dazu gehören Versorgung, Zuwendung und Liebe, körperliche Unversehrtheit, Körperpflege, Gesundheitsfürsorge, ein geregelter Tagesablauf, Aufsicht, stabile Bindungen, relative Freiheit von Angst, Respekt, altersentsprechende Intimität, Schutz vor sexueller Ausbeutung, Anregung und Vermittlung von Erfahrungen.
Die Nichterfüllung dieser kindlichen Bedürfnisse kann verschiedenen Bereichen zugeordnet werden (Hofacker 2012, 97). Diese sind der körperliche, der erzieherisch-kognitive, der emotionale und der Schutzbereich (Galm et al. 2010, 25). Sie bezeichnen zugleich die Formen von Vernachlässigung. Im Einzelfall besteht die Möglichkeit, dass ein spezieller Versorgungsbereich betroffen ist. Allerdings gilt es als nachgewiesen, dass häufig mehrere Vernachlässigungsformen gleichzeitig und in unterschiedlich starker Ausprägung in der jeweiligen Form vorhanden sind (Gitter 2012, 130; Galm et al. 2010, 26). Die Vernachlässigungshandlungen stellen sich in den einzelnen Bereichen wie folgt dar:
Bei körperlicher Vernachlässigung bleibt die Grundversorgung des Kindes aus. Es wird nicht ausreichend mit Nahrung und Flüssigkeit versorgt. Zudem werden die nötigen Pflegehandlungen von den Eltern nicht durchgeführt (Gitter 2012, 129). Ferner wird die kindliche Gesundheit vernachlässigt (Hofacker 2012, 97).