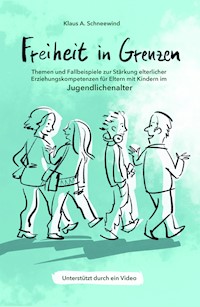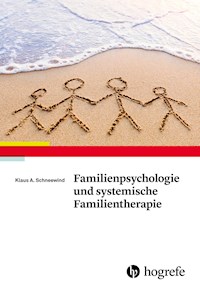9,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
"Schwierige" Menschen, die unser Leben beeinträchtigen, gibt es zuhauf. Dieses schmale Buch zeigt die Bandbreite unterschiedlicher Typen von "schwierigen" Zeitgenossen und deren Verhaltensweisen. Dabei erweisen sich Abgrenzung, konstruktive Beziehungsfertigkeiten und Ärgerkontrolle als wichtige Ressourcen, um sich gegen "schwierige" Menschen zu behaupten. Einschlägige Beispiele ermöglichen Ihnen, selbst herauszufinden, wie Sie Beziehungsprobleme bewältigen und der "Ärgerfalle" entgehen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 41
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Impressum:
© 2018 K. A. Schneewind
Illustrationen und Titelbild: Björn von Schlippe
Korrektorat, Layout u. Umschlaggestaltung:
Angelika Fleckenstein, Spotsrock
ISBN Taschenbuch:
978-3-7469-2570-7
ISBN Hardcover:
978-3-7469-2571-4
ISBN eBook:
978-3-7469-2572-1
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Klaus A. Schneewind
Wie gehe ich mit „schwierigen“ Menschen um?
– Wege aus der Ärgerfalle –
Inhalt
Vorwort
1.Wann sind schwierige Menschen „schwierig“?
2.Ärger und Ärgerkontrolle
3.Grenzen erkennen und Grenzen setzen
4.Grundlagen konstruktiver Beziehungsfertigkeiten
5.Beziehungskompetenzen stärken
Anhang
Literatur
Vorwort
Dass es nicht immer leicht ist, mit anderen Menschen – wie es so schön heißt – gut auszukommen, ist eine Binsenweisheit. Für manche ist es, wenn es um den Umgang mit mutmaßlich „schwierigen“ Menschen geht, naheliegend, sich an die in englischer Sprache formulierte Empfehlung zu halten: „love it, change it or leave it“ (vgl. hierzu z. B. den entsprechenden Text von Gerhard Nagel, 2018, für junge Führungskräfte). Was Familien anbelangt, hat sich in Deutschland das „leave it“ immer mehr durchgesetzt: die Scheidungsquote ist zwischen 1960 und 2016 um das Vierfache gestiegen, d. h. von 10 Ehescheidungen pro 100 Eheschließungen im Jahr 1960 auf 40 Ehescheidungen pro 100 Eheschließungen im Jahr 2016.
Insofern liegt es nahe, der Frage nachzugehen, was dazu beiträgt, dass Menschen „schwierig“ sind oder „schwierig“ werden – eine Feststellung, die allerdings immer im sprichwörtlichen „Auge des Betrachters“ liegt und deswegen auch mit Anführungs- und Schlusszeichen versehen ist. Es geht in diesem Buch daher vornehmlich darum, Kompetenzen zu vermitteln, die dazu geeignet sind, nicht vorzeitig die „Flinte“ ins Korn zu werfen, sondern Möglichkeiten zu nutzen, die den Weg ebnen, Ärger zu kontrollieren, Grenzen zu setzen und konstruktive Beziehungskompetenzen zu stärken.
Der Text zu diesem Band ist entstanden auf der Basis von Workshops, die ich seit rund 20 Jahren zu dieser Thematik durchgeführt habe.
Klaus A. Schneewind
1. Wann sind schwierige Menschen „schwierig“?
Diese Frage – und vor allem das mit einem Anführungszeichen versehene Wörtchen „schwierig“ – lässt die Nachfrage aufkommen, was diese Anführungszeichen eigentlich bedeuten sollen. Die Antwort ist ebenso einfach wie herausfordernd: Einfach deswegen, weil wir im Kontakt mit einer anderen Person ziemlich schnell feststellen, ob wir es mit einem „schwierigen“ Gegenüber zu tun haben (z. B., wenn dieses Gegenüber uns im Gespräch nicht anschaut, auf Fragen nicht oder nur unwirsch reagiert oder ein Gespräch von sich aus abrupt abbricht). Und herausfordernd deswegen, weil wir entscheiden müssen, wie wir mit einer Person, die wir als einen „schwierigen“ Kantonisten wahrnehmen, umgehen wollen. Mit anderen Worten: ob jemand „schwierig“ ist oder nicht, bestimmen wir selbst. Oder anders ausgedrückt: Alles, was wir erleben und wie wir es erleben, ist stets im „Auge des Betrachters“ – gleichgültig, ob es sich dabei um sogenannte „hard facts“ (z. B. der Tod einer Person) oder „soft facts“ (z. B. das Nichteinhalten einer Verabredung) handelt.
Vor allem bei den „soft facts“ kommt das „Auge des Betrachters“ besonders zum Tragen. Ganz allgemein lässt sich dies an der Verarbeitung der Botschaft eines Kommunikationspartners A (Senders) an einen Kommunikationspartner B (Empfänger) verdeutlichen (vgl. Abb. 1).
Abb. 1: Verarbeitung von Botschaften im Kommunikationsprozess
Aufseiten des Empfängers findet eine komplexe Dekodierung der Botschaft des Senders statt. Angenommen, bei dem Sender handelt es sich um einen Arbeitskollegen des Empfängers und die Botschaft des Senders lautet: „Geben Sie mir mal kurz Ihren Taschenrechner“. Je nach der Qualität der Beziehung zwischen den beiden Arbeitskollegen und auch der Beziehungserfahrungen, die sie mit anderen Personen gemacht haben, können sowohl die beobachtbaren als auch die intern ablaufenden Prozesse sehr unterschiedlich ausfallen. Dabei spielt die Art und Weise, wie die Botschaft des Senders vorgetragen wird, eine zentrale Rolle.
Wenn die Botschaft „Geben Sie mir mal kurz Ihren Taschenrechner“ (neben einem fehlenden „Bitte“) kühl und herrisch vorgetragen wird, ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass sich beim Empfänger eine erfreute Bereitschaft einstellt, dieser Aufforderung nachzukommen. Die Wahrnehmung dieser Botschaft verknüpft sich mit bestimmten Empfindungen, die sich in Gedanken (z. B. „Schon wieder werde ich wie ein Lakai behandelt“), Gefühlen (z. B. „Ärger“), Körperempfindungen (z. B. „Anspannung“) einstellen und einen Handlungsimpuls auslösen (z. B. „Am liebsten würde ich sagen: So schon mal gleich gar nicht – suchen Sie sich jemand anderen“), der jedoch von einer Folgeerwartung (z. B. „Wenn ich es nicht tue, gibt’s nur Probleme“, zumal wenn es sich bei der betreffenden Person um einen Vorgesetzten handelt) eingebremst wird. Es kommt dann zu einer beobachtbaren Reaktion