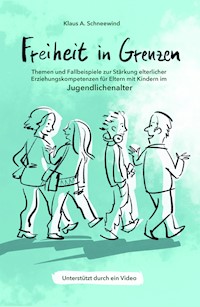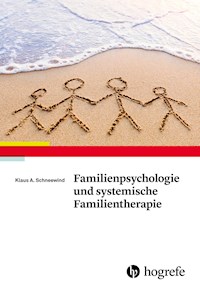
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es gibt Familien in vielen verschiedenen Zusammensetzungen und Arten. In diesem Buch wird das Familienleben in seiner ganzen Vielfalt betrachtet. Dazu werden die Sichtweisen der Familienpsychologie und der systemischen Familientherapie kombiniert. Zunächst erfolgt eine Schilderung der Unterschiede in den Beziehungen zufriedener und unzufriedener Paare, der Konsequenzen mangelnder Partnerschaftsqualität und -stabilität sowie der unterschiedlichen Beziehungs- und Erziehungskompetenzen von Eltern. Darüber hinaus nimmt das Buch die Qualität von Beziehungen zwischen Geschwistern, Großeltern und weiteren Verwandten in den Blick. Vor diesem Hintergrund werden einige präventive Ansätze zur frühzeitigen Stärkung von Paar- und Eltern-Kind-Beziehungen exemplarisch dargestellt und deren Wirksamkeit wird bewertet. Die zentralen Vorgehens- weisen in der Familientherapie werden erläutert. Das Buch schließt mit einer detaillierten Darstellung der Möglichkeiten der systemischen Familientherapie für die Behandlung von Familien. Hierbei werden zentrale Techniken der systemischen Familientherapie anhand von Beispielen veranschaulicht und die wesentlichen Ergebnisse zur Wirksamkeit basierend auf der aktuellen Befundlage dargestellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Klaus A. Schneewind
Familienpsychologie und systemische Familientherapie
Prof. em. Dr. Klaus A. Schneewind, geb. 1939. 1959–1964 Studium der Psychologie, 1964 Promotion und 1964–1970 Wissenschaftlicher Assistent an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. 1968–1970 Freistellung als Research Associate an der University of Illinois, Champaign-Urbana. 1970–1977 Professur an der Universität Trier. 1977–2008 Professur an der Ludwig-Maximilians-Universität München. 2013–2017 Seniorprofessur an der Psychologischen Hochschule Berlin.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Umschlagabbildung: © iStock.com by Getty Images / NicoElNino
Satz: Matthias Lenke, Weimar
Format: EPUB
1. Auflage 2019
© 2019 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-2950-2; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-2950-3)
ISBN 978-3-8017-2950-9
http://doi.org/10.1026/02950-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
|5|Vorwort
Dieses Buch versucht einen gewagten Spagat, indem es die Vielfalt des Familienlebens aus der Perspektive der Familienpsychologie und der systemischen Familientherapie beleuchtet und auf Möglichkeiten für ein gelingendes Familienleben verweist. Dass die Familienpsychologie und die systemische Familientherapie zwei „ungleiche Schwestern“ seien, wurde 2012 in einem Editorial der Zeitschrift „Familiendynamik“ von Arist von Schlippe und dem Autor des vorliegenden Buchs deutlich zum Ausdruck gebracht. Es hieß in diesem Editorial allerdings auch, dass beide Disziplinen „füreinander bedeutsame Umwelten“ seien und dass sie als solche in der Lage sind, „sich gegenseitig dazu anzuregen und sich weiterzuentwickeln“ (vgl. Schneewind & von Schlippe, 2012, 2, S. 81).
In diesem Sinne versteht sich dieser Band – trotz der „ungleiche Schwestern“-Metapher – als Beleg dafür, dass beide Schwestern gar nicht so „ungleich“ sind. Zumal wenn es darum geht, das Spektrum von Familienbeziehungen auszuloten und gegebenenfalls Veränderungen präventiver und – falls erforderlich – systemisch-beraterischer bzw. -therapeutischer Natur auf den Weg zu bringen sowie deren Wirksamkeit zu belegen. Sofern das gelingt, kann dies auch zum Gelingen eines zufriedenstellenden Familienlebens für alle Beteiligten beitragen.
Abschließend noch ein kleiner aber nicht unbedeutender Hinweis in eigener Sache: Ich habe bei der generalisierenden Erwähnung von Repräsentanten der Themenbereiche Familienpsychologie und systemische Familientherapie keine Geschlechtsdifferenzierung vorgenommen (z. B. Familienpsychologinnen und Familienpsychologen oder Systemische Familientherapeutinnen und Familientherapeuten), sondern mich entschlossen, in diesem Fall aus Lesbarkeitsgründen die männliche Variante zu wählen.
Klaus A. Schneewind
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
I. Vom Zustand der Familie in Deutschland
1 Familienleben im gesellschaftlichen Blickfeld
1.1 Das allmähliche Verschwinden der „Familie“ in Deutschland
1.2 Die Pluralisierung von Familienformen hat zugenommen
1.3 Wie geht’s der Familie? – nicht nur eine Party-Frage
1.4 Grundlegendes zur Lebensform „Familie“ aus Sicht der Familienpsychologie
2 Familienbeziehungen klären: Themen und Ergebnisse nichtinterventiver familienpsychologischer Forschung
2.1 Unterschiede in den Beziehungen zufriedener und unzufriedener Paare und Ehen
2.2 Beziehungs- und Erziehungskompetenzen von Eltern im Umgang mit ihren Kindern
II. Prävention im Kontext von Familien
3 Prävention im Kontext von Paar- und Eltern-Kind-Beziehungen
3.1 Formen und Strategien präventiver Intervention
3.2 Prävention im Kontext von Paarbeziehungen
3.2.1 Das „paarlife“-Programm
3.2.2 Die Paarkommunikationstrainings EPL, KEK und KOMKOM
3.3 Prävention im Kontext von Eltern-Kind-Beziehungen
3.3.1 Triple P – „Positives Erziehungsprogramm für alle Eltern“
3.3.2 Starke Eltern – Starke Kinder©
3.3.3 Das EFFEKT©-Elterntraining
3.3.4 Das „Freiheit in Grenzen“-Programm
III. Systemische Familientherapie: Grundlagen, Anwendung und Wirksamkeit
4 Therapie im Kontext von Familienbeziehungen
4.1 Entwicklung der systemischen Familientherapie: von der Differenzierungs- zur Integrationsphase
4.2 Was bedeutet „systemisch“ im Kontext der Familientherapie?
4.3 Systemische Interventionen in der Familientherapie
4.4 Wirksamkeit systemischer Familientherapie
4.4.1 Studien zur Wirksamkeit systemischer Therapie/Familientherapie
4.4.2 Metaanalysen im Rahmen von systemischer (Familien-)Therapie
4.4.3 Zur Effektivität systemischer Therapie/Familientherapie jenseits des „Goldstandards“
Schlussbemerkung
Literatur
Sachregister
|9|I. Vom Zustand der Familie in Deutschland
|11|1 Familienleben im gesellschaftlichen Blickfeld
Auf der Basis einschlägiger empirischer Daten aus unterschiedlichen Bereichen der Familienforschung sollen die folgenden vier Themen ausführlicher dargestellt werden.
1.1 Das allmähliche Verschwinden der „Familie“ in Deutschland
Überblick
Wir alle sind Familienmenschen: Jeder von uns hat einen Vater und eine Mutter. Biologisch betrachtet sind wir eingebunden in die stetige Abfolge des Parentalen und Filialen. Allerdings hat sich in Deutschland die Anzahl der Geburten seit dem Jahr 1960 nahezu halbiert und bleibt deutlich unter dem Kriterium der „Bestandserhaltung der Bevölkerung“. Dies zeigt sich u. a. auch in den aktuellen Befunden des haushaltsbezogenen Mikrozensus der Bundesrepublik Deutschland, wonach Familien (d. h. Paare mit Kindern und Alleinerziehende) den geringsten Anteil an Haushalten darstellen.
Unbestritten ist, dass wir – ob wir es wollen oder nicht – alle Familienmenschen sind. Dies hat der Familientherapeut Duss-von Werdt (1980, S. 18) klar zum Ausdruck gebracht, wenn er feststellt: „Jeder hat Vater und Mutter, selbst wenn er sie nie erlebt und gekannt hat. Er ist und bleibt ihr Kind.“ Und er fährt fort, dass „man nie niemandes Kind“ ist und dass „diese zwei Existenzdimensionen des Kindlichen und Elterlichen … den Familienmenschen“ ausmachen, da diese „jeder Form von tatsächlich wahrgenommener Elternschaft und konkret erfahrener Eltern-Kind-Beziehung als deren Bedingung“ vorausliegen.
Man denke dabei an die auch in Deutschland im Jahr 2000 – erstmalig in Hamburg – eingeführten Babyklappen, in denen bis Januar 2012 bereits 278 neugeborene Kinder anonym abgelegt wurden, die nie ihre leiblichen Eltern kennenlernten (vgl. Continho & Krell, 2011). Dennoch sind diese Kinder, ob sie es wollen oder |12|nicht, genetisch mit ihren leiblichen Eltern verbunden. Diese genetische Grundausstattung beeinflusst nicht nur ihre persönliche Entwicklung, sondern – wenn es dazu kommen sollte – auch ihre spätere familiale Entwicklung im Kontext von Paar- und Eltern-Kind-Beziehungen (vgl. Kandler, 2013; Lenz, 2012).
Was aber ist nun eigentlich unter dem Begriff Familie zu verstehen? Der Familiensoziologe Schneider (2012, S. 97) lässt zunächst einmal aufhorchen, wenn er behauptet: „Die Familie gibt es nicht.“ Dann aber fährt er fort: „Vielmehr ist von einer Vielfalt familialer Lebensformen auszugehen … Bei aller gesellschaftlichen Prägung, Familie ist auch ein individuelles Beziehungsgefüge, das durch Individuen hervorgebracht, gelebt und gestaltet wird. Typische Muster und Gestaltungsformen geben der Familie ihr jeweiliges Gesicht und wirken zugleich zurück auf die Gesellschaft“. Das Verständnis von Familie konzentriert sich dabei auf unterschiedliche selbstgestaltete Lebensformen im Kontext gesellschaftlicher Gegebenheiten.
Eine allgemein verbreitete Auffassung zu dem, was Familie ist, stammt vom ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler, die er anlässlich einer Anfang 2006 beim Jahresempfang der Evangelischen Akademie Tutzing gehaltenen Rede formuliert hat. Er sagte: „Familie ist da, wo Kinder sind“, wobei er freilich nicht auch zum Beispiel Schulklassen oder Sportvereine, in denen es ja auch Kinder gibt, gemeint hat.
Ein weiterer Ansatz zur Festlegung des Familienbegriffs findet sich im jährlich durchgeführten Mikrozensus der Bundesrepublik Deutschland. Dieser repräsentiert die Befragung von 1 % der Bewohner und Bewohnerinnen aller bundesdeutschen Haushalte und erlaubt somit eine Einschätzung der Familien- und Lebensformen in Deutschland. Im Mikrozensus wird unterschieden, ob es sich um Haushalte mit und ohne Partner bzw. Partnerin sowie um Haushalte mit Kindern und ohne Kinder handelt.
Der Familienbegriff im Mikrozensus umfasst Familien im Sinne einer zweigenerationalen Perspektive lediglich Ehepaare, nichteheliche und gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften mit Kindern sowie Alleinerziehende mit Kind(ern). Hingegen werden Ehepaare und Lebensgemeinschaften sowie Alleinstehende (darunter auch Alleinlebende) ohne Kind(er) nicht als Familien bezeichnet. Bezogen auf das Jahr 2016 wurden rund 830.000 Personen in rund 370.000 Haushalten befragt (Statistisches Bundesamt, 2017b; im Folgenden jeweils gerundete Zahlen).
Auch wenn inzwischen eine leichte Erholung des Geburtendefizits stattgefunden hat, besteht in der Relation von Geburten und Sterbefällen seit 1972 ein Negativsaldo zu Ungunsten der Geburten. Für das Jahr 2015 standen 737.575 Geburten 925.200 Sterbefälle entgegen, was einem Geburtendefizit von 187.625 Neugeborenen entspricht.
|13|Wenn das Verständnis von Familie mit der Geburt von Kindern, d. h. einer wenigstens zwei Generationen umfassenden Perspektive, im Zusammenhang steht, dann zeigt sich auch für den Zeitraum seit 1960, dass die Zahl der Lebendgeburten in Deutschland – abgesehen von kleineren Ausreißern für die Jahre 1990 und 2016 – stetig abgenommen hat (vgl. Tab. 1). Dabei ist der aktuelle Geburtenzuwachs zu 3 % auf deutsche und zu 25 % auf nichtdeutsche (vor allem afghanische, irakische und türkische) Frauen zurückzuführen.
Tabelle 1: Lebendgeburten in Deutschland (eigene Berechnungen auf Basis von Daten des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln e. V., n. d., und des Statistischen Bundesamts, 2017d)
Jahr
Lebendgeburten (in Millionen)
In Prozent von 1960
1960
1.26
100
1970
1.04
83
1980
0.87
69
1990
0.91
72
2000
0.76
60
2016
0.79
63
Demnach hat sich die Zahl der jährlichen Geburten von 1960 bis 2015 um 520.000 Geburten (bzw. prozentual um 41 %) verringert. Sofern diese Entwicklung als linearer Trend anhalten würde, gäbe es in 55 Jahren – also im Jahr 2080 – in Deutschland keine Geburten mehr (so viel nur zur Problematik linearer Trends im Kontext von zweifelhaften linearen Prognosen).
Die zusammengefasste Geburtenziffer, d. h. die Summe der 30 bzw. 35 altersspezifischen Geburtenziffern der Altersjahrgänge 15 bis 45 bzw. 49 für ein bestimmtes Kalenderjahr, betrug für das Jahr 2015 in Deutschland 1.50 Kinder je Frau – ein Wert, der nach zuvor niedrigeren Geburtenziffern erstmalig nach 33 Jahren wieder erreicht wurde. Im Jahr 2014 betrug die zusammengefasste Geburtenziffer noch 1.47 Kinder je Frau oder weniger statistisch mit Blick auf „ganze“ Kinder ausgedrückt: 2015 wurden im Vergleich zu 2014 pro 1.000 Frauen 27 Kinder mehr geboren. 2016 hat sich die Geburtenrate nochmals um 7 % erhöht, was vor allem auf eine höhere Geburtenrate zugewanderter Frauen zurückzuführen ist: für deutsche Mütter beläuft sich der Zuwachs – wie bereits erwähnt – auf 3 %, während er bei ausländischen Müttern 25 % beträgt (Statistisches Bundesamt, 2018).
Vor diesem Hintergrund rechnet das Statistische Bundesamt bereits in seiner im Jahr 2017 erstellten Prognose zum Thema „Lebendgeborene“ bis zum Jahr 2060 bei stärkerer Zuwanderung mit einer Geburtenrate von 1.6 Kindern pro Frau und |14|bei schwächerer Zuwanderung mit einer niedrigen Geburtenrate von 1.4 Kindern pro Frau (oder wieder auf „ganze“ Kinder bezogen: 16 Kinder bzw. 14 Kinder pro 10 Frauen). Wenn diese Prognosen zutreffen, muss man davon ausgehen, dass von den 16 bzw. 14 Kindern pro 10 Frauen im Schnitt die eine Hälfte der Kinder männlichen und die andere Hälfte weiblichen Geschlechts ist. Mit anderen Worten: da bekanntermaßen ausschließlich Frauen Kinder bekommen können, käme es in Deutschland auf Dauer zu einer deutlichen Bevölkerungsschrumpfung und damit auch zu einer immer geringer werdenden Möglichkeit, eine Familie zu gründen.
Hinzu kommt, dass sich – nach den Ergebnissen der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung für Deutschland – die Schere zwischen gestorbenen und geborenen Personen in Deutschland immer weiter öffnet. Nach der Prognose für das Jahr 2060 wird erwartet, dass die Anzahl der zu diesem Zeitpunkt Gestorbenen mit rund einer Million doppelt so groß ist wie die Zahl der Geborenen mit rund 500.000 Kindern (Statistisches Bundesamt, 2017b).
Vor diesem Hintergrund wird verständlich, dass die Repräsentanten der deutschen Wirtschaft zum Ausgleich des Mangels an Erwerbsfähigen eine entsprechende Zuwanderung von Arbeitskräften fordern und insofern – im Gegensatz zu manch anderen – einer Zuwanderung von Ausländern und ihren Familien positiv gegenüberstehen (vgl. Bonin, 2014; Barslund et al., 2015).
1.2 Die Pluralisierung von Familienformen hat zugenommen
Überblick
Neben „traditionellen“ Familien (d. h. verheiratete und genetisch nicht verwandte Eltern unterschiedlichen Geschlechts mit wenigstens einem eigenen Kind) hat auch rechtlich eine Reihe weiterer Familienformen an Bedeutung gewonnen (z. B. „Stief“-, „Patchwork“-, „Regenbogen-, „Queer“-, „Polyamore“- „Transsexuelle“ bzw. „Transidente“- sowie neuerdings auch „Schwulen- und Lesben“-Familien). Darüber hinaus kann es womöglich nach einer aktuellen Entscheidung des Deutschen Ethikrats bald auch Geschwisterfamilien mit eigenen Kindern geben.
„Die Familie gibt es nicht“, behaupten Seiffge-Krenke und Schneider (2012, S. 16), wobei die Betonung auf „Die“ als einer einzigen Variante von Familie liegt. Vielmehr gibt es unterschiedliche Familienleitbilder, die in einer vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (2013) herausgegebenen Publikation zum Thema Familienbilder auf der Basis einer repräsentativen Stichprobe von 5.000 Personen im Alter von 20 bis 39 Jahren dargestellt wurden. Vorgegeben waren sieben Kon|15|stellationen von Familienleitbildern, die – ausgedrückt in Prozentanteilen – von den Befragten als Familienleitbild bezeichnet wurden (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, 2013, S. 10):
Heterosexuelles Paar mit Kindern: 100 %
Ein unverheiratetes heterosexuelles Paar mit Kindern: 97 %
Ein homosexuelles Paar mit eigenen Kindern: 88 %
Eine Mutter, die mit einem neuen Partner unverheiratet zusammenlebt: 85 %
Eine alleinerziehende Mutter: 82 %
Ein heterosexuelles Ehepaar ohne Kinder: 68 %
Ein unverheiratetes Paar ohne Kinder: 33 %
Mit Bezug auf den haushaltsbezogenen Mikrozensus 2013 hat Schneider (2015) für Deutschland den prozentualen Anteil folgender Lebensformen zusammengestellt:
Ehepaare mit ledigen Kindern im Haushalt: 19 %
Lebensgemeinschaften mit ledigen Kindern im Haushalt: 2 %
Ehepaare ohne Kinder im Haushalt: 24 %
Lebensgemeinschaften ohne Kinder im Haushalt: 5 %
Alleinerziehende: 7 %
Alleinwohnende: 39 %
Alleinstehende: 5 %
Ein anderer Aspekt zum Verständnis von Familie zeigt sich, wenn junge Erwachsene (d. h. 18- bis 30-Jährige) nach ihrer Idealvorstellung einer Familienform gefragt werden (vgl. https://tinyurl.com/idealvorstellung). Mit geringen Unterschieden ergibt sich für Männer und Frauen ein sehr ähnliches Bild: es ist die sogenannte Kernfamilie, wonach beide Elternteile mit ihrem Kind bzw. ihren Kindern zusammenleben, die bei Männern (68 %) und Frauen (67 %) eindeutig eine Spitzenposition einnimmt.
Das Leben in einer Großfamilie mit drei Generationen (d. h. Großeltern, Eltern und Kinder unter einem Dach oder in naher Nachbarschaft) wird von 19 % (Männer) und 20 % (Frauen) als ideale Familienform betrachtet. Hingegen fallen gleichgeschlechtliche Paare mit Kind bzw. Kindern mit 4 % (Männer) und 2 % (Frauen) sowie Patchworkfamilien (d. h. Paare mit einem Kind oder mehreren Kindern aus früheren Beziehungen) mit jeweils 1 % der Männer und Frauen deutlich zurück. Den geringsten Zuspruch als Idealfamilie erhält mit jeweils 0 % die Familienform der Alleinerziehenden, die mit einem oder mehreren Kindern zusammenleben (Welche der folgenden Familienformen ist Ihre Idealvorstellung? [in Prozent], n. d.).
Ein weiterer empirischer Befund bezieht sich auf eine aktuelle bevölkerungsrepräsentative Befragung bezüglich der Bedeutung von Familienformen in den kommenden 20 Jahren. Dabei zeigt sich die Überzeugung, dass insbesondere Patchworkfamilien mit 83 % – gefolgt von gleichgeschlechtlichen Paaren mit Kindern (80 %) und auch Alleinerziehenden (69 %) – an Bedeutung gewinnen werden. Hin|16|gegen werden traditionelle Kernfamilien für 34 % der Befragten an Bedeutung verlieren. Für das Leben von Großfamilien, beläuft sich der Verlust an Bedeutung sogar auf 61 % der Befragten (Die Zukunft der Familie, Forsa Studie im Auftrag der Zeitschrift ELTERN, 2015).
Was den Familienbildungsprozess anbelangt, gibt es im gegenwärtigen deutschen Recht nur noch wenige Eheverbote, die in den §§ 1306 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) aufgezählt sind. Demnach ist eine Eheschließung bei bestehender Ehe, d. h. eine Doppelehe, strafbar. Gleiches gilt für Lebenspartnerschaften im Sinne eines Verbots von Bi- und Polygamie gemäß § 172 StGB. Darüber hinaus besteht auch ein Verbot der Verwandtenheirat. Demzufolge darf eine Ehe nicht geschlossen werden zwischen Blutsverwandten gerader Linie und zwischen voll- oder halbgebürtigen Geschwistern. Gleichermaßen gilt ein derartiges Verbot auch für adoptierte Kinder im Verhältnis zu den Adoptiveltern und deren Verwandten.
Im Übrigen betrifft ein solches Verbot auch den sogenannten „einvernehmlichen Geschwisterinzest“. Hierzu hat allerdings der deutsche Ethikrat in einer 2014 veröffentlichten Stellungnahme „mehrheitlich dafür plädiert, den einvernehmlichen Beischlaf unter erwachsenen Geschwistern nicht mehr unter Strafe zu stellen“, ohne dass dieser Appell bislang rechtlich anerkannt worden ist (vgl. Deutscher Ethikrat, 2015). Zu weiteren Diskussionen bezüglich dieser Thematik sei auf den im Internet abrufbaren Beitrag „Ehen zwischen Verwandten – was geht? Was geht nicht? Und warum?“ auf www.ehe.de verwiesen.
Nicht nur Eheschließungen zwischen Verwandten, sondern auch zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren sowie den sogenannten Regenbogen- und Queer-Familien mit Kindern, stellen eine gesellschaftliche Herausforderung dar, wenn auch unterschiedlicher Art. Dies vor dem Hintergrund, dass es nach den Informationen des Statistischen Bundesamts in Deutschland im Jahr 2015 insgesamt rund 94.000 Paare gab, „die in einer gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft lebten. Dies waren über die Hälfte mehr (57 %) als zehn Jahre zuvor (2005: rund 60.000 Paare). Männer lebten etwas häufiger mit einem Partner des gleichen Geschlechtes zusammen als Frauen, sie führten 52 % aller gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften.
Mit 46 % lebte 2015 etwas weniger als die Hälfte aller gleichgeschlechtlichen Paare in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft (rund 43.000 Paare). Seit dem Jahr 2006, als der Familienstand erstmals im Mikrozensus abgefragt wurde, hat sich die Zahl der eingetragenen Lebenspartnerschaften damit weit mehr als verdreifacht (2006: rund 12.000 Paare)“ (Statistisches Bundesamt, 2017a).
Mit Bezug auf die Zunahme homosexueller Partnerschaften hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe die Rechte homosexueller Eltern gestärkt. Nach einem am 15. Juni 2016 veröffentlichten Beschluss kann ein Kind auch dann zwei |17|Mütter mit allen Elternrechten haben, wenn die nichtleibliche Mutter das Kind nicht adoptiert hat. Im konkreten Fall bekam ein lesbisches Paar in Südafrika ein Kind, nachdem sich eine Partnerin hatte künstlich befruchten lassen. Die schwangere Südafrikanerin war mit einer Deutschen verheiratet – was nach südafrikanischem Recht möglich ist. Das Kind erhält nun auf Wunsch der Mütter die deutsche Staatsbürgerschaft. Dies sei im Sinne des Kindeswohls, begründete der BGH. Da beide Frauen verheiratet sind, gilt in Südafrika auch die deutsche Partnerin rechtlich gesehen als Mutter des Kindes.
Inzwischen hat sich – wie bereits erwähnt – die rechtliche Situation für homosexuelle Partnerschaften in Deutschland deutlich geändert: nachdem der Bundestag in seiner Sitzung am 30. Juni 2017 mit einer Mehrheit für die sogenannte „Ehe für alle“ gestimmt hat, besteht ab dem 1. Oktober 2017 die Möglichkeit, dass homosexuelle Paare nicht mehr in einer „eingetragenen Lebenspartnerschaft“ leben müssen, sondern heiraten und sodann auch Kinder adoptieren können (vgl. Stocker, 2017), was allerdings (noch) nicht für die Gruppe der intersexuellen Personen gilt. Die erste Heirat eines schwulen Paars erfolgte in Berlin am 2. Oktober 2017. Nur kurze Zeit später adoptierte dieses Paar ein Kind. Dies war deutschlandweit die erste gemeinschaftliche Adoption durch gleichgeschlechtliche Partner und damit auch rechtlich die erste Gleichgeschlechtlichen-Familie.
Noch im Jahr 2015 hatte die Zeitschrift Der Spiegel in einem Beitrag mit dem Titel „Familie für alle“ generell angemerkt, „dass homosexuelle Paare für Adoptionen vermehrt ins Ausland gehen, weil es für sie die einzige Möglichkeit ist, legal gemeinsam Kinder zu adoptieren und in Deutschland anerkannt zu werden“ (Amann et al., 2015, S. 16). Dies vor dem Hintergrund, dass es in juristischer Hinsicht für die Familiengründung von gleichgeschlechtlichen Paaren Restriktionen gab (vgl. Jansen et al., 2014). So war bis zum 1. Oktober 2017 die gemeinschaftliche Adoption eines Kindes durch ein gleichgeschlechtliches Paar in Deutschland nicht erlaubt, was allerdings für intersexuelle Menschen, die physisch weder männlichen noch weiblichen Geschlechts sind, nach Aussage des Bundesverfassungsgerichts gesetzlich frühestens Ende 2018 möglich ist. Hingegen brauchen inzwischen homosexuelle Paare nicht mehr – wie bisher – in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft zu leben, sondern können wie heterosexuelle Paare heiraten und Kinder adoptieren. Bis zu diesem Zeitpunkt mussten Homosexuelle und ihre Lebenspartner auf verschiedene, im Folgenden kurz dargestellte, Adoptionsmöglichkeiten zurückgreifen.
Zum einen bestand die Möglichkeit zu einer Stiefkindadoption, dies allerdings nur, wenn das Paar in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebte (was – wie bereits erwähnt – seit 2001 in Deutschland möglich war) und wenn der leibliche Elternteil über das alleinige Sorgerecht verfügte sofern ein gleichgeschlechtlicher Partner ein leibliches Kind aus einer früheren Beziehung in die aktuelle Beziehung einbrachte.
|18|Eine weitere Variante zur Familiengründung von homosexuellen Paaren bestand in der sogenannten Sukzessivadoption, die in Deutschland seit 2014 möglich war und bei der es darum geht, dass ein von dem anderen Lebenspartner bereits adoptiertes Kind später selbst adoptiert werden kann, was auch in diesem Fall eine eingetragene Lebenspartnerschaft voraussetzte.
Eine dritte Möglichkeit bezog sich auf eine Auslandsadoption vor dem Hintergrund, dass in Deutschland eine gemeinsame Adoption bis zur aktuellen Möglichkeit einer Heirat rechtlich nicht erlaubt war. Wurde ein Kind dagegen im Ausland nach dortigem Recht von beiden Partnern gemeinsam adoptiert (was z. B. in den USA möglich ist), mussten die deutschen Behörden diese Auslandsadoption anerkennen (BGH, Az.: XII ZB 730/12).
Für schwule Paare verbietet bislang die deutsche Rechtsprechung, ein gemeinsames Kind zu zeugen, welches das Erbgut eines Partners in sich trägt, da generell Leihmutterschaft in Deutschland verboten ist. Jenseits der Neuregelung der Adoptionsmöglichkeit durch homosexuelle Paare besteht jedoch für homosexuelle Paare beiderlei Geschlechts auch die Möglichkeit, sich auf folgendem Weg einen Kinderwunsch zu erfüllen: Wenn ein lesbisches oder ein schwules Paar sich ein gemeinsames Kind wünschen, stellt sich in beiden Fällen die Frage nach dem fehlenden biologischen Part. Eine Lösung für schwulen/lesbischen Kinderwunsch bietet hierzulande die Gründung einer sogenannten Queer-Familie (s. z. B. http://www.queer-baby.info/).
Hierbei findet durch die Samenspende eines schwulen Partners eine künstliche Insemination bei einer Frau statt, die in einer lesbischen Partnerschaft lebt. Dabei kann gemeinsam mit einem lesbischen Paar (oder als Samenspender für eine Frau, welche ihre Familie für zwei weitere Väter öffnet), ein Kind gezeugt werden. Hier ein Beispiel aus einer im Jahre 2013 auf Facebook veröffentlichten Mitteilung: „Am Wochenende bin ich Vater geworden. Mutter und Kind sind wohlauf. Gemeinsam mit ihrer Frau und meinem Mann freuen wir uns über unsere wundervolle Tochter“.
Was die Häufigkeit von Queer-Familien in Deutschland anbelangt, gibt es wenig belastbare Informationen. In einem 2014 durchgeführten Interview stellte die Leiterin des für Regenbogenfamilien zuständigen Projekts des deutschen Lesben- und Schwulenverbands (LSDV) fest: „In Metropolen scheint der Anteil der Queerfamilys [sic] recht groß zu sein. Das lässt eine Studie der Stadt Köln aus dem Jahr 2011 vermuten, die zeigte, dass sich in jeder vierten Kölner Regenbogenfamilie lesbische Mütter und schwule Väter gemeinsam um das Wohlergehen der Kinder kümmern“ (Jansen, 2014).
Ein weiterer Paar- bzw. Familientyp bezieht sich auf sogenannte polyamore – im Gegensatz zu monoamoren – Beziehungen zwischen Erwachsenen, die in Deutschland gesetzlich zulässig sind. Dies trifft nicht nur für Paarbeziehungen wie das be|19|rühmte französische Paar Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir zu, sondern findet sich auch in Familien, d. h. in der Gemeinschaft mit Kindern. Zuverlässige Daten über die Verbreitung polyamorer Familien gibt es nicht. Wohl aber Berichte über Einzelfälle, wie den von Lisa Seelig (2010) berichteten. Dort heißt es:
Polyamorie, das klingt nach Orgie. Doch wer eine Liebesbeziehung mit mehreren Menschen führt, muss vor allem gut organisiert sein. Nur so funktioniert etwa die Beziehung zwischen Franziska, Dave und Hinnerk. Wenn Franziska, Dave und Hinnerk mit den Kindern auftauchen – beim Kinderarzt, in der Kita oder im Zoo –, legen sich die Leute, die sie sehen, ihre eigene Wirklichkeit zurecht: Einer der beiden jungen Männer ist dann ein Kumpel. Oder der Bruder. Oder der Patenonkel. Erfahren sie später, dass Dave und Hinnerk beide eine feste Beziehung mit der 26-jährigen Franziska führen, dass beide Kinder mit ihr haben und dass die drei sogar zusammenleben, reagieren fast alle mit freundlicher Ablehnung. Ach, ist ja interessant, heißt es bestenfalls. Und, unvermeidlich: Also für mich wär das ja nichts! Franziska, Dave und Hinnerk – in den Augen der meisten Menschen sind sie seltsame Exoten.
Schließlich soll zur Thematik unterschiedlicher Lebens- und Familienformen noch auf die Gruppe der Transsexuellen bzw. Transidenten eingegangen werden. Es sind dies Personen, die entgegen ihres physischen Geschlechts sich dem jeweils anderen Geschlecht zugehörig fühlen. Nach einem Beitrag von Weitzel (2017, S. 8) kommt „auf 430 Geburten in Deutschland … nach aktueller Datenlage ein Mensch, der später eine Vornamens- und Personenstandsänderung nach dem 1981 in Deutschland eingeführten ‚Transsexuellen Gesetz‘ ermöglicht“. Inzwischen gibt es in der Bundesrepublik „172.000 transidente Menschen … mit rechtlicher Anerkennung ihrer geschlechtlichen Identität, die … Anspruch auf ein Streben nach Glück, auf die Unantastbarkeit ihrer Würde wie auch auf das Recht, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten“ haben.
Informationen über Transsexuelle Familien, wie zum Beispiel der folgende im Jahr 2015 in der Zeitschrift Eltern veröffentliche Fall, sind allerdings selten anzutreffen. Es heißt dort: „Nina ist Mitte vierzig und lebt mit ihrer Frau und ihren vier Kindern in einer Kleinstadt in Deutschland. Bis vor zwei Jahren hatte sie noch einen männlichen Vornamen, lebte als Mann. Doch dann änderte sich ihr Leben“ (Wiedenhöft, n. d.).