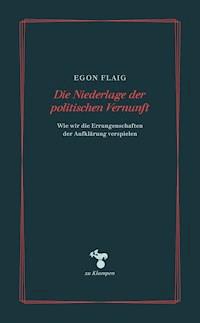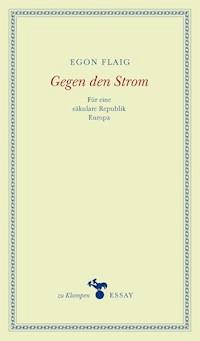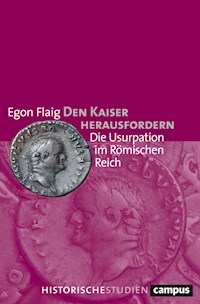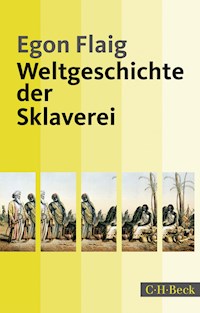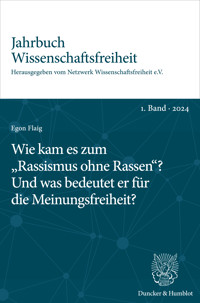
Wie kam es zum „Rassismus ohne Rassen“? Und was bedeutet er für die Meinungsfreiheit? E-Book
Egon Flaig
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Duncker & Humblot
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
null
Das E-Book Wie kam es zum „Rassismus ohne Rassen“? Und was bedeutet er für die Meinungsfreiheit? wird angeboten von Duncker & Humblot und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
[83]
Jahrbuch Wissenschaftsfreiheit, 1 (2024): 83 – 104https://doi.org/10.3790/jwf.2024.1431301
Wie kam es zum „Rassismus ohne Rassen“? Und was bedeutet er für die Meinungsfreiheit?
Von Egon Flaig*
I. Den Rassismus definieren. Claude Lévi-Strauss
Genetiker mögen darüber streiten, ob es Rassen im biologischen Sinne gibt oder nicht. Für Kulturwissenschaftler genügt es zu wissen, daß der Rassismus keine Rassen benötigt, die sich mittels genetischer Merkmale objektiv bestimmen ließen. Indes, er kann nicht funktionieren ohne den festen Glauben, es existierten Rassen als definierbare Entitäten. In einem Interview bezeichnete Claude Lévi-Strauss 1988 den Rassismus als
„eine präzise Doktrin, die man in vier Punkten resümieren kann. Erstens: Es existiert eine Korrelation zwischen dem genetischen Erbe einerseits und den intellektuellen Fähigkeiten sowie den moralischen Anlagen anderseits. Zweitens: Dieses Erbe, von dem jene Fähigkeiten und Anlagen abhängen, haben alle Mitglieder bestimmter menschlicher Gruppen miteinander gemein. Drittens: Diese Gruppierungen werden ‚Rassen‘ genannt und können hierarchisiert werden gemäß ihrem genetischen Erbe. Viertens: Diese Differenzen ermächtigen die sogenannten überlegenen ‚Rassen‘, die anderen zu beherrschen, auszubeuten und eventuell zu vernichten.“1
Lévi-Strauss definiert scharf. Die letzten beiden Punkte sind die historisch und politisch maßgeblichen. Höherwertigkeit und Minderwertigkeit bemessen sich einzig danach, ob die intellektuellen und moralischen Dispositionen zwischen menschlichen Gruppen erheblich divergieren. Was das bedeutet, klärt sich, wenn man einen Blick auf die Problemgeschichte wirft. Die von Lévi-Strauss gebrauchte Definition beruht auf dem von Aristoteles formulierten Konzept des „Sklaven von Natur“. Damit meinte Aristoteles, daß es Menschen gäbe, deren Vernunft von Natur aus defizient ist und die darum nicht in der Lage sind, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Für solche Menschen sei es besser, wenn sie anderen als Sklaven dienten. Für Aristoteles war diese Divergenz ein objektiver Sachverhalt, der nicht nur einzelne Menschen betraf sondern – und an dieser Stelle wird er unklar und wider [84] sprüchlich – ganze menschliche Gruppen und Völker. Eben das macht den Rassismus aus – und zwar völlig ohne Rücksicht auf die Hautfarbe. In der Antike war die aristotelische Doktrin extrem minoritär. Denn der Großteil der stoischen Philosophen sowie die römischen Juristen erachteten alle Menschen als „natürlich gleiche“ Wesen. Die moralischen und intellektuellen Ungleichheiten bewerteten sie als Folgen kulturbedingter Sozialisation. Die aristotelische Lehre von der naturgegebenen Ungleichheit lehnten sie ab als eine unangemessene Überheblichkeit.2 Nun entstehen in Gesellschaften mit Sklaverei großen Ausmaßes beinahe unumgänglich rassistische Vorstellungen; denn der Unterschied zwischen den versklavten Menschen und den Freien ist dermaßen groß – hinsichtlich des Habitus, des Verhaltens, des Selbstbewußtseins und der Ausrucksmöglichkeiten – daß man die Sklaven als vollkommen differente Wesen wahrnimmt. Nämlich als Wesen, die moralisch und geistig minderwertig zu sein scheinen und weit entfernt sind vom Menschsein. Nicht zufällig wurde die Doktrin des Aristoteles stark rezipiert in der islamisch-arabischen Philosophie; denn die islamische Welt des Mittelalters war das größte und langlebigste sklavistische System der Geschichte.3 Und im islamischen Raum wurde der Rassismus plötzlich hautfarblich: Die Weißen und die Schwarzen galten als minderwertige Rassen, weil sie in extremen Klimazonen lebten, in denen das Menschsein nicht gänzlich erreicht wird; hingegen galt die braune Rasse als hochwertig, weil sie in einem gemäßigten Klima lebt, wo das Menschsein sich vollenden kann.4 Von diesem hautfarblichen Rassismus findet sich in der Antike und im mittelalterlichen Europa nichts; er gelangt erst im 15. Jh. über die Reiseliteratur nach Portugal. Mit den iberischen Eroberungen in Amerika stellte sich die Frage, wie die Indianer zu behandeln seien und plötzlich wurde die Doktrin des Aristoteles relevant. In der großen Diskussion von Valladolid verfocht Bartolomé de las Casas die klassische kirchliche Lehre, wonach alle Menschen von Natur aus gleich seien, sein Kontrahent Sepúlveda hingegen vertrat die Ansicht, daß die Indios gemäß der Doktrin des Aristoteles „Sklaven von Natur“ seien.5 Als dann im 17. Jh. die Plantagenwirtschaft in Brasilien und in der Karibik in großen Mengen schwarzafrikanische Sklaven einsetzte, war [85] das Aufkommen eines hautfarbenen Rassismus nicht mehr zu verhindern. Allerdings blieben die rassistischen Vorstellungen – wenn man die Texte der europäischen Literatur der frühen Neuzeit durchgeht – immer minoritär. Vor allem die katholische Kirche zeigte sich in ihren offiziellen Stellungnahmen vollkommen immun gegen die Doktrin von der naturgegebenen Ungleichheit zwischen menschlichen Gruppen.6
Dieser kurze Ausflug in die Problemgeschichte verdeutlicht, warum Lévi- Strauss bei seiner Definition sich an das aristotelische Konzept anlehnte. Und er läßt ersehen, wie wichtig scharf konturierte Kategorien sind, wenn es gilt, kulturwissenschaftliche Fragen präzise zu formulieren. Soziologen und Historiker, die auf strenge Begrifflichkeit Wert legen, orientieren sich an der Definition von Lévi-Strauss, so etwa Albert Memmi, Loïc Waquant, George M. Fredrickson und inzwischen auch Pierre-André Taguieff.7 Nichtsdestotrotz hat sich in den letzten vier Jahrzehnten ein neues Konzept von Rassismus ausgebreitet, nämlich dasjenige des „Rassismus ohne Rassen“ – mit fatalen Folgen in den Kulturwissenschaften und im Rechtssystem. Dieses Konzept enthält zwei Komponenten, erstens die Annahme, daß manche Kulturen miteinander unvereinbar sind, zweitens die soziale Praxis, „Andere“ zu diskriminieren.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: