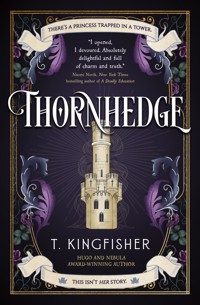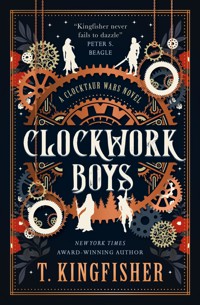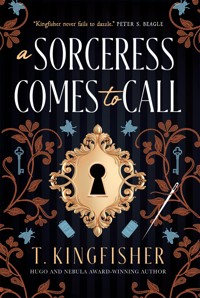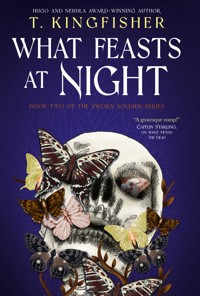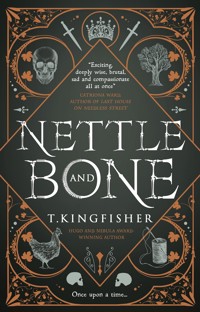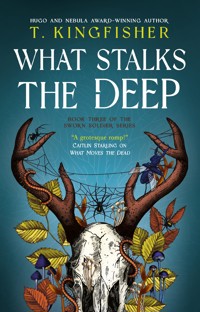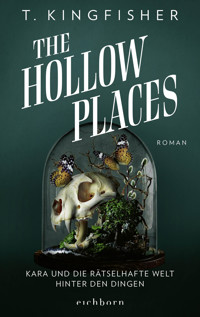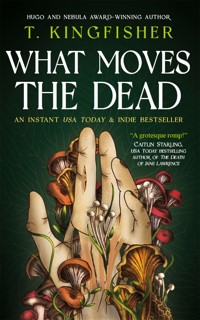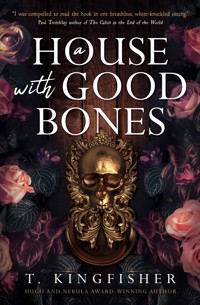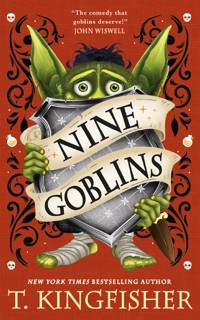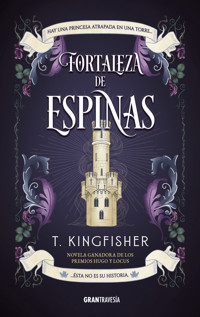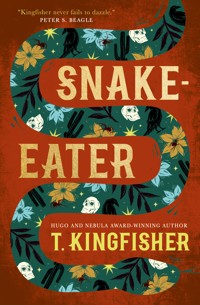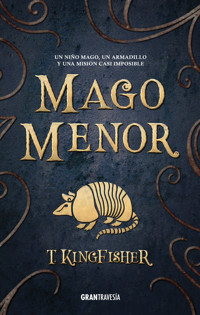9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die junge Marra, drittgeborene Tochter eines kleinen Königreichs, muss mitansehen, wie ihre beiden älteren Schwestern nacheinander mit dem sadistischen Prinz Vorling verheiratet werden. Nach dem mysteriösen Tod der Älteren, muss die Jüngere ihren Platz einnehmen, um Vorling endlich einen Erben zu schenken - ein Los, das auch Marra zu drohen scheint.
Es sei denn, sie nimmt ihr Schicksal in die eigene Hand und sucht sich ein paar schillernde Verbündete für ihren Plan - denn Marra will den Prinzen nicht küssen, sondern ihn töten!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Kapitel1
Kapitel2
Kapitel3
Kapitel4
Kapitel5
Kapitel6
Kapitel7
Kapitel8
Kapitel9
Kapitel10
Kapitel11
Kapitel12
Kapitel13
Kapitel14
Kapitel15
Kapitel16
Kapitel17
Kapitel18
Kapitel19
Kapitel20
Kapitel21
Kapitel22
Anmerkung der Autorin
Über das Buch
Die junge Marra, drittgeborene Tochter eines kleinen Königreichs, muss mitansehen, wie ihre beiden älteren Schwestern nacheinander mit dem sadistischen Prinz Vorling verheiratet werden. Nach dem mysteriösen Tod der Älteren, muss die Jüngere ihren Platz einnehmen, um Vorling endlich einen Erben zu schenken – ein Los, das auch Marra zu drohen scheint. Es sei denn, sie nimmt ihr Schicksal in die eigene Hand und sucht sich ein paar schillernde Verbündete für ihren Plan – denn Marra will den Prinzen nicht küssen, sondern ihn töten!
Über die Autorin
T. Kingfisher ist das Pseudonym der bekannten Schriftstellerin Ursula Vernon. In einem anderen Leben schreibt sie Kinderbücher und abseitige Comics und hat u.a. den Hugo-, Sequoyah- und Ursa-Major-Preis gewonnen sowie diverse Junior-Library-Guild-Auszeichnungen eingeheimst. Als T. Kingfisher schreibt sie Bücher für Erwachsene. Wenn sie nicht gerade schreibt, findet man sie im Garten, wo sie vermutlich gerade Augenkontakt mit Schmetterlingen sucht.
T. KINGFISHER
WIE MAN EINEN PRINZEN TÖTET
ROMAN
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Jasmin Schreiber
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel der amerikanischen Originalausgabe:»Nettle & Bone«
Für die Originalausgabe:Copyright © 2021 by Ursula VernonPublished by arrangement with Ursula Vernon
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2023/2024 byBastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Doreen FröhlichUmschlaggestaltung: Massimo Peter-BilleUmschlagmotiv: Massimo Peter-BilleeBook-Erstellung: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-4271-9
luebbe.delesejury.de
Für alle verrückten Hühner.Und die eine unter Millionen.
KAPITEL 1
Die Bäume waren voll Krähen und die Wälder voller Verrückter, die Grube war voll Knochen, und in den Händen hielt sie Draht.
Dort, wo die Drahtenden sie geschnitten hatten, bluteten ihre Finger. Der Blutstrom der ersten Wunden war versiegt. Die Ränder waren rot und heiß geworden, und auf ihrer Haut breiteten sich giftig aussehende Streifen aus. Ihre Fingerspitzen waren angeschwollen und weniger flink.
Ja, Marra war sich bewusst, dass das alles nicht ideal war. Doch lange genug zu leben, um an einer Infektion zu sterben, war sowieso zu unwahrscheinlich, als dass sie sich darüber jetzt Sorgen machen müsste.
Sie nahm einen langen, dünnen Beinknochen und umwickelte seine Enden mit Draht. Er passte zu einem anderen Knochen – zwar nicht vom selben Tier, aber ähnlich genug. Sie band beide zusammen und fügte sie in das Gestell ein, das sie gerade schuf.
Die Leichengrube war randvoll, doch Marra brauchte nicht allzu tief zu graben. Die einzelnen Schichten erzählten von unterschiedlichen Phasen des Hungers. Zuerst hatten sie Hirsche gegessen und Rinder. Als das Vieh ausging und es auch keine Rehe mehr gab, aßen sie die Pferde, und als die Pferde aus waren, aßen sie die Hunde.
Als es die nicht mehr gab, aßen sie sich gegenseitig.
Es waren die Hunde, die Marra wollte. Vielleicht hätte sie auch einen Mann aus Knochen bauen können, doch für Männer hatte sie keine große Liebe mehr übrig. Hunde jedoch … Hunde waren immer ehrlich.
»Aus ihren Fingern schafft er Stimmwirbel, schön und klar«, sang sie leise und monoton, fast unhörbar, »und bespannt die Knochen mit ihrem güldenen Haar …«
Die Krähen riefen einander von den Bäumen aus mit erhabenen Stimmen zu. Marra fragte sich, was der Harfner in dem Lied wohl gedacht hatte, während er jene Harfe aus den Knochen einer toten Frau baute. Vermutlich wäre er der einzige Mensch auf der Welt, der verstehen würde, was sie hier gerade tat.
Vorausgesetzt, er hat überhaupt jemals wirklich existiert. Und wenn ja, was für eine Art Leben hatte er wohl geführt, in dem er an einen Punkt kam, eine Harfe aus Leichen bauen zu müssen? Und wenn wir gerade dabei sind: Was sagt es über dein Leben aus, wenn du dir einen Hund aus Knochen bauen musst?
Viele der Knochen waren aufgebrochen worden, um an das Mark in ihnen zu kommen. Wenn sie zwei zusammenpassende Knochenstücke fand, konnte sie diese einfach wieder zu einem Ganzen zusammenfügen, doch oft waren die Enden zersplittert. Dann musste sie die Stücke mit Draht zusammenschienen, wobei sie blutige Fingerabdrücke auf den Knochen hinterließ. Doch das war in Ordnung. Das war Teil der Magie.
Hat sich der große Held Mordechai, als er den giftigen Wurm erschlug, über schmerzende Finger beschwert? Nein, natürlich nicht. Zumindest nicht da, wo ihn jemand hören und es hätte aufschreiben können.
»Das einz’ge Lied, das dieser Harfe entspringt«, krächzte sie, »ist O! Der furchtbare Regen und Wind …«
Sie war sich bewusst darüber, wie wild sie klang. Ein Teil von ihr erschrak deshalb etwas. Der andere, größere Teil jedoch sagte sich, dass sie am Rande einer Grube voller Knochen kniete. Und das in einem Land, das vor lauter Grauen so aufgedunsen war, dass ihre Füße in der Erde versanken – ganz so, als liefe sie auf der Oberfläche einer gigantischen Eiterblase. Ein wenig Wildheit war hier also nicht fehl am Platz.
Die Schädel waren einfach. Sie hatte ein schönes, breites Exemplar gefunden, mit kräftigen Kiefern und ausdrucksstarken Augenhöhlen. Dutzende hätte sie haben können, doch sie brauchte nur einen. Das schmerzte sie auf unerwartete Weise: Die Freude über den einen Schädel wurde schnell von der Trauer über all jene überschattet, die ungenutzt blieben.
Ich könnte für den Rest meines Lebens hier sitzen und Hunde aus Knochen bauen, die Hände voller Draht. Und dann werden mich die Krähen fressen, und ich werde in die Grube fallen, und wir werden alle zusammen Knochen sein …
Ein Schluchzen blieb ihr in der Kehle stecken, und sie musste kurz innehalten. Sie kramte in ihrem Rucksack nach ihrem Wasserschlauch und nahm einen Schluck.
Der Knochenhund war halb fertig. Sie hatte schon den Schädel und die elegant geschwungene Wirbelsäule, zwei Beine und die langen, feinen Rippen zusammengefügt. In diesem einen Knochenhund würde sich mindestens ein Dutzend weiterer Hunde verbergen – doch der Schädel, der war das Wichtigste.
Marra streichelte die hohlen Augenhöhlen, welche zart mit Draht umflochten waren. Alle sagten, dass das Herz der Sitz der Seele sei, aber sie glaubte nicht mehr daran.
Sie baute vom Schädel ausgehend nach unten. Mehrere Knochen hatte sie schon verworfen, weil sie nicht zu ihm zu passen schienen. Die langen, unglaublich feinen Knöchelchen der Windhunde taugten nicht, um ihn zu tragen. Sie brauchte etwas Stärkeres und Solideres; Wildschwein- oder Elchhunde, etwas mit Gewicht.
Es gab doch so einen Springseilreim über einen Knochenhund, oder? Wo hatte sie ihn gehört? Sicherlich nicht im Palast, denn Prinzessinnen sprangen kein Seil. Es musste später gewesen sein, in einem Dorf in der Nähe des Konvents. Wie ging das doch gleich? Knochenhund, Steinhund …
Die Krähen krächzten links von ihr in den Baumkronen und riefen eine Warnung. Marra schaute auf. Irgendetwas war im Anmarsch, stürmte durch die Bäume. Sie zog die Kapuze ihres Umhangs über den Kopf und rutschte ein Stück weiter in die Grube hinunter, wobei sie das Hundeskelett fest an ihre Brust drückte. Ihr Mantel war aus Eulentuchfetzen und Nesselgarn gefertigt. Der Zauber war zwar unvollkommen, aber er war das Beste, was sie in der kurzen Zeit hinbekommen hatte.
Vom Morgengrauen bis zur Abenddämmerung und wieder zurück, mit einer Stechnadel aus einem Dorn – ja, ich würde gern sehen, wie das jemand besser hinkriegt. Sogar die Staubfrau sagte, ich hätte das gut gemacht, und ihr Lob kommt so selten wie der Regen in der Wüste.
Marras Lumpenmantel ließ große Lücken frei, aber sie hatte festgestellt, dass dies keine Rolle spielte. Er lockerte ihre Gestalt auf, sodass die Leute durch sie hindurchzusehen schienen. Und selbst wenn sie fanden, dass dort in der Ecke das Licht- und Schattenspiel ein wenig seltsam wirkte, blieben sie nie lang genug, um den Grund dafür herauszufinden.
Die Menschen waren bemerkenswert schnell bereit, den eigenen Augen zu misstrauen. Vielleicht, so dachte Marra, war die Welt an sich so fremd und unser Sehsinn so mangelhaft, dass man irgendwann dem Glauben verfiel, dass sowieso alles eine Illusion sein konnte.
Der Mann trat zwischen den Bäumen hervor. Sie hörte ihn vor sich hin murmeln, konnte die Worte jedoch nicht verstehen. Dass es ein Mann war, vermutete sie nur wegen seiner tiefen Stimme, und selbst das war geraten.
Die meisten Menschen im eitrigen Land waren harmlos. Sie hatten das falsche Fleisch gegessen und waren dafür bestraft worden. Einige von ihnen sahen Dinge, die nicht da waren, andere konnten nicht mehr laufen, sodass ihre Kameraden ihnen helfen mussten. Mit zwei von ihnen hatte sich Marra vor einigen Nächten ein Feuer geteilt, obwohl sie sich hütete, das ihr angebotene Essen anzunehmen. Welch grausamer Geist, der die hungernden Menschen für das bestrafte, was sie zu essen gezwungen worden waren – andererseits hatten die Geister ja auch nie vorgegeben, freundlich zu sein.
Die Menschen am Feuer hatten sie dennoch gewarnt. »Sei vorsichtig«, sagte eine. »Sei schnell, sei sehr schnell, und sei leise. Es gibt ein paar, vor denen du dich in Acht nehmen musst. Sie waren schon vorher böse und sind jetzt noch bösartiger.«
»Böse«, stimmte der Zweite zu. Sein Atem ging sehr schwer, und er musste nach jedem Wort eine kleine Pause machen. Marra konnte sehen, dass ihn das frustrierte. »Nicht … gut. Alle … von uns … jetzt«, er schüttelte reumütig den Kopf, »aber sie … böse.«
»Es nützt nichts, wütend zu sein«, sagte die Erste. »Aber sie wollten nicht hören, sie haben zu viel gegessen. Es hat ihnen geschmeckt.« Sie brach in ein etwas zu schrilles Lachen aus und sah auf ihre Hände hinunter. »Wir haben aufgehört, sobald es etwas anderes gab … Doch sie haben einfach weitergegessen.«
Der Zweite schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er. »Mehr … als das. Immer … wütend. Geboren.«
»Manche werden so geboren«, stimmte Marra zu und nickte.
Ein Teil dieser Menschen waren Männer. Und einige dieser Männer waren Prinzen. Ja, ich weiß, es ist eine andere Form der Wut. Etwas Dunkleres, Durchdachteres.
Der Mann sah erleichtert aus, weil sie verstanden hatte. »Ja. Wütender … jetzt. Sehr.«
Sie saßen alle drei schweigend um das Feuer herum. Marra streckte ihre Hände in Richtung der Flammen und atmete langsam aus.
»Meistens töten sie Leute wie uns«, sagte die Erste abrupt. »Wir können nicht immer fliehen. Die Dinge geraten durcheinander …«
Sie machte eine Geste über ihren Augen in der Luft, die Marra nicht zu verstehen vermochte. Doch der Begleiter nickte, als er sie sah.
»Wir sind sowieso schon leicht zu fangen. Aber wenn sie dich sehen, werden sie auch hinter dir her sein.«
Das Feuer knisterte. Dieses Land war sehr feucht, und Marra war dankbar für die Wärme, und doch … »Hast du keine Angst, dass sie das Feuer sehen könnten?«, fragte sie.
Die Frau schüttelte den Kopf. »Sie hassen es«, antwortete sie. »Das gehört zur Strafe. Je mehr sie essen, desto mehr fürchten sie es. Weißt du, sie kochen das Fleisch nicht …«
Sie rieb sich über ihr Gesicht und war offensichtlich erschüttert.
»Sicherer so«, sagte der Mann. »Aber … es kann … nicht die ganze Zeit … brennen.«
Die beiden lehnten sich aneinander. Die Frau legte ihren Kopf an seine Schulter, und er umfasste ihren Körper und zog sie enger an sich.
Vor einigen Tagen noch hätte Marra sich gefragt, wieso sie dieses schreckliche Land nicht einfach verließen. Mittlerweile wusste sie es. Vielleicht waren sie nicht geistig gesund in dem Sinne, wie es die Welt außerhalb jenes Landes verstehen würde – doch sie waren keine Narren. Wenn sie glaubten, dass sie in diesem Land sicherer wären als außerhalb, war es nicht an ihr, das zu hinterfragen.
Wenn ich jedem, den ich treffe, erklären müsste, was mit mir geschehen ist … Wenn sie mich für das, was ich tun musste, verurteilen würden – nein, in einem Land mit umherstreifenden Kannibalen zu leben ist vermutlich ein kleinerer Preis, als sich dauernd erklären zu müssen. Zumindest versteht hier jeder, was passiert ist, und ist so zuvorkommend zu den anderen, wie es eben geht.
Als junges Mädchen hätte sie das wohl nicht verstanden, doch Marra war nicht mehr das Mädchen von früher. Sie war dreißig Jahre alt, und alles, was von jenem Mädchen übrig geblieben war, waren die Knochen.
Für einen Moment hatte sie die beiden sogar beneidet. Zwei Menschen, vom Schicksal bestraft ohne eigenes Zutun – doch sie hatten einander.
Jetzt, da sie in der Knochengrube saß, zuckte das Skelett an ihrer Brust.
»Shhh …«, flüsterte Marra in die Augenöffnungen des Schädels hinein, »shhh …«
Knochenhund, Steinhund … schwarzer Hund, weißer Hund …
Sie hörte seine Schritte, als der Mann näher kam. Hatte er sie gesehen? Wenn ja, dann hat auch er ihren Anblick als eine optische Täuschung abgetan. Die Schritte bewegten sich am Rand der Grube entlang, schließlich verklangen die Atemgeräusche.
»Vermutlich harmlos«, murmelte sie dem Schädel zu. Und selbst wenn nicht, sie wäre kein leichtes Ziel gewesen.
Die anderen, sanftmütigeren Menschen hier waren besonders verletzlich. Wenn man gelernt hatte, seinen eigenen Sinnen nicht zu trauen, wartete man vielleicht zu lange, um vor einem Feind zu fliehen.
Marra war sich ihrer eigenen Wahrnehmung nicht mehr so sicher wie früher, aber ihr Verstand war noch nicht zerrüttet, noch nicht von wütenden Geistern zersetzt.
Als die Schritte schon einige Minuten verhallt und die Krähen zur Ruhe gekommen waren, setzte sie sich wieder auf. Nebel säumte die Ränder des Waldes und hing in Schwaden über der Wiese. Die Krähen krächzten im Chor, ganz wie ein unrhythmischer Herzschlag. Sonst regte sich nichts.
Sie beugte sich wieder über den Knochenhund, und ihre Finger huschten über die Drähte in der Hoffnung, ihre Aufgabe vor Einbruch der Dunkelheit zu beenden.
*
Der Knochenhund wurde in der Abenddämmerung lebendig. Er war zwar noch nicht ganz fertig, doch schon kurz davor. Marra beugte sich gerade über die linke Vorderpfote, da gähnte der Schädel, und der Hund streckte sich, ganz so, als ob er aus einem langen Schlummer erwachte.
»Shhh …«, sagte sie zu ihm. »Ich bin fast fertig –«
Der Hund setzte sich auf, öffnete sein Maul, und der nebelgleiche Geist einer nassen Zunge wischte Marra übers Gesicht. Sie kratzte den Kopf an der Stelle, an der normalerweise die Ohren wachsen würden, und ihre Nägel machten dabei ein leise schabendes Geräusch auf der blassen Oberfläche. Der Knochenhund wedelte mit dem Schwanz und wackelte glücklich mit der Wirbelsäule und dem Becken hin und her.
»Halt still«, sagte Marra und hob seine Vorderpfote an. »Setz dich und lass mich das zu Ende bringen.«
Er setzte sich brav hin und blickte mit leeren Augenhöhlen zu ihr hoch. Ihr Herz zog sich schmerzhaft zusammen.
Die Liebe eines Knochenhundes, dachte sie und beugte sich wieder über die Pfote. Alles, was ich heutzutage noch wert bin.
Andererseits waren nur wenige Menschen der Liebe eines lebenden Hundes wirklich wert. Es gab Geschenke, die man eigentlich nicht verdiente.
Jeden noch so kleinen Fußknochen musste sie mit einer einzelnen Drahtwindung einwickeln und mit den anderen verbinden. Anschließend musste sie die gesamte Pfote noch mehrmals mit Draht umschlungen, um sie zu stabilisieren. Die Konstruktion hätte eigentlich nicht halten dürfen, und doch tat sie es. Marras Mantel war auf die gleiche Weise zusammengefügt. Die Nesselschnüre und der zerfledderte Stoff hätten eigentlich auseinanderfallen müssen, und doch war der Mantel viel stabiler, als er aussah.
Die Krallen des Hundes wirkten ohne das sie umhüllende Fleisch lächerlich groß. Sie wickelte jede einzelne wie ein Amulett ein und verband sie mit dem kleinen Korb aus dünnen Drähten.
»Knochenhund, Steinhund«, flüsterte sie. Sie konnte die Kinder vor ihrem inneren Auge sehen, drei kleine Mädchen, die sich gegenseitig etwas vorsangen.
Knochenhund, Steinhund … schwarzer Hund, weißer Hund … lebender Hund, toter Hund … gelber Hund, lauf!
Bei lauf war das kleine Mädchen aus der Mitte des Seils herausgesprungen und hatte begonnen, unter dem schwingenden Seil hin und her zu laufen; die einzigen Geräusche waren die ihrer Füße und das Klatschen des Seils auf dem staubigen Boden. Als sie schließlich stolperte, ließen die beiden anderen Mädchen die Seilenden fallen, und alle kicherten.
Der Knochenhund legte seine Schnauze auf ihren Unterarm. Er hatte weder Ohren noch Augenbrauen, und doch konnte Marra seinen Blick regelrecht spüren – ein bisschen melodramatisch und hoffnungsvoll, wie Hunde eben oft waren.
»So«, sagte sie schließlich. Ihr Messer war vom Drahtschneiden ganz stumpf geworden, und sie brauchte mehrere Versuche, um das letzte Stück abzuhacken. Sie schob das scharfe Drahtende unter eine Verbindungsstelle, damit es nicht an irgendetwas hängen bliebe. »So, bitte sehr. Ich hoffe, das ist genug.«
Der Knochenhund setzte seine Pfote ab und prüfte sie. Er blieb einen Moment stehen, dann drehte er sich um und rannte in den Nebel davon.
Marra ballte ihre Faust und drückte sie gegen ihren Bauch.
Nein! Er läuft weg – ich hätte ihn festbinden sollen, hätte daran denken sollen, dass er weglaufen könnte …
Das Klappern seiner Pfoten verhallte im Weiß des Nebels.
Sicher hatte er vor seinem Tod irgendwo ein anderes Herrchen. Vielleicht sucht er es jetzt.
Ihre Hände schmerzten. Ihr Herz schmerzte. Armer, törichter Hund. Sein erster Tod hatte nicht ausgereicht, um ihn zu lehren, dass nicht alle Herren der Liebe würdig waren. Auch Marra selbst hatte das zu spät gelernt.
Sie blickte in die Knochengrube. Ihre Finger pochten – nicht auf diese furchtbar stechende Art wie damals, als sie den Nesselumhang genäht hatte. Das Pochen kam dieses Mal von tiefer drin, im Takt ihres Herzschlags. Die Röte arbeitete sich an ihren Händen empor, eine lange Linie schlängelte sich bereits über ihr Handgelenk.
Den Gedanken daran, sich wieder hinzusetzen und einen neuen Hund zu bauen, konnte sie nicht ertragen. Marra ließ den Kopf in ihre schmerzenden Hände sinken.
Drei Aufgaben hatte ihr die Staubfrau gegeben: Nähe einen Mantel aus Eulentuch und Nesseln. Baue einen Hund aus verfluchten Knochen. Fange das Mondlicht in einem Tontiegel ein. Und sie versagte schon bei der zweiten Aufgabe, bevor sie die Chance hatte, die dritte zu beginnen.
Drei Aufgaben, dann würde sie von der Staubfrau die Hilfsmittel bekommen, um einen Prinzen zu töten.
»Typisch«, sagte sie in die Hände, die immer noch ihren Kopf hielten. »So was von typisch! Natürlich schaffe ich einerseits das Unmögliche, denke dann aber andererseits nicht daran, dass ein Hund auch mal weglaufen kann.«
Vermutlich hatte der Hund eine Fährte aufgenommen, und nun würde er schon Hunderte Meilen weit weg sein, um Knochenhasen, Knochenfüchse oder Knochenhirsche zu jagen.
Sie lachte in ihre geschwollenen Hände, und Elend verwandelte sich, wie so oft, in Sarkasmus.
Nun ja. War das nicht abzusehen gewesen? Das habe ich davon, wenn ich erwarte, dass Knochen loyal sind. Nur weil ich sie zurück ins Leben gebracht und verkabelt habe. Was weiß ein Hund schon von Wiederauferstehung?
»Ich hätte ihm einen Knochen geben sollen«, sagte sie und ließ die Hände sinken. Die Krähen in den Bäumen stimmten in ihr Lachen ein.
Nun.
Wenn die Staubfrau sie schon im Stich gelassen hatte – oder wenn sie die Staubfrau im Stich gelassen hatte –, dann würde sie eben ihren eigenen Weg gehen. Marra hatte bei ihrer Taufe eine Patin gehabt, die ihr zwar ein Geschenk gemacht, ihren Lebensweg jedoch nicht gerade geebnet hatte. Vielleicht gab es hier eine Schuld zu begleichen.
Sie drehte sich um und machte sich auf den Weg, Schritt für Schritt hinaus aus dem eitrigen Land.
KAPITEL 2
Marra war ein mürrisches Kind gewesen – die Art von Kind, das immer genau an der falschen Stelle steht, sodass es die Erwachsenen auffordern müssen, aus dem Weg zu gehen. Sie war nicht unbedingt langsam im Kopf, aber sie erschien jünger, als sie tatsächlich war, und lange Zeit interessierte sie sich nur für sehr wenige Dinge.
Sie hatte zwei ältere Schwestern. Ihre Schwester Damia war sechs Jahre älter, was Marra wie ein ganzes Leben vorkam. Sie liebte sie sehr. Damia war groß und ausgeglichen und sehr blass, ein Kind der ersten Frau von Marras Vater.
Die andere Schwester, Kania, war nur zwei Jahre älter als Marra. Sie teilten sich zwar eine Mutter, jedoch keinerlei Zuneigung.
»Ich hasse dich«, sagte die zwölfjährige Kania durch ihre zusammengebissenen Zähne zur zehnjährigen Marra, »ich hasse dich und hoffe, dass du stirbst!«
Marra trug das Wissen, dass ihre Schwester sie hasste, unter ihren Rippen mit sich herum. Zwar berührte es nicht ihr Herz, aber es schien ihre Lungen zu füllen. Manchmal, wenn sie einen tiefen Atemzug nehmen wollte, dachte sie an die Worte der Schwester und blieb atemlos zurück.
Sie erzählte es niemandem, wieso auch? Ihr Vater war nicht ohne Liebe, doch war er meist abwesend, selbst wenn er physisch anwesend war. Im Idealfall hätte er sie unbeholfen auf den Rücken getätschelt und ihr gesagt, sie solle sich eine Kleinigkeit aus der Küche holen. Ganz so, als sei sie noch klein. Und ihre Mutter, die Königin, hätte nur mit zerstreuter Stimme entgegnet: »Sei nicht albern, deine Schwester liebt dich«, während sie die neueste Depesche ihrer Spionagemeister öffnete und eine jener politischen Entscheidungen traf, die das Königreich vor dem Untergang bewahrten.
Als Prinz Vorling mit Damia verlobt wurde, jubelte der ganze Hof. Marras Familie regierte einen kleinen Stadtstaat, der das Pech hatte, den einzigen tiefen Hafen an der Küste zweier rivalisierender Königreiche zu besitzen. Beide Reiche wollten sich diesen Hafen einverleiben, und jedes von ihnen hätte die Stadt mit wenig Anstrengung überrollen und einnehmen können. Marras Mutter hatte das ganze Reich schon lange in einem gefährlichen Balanceakt halten müssen.
Doch nun würde Prinz Vorling aus dem Nördlichen Reich Damia heiraten und damit ein Bündnis zwischen ihnen schmieden. Sollte das Südreich versuchen, den Hafen zu erobern, würde das Nördliche Reich ihn verteidigen. Damias erster Sohn würde eines Tages auf dem Thron des Nordens sitzen, und ihr zweiter (sollte sie einen haben) würde die Hafenstadt regieren.
Es war vielleicht etwas seltsam, den erstgeborenen Sohn eines mächtigen Reiches für eine so kleine Sache wie das Hafenkönigreich zu opfern, aber es hieß, die Blutlinie der königlichen Familie des Nordens sei dünn geworden, und es hätten im Laufe der Jahrhunderte zu viele enge Cousins geheiratet. Sie wurden durch mächtige Magie geschützt, aber Magie konnte das Blut nicht heilen, also suchten die Könige nach Heiratsmöglichkeiten außerhalb ihrer Landesgrenzen. Indem es das Hafenkönigreich und seinen Schiffshafen durch Heirat an sich band, reicherte das Nordkönigreich auf einen Schlag sein Blut sowie die Staatskasse an.
»Endlich«, sagte Marras Vater. »Endlich werden wir sicher sein!«
Ihre Mutter nickte. Jetzt würde es das Südreich nicht mehr wagen, sie anzugreifen – und das Nördliche Reich würde es nicht mehr nötig haben.
Nur Marra weinte. »Aber ich will nicht, dass du gehst!«, schluchzte sie und klammerte sich an Damias Taille. »Du gehst weg!«
Damia lachte. »Es wird schon gut gehen«, sagte sie. »Ich werde dich besuchen kommen. Oder du kommst mich besuchen!«
»Aber du wirst nicht hier sein!«
»Hör auf«, sagte ihre Mutter schmallippig und zog ihre Tochter von ihrer Stieftochter weg. »Sei nicht so egoistisch, Marra.«
»Marra ist nur sauer, weil sie selbst keinen Prinzen abgekriegt hat«, spottete Kania.
Die Ungerechtigkeit dieser Aussage ließ Marra noch heftiger weinen. Sie war schon zwölf und wusste, dass sie zu alt für einen Wutanfall war, aber sie spürte ihn trotzdem herannahen. Man holte die Amme, und die brachte sie fort. So konnte Marra nicht dabei zusehen, wie Damia ihren Weg antrat – mit all dem Pomp und den Zeremonien einer Braut, die sich auf den Weg ins Reich ihres Bräutigams machte.
Doch als Damias Leichnam fünf Monate später nach Hause gebracht wurde, da sah sie zu.
Ein schwarzer Wagen kam ins Schloss, gezogen von sechs schwarzen Pferden, flankiert von Reitern in Trauerkleidung. Vor und hinter dem Wagen standen drei schwarze Kutschen mit zugezogenen Vorhängen. Auch ihre Pferde waren schwarz, und sie trugen schwarzes Zaumzeug, schwarze Sättel und schwarze Schabracken.
Die ganze Aufmachung erschien Marra wie eine viel zu extravagante Trauerbekundung. Hier wollte jemand die ganze Welt wissen lassen, wie viel Trauer er sich leisten konnte.
»Ein Sturz«, flüsterte man sich zu. »Der Prinz ist untröstlich. Es heißt, sie war von ihm schwanger.«
Marra schüttelte den Kopf. Das war nicht möglich, die Welt konnte nicht so aus den Fugen geraten sein, dass sie Damia sterben ließ.
Sie weinte auch nicht, denn sie glaubte nicht daran, dass ihre Schwester tot war, und es kam ihr sehr seltsam vor, dass die anderen davon so überzeugt waren. Sie liefen hin und her, manchmal weinten sie, meistens jedoch planten sie die Details der Beerdigung.
Marra schlich sich in dieser Nacht in die Kapelle. Wenn sie beweisen konnte, dass der dort aufgebahrte Leichnam nicht Damia war, konnte man diesen ganzen Unsinn mit der Beerdigung sein lassen.
Die verhüllte Gestalt roch stark nach Kampfer. Auf dem Leichentuch befand sich eine Totenmaske. Es war Damia, mit unbewegtem Gesicht. Marra starrte die Gestalt eine Weile lang an und dachte daran, dass es schon einige Tage her war, seit sie vom Tod ihrer Schwester erfahren hatten. Die letzten Tage waren kühl gewesen, jedoch nicht richtig kalt, weshalb der Kampfer den Geruch der Verwesung nicht ganz überdecken konnte. Wenn sie die Totenmaske beiseiteschob und das Leichentuch abriss, würde sie eine verwesende Leiche sehen. Wie die wohl aussähe?
Ich habe wie ein kleines Kind gedacht, dachte Marra nun wütend, ich dachte, dass ich erkennen würde, ob Damia unter dem Tuch liegt. Dabei könnte es jeder sein.
Sogar sie.
Sie schlich sich wieder davon und ließ das Leichentuch unangetastet.
Die Beerdigung war prunkvoll, aber überstürzt. Die Reiter, die der Fürst geschickt hatte, waren besser gekleidet als Marras Mutter und Vater. Marra ärgerte sich über ihre Eltern, weil sie schäbig aussahen, und über den Prinzen, weil er das für alle offensichtlich machte.
Sie ließen den Leichnam in die Erde hinab. Es hätte Damia sein können. Es hätte jeder sein können. Marras Vater weinte, Marras Mutter starrte geradeaus und umklammerte ihren Gehstock mit weißen Knöcheln.
Es folgten Tage, einer nach dem anderen, die zu Wochen wurden. Marra glaubte nun doch, dass es Damia gewesen war, vor allem, weil alle anderen es zu glauben schienen. Doch jetzt schien es zu spät zum Trauern, und überhaupt, wie konnte so etwas geschehen?
Einmal versuchte sie, mit Kania darüber zu sprechen.
»Natürlich ist sie tot«, sagte ihre Schwester knapp. »Sie ist schon seit Monaten tot.«
»Ist sie das?«, fragte Marra. »Ich meine – sie ist es. Aber … tot! Wirklich tot? Ergibt das einen Sinn für dich?«
Kania starrte sie an. »Mach dich nicht lächerlich«, sagte sie. »Es braucht keinen Sinn zu ergeben. Menschen sterben einfach, das ist alles.«
»Ja, vermutlich«, sagte Marra. Sie setzte sich auf den Rand des Bettes. »Ich meine … Alle sagen, dass sie es ist.«
»Sie würden wohl kaum lügen«, sagte Kania. »Durch die Heirat Damias mit dem Prinzen waren wir in Sicherheit. Jetzt, wo Damia tot ist, wird der Prinz jemand anderen heiraten, und wir sind wieder in Gefahr.«
Marra sagte nichts. Daran hatte sie noch gar nicht gedacht. Ich muss anfangen, wie eine Erwachsene zu denken. Kania macht das schon viel besser als ich.
Die zwei Jahre Altersunterschied schienen plötzlich riesig zu sein, voll mit Dingen, die Marra zwar wusste, über die sie sich aber noch nie richtig Gedanken gemacht hatte.
Kania seufzte. Sie griff nach Marra und legte einen Arm um sie. »Ich vermisse sie auch«, sagte sie.
Marra nahm die Umarmung an, obwohl sie wusste, dass ihre Schwester sie hasste. Hass war, wie die Liebe, offenbar kompliziert.
*
Der Rand des eitrigen Landes lag vor ihr. Marra betrachtete ihn fast eine Minute lang und dachte nach.
Es war seltsam, wie klar abgegrenzt er aussah, wie der Schatten, den eine Wolke wirft. Dieser Teil hier war dunkel und der andere Teil dort drüben hell. Es dauerte einen Moment oder zwei, bis der Wind von der einen Seite zur anderen wehte.
Sie konnte die Krähen rufen hören. Die auf der Außenseite klangen wie normale Krähen – Krah! Krah! Krah!
Die über ihrem Kopf hörten sich an wie Kra-hak! Kra-hak! Kra-hak! Sie fragte sich, ob die Krähen draußen die Krähen des eitrigen Landes genauso hassten wie die Dorfbewohner draußen die Menschen hier drin. Sie hatten Marra davor gewarnt hineinzugehen.
»Sie werden dich töten, sobald sie dich sehen«, hatte ein Mann gesagt, während er sich gegen den Zaun lehnte. Ein zweiter Mann – sein Freund oder sein Bruder, Marra war sich nicht sicher – nickte. »Es kriecht«, sagte der zweite Mann. »Wird jedes Jahr ’n bisschen größer.«
Jetzt nickte der Erste. »Es gibt Bäume, die früher auf unserer Seite waren und jetzt da drüben sind.« Er spuckte. »Verdammte Kannibalen. Wenn du da reingehst, fressen sie dich und lutschen deine Knochen aus.«
»Gibt keinen Grund, da reinzugeh’n«, sagte der Zweite. »Nicht für schlaue Leute.«
Sie sahen sie misstrauisch an. Der Erste spuckte wieder, dieses Mal gleich neben ihre Füße.
Marra hatte festgestellt, dass die Leute drinnen viel freundlicher waren. Sie teilten ihr Feuer mit ihr und gaben ihr die besten Ratschläge, die sie eben geben konnten.
Ich habe mir mal wieder über die falschen Dinge Sorgen gemacht.
Wie immer.
Sie hatte anderthalb Tage gebraucht, um vom Haus der Staubfrau ins eitrige Land zu gelangen. Irgendwie hatte Marra das Gefühl, dass es länger hätte dauern müssen. Sie hatte noch nie vom eitrigen Land gehört, und es hätte nicht einfach da sein dürfen – genau dort, praktisch direkt vor der Haustür.
Magie, vielleicht. Magie oder Schlimmeres.
Dass ein Land wie dieses überhaupt existierte. Dass die Götter es dermaßen zerstört hatten. Dass man, wenn man an den Ort dachte, eine Richtung wählte und einfach loslief, wirklich ankam; egal, welchen Weg man nahm.
Der Gedanke gefiel ihr nicht. Es bedeutete, dass das eitrige Land auch ihr eigenes Königreich berühren könnte, dass die Götter, die die hungernden Menschen bestraften, eines Tages ihre Hand ausstrecken und Marras eigenes Land berühren könnten. Das eitrige Land war einfach zu nah und zu real und zu hungrig.
Marra zog den Mantel aus Eulentuch über die Schultern und trat aus dem Land heraus. Der Fluch zerrte dabei an ihr, juckte wie Mückenstiche auf ihrer Haut. Instinktiv schlug sie sich auf die Arme, obwohl sie wusste, dass dort nichts war.
Der Boden fühlte sich unter ihren Füßen auf einmal seltsam hart an, als wäre sie gerade von einem Teppich auf Stein getreten. Sie sah sich um und blinzelte in das helle Licht.
Marra machte ungefähr zehn Schritte, die Hände vor die Brust gedrückt, bevor jemand rief: »Halt!«
*
Kaum eine Jahreszeit nach Damias Beerdigung erreichte die Familie die Nachricht, dass der Prinz bereit war, Kania zu heiraten.
»Noch nicht«, sagte Marras Mutter. »Erst in ein oder zwei Jahren. Jetzt wäre es nicht schicklich, aber dann schon. Für das Bündnis.«
Kania nickte. Ihre Haut war dunkler als die von Damia, und sie war mindestens zehn Zentimeter kleiner, doch in diesem Moment fand Marra, dass ihre beiden großen Schwestern einander sehr ähnlich sahen – entschlossen und stark und ein bisschen ängstlich.
»Nein …«, flüsterte Marra, doch sie sagte es so leise, dass es niemand hörte. Es war absurd zu denken, dass Kania ebenfalls sterben würde, nur weil Damia gestorben war. Damias Tod war ein Unfall gewesen – das war alles. Eine Tragödie. Niemand war schuld daran.
Marra wusste das alles, doch sie konnte das nagende Grauen, das sich unter ihrem Brustbein festgesetzt hatte, nicht abschütteln. Sie hatte das Gefühl, dass dieses Grauen für andere Menschen so sichtbar wie eine Wucherung sein musste, und es kam ihr seltsam vor, dass niemand es je kommentierte.
»Sei vorsichtig«, sagte sie eines Tages zu Kania. »Bitte …«
Sie hielt inne. Sie wusste nicht, wie sie den Satz beenden sollte. Bitte heirate nicht? Lauf keine Treppen hinab?
Kania warf ihr einen scharfen Blick zu. »Was meinst du mit vorsichtig?«
Marra schüttelte unglücklich den Kopf. »Ich weiß es nicht«, sagte sie. »Ich habe einfach das Gefühl, dass etwas schiefgehen wird.«
»Nichts wird schiefgehen«, sagte Kania. »Damia hatte einen Unfall. Das passiert mir nicht!« Beim letzten Wort erhob sich Kanias Stimme scharf, und sie drehte sich um und stolzierte davon.
Ich habe es schon wieder verbockt. Ich darf nicht noch einmal etwas sagen, bevor ich mehr weiß.
Ein Jahr verging, und Kania ging in den Norden, wenngleich mit etwas weniger Pomp, als Damia es getan hatte. Marra grub ihre Nägel in ihre Handflächen und sah ihr nach. Ihre Schwester war viel zu jung, doch niemand kommentierte das. Vor Damias Tod hätte Marra das Wort ergriffen und Antworten und Erklärungen gefordert. Nun jedoch senkte sie einfach den Kopf und sagte nichts.
Alle anderen wissen, dass es zu früh ist, sie müssen es wissen! Aus welchem Grund schweigen sie? Warum spricht niemand darüber?
»Weine nicht«, sagte ihre Amme, als Marra auf der Schlossmauer stand und beobachtete, wie die Pferde des Prinzen Kania wegbrachten. »Versuch wenigstens, dich für sie zu freuen. Eines Tages wirst du deinen eigenen Prinzen haben!«
Marra schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, dass ich einen will«, sagte sie.
»Natürlich willst du einen«, sagte ihre Amme. Sie war eingestellt worden, um dafür zu sorgen, dass die Prinzessinnen gekleidet und gefüttert wurden und laufen lernten, dass sie lernten, zu sprechen und höflich zu lächeln. Doch sie war nicht dafür zuständig, die Fäden ihrer Gedanken zu entwirren. Marra wusste das und sah auch, dass sie zu viel von der Amme verlangte. Also sagte sie nichts mehr und sah einfach zu, wie die Pferde ihre Schwester immer weiter wegbrachten.
*
Acht Monate später ging Marra in den Konvent. Sie war fünfzehn. Es machte eigentlich keinen Sinn, dass sie im heiratsfähigen Alter in ein Kloster ging, doch Prinz Vorling wollte das so. Kania hatte bisher noch kein Kind bekommen. Wenn Marra nun heiraten würde und vor Kania einen Sohn gebar, wäre dieses Kind ein Konkurrent für Vorlings Erbe um den Thron des kleinen Hafenkönigreichs.
Der Prinz hatte seinen Willen bekommen. Das Messer des Nördlichen Reichs saß noch immer eng an der Kehle des kleinen Königreichs, und nun hatte Vorling auch noch Kania als Geisel.
Die Königin erklärte Marra dies, obwohl sie das Wort Geisel nicht benutzte. Sie benutzte Begriffe wie Nutzen und Diplomatie, aber Marra wusste sehr wohl, dass Geisel irgendwo im Hintergrund lauerte. Kania war eine Geisel des Prinzen. Marras zukünftige Kinder, falls es welche geben sollte, waren die Geiseln von Kanias Fruchtbarkeit.
»Das Kloster wird dir gefallen«, sagte die Königin. »Auf jeden Fall wirst du es besser finden als hier.« Sie und Marra sahen sich sehr ähnlich, rundlich und breitgesichtig, nicht zu unterscheiden von irgendeinem der Bauern, die auf den Feldern vor dem Schloss arbeiteten.
Der Verstand der Königin war scharf wie ein eiserner Dolch. Ihre Tage verbrachte sie damit, ein Netz aus Allianzen und Handelsvereinbarungen zu knüpfen und damit dem Königreich die Existenz zu sichern, ohne verschlungen zu werden. Sie hatte offenbar beschlossen, dass Marra aus dem Spiel der Kaufleute und Fürsten herausgenommen und sicher beiseitegestellt werden konnte. Marra verübelte ihrer Mutter einerseits, dass sie so berechnend vorging, war aber gleichzeitig dankbar, aus dem Spiel aussteigen zu können. Diese widerstreitenden Gefühle und Gedanken fügte sie zu all den komplizierten Dingen hinzu, die sich unter ihrem Herzen angesammelt hatten.
Und ja, sie mochte das Kloster. Das Haus der Herrin der Grackeln war ruhig und langweilig. Hier konnte sie sich auf klare Erwartungen und Anweisungen verlassen, ohne durch diplomatische Umschreibungen verwirrt zu werden.
Sie war zwar keine richtige Novizin, aber sie arbeitete mit ihnen im Garten und strickte Bänder und Tücher. Sie mochte Stricken, Stoffe und Fasern. Ihre Hände waren beschäftigt, während sie frei denken konnte, ohne dass jemand danach fragte. Wenn sie etwas Dummes sagte, fiel das nur auf sie zurück und nicht auf die ganze königliche Familie. Wenn sie die Tür zu ihrem Zimmer schloss, blieb diese geschlossen. Im königlichen Palast wurden die Türen ständig geöffnet, Diener kamen und gingen, Krankenschwestern kamen und gingen, Hofdamen kamen und gingen. Prinzessinnen waren öffentliches Eigentum.
Sie hatte nicht gewusst, dass eine Nonne mehr Macht hatte als eine Prinzessin, dass sie eine Tür schließen konnte.
Niemand außer der Äbtissin wusste, dass sie eine Prinzessin war. Alle wussten jedoch, dass sie auf irgendeine Weise adliger Abstammung war, also erwarteten sie nicht von ihr, die Ställe der Esel und Ziegen auszumisten. Als Marra dies einige Monate nach ihrer Ankunft bemerkte, flammte so etwas wie Wut in ihr auf. Sie war stolz auf ihre Arbeit, denn es war etwas, das ihr, Marra, gehörte – nicht der Prinzessin des Reiches –, und sie machte es gut. Ihre Stiche waren klein und fein und sehr genau, ihre Weberei gleichmäßig und sorgfältig. Dass sie immer noch im Schatten der Prinzessin lebte, weckte den Starrsinn in ihr. Sie ging in den Stall, holte eine Mistgabel und machte sich an die Arbeit.
Sie war unheimlich schlecht darin, aber sie hörte nicht auf und machte am nächsten Tag weiter, obwohl ihr Rücken schmerzte und sich die ersten Blasen an den Handflächen bildeten.
Es ist nicht schlimmer, als wenn man das erste Mal vom Pferd fällt. Schaufel weiter.
Die Ziegen beobachteten sie misstrauisch, aber das hatte nichts zu bedeuten, denn Ziegen beobachteten jeden misstrauisch. Marra vermutete, dass sie nicht viel von ihrer Schaufeltechnik hielten.
»Niemand erwartet das von dir«, sagte die Novizenmeisterin, die in der Stalltür stand. Ihr Schatten fiel wie ein Fels in den Mittelgang des Stalls.
»Das sollten sie aber«, sagte Marra und umklammerte den Griff der Mistgabel, während ihre Blasen brannten. Sie schob die Spitze der Zinken unter einen Dungklumpen und hob ihn vorsichtig an.
Die Meisterin seufzte. »Manchmal bekommen wir Neulinge, die noch nie gearbeitet haben«, sagte sie zerstreut. »Manche von ihnen haben Angst vor zu harter Arbeit. Dann gibt es welche, die meinen, Arbeit sei generell nichts für sie. Und dann gibt es wieder welche, die sich reinsteigern … für die Arbeit eine Art Selbstbestrafung ist.«
Marra kippte den Dung in die bereitstehende Schubkarre und richtete sich auf. Ihr Rücken fragte sie dabei laut vernehmlich, ob sie das wirklich tun wollte. »Und, was meint Ihr? Was davon ich bin?«
Die Herrin zuckte mit den Schultern. »Am Ende landen alle am selben Punkt. Man macht die Arbeit, weil sie getan werden muss. Und es ist befriedigend, sie für eine Weile als erledigt betrachten zu können.« Sie nahm Marra die Mistgabel ab und räumte mit zwei, drei fachkundigen Handgriffen ein Stück des Stalls frei.
»Halte sie so. Du hältst zu dicht an der Gabel, du verlierst dadurch die Hebelwirkung.«
Marra nahm ihr die Mistgabel wieder ab und versuchte es, mit Bedacht. Stimmt, so war es einfacher, und die Gabel schien plötzlich viel weniger zu wiegen. Weil Marra es jetzt richtig machte, waren die Ziegen wohl nicht mehr amüsiert und zogen ab.
»Ich werde dich in den Dienstplan mitaufnehmen«, sagte die Novizenmeisterin und schnippte ein wenig Dreck von ihrem Gewand. »Wenn du mit dieser Box fertig bist, kannst du für heute Schluss machen. Und sprich mit der Apothekenschwester wegen deiner Blasen.«
»Danke«, sagte Marra fast unhörbar und senkte den Kopf. Sie fühlte sich, als hätte sie eine Prüfung bestanden, auch wenn diese nur in ihrem Kopf stattgefunden hatte, und sie nicht genau wusste, was sie gelernt hatte, falls es überhaupt etwas war.
KAPITEL 3
Marra stand am Rande des eitrigen Landes und drehte sich zum Ursprung der Stimme um. Hier war es zu hell, sie hatte sich an das Zwielicht dort drüben gewöhnt. Ihre Augen schmerzten, als ob sie auf ein Schneefeld statt auf eine staubige Straße und eine Reihe von Zäunen blickte.
»Ich habe dich gesehen«, brüllte die Stimme.
Marra blinzelte gegen das Licht und erblickte jetzt den Sprecher. Einen Mann. Er sah ganz normal aus in seiner graubraunen Kleidung, die jeder hier am Rande der Wüste trug. Es gab nichts Auffälliges an ihm, außer dass er sie anschrie.
»Hallo?«, krächzte sie. Ihre Stimme klang so rau wie die der Krähen über ihr.
»Ich habe dich da rauskommen sehen«, knurrte der Mann. »Du bist eine von denen. Eine von den Bösen!«
Marra schüttelte den Kopf. Das war absurd. Sie hatte bereits mit verfluchten Seelen das Brot gebrochen, aber ausgerechnet ein angeblich geistig gesunder Mann wollte sie aufhalten. Es war lächerlich. Es war …
Typisch. Der Prinz ist ebenfalls angeblich zurechnungsfähig, wie Männer das eben so beurteilen. Ich hätte es wohl kommen sehen müssen.
»Ich bin nicht von dort«, sagte sie und kämpfte gegen den Drang an, die Menschen da drüben zu verteidigen. »Ich habe mich verlaufen. Ich komme aus dem Hafenkönigreich.«
»Das Hafenkönigreich ist nicht einmal ansatzweise in der Nähe von hier!«
Trotz allem fühlte Marra einen Anflug von Erleichterung. Das war gut. Das eitrige Land berührte ihr eigenes Königreich nicht – noch nicht.
Ihre Erleichterung war jedoch von kurzer Dauer, als sie sah, dass der Mann eine Schaufel bei sich trug. Marra betrachtete sie misstrauisch, da sie wusste, dass eine Schaufel sowohl dazu dienen konnte, tote Körper zu begraben, als auch, lebende Körper überhaupt erst einmal zu töten.
»Ich bin lange Zeit gereist«, erklärte Marra, »um hierherzukommen. Nun, nicht speziell hierher. Zur Staubfrau.« Sie fragte sich, ob der Name helfen würde. Sicherlich respektierte jeder Staubfrauen?
Der Mann spuckte auf den Boden. »Versuchst du, die Toten zu erwecken?«, fragte er. »Die bösen Toten da drinnen?« Er machte einen Schritt nach vorn.
»Nein, ich …« Marra wich zurück und warf einen Blick über ihre Schulter.
Konnte sie es zurück in die Sicherheit des Nebels schaffen?
Das ist doch völlig lächerlich. Musste der Held Mordecai anhalten und den Einheimischen die Sache mit dem Giftwurm erklären? Haben sie denn versucht, ihn zurück in die Sümpfe zu jagen?
Schlimm genug, dass Marra bei der Aufgabe versagt hatte, aber jetzt das?
Der Mann machte einen weiteren Schritt nach vorn und hob seine Schaufel. »Du gehst da wieder rein«, sagte er. »Du gehst zurück, oder ich töte dich. Du bleibst da, wo du hingehörst!«
»Aber …«
Sie versuchte, sich zu erklären, wirklich. Die Worte sprudelten aus ihr heraus wie Blut aus einer Wunde, ein Wirrwarr von Erklärungen über die Staubfrau und den Knochenhund und drei unmögliche Aufgaben und das Reisen mit den Kutschen aus dem Hafenkönigreich, und nach etwa dreißig Sekunden wurde ihr klar, dass er ihr überhaupt nicht zuhörte. Er starrte an ihr vorbei, in den Nebel.
Marra drehte sich um und sah Schatten, die sich am düsteren Rand des eitrigen Landes bewegten.
»Oh Gott«, flüsterte der Mann und umklammerte seine Schaufel. »Da kommt was!«
Marra erstarrte, gefangen zwischen dem Schatten und der Schaufel. Sie wagte nicht, sich zu bewegen. Sie hörte Schritte auf dem Boden, ein rasselndes Geräusch, und dann …
Es galoppierte aus dem Nebel, ein bewegliches Gespenst, das auf langen Beinen umhersprang. Kurz richtete es sich auf und leckte mit seiner Geisterzunge an ihrem Gesicht, dann ließ es sich wieder fallen.
»Hund«, sagte sie. Tränen liefen ihr über das Gesicht. »Hund! Du bist zurückgekommen!«
Der Knochenhund starrte sie aus leeren Augenhöhlen an, das Maul zu einem fleischlosen Grinsen geöffnet.
»M-Monster!«, schrie der Bauer und wankte zurück. »Monster!«
Monster? Wo denn?
Marra blickte hinter sich und rätselte, ob etwas Schreckliches aus dem eitrigen Land gekommen war. Der Skeletthund bellte lautlos und hüpfte umher, und Marra hörte das Klappern von Wirbeln und Draht.
Sie griff nach dem Rückgrat des Hundes und suchte nach einer geeigneten Möglichkeit, ihn festzuhalten. Ein haarloses Tier lässt sich schlecht am Fell packen. »Still!«, flehte sie ihn an. »Beruhige dich! Sei leise!«
Der Rand des eitrigen Landes war ruhig. Eine Krähe krächzte, und ihr Ruf hallte in einem Raum wider, der weder hier noch dort war. Der Mann war schon lange fort und hatte seine Schaufel zurückgelassen.
Ein Monster?
Und dann sah sie nach unten und erkannte, dass ihr Angreifer vom Hundeskelett gesprochen hatte.
Oh. Richtig. Ich nehme wohl an … ja.
Sie runzelte die Stirn. Er war ein guter Hund. Er hatte ausgezeichnete Knochen, und selbst wenn sie zu viel Draht verwendet und ihn an den Zehen und einem der Schwanzknochen ein wenig durcheinandergebracht hatte, würde sie doch denken, dass ein anständiger Mensch innehalten und die Handwerkskunst bewundern würde, bevor er schreiend davonlief.
»Über Geschmack lässt sich nicht streiten«, murmelte sie. Sie weinte ein wenig, aber ihre Tränen fühlten sich so geisterhaft an wie die Zunge des Knochenhundes. »Also gut. Lass uns zur Staubfrau zurückgehen und ihr zeigen, dass es dich gibt.«
*
Da sie zwar eine Art Novizin war, aber nie den Ordensdienst antreten würde, wurde von Marra nicht erwartet, drei Mal am Tag am Gottesdienst teilzunehmen. Manchmal ging sie trotzdem. Die Gottesdienste für die Herrin der Grackeln waren kurz. Die Göttin – oder Heilige, da war man sich nicht ganz sicher – interessierte sich nicht für komplizierte Theologie. Niemand wusste, was sie wollte; nur, dass sie den Menschen im Allgemeinen wohlgesonnen war. »Wir sind eine Mysterienreligion«, sagte die Äbtissin, wenn sie etwas mehr Wein getrunken hatte als sonst, »für Leute, die zu beschäftigt sind, um sich mit Mysterien zu befassen. Also kommen wir einfach zurecht, so gut es geht. Gelegentlich hat jemand eine Vision, aber sie scheint nicht viel zu wollen, die Herrin. Deshalb versuchen wir, ihr den gleichen Gefallen zu tun.«
Die Statue der Herrin der Grackeln zeigte eine Frau, deren Kapuze ihr Gesicht bis zum Mund bedeckte. Sie trug ein leichtes, schiefes Lächeln auf den Lippen, und vier kleine Vögel saßen auf ihren Armen. Die Altartücher waren mit Darstellungen unbedeutenderer Heiliger bestickt. Da die Göttin keine Forderungen stellte, wurden Gebete an Heilige dargebracht, die keine eigene Anhängerschaft hatten.
»Einige von ihnen sind wahrscheinlich nicht mehr am Leben«, sagte die Äbtissin und zündete Kerzen an, »aber so ein paar Gebete für die Toten können ja auch nicht schaden.«
Der Konvent teilte sich eine Mauer mit einem Mönchskloster, und wenn sie eine Anstandsdame dabeihatte, konnte Marra deren Bibliothek benutzen. Sie war noch nie sonderlich gut im Lesen gewesen, aber es gab Bücher über alles Mögliche, nicht nur über Religion, und sie fand auch welche über das Weben und Stricken. Um neue Muster zu lernen, lohnte sich das Entziffern dieser langen und komplizierten Worte. Marra setzte die Bruchstücke auf Zetteln zusammen, manchmal klappte das, manchmal eher nicht. Doch die Neugier, ob sich das nächste Stückchen entschlüsseln ließe, und das nächste und das nächste, brannte lichterloh in ihr und ließ sie immer weitermachen.
Sie konnte sich nicht erinnern, jemals zuvor so etwas empfunden zu haben. Es gab keinerlei Notwendigkeit, die intellektuelle Neugierde von Prinzessinnen zu fördern. Sie wusste nicht einmal genau, wie sie es nennen sollte. Es fühlte sich an wie ein Leuchten in ihrer Brust, und sie konnte ein kleines Stückchen des Wegs vor ihr sehen. Und das wiederum reichte aus, um sie immer wieder voranzutreiben. Es gab niemanden, der ihr die Antworten auf ihre Fragen geben oder ihr sagen konnte, ob die gesuchten Informationen überhaupt existierten. Sie hatte niemanden, mit dem sie ihre Aufregung teilen konnte, aber das machte ihr nichts aus, denn es kam ihr nicht in den Sinn, dass sich jemand anderes dafür interessieren könnte.
Da Marra königlicher Herkunft und keine echte Nonne war, durfte sie weitermachen. In ihren jährlichen Schreiben an das Königshaus bat die Äbtissin um Bezahlung für Marras Aufenthalt und erwähnte dabei, dass ihr Schützling gern strickte und stickte. Dadurch fanden neben Münzen auch feine Wolle und gefärbtes Garn ihren Weg ins Kloster.
Marras Mutter, die Königin, schickte einmal im Monat sorgfältig und präzise verfasste Briefe. Sie enthielten keine Informationen, die für Spione von Interesse sein könnten. Der König hatte eine Erkältung. Die Apfelbäume im Innenhof blühten. Die Königin vermisste sie (Marra war sich nicht sicher, ob sie das glaubte oder nicht). Und jeden Monat die gleiche Zeile: »Deine Schwester sagt, dass es ihr gut geht.«
Mit achtzehn verliebte sich Marra leidenschaftlich in einen jungen Akolythen des Mönchsklosters, der beim Kellermeister in die Lehre ging. Er hatte schöne Augen und geschickte Hände, und sie war ihm vollständig verfallen. Vier oder fünf Mal schliefen sie unbeholfen und hektisch miteinander, und dann hörte Marra, wie er vor den anderen Akolythen prahlte, mit einer der unehelichen Töchter des Königs geschlafen zu haben. Für Marra spielte es keine Rolle, dass sie ihn verhöhnten und ihm nicht glaubten. Sie ging in ihr Zimmer, rollte sich zusammen und beschloss, an einem gebrochenen Herzen zu sterben. Minnesänger würden traurige Lieder darüber schreiben, wie sie ihr Gesicht zur Wand gedreht hatte und wegen der Untreue der Männer zugrunde ging.
Sie konnte sich nicht ganz entscheiden, ob sie ein Geist sein wollte, der im Konvent spuken würde, oder lieber nicht. Sie wäre zufrieden damit, ein schönes Gespenst mit traurigen Augen zu sein, das durch die Flure wandert, den Mond anschaut und leise weint. Eine Warnung für andere junge Frauen. Andererseits war sie immer noch klein, rundlich und stämmig, und es gab nur sehr wenige Geistergeschichten über kleine, rundliche und stämmige Frauen. Marra hatte es in ihren achtzehn Lebensjahren schon nicht geschafft, auch nur ein einziges Mal blass, schmächtig und schwindsüchtig auszusehen, und sie glaubte nicht, dass das vor ihrem Tod noch was werden würde. Vielleicht wäre es doch besser, das mit den Geistergeschichten zu lassen und einfach bei Liedern zu bleiben.
Die Apothekenschwester besuchte sie, die Nonne, die sich um die medizinische Versorgung der Bewohnerinnen des Klosters kümmerte, und Medikamente, Salben und andere Behandlungen für die Bäuerinnen in der näheren Umgebung zusammenstellte. Sie betrachtete Marra ein paar Minuten lang intensiv. »Es ist ein Mann, nicht wahr?«, sagte sie schließlich.
Marra brummte. Vor etwa einer Stunde war ihr aufgefallen, dass sie nicht wusste, wie die Minnesänger überhaupt von ihrer Existenz erfahren sollten, um traurige Lieder über sie zu schreiben. Dieses Problem beschäftigte sie ein wenig. Musste man ihnen vielleicht Briefe schreiben?
Die Apothekerin schenkte zwei kleine Gläser Kräuterlikör ein und reichte Marra eines davon. »Trink mit mir«, sagte sie, »und ich erzähle dir von dem ersten Jungen, den ich je geliebt habe.«
Es bedurfte dreier weiterer Gläschen Schnaps und zweier weiterer Leidensgeschichten, doch schließlich öffnete sich Marra und erzählte der Apothekenschwester alles.
Die Schwester gab ihr vorsichtshalber einen speziellen Tee, um ihre Periode hervorzurufen, ging zur Äbtissin, und der junge Mann wurde eine Woche später in ein anderes Kloster versetzt.
Marra fühlte sich wund und leer und grübelte darüber nach, dass »unbekannte Adelige« in den Köpfen der Mönche irgendwie zu »Bastardtochter des Königs« geworden war. Nun ja. Es war sicherer, als eine Prinzessin zu sein. Sie stand außerhalb der Hierarchie, und so hatte man ihr eine Geschichte zugewiesen, die ihrer Position gerecht wurde. Marra schämte sich an ihrer Mutter statt, da nun alle glaubten, der König sei untreu gewesen, dann kam ihr plötzlich in den Sinn, dass er vielleicht tatsächlich untreu gewesen war und sie ja Halbschwestern hatte, aber dieser Gedanke war zu schockierend und beunruhigend, also verdrängte sie ihn sofort.
Ihr Herz heilte, wie es