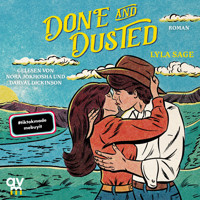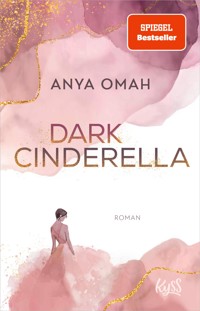2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fünf Lebenslinien. Drei Generationen. Eine Familie. Ein einsamer, alter Eigenbrödler. Eine verschlossene, junge Frau. Ein sich entfremdendes Ehepaar. Und ein kleines, aufgewecktes Mädchen voller Lebensmut und Liebe. Untrennbar verwoben zum Geflecht einer Familiengeschichte zwischen Früher und Heute, mit ungewissem Morgen. Erzählt aus den unterschiedlichen Perspektiven der einzelnen Familienmitglieder. Ein Generationenroman rund um eine junge Familie und das Zerwürfnis von Vater und Sohn in der Vergangenheit, das seinen Schatten bis in die Gegenwart wirft und die Zukunft beeinflusst. Es ist eine Geschichte über geplatzte Träume, vertane Chancen und über's Mutigsein. Eine Geschichte darüber, dass es nie zu spät ist, über seinen Schatten zu springen und für sich einzustehen. Über den Mut, den es braucht, etwas zu ändern. Über das Wagen und Scheitern. Über das Fallen und Wiederaufstehen. Auf der Suche nach uns selbst und dem, was wir wirklich wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Katharina Maria Bellerich
Wie schreibt man eigentlich Familie?
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Wie schreibt man eigentlich Familie?
1. LISA
2. SABINE
3. KARL-HEINZ
4. THOMAS
5. MARIE
6. LISA
7. THOMAS
8. SABINE
9. KARL-HEINZ
10. THOMAS
11. MARIE
12. SABINE
13. LISA
14. THOMAS
15. SABINE
16. SABINE
17. THOMAS
18. SABINE
19. KARL-HEINZ
20. SABINE
21. LISA
22. MARIE
23. THOMAS
24. SABINE
25. KARL-HEINZ
26. LISA
27. SABINE
28. MARIE
29. THOMAS
30. KARL-HEINZ
31. LISA
32. SABINE
33. KARL-HEINZ
34. LISA
35. KARL-HEINZ
36. SABINE
37. THOMAS
38. KARL-HEINZ
39. LISA
40. THOMAS
41. SABINE
42. KARL-HEINZ
43. LISA
44. KARL-HEINZ
45. MARIE
46. THOMAS
47. MARIE
48. SABINE
49. LISA
50. KARL-HEINZ
51. SABINE
52. MARIE
53. LISA
54. SABINE
55. THOMAS
56. LISA
57. THOMAS
58. LISA
59. THOMAS
60. KARL-HEINZ
61. LISA
62. SABINE
63. THOMAS
64. MARIE
65. SABINE
66. THOMAS
67. KARL-HEINZ
68. LISA
69. SABINE
70. MARIE
71. THOMAS
72. SABINE
73. LISA
74. KARL-HEINZ
75. THOMAS
76. SABINE
77. LISA
78. MARIE
79. THOMAS
80. LISA
81. KARL-HEINZ
82. SABINE
83. THOMAS
84. KARL-HEINZ
85. SABINE
86. LISA
87. SABINE
88. KARL-HEINZ
89. SABINE
90. MARIE
91. LISA
92. THOMAS
93. KARL-HEINZ
94. SABINE
95. THOMAS
96. MARIE
97. LISA
98. KARL-HEINZ
99. SABINE
100. THOMAS
101. MARIE
102. SABINE
103. LISA
104. THOMAS
105. KARL-HEINZ
106. LISA
107. SABINE
108. THOMAS
109. LISA
110. MARIE
111. KARL-HEINZ
112. THOMAS
113. LISA
114. THOMAS
115. SABINE
116. KARL-HEINZ
117. MARIE
118. LISA
119. SABINE
120. THOMAS
121. KARL-HEINZ
122. SABINE
123. THOMAS
124. MARIE
125. KARL-HEINZ
126. THOMAS
127. LISA
128. SABINE
129. THOMAS
130. MARIE
131. KARL-HEINZ
132. * EPILOG * - SABINE - etwas später
Impressum neobooks
Wie schreibt man eigentlich Familie?
Die Handlung und alle handelnden Personen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden oder realen Personen wären rein zufällig.
1. LISA
Lisa war nicht besonders groß, nicht besonders klein, nicht besonders dick oder dünn. Auch ihr Name war nicht besonders schön, sondern ein Allerweltsname, den jeder tragen konnte. Die Frau an der Supermarktkasse, im Wartezimmer beim Arzt oder an der Straßenbahnhaltestelle, die Studentin im Hörsaal. Überhaupt war Lisa in nichts besonders, sondern irgendwie ganz einfach Durchschnitt. Etwas eigen vielleicht. Aber nicht außergewöhnlich. Man würde wohl einfach freundlich grüßend an ihr vorbei gehen und sich am Ende des Tages auch nicht mehr an sie erinnern. Eben nichts, außer gewöhnlich.
Lisa war an einem frühen Mittwochabend auf dem Nachhauseweg von der Arbeit. Sie war etwas früher dran als sonst. Sie hatte noch über einen kurzen Umweg ein vorbestelltes Buch in der Buchhandlung abgeholt. Mit dem Buch in der Tasche sehnte sie sich nun nach dem Feierabend. Der Tag war anstrengend gewesen. Der neue Chef forderte viel und die KundInnen waren heute besonders unfreundlich. Das musste an dem verregneten Novembertag liegen.
Das war immer so: Je grauer der Tag, desto finsterer waren die Gesichter der Menschen. Die Kapuzen tief ins Gesicht gezogen, die Mantelkrägen aufgestellt. Frauengestalten verschmolzen mit dem Grau der Straßen und Häuser.
Und auch Lisa trug wie immer ihren schwarzen Mantel und darunter den grauen, warmen Rollkragenpullover, den sie so mochte, weil er sich gut kombinieren ließ. Klassisch in Schnitt und Farbe. Praktisch. Eine schwarze Hose dazu - fertig.
So, wie der gesamte Inhalt ihres Kleiderschranks. Nicht, dass sie keine Farben mochte. Aber sie wusste einfach nicht so recht, welche Farbe zu ihr passte. Etwas Neues auszuprobieren, war nicht so ihr Ding. Man kannte sie schließlich so und sie selbst kannte es nicht anders.
Ebenso verhielt es sich mit ihrer Frisur. Der immer gleiche, praktische Haarschnitt. Offen trug sie die Haare nie. Wozu auch?
Zusammengebunden störten sie nicht und sie brauchte sich nicht weiter Gedanken darüber machen, wie sie ihr Haar tragen sollte.
Überhaupt tat sie sich schwer mit Veränderungen oder Abweichungen von ihrer Norm. Sie brauchte klare Linien, Routinen und Planbarkeit. Die immer gleichen Abläufe gaben ihr Sicherheit.
Nicht, dass ihr das Andere, das Unbekannte oder Ungewöhnliche Angst machte. Nein, das nicht! Angst war ein zu mächtiges Wort. Solch starke Emotionen gönnte sie sich nicht. Weder nach oben noch nach unten; nicht im Positiven und nicht im Negativen. Viel zu anstrengend. Sie mochte es schlicht nicht, wenn etwas nicht so kam, wie erwartet.
Vielmehr gab es zu Lisa an sich auch nicht zu sagen. Vielleicht noch, dass sie einen zwei Jahre älteren Bruder hatte. Das Verhältnis zu ihm wie auch zu den Eltern war solide. Man sah sich an Weihnachten, zum Geburtstag und gelegentlich auch mal zwischendurch; man wohnte ja schließlich in derselben Stadt. Sie waren nie umgezogen und zur Ausbildung hatten weder sie noch ihr Bruder fortgehen müssen und so waren sie allesamt in der gleichen Stadt geblieben. Dort, wo sie sich auskannten. Immerhin lebten sie nun in unterschiedlichen Stadtteilen. Aber gut erreichbar mit Bus und Bahn und alles fußläufig in der Nähe, was man zum alltäglichen Leben brauchte.
Lisa ging also nun mit aufgestellten Mantelkragen die Straße hinunter, um ihre Straßenbahn nach Hause zu erwischen. Sie hatte noch Essen von gestern in einer Dose im Kühlschrank übrig. Das würde sie sich gleich nach einer warmen Dusche aufwärmen. Danach vielleicht noch etwas im neuen Buch lesen oder fernsehen und dann auch bald zu Bett gehen. Sie war müde und morgen Früh würde der ganz normale Alltagstrott wieder von vorne losgehen.
Mittlerweile hatte sie die Haltestelle erreicht. Gleich würde die nächste Straßenbahn schon kommen. Da fiel ihr Blick auf ein kleines Mädchen in einem roten Regenmantel und gelben Gummistiefeln. Ein kleiner Farbklecks vor dem tristen Grau in Grau der Häuserfassade. Es stand einfach da, schaute den Regentropfen zu, wie sie vom Himmel in die immer größer werdenden Pfützen fielen. Die Menschen hasteten an ihm vorbei; keiner schien es zu registrieren.
Dann plötzlich machte es einen Satz und sprang mit beiden Füßen in die Pfütze, dass es nur so in alle Richtungen spritzte, und lachte dabei so fröhlich und frei wie es nur kleine Kinder taten.
Lisa lächelte ihr erstes Lächeln des Tages. Die anderen Passanten sahen das kleine Mädchen und ihre Mutter strafend an.
2. SABINE
Auch Sabine war auf dem Nachhauseweg von der Arbeit an diesem grauen frühen Mittwochabend im November. Ein Tag, an dem man am liebsten morgens im Bett geblieben wäre.
Es war anstrengend gewesen heute im Büro. Die Stimmung unter den KollegInnen war gereizt. Die Zahlen stimmten nicht zum Jahresabschluss und man schob sich gegenseitig den schwarzen Peter zu.
Überhaupt waren heut Früh daheim auch schon alle mit dem falschen Fuß aufgestanden. Thomas und ihre beiden Kinder Marie und Paul.
Früher hatte sie immer viele Kinder haben wollen. Damals hatte man aber auch als Frau nicht sofort nach dem Mutterschutz oder spätestens nach der Elternzeit wieder voll in den Job einsteigen müssen, damit einem gerade einmal genug Geld pro Haushalt und Monat zur Verfügung stand, um die nötigsten Kosten zu decken. Manche Frauen taten das vielleicht auch gern, aber Sabine hätte es sich anders gewünscht. Sie selbst wäre sehr gern am Nachmittag bei ihren Kindern zu Hause, wenn es die finanzielle Situation erlauben würde.
Sabine blickte auf die Uhr. Sie musste sich beeilen. Noch schnell die Kinder aus der Betreuung abholen und zuhause würde sie dann etwas zu essen zubereiten, dabei Pauls Schularbeiten korrigieren und mit Marie spielen, bis Thomas hoffentlich auch von der Arbeit kam und sie gemeinsam zu Abend essen konnten. Sofern er es denn heute pünktlich aus seiner Schicht schaffte. Aufräumen, die Kinder zu Bett bringen, das Nötigste besprechen, damit nichts unterging, und dann selbst todmüde ins Bett fallen. Ihr Mann würde ihr wenig später folgen. Da schlief sie allerdings meist schon, nachdem sie sich wie jeden Abend gefragt hatte, ob sie eine gute Mutter sei und allem gerecht würde. Doch schlussendlich würde sie sich eine Antwort auf diese Frage vermutlich wieder einmal schuldig bleiben, sodass sie sie morgen Abend sehr wahrscheinlich wieder quälen würde.
Mit diesen Gedanken an den bevorstehenden allabendlichen Ablauf im Kopf war sie, ohne es zu merken, vor dem Haus der Kindertagesbetreuung angelangt. Fast wäre sie daran vorbeigelaufen.
Kaum, dass sie Tür geöffnet hatte, kam ihr Marie auch schon vergnügt in ihrem roten Regenmantel mit den gelben Gummistiefeln entgegengelaufen. Gefolgt von Paul, der pflichtbewusst Maries Kindergartentasche und seinen eigenen Schulranzen trug.
Als sie die beiden sah, ging ihr, müde wie sie war, das Herz auf. Ihre beiden. Viel zu schnell wurden sie groß. Wo war nur die Zeit geblieben? Die Tage waren anstrengend und reihten sich aneinander. Tagein tagaus derselbe Trott und so vergingen die Tage, Wochen, Monate und Jahre.
Sie meldete Marie und Paul bei den Erzieherinnen ab und gemeinsam traten die drei vor die Tür, um an der Haltestelle auf die nächste Straßenbahn nach Hause zu warten. Na klasse, jetzt fing es auch noch an zu regnen.
Sabine zog die Kapuze tief ins Gesicht und ärgerte sich darüber, dass sie ihren Schirm in der morgendlichen Hektik an der Garderobe hatte hängen lassen. Bis die Bahn käme, wären sie alle durchnässt und ausgekühlt. Sie forderte ihre beiden auf, es ihr gleich zu tun und sich so gut es ging vor dem Regen zu schützen.
Plötzlich hüpfte Marie mit beiden Füßen in die Pfütze. Sie hätte es wissen müssen: Marie und der Regen. Sabine sah sich entschuldigend um. Das Wasser hatte in alle Richtungen gespritzt und sicher den ein oder anderen der wartenden Fahrgäste erwischt.
Das hatte gerade noch gefehlt. Jetzt konnte sie die Kinder daheim auch noch in die Badewanne stecken und eine extra Maschine waschen.
„Marie, ich habe dir schon hunderttausend Mal gesagt,...“
3. KARL-HEINZ
Verdammter Mist, jetzt auch noch Regen! Karl-Heinz hasste die dunkle Jahreszeit. Er hatte sie nie besonders gemocht, die Monate, in denen es früh dunkel wurde und die Nächte lang waren.
Doch seit Annemarie vor sieben Jahren verstorben war, machte ihm der Winter noch mehr zu schaffen. Dunkelheit und Einsamkeit, das vertrug sich einfach nicht.
Und das Schlimmste stand ihm noch bevor: Weihnachten. Während sich alle Welt auf das friedliche Familienfest freute, hätte er es am liebsten verschlafen. Einfach die Decke über den Kopf gezogen: nichts sehen, nichts hören und vor allem nichts fühlen. An kaum einem anderen Tag im Jahr schmerzte ihn der Verlust seiner großen Liebe so sehr wie zur Weihnachtszeit. Denn mit Annemarie hatte er nicht nur seine Frau, sondern auch seinen Sohn Thomas verloren.
Er spürte die Wut und den Zorn in sich aufsteigen. Die Traurigkeit und Hilflosigkeit dahinter verdrängte er. Wie immer.
Thomas, dieser uneinsichtige Sturkopf. Sie hatten seit Annemaries Tod kein Wort mehr miteinander gewechselt. Und dass, obwohl sie in der gleichen Stadt lebten.
Es war Annemarie gewesen, die die Familie zusammengehalten hatte. Die alle an einen Tisch brachte; zum Beispiel an Weihnachten, zu den Geburtstagen und manchmal auch einfach so. Man hatte sich über Neuigkeiten ausgetauscht, ein paar Worte gewechselt. Für Herzlichkeit war immer seine Frau zuständig gewesen.
Er hatte für Sentimentalitäten nie viel übriggehabt. Genau wie Lisa. Seine Tochter. Sie waren beide eher pragmatisch veranlagt, während Thomas und Annemarie zu emotional und gefühlsduselig waren.
Sabine, Thomas’ Frau, war damals schwanger gewesen. Er hatte mittlerweile zwei Enkelkinder. Das wusste er von Lisa.
Wieder spürte er einen Stich im Herz. Gefolgt von Zorn. Im Wütendsein war er schon immer gut gewesen. Auch da war es Annemarie gewesen, die es handzuhaben wusste, dass die Wut meist so schnell verflog, wie sie aufgekeimt war.
Er hatte es ihr nie gesagt. Ihr nicht und den Kindern nicht. Dass er sie liebte, dass er sie brauchte. Jetzt war es zu spät. Jetzt war sie nicht mehr da und Thomas wollte nichts mehr von ihm wissen.
Und Lisa? Die ging ihren Weg und machte sich ohnehin nichts aus dererlei Liebesbekundungen. Sie hatte das noch nie gebraucht. Schon als Kind nicht. Heute stand sie mit beiden Beinen im Leben. Er war stolz auf sie. Ob ihr das wohl bewusst war?
Auch diesen Gedanken schob er beiseite.
Wie jedes Jahr seit Annemaries Tod würde Lisa an Weihnachten arbeiten. Sie würden telefonieren, sich gegenseitig frohe Weihnachten wünschen und beteuern, dass es ihnen gut ging und Weihnachten ohnehin überbewertet würde. Abgehakt. Weiter im Kalender.
Karl-Heinz war heute den ganzen Tag unterwegs gewesen. Hatte wie schon so oft in letzter Zeit Stunden in den Wartezimmern der Arztpraxen verbracht. Sie hatten ihn mal wieder auf den Kopf gestellt und wie immer nichts gefunden, was für die Schmerzen in seiner linken Brust verantwortlich war.
Diese Quacksalber. Pah, Ärzte. Dass er nicht lachte. Da taten sie immer so gescheit, waren gut darin, Ratschläge zu erteilen, wussten alles besser. Und dann, wenn man sie wirklich einmal brauchte? Dann wussten die Götter in Weiß sich auch keinen Rat. Genau wie Thomas. Wäre es nach ihm gegangen, hätte sein Sohn etwas Handfestes gelernt und nicht Medizin studiert.
Schlussendlich hatten sie ihn wie immer an die Spezialisten in der Klinik verwiesen. Sogar einweisen wollten sie ihn schon. Aber nicht mit ihm. Er würde ganz sicher nicht zu Thomas in die Klinik gehen. Da ging er lieber zum nächsten niedergelassenen Kardiologen auf seiner Ärzteliste.
4. THOMAS
Thomas seufzte. Er würde es wie viel zu oft in letzter Zeit wieder nicht pünktlich zum Abendessen zu Sabine und den Kindern schaffen. Er musste nach seiner Schicht noch eine Nachtschicht übernehmen und schickte Sabine schnell eine Nachricht, damit sie nicht auf ihn wartete.
Personelle Engpässe war die verharmlosende Beschreibung der seit einer gefühlten Ewigkeit herrschenden maroden Personaldecke unter den Pflegedienstkräften. Kündigungswellen und Krankheitsstände wechselten sich ab. Huhn oder Ei? Das eine führte zum anderen und umgekehrt. Wer konnte es ihnen verübeln?
Schlechte Bezahlung, Schichtdienst, körperlich und emotional anstrengende Tätigkeit und fehlendes Ansehen sowohl seitens der PatientInnen, die man wusch, deren Hintern man abputzte, denen man zuhörte, wenn sie sich ausweinten, als auch seitens der ÄrztInnen, die alles an sie delegierten, für das sie entweder keine Zeit oder auf das sie keine Lust hatten. Die Drecksarbeit. Das Unschöne. Und wenn wieder ein Kollege oder eine Kollegin unter den ohnehin schon zu wenigen Pflegekräften ausfiel, unter der Arbeitslast zusammenbrach, bedeutete dies zwangsläufig mehr Arbeit für die Verbliebenen. Pflege im Akkord. Fließbandarbeit in der ohnehin schon kaum zu bewältigenden Taktung. Es ging zu wie in der Bahnhofshalle.
Es war schwer, sich unter diesen Umständen Empathie und Menschlichkeit zu bewahren und sich auch noch selbst zu schützen. Nicht abzustumpfen und dennoch keines der täglichen Schicksale mit nach Hause zu nehmen. Gerade jetzt in der dunklen und kalten Jahreszeit. Da hatten sie deutlich mehr zu tun.
Wäre er nicht Pflegedienstleiter, er hätte es seinen KollegInnen vermutlich gleichgetan. Ja, wahrscheinlich hätte auch er irgendwann das Handtuch geworfen. Gekündigt oder sich einfach krankgemeldet, wenn es gar nicht mehr ging.
Aber so schob er die Extraschichten, die er seinen Mitarbeitern nicht mehr zumuten wollte. Versuchte die Stimmung unter ihnen aufzufangen. War Bindeglied zwischen den Pflegekräften und der Klinik und zugleich fühlte er sich wie eine Marionette am seidenen Faden. Wie ein Klempner, der versuchte, eine defekte alte Leitung zu stopfen. Immer wenn er ein Loch notdürftig geflickt hatte, kam das Wasser an einer anderen Stelle wieder heraus. Unermüdlich fand es seinen Weg und er hatte nicht genug Hände, nicht genug Material, um alle Löcher zu stopfen. Es war längst kein einzelnes defektes Rohr mehr, sondern vielmehr ein Kollateralschaden sämtlicher Hauptleitungen, sodass sie alle zu ertrinken drohten. Ihnen allen stand das Wasser längst bis zum Halse.
Er hatte sich oft gefragt, wie sein Leben wohl verlaufen wäre, wenn er das Medizinstudium nicht kurz vor Ende geschmissen hätte. Wenn er, wie geplant, Arzt geworden wäre. Wo stünden sie dann jetzt? Er, Sabine und die Kinder?
Dann müsste sie nicht arbeiten gehen, könnte bei den Kindern sein, solange sie noch klein waren. Und er? Er würde wohl kaum mehr arbeiten, als er es jetzt tat, aber sie müssten wenigstens nicht am Ende des Monats jeden Cent zweimal umdrehen.
Sein Vater hatte nie Zeit für ihn und seine jüngere Schwester gehabt. Er selbst hatte es immer besser machen wollen bei Marie und Paul. Und auch bei Sabine.
Und war es ihm gelungen? Nein, auch er war kaum daheim, wenn auch aus anderen Gründen als sein Vater damals. Und wenn er es war, dann war er müde und abgekämpft und hatte nicht die Energie und Kapazität für seine Lieben, die er gerne gehabt hätte.
Auf der anderen Seite war er, durch das, was er tagtäglich erlebte, im Grunde seines Herzens manchmal froh, nicht zu den ÄrztInnen zu gehören. Die meisten, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, die er in seiner beruflichen Laufbahn kennengelernt hatte, waren ihm fremd in ihrer Art, wie sie mit Menschen - egal ob PatientIn oder Personal - umgingen. Sie alle hatten nichts von dem Idealismus und der Menschlichkeit, mit denen er damals sein Studium begonnen hatte und von denen er dachte, dass sie unabdingbare Eigenschaften in der Arbeit mit Menschen seien.
Vielleicht war das aber auch nur die eine Seite der Medaille, denn auch er musste zugeben, dass man mit der Zeit und der Arbeitslast abstumpfte und es harte Arbeit war, sich seine Ideale und Werte immer wieder selbst vor Augen zu halten, um sie tagtäglich zu leben. Auch ihm und seinen KollegInnen gelang es längst nicht immer, dieses Credo zu verfolgen. ÄrztInnen wie auch PflegerInnen waren gleichermaßen Menschen, die im Klinikalltag an ihre Grenzen kamen, und in beiden Berufsgruppen gab es gute und schlechte Beispiele, wie man damit umging, und wie man sich dadurch veränderte.
5. MARIE
Marie liebte den Regen. Im Sommer, wenn er auf den heißen Asphalt fiel, konnte sie ihn sogar riechen.
Und jetzt im Winter, wenn alles grau war und es besonders viel regnete, spiegelten sich all die bunten Lichter der Autos und Häuser in den Pfützen. Dann leuchtete es überall. Schnee gab es auch im Winter in ihrer Stadt nicht. Den kannte sie nur aus Büchern.
Also war Marie auch mit dem Regen zufrieden. Er konnte in den unterschiedlichsten Formen vom Himmel fallen, wenn man genau hinsah. Er war nie gleich.
Marie schaute dem Regen aber nicht nur gern zu, sondern sie mochte es auch, ihm zuzuhören. Am allerliebsten hatte Marie es, wenn sie in ihrem warmen Bett gekuschelt, dem Regen lauschen konnte, wenn er gegen das Fenster prasselte. Mal große, einzelne Tropfen, mal ganz viele kleine, hektische Tropfen. Wie ein Trommeln. Paul hatte dafür nicht viel übrig. Aber Marie hätte stundenlang zuhören können, wenn sie doch davon nur nicht so hundemüde würde.
Mama sagte immer, es regnete Hunde und Katzen. Aber die waren nun wirklich noch nie vom Himmel gefallen. Zumindest hatte Marie das noch nie gesehen.
Und dass bei dem Wetter kein Hund vor die Tür ging, stimmte auch nicht. Da musste sich Mama auch geirrt haben. Frau Meier, ihre Nachbarin, war heut Früh mit Pepe spazieren gegangen, wie jeden Morgen, und da hatte es ganz doll geregnet.
Das hatte Marie genau gesehen, als sie auf der Fensterbank sitzend nach draußen geschaut und die dicken Regentropfen beobachtet hatte. Sie hatte es Mama sagen wollen, aber die hatte heute Morgen keine Zeit gehabt, ihr richtig zuzuhören.
„Jaja, Marie“, hatte sie gesagt, bevor Marie ihren Satz beenden konnte, und dabei schnell die Brote für Paul und sie geschmiert.
Sie waren schon spät dran gewesen. Mama hatte heute einen wichtigen Termin auf der Arbeit und war deshalb nicht gut aufgelegt gewesen. Da musste man sie besser in Ruhe lassen. Das wussten Paul und Marie.
Aber wenn doch der Regen... Marie hatte geschmollt, weil Mama sie nicht richtig beachtet hatte. Überhaupt hörte Mama ihr in letzter Zeit nie wirklich zu und hatte wenig Zeit für sie und ihren Bruder.
Und auch Papa war meistens schon bei der Arbeit, wenn Marie und Paul aufstanden, und kam abends erst wieder, wenn sie schon im Bett lagen. Manchmal auch erst in der Früh, wenn sie schon beim Frühstück saßen. Das waren sie und Paul schon gewohnt.
Sie freuten sich immer sehr, wenn Papa doch einmal früh genug daheim war, um mit ihnen zu Abend zu essen. Und an den Wochenenden musste er leider auch oft in die Klinik. Dort half er kranken Menschen wieder gesund zu werden.
Paul war auch schlecht gelaunt gewesen, weil er am Samstag ein Fußballspiel hatte und Papa schon wieder nicht dabei sein konnte, obwohl er es beim letzten verpassten Spiel hoch und heilig versprochen hatte.
So waren sie alle missmutig und in Hektik aus dem Haus gegangen und in den verregneten Tag gestartet.
Auch jetzt waren noch dicke Wolken am Himmel. Es hatte den ganzen Tag geregnet und die kurze Regenpause schien nicht mehr lange anzuhalten. Gleich würde es wieder anfangen zu regnen.
Marie drückte die Nase an die Fensterscheibe, um besser sehen zu können. Es wurde schon fast dunkel.
Da! Da kam Mama! Endlich! Marie rief nach Paul und rannte ihrer Mutter entgegen. Fast wäre sie in ihren Gummistiefeln gestolpert. Aber nur fast. Bei ihrer Mutter angekommen, umarmte sie sie stürmisch. Paul kam hinterher.
Gemeinsam traten sie zu dritt auf die Straße in den Regen hinaus und gingen zur S-Bahn-Haltestelle. Die letzte Bahn nach Hause hatten sie knapp verpasst und so mussten sie etwas warten. Ganz zur Freude von Marie. Das bedeutete mehr Zeit im Regen.
Mama schaute nicht so glücklich drein und hatte schon die Kapuze aufgezogen und sie und Paul aufgefordert, es ihr nachzumachen. Das brauchte sie Marie nicht zweimal sagen. Sie liebte ihren roten schönen Regenmantel mit der extra großen Kapuze und der kuschlig weichen Innenseite.
Dann tauchte Marie ab, in ihre eigene Welt. Völlig fasziniert beobachtete sie, wie die Regentropfen immer größer werdende Kreise in die Pfützen zeichneten. Sie nahm schon längst nichts mehr um sich herum wahr, so gebannt schaute sie auf das schöne Wasserspiel auf dem Boden vor ihr.
Wenn schon so kleine Tropfen Kreise warfen, was würde wohl passieren, wenn sie selbst in die Pfütze hineinsprang?
6. LISA
Unter allen Kindern dieser Welt hätte Lisa ihre kleine Nichte Marie sofort entdeckt.
Lisa machte sich nicht viel aus Kindern. Vor allem nicht aus eigenen. Sie hatte ihren Bruder Thomas in dieser Hinsicht nie verstanden. Der hatte schon früh gewusst, dass er Kinder und Familie haben wollte. Sogar schon bevor er Sabine kennengelernt hatte. Wenn es so etwas geben würde, dann könnte man bei den beiden glatt meinen, dass sie füreinander bestimmt seien, so gleichgeschaltet, wie sie oft daherredeten.
Lisa mochte Sabine nicht sonderlich und konnte nicht allzu viel mit ihr anfangen, aber ihr Bruder war scheinbar glücklich mit ihr. Also passte es für Lisa. Und die beiden hatten schon schwierige Zeiten miteinander durchgestanden und ihre Beziehung hatte es überlebt, also schien es zu passen. Punkt.
Lisa hingegen war in ihrem Leben noch nie verliebt gewesen. Für zwischenmenschliche Zärtlichkeiten hatte sie generell nicht viel übrig. Energieverschwendung. Sie mochte ihr Leben so, wie es war. Wollte keine faulen Kompromisse. Wollte sich nicht nach jemandem richten, der dann ohnehin irgendwann einfach wieder aus ihrem Leben verschwinden würde. Wenn man nach der Scheidungsrate von knapp 40% ging, war eine Ehe ohnehin so ziemlich das Unvernünftigste, was man tun konnte. Und wenn sie es sich genau überlegte, war da auch gar kein Platz für einen Mann in ihrem Leben. Sie hatte sich aus gutem Grund für die kleine, günstige und gut geschnittene Zwei-Zimmer-Wohnung entschieden. Sie war genau richtig für Lisa. Und weil sie sich ihrer Sache sicher war, hatte sie sich ein Einzelbett in die kleine Nische gestellt, die genau für diesen Zweck gemacht worden zu sein schien. Sie vermisste nichts. Und was man nicht kannte, konnte man schließlich auch gar nicht vermissen.
Aber Lisa liebte Marie. Das kleine Mädchen hatte ihr Herz vom ersten Moment an erobert. Schon als Lisa sie zum ersten Mal halten durfte.
Normalerweise hatte Lisa kein Händchen für Kinder und schon gar nicht für Babys. Sie fühlten sich nie wohl bei ihr. Vermutlich spürten diese kleinen Geschöpfe ihre Unsicherheit und dass sie nicht viel für Babys übrighatte. Kleinkinder nahmen sie meist gar nicht erst wahr und Babys fingen meist an zu weinen, wenn man sie ihr auf den Arm gab, was Gott sei Dank ohnehin nicht oft vorkam. Bei Paul, Maries älterem Bruder, war es so gewesen und auch bei Kindern von KollegInnen oder Bekannten, wenn ihr die stolzen Eltern ihre Babys doch einmal in den Arm drückten. Lisa war jedes Mal froh gewesen, wenn sie die Kleinen wieder zurückgeben konnte. Sie hatte Sorge, etwas kaputt zu machen.
Bei Marie war es ganz anders gewesen. Thomas hatte ihr die Kleine gegeben, obwohl sie unruhig und weinerlich gewesen war. Und zu aller Erstaunen hatte sie sich bei Lisa beruhigt, sich an sie geschmiegt und war eingeschlafen. Lisa hatte es selbst kaum glauben können. Und wie die Kleine so da lag, friedlich und schutzbedürftig, hatte Lisa - das erste und einzige Mal in ihrem Leben - ihr Herz geöffnet und Marie ganz fest darin eingeschlossen. Sie hatte alles um sich herum vergessen und war wie versteinert gewesen. Hatte sich nicht getraut, sich zu bewegen, um die Kleine nicht zu wecken, und die Zeit war einfach stehen geblieben. Dann - irgendwann nach einer gefühlten Ewigkeit - hatte Marie die Augen geöffnet und Lisa hatte das Gefühl, sie hätte so etwas wie ein Lächeln erkennen können. Von da an gab es ein unsichtbares Band zwischen den beiden, das bis heute bestand.
Marie war ein aufgewecktes kleines Mädchen. Fröhlich, frech und frei. So ganz anders als Lisa. Vermutlich genau das Gegenteil.
7. THOMAS
Er hatte es ihnen beiden sagen wollen. Damals als Mama krank war und Sabine schwanger wurde. Mit seiner Mutter hatte er immer über alles reden können. Sich ihr anvertrauen können mit seinen Sorgen. Sein Vater war da seit jeher anders. Ein Kopfmensch wie seine Schwester. Aber während Lisa sich Emotionen ganz verbot, lebte sein Vater dann und wann seinen aufgestauten Frust und Ärger aus. Nach Mamas Tod war das vermutlich noch schlimmer geworden. Das war das (einzig) Gute daran, wenn man keinen Kontakt mehr hatte, so musste Thomas das zumindest nicht mehr über sich ergehen lassen.
Sein Vater war auch immer zugleich sein größter Kritiker gewesen. Thomas hatte Zeit seines Lebens das Gefühl gehabt, es ihm nicht recht machen zu können. Egal was er tat. Als Kind hatte er es wieder und wieder versucht und war doch immer gescheitert. Mit diesem Vorsatz auf die Nase gefallen.
Ganz anders als Lisa. Der fiel es scheinbar leicht, ihn zufrieden zu stellen. Und wenn dies einmal nicht der Fall war - wobei er sich daran beim besten Willen nicht erinnern konnte; nein, ihm fiel tatsächlich auch nach längerem Überlegen keine einzige Situation ein - aber selbst wenn, so wäre Lisa mit der Gabe ausgestattet, es gar nicht an sich herankommen zu lassen.
Thomas nicht. Wie seine Mutter nahm er sich alles zu Herzen. Suchte den Fehler stets zunächst bei sich. Und selbst, wenn er ihn nicht fand, gelang es ihm kaum, den Fehler von sich zu weisen und bei anderen zu suchen. Er schob die Schuld dann auf die Situation oder die äußeren Umstände. Erst nach Jahren, ach was nach Jahrzehnten des inneren Kampfes schaffte er es, seinen Vater kritisch zu betrachten.
Seine Mutter hatte gleich gewusst, dass ihn etwas bedrückte. Wie so oft hatte er nichts sagen müssen. Sie war toll darin gewesen, einem die Angst zu nehmen. Hatte ihn immer unterstützt. Verständnis gezeigt. Gemeinsam nach Lösungen gesucht und Wege aufgezeigt, wenn er glaubte in einer Sackgasse zu stecken.
„Eine Sackgasse kann niemals eine Einbahnstraße sein“, hatte sie immer gesagt (Den Spruch hatte sie sicher wie all die anderen aus einem ihrer Lieblingsbücher). Er verstand es erst jetzt.
Damals hatte er geglaubt, er stecke fest. Er hatte das Gefühl, er habe sich in eine Sackgasse manövriert. Er hatte sich nach dem Abitur zunächst für eine Ausbildung als Krankenpfleger entschieden. Er wollte Menschen helfen. War jahrelang als Rettungssanitäter mitgefahren.
Schon das hatte sein Vater nicht verstanden. Wäre es nach Karl-Heinz gegangen, hätte er eine Ausbildung im Handwerk gemacht. Wie er selbst, versteht sich. Etwas für echte Männer. Etwas Handfestes und nichts (A)Soziales.
Eigentlich hatte Thomas studieren wollen, aber das Medizinstudium war ihm eine Nummer zu groß gewesen. Als Einziger in der Familie zu studieren und dann auch noch ein so elitäres Fach? Der Widerstand seines Vaters war ohnehin schon groß genug gewesen und für ÄrztInnen hatte dieser noch nie etwas übriggehabt und machte daraus auch keinen Hehl. Nur seine Mutter hatte von seinen Träumen gewusst. Ihm gut zugeredet, es doch wenigstens zu versuchen. Doch er hatte sich lange nicht getraut.
Schlussendlich war es eine Erfahrung während eines Notfalleinsatzes gewesen, die ihn dazu gebracht hatte, über seinen Schatten zu springen und doch zu studieren: eine Frau war während des Einsatzes verstorben. Der behandelnde Notarzt hatte einen Fehler gemacht. Und er, Thomas, hatte es bemerkt, auf ihn eingeredet, doch der Arzt hatte nicht auf ihn gehört, einen dummen Sanitäter, was er sich wohl einbildete. Thomas hatte es mit ansehen müssen; hatte nichts tun können. Nichts tun dürfen. Oder doch? Diese Frage quälte ihn bis heute.
Es war ihm immer schon schwergefallen, sich gegen Autoritäten durchzusetzen - sich ihnen zu widersetzen. Wohl auch ein Erbe seiner Kindheit.
Aber ihm war nach dieser Erfahrung klar gewesen, dass er mit Leib und Seele Arzt sein wollte. Er wollte selbst Entscheidungen treffen und sich nicht anderen unterordnen, die Unrecht hatten, nur weil sie einen höheren Rang hatten.
Seine Mutter war stolz auf ihn gewesen, als er ihr seinen Studentenausweis gezeigt hatte. Sein Vater nicht. Er hatte ihm postwendend zu verstehen gegeben, dass er diesen Weg nicht unterstützte. Das war Thomas ohnehin klar gewesen.
Er hatte neben dem Studium weiter als Sanitäter gearbeitet, Nachtschichten im Krankenhaus geschoben und war gerade so über die Runden gekommen. Dank seines Ehrgeizes und vor allem aber auch seines Interesses - oder wahrscheinlich konnte man sogar von Leidenschaft für die Medizin sprechen - hatte er nur Bestnoten erzielt und dadurch sogar ein Stipendium ergattert. Aber der Druck auf seinen Schultern war gewaltig gewesen.
Dann war seine Mutter plötzlich krank geworden und er hatte sich gekümmert. Er hatte es als seine Pflicht empfunden, zu helfen. Etwas zurückzugeben, da sie ihm zeit ihres Lebens doch so viel gegeben hatte. Lisa hatte es nicht gekonnt. Er schon.
Als Sabine ungeplant schwanger geworden war, war von einem Moment auf den anderen alles zusammengeklappt, wie ein Kartenhaus. Sie hatten sich auf das Kind gefreut. Bis heute waren seine beiden Kinder das größte Geschenk seines Lebens, aber der Zeitpunkt hätte damals nicht schlechter sein können. Er hatte kurz vor dem letzten Examen gestanden, seine Mutter war schwer krank gewesen und finanziell hatte es an allen Ecken und Enden gefehlt. Sie waren zudem einfach noch sehr jung gewesen. Er hatte sich entscheiden müssen und er hatte es getan, aus Liebe. Hätte es immer wieder getan. Er hatte das Studium schweren Herzens aufgegeben und sich für die Familie entschieden. Damals war er so blauäugig gewesen, zu glauben, dass er es irgendwann würde nachholen können. Aber die Zeit hatte ihn eines Besseren belehrt und den Irrglauben aufgedeckt.
Er war damals zu seinen Eltern gefahren, um ihnen von der Schwangerschaft und der Entscheidung zu erzählen, sich auf die in seiner Klinik ausgeschriebene Stelle als Pflegedienstleiter zu bewerben.
Bevor er etwas gesagt hatte, hatte seine Mutter es ihm bereits angesehen. Gesehen, wie schwer es ihm gefallen war, dass er mit sich gerungen hatte, und auch die Ambivalenz seiner Gefühlslage bezüglich Sabines Schwangerschaft, die er zu unterdrücken versucht hatte, weil er sich für die Zweifel schämte.
Wieder hatte sie tröstende Worte gefunden, seinen Zweifel weggewischt, bewirkt, dass er sich auf sein Kind freute, wie er sich noch nie gefreut hatte, und dass, obwohl Mama selbst bereits oftmals zu schwach war, die Augen offen zu halten und zu sprechen.
Sie war als austherapiert nach Hause entlassen worden. Und Thomas hatte sich rund um die Uhr um sie gekümmert. Hatte während dieser Zeit wieder in seinem alten Kinderzimmer geschlafen, um immer bei ihr sein zu können, obwohl er schon Mitte zwanzig gewesen war und längst mit Sabine sein eigenes Leben lebte. Sein Vater und Lisa hatten nur hilflos zusehen können, hatten sich wie immer in Arbeit gestürzt. Er hatte ihnen deshalb nie einen Vorwurf gemacht. Er hatte es verstanden und es als seine Aufgabe empfunden, seiner Mutter beizustehen. Bis zum Schluss.
8. SABINE
„Marie, ich habe dir schon hunderttausend Mal gesagt...“ Sabine zog Marie mit einem Ruck aus der Pfütze. Etwas zu ruppig. Marie erschrak.
Sofort fühlte Sabine sich schlecht. Wieder einmal. Sie war übermüdet, überarbeitet und wie so oft in letzter Zeit brauchte es nicht viel, dass sie aus der Haut fuhr, um es unmittelbar im nächsten Moment wieder zu bereuen und von Schuldgefühlen und Selbstzweifeln übermannt zu werden. So war sie nie gewesen und so hatte sie nie sein wollen. Eine überreizte, mitunter auch überforderte Mutter, die ihre Kinder anbrüllte. Aber sie konnte selbst nicht mehr. Sie wusste, das entschuldigte nichts, aber sie war am Ende ihrer Kräfte und das merkte sie vor allem in solchen Situationen. Die Grenze war längst überschritten. Bei ihr - genauso wie auch bei Thomas. Die ständigen finanziellen Sorgen, das hohe Arbeitspensum bei ihnen beiden, die steigenden Lebenshaltungskosten und jetzt auch noch die Mieterhöhung, all das belastete ihre Beziehung und ihre Familie.
Es hatte sich über die letzten Jahre stetig gesteigert. Schon während ihrer Schwangerschaft mit Paul. Thomas hatte damals sein geliebtes Studium abgebrochen, damit sie besser über die Runden kamen. Das schlechte Gewissen darüber bedrückte sie bis heute. Nicht zuletzt, weil Thomas zuvor so lange damit gehadert hatte, seinen Weg zu finden und seiner Berufung zu folgen.
Sabine war so stolz auf ihn gewesen, als er sich endlich zu einem Medizinstudium durchgerungen hatte. Er war der geborene Arzt, aber er hatte sich nicht getraut. Er hatte das Studium in Rekordzeit mit besten Noten absolviert, hatte kurz vor dem Abschluss gestanden und dann war sie schwanger geworden. Sie hatten sich immer Kinder gewünscht. Sie bedeuteten ihnen beiden alles. Und dennoch war es nicht immer leicht.
Paul war nicht geplant, aber nach einem kurzen Moment der Starre umso mehr erwünscht gewesen. Annemarie, ihre Schwiegermutter, war damals schwer krank gewesen und Thomas war durch die Doppel-, nein im Grunde sogar Dreifachbelastung aus Studium, Arbeit und Pflege seiner Mutter, ohnehin schon am Limit gewesen.
Und dann auch noch ihre Schwangerschaft. Die hatte die Grenzen des Menschenmöglichen gesprengt. Sabine hatte es ihm erst gar nicht sagen wollen. Hatte sogar kurz über einen Abbruch nachgedacht. Ganz kurz. Sie waren noch jung gewesen, aber sie waren beide Familienmenschen und Kinder waren für sie immer ein gemeinsamer, wenn auch eher noch in der Ferne liegender Wunschtraum gewesen. Sie hätte es sich niemals verziehen. Wäre daran zerbrochen, wenn sie ihr gemeinsames Kind abgetrieben hätte, das zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht willkommen gewesen wäre.
Sabine war zerrissen gewesen zwischen Freude und Verzweiflung. Thomas hatte es bemerkt und sie hätte ihm niemals etwas vormachen können. Nach einem kurzen Moment der Stille, der ihr wie eine halbe Ewigkeit vorgekommen war, hatte er geseufzt und sie hatte dieselbe Zerrissenheit in seinen Augen gesehen, die auch in ihr gewütet hatte. Sie hatten einander angesehen und still und tränenlos geweint.
Thomas hatte also sein Studium abgebrochen, sich auf die Stelle als Pflegedienstleiter in der Klinik, in der er nebenbei schon gearbeitet hatte, beworben, um für sie und ihr gemeinsames Kind sorgen zu können, und sich noch intensiver um seine Mutter kümmern wollen. Nur dass es zu Letzterem niemals gekommen war.
9. KARL-HEINZ
Karl-Heinz erinnerte sich noch gut an den Streit mit seinem Sohn. Als wäre es gestern gewesen, denn die Ereignisse hatten sich damals überschlagen.
An jenem Tag vor mehr als sieben Jahren war er missgelaunt von der Arbeit heimgekommen. Er hatte es nicht ertragen können, seine Frau so leiden zu sehen, und sich in Arbeit gestürzt. So hatte er es immer getan. Er hatte die Augen vor der Wirklichkeit verschlossen und war geflüchtet, wann immer er etwas nicht nach seiner Art hatte bewältigen und verändern können.
Annemaries Erkrankung hatte ihnen allen damals den Boden unter den Füßen weggerissen. Während er es nicht hatte wahrhaben wollen, hatte seine Frau gekämpft wie eine Löwin. Hatte alles versucht. Sie hatte das Leben geliebt, war eine begnadete Optimistin und wenn diese zuversichtliche Lebenseinstellung einmal nicht gegriffen hatte, glaubte sie dennoch immer an das Gute und auch an Gottes Hand, die sich schützend über ihr ausbreitete. Er hatte sich oft gefragt, was sie an ihm, Karl-Heinz, dem ewigen Pessimisten und Atheisten gefunden hatte?
Doch wo war ihr Gott gewesen, als sie, die immer nur Gutes getan hatte, ihn brauchte? Gott hatte sie elendig verrecken lassen. Und doch hatte sie bis zuletzt an ihn geglaubt. Hatte nie gezweifelt. Karl-Heinz hatte das insgeheim immer bewundert. Und doch hatte er, der Pessimist, am Ende recht behalten. Leider. Zu gerne hätte er sich in diesem Punkt eines Besseren belehren lassen.
Thomas hatte Annemarie gepflegt, als man sie zum Sterben nach Hause geschickt hatte. Sein Sohn hatte sie schon während der Zeit im Krankenhaus begleitet, weil er selbst es nicht konnte.
Karl-Heinz hasste Ärzte und Krankenhäuser. Ihm wurde jedes Mal mulmig zu Mute, wenn er eines betreten musste, und wenn es irgendwie möglich war, versuchte er es zu vermeiden. Es war einfach nicht sein Ding. Und Annemaries Erkrankung und der schwere Weg bis zu ihrem Tod hatten ihn in dieser negativen Grundeinstellung nur noch bestätigt. Also war Thomas eingesprungen. Wenigstens dafür war sein Werdegang gut gewesen. Immerhin.
An jenem Tag hatte die Tür zum Zimmer mit ihrem Pflegebett offen gestanden und Annemarie hatte mit angestrengter Stimme zu Thomas gesprochen. Karl-Heinz hatte wieder einmal eine große Wut gespürt. Die Ohnmacht hatte ihn förmlich erschlagen. Seine Frau hatte so schwach geklungen. Sie hätte sich schonen sollen und nicht aufregen. Doch das hatte sie zweifelsohne getan. Sie war hoch emotional gewesen. Ihre Stimme belegt. Sie hatte geweint. Karl-Heinz‘ Wut war ins unermessliche gestiegen. Er war übergeschäumt.
Mit einem Ruck hatte er die Tür geöffnet und Thomas als den Übeltäter für Annemaries Emotionschaos ausfindig gemacht. Seine Wut hatte sich über seinem Sohn entladen. Bevor dieser überhaupt gewusst hatte, was mit ihm geschah, hatte er Thomas all das an den Kopf geworfen, was er all die Jahre nicht gesagt hatte:
Dass er in seinen Augen ein Taugenichts sei, der nichts im Leben erreicht habe, nichts aus seinem Leben gemacht habe. Der sich kaum über Wasser halten könne mit seinen Jobs, der ihm und seiner Mutter deshalb großen Kummer bereite, in einer doch ohnehin schon so sorgenvollen Zeit.
Dass es Annemarie wahrlich krank gemacht habe vor Sorge um ihren Sohn, der seinen Weg nicht zu finden schien.
Dass er die größte Enttäuschung seines Lebens sei. All das und noch vieles mehr war nur so aus ihm herausgesprudelt.
Er hatte Erleichterung verspürt - für den Bruchteil einer Sekunde, als er Thomas für alles verantwortlich machen konnte. Für Annemaries Erkrankung, für die es keine Erklärung gab. Die sie alle eiskalt erwischt hatte.
Auch heute noch, fast ein Jahrzehnt nach Annemaries Tod fühlte er, dass er recht gehabt hatte. Es war sicher ihr sorgenvolles Mutterherz gewesen, das zur Erkrankung beigetragen hatte. Ganz bestimmt. Für ihn als rationaler Mensch war das eine Erklärung, die ihm half, das Ganze in einen sinnstiftenden Zusammenhang zu setzen. (Wenn man denn im Hinblick auf Annemaries Tod überhaupt auch nur ansatzweise von Sinn sprechen konnte.) Alles Unerklärliche ängstigte ihn - er brauchte Erklärungen und das war die einzig plausible.
Er hatte den Schmerz in Thomas‘ Blick gesehen. Seine Worte hatten seinen Sohn scheinbar getroffen. Doch Thomas war nicht einmal Manns genug gewesen, seinem Vater etwas zu entgegnen. Sich zu verteidigen. Das hatte ihn, Karl-Heinz, nur in dem bestärkt, dass er recht hatte, ihn noch wütender werden lassen und zu einer weiteren Schimpftriade geführt, die die erste noch übertroffen hatte.
Für ihn war das einem Schuldeingeständnis seines Sohnes gleichgekommen und dazu hatte es dessen duckmäuserische Art wieder einmal sichtbar gemacht, die er so hasste. Er hatte ihn doch zu einem richtigen Mann erzogen, der sich verteidigen konnte, und nicht zu so einem Weichei. Und das war noch nett ausgedrückt.
Thomas war aufgestanden und wortlos gegangen. Kampflos. Sprachlos. Geschlagen. Der Feigling.
Annemarie hingegen hatte währenddessen keinen Ton gesagt. Sie hatte stillschweigend zugehört und die Szene beobachtet. Sie war ihm noch müder und erschöpfter vorgekommen als jemals zuvor und hatte ihn nur mit müden, traurigen Augen angeschaut und ihm zu verstehen gegeben, dass sie sich ausruhen musste.
Auch er hatte also das Zimmer verlassen und als er später noch einmal nach ihr schauen wollte, hatte sie nicht mehr geatmet. Sie war einfach gestorben. Einfach so. Ohne, dass er sich verabschieden konnte. Ohne, dass er es hatte kommen sehen. Ohne, dass er etwas dagegen hätte unternehmen können. Sie war einfach nicht mehr da gewesen. Nur noch der bereits deutlich erkaltete Körper. Die seelenlose Hülle, die so gar nichts mehr mit seiner Annemarie gemein gehabt hatte. Die gezeichnet gewesen war von der Erkrankung, vom langen und doch verlorenen Kampf.
10. THOMAS
Nach Mamas Tod war es zum Bruch zwischen Karl-Heinz und ihm gekommen. Thomas hatte es nicht fassen können, dass seine Mutter noch in jener Nacht verstorben war. Dass sie einfach so von ihnen gegangen war, ohne dass er sich von ihr hatte verabschieden können.
Er war im Streit mit seinem Vater gegangen. Hatte ihr nur einen flüchtigen Kuss auf die Wange gegeben, ihre Hand gedrückt und ihr wortlos versprochen, am nächsten Tag wiederzukommen, wenn sein Vater bei der Arbeit gewesen wäre. Er hatte nicht erahnen können, dass dies ein Abschied für immer gewesen war.
Lisa hatte ihn noch in der Nacht darüber informiert, dass Mama verstorben war. Am Telefon. Sachlich und kühl, wie es ihrer Art entsprach. Aber er hatte gespürt, dass auch Lisa der Verlust hinter der gefassten Fassade geschmerzt hatte.
Ihm selbst hatte es den Boden unter den Füßen weggerissen und er war in ein tiefes Loch gefallen. Er hatte sich isoliert und mit niemandem sprechen wollen. Nicht mal mit Sabine. In seinen Gedanken hatte er den Abend wieder und wieder Revue passieren lassen.
Karl-Heinz hatte ihm die Schuld am Tod seiner Mutter gegeben. Wenn er ihn schon für ihre Erkrankung verantwortlich gemacht hatte, dann auch ganz sicher für ihren Tod. Daran hatte Thomas keinen Zweifel. Das hatte er gewusst, auch ohne, dass sie je wieder miteinander gesprochen hatten.
Thomas hatte sich wieder und wieder gefragt, ob das stimmte? Ob wirklich er es gewesen war, der seiner Mutter so viel Kummer bereitet hatte, dass sie überhaupt erst unheilbar krank geworden war?
Er hatte danach mit niemandem darüber gesprochen. Nicht einmal mit Sabine, mit der er sonst alles geteilt hatte. Er war das Gespräch mit seiner Mutter unzählige Male im Geiste durchgegangen. Hatte darüber nachgedacht, ob er ihr mit den Neuigkeiten um Sabines Schwangerschaft und den Abbruch seines Studiums zu viel zugemutet hatte, sodass sie zu guter Letzt sogar verstorben war?
Und selbst wenn das nicht stimmte, so hatte er sich dennoch Vorwürfe gemacht. Machte sie sich bis heute.
Sein Verstand wusste es im Grunde besser. Ihr Tod war aus medizinischer Sicht unumgänglich und schlussendlich nur eine Frage der Zeit gewesen. Doch er wusste auch, dass es fatale Folgen haben konnte, wenn sie sich emotional aufregte. Egal, ob durch die Neuigkeiten, die er ihr übermittelt hatte oder durch den Streit vor ihren Augen mit seinem Vater.
Und so machte er sich dennoch Vorwürfe, denn dass der Streit mit seinem Vater zu ihrem Tod geführt haben könnte, konnte er nicht von der Hand weisen. Doch das war wohl kaum seine Schuld gewesen, oder? Sein Vater hatte überreagiert. Wenn überhaupt, so traf seinen Vater (auch) die Schuld am Tod seiner Mutter. Aber vielleicht hätte er, Thomas, dafür Sorge tragen können, dass es nicht vor seiner Mutter hätte passieren müssen, sodass sie hatte mitansehen müssen, wie Vater und Sohn gestritten hatten.
Seine Emotionen waren immer schon stärker gewesen als sein Verstand und so hatte er versucht mit dieser Schuld leben zu lernen. Für seinen Vater war die Sache ohnehin klar gewesen.
Es war Sabine gewesen und der Umstand, dass sie bald ein Kind erwartet hatten, die ihn gerettet hatten vor der Leere, die er empfunden hatte.
Sabine hatte die Scherben, die von ihm übrig gewesen waren, wieder aufgesammelt und zusammengesetzt. Sie hatte seine kaputte Seele aufgefangen und er hatte sich ganz langsam wieder geöffnet.
Als er sich endlich einigermaßen gefangen hatte, stand die Geburt kurz bevor. Er hatte sich um ihretwillen und um Pauls Willen zusammenreißen und nach vorne blicken müssen.
Sie hatten kurzerhand beschlossen, noch zu heiraten, bevor sie Eltern werden sollten. Die Hochzeit war letztendlich auch gleichzeitig ein symbolischer Schlussstrich geworden. Er hatte nach dem Zerwürfnis mit Karl-Heinz jeden Kontakt zu ihm abgebrochen. Ihm war klar gewesen, dass Karl-Heinz sich nicht bei ihm melden würde und er selbst war zu gekränkt, um einen Schritt auf seinen Vater zuzugehen. Nicht nach all der Schuldzuweisung und all dem, was er ihm sonst noch an den Kopf geworfen hatte.
So war ihm nur seine jüngere Schwester Lisa von seiner Familie geblieben. Sie hatte es geschafft, sich auf niemandes Seite zu schlagen und sowohl mit ihrem Vater als auch mit ihm und Sabine in Verbindung zu bleiben. Sie war Trauzeugin geworden. Da ihn außer Lisa nichts mehr mit seiner Ursprungsfamilie verband, hatte er sich dazu entschlossen, Sabines Nachnamen anzunehmen. Er hatte gehofft, mit seinem alten Familiennamen auch seine familiäre Bürde abzulegen und sich endlich vom väterlichen Einfluss loszueisen. Er wollte ein für alle Mal von seinem Vater loskommen. Dass er ihn damit sicherlich gekränkt hatte, war ihm, wenn er ehrlich zu sich selbst war, dabei ein willkommener Nebeneffekt gewesen. Während sein Vater es bestimmt, um die Kränkung abzuwenden, als weiteres Indiz für seine fehlende Männlichkeit abgetan hatte, den Namen der Frau anzunehmen. Aber für Thomas war es ein wichtiger Akt der Abnabelung gewesen.
Trotz all der Jahre, die seitdem vergangen waren, schmerzte es ihn bis heute, dass seine Mutter weder bei der Hochzeit hatte dabei sein können, noch ihre Enkelkinder hatte aufwachsen sehen. Sie fehlte ihm.
11. MARIE
Marie erschrak und fuhr zusammen. Mama hatte sie am Arm gepackt und aus der Pfütze gezogen. Marie blickte sie erstaunt und fragend an. Sie wusste gar nicht, was sie falsch gemacht hatte.
Früher waren sie gemeinsam in die Pfützen gesprungen und hatten gelacht. Marie lachte so gern. Am liebsten mit Mama, Papa und Paul. Aber das kam nur noch selten vor. Marie konnte sich an das letzte Mal gar nicht mehr richtig erinnern. Sie fand das sehr schade. Lachen war etwas so Schönes.
Da erblickte sie Tante Lisa und rannte los, um in deren Armen zu verschwinden. Sie kuschelte sich an sie, schmiegte ihren Kopf an deren warmen Schal.
Marie liebte ihre Patentante. Mama mochte sie zwar nicht so recht - zumindest redeten die beiden kaum miteinander und Marie hatte auch noch nie gesehen, wie sie sich umarmt hatten - aber all das war ihr egal.
„Lisa ist deinem Opa Karl-Heinz sehr ähnlich.“, hatte Papa mal erzählt, so als sollte das irgendetwas erklären. Aber den kannte Marie gar nicht und so verstand sie auch nicht, was Papa damit meinte. Dann würde sie ihren Opa doch bestimmt auch mögen?
Sie hatte mal versucht, herauszufinden, warum sie ihren Opa noch nie gesehen hatte, aber Papa und Mama hatten so komisch reagiert, dass Marie sich nicht getraut hatte, nochmal nachzufragen. Marie wusste nur, dass Papa und Opa sich ganz doll gestritten hatten und nicht mehr miteinander redeten. Aber warum, wusste sie nicht. Dabei sagte Papa immer zu ihnen, dass sie sich entschuldigen und wieder vertragen sollten, egal wie schlimm sie und Paul sich gestritten hatten. Er und Opa könnten sich doch auch einfach wieder vertragen?
Ihre Oma war schon vor Pauls Geburt gestorben. Genau wie Mamas Eltern. Oma Annemarie war schwer krank gewesen. Papa erzählte oft von ihr. Er schaute dann immer ganz traurig. Er und auch Mama mussten sie sehr liebgehabt haben. Marie schaute sich immer gern das Foto von ihr in der Küche an. Das, auf dem Papa und Tante Lisa noch klein waren. Da sahen alle so fröhlich aus. Oma und Papa strahlten um die Wette und sogar Tante Lisa hatte ein bisschen gelacht, obwohl die nicht so gern lachte. Das sagte zumindest Mama; auch wenn Tante Lisa und Marie eigentlich immer viel miteinander lachten und ihren Spaß hatten.
Von Opa gab es leider kein Foto. Marie war neugierig. Sie wusste, dass er hier irgendwo in der Stadt leben musste, und sie fand es ganz schön merkwürdig, dass sie ihn gar nicht erkennen würde, wenn er vor ihr stand. Fast ein bisschen gruselig. Aber vor allem spannend.
Sie hatte sich schon mal überlegt, Tante Lisa nach einem Foto von Opa zu fragen, aber sie spürte, dass das keine gute Idee war. Mama und Papa wären bestimmt sauer auf sie oder auf Tante Lisa, oder noch schlimmer traurig. Und das wollte sie auf keinen Fall. Also hatte sie sich einfach schon oft ausgemalt, wie es sein würde, wenn sie ihn einmal treffen könnte. Ob er wohl wusste, dass es sie gab? Und wie sie aussah? Wahrscheinlich schon. Vielleicht hatte Lisa ihm mal Fotos von ihr und Paul gezeigt? Allein bei dem Gedanken wurde sie ganz aufgeregt und ihr Herz schlug schneller.
12. SABINE
Lisa und Marie strahlten einander an. Sabine spürte die Eifersucht wie einen Stachel in ihrem Mutterherz. Sie konnte nichts dagegen tun und es beschämte sie.
Marie ließ die Pfütze links liegen und lief Freude strahlend auf ihre Patentante zu. Sabine verfolgte die Szene stumm. Von Beginn an war ein unsichtbares Band zwischen den beiden gewesen. Es war Sabine bis heute ein Rätsel.
Sie selbst hatte Lisa, so leid es ihr tat, nie viel abgewinnen können. Für Sabine war Lisa unnahbar. Sie wurde selbst nach all den Jahren einfach nicht warm mit ihr und empfand die Treffen immer als anstrengend. Man hatte sich nicht viel zu sagen. Früher hatte sich Sabine sehr um Konversation bemüht. Hatte versucht, einen Einblick in Lisas Welt zu bekommen und sie zu verstehen. Doch Lisas Antworten waren immer einsilbig und die seltenen Gegenfragen wirkten wie vorformuliert, blieben stets an der Oberfläche und zeugten nicht von einem ernsthaften Interesse.
Also hatte Sabine den Versuch, eine Beziehung zu ihrer Schwägerin aufzubauen, mit der Zeit aufgegeben, und sich eingestanden, dass Lisa ein Mensch war, zu dem sie ohne das Verwandtschaftsverhältnis wohl keinen Kontakt haben würde. Aber sie war nun mal Thomas‘ Schwester und nach Annemaries Tod und dem Zerwürfnis mit Karl-Heinz das letzte Überbleibsel von Familie, das sie hatten, und allein das machte es wert, dass man die Verbindung nicht leichtfertig abreißen ließ.
Und das Wichtigste: Marie liebte ihre Tante. So hölzern und schwierig diese sein mochte. Und diese Liebe schien kurioser Weise auf Gegenseitigkeit zu beruhen. In Maries Gegenwart war Lisa wie ausgewechselt und wirkte auf Sabine nicht so verkopft, wie es sonst ihrer Natur entsprach. Marie hatte Lisa verzaubert.
Lisa hatte sich immer aus dem Streit zwischen Thomas und seinem Vater rausgehalten. Hatte weder für Karl-Heinz noch für Thomas Partei ergriffen und es geschafft, zu Bruder und Vater Kontakt zu halten, obwohl der Graben zwischen den Männern unüberwindbar war und keiner der beiden am jeweils anderen ein gutes Haar ließ.
Das rechnete Sabine ihr hoch an, auch wenn oder gerade, weil sie nicht verstand, wie es ihrer Schwägerin gelang, so neutral wie die Schweiz zu sein und das ganze hoch emotional aufgeladene Thema nicht an sich heranzulassen. Damals wie heute. Immerhin ging es dabei doch auch um den Tod der eigenen Mutter, der mit all dem in einem komplizierten Geflecht verwoben war.
Aber Lisa hatte ihr und Thomas auch damals nach dem großen Knall mit Karl-Heinz beigestanden, auf ihre eigene pragmatische Art und ihnen im Alltag unter die Arme gegriffen als sie, Sabine, es schwangerschaftsbedingt nicht mehr konnte. Gleichzeitig hatte sie auch Karl-Heinz mit allem Organisatorischen rund um die Beerdigung geholfen. Emotionaler Beistand war es nicht gewesen, aber Lisa hatte ihnen vieles abgenommen und sie unterstützt, wenn Thomas nicht bei ihr sein konnte.
Lisa hatte das Patenamt bei Paul ausgeschlagen. Sie hatte sich vermutlich überfordert gefühlt. Obwohl Thomas und sie so etwas im Grunde schon hätten ahnen müssen, hatten sie sich dadurch dennoch seltsam zurückgestoßen gefühlt. Aber bei Marie war es dann anders gewesen. Es war, als hätte Marie Lisa als Patentante selbst ausgewählt.
13. LISA
„Miechen!“ Lisa schloss ihr Patenkind in die Arme.
Sofort waren die Strapazen des Tages wie weggefegt und der graue Novembertag längst nicht mehr so grau und trist. Mit Marie sah sie die Dinge anders, sah sie die Welt für den Moment mit den Augen eines Kindes. Die Farben wurden bunter und die Sorgen des Lebens fast bedeutungslos. Es war die beste Medizin.
Marie lachte: „Dein Schal kitzelt!”