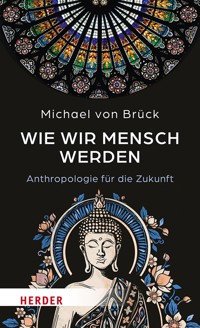
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Nur wer sich diese Fragen beantwortet, wird in der Welt und in seinem Leben Orientierung finden. Ob man sich dabei auf die Religionswissenschaften oder die Naturwissenschaften stützt, ist mehr als nur ein Zufall. Es zeigt, wie eng das Bedürfnis des Menschen nach Erkenntnis mit der Suche nach Sinn verwoben ist. Der Theologe und Zen-Lehrer Prof. Michael von Brück beschreibt anhand eines einmaligen Crossover wissenschaftlicher Disziplinen, dass am Ende immer eine Verbindung aus Selbstverständnis und Sinnverständnis steht. Erstmals verknüpft er Denkansätze aus verschiedenen Fachgebieten zu einer wahrhaft modernen Anthropologie des Menschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2025
Hermann-Herder-Str. 4, 79104 Freiburg
Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden
Sie sich an [email protected]
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Gestaltungssaal, Rohrdorf
Umschlagmotiv: © mauritius images / Godong / Alamy / Alamy Stock Photos; © Shutterstock AI Generator / shutterstock
E-Book-Konvertierung:: Newgen Publishing Europe
ISBN Print 978-3-451-03511-1
ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-83628-2
ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-83636-7
Inhalt
Einleitung
Kapitel 1: Bewusstsein, Ich und Selbst
Worum geht es?
Begriffsklärungen
Bewusstsein als Prozess
Ich und Selbst – wer ist Subjekt von Erlebnis und Erfahrung?
Achtsamkeit und Mitwelt
Bewusstseinsfaktoren im Buddhismus
Ordnungsebenen und »mystisches Einheitsbewusstsein«
Künstliche Intelligenz
Schlussfolgerungen aus interkultureller Perspektive
Kapitel 2: Wissen und Wahrheit in europäischen und asiatischen Traditionen
Worum geht es?
Zum Wahrheitsbegriff in der europäischen Tradition
Die religiöse Dimension von Wahrheit
Der Wahrheitsbegriff im Buddhismus
Erkenntnis und Wahrheit im hinduistischen Advaita Vedanta
Wahrheitsfrage und mystische Erfahrung
Spätere Fremdinterpretationen
Schlussfolgerungen aus interkultureller Perspektive
Kapitel 3: Schöpfungsmythen und Evolutionstheorien in Indien
Worum geht es?
Die Mythen der Evolution
Theoriebildungen zum Evolutionsgedanken
Die Evolutionstheorie im Buddhismus
Schlussfolgerungen aus interkultureller Perspektive
Kapitel 4: Die Freiheit der Person
Worum geht es?
Karma und Schicksal
Karma und Freiheit
Woher kommt das Böse?
Buddhistische Grundgedanken zur Freiheit der Person
Schlussfolgerungen aus interkultureller Perspektive
Kapitel 5: Liebe und Verantwortung
Worum geht es?
Liebe – Urphänomen und Blüte von Kultur
Ethik und Liebe im Buddhismus
Liebes-Ethik im Vedanta
Schlussfolgerungen aus interkultureller Perspektive
Kapitel 6: Sterben und Tod
Worum geht es?
Sterben, Tod und Jenseitserwartung im Christentum
Sterben, Tod und Befreiung im Hinduismus
Sterben, Tod und Erwachen im Buddhismus
Schlussfolgerungen aus interkultureller Perspektive
Epilog
Weisheit
Literaturverzeichnis
Quellen zu Buddhismus und Hinduismus
Forschungsliteratur
Abkürzungen
Personenregister
Sachregister
Über den Autor
Über das Buch
Einleitung
Die Angst vor dem Unaufklärbaren hat nicht allein das Dasein des einzelnen ärmer gemacht, auch die Beziehungen von Mensch zu Mensch sind durch sie beschränkt, gleichsam aus dem Flußbett unendlicher Möglichkeiten herausgehoben worden auf eine brache Uferstelle, der nichts geschieht.1
(Rainer Maria Rilke)
Die uralten Fragen: Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und noch einmal ähnlich, aber doch vielleicht charakteristisch menschlich: Wer sind wir? – sie sind nie ein für alle Mal zu beantworten, natürlich sind sie letztlich unaufklärbar. Viele meinen, man solle sie deshalb lieber nicht stellen. Und wir stellen sie doch. Es sind die immer neu nicht gefragten oder verdrängten Fragen. Sie stellen sich spätestens, wenn wir ans Sterben denken. Und sie stellen sich heute neu, wenn wir real an das Aussterben vieler Arten von Tieren und Pflanzen und möglicherweise auch des Menschen denken. Wer sind wir?
Das Besondere am Menschen ist seine Kultur. Kultur stärkt die Gruppenkohärenz, d. h. auf Grund von Traditionen kann angepasstes Verhalten kohärent geregelt werden, was ein evolutionärer Vorteil ist, der im Ansatz auch bei Tieren auftritt. Kultur vermeidet deterministische Prägung, sie ist offen für Anpassungen an neue Verhältnisse und neue Bedürfnisse. Sonst wäre eine Erschließung von neuen Siedlungsräumen nicht möglich gewesen, denn sie erfordern Anpassung an ungewohnte Territorien. Auch dies kann man schon bei Tieren beobachten. Alles, was dem Menschen widerfährt, wird dabei umgestaltet, so dass der Mensch im kulturellen Handeln in gewisser Weise immer sich selbst begegnet. Kultur wird möglich durch Sprache und Symbolisierung, die durch die Erweiterung des Rahmens bzw. Denkhorizonts Abstraktion schafft und damit die Übertragung von Erfahrungen in neue Kontexte. Religion ist der umgreifende Rahmen von Kultur. Hier fragt der Mensch nach einem letztgültigen Zusammenhang aller Erfahrungen. Solche Rahmen setzen Normen für das Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Erinnern und Handeln, für die Erfahrung also. Im kollektiven wie individuellen Gedächtnis werden Kulturmuster überliefert. Sie bilden das ab, was eine Gesellschaft für gültiges Wissen hält. Im Horizont der heutigen interkulturellen Welterfahrung des Menschen können die kulturellen Prägungen des Menschseins nur interkulturell erörtert werden, so dass wechselwirkende Brechungsmuster von Fakten entstehen, deren Interpretation und sprachliche Modellbildungen unser Fragen nach dem, was bzw. wer wir sind, vorantreiben.
Die genannten Fragen sind meistens unter dem Etikett der Anthropologie gestellt und bearbeitet worden, der »Lehre vom Menschen« also. Was aber soll denn das sein? Heute fragt man Psychologen, Verhaltensforscher, Soziologen, Biologen und Hirnforscher, manchmal auch Künstler, kaum noch Philosophen und Theologen. Die anthropologischen Einsichten, die wir seit Platon und Aristoteles oder Goethe und Nietzsche, seit Marx oder Freud zitieren, helfen wohl auch nicht viel weiter. Wir befinden uns in einer Situation, in der einem das Zitieren vergehen kann, denn Antworten auf die gegenwärtig brisanten Probleme von Zerstörung der Mitwelt, Krieg, der Angst vor Künstlicher Intelligenz und dem Überwachungsstaat sind eine Überlebensfrage, auf die Antworten so dringlich, aber doch schwer zu haben sind. Und wie viele Menschen kann die Erde noch (er-)tragen? Die demographische Kurve ist eine Zeitbombe.
Sind wir die »letzte Generation«? Wenn nicht, wie soll es weitergehen? Wie kann es überhaupt weitergehen? Das ökologische und humanitäre Desaster ist konkret. Vielleicht bleiben nur noch wenige Jahre, um zumindest das Schlimmste zu verhüten. Angesichts der in der Welt zunehmenden Gewalt eine Illusion? Gewalt in Kriegen, die wir nicht mehr für möglich gehalten hatten, aber auch vor unserer Haustür: in den Schulen, in der Arbeit, in den sozialen Beziehungen, in den sogenannten »sozialen« Netzwerken, ganz öffentlich. Und zunehmend: Hass, Ausgrenzung, Gesprächsverweigerung, Schuldzuschreibungen und Behauptungen, die wenig Raum für faire Auseinandersetzung lassen. Wie soll da die Menschheit überleben können? Und: Wo ist da Vernunft oder Geist, oder sogar eine Evolution des Geistes einer Menschheit? Ist der Mensch menschheitsfähig?
Ist der Mensch menschheitsfähig?
Die Menschheit? Sie setzt sich zusammen aus Milliarden einzelner Menschen, jeder und jede mit konkreten Hoffnungen und Ängsten, enttäuschten Erwartungen und Lebenshunger. Alle wollen glücklich sein, aber was ist Glück? Ist der Mensch emotional und sozial hinreichend ausgestattet, um seine technologischen Fähigkeiten so meistern zu können, dass er sich nicht selbst zerstört? Die nur oberflächlich kaschierte Aggressivität des Menschen begleitet die Geschichte, die wir kennen, von Anfang an. Ungezügelte Begierde und eine tief verankerte Angst sind Antriebskräfte, die kreative und destruktive Wirkungen zugleich haben. Gleichzeitig erleben wir Liebe, Verbundenheit, kreatives Engagement für andere Menschen, Solidarität, Projekte für eine neue und nachhaltige Lebensgestaltung. Und das weltweit, großartig! Ist der Mensch nun von Grund auf böse oder gut? Können wir die Frage überhaupt beantworten und dabei mehr bieten als persönliche Hoffnungen und Erwartungen, können wir also mit Gründen und kulturellen Erfahrungen argumentieren, die mehr sind als festgezurrte Meinungen?
Der Geist des Menschen ist fähig, ein Kaleidoskop des Möglichen zu beschreiben, wobei er sich selbst erkennt. Das Mögliche beruht auf dem Faktischen. Was aber ist das? Das Faktische bin zweifelsfrei »ich«, weil ich diesen Satz denke (wie Descartes meinte). Oder doch nicht? Ich bin nur, weil zuvor »wir« ist, biologisch ohnehin, aber auch kulturell-geistig. Doch wer sind wir? Den vielen Ausprägungen dessen, was wir als das Böse fürchten, sind wir täglich ausgesetzt. Aber können wir auch die Möglichkeiten und Ressourcen ausloten, die vielleicht noch nicht hinreichend entwickelt und verwirklicht worden sind? Sind wir mehr, als wir von uns denken (und erleben)?
Die folgenden Argumentationen beruhen auf personaler Intention, Rationalität und transpersonaler Offenheit für tiefere Einsichten in die Zusammenhänge der Wirklichkeit. Ob dieser »Spagat« erfolgreich sein kann?
»Der Garten des Menschlichen« war der Titel, mit dem Carl Friedrich von Weizsäcker (1912–2007) seinen großen Beitrag zur Anthropologie im Jahre 1977 einführte. Die Metapher des Gartens steht für Vielfalt, die gleichwohl geordnet ist. Im Garten gibt es keine lineare Zweckrationalität, die auf ein definierbares Ziel zulaufen würde, sondern hier entstehen in wechselseitigen Abhängigkeiten in unerschöpflicher Kreativität Formen und Verknüpfungen, die wir als »schön« empfinden. Aber der Gärtner muss die natürlichen Prozesse mit Pflege fördern, sonst verwuchert das Gelände oder die Pflanzen sterben. Er sollte dabei die »Einheit der Natur« im Blick haben. Ich verdanke Carl Friedrich von Weizsäcker nicht nur den Bezug zu diesem Titel, sondern auch zur Weite seines Denkens und der Klarheit seiner Argumentationen. Als ich daran beteiligt wurde, den von der Stiftung Niedersachsen 1988 ausgerichteten Kongress »Geist und Natur« unter der Leitung Carl Friedrich von Weizsäckers wissenschaftlich mit vorzubereiten, wurden Fragen aufgeworfen, die »den Widerspruch zwischen naturwissenschaftlicher Erkenntnis und philosophischer Welterfahrung« (so der Untertitel des Buches, das nach dem Kongress 1989 von dem Physiker Hans-Peter Dürr und dem Philosophen Walther Ch. Zimmerli herausgegeben wurde) in den Blick nehmen sollten. Die damalige Intention wurde auf dem Buchumschlag so formuliert: »Unser Bild von der Welt hat sich innerhalb weniger Jahrzehnte durch die Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft und die Fortschritte auf technologischem Gebiet schneller und radikaler verändert als je zuvor in der Geschichte. In einem solchen Moment des geistigen Umbruchs sind Physiker und Biologen, Philosophen und Sozialwissenschaftler gleichermaßen gefordert, an der Grundlegung eines neuen Verständnisses von Mensch und Natur, Geist und Materie mitzuarbeiten.«
Diese Aufgabe bleibt uns gestellt. Seither haben die sogenannten bildgebenden Verfahren die Neurowissenschaften noch einmal revolutioniert. Die Arbeit am vorliegenden Buch ist eine Neuaufnahme der damaligen Fragen im Horizont heutigen Wissens und der Debatten um »Bewusstsein« (gibt es das überhaupt?) im interdisziplinären Diskurs,2 und ich werde dabei auf frühere Veröffentlichungen3 zurückgreifen, die nun in einem anderen Kontext stehen. Das gemeinsame Fragen, die gemeinsame Suche nach (immer vorläufigen) Antworten ist fruchtbar. Hier wird nicht nur Wissen generiert, sondern es werden Freundschaften gestiftet. Freundschaft wiederum entdeckt die Nähe des Denkens, wenngleich oft die Sprachformen und Denkmuster ganz verschieden sind. Es zeigen sich aber auch Widersprüche und kaum überbrückbare Gräben zwischen den Wissensdisziplinen. Wir gehen dann auf Entdeckungsreisen des Denkens, die Vergnügen bereiten und Erkenntnis wachsen lassen können.
Im Gegensatz dazu fühlen sich viele Menschen bedroht (und furios beleidigt), wenn jemand etwas anderes lebt und lehrt, als wir selbst es für richtig halten. Die Erfahrung aber zeigt: Wir können viel gewinnen, wenn wir lernen, zunächst einmal zu schweigen, zuzuhören und sowohl intellektuell als auch emotional etwas abzurüsten. Vielleicht hat der Andere – die andere Fachdisziplin, die andere Kultur, die andere Lebenserfahrung – ja etwas sehr Spannendes beizutragen? Vielleicht gibt es ja doch begründbare Antworten auf unsere Fragen? Die dann auch dazu führen könnten, dass unser Verhalten nicht den Ast absägt, auf dem wir selbst sitzen, psychologisch wie ökologisch?
Das vorliegende Buch will dies versuchen. Die Welt ist komplex, wir Menschen sind es erst recht. Ohne eine gewisse Reduktion verlaufen wir uns allerdings im Dickicht der Argumente und Perspektiven und Sprachen und Methoden. Aber wenn wir zu sehr vereinfachen, erfassen wir weder die Komplexität noch die Möglichkeiten, die wir vielleicht haben. Die Geschichte ist nicht abgeschlossen, der Mensch ist nicht »fertig«, das Gehirn ist »plastisch« (es wird umgestaltet je nachdem, wie es gebraucht wird), die Gefühle können geformt werden, das Denken kann (hoffentlich) lernen, indem es mit Genauigkeit praktiziert und auf sich selbst angewendet wird …
Ein Blick in die Geschichte, einschließlich der Wissenschaftsgeschichte, zeigt: Bewertungen und Urteile, die aus empirischen Daten gewonnen werden, sind historisch bedingt. Was alles ist nicht schon »dem Menschen« zugeschrieben und angedichtet worden, und in alle Deutungen sind Vorurteile und Werturteile eingeflossen. Das ist unvermeidlich. Der historische Blick beweist, wie veränderlich das Menschenbild ist: Kulturelle Erfahrungen, Machtinteressen und weltanschauliche Vorgaben beeinflussen das, was Menschen sehen, wahrnehmen, über sich selbst denken und, davon nochmals zu unterscheiden, öffentlich sagen. Interdisziplinär muss der Blick schon deshalb sein, weil der Mensch ein biologisches wie kulturelles Wesen ist, er kann als Individuum and als soziales (bzw. politisches) Wesen beschrieben werden. Alle Aspekte stehen miteinander in Wechselwirkung, und jede Einseitigkeit greift zu kurz. Nehmen wir als Beispiel zwei Dimensionen menschlichen Lebens: die wirtschaftlichen Verhältnisse und die künstlerische Kreativität. Beide beeinflussen einander, beide sind hochkomplexe Leistungen des Individuums in sozialen Bezügen, wobei auch umgekehrt die jeweilige Gesellschaft die individuelle Intention und Kreativität prägt. Weder die (materialistische) These von der ökonomischen Basis und dem (bloß) kulturellen Überbau noch die (idealistische) Behauptung der kulturellen Kreativität als höherer Funktion gegenüber der ökonomischen Ebene sind haltbar: Die Dimensionen des Menschlichen durchdringen und beeinflussen einander. Es ist prinzipiell unmöglich, dieses komplexe Geflecht erschöpfend darzustellen. Aus Gründen der notwendigen Beschränkung muss in diesem Buch der sozialen Dimension (und soziologischen Perspektive) etwas weniger Aufmerksamkeit zuteilwerden. Ich habe diese Perspektive aufgegriffen in meinem Interkulturellen Ökologischen Manifest (2020). Dennoch ist in den folgenden Kapiteln die gesellschaftliche Prägung, die Suche nach dem und die Bedrängung durch das »Kollektiv« immer präsent.
Ausgangspunkt sind die jüngsten Debatten und Erkenntnisse in den Neurowissenschaften.4 Hier wurden in den letzten Jahren Daten gesammelt, Perspektiven geöffnet und Zusammenhänge erkannt, die uns neue Einsichten in die Funktionsweise des Bewusstseins, des Denkens wie der Gefühle, beschert haben. Doch gerade diese Debatten zeigen: Daten sind noch keine Vorstellungen, denn sie müssen verknüpft und in Kontexten verstanden werden. Das setzt Vorannahmen voraus und Sprachbilder, die etwas suggerieren können, was durch die bloßen Daten gar nicht abgedeckt ist. Vorannahmen und Denkmodelle sind nötig, aber sie sind problematisch. Es werden also Modelle des Denkens gebraucht, die selbstverständlich historisch bedingt sind. Kulturen entwickeln Modelle zur Beschreibung von Sachverhalten, und diese Modelle gelten fortan als »typisch« für das mythologische oder das aufgeklärt-rationale Denken, oder »typisch« für Indien oder China oder »den Westen«. Mit solchen Denkmustern identifizieren wir uns dann, aber bei genauerer Betrachtung wächst die Erkenntnis: Die Pluralität der Modelle relativiert die jeweils möglichen Ansprüche auf Geltung. Modelle der Welt und des Menschen, Weltbilder also, streben meist Widerspruchsfreiheit (Konsistenz) an, aber das ist keineswegs immer der Fall und gelingt nie völlig befriedigend. Oft sind sie assoziativ, mit Entsprechungen argumentierend, die keine strikte Kausalität aufweisen. Modelle des Denkens bilden Rahmen, in denen individuelle Erfahrungen zu kollektivem Gedächtnis verarbeitet werden, das wiederum Erwartungen formuliert, in denen Erkenntnis möglich wird. Denn das, was im Modell möglich ist, formt als Paradigma die Erwartung, die Daten sucht, findet und dann zu einem Gesamtbild zusammenfügt. Paradigmenwechsel (im Sinne Thomas Kuhns5) markieren den Zusammenbruch solcher Modelle, die dann durch neue ersetzt werden. Auch diese sind historisch bedingt und zerbrechen wieder im Laufe der Zeit.
Die Pluralität der Modelle relativiert die jeweils möglichen Ansprüche auf Geltung.
Paradigmen sind dann nicht mehr tauglich, wenn neue Daten neue Erkenntnisse generieren, die einen anderen Deutungsrahmen erzwingen. Dies ist in den Neurowissenschaften und den Technologien zur Künstlichen Intelligenz der letzten Jahre der Fall gewesen. Wie in der Kulturgeschichte so häufig (in Kunst, Kommunikation und Wissenschaft), haben neue Technologien (bildgebende Verfahren) nicht nur Fortschritte in der Erzeugung und Darstellung von Wissen ermöglicht, sondern völlig neue Werkzeuge geschaffen, die Einblicke in die Funktionsweisen des menschlichen Gehirns erlauben. Der Sprung ist nicht nur quantitativ, sondern qualitativ. Es ist zu erwarten, dass diese Entwicklungen anhalten. Dass den mentalen Fähigkeiten des Menschen, seine eigenen mentalen Funktionsweisen zu erkennen, Grenzen gesetzt sind, ist zu vermuten. Wo diese Grenzen liegen, ist offen. Dass Probleme, die heute als unlösbar gelten, gelöst werden können, ist angesichts der bisherigen Wissenschaftsgeschichte gewiss. Dass dafür neue Denkformen notwendig werden, ist wahrscheinlich.
Modelle des Denkens bilden Rahmen, in denen individuelle Erfahrungen zu kollektivem Gedächtnis verarbeitet werden, das wiederum Erwartungen formuliert, in denen Erkenntnis möglich wird.
Religion, Wissenschaft und Kunst haben eines gemeinsam: Sie gehen davon aus, dass die Welt nicht so ist, wie sie der Sinneserfahrung erscheint.6 Hinter den alltäglichen Eindrücken des Zufalls oder der Ordnung liegen andere Ordnungen – spirituelle, ästhetische, mathematische, die zumindest im Prinzip erkennbar sind. Solche Erkenntnisse werden in den jeweils unterschiedlichen Symbolsystemen von Religion, Wissenschaft und Kunst codiert. Diese Symbole beschreiben aber nicht nur, sondern sie gestalten aktiv das Leben des Einzelnen wie die soziokulturellen Verhältnisse von Gesellschaften. Sie sind Handlungsmuster.
Die Naturwissenschaften beschränken sich auf kausale Beschreibungen, die objektivierbare Daten zu überprüfbaren Theorien verknüpfen, indem sie Strukturen in der Materie und ihren Entwicklungen freilegen. Die Religionen gehen darüber hinaus. Sie beanspruchen, auf Grund subjektiver Erfahrung (die intersubjektiv verallgemeinert wird durch Mythen und Rituale) eine bewusste und intentionale Instanz als Urheber und Garant dieser Ordnung zu kennen – meist, aber nicht immer, mit dem Begriff Gott bezeichnet. Diese ursprüngliche Ordnung im eigenen Bewusstsein zu erfahren, ist Inbegriff der Spiritualität. Die Kunst macht das Verborgene bzw. die hinter den Dingen liegende Ordnung (oder auch Unordnung) sichtbar, hörbar, sinnlich erfahrbar. Diese hintergründigen Muster des Lebens bewusst zu machen, ist wichtig, denn sie prägen unser Denken, unser Fühlen, unsere Entscheidung. Eine solche formt sich in der rituell stabilisierten Kommunikation von Menschen, die Gesellschaften Zusammenhalt und Orientierung für das soziale Handeln gibt.
Die jeweiligen Welt- und Menschenbilder sind unterschiedlich, aber eben diese Bilder werden zwischen den sozial-kulturellen Systemen von Religion, Kunst und Wissenschaft wie auch zwischen Kulturen ausgetauscht. Interkultureller Austausch und interkulturelle Aneignung sind die Triebkraft der kulturellen Evolution des Menschen! In Gestalt von Deutungen und kollektiver Praxis (Rituale und Gewohnheiten) gehen sie über von einem Bereich in den anderen, und das macht ihre Kreativität aus, es erschwert aber auch, dass Religion, Wissenschaft und Kunst7 miteinander in vernünftige Diskurse eintreten können.
Interkultureller Austausch und interkulturelle Aneignung sind die Triebkraft der kulturellen Evolution des Menschen!
Die folgenden Kapitel beschränken sich auf Modelle, die sich aus der Begegnung von Asien und Europa/Amerika ergeben. Asiatische Kulturen beeinflussen schon seit langem die Umgestaltung europäisch-amerikanischer Religionskulturen, ihre Philosophien und Künste. Gibt es hier Einsichten, die vertiefte Perspektiven auf die philosophischen Interpretationen der Daten aus den Neurowissenschaften und vielleicht auch der Künstlichen Intelligenz ermöglichen?8
Themen wie das Leib-Seele-Problem, eine monistische Interpretation der Wirklichkeit durch Überwindung des Materie-Geist-Dualismus, eine integrale Deutung des Subjekt-Objekt-Dualismus, die Willensfreiheit des Menschen, die Fähigkeit zu Gerechtigkeit und Frieden angesichts des evolutionären Erbes, die Frage nach der Wirklichkeit der Liebe, die Frage nach Sterben und Tod werden in diesem Rahmen neu gestellt. Zentral ist das sogenannte »schwierige Problem« (the hard problem)9, nämlich die Frage, wie auf der Basis physikalisch und chemisch beschreibbarer Strukturen (neuronale Netzwerke) Gedanken, subjektive Empfindungen und Erfahrungen entstehen, also das, was »Bewusstsein« genannt wird. Was heißt es, wenn materielle Strukturen des Gehirns und geistige Strukturen des Denkens und der Gefühle »korreliert« gedacht werden? Dieses Problem ist ein Leitthema des Buches, und es wird in den einzelnen Kapiteln aus unterschiedlichen Perspektiven erörtert werden. Jedes Kapitel wird eingeleitet durch zentrale Gedanken von Rainer Maria Rilke, die er in seinem Werk Briefe an einen jungen Dichter (1903–1908) entwickelt hat. Sie waren Inspirationen für den Autor und sollen die Leser ebenfalls inspirieren, vielleicht auch verblüffen. Und sie formen eine Klammer, die sich um die einzelnen Fragen des Buches legt und dieselben verbindet.
Die ausgewählten Themen sind nicht neu, auch nicht die Denkmodelle, mit ihnen umzugehen. Vieles, was heute an Deutungen aus dem Buddhismus oder Hinduismus fasziniert, hat Vor-Bilder auch in der europäischen Religions- und Philosophiegeschichte. Aber es sind nur wenige Spezialisten, die damit vertraut sind. Manche Sprachbilder für ein nicht-dualistisches Weltbild, individual- und sozialethische ebenso wie ästhetische Theorien, haben eine lange Tradition in der griechischen Philosophie, vor allem im Neuplatonismus. Auch die Aristoteles-Rezeption im Mittelalter hat hier viel beizutragen, vor allem aber die Fülle der europäischen Mystik, in der die Philosophie des Idealismus und der Romantik wurzelt. Die Geschichte dieser Theorien kann hier ebenso wenig behandelt werden wie die Geschichte der Rezeption indischer oder ostasiatischer Philosophien in Europa seit der Aufklärung und der Romantik.10 Allerdings ist es bemerkenswert, wie z. B. in der Philosophie Schellings und bei Schopenhauer Themen erörtert werden, die ähnlich – aber doch mit feinen Differenzen – in den indischen Systemen der Metaphysik, Anthropologie und Ethik diskutiert werden. Die europäische Mystik war weitgehend neuplatonisch geprägt, und zwar einschließlich der islamischen, wie sie besonders Ibn al-Arabi (1165–1240) entwickelt hatte. Und das alles, bevor man seit Ende des 17. Jahrhunderts mit Indien in intensiveren geistigen Austausch trat. So hatte Nikolaus von Kues (1401–1464), der ein genauer Leser Meister Eckharts (ca. 1260–1328) war, eine Lehre vom Zusammenfall der Gegensätze (coincidentia oppositorum) als letztgültige Einheit der Wirklichkeit entwickelt, die Jakob Böhme (1575–1624) in der ihm eigenen Sprache weiterentwickelte. Der niederländisch-jüdische Philosoph Baruch de Spinoza (1632–1677) hatte eine All-Einheitslehre rational zu begründen versucht, die in der Goethezeit eine Renaissance erfuhr. So hat Friedrich Wilhelm Schelling 1798 in seiner Schrift »Von der Weltseele«11 nach einem »gemeinschaftlichen Princip« gesucht, das allen anorganischen und organischen Prozessen in der Natur zugrunde liege, das in allem gegenwärtig sei und darum selbst nichts Besonderes sein könne, eine Art Weltseele, ein atman also, der wie die magnetische Kraft allen Erscheinungen innewohne und damit etwas darstelle, das Materielles und Geistiges umfasst. Später sprach man von der Lebensenergie, heute von der Grund-Energie oder der »Quanteninformation«12 bzw. der Ganzbewegung (holomovement)13. Johann Gottlieb Fichte (1762–1814) definierte Bewusstsein als Selbst-Erkennen, ähnlich dem, was heutige Neurobiologen als »Sekundärbewusstsein« oder die »interne Verarbeitungsebene« von Information bezeichnen. Auch Schellings Unterscheidung von »bloß endlicher Erkenntnis« und »intellektueller Anschauung« (die auf die deutsche Mystik bei Meister Eckhart, Heinrich Seuse und später Jakob Böhme zurückgeht) liest sich wie ein Echo auf die Unterscheidung von »relativer Wahrheit« und »absoluter Wahrheit« im Buddhismus und im indischen Vedanta. Wenn nach Immanuel Kants Kritik schon klar war (und ist), dass wir die Welt, wie sie ist (»Ding an sich«), nicht kennen können, da jedes Wissen mentale Konstruktion nach den Bedingungen des menschlichen mentalen Vermögens ist, so wäre doch vielleicht eine andere Form des Wissens – eine Intuition, eine mystische Schau, eine ästhetische Gesamtwahrnehmung hinter den Wahrnehmungen von Erscheinungen möglich? Ließe sich eine solche Dimension gar durch ein rationales Verfahren erschließen? Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer – die Philosophie des Idealismus scheint bezüglich der letzten Frage gescheitert zu sein. Das Problem ist aber nicht erledigt: In Ernst Cassirers (1874–1945) Analyse der symbolischen Formen, in der Prozessphilosophie Alfred North Whiteheads (1861–1947) sowie ihren amerikanischen Adaptationen und eben auch in den neueren Diskussionen um die »Neurobiologie« und »Neurophilosophie«14 taucht es in je eigener Gestalt wieder auf.
Warum beginnen wir mit dem Bewusstsein und nicht mit der Biologie oder mit dem Urknall? Weil wir, auch wenn wir nach den materiellen Bedingungen der Welt und des Lebens und des Menschen fragen, in und mit dem Bewusstsein fragen. Wir können zwar mit guten Gründen annehmen, dass es eine Welt außerhalb von uns gibt, bevor es überhaupt Menschen oder Leben auf der Erde gab. Doch auch diese Annahme machen wir im Bewusstsein. Die Quantentheorie (als Basis heutiger Physik) ist nicht eine Aussage darüber, »wie die Welt ist«, sondern darüber, wie der Mensch messend und eingreifend mit der Welt in Beziehung tritt. Sie ist eine statistische Theorie, und was wir sehen, hängt ab von dieser Interaktion, also auch vom Bewusstsein.
Die sechs Kapitel folgen also einer inneren Logik: Wir fragen erstens nach den Grundlagen des Wissens über den Menschen aus heutiger Perspektive, um davon abgeleitet zweitens zu prüfen, wie Wissen zu Systemen gültiger Aussagen organisiert und als verlässliche Basis des Handelns kommuniziert wird. Drittens wird nach den Bedingungen der Entwicklung des Menschen im Rahmen evolutionärer Prozesse gesucht. Viertens diskutieren wir, ob und unter welchen Voraussetzungen der Mensch die Freiheit hat, das so erworbene Wissen zu Handlungsentscheidungen zu nutzen. Daraus ergibt sich fünftens die Frage nach der Wirkkraft der Liebe und dem ethischen Maßstab, nach dem vernunftgestützte Entscheidungen gefällt werden können. Sechstens fragen wir, ob es begründete Aussagen über Sinn und Ziel des Lebensprozesses angesichts der Endlichkeit des Menschen geben kann.
Bei einigen Themen werden wir historisch vorgehen, um zu zeigen, wie sich das Menschenbild entwickelt hat. Dabei ist der Begriff »Bild« wörtlich zu nehmen, denn kulturelles Wissen ist nicht nur in Begriffen und analysierender Sprache codiert, sondern auch in Kunstwerken, Ritualen und Erzählungen. Dies ist das Feld der Kunst und der Religionen, die in nicht europäischen Kulturen gar nicht deutlich von Philosophie zu trennen sind. Wir werden also die Fragen nach Denkformen und Welt-Modellen im Rahmen der Religionsgeschichte stellen. Bei anderen Themen ist diese historische Perspektive nur schwer möglich: Die »Liebe« ist kaum mit historischem Wissen begreifbar. Man hat zwar Verhaltensgewohnheiten, Ritualpraxen, soziale Muster und mediale Darstellungen (vor allem in Poesie und bildender Kunst) um Partnerwahl, Sexualität, Ehe und Familie usw. untersuchen können, aber das ist nicht »die Liebe«. Dieselbe muss zunächst als Phänomen bestimmt werden, und – was wundert es – nicht allzu viel ist hier dem Blick von außen zugänglich.
Unterschiedliche Perspektiven können einander ergänzen, sie reißen aber auch Bruchlinien auf. Denn wir haben es mit der Beschreibung des Faktischen und Erörterungen des Möglichen zu tun. Beides gilt gleichzeitig: Wir sind Menschen und haben als solche eine nicht bezweifelbare Würde, wie ich zeigen werde; und wir werden Menschen, weil die Potenziale immer neu aktualisiert werden und in diesem Prozess jeweils weiter anwachsen. Unter beiden Aspekten beruhen die Argumente auf empirischem Wissen und rationalen Erwägungen dessen, was noch nicht gewusst wird, aber Wahrscheinlichkeit hat. Das Faktische wird gedeutet in einem Rahmen, der auch subjektiv, historisch bedingt und von Interessen geleitet ist, wie wir oben sagten. Das Mögliche aber beruht auf dem Transport von aus der Vergangenheit stammenden Erwartungen und Hoffnungen. Sie sind gezeichnet von Erfahrungen des Glücks wie von Enttäuschungen und Erfahrungen des Scheiterns.
Auch aus diesem Grund sind die folgenden Aussagen und Vorschläge unvollständig. Sie sind durch neue Daten sowie Gegenstimmen auf dem Hintergrund anderer Erfahrungen frag-würdig. Manches bleibt assoziativ, weil mentale Projekte nicht eindeutig und darum offen sind. Auch die Beschreibung von biologischen Prozessen im Menschen ist Beschreibung, also mentales Projekt: Wahrnehmung, Datensammlung, Theoriebildung, Deutung in Sprache. Wir wissen heute über Genetik, Epigenetik und den Einfluss des Bewusstseins auf die Regulationsprozesse des Körpers ungleich mehr als noch vor einigen Jahren. Und auch das heutige Wissen wird schnell überholt werden. Nicht nur die Sprachen einzelner Völker, sondern auch die Sprachen sozialer Gruppen und unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen sind verschieden. Sie schaffen Identitäten, in denen sich das Menschliche nicht nur mitteilt, sondern auch formt. Anthropologie wird nicht nur in Sprachen geschrieben, sondern Menschsein geschieht in Sprache. Und das nicht im Singular, sondern im Plural.
1 Rainer Maria Rilke, Briefe an einen jungen Dichter, 12. August 1904, Frankfurt a. M.: Insel 1998, 44.
2 In den letzten Jahrzehnten habe ich am Humanwissenschaftlichen Zentrum der Universität München mitarbeiten können. Das Zentrum, das von dem Neurowissenschaftler Ernst Pöppel inspiriert und gegründet wurde, ist ein interdisziplinärer Think-Tank. Ihm sowie den Kollegen, die hier regelmäßig und intensiv zusammenarbeiten (vor allem Eva Ruhnau [Physik], Armin Nassehi [Soziologie], Oliver Jahraus [Germanistik]), habe ich für viele Anregungen zu danken.
3 Der vorliegende Text beruht auf der überarbeiteten, aktualisierten und erheblich erweiterten Neufassung des Teiles „Interkulturelle Perspektiven“ aus: Günter Rager/Michael von Brück, Grundzüge einer modernen Anthropologie, Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht 2012.
4 Das Problem besteht darin, dass wir uns nur auf wenige systematische Darstellungen/ Interpretationen von Neurowissenschaftlern beziehen können. Selbstverständlich ist, wie in jeder Wissenschaft, die Forschung im Fluss, und es gibt unterschiedliche Meinungen auch bei grundlegenden Fragen. Dennoch hat sich eine Art »Standardmodell« herausgebildet, und der Bezug auf diese grundlegenden Erkenntnisse muss hier genügen.
5 Th. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen), Chicago: University of Chicago Press 1962.
6 R. N. Bellah, Religion in Human Evolution, Cambridge/London: Tantor and Blackstone Publishing 2011, XIII ff.
7 Auf den Bereich der Kunst, ihre Symbolsysteme und deren Verhältnis zu Wissenschaft und Religion kann in diesem Buch nicht eingegangen werden.
8 Ein entsprechender Diskurs wird vor allem in der englischsprachigen Welt publikumswirksam geführt. Er kristallisiert sich um die »Mind and Life«-Konferenzen (seit 1987), die von Kognitionswissenschaftlern (Francisco Varela), Neurowissenschaftlern (Richard Davidson), Psychologen (Daniel Goleman) auf der einen und (vor allem tibetischen) Buddhisten (Dalai Lama, Matthieu Ricard) auf der anderen Seite angeregt werden; ein Niederschlag dieser Debatten in Deutschland ist das Buch: Wolf Singer/Matthieu Ricard, Hirnforschung und Meditation: Ein Dialog. edition unseld, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2008. Viele Dialoge und Veröffentlichungen mit großen Auflagen drehen sich um das Thema Wissenschaft und Weltbild (Religion/Spiritualität), z. B. Deepak Chopra/Leonard Mlodinow, War of the World Views. Science vs. Spirituality, London u. a.: Rider 2011, vom Verlag in der Reihe »new ideas for new ways of living« publiziert und von Wissenschaftlern wie Stephen Hawking, Rudolph Tanzi (Harvard), Hans-Peter Dürr (Max -Planck-Institut Garching) sowie dem Dalai Lama kommentiert. Dazu auch Monika Niehaus/Martin Osterloh, Dem Gehirn beim Denken zusehen. Facetten der Neurowissenschaften, Stuttgart: Hirzel 2023. Eine interessante Publikation in diesem Kontext ist: Jan W. Vasbinder/Balázs Gulyás (Eds.), Cultural Patterns and Neurocognitive Circuits. East-West Connections. Exploring Complexity Vol. 2, Singapore, London, New York et al.: World Scientific Publishing 2017. Die Liste ließe sich fortsetzen.
9 D. J. Chalmers, The Conscious Mind. In Search of a Fundamental Theory, Oxford: Oxford Univ. Press 1996.
10 Dazu W. Halbfass, Indien und Europa, Basel/Stuttgart: Schwabe 1981; U. App, The Birth of Orientalism, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2010; ders., Schopenhauers Kompass, Rorschach/Kyoto: University Media 2011. Auch M. v. Brück/Whalen Lai, Buddhismus und Christentum. Geschichte, Konfrontation, Dialog, München: C.H. Beck 1998.
11 Hinweise und Zitate bei U. App, Schopenhauers Kompass, a. a. O., 41 ff.
12 Th. Görnitz, Bewusstsein naturwissenschaftlich betrachtet und enträtselt, in: T. Müller/ Th. M. Schmidt (Hg.), Ich denke, also bin ich Ich? Das Selbst zwischen Neurobiologie, Philosophie und Religion, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2011, 64 ff. In diese Richtung zeigt auch der Informations-Begriff des Physikers Anton Zeilinger (geb. 1945, Nobelpreis 2022), der maßgeblich den Quanten-Computer entwickelt hat und u. a. im Dialog mit dem Dalai Lama die Konsequenzen für das Welt- und Menschenbild wiederholt erörtert hat.
13 D. Bohm, Wholeness and the Implicate Order, London: Routledge 1980.
14 Th. Metzinger, Bewusstseinskultur. Spiritualität, intellektuelle Redlichkeit und die planetare Krise, Berlin: Berlin Verlag 2022.
Kapitel 1:Bewusstsein, Ich und Selbst
Wenn Sie sich an die Natur halten, an das Einfache in ihr, an das Kleine, das kaum einer sieht, und das so unversehens zum Großen und Unermeßlichen werden kann; wenn Sie diese Liebe haben zu dem Geringen (…) dann wird Ihnen alles leichter, einheitlicher und irgendwie versöhnender werden, nicht im Verstande vielleicht, der staunend zurückbleibt, aber in Ihrem innersten Bewußtsein, Wachsein und Wissen.1
(Rainer Maria Rilke)
Worum geht es?
Unser Menschenbild befindet sich im Umbruch. Nachdem das Weltbild – vor allem die Kosmologie und die Erkenntnisse über die Grundbausteine der Welt – durch die Allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenphysik zu Beginn des 20. Jahrhunderts revolutionäre Phasen durchgemacht hat, sind es nun die digitale Revolution mit der Entwicklung »Künstlicher Intelligenz« sowie die Neurowissenschaften, die noch viel fundamentaler als die Psychoanalyse um 1900 das Selbstverständnis des Menschen bzw. das Verhältnis zu sich selbst herausfordern. Wer ist der Mensch? Und wer darf sich überhaupt mit welcher Kompetenz zu dieser Frage äußern? Die Frage nach dem subjektiven Erleben, nach der »Gültigkeit« von Bewusstseinszuständen, die sich vom »Normalen« unterscheiden, galt noch bis vor kurzem als wissenschaftlich unseriös. Das hat sich geändert: Bewusstseinsprozesse, wie sie unter Drogen kontrolliert induziert werden können, Nahtod-Erlebnisse, Zustände des Bewusstseins in der Meditation usw. werden wissenschaftlich untersucht, auch wenn befriedigende Deutungen solch außergewöhnlicher Bewusstseinszustände bzw. »Grenzerfahrungen« (noch) nicht in Sicht sind.2
Bewusstseinsprozesse, wie sie unter Drogen kontrolliert induziert werden können, Nahtod-Erlebnisse, Zustände des Bewusstseins in der Meditation usw. werden wissenschaftlich untersucht, auch wenn befriedigende Deutungen solch außergewöhnlicher Bewusstseinszustände bzw. »Grenzerfahrungen« (noch) nicht in Sicht sind.
Das, was Wissenschaft als Wissen bezeichnet, prägt auch die sozialen und ethischen Debatten. Das spiegelt sich auch in den Wissens- und Wissenschaftsdiskussionen selbst wider. Nicht zufällig enthält der »Report« der Max-Planck-Gesellschaft »Zukunft Gehirn«3 nicht nur Beiträge zur Evolution und Funktionsweise der Hirnarchitekturen, sondern auch zu pädagogischen, rechtstheoretischen und medizinischen »Konsequenzen« aus der neurobiologischen Forschung.
Ein weiterer Grund für den Umbruch im Menschenbild ist die Interkulturalität. Zwar erobern moderne Wissenschaft und Technik, die ihre Entwicklung aus Europa und Amerika heraus angetreten haben, mit unverminderter Dynamik die gesamte Welt, aber die europäischamerikanische Zivilisation büßt in atemberaubendem Tempo und weltweit ihren Anspruch auf das Monopol bei der Deutung dessen ein, was ein gutes Leben ist, was der Mensch als Kulturwesen tun soll und was nicht, was politisch und ökologisch notwendig sei. Das zeigt sich im großen Stil auch in der Politik und Wirtschaft: Das Weltgewicht verlagert sich nach China und Indien.4 Europa wird an den Rand gedrängt, ökonomisch wie politisch. Asiatische Kulturen, auch islamische (man denke an die Stadtentwicklungsprojekte der Golf-Staaten) und andere, stricken an den Mustern mit, die vorgeben, was wir von uns selbst halten und was wir von uns selbst halten werden, und wie Sein und Sollen miteinander in Übereinstimmung gebracht werden können. Differenzen und harte Konfrontation brechen dabei auf, und ob oder wie eine mögliche Integration gelingt, wird ganz wesentlich darüber entscheiden, ob nicht nur das Gehirn, sondern auch die Menschheit eine »Zukunft« hat oder nicht.
Gegenwärtig spielen drei Lernvorgänge eine gewichtige Rolle:
Wir lernen erstens, dass wir die Welt nicht »an sich« kennen, sondern nur in unseren Modellen und Konstrukten. Das hat zwar schon Immanuel Kant unmissverständlich formuliert, aber in den Naturwissenschaften gab es doch eine »Objektivitätsgläubigkeit«, die einem religiösen Unfehlbarkeitsanspruch nicht unähnlich war: Die Wissenschaften strahlten Sicherheit aus, vielleicht auch eine gewisse Arroganz der Erkennbarkeit und »Machbarkeit« der Dinge. Damit ist es vorbei. Auch die menschliche Vernunft ist Produkt der biologischen und kulturellen Evolution. Wir wissen, dass wir mittels des Lichtes suchen, das wir selbst produzieren. Wer immer dieses »wir« ist – es handelt sich jedenfalls um die bewussten Prozesse des Erkennens, um eine »anthropogene« Größe also.
Wir begreifen zweitens, dass wir nicht nur Körper sind und Substanz im Sinne lokal angeordneter materieller Teile, die beschreib- und messbar sind. Wir wissen auch, dass wir Psyche oder Geist sind, ein Wirkungsfeld, das diesen Körper erheblich beeinflusst. Nicht nur der Körper und seine Zustände beeinflussen das, was wir bisher meist Psyche oder Geist genannt haben, sondern auch umgekehrt haben mentale Prozesse messbare Wirkungen auf das, was wir körperliche Vorgänge nennen und in physikalischen oder chemischen Formeln beschreiben. Das Stichwort »Psychosomatik« ist in aller Munde. Die Placebo-Forschung ist eine anerkannte Disziplin, und auch die Epigenetik beweist, dass kulturell erworbene Eigenschaften die Gene steuern, und dass so »Erlerntes« auch vererbt werden kann. Doch wir sind weit davon entfernt zu verstehen, wie »mentale Impulse«, also Gedanken und Emotionen, biochemische Prozesse beeinflussen können, die mit klassischen naturwissenschaftlichen Messverfahren nachweisbar sind. Wir lernen, dass die Komplexität der Wechselverhältnisse zwischen den einzelnen Dimensionen des Menschseins größer ist, als wir bisher angenommen haben.
Und wir lernen drittens, dass es noch eine weitere Dimension des Menschseins gibt, die in den europäischen Sprachen als das Spirituelle bezeichnet wird. War dieses Wort zunächst ein Erbe der mönchischen christlichen Tradition gewesen und dann seit den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts ein Slogan, der mit alternativen esoterischen Bewegungen in Verbindung gebracht wurde, so ist er heute ein Begriff, der in den etablierten Wissenschaften akzeptiert ist, und zwar in der Pädagogik ebenso wie in der Neurobiologie und der Medizin, in der Religionswissenschaft ohnehin und in den anderen Kultur- und Sozialwissenschaften mehr und mehr. Denn die spirituelle Dimension des Menschseins ist etwas Eigenes gegenüber der psychischen. Das hat zwar auch bereits Platon so gesehen, und über die Neuplatoniker ist diese Auffassung in das frühe Christentum gelangt – man unterschied die leibliche (somatische), seelische (psychische) und spirituelle (noetische) Dimension –, aber in der Moderne war davon nur der Dualismus von Materie und Geist übriggeblieben. Die Frage aber, was das »Spirituelle« genau ist, kann heute neu gestellt werden, und zwar als Forschungsgegenstand mehrerer Einzeldisziplinen.
Die Entwicklung der wissenschaftlichen Disziplinen ist nicht vom Himmel gefallen, sie ist selbst in historischen Prozessen verankert. Das bedeutet: Auch wenn sich bestimmte Methoden bewährt haben, heißt das nicht, dass sie in einem anderen Rahmen neuer und weiterer Fragestellungen genügen würden.5 Darum der Ruf nach neuen Disziplinen und Inter-Disziplinarität, der aber so schwer umzusetzen ist, weil man meistens neue Begriffe, Fragen und Erkenntnisse in den alten, weil bekannten, Kategorien erklären muss. Stattdessen analysiert man Phänomene empirisch so, dass ihre Ursachen reduktionistisch erforscht werden, und statt netzwerkartiger oder »komplementärer« Beschreibungsweisen verfällt man eher einer »Monokausalitis«,6 die gleichwohl entscheidende Fragen, wie z. B. die nach den Wechselwirkungen von somatischen und spirituellen Prozessen, ausblendet.
Die folgenden Ausführungen sind selbstredend kein Beitrag zu den Neurowissenschaften. Sie können und wollen nichts anderes, als die Deutungen neurowissenschaftlich gewonnener empirischer Daten in einen interkulturellen Horizont zu stellen. Die Modelle, in denen neurowissenschaftliche Daten interpretiert werden, sollen nicht allein aus der europäisch-amerikanischen Philosophie- und Kulturgeschichte gewonnen werden. Dies könnte sich als produktiv erweisen, denn die genannten Modelle repräsentieren möglicherweise Einseitigkeiten bzw. Begrenzungen bei der Modellbildung. Dafür ist es allerdings unerlässlich, dass einige Kernthesen der gegenwärtigen neurowissenschaftlichen Debatte erläutert werden und das, was gegenwärtig als gesicherte Erkenntnis gilt, dargestellt wird.7 Dies kann allerdings nur exemplarisch geschehen mit Berufung auf einige der publikumswirksamen Autoren sowie durch prinzipielles Hinterfragen von sprachlich-kulturellen und systemischen Rahmenbedingungen des neurowissenschaftlichen Diskurses.
Denn es ist zu bedenken: Die Naturwissenschaften liefern Messdaten in Zahlen, Relationen und Proportionen, abhängig von den Fragestellungen, die in ausgeklügelten Experimenten formuliert worden sind. Solche Fragestellungen sind von einzelnen Menschen oder Forschergruppen erarbeitet worden, sie setzen also voraus, was sie suchen: Bewusstsein, d. h. intentionale Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf »etwas« auf Grund von Erfahrung in komplexen sozialen Zusammenhängen. Die Rahmenbedingungen der Fragen wie auch die Fragen selbst sind in verschiedenen Kulturen und Milieus unterschiedlich, ebenso auch die Deutungen der Ergebnisse. Alles, was über den Formalismus mathematisch-geometrischer Proportionen hinausgeht, wird in Sprache formuliert. Sprache aber verwendet Metaphern: Sie zeigen nicht das, was die Welt ist, sondern das, was wir von der Welt denken.
Wir stellen die Frage nach dem Menschen auf dem Hintergrund der platonisch-aristotelisch-cartesianisch-kantianischen Tradition, und wir haben sie seit Jahrhunderten auf diese Weise gestellt. Wir haben uns dabei als Materialisten, Idealisten, Spiritualisten – oder was auch immer – erwiesen. Dabei ist durchaus nicht eindeutig klar, was es heißt, eine materialistische oder idealistische oder sonstige Position einzunehmen. Denn das hängt an dem Begriff, den man von »Materie«, »Idee«, »Geist« usw. hat. Da gibt es viele Varianten, und unter heutigen naturwissenschaftlichen Vorgaben erst recht, so etwa wenn als Interpretation der Quantenphysik Vorstellungen wie »Materie als nicht-lokalisierter Informationsstrom« oder »Quanteninformation« (als letzte »Bausteine« der Wirklichkeit, die nicht mehr »materiell« im klassischen Sinne sind) auftauchen.8 Aber auch hier müsste geklärt werden, was unter »Vorstellungen« verstanden wird. Dazu eignet sich die Analyse der Interpretationen neurowissenschaftlicher Daten, wie sie einige Neurowissenschaftler selbst vortragen (z. B. in Deutschland Wolf Singer, Ernst Pöppel, Gerhard Roth), oder wie sie von Philosophen (z. B. Thomas Metzinger) interpretiert werden. Hier kann der erwähnte, von der Max-Planck-Gesellschaft herausgegebene Band »Zukunft Gehirn« als Beispiel gelten.9 Gewiss ist es richtig, Naturwissenschaft und Metaphysik zu unterscheiden. Aber, wie der Philosoph Julian Nida-Rümelin sofort hinzufügt, klar ist auch, »dass diese Unterscheidung problematischer ist als ursprünglich angenommen«10, und zwar nicht nur, weil es kein eindeutiges Kriterium dafür gibt, wie Nida-Rümelin bemerkt, sondern auch, weil die Unterscheidung selbst in einem modellhaften Rahmen vollzogen werden muss, der nicht der im Experiment überprüften Empirie entstammt, sondern mentales Konstrukt ist.
Unendlich viele Fragen, ein Ringen um klare Begriffe, Deutungen von Metaphern, in denen immer neue Meinungen geäußert werden, ohne dass logisch eindeutig bestimmt wäre, was genau gemeint ist. So etwa, wenn Wolf Singer vorschlägt, von einem »Dialog der Gehirne« zu sprechen. Wie bitte, Gehirne unterhalten sich? Nein, der Ausdruck ist eine Metapher für die Erkenntnis, dass die Entstehung reziprok aufeinander einwirkender neuronaler Netzstrukturen nicht im Rahmen der Gehirnarchitektur von Individuen beschrieben werden kann, sondern hochgradig sozial organisiert ist. Aber »Gehirne« sind nicht im »Dialog«. Was genau ist es, das hier mit wem bzw. womit kommuniziert? Nicht nur einzelne Neuronen, sondern die »Netzwerke«, die Information bearbeiten oder selbst Information sind? Die in rückgekoppelten Schleifen andere Netze wie sich selbst ständig neu hervorbringen? Weiter: Interpretationen neurowissenschaftlicher Daten benutzen häufig den Begriff des »Korrelats«. Demnach seien mentale Prozesse neuronal korreliert. Was besagen soll, dass mentale Zustände Produkte neuronaler Mechanismen sind, deren komplexe Netzwerkstrukturen durch Vermittlung elektrischer und biochemischer Signale zustande kommen. Wo aber ein Korrelat ist, müssen zumindest zwei Systeme aufeinander bezogen werden. Der Begriff des Korrelats impliziert also einen wie auch immer gearteten Dualismus. Einen solchen meint eine naturalistische Beschreibungsweise natürlich nicht, denn eben dieser Interpretation gemäß sind mentale Zustände kausal abhängig von der Aktivität physikalisch beschreibbarer Neuronennetzwerke. Was aber dann? Was genau ist korreliert?
Selbstverständlich will man mentale Zustände im Rahmen der Naturgesetze interpretieren, sonst verließe man den Boden der Wissenschaft. Aber was sind Naturgesetze? Ist die Newton’sche Mechanik gemeint oder die Quantentheorie,11 deren Interpretationen zu einem Materiebegriff tendieren, der eher Potentialfeldern entspricht, die Information tragen, als mechanisch beschreibbaren Interaktion von »Substanzen«? Wolf Singer zieht sich in der Debatte, auf Nida-Rümelin antwortend, zurück und schwächt den Begriff der neuronalen Determination ab, wenn er formuliert, dass neuronalen Strukturen immerhin eine »tragende Rolle« zukomme.12 Das freilich wird wohl niemand bestreiten, aber der Begriff ist zu wenig konturscharf. Könnten »Korrelate« vielleicht eher als unterschiedliche Beschreibungsweisen aufgefasst werden, die ein und dieselbe implizite Ordnung in expliziten Kategorien erfassen? Dies etwa wäre das Modell, das dem Quantenphysiker David Bohm (1917–1992) vorschwebte.
Ein weiteres Problem stellt sich wie folgt dar: Wenn neurobiologische Daten zu systemischen Ordnungen verknüpft und die Wirkungen solcher Systeme in Sprache beschrieben werden, taucht begrifflich – es ist wohl kaum anders denkbar – die Formulierung auf: »Unser Gehirn« tut dies und jenes.13 Was zeigt das Possessivpronomen an, wer ist der Eigentümer? Oder man glaubt, durch das Verständnis von Gehirnprozessen könne man begreifen, »wie Risiko über das Gehirn unser Verhalten beeinflusst«, so dass »wir dem Risiko nicht länger schicksalhaft ausgeliefert« seien.14 In allen diesen Fällen wird ein Subjekt eingeführt, das einer anderen Ordnungsebene gegenüber den Hirnprozessen angehört, aber was soll das sein, da ja gerade keine Ich-Zentrale ausfindig gemacht werden kann?
Man kann die Fragen noch weitertreiben: Wenn die materiell berechenbaren neuronalen Verschaltungen das menschliche Verhalten determinieren, gibt es keine Willensfreiheit. Auch Neurobiologen, die dies behaupten, wollen aber daran festhalten: »Die handelnde Person ist verantwortlich für ihr Tun und muss für die Folgen eintreten.«15 Warum eigentlich, wenn nicht nur aus sozial-pragmatischen Gründen? Und wer ist hier »Person«? Was ist die Person mehr als die komplexen neuronalen Verschaltungssysteme, und wo kommt dieses »mehr« her? Die gängige Antwort ist die, dass es sich um ein emergentes Phänomen handele, denn natürlich könne man bei den bildgebenden Verfahren zwar Typen von Gehirnleistungen lokalisieren und beschreiben und ihre indirekten Wirkungen sehen, nicht aber die Inhalte dieser Leistungen, also Gedanken.16Emergenz tritt in der Natur häufig auf, vielleicht ist Evolution Emergenz? Denn schließlich ist die Vernunft einschließlich der Ratio und ihrer Fähigkeit zur Begriffsbildung auch ein emergentes Produkt der Natur. Der Begriff der Emergenz besagt, dass eine systemisch verbundene Einheit neue Eigenschaften gegenüber den Ausgangsbedingungen hat, d. h. dass die Erzeugung einer qualitativen Struktur aus quantitativ bestimmten Bestandteilen tatsächlich neue Systemeigenschaften ergibt (Wasser hat ganz andere Eigenschaften als Wasserstoff und Sauerstoff für sich betrachtet), oder anders ausgedrückt: Das emergente Phänomen ist mehr als die Summe der Teile. Mentale Prozesse (Denken, Fühlen, Gedächtnis usw.) unterscheiden sich qualitativ von den chemischen und elektrischen Reaktionen, die in den verschalteten Zellen ablaufen, wenngleich die mentalen Eigenschaften nicht ohne diese neuronalen Netzwerke auftreten. Man kann sie also als emergent bezeichnen. Damit ist allerdings weiterhin offen, ob es sich um »materielle« oder »geistige« Vorgänge handelt. Wie gesagt, das hängt an den zugrunde gelegten Begriffen.17 Man soll sich nur nicht täuschen: Keineswegs nur der Begriff des Geistes ist strittig, sondern nicht weniger der Begriff der Materie.
Jetzt aber kommen wir angesichts einer Situation, die als Patt zwischen Materialisten und Idealisten beschrieben werden könnte (oder auch nicht), in eine ganz andere Lage. Wir lernen nicht nur, arbeitende Gehirne in die Röhre zu legen und den gehirnregionalen Sauerstoffverbrauch live und dennoch nicht-invasiv zu messen, um damit Aktivitätsmuster des Gehirns zu erkennen und Rückschlüsse auf die »Funktionsweisen des Geistes« zu ziehen. Und wir lernen auch nicht nur, diese Ergebnisse mit klinischen Einzelfällen in Verbindung zu bringen, wo Ausfälle von Gehirnregionen Störungen bewirken, die wiederum die Lokalisierung kognitiver Leistungen und Einsichten in die Architektur des Gehirns ermöglichen.18 Die Entstehung von Gefühlen und Gedanken und deren Korrelation, die Entwicklung von Wahrnehmungsprozessen und das Zustandekommen von Willensentscheidungen ist damit aber noch nicht zureichend erklärt.
Denn wir lernen auch, dass die Interpretationen dieser Messdaten in der Sprache unserer je eigenen kulturellen Entwicklungsgeschichte geschehen (wie sonst?). Doch es gibt Alternativen in anderen Sprachen. Wir lernen die Kulturen Indiens, Chinas, der afrikanischen und amerikanischen Völker kennen (um nur einige zu nennen), und es zeigt sich, dass die Denkformen, in denen wir nach Raum, Zeit, nach der Welt und dem Menschen fragen, auch anders sein können. Diese Andersheit umfasst viele Bereiche, sie betrifft vielleicht alle Dimensionen des menschlichen Lebens, einschließlich des Wissenschaftsbetriebs. Noch einmal: Die Messdaten sind kulturinvariant, sofern sie größtmögliche Genauigkeit aufweisen und unabhängig von jeweiligen kulturellen Orten wiederholt erzeugt und dadurch überprüft werden können. Ihre Interpretation aber geschieht, sobald wir mathematische Formalisierungen verlassen (und einige Wissenschaftler beschränken sich genau aus diesem Grunde darauf, bei den unanschaulichen Formalismen der Darstellung zu bleiben) und mit der Sprache operieren. Und die ist metaphorisch, kulturvariant, »obertönig«.
Die wichtigste Erkenntnis aus diesem interkulturellen »Aha-Erlebnis« ist vermutlich diese: Wir müssen uns nicht dem Zwang unterwerfen, entweder materialistische Monisten oder idealistische Dualisten zu sein, also entweder alles im Menschen auf biochemische oder elektromagnetische Wechselwirkungen zu beschränken und damit den »Geist« zu eliminieren, oder aber den Geist als eigene Domäne gegenüber dem »bloß Materiellen« retten zu wollen, wobei wir Dualisten würden, was letztlich jeder naturwissenschaftlichen Evidenz zu widersprechen scheint. Nein, es geht auch anders. Wir können die Welt als Einheit denken, wobei Parameter, die wir dem Materiellen zuordnen, und Parameter, die wir als Geistiges begreifen, ein nicht-duales Kontinuum bilden. So die überwältigende Mehrheit der indischen Philosophien und Anthropologien.
Wir können die Welt als Einheit denken, wobei Parameter, die wir dem Materiellen zuordnen, und Parameter, die wir als Geistiges begreifen, ein nicht-duales Kontinuum bilden.
Was bedeutet das für unser Menschenbild? Was bedeutet das für die Wissenschaften und für unser Selbstverständnis als denkende Wesen? Was für den Begriff des Erkennens und der Wahrheit? Und vor allem: Was ist mentale und/oder spirituelle Erfahrung, nach der viele Menschen heute suchen, um Orientierung und ein gewisses Maß an Gewissheit zu finden angesichts einer Welt, die immer unüberschaubarer zu werden scheint? Ist spirituelle Erfahrung der Weg, die alte Frage »Wer sind wir« neu zu stellen angesichts einer Situation, in der die Rationalität vielleicht in eine Sackgasse geführt hat? Wie auch immer, es gilt ein alter Satz,19 leicht abgewandelt, in neuen Kontexten: experientia quaerens intellectum, die Erfahrung sucht nach Verstehen. Genau das wollen wir nun versuchen.
Begriffsklärungen
Zunächst ist zu klären, was wir meinen, wenn Begriffe wie Bewusstsein, Ich und Selbst gebraucht werden. Dann erst kann die Frage gestellt werden, ob diese Begriffe beschreiben, was der Fall ist, ob sie die Daten der Neurowissenschaften sinnvoll interpretieren, die aus empirischen Messverfahren gewonnen wurden, und ob sie konsistente Aussagen ermöglichen und der Vernunft einleuchten. Denn jede Frage ist ein Produkt des Denkens, das wiederum als eine Funktion des Bewusstseins erscheint. Dabei ist unklar, was Bewusstsein ist. Der Begriff könnte in die Irre führen, denn er suggeriert ein »Etwas«, das es irgendwie substantiell »gibt«, das räumlich und zeitlich abgegrenzt wäre wie andere Dinge auch. Das ist aber nicht der Fall. Denn Bewusstsein ist unser fundamentaler Erlebensmodus, Bewusstsein ist die Voraussetzung dafür, dass uns überhaupt etwas als etwas erscheint (einschließlich des »Bewusstseins« als Gegenstand unseres Nachdenkens und Empfindens). Wir kennen Bewusstsein ausschließlich als Funktion. Bewusstsein ist ein Selbst-Gewahrwerden von Wahrnehmungen, Empfindungen und Denkakten, die sich zu einem Etwas formen, das wir »uns« gegenüber empfinden. Dies geschieht in der Zeit, denn es gibt ein Vorher und Nachher zu jedem Bewusstseinsakt. Bewusstsein ist also ein Prozess, kein festes »Ding«, auf das man zeigen könnte. Dieser Prozess ereignet sich in verschiedenen funktionalen Zuständen. Die Art des Bewusstseinszustandes ist die Voraussetzung dafür, dass und wie wir Zeit erfahren, denn abhängig von Bewusstseinszuständen fühlt sich Zeit verschieden an. Das erleben wir nicht nur in der Meditation und anderen »außergewöhnlichen« Zuständen, sondern auch abhängig von Stimmungen (Langeweile, Begeisterung) oder auch vom Lebensalter (für ältere Menschen vergeht die Erlebenszeit schneller). Ebenso wird die räumliche Gliederung, die wir im Zustand des Tages-Bewusstseins erleben, im Traum oder in Zuständen von meditativem Ganzheitsbewusstsein überwunden. Was bedeutet das? Was berechtigt uns, von »außergewöhnlichen« Bewusstseinszuständen zu sprechen, was ja den »gewöhnlichen« oder normalen Zustand voraussetzt. Wer setzt das Maß dafür, was »normal« ist?
Bewusstsein ist ein Selbst-Gewahrwerden von Wahrnehmungen, Empfindungen und Denkakten, die sich zu einem Etwas formen, das wir »uns« gegenüber empfinden.
Wir wollen mit einer Arbeitsdefinition beginnen: Bewusstsein ist eine Gruppierung bewusster Zustände, in denen wir selbstreflexiv der jeweiligen Bewusstheit »von etwas« gewahr werden. Bewusstsein ist das verstehende Erfassen (Apperzeption), die Wahrnehmung und das Erleben der Wahrnehmung als Wahrnehmung, die abstrahierende Begriffsbildung und der Bezug des Ganzen auf ein zentrales Ich, das dies alles erlebt. Aber dieses Ich existiert nicht für sich, sondern als Knotenpunkt von intersubjektiven Bezügen.20
Bewusstsein ist eine Gruppierung bewusster Zustände, in denen wir selbstreflexiv der jeweiligen Bewusstheit »von etwas« gewahr werden.
Diese Definition erscheint kompatibel mit einer Arbeitsdefinition, die der amerikanische Psychologe Daniel Siegel vorgeschlagen hat, und die in der interdisziplinären Kooperation zwischen Psychologie, Neurobiologie und Kognitionswissenschaften breite Zustimmung erfahren hat:21
»Ein Kernaspekt des Geistes ist ein verkörperter und relationaler Prozess, der den Fluss von Energie und Information reguliert (…) Das Gehirn ist der verkörperte neuronale Mechanismus, der diesen Fluss reguliert, Beziehung (Relation) ist das Mitteilen dieses Flusses.«
Was aber ist hier als welcher Prozess »verkörpert«? Was ist Information und auf welcher (materiellen?) Basis findet der soziale Austausch statt? Siegel unterscheidet das Materielle (»Brain«) von einer hinzukommenden Beziehungs-Komponente (»Relationship«). »Mind« würde aus dem materiellen »Brain« emergieren und sodann durch »Relationship« gestaltet werden. Ist aber das Materielle bzw. die Emergenz von »Mind« etwa etwas anderes als ein Netzwerk von Beziehungen? Wir werden darauf zurückkommen.
Nach dieser allgemeinen Begriffsklärung soll nun das Problemfeld abgesteckt werden, in dem die interkulturelle Begriffsanalyse erfolgt,22 die angesichts der Frage nach Meditation und Ganzheitsbewusstsein unumgänglich ist. Wir müssen nun also die Begriffe für Bewusstsein, Psyche, Geist, Spirituelles noch einmal in diesem Rahmen diskutieren. Einige grundsätzliche Bemerkungen müssen genügen.
Einer der ältesten und grundlegenden Texte des Buddhismus, die Schrift Dhammapada, beginnt mit der Feststellung, dass alles im Bewusstsein geschieht23 – wo auch sonst? Wir haben keine Möglichkeit zu erfahren und zu wissen, es sei denn im Bewusstsein. Und dieses ist komplex. Es ist kein substantielles Etwas, sondern eine Sequenz von ständig sich verändernden Zuständen, die jedoch durch Vernetzungs- und Rückkopplungsprozesse eine Empfindung von Kohärenz erzeugen, die als »Ich« oder »Selbst« bezeichnet wird. Was hier Empfindung ist, was Kohärenz, was überhaupt ein Zustand, all das sind Fragen, deren Beantwortung von zahlreichen Vorentscheidungen abhängt. Das zeigt sich schon an der Vielzahl der Begriffe, die diese Thematik ansprechen: Bewusstsein, Ich, Selbst, Seele, Psyche, Geist, Verstand, Vernunft – was ist das? Man könnte noch weitere Unterscheidungen vornehmen, wenn z. B. lateinisch ratio und intellectus, anima und spiritus unterschieden werden, und das ist in den philosophischen Traditionen natürlich auch geschehen. Diese Begriffe sind jedenfalls Kategorien, die bei der Herausbildung der europäischen Philosophien, namentlich bei der Rezeption des Aristoteles in der Vermittlung durch die Araber im Mittelalter und auf dem Hintergrund des Neuplatonismus, zur Geltung gebracht wurden.
Immer wieder wird behauptet (übrigens nicht nur im Alltagsgespräch, sondern auch als akademisches Vorurteil), der Westen (Europa/ Amerika) habe das autonome Ich entdeckt und dann mit Sigmund Freud relativiert, der Osten (Indien/China) hingegen hätte den Blick auf das Nicht-Ich (Pali anatta bzw. Sanskrit anatman, chinesisch wuhsin) gerichtet, besonders im Buddhismus und Daoismus. Zumindest habe »der Osten« auf eine irgendwie geartete transpersonale Wirklichkeit verwiesen, die von den Ich-Strukturen nur verdeckt würde, während der Westen stolz auf seine Entdeckung des Individuums oder des Personalen sei.
Dieses einfache Schema von »Osten« und »Westen« ist unzutreffend. In den indischen Traditionen etwa zeigt sich ein höchst differenziertes Bild: Die Unterscheidungen von individuellem Lebensprinzip (Sanskrit jiva) oder Ich (ahamkara) und transzendentem Grund der Person im Selbst (atman oder purusha) als transpersonale oder transhistorische Geistigkeit zeigen, wie differenziert dort die Analyse ist. Darüber hinaus gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen philosophischen Systemen, die sich in Indien und China herausgebildet haben. Indische Philosophien haben weitgehend nicht-dualistische Systeme herausgebildet, was das Verhältnis von Materie und Bewusstsein betrifft. Aber auch in indischen (buddhistischen wie hinduistischen) Philosophien gibt es dualistische Beschreibungen des Leib-Seele-Problems, wenn etwa im indischen und tibetischen Buddhismus davon ausgegangen wird, dass es ein materielles Kontinuum und ein geistiges Kontinuum gebe, die jeweils parallel zueinander existieren. Jeder Zustand sei abhängig von einem vorausgehenden Zustand, und weder könne das Geistige auf das Materielle noch das Materielle auf das Geistige kausal zurückgeführt werden.24 Und umgekehrt sind auch in Europa bereits in der Antike und im »Mittelalter« (meist auf dem Hintergrund neuplatonischen Denkens) keineswegs nur dualistische, sondern auch nicht-dualistische Entwürfe für eben diese Problematik entwickelt worden.
Seit der Mitte des ersten vorchristlichen Jahrtausends zählt in Indien die philosophische Tradition des Samkhya und später auch des Yoga und der Bhagavad Gita alle Bewusstseinskategorien zu der Welt des Veränderlichen, zur Welt der Natur (prakriti, »das Hervorgebrachte«, wie es im Sanskrit heißt), während das reine Beobachten aller dieser Zustände den purusha ausmache. Purusha – oft übersetzt mit »Geist« oder »Selbst« – steht für ein Prinzip jenseits des Erfahrbaren. Er ist das Unveränderliche, der selbst keinen Inhalt haben kann, weil er ja sonst begrenzt und veränderlich wäre. Purusha gilt als der reine bewusste Spiegel, der alle Prozesse beobachtend begleiten kann, selbst aber nicht den prozessualen Veränderungen unterworfen sei. Das, was wir das Psychische nennen, gehört nach indischem Verständnis also zum Bereich der raumzeitlichen Relativität, zu dem, was wir in der europäischen Tradition als das Materielle bezeichnen. »Bewusstsein« und die »Sinne« gehören nicht zwei prinzipiell unterschiedlichen Bereichen (Geist und Materie) an, sondern sie sind verschiedene Funktionen in dem einen selbstreflexiven Lebensstrom.25 Man sieht: Dies ist eine ganz andere Einteilung, als wir dies in Europa mit der Unterscheidung von Materie und Geist kennen.
Demgegenüber gibt es in Indien und China nicht-dualistische Systeme, die nur eine einzige Wirklichkeit anerkennen. Dieses Eine umfasst alles, es zeigt sich als die Dynamik des Einen, die in sich komplexe Formen vom kleinsten raumzeitlich bestimmten Teilchen bis hin zur bewussten Selbstreflexivität beim Menschen (und noch anderen höher entwickelten Lebensformen, die im Mythos eine Rolle spielen) entwickelt. Diese Wirklichkeit ist kreativ, produziert intelligente und intelligible Formen, sie spielt gleichsam mit sich selbst in der Dynamik der ihr inhärenten Eigenbewegung, wie es im indischen Shivaismus metaphorisch im Spiel (lila) der citshakti, der Bewusstseinskraft Shivas, angeschaut wird. Indien und auch die chinesischen Traditionen haben auf der Grundlage solcher Intuitionen hochkomplexe Psychologien erarbeitet, die sich teilweise sehr präziser Begrifflichkeiten bedienen, um die Unterschiede von Bewusstseinszuständen zu beschreiben bzw. zu entfalten und dabei unterschiedliche Erfahrungsebenen des Menschen, der mit sich selbst kommuniziert, zur Sprache zu bringen.
Damit ist die Frage verknüpft: Wer





























