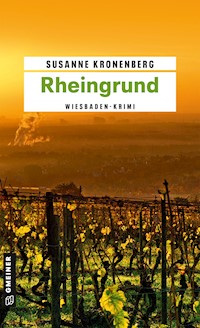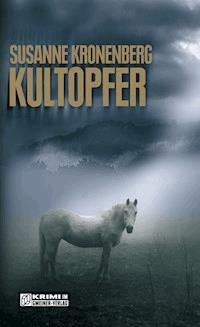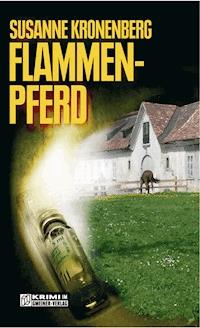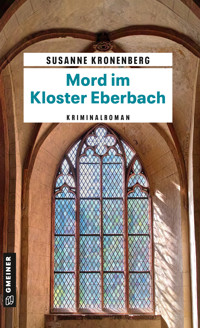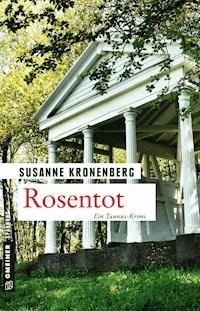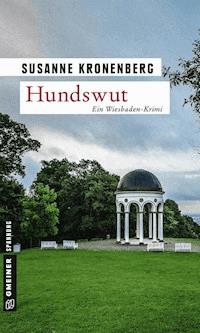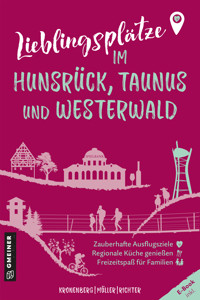Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Privatdetektivin Norma Tann
- Sprache: Deutsch
Brennende Luxuswagen in Wiesbaden. Unter Verdacht stehen Aktivisten, die für eine Verkehrswende kämpfen. Teil der Gruppe ist die 20-jährige Ona. Erst kürzlich folgte sie ihrer Großmutter aus der spanischen Heimat in deren Geburtsstadt Wiesbaden. Jorinde Ruiz Alvarez sorgt sich um ihren Bruder, der den Kontakt zu ihr abgebrochen hat. Freiwillig? Oder schottet seine Lebensgefährtin den Immobilieninvestor ab? Jorinde bittet die Privatdetektivin Norma Tann um Hilfe. Bald darauf wird in einem ausgebrannten Auto ein Toter entdeckt. Sind Ona und ihre Gruppe in einen Mord verwickelt?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Susanne Kronenberg
Wiesbadener Visionen
Norma Tanns zehnter Fall
Zum Buch
Rauch auf der Rue BeherzteVerkehrsgegner kämpfen für ihre Vision einer zukunftsfähigen Innenstadt. Doch ist die Gruppe auch für die Autobrandserie in Wiesbadens Straßen verantwortlich? Im Hintergrund der Initiative hält der Maler Fredo die Fäden in der Hand. Sein Mäzen ist ein bekannter Immobilienmogul. Dass dessen Gemäldesammlung verkauft werden soll, weckt das Misstrauen der Privatdetektivin Norma Tann. Die 20-jährige Ona schließt sich der Initiative an. Nach dem Tod des Großvaters verließ sie die spanische Heimat und folgte ihrer Großmutter Jorinde in deren Geburtsstadt Wiesbaden. Jorinde Ruiz Alvarez sorgt sich um ihren Bruder Lothar, einen wohlhabenden Immobilieninvestor. Hat er auf eigenen Wunsch den Kontakt zu ihr abgebrochen oder schottet seine Lebensgefährtin ihn ab? Jorinde bittet die Privatdetektivin Norma Tann um Hilfe. Als auf dem Neroberg, Wiesbadens Wahrzeichen, ein SUV ausbrennt und im Wrack eine Leiche gefunden wird, geraten Ona und die anderen Aktivisten unter Verdacht, in den Mord verwickelt zu sein. Normas Auftrag erfährt eine ungeahnte Wendung.
Susanne Kronenberg, geboren in Hameln und im Taunus heimisch, lässt sich gern vom historischen Hintergrund ihrer Wahlheimat inspirieren. Welcher Stellenwert Bürgerinitiativen gebührt, erwies sich bereits in den 1960er-Jahren, als Wiesbaden zur „Autostadt“ umgebaut werden sollte. In das derzeitige Milieu junger Verkehrsaktivisten führt der zehnte Fall der Wiesbadener Privatdetektivin Norma Tann. Neben Kriminalromanen veröffentlichte die Autorin Kurzgeschichten für verschiedene Anthologien, eine Reihe von Jugendbüchern sowie Fachbücher und Bücher zu regionalen Themen. Als Dozentin für Kreatives Schreiben gibt sie Kurse und Workshops. Sie ist Mitglied des „Syndikats“ und Mitgründerin der Wiesbadener Autorengruppe „Dostojewskis Erben“.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Branko Srot / stock.adobe.com
ISBN 978-3-8392-7634-1
Prolog
Schritt für Schritt taucht sie tiefer in die nächtliche Stille ein. Schwer und schwarz reihen sich die Stämme im Licht des aufgehenden Monds aneinander. Der Pfad führt steil bergauf. Norma hält inne, schöpft Atem. Sie rückt den Tragegurt der Fototasche zurecht und betrachtet den blass schimmernden Himmelskörper. Das sich im Wind wiegende Geäst übt eine beruhigende Wirkung auf sie aus. Bald setzt sie den Weg fort. Das Stativ schlägt im Gleichmaß ihrer Bewegungen gegen ihre Hüfte.
Vom Waldparkplatz bis hinauf zum Nerobergtempel brauchen Fußgänger in der Regel keine zehn Minuten – am helllichten Tag zumindest. Im schwarzblauen Zauber der Vollmondnacht scheinen sich die Sekunden zu Minuten auszudehnen. Etwas Kleines, Dunkles huscht vor ihr über den Pfad. Endlich öffnet sich der Wald und gibt den Blick auf die baumlose Bergkuppe frei. Schon kann sie das helle Säulenrund des Pavillons erkennen. In seinem Hintergrund erstreckt sich das nächtliche Panorama der Stadt wie ein aus blinkenden Lichtpunkten gewebter Teppich.
Soll sie das Stativ im Tempelchen aufstellen? Sie öffnet die Fototasche und holt die Nikon hervor. Gewichtig und fremd liegt ihr die Kamera in der Hand. Sie freut sich auf ihre ersten Nachtaufnahmen. Der prüfende Blick durchs Objektiv weiß nicht zu überzeugen. Die Kronen der hangabwärts stehenden Bäume drängen sich in den Bildausschnitt hinein. Jahr für Jahr rückt der Wald näher an den Aussichtspunkt heran. Sie beschließt, ihr Anfängerglück ein Stück weiter unten zu versuchen: auf der Löwenterrasse, die sich über den städtischen Weinbergen erstreckt. Zuversichtlich nimmt Norma ihre Sachen auf und verlässt den Monopteros.
Der Weg führt auf die obere Station der Nerobergbahn zu, deren Betrieb zur Nachtzeit eingestellt wird. Der Biergarten am Turm und der Weinstand zwischen den Reben sind längst geschlossen. Vor der Bergstation wendet sie sich nach links und steigt die Stufen hinunter. Wie ein riesiger, finsterer Sarg liegt der Monolith des Kriegerdenkmals im silbrigen Licht da. Ein Nachtvogel breitet die Flügel aus und hebt geräuschlos ab. Norma muss aufpassen, um nicht über Äste und Steinkanten zu stolpern. Das grobe Pflaster leitet sie zur Terrasse hinab. Dort flankieren zwei steinerne Löwen den Aussichtsplatz. Beinahe lebendig erscheinen ihr die grob gehauenen Köpfe. Die Gesichter, die bei Tag betrachtet von einfältigen Zügen geprägt sind, weisen im Zwielicht der Mondnacht eine wohlwollende Güte auf.
Die Aussicht: verheißungsvoll. Ob die Kamera die vielfarbigen Lichter wohl einfangen kann? Norma baut das Stativ auf, schraubt die Nikon fest. Die Testaufnahmen lassen die nötige Tiefenschärfe vermissen. Ein Spickzettel hilft weiter. Sie vertieft sich in das Einstellen, Anvisieren und Auslösen und das kritische Begutachten der Ergebnisse, bis ein explosiver Knall sie aus der Konzentration reißt. Schon riecht es scharf nach Rauch, nach schwelendem Kunststoff. Oben am Tempel lodern gleißende Flammen empor. Intuitiv schaltet sie die Kamera auf die Videofunktion um und richtet den Apparat auf das Feuer aus, während sie zugleich 112 auf dem Handy wählt. Hastig gibt sie die Position durch und stürmt los. Die Flammen vernichten ein Auto, einen massigen Geländewagen. Das lässt die qualmende Silhouette erkennen.
Was ihr der Anblick nicht verrät: Im Kofferraum verbrennt ein Mensch.
Eine Woche zuvor
1
Samstag, der 21. Oktober Wiesbaden
Ein Schuss.
Das Echo hallte an den Fassaden wider. Schlagartig verstummten die Kinderstimmen, die der Abendwind in die Wohnung hinaufgetragen hatte. Ein Kläffer schwieg unverhofft. Über den Baumkronen der Allee erhob sich das panische Rauschen Tausender flatternder Flügel. Durch das offene Fenster schaute Norma den schwarzen Vogelschwärmen nach, die in unschlüssigem Auf und Ab über den Hausdächern kreisten. Sie spürte, wie sich ihre Schultern entspannten. Ein krachender Böller hatte sie in Alarm versetzt, was nicht verwunderlich war. Als ehemaliges Mitglied der Wiesbadener Mordkommission befürchtete sie bei einem Knall zunächst das Schlimmste. Die aufgescheuchten Stare erinnerten sie daran, was sie im Wiesbaden-Magazin gelesen hatte: Dass sich die Stadtverwaltung bemühe, die Vögel aus ihren Nachtquartieren zu vertreiben. »Vergrämen« war der Fachausdruck dafür, wenn sie sich richtig erinnerte. Die Beschwerden der Anwohner der Adolfsallee machten drastische Maßnahmen unausweichlich, nachdem vom Band abgespielte Falken- und Habichtschreie nicht zum erwünschten Erfolg geführt hatten.
Die Frau neben Norma – eine feenhafte, zarte Person mit stahlgrauem Haarknoten, die von einer inneren Kraft beseelt schien – beugte sich weit über die Fensterbrüstung und deutete auf die Kastanien, deren Kronen sich als grün-bauschiges Band entlang der Hausfassaden zogen. »Ich mag das Spektakel, mit dem sich die Stare abends in ihren Schlafbäumen niederlassen. Wussten Sie, dass die Adolfsallee einst zum Autobahnzubringer ausgebaut werden sollte? Stellen Sie sich die Blechlawine vor, die sich heute unter diesem Fenster entlangwälzen würde! Da sind mir die Vögel lieber. Trotz ihrer Hinterlassenschaften.« Sie rümpfte die Nase.
Norma wusste, worauf sie anspielte. Der erbärmliche Zustand der Autos, die unter den Kronen abgestellt waren, ließ sich nicht leugnen. Manche Karosserien trugen einen richtigen Panzer aus Starenkot. Das stank den Besitzern gewaltig – im wahrsten Sinn des Wortes.
»Von diesen Plänen in den 1960er-Jahren habe ich gehört«, antwortete sie, während sie auf die begrünte Allee hinunterblickte, in der sich ein Spielplatz für die jungen und rund um das Rondell eines Brunnens ein Biergarten für die älteren Anwohner befand. »›Autobahnisierung‹ nannte man das. Zum Glück hat eine Bürgerinitiative damals das Schlimmste verhindert. Sonst wäre Wiesbaden zur Autostadt umfunktioniert worden. Dabei gab es zu der Zeit viel weniger Verkehrsprobleme als heutzutage.«
Die Stare schlugen weiterhin ihre aufgeregten Bögen am Himmel. Ob sich die Vertreibungsaktionen gleichermaßen gegen Wiesbadens farbenprächtige Einwanderer richteten? Die Papageien und Großsittiche fühlten sich in den Parks und Villengärten längst wie zu Hause, Norma hatte ihren Spaß an den gewitzten Krakeelern.
Ihre Gastgeberin empfand offensichtlich ähnlich. »Hoffentlich stören sich die Papageien nicht an dem Geknalle. Solch prachtvolle Exoten haben wir selbst in Gerona nicht.«
»Sie kommen aus Spanien, Frau …?«, verhaspelte sich Norma. »Entschuldigen Sie bitte, mir ist Ihr Name entfallen.«
Die Dame war auf sie zugekommen, als Norma erfolglos an Lothar Wiedbrechts Wohnungstür geklingelt hatte. Ob sie sich kurz unterhalten könnten? Unschlüssig war Norma der Unbekannten in die Nachbarwohnung gefolgt. Nun befanden sie sich im Erker eines geräumigen Wohnraums. Neben der Zimmertür stapelten sich Umzugskartons. In einer Ecke lehnte ein großformatiger Bilderrahmen, dessen Vorderseite vom Betrachter abgewandt war und Normas Neugier weckte. Als Private Ermittlerin interessierte sie sich insbesondere für die kleinen Details.
»Ruiz Alvarez, ich trage den Familiennamen meines spanischen Ehemanns. Mit Vornamen heiße ich Jorinde. Ich bin eine geborene Wiedbrecht, Lothar ist mein Bruder. Er hat mir diese Wohnung überlassen, in die ich erst kürzlich eingezogen bin. Ihm gehört dieses wunderschöne Haus«, fügte sie mit stolzem Lächeln hinzu.
Der Mann besaß nicht allein dieses beachtliche und mehrstöckige Jugendstilbaudenkmal. Er war außerdem im Besitz einer stattlichen Reihe von Mietshäusern neben zahlreichen Bürogebäuden. Genau deswegen wollte Norma zu ihm. Lothar Wiedbrecht schien gefühlt die halbe Stadt zu gehören. Aus bescheidenen Verhältnissen stammend, hatte er in jungen Jahren begonnen, mit Immobilien zu spekulieren.
»Können Sie mir sagen, wann Ihr Bruder nach Hause kommt? Oder wo ich ihn finde?«
Jorinde Ruiz Alvarez atmete hörbar aus. »Das weiß ich leider nicht. Aus diesem Grund habe ich Sie hereingebeten. Ich hoffte, diese Fragen würden Sie mir beantworten.«
»Wie kamen Sie auf diesen Gedanken?«, wunderte sich Norma. »Ich bin Ihrem Bruder nur ein Mal persönlich begegnet. Dabei hat er mir seine Hilfe angeboten, falls ich irgendwann eine Wohnung suchen sollte, was mittlerweile der Fall ist. Ein guter Freund hatte uns miteinander bekannt gemacht.«
Das kurze Aufeinandertreffen lag mehrere Wochen zurück. Lothar Wiedbrecht hatte zu einem klassischen Konzert im Kurhaus eingeladen, um mit den Einnahmen ein Heim für minderjährige Geflüchtete zu unterstützen. Man schätzte ihn in der Stadt für sein karitatives Engagement. Der gute Freund war Lutz Tann, ein in der Wiesbadener Gesellschaft bestens vernetzter Verleger und der Vater von Normas verstorbenem Ex-Mann Arthur. Sowie seit vielen Jahren ihr väterlicher Vertrauter. Die Wohnung sollte für sie und Timon sein. Endlich wollten sie das Zusammenleben wagen. Doch dies war nicht der Augenblick, vor einer Fremden ihre Familienverhältnisse und Zukunftspläne mit ihrem Lebensgefährten auszubreiten.
»Bitte halten Sie mich nicht für aufdringlich«, sagte Jorinde Ruiz Alvarez und fügte erklärend hinzu: »Sie sind Lothars erster Besuch, seit ich hier eingezogen bin, und mein spontaner Gedanke war, Sie könnten ihn vielleicht näher kennen und mir sagen, was mit ihm los ist. Nehmen Sie doch Platz!« Einladend wies sie auf eine helle Ledercouch.
Halbherzig folgte Norma der Bitte. War Jorinde Ruiz Alvarez in Sorge um ihren Bruder oder fühlte sie sich einfach nur einsam? Fraglos wünschte sie sich jemanden zum Reden. Norma legte ihre Jacke über die Sofalehne und stellte den Rucksack auf dem Teppich ab. Im Sitzen warf sie einen verstohlenen Blick auf die tickende Wanduhr. Noch zehn Minuten, dann würde sie sich höflich, aber bestimmt verabschieden. Ihr Gegenüber ließ sich Zeit. Schweigend war Jorinde in einem Ohrensessel versunken, dessen wuchtige Rundungen ihre fragile Gestalt noch zerbrechlicher erscheinen ließen.
Norma studierte währenddessen den Aufmacher des Wiesbaden-Magazins, das auf dem Couchtisch lag. »Feuerteufel hat wieder zugeschlagen«, lautete die Headline, und die Zeilen darunter beschrieben die Details: »SUV ging auf der Rue in Flammen auf. Polizei weiterhin ohne Spur.« Warum nicht »Polizei tappt im Dunkeln«? Norma amüsierte sich im Stillen. Andererseits, diese Autobrände waren alles andere als komisch. Die Wilhelmstraße, von den Einheimischen »Rue« genannt, zählte zu Wiesbadens ersten Adressen. Innerhalb weniger Wochen hatten Brandstifter mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet abgefackelt und waren dabei durchaus wählerisch vorgegangen. Jedes Mal hatte es ein Modell der Luxusklasse getroffen.
Endlich begann Jorinde zu sprechen. »Ich bin über 70. Wiesbaden ist meine Heimatstadt. In der ›Paulinen Klinik‹ habe ich Krankenschwester gelernt. Doch mit Anfang 20 schien mir in Deutschland alles zu eng. Ich bin viel herumgekommen. Zuletzt gehörte mir ein Café in Gerona, aber nach Juans Tod …«
»Juan – Ihr Mann?«, fragte Norma behutsam.
»Ein Autounfall in den Bergen, es herrschte dichter Nebel. Er starb an der Unfallstelle.«
Draußen hatten die Kinder ihr Spiel wieder aufgenommen. Ihr Lachen wurde beinahe von dem Bellen übertönt, das sich zu einem sirenenartigen Jaulen steigerte. Soll die Stadt den Hund doch als Vogelschreck engagieren, dachte Norma ironisch. Neben der Haustür war ihr beim Eintreten ein buntes Firmenschild mit der Aufschrift »Jeannes Fellkids – Schönheit für deinen haarigen Liebling«aufgefallen. Vielleicht waren Herrchen oder Frauchen Kunde des Hundesalons.
Flink stemmte sich Jorinde aus dem Sessel, schloss das Fenster und bemerkte, nachdem sie erneut Platz genommen hatte: »Ist es nicht merkwürdig? Je älter ich werde, umso öfter denke ich an früher. Wie es war als Kind. Nach Juans Beerdigung überkam mich eine tiefe Sehnsucht nach dem Rhein und dem Taunus, nach seinem intensiven Grün. Diese Wohnung hatte mir mein Bruder seit Langem versprochen, aber sie war gut vermietet. Als sie kürzlich unverhofft frei wurde, ist mir das wie ein Zeichen erschienen. Wie ein, ja, Weckruf! Jetzt oder nie! Also habe ich Nägel mit Köpfen gemacht und das Café verkauft.«
»Kein leichter Schritt, so ein Neuanfang«, meinte Norma, um etwas zu sagen. Der große Zeiger der Wanduhr schien wie eingerostet, wollte kaum weiterziehen.
»Zum Glück bin ich nicht allein gekommen«, berichtete Jorinde lebhaft. »Meine Enkelin hat mich begleitet. Ona ist in Gerona aufgewachsen, zum nächsten Semester will sie sich an der Hochschule RheinMain einschreiben. Sie hat ihren Großvater sehr geliebt, was sage ich, sie hat ihn vergöttert. Die Trauer hat sie aus der Bahn geworfen. Ich hoffe, der Ortswechsel wird sie auf neue Gedanken bringen.«
»Und Sie haben Ihren Bruder hier«, ergänzte Norma. »Machen Sie sich Gedanken um seine Gesundheit?«
Der Immobilieninvestor müsste um die 80 sein, schätzte sie.
Jorinde wedelte aufgeregt mit den Händen. »Ehrlich gesagt, habe ich keinen Schimmer, wie es Lothar gerade gesundheitlich geht. Vor dem Umzug standen wir telefonisch in Kontakt. Seit ich in Wiesbaden bin, habe ich ihn nicht ein einziges Mal zu Gesicht bekommen.«
»Demnach ist Ihr Bruder verreist?«
»Nein, nein«, widersprach Jorinde heftig. »Lothar ist zu Hause. Ich höre seine Stimme, wenn ich an der Tür … nicht, dass ich lauschen würde, sicher nicht. Ich habe wieder und wieder geklingelt, und entweder macht Cordula gar nicht erst auf oder sie wimmelt mich ab. Nicht einmal Ona will sie zu ihm lassen, seine Großnichte, die hat er zuletzt als Neunjährige gesehen. Das gehört sich doch nicht!« In ihrer Empörung straffte sich ihr Körper, und sie wuchs ein Stück aus dem klobigen Polstermöbel heraus.
»Cordula ist seine Frau?«
»Nein, seine Frau, das war Ellen! Lothar ist Witwer. Cordula ist seine Lebensgefährtin. Mehr als 20 Jahre jünger! Wo die Liebe hinfällt, wie man so sagt.« Ihr unsteter Blick ließ darauf schließen, für wie suspekt sie diese Lebensweisheit hielt.
»Cordula würde mit Lothar lieber heute als morgen zum Standesamt gehen«, ergänzte sie nach einer Gedankenpause. »Eine zweite Ehe käme meinem Bruder jedoch wie ein Verrat vor. Mit Ellen wird er auf ewig innig verbunden bleiben.«
Auch Norma und Timon waren nicht verheiratet. Eine Entscheidung aus freien Stücken von beiden. Ob Cordula darunter litt, als zweite Wahl zu gelten? Womöglich ließ sich die Kränkung auf finanzielle Weise besänftigen. Wiedbrecht galt als überaus wohlhabender Mann. Norma ärgerte sich über sich selbst, wie schnell sie mit derartigen Vorurteilen war. Genauso gut konnte es sich um ehrliche Gefühle handeln.
Der Minutenzeiger hatte das im Stillen gesetzte Ziel erreicht. Bevor Norma sich erhob, legte sie eine Visitenkarte auf den Couchtisch. »Darf ich Sie um einen Gefallen bitten? Wenn Sie Ihren Bruder sprechen, könnten Sie ihm bitte ausrichten, dass ich eine Wohnung suche?«
»Sehr gern, sofern ich ihn zu sehen bekomme«, versprach Jorinde und griff nach der Karte. »Sie sind Privatdetektivin, Frau Tann!«
Ein gewisses Misstrauen begegnete Norma häufig. Sie hatte eben keinen Allerweltsberuf. Um keine falsche Annahme aufkommen zu lassen, erklärte sie aufrichtig: »Ich bin Private Ermittlerin und lebe in gesicherten finanziellen Verhältnissen.«
Jorinde ließ ein leises, sympathisches Lachen hören. »Ich zweifle weder an der Seriosität Ihres Berufs noch an Ihrem Einkommen, Frau Tann. Meinem Bruder werde ich Sie gern empfehlen.«
Als Norma ihr in den Flur folgte, öffnete sich dort eine Zimmertür, und eine junge Frau spähte durch den Türspalt. Ein kaffeefarbener Lockenflaum umrahmte ihr missmutiges, nein, wohl eher trauriges Gesicht. Ihr schmaler Oberkörper steckte in einem übergroßen blauen Männerhemd, als sollte der Stoff seine Trägerin von der Außenwelt abschotten.
»Meine Enkelin Ona«, erklärte Jorinde in liebevoller Tonlage.
Unwillkürlich fragte sich Norma, ob das voluminöse Hemd ein Erbstück von Onas verstorbenem Großvater war.
»Ona möchte etwas mit Medien studieren«, flötete Jorinde, ganz die wohlwollende Großmutter, an Norma gewandt.
»Aha«, antwortete diese, die sich unter »etwas mit Medien« wenig vorstellen konnte – streng genommen gar nichts.
Offenbar erging es der Großmutter kaum besser. »Was ist das genau, Ona?«
»Hat mit Film und Computern zu tun«, antwortete sie lakonisch mit sympathischem Akzent, was Norma nicht wesentlich schlauer machte.
Mit einem genervten Augenrollen und ohne ein weiteres Wort zu verlieren, schlüpfte das Mädchen durch die Wohnungstür. Durch das Treppenhaus hallte das Trappeln eiliger Schritte.
Jorinde schickte einen resignierten Seufzer hinterher. »Wer könnte Onas Trauer um ihren Großvater besser verstehen als ich? Auch mir fehlt er sehr. Aber sie steigert sich so hinein. Ona hat sogar seine Hemden mitgebracht und trägt kaum etwas anderes.« Sie wünschte Norma einen schönen Tag und schloss die Tür.
Norma hielt vor der Nachbarwohnung inne. Unter einem Messingschild mit der Aufschrift »L. und E. Wiedbrecht« prangte ein größeres, glänzenderes mit der Gravur »Cordula von Schwenk«. Anhaltend betätigte Norma den Klingelknopf. Drinnen rührte sich wieder nichts.
Das Mädchen war außer Sicht, als sie aus dem Haus trat. Aus den Baumkronen drang vielstimmiges Zwitschern und Piepen. So viel zum Erfolg der Bölleraktion. Beim Blick zurück erspähte sie hinter einem Fenster eine Gestalt: Jorinde Ruiz Alvarez winkte ihr zum Abschied zu. Als Norma grüßend die Hand hob, bemerkte sie eine Bewegung hinter einer Scheibe der Nachbarwohnung. Eilig zog jemand die Gardine vor. Eine Frau? Norma konnte es nicht genau sagen.
2
Die Umzugspläne hatten Norma in eine Zwickmühle gebracht. Seit der Trennung von Arthur vor vielen Jahren wohnte sie im Wiesbadener Stadtteil Biebrich. Die Vorstellung, demnächst anderswo zu Hause zu sein, ließ sie schon jetzt das Panorama hinter dem Küchenfenster vermissen: der Anblick des Rheins mit seinen Ausflugsdampfern und Frachtkähnen, die behäbig an der Rettbergsaue, der Insel mitten im Strom, vorüberschipperten. Durch die Dachfenster konnte sie bis zum Schloss hinüberschauen und den Ring der Götterfiguren auf der barocken Rotunde erspähen. Wenn ihr nach frischer Luft und Bewegung war, musste sie nur vor die Tür gehen, um eine Runde durch den Schlosspark oder entlang des Ufers zum Schiersteiner Hafen zu joggen. Liebend gern hätte sie die Wohnung behalten. Leider war es keine Option, dass Timon bei ihr einzog. Beide lebten seit geraumer Zeit allein und schätzten Rückzugsorte, die in der Dachwohnung mit zwei Zimmerchen nicht vorhanden waren. Zudem wünschten sie sich eine deutlich geräumigere Küche. Lange genug hatten sie sich beim gemeinsamen Kochen gegenseitig auf den Füßen gestanden. Letztendlich wog der Wunsch zusammenzuleben mehr als der Verlust des vertrauten Nests. Timon konnte sich zurzeit nicht aktiv an der Suche beteiligen. Er war von seinem Arbeitgeber, dem Hessischen Landeskriminalamt, für mehrere Wochen nach Brüssel beordert worden.
Bisher war die Suche nach einer passenden Bleibe nicht erfolgreich gewesen. Während Norma auf die Innenstadt zuschritt, beschloss sie, Wiedbrecht in den nächsten Tagen noch einmal einen Besuch abzustatten. Unterwegs schlug sie weite Bögen um die Kastanienbäume. Der Vogelkot breitete sich unterhalb der Baumkronen aus, und sein Geruch stieg ihr beißend in die Nase. Nichtsdestotrotz genossen die Gäste des nahen Biergartens ihren Aperol Spritz oder eine andere Erfrischung in den späten Sonnenstrahlen. Die Tische reihten sich rund um den plätschernden Brunnen. Für die zweite Oktoberhälfte waren die Tage ungewöhnlich warm, doch die Abendluft schien bereits den Herbst mit sich zu bringen.
Wiedbrechts Jugendstilhaus stand in einer Reihe weiterer Baudenkmäler der Gründerzeit, mit denen sich die Adolfsallee schmückte. Die Prachtbauten mit ihren stattlichen Erkern, Schmuckgiebeln und typischen historistischen Elementen säumten den Boulevard auf beiden Seiten. Die Dämmerung senkte sich über die Allee, und hinter den Fenstern gingen die Lichter an. Im Vorübergehen las Norma die Schilder von Arztpraxen und Kanzleien. Neben den Geschäftsräumen beherbergten die Häuser vor allem Wohnungen, durch deren Fenster Norma einen Blick auf die überhohen Wände und reich verzierten Stuckdecken warf. Residieren vom Feinsten – sofern man zu den Glücklichen zählte, die ein solches Domizil ergattern und sich leisten konnten.
Mit einer nüchterneren Architektur zeigte sich die Adolfstraße, die sich der gleichnamigen Allee anschloss. Stoßstange an Stoßstange staute sich eine Autokarawane auf die Rheinstraße zu, eine der Hauptverkehrsadern Wiesbadens. Dass sich auch dort kaum ein Rad rührte, lag nicht allein am Feierabendverkehr. Grund für den Stillstand war eine Demonstration. Aus der Ferne hallten Norma Sprechchöre und das schrille Getöse unzähliger Fahrradklingeln entgegen. Schilder wurden in den Abendhimmel gereckt, und über den Köpfen der Protestierenden spannten sich bunt beschriftete Transparente. »Weg mit dem Blech«, »Freiheit fürs Fahrrad« und »Verkehrswende jetzt« lauteten einige Forderungen. Neugierig näherte sich Norma dem Aufmarsch und mischte sich unter die Passanten, bis der Zug auf dem Luisenplatz ins Stocken geriet.
Zu Füßen des Oraniendenkmals bemerkte Norma zwei sportliche junge Männer. Der eine – in Pluderhosen und breit kariertem Hemd, die flachsfarbenen Dreadlocks zu einem Dutt aufgetürmt – machte die Räuberleiter für den anderen, um diesen auf den gut zwei Meter hohen Sandsteinsockel hinaufzuhieven. Der zweite trug ein weißes Hemd unter einem schwarzen Sakko. In Verbindung mit einem adrett gegelten Kurzhaarschnitt wirkte es unpassend, dass seine Jeans über dem Knie aufgerissen war. Halt suchend umklammerte der Sakkoträger mit einem Arm die Vorderbeine des Rosses aus Bronze, das sich über ihm aufbäumte, und ließ sich von einer schwarz gekleideten jungen Frau ein Mikrofon reichen. Eine zweite Aktivistin befestigte ein tiefschwarzes Banner am Sockel des Denkmals. Darauf prangte das knallrote Emblem der Aktivistengruppe »AntiCar aktiv«.
Der Mann unter dem Bronzepferd benötigte nur wenige Worte, um sich Gehör zu verschaffen. Bald lauschten die Umstehenden, so wie Norma selbst, aufmerksam seiner leidenschaftlichen Rede. Nachdem er gegen die seiner Meinung nach rückständige und verschlafene Verkehrspolitik der Wiesbadener Stadtpolitik gewettert hatte, breitete er seine Vorstellungen von einer zukunftsfähigen City aus. Ob Verbrenner-, Hybrid- oder Elektromotor: Kein einziges motorbetriebenes Privatfahrzeug solle in Zukunft einen Platz in der gesamten Innenstadt haben. Die Blechlawine, die sich Tag für Tag über den Ersten und Zweiten Ring wälze, sei eine Zumutung für die Anwohner. Völlig aus der Zeit gefallen erschienen ihm die von abgestellten Autos verstopften Straßen der Wohnviertel. Die wenigen autofreien Aktionstage, die bislang im Zentrum stattgefunden hätten, seien ein löblicher Anfang, würden aber keinesfalls ausreichen.
Der täglichen Autolawine und den giftigen Abgasen müsse endlich und ein für alle Mal ein Ende gesetzt werden, verlangte er unter dem Beifall seiner Anhänger und rief mit klarer, volltönender Stimme: »Stellt euch vor, überall da, wo jetzt Autos parken, würden Kinder spielen, könnten sich Freunde treffen. Wie viel Platz wäre dort für Gärten. Blumen statt Blech. Das ist meine Vision einer lebenswerten Stadt. Meine Vision eines lebenswerten Wiesbadens.«
In die frenetische Zustimmung seiner Anhänger mischten sich die Pfiffe und das Gejohle der Teilnehmer einer Gegendemonstration, die sich ebenfalls auf dem Luisenplatz eingefunden hatte. Was die Anliegen dieser Protestler waren, ließ sich ihren Transparenten entnehmen. Parolen wie »Mein Auto bleibt mobil«und »Autogegner – nicht mit uns!« entdeckte Normamehrmals.
»Ich habe ein Recht auf meine Unabhängigkeit«, schrie eine Frau und schwenkte angriffslustig ihr Pappschild. »Freie Fahrt für freie Bürger*innen«, stand darauf.
»Du raubst mir meinen Parkplatz nicht, du linksgrün versiffter Utopist«, brüllte ein Mann aufgebracht und stemmte die Fäuste in die Seiten. Seine Begleiter stimmten begeistert ein und wiederholten das Statement lautstark. Die folgenden Kommentare gingen in ohrenbetäubenden Pfiffen und Pöbeleien der Gegenseite unter. Polizisten marschierten auf, um die Kontrahenten auf Abstand zu halten. Unter den Leuten, die sich zu Füßen des Denkmals versammelt hatten und jedes Wort des flammenden Appells in sich aufzusaugen schienen, entdeckte Norma ein bekanntes Gesicht: Jorindes Enkeltochter lauschte dem Redner mit leuchtenden Augen.
3
Was mochte die fremde Besucherin von Jorinde gewollt haben? Diese Frage beschäftigte Ona, während sie einfach draufloslief. War sie eine Bekannte von Onkel Lothar oder eine Freundin von Cordula? Sollte sie zwischen Jorinde und der Verwandtschaft vermitteln? Der Onkel war ihnen seit dem Einzug nicht begegnet, obwohl die Großmutter alles daransetzte, ein Treffen zu viert zu arrangieren. Ona hatte Lothar zuletzt als Neunjährige bei einem der seltenen Besuche in Jorindes deutscher Heimatstadt gesehen. Ihr grauste davor, im Treppenhaus zufällig auf ihn zu treffen. Wie sollte sie ihn ansprechen? Außerdem könnte sie nicht einmal sicher sein, ob er es überhaupt wäre. Wie peinlich! Cordula dagegen begegnete ihr öfter, seit Ona im Hundesalon jobbte. Jeanne, die Hundefriseurin, war Cordulas Tochter. Die Mutter beherrschte es in Perfektion, Ona wie Luft zu behandeln.
Gleich für den zweiten Abend im neuen Zuhause hatte Jorinde den Bruder samt seiner Partnerin zum Essen eingeladen. Die Vorbereitungen waren mühsam gewesen zwischen Stapeln von Umzugskartons und sich türmenden Küchenutensilien, weil sie noch nicht zum Einräumen gekommen waren. Doch auf die Gäste hatten sie vergebens gewartet. Onas Sturmklingeln nebenan war ebenso wenig von Erfolg gekrönt gewesen wie Jorindes Telefonterror. Anderthalb Stunden zu spät hatten sie das verkochte Risotto schließlich zu zweit gegessen.
Ohne konkretes Ziel folgte Ona dem Verlauf der Adolfsallee, bis diese sich zu einer schmalen Straße verengte und weiter geradeaus führte. Der reine Bewegungshunger hatte sie ins Freie getrieben. Früher – bevor der Großvater gestorben war – hatte sie immer etwas vorgehabt, wenn sie nach draußen gegangen war. Zum Beispiel, sich mit Alba und Marta auf der Brücke am Onyar zu treffen. Jedenfalls solange sie noch Freundinnen gewesen waren. Oder sie hatte in Jorindes Café ausgeholfen. Die deutschen Touristen geizten nicht mit Trinkgeld, wenn sie in der ihnen vertrauten Sprache bedient wurden. Auf ihren Streifzügen durch Wiesbadens Innenstadt fühlte sie sich verloren. Wenn sie durch die überbreiten Straßenzüge irrte, sehnte sie sich nach Geronas Gassenschluchten, in denen sie als Kind gespielt hatte. Wie fehlte ihr der tosende Klang der Glocken von Santa Maria! Sie erinnerte sich, wie sie auf dem Weg zur Kathedrale ihre Finger in die Faust des Großvaters geschoben und an ihrem zehnten Geburtstag damit aufgehört hatte, um sich erwachsen zu fühlen. Nun war sie 20 Jahre alt und hätte alles dafür gegeben, es noch einmal tun zu können.
In der Rheinstraße stoppte eine Fußgängerampel ihren Marsch. Ungeduldig auf Grün wartend, tupfte sie sich mit dem Hemdsärmel über die Augen. Als ob die Heulerei etwas bringen würde. War es nicht ihre freie Entscheidung gewesen, mit nach Deutschland zu ziehen? Jorinde hatte sie nicht gedrängt – aber sie hatte sie spüren lassen, wie sehr sie sich freute. Die Mutter hatte sich, oh Wunder, wie immer in kühler Zurückhaltung geübt. Von jeher war Sonja eine Meisterin darin gewesen, die Verantwortung für das Kind abzuschieben. So hatte sie es immer gehalten und Ona der Großmutter überlassen, um sich auf ihre Karriere als Chirurgin zu konzentrieren. Der Vater, ebenfalls Mediziner, lebte in einer anderen Stadt, wo er eine eigene Familie hatte. Bei den wenigen Besuchen, deren Summe Ona an einer Hand abzählen konnte, war sie sich wie ein Alien vorgekommen: argwöhnisch belauert von den glotzäugigen Halbschwestern. Die bemühte Herzlichkeit von Papas neuer Frau hatte alles nur noch schlimmer gemacht.
Das grüne Ampelmännchen leuchtete auf. Im Pulk überquerte Ona die Straße. Sprachfetzen, die sie von den Passanten aufschnappte, klangen in ihren Ohren wie geschredderte Urlaute. Wie sehr sie den ratternden Singsang ihrer Heimat vermisste! Ein Problem der Ästhetik, nicht des Verständnisses. Das Deutsche war ihr geläufig. In der Überzeugung, eine Fremdsprache ließe sich zu keiner Zeit leichter lernen als in der Kindheit, hatte Jorinde sich oft in ihrer Muttersprache mit Ona unterhalten. Deutsche Literatur, Spielfilme und TV-Serien taten ihr Übriges. Seit Ona in Wiesbaden lebte, geschah es immer seltener, dass sie im Kopf einen Satz von einer Sprache in die andere übersetzen musste. So hätte sie temperamentvoll auf Deutsch lossprudeln können, wenn, ja wenn überhaupt jemand ein Wort für sie übriggehabt hätte. Außer ihrer Großmutter und Jeanne unterhielt sich niemand mit ihr. Halfen Tränen gegen die Verlorenheit? Ach, heul doch! Je lebhafter das Treiben ringsum, desto verlassener fühlte sie sich. Seltene persönliche Begegnungen erschienen ihr in der Erinnerung wie kostbare Geschenke. Enttäuscht trauerte sie dem kurzen Zusammentreffen auf dem Campus der Hochschule nach. Spontan hatte ihr eine Studentin einen Flyer in die Hand gedrückt. Bevor Ona hatte nachfragen können, was es mit der Initiative »AntiCar aktiv« auf sich hatte, war die andere von einer Gruppe junger Leute umlagert worden. Ona hatte sich übergangen gefühlt und nicht den Mut gefunden, sich dazwischenzudrängen. Beim nächsten Mal, so hatte sie sich geschworen, würde sie sich nicht beiseiteschieben lassen. Gegen zu viele Autos war sie doch auch!
Derart mit sich selbst beschäftigt, wäre sie beinahe in eine Menschentraube hineingelaufen. Genauer betrachtet war es ein Demonstrationszug. Mit ernsten Gesichtern trugen die Teilnehmer Schilder und Transparente vor sich her. Als Ona abrupt stoppte, strauchelte jemand hinter ihr. Der junge Mann war ihr offenbar ausgewichen, dabei über einen Bordstein gestolpert und auf die Knie gestürzt. Bevor sie eine Entschuldigung stammeln konnte, hatte sich der Mann aufgerappelt und war mit leisem Fluchen davongeeilt.
Sie schaute sich um. Der Zug war ins Stocken gekommen. Es waren überwiegend jüngere Leute, die sich zusammengetan hatten, um ihrem Widerstand gegen den Autokollaps in der Stadt Gehör zu verleihen.
»Schluss mit Suff!«, kreischte ein Mädchen in der Nähe. »Schluss mit Suff!«
Richtig, dachte Ona zustimmend. Alkohol ist nie eine Lösung, und schon gar nicht am Steuer. Die drei Buchstaben »SUV« auf dem Stück Pappe, das der Demonstrantin an einem Bindfaden um den Hals schlackerte, klärten bei näherer Betrachtung das Missverständnis auf.
Als sie weitergehen wollte, stieß Ona mit der Fußspitze gegen etwas Flaches, Hartes und entdeckte am Boden ein Smartphone in einer schwarzen Kunststoffhülle. Rasch bückte sie sich nach dem Fundstück. Ob es dem jungen Mann aus der Tasche gerutscht war? Was hatte er angehabt? Irgendetwas Dunkles. Eine schwarze Jacke? Angestrengt hielt sie nach ihm Ausschau, während sie sich von der Menge, die wieder in Bewegung geraten war, auf einen großen Platz mitziehen ließ. Dass sie den Gesuchten schnell erspähte, war kein Hexenwerk. Er hatte einen roten Steinsockel erklommen und stand dort unter dem Bauch eines mächtigen Bronzepferds, das seine Vorderbeine stolz in die Luft warf. Und noch jemanden erkannte Ona im Näherkommen. Die rundliche junge Frau – ganz in Schwarz gekleidet –, die dem Mann auf dem Sockel ein Mikrofon hinaufreichte, war niemand anders als jene AntiCar-Aktivistin, die sie auf dem Campus angetroffen hatte. Die Dunkelhaarige wandte sich einem blonden Mädchen und einem Mann mit sandfarbenen Dreadlocks zu. Die drei schienen sich gut zu kennen, so vertraut, wie sie miteinander sprachen. Der Mann machte wohl eine amüsante Bemerkung, denn er lächelte breit. Die Frauen kicherten glucksend.
Der Denkmalkletterer klopfte auf das Mikrofon und begrüßte die Menge. Schnell strömten die Menschen heran. Zögerlich zuerst, dann zunehmend mutiger verkündete der Redner seine Vision einer lebenswerten City. »Autos raus aus der Stadt!« Ona gefiel, was er sagte, und sie vernahm auch ringsherum eine breite Zustimmung. Dennoch waren nicht alle Anwesenden der Meinung, dass man den Individualverkehr aus den Wohnstraßen verbannen sollte. Ein Stück abseits erregte sich eine Gruppe von Leuten, die den Redner mit groben Kommentaren verhöhnte und wüst beschimpfte. Ona atmete auf, als sich eine Schar Polizisten abschirmend zwischen den Lagern formierte.
Der Aktivist klammerte sich unbeirrt an einem der hoch erhobenen Vorderbeine der Statue fest, die andere Hand reckte er zur Faust geballt kämpferisch in den Himmel. Mit einem Dank an die Zuhörerschaft beendete er seinen Vortrag und stieg unter beifälligem Applaus von dem Podest herunter. Unten wurde er sofort von den Umstehenden umringt. Eine ältere Frau klopfte ihm wie einem Pferd anerkennend auf den Rücken. Während Ona darauf wartete, dass sich der Trubel legte, beobachtete sie den Dreadlocks-Träger, der gemeinsam mit dem Mädchen vom Campus Flyer an Interessierte verteilte und deren Fragen beantwortete. Sein Name war Nick, wie sie aus den Gesprächen heraushörte.
Endlich löste sich der Trubel um den Redner auf. Ona sprach ihn begeistert an. »Mega, was du gesagt hast!«
Er lächelte routiniert und bedankte sich, bevor er sie erkannte: »Die Frau, die im Weg stand!« Mit schiefem Grinsen wies er auf das Dreieck, das über dem Knie im Jeansstoff klaffte. Die Haut darunter war gerötet.
»Sorry. Vielleicht kann ich es wiedergutmachen.« Sie hielt ihren Fund hoch. »Hast du das verloren?«
Erschrocken klopfte er die Jacken- und Hosentaschen ab. »Krass, habe ich gar nicht bemerkt. Das wär’s gewesen, meine kompletten Daten … danke dir!«
»De nada! Tschüss!«
»Halt, warte! Darf ich dich nachher … magst du einen Kaffee oder so?«
Ihre Blicke trafen sich. Haselnussbraune Augen. Igelfrisur von identischem Farbton. Auf der Stupsnase und den Wangen sammelten sich Sommersprossen, was ihm einen kindlichen Ausdruck verlieh.
»Wir gehen nachher zusammen was trinken«, sagte er, als sie zögerte. »Wenn du Zeit hast …«
Sie deutete auf ein Transparent. »Mit ›wir‹ meinst du die Leute von AntiCar aktiv?«
»Klar, wir wuppen das hier zusammen. Die Demo und das alles ist unser gemeinsames Ding.«
Ona deutete mit dem Kinn auf den Mann mit dem Dutt. »Also gehört Nick zu euch?«
»Sicher! Nick, Marleen, Jule und einige andere. Ich heiße Lennart. Kommst du mit?«
Ohne den Blick von Nick zu lösen, nahm sie Lennarts Einladung an.
4
Eiligen Schrittes erreichte Norma das Rheingauviertel und achtete unterwegs auf die Flächen unter den Baumkronen. Anders als in der Adolfsallee waren die Bereiche in diesen Straßen weitgehend unbeeinträchtigt von den Hinterlassenschaften der Vogelscharen. Sie musste sich sputen. Luigi Milano wartete nicht gern. Vor allem, wenn es ums Essen ging, konnte er schnell ungehalten werden. Der Kriminalhauptkommissar liebte es, den Grantler zu geben. Seine Frotzeleien riefen wie aufs Stichwort Dirk Wolfert auf den Plan, um den vermeintlichen Zwist zu schlichten. Wolfert fühlte sich leicht gedrängt, Partei für Norma zu ergreifen, selbst wenn sich Milano nur einen ruppigen Spaß erlaubte. Für den Spruch, dass Gegensätze sich anziehen, waren die Männer der beste Beweis. Nach ihrem Abschied aus dem Polizeidienst hatte Norma die ehemaligen Kollegen aus dem Kommissariat nicht aus den Augen verloren. Sie schätzte ihre Freunde trotz ihrer Schrullen. Auf einen Umstand konnte sie sich immer verlassen: Langeweile kam mit ihnen niemals auf. Einmal im Monat trafen sie sich zum Abendessen. Dieses Mal hatte Milano das Restaurant ausgesucht – sehr neu, sehr schick, sehr italienisch, wenn man der Webseite Glauben schenken durfte. Gespannt darauf, inwieweit Küche und Service den Ansprüchen des Kommissars standhalten würden, näherte Norma sich dem Ziel.
Wie eine Wegmarke erschien ihr eine gelbe Raute, die von der Innenbeleuchtung des Restaurants auf das Pflaster geworfen wurde. Der Lichtschein fiel auf ein Fahrzeug, das mitten auf dem Gehweg stand. Ganz schön frech, bis vor die Tür zu rollen, ärgerte sich Norma, die im Innern des Autos niemanden entdeckte. Kopfschüttelnd schlängelte sie sich an dem Wagen vorbei und betrat den Gastraum. Die Freunde waren vor ihr eingetroffen. Von einem Tisch am Fenster winkte Wolfert freudig herüber. Wie nicht anders zu erwarten, entsprach sein Auftritt im dunkelblauen Hemd, mit dezenter Krawatte und hellgrauem Sakko rundum der Eleganz des Schauplatzes. Sogar an ein Einstecktuch hatte er gedacht.
Sie trug ihre Lieblingsjeans und hatte diese mit Bluse und Blazer aufgehübscht. Wolfert sprang auf und rückte den dritten, noch freien Stuhl zurecht. Milano brummte ihr einen Gruß entgegen. Aufgrund der ihm eigenen Düsternis wirkte er inmitten des edlen Restaurants wie ein Wesen von einem anderen Stern. Ein Eindruck, den die abgeschabte Kordhose und das knittrige, den massigen Bauch umspannende Poloshirt unterstrichen.
»Habt ihr mitbekommen, wer draußen so dämlich geparkt hat?«, fragte sie, nachdem sie Platz genommen hatte. »Ein Gast von hier?«