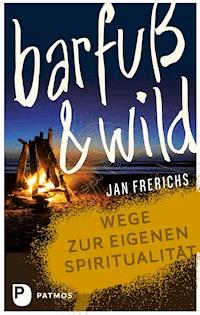Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die WILDE KIRCHE hat es immer gegeben. Ihre Kathedralen sind Wälder, Berge, Täler, Flussufer, Wüsten und der Ozean. Ihre Gläubigen pflegen seit Urzeiten eine innige Beziehung zur Erde und zu allen Geschöpfen. »Wild« heißt diese Kirche nicht, weil sie ungestüm oder chaotisch wäre. Sondern weil sie draußen ist, ungezähmt, voller ursprünglicher Lebenskraft und unausrottbar. Dieses Buch ist für Menschen geschrieben, die ihre spirituelle Heimat verloren haben. Die sich im konventionellen Christentum und in der Institution Kirche nicht mehr zu Hause fühlen – und diese Wurzeln dennoch nicht einfach abschneiden wollen. Die sich weder bei Konservativen noch bei Progressiven einordnen, weil es ihnen um mehr als »die Kirche« geht. Weil sie ahnen, dass die spirituelle Obdachlosigkeit, die sie erleben, gar nicht bloß das Problem, sondern ein Teil der Lösung sein könnte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Zu diesem Buch
ERFAHRUNGGeschichten erzählen –das Herz der Wilden Kirche schlagen hören
Auf der Suche nach dem Ursprung
Das Herz der Wilden Kirche
Vom Zuschauer zum Zeugen
Statt vieler Erklärungen: Eine Geschichte
Meine (Wieder-)Entdeckung der Wilden Kirche
Die Reise
Der Wendepunkt
Das Kloster im Wald
Ein Gespräch, das alles verändert
Mit Bruder Wind beten
Mit Schwester Wasser beten
Mit Bruder Feuer beten
Mit Mutter Erde beten
Der Regenbogen
Die Rückkehr
REFLEXIONDie Seele entkolonialisieren –Raum schaffen für die Wilde Kirche
01 Die Zivilisation abstreifen
02 Entkolonialisierung der Seele
03 Folgen der (spirituellen) Kolonialisierung
04 Wilde Kirche als herrschaftsfreier Raum
05 Wer ist »wir« in der Wilden Kirche?
06 Wildnis als Ort spiritueller Erfahrung
07 Das Universum ist in uns
08 Da sein
09 Wildnis als Grundlage unserer Existenz
10 Unsere ursprüngliche Wildnis ist der Wald
11 Die Kunst, in den Spiegel der Natur zu schauen
12 Keine Zuschauer, bitte (erste und zweite Bibel)
13 Geschichten als Brücke zur Weisheit
14 Die Ursprache der Menschheit wieder lernen
15 Wilde Spiritualität
16 Von der Entspannung zur Entspanntheit
17 Ursünde
18 Ursegen
19 Geburtlichkeit
20 Panentheismus
21 In Gott sein
22 Die große und die kleine Tradition
23 Herbst – die Essenz des Lebens feiern
24 Winter – die Rückkehr des Lichts feiern
25 Frühling – das Neuwerden feiern
26 Sommer – die Fülle des Lebens feiern
27 Jahreskreis als Initiation
28 Wildnis ist der maßgebliche Ort für Initiation
29 Welche Folgen es hat, wenn Initiation fehlt
30 Warum niemand in die Wilde Kirche gehen kann
31 Wilde Kirche versus Institution
PRAXISDas Feuer hüten –Handwerkszeug für die Wilde Kirche
Woran man die Wilde Kirche erkennt
Der Rahmen selbst ist nicht die Wilde Kirche
Wo finde ich die Wilde Kirche (und wo nicht)?
Den Weg des Kreises gehen
Auf die Stille hören
Singen
Von Herzen schreiben
Von Herzen zuhören
Von Herzen sprechen
Die Sitzordnung
Den Raum gestalten
Der Redegegenstand
Richtlinien für das Kreisritual
Der Rahmen: Eröffnung und Abschluss
Umgang mit Störungen
Kreis-Formate
Themen im Kreis
Die erste Bibel lesen
Einen Schwellengang unternehmen
In den Spiegel der Natur schauen
Die Erfahrungen im Kreis teilen
Geschichten im Kreis spiegeln
Die zweite Bibel lesen
Die Wahrheit zwischen den Zeilen
Beispiel: Geschichte einer Dämonenaustreibung
Empfehlungen für Auswahl und Vorbereitung
Die Feuerhüter-Meditation
Am Ende: Der Sonnengesang
TEXTNACHWEIS
ÜBER DEN AUTOR
ÜBER DAS BUCH
IMPRESSUM
HINWEISE DES VERLAGS
Bonus zum Buch
(Bilder, Audio- und Videomaterial, Literaturempfehlungen u. a.) unter:
https://wildekirche.online
Zu diesem Buch
Die Wilde Kirche hat es immer gegeben. Ihre Kathedralen sind Wälder, Berge, Täler, Flussufer, Wüsten und der weite Ozean. Ihre Gläubigen pflegen seit Urzeiten eine innige Beziehung zur Erde und zu allen Geschöpfen und sie betrachten sich als Kinder des wilden Gottes und der zärtlichen Mutter Erde. Alle sind Geschwister. Es gibt keine Hierarchie. Es gibt keine Dogmatik. Die erste Bibel der Wilden Kirche ist die Schöpfung mit all ihren Kreaturen, Erscheinungen und Kreisläufen, und es ist eine alte Kunst, diese Bibel zu lesen. Sie ist ein Spiegel für unsere Seelen. Es ist Zeit, wieder heimisch zu werden in dieser Kirche, denn die Erde leidet und braucht uns.
Die Rückkehr in die Wilde Kirche ist ein Prozess der Befreiung von Körperfeindlichkeit, Patriarchalismus, Klerikalismus und Egoismus. Die Wilde Kirche schafft Räume, um den Herzensgrund zu berühren und die zarten Bande der tiefen Beziehung wieder aufzunehmen und weiterzuknüpfen, die zwischen allen und allem besteht – »in Christus«, wie wir es in unserer Tradition ausdrücken. So können wir wieder eine Weltanschauung, eine Kosmologie entwickeln, die uns nicht abtrennt von allem, sondern mit allem verbindet.
Dieses Buch ist aus der Praxis entstanden. Es gründet in den Erfahrungen, die wir in den vergangenen Jahren in unseren Seminaren und Auszeiten in der Lebensschule bei barfuß & wild gesammelt haben. Das Buch erzählt von meiner und unserer (Wieder-)Entdeckung der Wilden Kirche – es ist keine umfassende Abhandlung oder Definition dieses Begriffs.
Nur so viel vorab: »Wild« heißt diese Kirche nicht, weil sie ungestüm oder chaotisch wäre. Sondern weil sie draußen ist, ungezähmt, nicht domestiziert, voller ursprünglicher Lebenskraft und unausrottbar.
Das Buch ist für Menschen gedacht, die ihre spirituelle Heimat verloren haben. Menschen, die sich im konventionellen Christentum und in der Institution Kirche nicht mehr zu Hause fühlen – und diese Wurzeln dennoch nicht abschneiden wollen.
Es ist für Menschen geschrieben, die sich weder bei Konservativen noch bei Progressiven einordnen wollen oder können, weil es ihnen um mehr als »die Kirche« geht. Weil sie ahnen, dass die spirituelle Obdachlosigkeit, die sie erleben, gar nicht bloß das Problem, sondern ein Teil der Lösung sein könnte. Weil ihre Entfremdung und Entbindung von der eigenen Tradition oder von bestimmten Teilen davon auch ein Ausdruck von persönlichem und spirituellem Wachstum ist. Und weil all das eine Einladung ist, die Verantwortung für den eigenen Weg zu übernehmen.
Das Buch ist für Menschen geschrieben, die sich nach echter, mitfühlender Gemeinschaft sehnen, die die üblichen konfessionellen Grenzen weit übersteigt. Eine Gemeinschaft nämlich, die weit in die mehr-als-menschliche Welt hineinreicht und die in Wahrheit dort wurzelt.
Schließlich ist das Buch für Menschen, denen das gegenwärtige Leid der Erde und aller Kreaturen nicht egal ist und die nicht nur Symptome bekämpfen, sondern an die Wurzeln gehen wollen.
Willkommen also zu einer spirituellen Entdeckungsreise, die bis in die Ursprünge der menschlichen Gemeinschaft zurückreicht. Vor etwa einer Million Jahren haben Menschen gelernt, das Feuer zu hüten. Das Feuerhüten ist in unsere menschliche DNA eingegangen – aber es bedeutet viel mehr, als bloß ein bisschen Holz zu verbrennen.
Am Feuer haben wir das Sprechen gelernt. Seit etwa 50.000 Jahren teilen wir unsere Erfahrungen und Geschichten, indem wir um ein Feuer herumsitzen. Lange bevor irgendjemand den ersten Buchstaben geschrieben hat, haben Menschen auf diese Weise ihr Wissen und ihre Weisheit, kurzum: alles, was wichtig ist, weitergegeben und überliefert.
Wenn wir auf diese Weise das Feuer hüten, dann ist das ein universales Sinnbild für das Leben in seiner einfachsten und grundlegendsten Ausdrucksform. So wie die Erde um die Sonne kreist, die uns Wärme spendet und unser Leben erst möglich macht, so versammelt sich die Gemeinschaft der Familie und des Dorfes um ein Feuer oder später um den Herd, um in diesem Kreis Geschichten zu erzählen.
Viele, die zu uns kommen, hungern und dürsten nach einer solchen Erfahrung von Verbundensein. Und das heißt: nach einer Erfahrung von respektvoller, mitfühlender und nicht-exklusiver Gemeinschaft, die sie nicht entmündigt und ihnen die Autonomie nimmt, sondern die ihren Erfahrungen und ihrer subjektiven und individuellen Wahrheit Raum gibt und sie anerkennt. Solche Gemeinschaften fallen nicht vom Himmel. Es braucht Menschen, die diese Räume schaffen und das Feuer im Kreis hüten. Auch das ist ein Ziel dieses Buches: Es will zur Praxis führen und das grundlegende Handwerkszeug beschreiben, um eine solche Art von Gemeinschaft zu ermöglichen und zu pflegen.
Wenn du dich also in all dem wiederfindest, vielleicht auch nur in einigen Punkten, dann herzlich willkommen in der Wilden Kirche.
ERFAHRUNGGeschichten erzählen –das Herz der Wilden Kirche schlagen hören
Als ich einige Monate nach meinem 40. Geburtstag mitten in der Toskana auf einem Bio-Bauernhof irgendwo im Nirgendwo mit elf anderen Menschen in einem provisorisch zusammengezimmerten Seminarraum Platz nahm, ahnte ich nicht, wie grundsätzlich die folgenden Tage mein Leben verändern würden. Eine Freundin hatte mir von ihrer Visionssuche erzählt, und ich wusste nur: Das will ich auch. Und so hatte ich mir so eine Visionssuche zum Geburtstag gewünscht. Mit dem Begriff konnte damals niemand in meinem Umfeld etwas anfangen, und schon gar nicht hätte jemand sich so etwas zum Geburtstag gewünscht: Vier Tage und vier Nächte allein, fastend, ohne Dach über dem Kopf in der Wildnis – das wäre den meisten wie eine Strafe vorgekommen. Oder wie eine Art Überlebenstraining.
Eine Visionssuche ist aber kein Überlebenstraining. Und schon gar keine Strafe. Was es aber genau ist, was mich da in die Wildnis lockte, konnte ich auch nicht erklären.
Und so saß ich damals in jenem Kreis und wusste nur: Etwas in mir will da hinausgehen. Es zog mich auf geheimnisvolle Weise in die Natur, obwohl ich überhaupt kein Pfadfindertyp bin und die Dunkelheit bis dahin geflissentlich gemieden hatte.
Ich ahnte jedoch, dass diese Tage und Nächte mir die Möglichkeit geben würden, etwas Ursprüngliches zu berühren. Da war ein inneres Bild: Ich allein draußen in der Natur – und diesem inneren Bild folgte ich.
Auf der Suche nach dem Ursprung
Diesen mächtigen Wunsch, etwas Ursprüngliches (und damit »die Wahrheit«) zu berühren, kannte ich schon. Aus diesem Wunsch heraus war ich nach dem Zivildienst Franziskaner geworden und hatte dann als junger Mann begonnen, Theologie zu studieren. Ich habe allein ein halbes Jahr lang nichts anderes getan, als Hebräisch zu büffeln, um die Texte der Bibel in der Originalsprache lesen zu können. Ich hoffte, auf diese Weise dem Ursprung und damit der Wahrheit näherzukommen. Ich erinnere mich noch gut an das Gefühl, etwas ganz Großem auf der Spur zu sein. Mit diesem Gefühl saß ich in der ersten Hebräisch-Stunde und hing an den Lippen meines Lehrers: »Stellen Sie sich vor, 5000 Jahre vor Christus geht irgendwo im Orient die Sonne auf und jemand sagt jom; das ist Hebräisch und heißt Tag.«
Ich las mit Begeisterung in der hebräischen Bibel. Mit dem Gefühl, jetzt wirklich das Original zu berühren. Bis ich erfuhr, dass diese hebräische Textfassung nur ein bisschen mehr als 1000 Jahre alt war. Was Menschen vor 5000 Jahren wirklich bewegt hat, wissen wir schlicht nicht, denn wir haben keine schriftlichen Zeugnisse von ihnen. Wir haben nur jüngere Abschriften, wenn überhaupt. Irgendwann wurde mir klar, dass ich auf diesem Weg – von außen – dem Ursprung nicht näherkommen konnte.
Ähnlich und noch schwieriger ist es mit den vorchristlichen Traditionen. Die Kelten zum Beispiel haben gar nichts aufgeschrieben. Keltische Schriftquellen stammen alle aus der christlichen Zeit. Und die Bezeichnungen der keltischen Feste wurden im 19. Jahrhundert (!) festgelegt. Ob und wie die Kelten also »Samhain« oder »Beltane« gefeiert haben, ob sie wirklich einen Baumkalender hatten – all das wissen wir überhaupt nicht aus Originalquellen, sondern können es uns nur erschließen. Ich will damit nicht sagen, dass die Beschäftigung mit der hebräischen Bibel oder mit keltischen oder anderen Traditionen unsinnig wäre. Im Gegenteil. Ich will nur sagen, dass wir von außen nicht zum Ursprung gelangen. Wissen allein hilft uns jedenfalls dabei nicht. Ganz gleich, wie tief wir in die Historie eines Textes oder einer Tradition eintauchen, den Ursprung können wir auf diesem Weg nicht berühren.
So ist mir damals schmerzlich bewusst geworden, dass ich im Grunde trotz allen Studierens ein Zuschauer war. Rückblickend weiß ich, was ich damals als junger Franziskaner eigentlich gesucht habe: eine eigene unmittelbare Erfahrung. Und weil niemand diese Erfahrung durch ein Studium finden kann, braucht es einen anderen Zugang. Das ist wohl auch der Grund, warum ich damals eine Pilgerreise unternehmen wollte von Münster in Westfalen, wo ich studierte, bis nach Jerusalem. Heute würde ich sagen, dass ich dadurch intuitiv den Raum geschaffen habe für eine Initiation, eine Einweihung, nach der meine Seele schon lange gedürstet hatte.
Ich machte mich irgendwann im Sommer 1998 auf den Weg und kam immerhin bis Assisi. Dort endete die Reise aus Gründen, von denen noch die Rede sein wird. Nach dieser Erfahrung verließ ich den Orden. Ich erlernte einen Beruf, gründete eine Familie, und die Suche, die mich hatte aufbrechen lassen, trat in den Hintergrund. Eine einmal begonnene Initiation lässt sich allerdings nicht einfach aufhalten. Der Same liegt im Boden und wartet auf den Zeitpunkt zum Keimen. Irgendwann nahm ich den Faden wieder auf und entdeckte die Visionssuche. Die 16 Jahre zwischen meiner Pilgerreise und meiner Visionssuche, der »Quest«, kommen mir heute vor wie eine Odyssee mit vielen scheinbaren Irrwegen und Sackgassen, die schließlich doch auf wundersame Weise »nach Hause« geführt haben.
Das Herz der Wilden Kirche
Da saß ich nun an jenem Abend in der Toskana. Ich weiß kaum mehr ein Wort von dem, was an jenem ersten Abend und in den folgenden Tagen in diesem Kreis gesprochen wurde. Worte waren nicht das Entscheidende in diesen Tagen. Und das war neu für mich. Sie waren aber auch nicht unwichtig. Und so ist mir die Geschichte einer Teilnehmerin sehr deutlich in Erinnerung geblieben, die sie in diesem Kreis am ersten Abend erzählte. Und sie ist mir deshalb in Erinnerung geblieben, weil ich kein Wort davon glauben konnte.
Zur Vorbereitung auf ihre Visionssuche hatte die Frau einige Zeit in der Natur verbringen wollen. Dafür war sie in den nahegelegenen Wald aufgebrochen. Sie war allerdings nie dort angekommen, erzählte sie, denn schon an der Landstraße, an einer Bushaltestelle, seien ihr Menschen in weißen Gewändern begegnet. Denen sei sie gefolgt in einen versteckten unterirdischen Raum. Dort brannte ein Feuer und alles war bereitet für ein Ritual, an dem sie spontan teilnahm. Es habe sich alles sehr stimmig angefühlt, obwohl sie mit »so was« eigentlich nichts anfangen könne.
Wie gesagt: Ich konnte kein Wort davon glauben. Das sollte wirklich so passiert sein? Wo gibt’s denn so was? Und überhaupt: Was sollen denn das für Leute gewesen sein? Eine Sekte? Worum ging es denn in diesem Ritual genau? Wieso hatten die Leute nichts dagegen, dass die Frau einfach so dabei war?
An diesem ersten Abend in der Toskana lernte ich eine wichtige Lektion. Und ich spürte den Herzschlag der Wilden Kirche. Dieses Herz hatte schon immer geschlagen und wird auch immer schlagen. Ich hatte es bloß nicht bewusst wahrgenommen und hätte es auch nicht so benennen können.
Ich erwartete natürlich eine Intervention der Ältesten, die die Visionssuche leiteten. Sie würden diese Geschichte sicher in Frage stellen, denn sie klang absolut unglaubwürdig. Das Gegenteil geschah. Statt den Beitrag dieser Teilnehmerin zu kommentieren oder zu diskutieren, nahmen die Ältesten jedes einzelne Wort der Frau offensichtlich sehr ernst. Die Geschichte wurde genauso gespiegelt, wie die Frau sie erzählt hatte. Und noch mehr: Im Spiegel bekam die Geschichte plötzlich einen tieferen Sinn. Und auch wenn ich mich nicht mehr erinnern kann, worin genau dieser Sinn bestand, so kann ich mich doch sehr deutlich an das Gefühl erinnern, die Frau auf eine tiefe Weise gesehen und verstanden zu haben. Es hatte einen Grund, warum die Frau genau diese Geschichte genau jetzt und genau so erzählte, und dieser Grund war in diesem Kreis berührt, gewürdigt und bezeugt worden. Das Ganze machte Sinn. Jetzt und hier machte das Ganze Sinn.
Heute bin ich selbst Visionssucheleiter und würde eine Geschichte wie die obige im Rahmen einer Visionssuche nicht mehr in Frage stellen. Wenn zum Beispiel eine Person erzählt, dass in der Auszeit ein großer Adler gekommen sei und sich auf ihrer Schulter niedergelassen habe, dann könnte ich natürlich sagen: Hier gibt es überhaupt keine Adler und sie setzen sich uns auch nicht auf die Schulter. Sag mir also, was »wirklich« passiert ist. Aber damit würde ich der Bedeutung dieser Geschichte und dem Menschen, der sie erzählt, nicht näherkommen. Denn selbst wenn der Adler nur in der Fantasie dieser Person erschienen ist – wie in einem Traum –, handelt es sich ja dennoch um eine Erfahrung, die eine Bedeutung haben kann. Also: Was bedeutet es für diese Person, dass der Adler auf ihrer Schulter gelandet ist? Was bedeutet es ganz subjektiv für diese Person, die es erzählt, in dem konkreten Kontext, in dem sie sich gerade jetzt in ihrem Leben bewegt? Was wird durch diese Erfahrung bezeugt oder gestärkt?
Deshalb spielte es damals in jenem Kreis auch keine Rolle, ob das unterirdische Ritual tatsächlich so passiert war. Es war eine Vision. Ein inneres Bild. Und wenn man so will, ist jede persönliche Erfahrung, von der ich erzähle, jede Zuschreibung, die ich mache (ein dunkler Wald, ein friedlicher Wald), eine Er-Innerung im wahrsten Sinne des Wortes, sprich: ein inneres Bild, denn ich betrachte die Wirklichkeit immer subjektiv durch meine persönliche Brille. Dass eine Geschichte sich nicht so zugetragen hat, wie sie erzählt wird, heißt nicht, dass sie nicht trotzdem wahr sein kann.
Vom Zuschauer zum Zeugen
Die Begebenheit in der Toskana war für mich deshalb so bedeutend, weil ich an jenem Abend vom Zuschauer zum Zeugen geworden war. Als Theologe hatte ich mich schon immer mit »unglaublichen« Geschichten beschäftigt, die traditionell überliefert werden. Und wenn ich ehrlich bin, hatte ich mich mit ihnen herumgeschlagen: Da werden Meere geteilt, Tote leben wieder und Unfruchtbare werden schwanger. Und mir ist an jenem Abend klar geworden, dass die Geschichten der Schlüssel zu allem sind, und genau deshalb war und bin ich Theologe: Mein Beruf ist die Rede (logos) von Gott (theos) – und dafür braucht es Geschichten. Gott ist ja letztlich ein Codewort für alles, was unser Begreifen übersteigt. Das heißt, wenn wir Gott sagen, meinen wir mehr, als wir uns konkret vorstellen können. Jeder Versuch, Gott festzulegen, schlägt fehl. Wenn ich Gott habe, ist es nicht mehr Gott. Geschichten ermöglichen jedoch, das Unbegreifliche zu berühren und zu begreifen, ohne es zu ergreifen. Vielmehr ergreift es mich – das ist das Geheimnis. Und das war und ist dieses geheimnisvolle Ursprüngliche, was ich 16 Jahre und länger gesucht hatte.
Statt vieler Erklärungen: Eine Geschichte
Deshalb werde ich dir jetzt auch eine Geschichte erzählen. Meine Geschichte. Sie handelt von meiner Initiation in die Wilde Kirche. Die äußeren Fakten sind in dieser Geschichte sekundär. Alles an dieser Geschichte ist »wahr« in einem tieferen Sinn. Die 16 Jahre zwischen meiner Pilgerreise und der Quest sind in dieser Erzählung auf einige Wochen und Tage verdichtet, denn es würde nicht nur den Rahmen sprengen, diese 16 Jahre hier nacherzählen zu wollen, die reinen Fakten würden auch nicht wirklich dazu beitragen, dir etwas Wesentliches von meiner subjektiven Erfahrung zu vermitteln. Fakten transportieren Wissen. Die Weisheit aber, die sich in diesen 16 Jahren wie eine Perle in mir geformt hat, braucht eine Geschichte.
Das bedeutet auch, du musst nicht an meine Geschichte »glauben«. Ich möchte vielmehr den Raum bereiten für deine eigene Erfahrung dessen, was wir »das Heilige« nennen. Diese Erfahrung ist das Eingangstor in die Wilde Kirche. Die Frage ist dabei niemals, ob es geschieht, sondern nur, ob du es auch wahrnehmen kannst.
Nehmen wir also an, das Folgende wäre so passiert …
Meine (Wieder-)Entdeckung der Wilden Kirche
Vor vielen Jahren lernte ich zu beten. Nicht mit Worten, wie man es als Kind lernt. Ich lernte zu beten, ohne Worte zu verwenden. Mit dem Herzen. Und mit Füßen und Händen und mit dem Hintern auf der Erde. Ich lernte, dass und wie mein ganzes Dasein und Sosein mit allem, was mich ausmacht, Gebet sein kann.
Damals studierte ich Theologie. Das Studium hatte meinen Kinderglauben aufgelöst wie ein Säurebad und bereits meine Seele angegriffen. Ich wusste nicht mehr, was ich glauben konnte und sollte. Ich zweifelte an allem, was bisher als gewiss erschienen war.
Gott war für mich ein Fragezeichen geworden. Ein leeres, verbrauchtes und abgegriffenes Wort, das nur noch eine bedrohliche Sinnentleerung verhüllte. Das schöne, warme Gefühl im Bauch beantwortete meine Fragen nicht mehr.
Ich spürte zunehmend eine Abwesenheit Gottes. Wo war Gott in der Katastrophe? Wo war Gott, wenn Menschen an Hunger starben? Wo war Gott im Krieg, in der Diktatur, in Ausbeutung und Terror? Wo war Gott, als Millionen Juden in den Gaskammern starben? Getötet von Christen. Wo war Gott, als die amerikanischen Ureinwohner zusammengetrieben und abgeschlachtet wurden? Getötet von Christen. Wo war Gott, als der sogenannte Heilige Bonifatius die uralte Donareiche fällte, um zu beweisen, dass sie nicht göttlicher Natur war, und damit den Grundstein legte für die Entheiligung der mehr-als-menschlichen Welt und ihre gewaltsame Ausbeutung und Zerstörung? Ausgebeutet und zerstört von Christen.
Wie konnte ich noch Christ sein angesichts der unheiligen Schandtaten, die meine Vorfahren verübt hatten? Wie konnte ich Christ sein, wenn das Christentum, das die Menschwerdung Gottes verkündete, dafür missbraucht worden war und immer noch wurde, um Rassismus, Antisemitismus, Sklaverei und Naturzerstörung zu rechtfertigen?
Wie konnte ich noch Katholik sein, wenn ich damit Teil einer Institution war, die dieser Abwesenheit Gottes nicht nur nichts entgegenzusetzen hatte, sondern auch noch dazu beigetragen hatte und weiterhin zur Scheinheiligkeit beitrug? Ja, scheinheilig kam mir alles vor. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: Mir war das Heilige verlorengegangen. Ich war in eine spirituelle Obdachlosigkeit gestürzt und fühlte mich heimatlos.
Noch dazu war ich damals ein junger Franziskaner und hatte immer mehr Mühe, das äußere Bild des »Geistlichen«, das ich abgeben wollte – oder meinte, abgeben zu müssen –, und meine Fragen und Zweifel und die innere Leere miteinander in Einklang zu bringen. Ich konnte nicht mehr beten, weil ich einfach keinen Sinn mehr darin sah. Ich empfand die Gemeinschaft der Brüder in dem kleinen Konvent, in dem ich zu der Zeit lebte, zunehmend als erdrückend. Die Brüder ihrerseits mieden mich und gingen irgendwann nicht mehr auf meine Fragen ein – und ich verstehe das heute sehr gut, denn ich verbarg meine abgründige Leere hinter der Fassade eines intellektuellen Hochmuts, der dabei war, sich in Zynismus zu verwandeln, für den nichts mehr einen Sinn ergeben konnte. Und ich wusste keinen Ausweg aus der Verbitterung, die mich immer mehr ergriff.
Die Reise
Eines Tages packte mich eine Idee. Tief in der Seele. Wo war sie hergekommen? Ich weiß es nicht mehr. Früher hätte man gesagt, das sei der Ruf Gottes. Heute würden wir sagen, dass sie aus den Tiefen des Unbewussten aufgestiegen war, weil die Seele immer weiß, was gut und notwendig ist. Ich spürte jedenfalls, dass diese Idee mehr war als ein Strohfeuer. Sie versprach Heilung von meiner seltsamen Krankheit. Ich wollte eine Pilgerreise unternehmen. Nach Jerusalem. Ins Heilige Land. Zu Fuß und ohne Geld. Jerusalem war schließlich Tabbur haOlam, der Nabel der Welt, und genau da wollte ich hin, um Antworten zu finden.
Je länger die Idee zu einem praktischen Projekt heranreifte, desto mehr erfasste mich die Sehnsucht, eine echte spirituelle Erfahrung zu machen, ja ein frommes, aber auch zutiefst autonomes Opfer zu bringen. Ein Opfer, das sich jedem Vergleich entzog. Meine Familie hielt das für eine närrische und auch gefährliche Idee, aber ich fürchtete viel mehr, dass meine franziskanischen Brüder es für eine Art spirituellen Hochmut halten und deshalb nicht unterstützen würden. Zu meinem Erstaunen stimmte mein Ausbildungsverantwortlicher nicht nur zu, sondern drängte mich regelrecht, schon im Sommer desselben Jahres aufzubrechen. Ich sollte mir ein ganzes Semester Zeit nehmen für die Reise.
Damals sprach kaum jemand vom Pilgern. Santiago de Compostela war nicht interessanter als Jerusalem oder Rom. Und kaum jemand wollte zu Fuß an einen dieser Orte gelangen, geschweige denn ohne Geld. Ich aber war entschlossen, dem radikalen Beispiel meines geistlichen Meisters Franz von Assisi nachzufolgen. Auch ihn hatte es in den Orient gezogen. Heute wäre eine solche Reise, wie ich sie vorhatte, wahrscheinlich gar nicht mehr möglich. Damals jedoch konnte man Israel noch auf dem Landweg über die Türkei, Syrien und Jordanien erreichen. Ich entschloss mich, Assisi, die Heimat des Poverello, des kleinen Armen, wie Franziskus in Italien genannt wird, in den Weg hineinzunehmen. Das bedeutete allerdings, dass ich von Italien dann mit einem Schiff bis nach Griechenland würde fahren müssen. Dafür hatte ich etwas Geld tief unten in meinem Rucksack vergraben und wollte es vorher nicht anrühren. Aber ich kann schon jetzt sagen, dass meine Reise in Assisi zu Ende war, denn ich hatte alles, was ich suchte, gefunden, als ich dort ankam.
Der Wendepunkt
Ich war von Münster in Westfalen aufgebrochen, durch das Ruhrgebiet und dann den Rhein hinaufgewandert, durch die Schweiz über den Gotthard. Ich hatte den Comer See passiert und war südlich von Mailand auf die Via Francigena, den alten Franziskuspilgerweg, gestoßen, über den heute Bücher geschrieben werden, von dem ich aber damals nichts wusste. Dort fuhr man mich mit einer Barke über den Po, und ein alter Pfarrer drückte mir einen Stempel in mein Notizbuch. Es gab sogar einen Fototermin. Wahrscheinlich für die Zeitung, denn es kamen offenbar nur selten Pilger, und so war jeder Einzelne ein Ereignis.
Kurzum: Es war ein Weg voller Wunder. Es war eine unglaubliche Reise. Weniger wegen äußerer Ereignisse wie der Po-Überfahrt. Mich hatte vielmehr die ungeheure Gastfreundschaft unzähliger Menschen, denen ich begegnet war, tief beeindruckt. Ich war bereit gewesen, die Nacht auch im Freien zu verbringen, wenn sich kein Unterschlupf finden sollte, aber es gab keinen Tag, an dem ich nicht irgendwo einem Menschen begegnete, der mich freundlich aufnahm, bewirtete und mir einen Schlafplatz anbot.