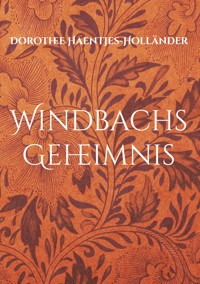
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schon ein paar Jahre hat die 34jährige Delphine Kunstmann an ihrer Dissertation über den Maler Emanuel Windbach geschrieben. Inzwischen aber muss sie sich eingestehen, dass sie die bahnbrechenden Ergebnisse, die sowohl sie sich erhofft hatte wie auch ihr Doktorvater, nicht erreichen kann. Statt einer erfolgreichen Promotion liegen Zukunftsängste vor ihr. Darüber hinaus hat Delphine nicht mal einen Partner, der ihr Mut machen könnte. In dieser trüben Situation erhält Delphine die Nachricht, dass sie geerbt hat. Das Haus ihrer Nachbarin Sidonie von Strawitz, mit der sie sich am Gartenzaun hin und wieder unterhalten hat. Ein Buch über die heilende Kraft eines Gartens, eines Zuhauses und über die Liebe zur Kunst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Winter hatte in diesem Jahr sehr früh begonnen. Bereits im November hatte es Frost gegeben. In der Dachgeschosswohnung war es eiskalt. Delphine fror. Das ewige Hocken am Schreibtisch ließ den Kreislauf einfach nicht auf Touren kommen. Seufzend trank sie einen Schluck Tee und mummelte sich tiefer in die Decken, die sie um ihre Schultern und über ihre Beine gelegt hatte. Seit Stunden starrte sie auf den Bildschirm ihres Computers. Vier Jahre schrieb sie nun schon an ihrer Doktorarbeit. „Natur und Ideal. Der Maler Emanuel Windbach im Spannungsverhältnis von Ästhetik und Moral“, so lautete der Titel. Windbachs Bilder liebte Delphine noch immer, trotz der Qualen, die sie ihr bescherten. Dennoch fragte sie sich allmählich, wie sie sich je für all das hatte entscheiden können: für einsame Stunden am Schreibtisch, für ergebnisloses Wühlen in Archiven und Bibliotheken und für die Aussicht, letzten Endes kaum ein auskömmliches Leben als Kunsthistorikern führen zu können. Es gab einfach zu viele in ihrer Zunft.
Ein Großteil ihrer Kommilitoninnen hatte sich inzwischen für die pragmatischste aller Lösungen entschieden: für das Heiraten und Kinderkriegen. Mit ihren 34 Jahren hätte Delphine auch für sich diese Lösung – zumindest als Zwischenlösung – nicht mehr ausschließen wollen. Allerdings standen die Männer im Augenblick vor ihrer Dachgeschosswohnung nicht gerade Schlange.
Delphines Blick wanderte zum Fenster. Wenigstens das hatte ihre eiskalte kleine Dachwohnung zu bieten: den Ausblick in die Wipfel alter Bäume und in die Gärten ihres Häuserblocks. Mit dem Frost aber schienen die Gärten erstarrt zu sein. Wie dürre, schwarze Finger sahen die entlaubten Äste der Bäume vor dem Grau des Winterhimmels aus. Kein Kind spielte auf den Klettergerüsten der zahlreichen jungen Familien rundum. Und auch Delphines Nachbarin mit dem unmittelbar angrenzenden Garten, die vom Frühjahr bis in den späten Herbst hinein so gut wie täglich in ihrem grünen Reich war, blieb angesichts der winterlichen Witterung wohl lieber im Haus.
Erst jetzt fiel Delphine auf, dass sie die alte Dame schon lange nicht mehr gesehen hatte. Sie hätte nicht behaupten können, sie gut zu kennen. Aber in den mittlerweile zehn Jahren, die Delphine nun schon hier wohnte, waren sie sich doch hin und wieder begegnet. Auf der Straße beim Einkaufen, oder auch wenn Delphine – selten genug – mit ihren Büchern auf dem vernachlässigten Stückchen Erde saß, das als „Garten“ zu ihrem Haus gehörte. Bei einer dieser Gelegenheiten, als sie gerade einen neuen Aufsatz von Ellen Brockstedt las, ihrer früheren Kommilitonin und heute ärgsten Konkurrentin in der Windbach-Forschung, war Delphine mit der Nachbarin ins Gespräch gekommen. Sie hatte sich sehr interessiert nach Delphines Lektüre erkundigt. Und fortan hatte Frau von Strawitz – so hieß die Nachbarin – bei jeder Begegnung freundlich bei Delphine nachgefragt: wie es mit der Arbeit voranging, wie ihre Zukunftsaussichten waren, und ob Delphine beabsichtigte, dauerhaft in ihrer Dachwohnung zu bleiben. Was im Grunde wohl hieß, ob Delphine denn keinen Freund habe, mit dem sie gelegentlich zusammenziehen wollte. Es waren Fragen, die Delphine auch von ihrer Mutter kannte. Allerdings wich sie ihnen bei dieser viel schneller aus. Sie spürte den Druck, der dahinterstand, die Sorge, die ihre Mutter um sie hatte. Nicht mal zu Unrecht, wie Delphine sich eingestehen musste. Bei Frau von Strawitz hingegen hatte sie das Gefühl, ehrlich antworten zu können und ihre eigenen Sorgen nicht verschweigen zu müssen. Und was besonders schön war: Frau von Strawitz stellte kluge Fragen zu Emanuel Windbach. Eine Gesprächspartnerin für Herz und Kopf!
Über die Nachbarin selbst wusste Delphine wenig. Nur dass sie um die achtzig sein musste, verwitwet war und keine Kinder hatte. Ihre einzige Gesellschaft war ihr Kater Nero. Ein Bild von einem Kater und tatsächlich rabenschwarz, bis auf eine einzige Stelle: ein rosa Fleck in den Ballen der rechten Vorderpfote, wie Frau von Strawitz erzählte, eine merkwürdige Laune der Natur.
In diesem Moment krächzte im knorrigen Apfelbaum der Nachbarin eine Krähe. Delphine sah hinüber und dachte gleichzeitig, dass sie auch Nero schon seit Wochen nicht mehr gesehen hatte. Bislang hatte sich noch keine Krähe gewagt, sich in seinem Reich so dreist aufzuführen! Jetzt drehte die Krähe den Kopf, und wenn Delphine nicht Realistin gewesen wäre, hätte sie geglaubt, der Vogel sehe sie an. „Mach die Fliege!“, rief sie der Krähe durch das geschlossene Fenster zu. Und tatsächlich hob die Krähe auf dem Ast ihre Flügel, drehte Delphine das Hinterteil zu, erleichterte sich kurz und flog davon.
„Blödes Vieh!“, schimpfte Delphine. Dann schälte sie sich aus ihren Decken. Die Krähe hatte sie erinnert, dass es Zeit war. Zeit, im Seminar Aufsicht während einer Klausur der Erstsemester zu führen und anschließend im Café zu bedienen. Davor allerdings noch – die dortigen Toiletten zu putzen. Selbst mit einem Stipendium war das Überleben als Doktorandin mühsam.
Die Uni lag mitten in der Stadt. Wie die Türchen eines Adventskalenders wirkten die erleuchteten Sprossenfenster des Barockschlosses in der bereits dämmrigen, weihnachtlich geschmückten City. In den Einkaufsstraßen herrschte reges Treiben. Menschen mit riesigen Plastiktüten hasteten von einem Geschäft zum anderen. Delphine hatte ihre Weihnachtseinkäufe längst erledigt. Kunststück – sie brauchte ja nur ein einziges! Ein Geschenk für ihre Mutter, bei der sie die Weihnachtstage verbringen und vom Moment ihrer Ankunft an die Stunden zählen würde, bis sie wieder wegfahren konnte. Eigentlich hatte sie ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter. Was sie aber nicht aushielt, war die stehengebliebene Zeit in ihrem Elternhaus. Nichts hatte sich verändert, seit sie bis zum Abitur hier gewohnt hatte. Ihr Zimmer sah noch immer aus wie zu ihrer Teenagerzeit, so wie das Schlafzimmer ihrer Mutter noch immer das Schlafzimmer ihrer Eltern war. Nur dass Delphines Vater seit fast fünfundzwanzig Jahren tot war. Die Blumenbeete sahen genauso aus wie damals, als sie als junge Familie hier eingezogen waren, und auch die Balkonkästen wurden seit Jahr und Tag genau gleich bepflanzt. Ihre zunehmende Sorge um die Zukunft ihrer Tochter versuchte Delphines Mutter mit dem Satz zu beschwichtigen: „Wenigstens hast du eines Tages mal das Haus.“ Bei der Vorstellung, später in der westfälischen Provinz leben zu müssen, graute es Delphine.
Dass sie kein Weihnachtsgeschenk für einen Freund kaufen musste, diesen Gedanken versuchte Delphine nicht an sich heranzulassen. Irgendwie hatte es bisher mit den Männern einfach nicht richtig geklappt. Der einzige Mann, mit dem sie seit Jahren kontinuierlich zu tun hatte, war Emanuel Windbach. Sicher hätte die Möglichkeit bestanden, sich durch eine flüchtige Bekanntschaft ein Kind zuzulegen. Aber die nächsten Jahre auch noch als Alleinerziehende zu leben – diese Idee lag für Delphine einfach jenseits aller Vernunft. Wirklich schade war allerdings, dass im Zusammenhang mit diesem Thema der Kontakt zu ihren Freundinnen in den letzten Jahren nach und nach eingeschlafen war. Sie waren allesamt Mütter geworden, und mit einem Mal hatten ihre Welten und die von Delphine nicht mehr zusammengepasst. Delphine hoffte, dass sie eines Tages wieder zueinanderfanden. Bis dahin aber musste sie sich mit der Rolle im Hintergrund und mit sporadischen Anrufen zufriedengeben.
Mit einem Mal schossen Delphine die Tränen in die Augen. Wenn sie jetzt noch länger nachdachte, käme sie an der Einsicht, gegen die sie tagsüber einigermaßen erfolgreich ankämpfte, kaum noch vorbei: Sie war einsam. Und sie hasste es, einsam zu sein.
Sie hatte noch ein kleines bisschen Zeit, und um sich abzulenken, blieb sie stehen und sah das nächstbeste Schaufenster an. Es war das Fenster der Universitätsbuchhandlung. Wie alle Geschäfte, hatte auch die Buchhandlung weihnachtlich dekoriert. Unter auf Karton gemalten Weihnachts-bäumen stapelten sich festlich verpackte Geschenke. Dazwischen lagen Bücher, deren Preis man in Gold auf weiße Engelsflügel geschrieben hatte. Ausgerechnet das Fenster mit den Kunstbänden hatte Delphine erwischt! Wieviel Spaß hätte es gemacht, hier nach Herzenslust einzukaufen! Aber erstens waren die Preise schwindelerregend. Zweitens: Wen wollte Delphine denn beschenken?
Ihr Blick blieb an einem mittelgroßen Buch hängen, auf dessen Titel eine Frau in antiken Gewändern den Betrachter mit betörend dunklen Augen ansah. Es war eine neue Publikation über Emanuel Windbach. Delphine kannte das Buch bereits. Es stammte aus der Feder ihrer Ex-Kommilitonin Ellen Brockstedt, einer nymphenhaften Gestalt mit dunklen Haaren und dunklen Augen, die selbstverständlich Kleidung trug, die, in einer modernen Variante, den Windbachgemälden entlehnt schien. Irgendwie war es ihr gelungen, für ihr wenig überzeugendes Werk einen Verleger zu finden, der das Buch in einer hohen Auflage zu einem Dumping-Preis anbot. Mit einer Mischung aus Ingrimm und Befriedigung hatte Delphine festgestellt, dass die lückenhafte Darstellung die entscheidenden Punkte in der Windbachforschung gänzlich vernachlässigte. Nämlich die Fragen nach nach dem Schicksal und Verbleib des verschollenen Bildes und dem Ursprung der wahrscheinlich Windbachuntypischen Aussage. Diese Fragen hatte die Wissenschaft trotz aller Anstrengungen bislang nicht beantworten können. Und an diesen nicht beantworteten Fragen drohte nun auch Delphines eigene Doktorarbeit zu scheitern. Dennoch, die im Buch abgebildeten Gemälde Windbachs, ihre Sehnsucht und ihre süße Melancholie, würden jeden Betrachter immer wieder begeistern und trösten, auch in den einsamsten Stunden. Und für ein breiteres Publikum – das musste Delphine zugeben – war das Buch dann doch ganz ordentlich gemacht.
Eine Idee durchzuckte Delphine. Sie war nicht der einzige Mensch auf Erden, der allein war. Und endlich wusste sie, für wen sie an diesem Tag doch noch ein Geschenk besorgen konnte. Als Dank für ein paar nette Worte, die sie am Gartenzaun oder auf der Straße gewechselt hatten. Zum Trost für vielleicht einsame Stunden in den Weihnachtstagen.
Sie ging in die Buchhandlung und kaufte das Buch. Für ihre Nachbarin. Für Frau von Strawitz.
Delphine hatte das Buch im Laden einpacken lassen. Auf diese Weise konnte sie gleich morgen früh damit bei Frau von Strawitz klingeln.
Nun saß Delphine auf dem altertümlichen Katheder im Hörsaal der Kunsthistoriker, wo die Erstsemester schon kurz vor dem Jahresende, drei Tage vor Weihnachten, ihre Klausur schrieben und gehörig schwitzten. Sie dachte daran, mit welcher Zuversicht und welchem Elan sie selbst vor vielen Jahren ihr Studium begonnen hatte – und wie aussichtslos ihre Lage ihr allmählich erschien. Sie hätte ihre Doktorarbeit längst fertig haben müssen. Stattdessen krebste sie immer noch damit herum, während Ellen Brockstedt, mit der sie damals zusammen in genau diesem Hörsaal gesessen und den ersten Vorlesungen gelauscht hatte, längst fertig geworden war und eben jene mittelklassige Publikation herausgebracht hatte, die Delphine gerade gekauft hatte. Jetzt schmuste Ellen mit Kunstbuchverlegern und ließ sich – wie Delphine von ebenso neidvollen Kommilitonen gehört hatte – horrende Vorschüsse zahlen, während Delphine Aufsicht über frisch geschlüpfte Kunstgeschichtsstudenten führte, die sie als Tutorin durch das Wintersemester begleitet hatte. Vielleicht wäre es besser gewesen, gleich eine Ausbildung als Erzieherin zu beginnen! Oder sich nicht neben der attraktiven Ellen Brockstedt auf das persönliche Steckenpferd ihres Professors einzulassen, auf ein Thema rund um das verschollene Bild des Malers Emanuel Windbach.
Als die Zeit um war, sammelte Delphine die Klausuren ein. Sie konnte die Herzen der jungen Kunsthistoriker förmlich schlagen hören, während sie ihr die Arbeiten in die Hand drückten.
Im Büro ihres Doktorvaters schloss Delphine die Klausuren in einem Schrank ein. Im Hinausgehen sah sie das Maßband, von dem der Professor jeden Tag einen Zentimeter abschnitt. Keine zweihundert Tage mehr, dann wurde Professor Erasmus pensioniert. Es war Zeit, dass Delphine eine Lösung fand. Für Emanuel Windbach – und für sich selbst.
Als Delphine an diesem Abend nach Hause kam, sah sie eher aus Routine in ihren Briefkasten. Der Großteil ihrer Korrespondenz – so sie denn überhaupt welche hatte – lief per Mail. Aber im Kasten lag tatsächlich ein Brief. Delphine nahm ihn heraus und sah nach dem Absender: „Notariat Dr. Martin Auerbach“ las Delphine stirnrunzelnd.
Oben in ihrer Wohnung drehte sie als erstes die Heizung hoch. Noch in ihrer Outdoorjacke öffnete sie den Umschlag und nahm den Brief heraus.
Dort stand:
Betreff: Sterbefall Sidonie von Strawitz.
Und darunter:
„Sehr geehrte Frau Kunstmann,
nach Eröffnung des Testaments der verstorbenen Sidonie von Strawitz durch das Amtsgericht, möchte ich Sie bitten, sich am 24.12. des laufenden Jahres um 9:00 Uhr in meiner Kanzlei einzufinden.“
Delphine musste sich erst einmal setzen. Sie drehte den Brief hin und her, las ihn nochmal und nochmal. Das konnte doch nur ein Versehen sein! Frau von Strawitz sollte tot sein? Seit wann? Warum hatte Delphine das nicht mitbekommen? Und konnte es denn sein, dass Notariate an Heiligabend noch arbeiteten?
Noch vor dem Frühstück rief sie am nächsten Morgen im Büro des Notars an und erkundigte sich, ob das nicht alles ein Irrtum sei. Aber die Sekretärin bestätigte die Richtigkeit des Schreibens. Alles Weitere würde Delphine durch den Notar selbst erfahren. „Wir sind froh, dass Sie diesen Termin wahrnehmen können“, sagte die Sekretärin. „Er kommt ja ein wenig überraschend.“
Nun saß Delphine in ihre Decken gehüllt am Frühstückstisch. Der Kaffee war kalt, genau wie ihre Füße. Vor allem aber fühlte Delphine sich innerlich wie erfroren. Ihr Blick wanderte auf das hübsch verpackte Buch. Im Moment ärgerte sie nicht mal mehr der Erfolg von Ellen Brockstedt. Sie konnte nur an Frau von Strawitz denken und daran, ob sie wohl allein und einsam hatte sterben müssen. Unwillkürlich kam ihr die Krähe in den Sinn, die am Tag zuvor auf dem alten Apfelbaum gesessen hatte. Die Krähe - ein Rabenvogel. Der Rabe galt seit alters als Todesbote. Warum hatte sie dieses Zeichen nicht erkannt?
Dann schüttelte sie den Kopf über sich selbst. Sie war weder abergläubisch noch esoterisch! Genau genommen glaubte sie an gar nichts. Nicht mal mehr an die Liebe, wie sie bitter feststellte. Nein, Delphine sah sich als Realistin. Und wenn ihr noch irgendetwas helfen konnte, dann eine realistische Einschätzung ihrer Lage.
Diese riet ihr klipp und klar, sich umgehend an den Schreibtisch zu setzen und weiterzuarbeiten: Windbachs große klassische Gemälde zu betrachten und sie Skizzen gegenüberzustellen, auf deren Basis er ein Bild gemalt haben musste, das jenseits der kunstvollen Strenge seiner ansonsten klassisch-antiken Themen lag: Ein Frauenakt, der in Windbachs Werk einzigartig war. Der Nachweis, dass es dieses verschollene Bild tatsächlich einmal gegeben hatte, würde völlig neuen Wind in die Windbachforschung bringen und das gesamte Werk des Malers, der aus ärmlichen Verhältnissen eines kleinen Eifelörtchens stammte und es bereits in jungen Jahren zu einer Professur an der Düsseldorfer Akademie gebracht hatte, in einem anderen Licht erscheinen lassen. Es würde am Menschen Windbach eine Façette zum Leuchten bringen, von der die schärfste Konkurrenz von Delphines Institut, ein einflussreiches Klübchen am Bamberger Lehrstuhl, seit Jahren behauptete, sie sei ein reines Hirngespinst. Die Skizzen seien das Ergebnis eines feuchtfröhlichen Abends unter Akademieprofessoren und hätten keinerlei Bedeutung für die weitere Deutung des Meisters. Ebenso hartnäckig aber hatte der hiesige Lehrstuhl von Professor Erasmus jahrelang dagegengehalten und behauptet, in jenem verschollenen Bild spiegele sich Windbachs wahrer Geist und seine wahre Identität: Nicht mehr der sittenstrenge Akademieprofessor, sondern der befreite Mensch und Mann, mit der gesamten Kraft seiner Lenden – wie es Delphines ansonsten mittlerweile eher resigniert wirkender Doktorvater Professor Siegmund Erasmus gern mit unerwartet aufleuchtenden Augen nannte. Professor Erasmus selbst hatte die Anstrengungen seiner Forschung und wohl auch seine Anstrengungen hinsichtlich der Kraft seiner Lenden aller Wahrscheinlichkeit nach längst eingestellt. Publiziert hatte er jedenfalls seit Jahren nichts mehr, was den Bambergern gehörig Auftrieb gab. Wie es um das Privatleben des Professors stand und die liebende Hand einer Frau, darüber ließen seine zunehmend speckigen Anzüge kaum Spekulationen zu. Bis vor wenigen Jahren hatte Delphine diesen hochgebildeten Mann geradezu verehrt. Seitdem er sich aber kaum noch der Wissenschaft und stattdessen immer mehr anderen „geistigen“ Dingen in nicht mehr zu vertretendem Maße widmete, war ihre Ehrfurcht allmählich geschwunden. Dennoch, Delphine hatte das Gefühl, auch ihm irgendwie die Beendigung ihrer Doktorarbeit schuldig zu sein, bevor er pensioniert wurde.
Also nichts wie ran an den Schreibtisch!, ermunterte sie sich selbst. Und noch im selben Moment, mit der kalten Kaffeetasse in der Hand, versank sie wieder in tiefes Grübeln.
Es fiel Delphine nicht leicht, ihrer Mutter gegenüber eine Entschuldigung zu finden, warum sie in diesem Jahr erst am Nachmittag des Heiligabend nach Hause kommen würde. Sie hätte natürlich sagen können, dass sie am Morgen jenen seltsamen Termin beim Notar hatte. Aber erstens konnte sie sich darauf noch immer keinen Reim machen. Und zweitens hätte sie dann aussprechen müssen, dass Frau von Strawitz tot war. Irgendwie wollte Delphine aber immer noch glauben, dass es doch ein Irrtum war, dass es sich bei dem Notartermin um die Angelegenheiten irgendeines Menschen handelte, nicht aber um Angelegenheiten, die sie und Frau von Strawitz betrafen. Schließlich aber fand sie eine Ausrede, eine Art Notlüge, an der ein Fünkchen Wahrheit aber vielleicht doch noch dran war.
„Weißt du“, sagte sie zu ihrer Mutter, „dies ist das letzte Weihnachten am Institut mit Professor Erasmus. Wir machen zwar keine offizielle Weihnachtsfeier, aber vor dem Jahresende gibt es immer ein paar Dinge zu ordnen, und ich dachte, in diesem Jahr wäre ich gern dabei. Zum letzten Mal.“ Ihr war vollkommen klar, dass sie damit auch den Abschluss ihrer Dissertation in Aussicht stellte – und ebenso klar war, dass ihre Mutter sich über nichts mehr freuen würde, als dass der Doktortitel ihrer Tochter in greifbare Nähe rückte. „Natürlich, mach das, feiere schön mit deinen Freunden vom Institut“, antwortete Delphines Mutter erwartungsgemäß. „Es reicht ja, wenn du am frühen Abend hier bist.“
Nun machte sich Delphine am Morgen eines grauen und kalten Heiligabend auf den Weg in die Stadt. Sie ging zu Fuß, immer noch rätselnd, was der Notar ihr unterbreiten mochte. Ob es sich darum handelte, die Grabpflege zu übernehmen oder sie sonst wie sicherzustellen? Oder ob sie schlicht und einfach Nero ein neues Zuhause bieten sollte? Das konnte sich allerdings schon erledigt haben. Seit Wochen hatte Delphine den Kater nicht mehr gesehen. Vielleicht war er noch vor Frau von Strawitz in den Katzenhimmel gekommen – oder zeitgleich mit ihr. Solche Phänomene gab es, jedenfalls hatte Delphine davon schon mal gehört. Vielleicht aber war der Kater auch längst irgendwo untergekommen. Je nachdem, wie das Ableben ihrer Nachbarin vonstattengegangen war, hatten möglicherweise entfernte Angehörige oder Bekannte das verwaiste Tier zu sich genommen.
Der Weg zur Notarkanzlei führte zunächst Richtung Uni. Delphine schlug einen kleinen Pfad ein, der durch den angrenzenden Hofgarten Richtung Hauptgebäude lief. Im Fenster ihres Instituts brannte Licht. Tatsächlich waren also ein paar Fleißige dabei, noch ein paar Dinge aufzuräumen, ganz so, wie Delphine es ihrer Mutter aufgetischt hatte.
Dann sah sie schon von weitem eine heruntergekommene Gestalt auf einer Bank sitzen. Und sie wusste, um wen es sich handelte. Seit einiger Zeit hortete Professor Erasmus in seinem Schreibtisch altes Brot. Damit zog er regelmäßig in den Hofgarten und fütterte die Tauben. Auch jetzt schwirrten und wackelten die Tauben um die zu Krümeln zerriebenen, hier und da leicht angeschimmelten Brotbrocken, die der Professor ihnen hinwarf.
„Guten Morgen, Herr Erasmus“, grüßte Delphine schüchtern, während sie raschen Schrittes an ihrem Professor vorüberzueilen versuchte.
Professor Erasmus sah auf. Sein Blick wirkte glasig. „Na, wen haben wir denn da? Ach, die Frau Kunstmann. Na, alles klar gegangen, neulich mit der Klausur bei den Erstsemestern?“
Delphine stand mehr als einen Meter von Professor Erasmus entfernt. Seine Alkoholfahne aber wehte bis zu ihr hinüber. In der Brusttasche seines verbeulten Wintermantels leuchtete eine Art goldener Knopf. Der Schraubverschluss eines Flachmanns.
„Ja, ja“, antwortete Delphine. „Ich habe die Arbeiten in Ihrem Büro im Schrank eingeschlossen. Ich kümmere mich im neuen Jahr darum.“
Der Professor nickte. „Ist recht, ist recht“, sagte er. „Nächstes Jahr ist ja auch noch ein Jahr. Haha! Na, dann haben Sie mal schöne Weihnachten!“
„Danke, Herr Erasmus. Sie auch. Alles Gute.“ Damit wandte sie sich ab und ging weiter.
„Frau Kunstmann?“, rief Professor Erasmus ihr hinterher. „Wissen Sie, was?“
Delphine drehte sich herum.
„Eigentlich müssten Sie ja Kunstfrau heißen!“ Er lachte dröhnend.
Delphine wandte sich wortlos wieder um. Sollte sie es noch jemals zum Abschluss ihrer Doktorarbeit bringen, wollte sie sich in diesem Moment den Verlauf ihrer Abschlussprüfung bei Professor Erasmus lieber nicht allzu genau vorstellen!
Die Kanzlei des Notars war mit einem Teppichboden ausgelegt, der jedes Geräusch dämpfte. Die Akten in den Schränken standen säuberlich aufgereiht wie Zinnsoldaten. Überall herrschten Struktur und Effizienz. „Frau Kunstmann?“, sprach eine Sekretärin Delphine in einem schick eingerichteten Wartezimmer an. „Herr Doktor Auerbach hätte jetzt Zeit für Sie.“
Der Notar sah genau so aus, wie Delphine sich einen Notar vorstellte. Anfang vierzig vielleicht, in einem edlen dunklen Anzug. Im Gesicht allerdings eine poppige Brille. „Also, Frau Kunstmann“, begann er. „Sie waren die Nachbarin von Frau von Strawitz.“
„Ja“, sagte Delphine bedrückt. „Ich hatte gar nicht gewusst, dass sie tot ist. Es tut mir so leid. Wann ist sie denn gestorben?“
Der Notar sah auf ein Schreiben, das er neben sich liegen hatte. „Das war am 18. November, vor etwa fünf Wochen also.“
„Und wie … wie … ich meine … Mir ist zwar irgendwann aufgefallen, dass ich sie gar nicht mehr gesehen habe. Aber war sie denn krank? Wie ist sie gestorben?“
„Frau von Strawitz ist in einem Krankenhaus gestorben“, antwortete der Notar ruhig. „Nach einer Einweisung durch ihren Arzt. Sie war kein Notfall. Sie hatte eine Tasche mit ein paar Dingen dabei. Dass sie gestorben ist, damit hat niemand gerechnet, sagte mir der Arzt aus dem Krankenhaus.“
„Und Nero? Was ist mit Nero? Ihrem Kater.“
Der Notar legte ein Papier mit einem Siegel, das er schon in Händen gehalten hatte, vor sich auf den Schreibtisch. „Frau Kunstmann“, sagte er. „Ich habe den Eindruck, dass die Situation Sie ziemlich überrascht?“ „Es ist Winter“, versuchte Delphine zu erklären. „Im Winter war Frau von Strawitz nie in ihrem Garten. Und auf der Straße sind wir uns nur hin und wieder begegnet. So gut … so richtig gut kennen wir uns – kannten wir uns ja gar nicht.“ Es klang wie eine Entschuldigung.
Der Notar räusperte sich, dann nahm er wieder das Papier mit dem Siegel zur Hand. „Also, es ist so. Frau von Strawitz war vor einem halben Jahr hier und hat Sie zur Erbin ihres Hauses eingesetzt. Samt Inventar. Dazu eine gewisse Summe Geldes auf einem Konto für die Erbschaftssteuer, die ja erst einmal auf Sie zukommt, für ein paar Reparaturen und für …“ Er machte eine kleine Kunstpause. „Für Katzenfutter. Sie sollen sich des Katers annehmen.“
„Aber … aber …“ Delphine wusste einfach nicht, was sie sagen sollte. „Und … wie …“
„Nur zu Ihrer Information: Es gab da auch noch eine etwas größere Geldsumme auf einem gesonderten Konto, aber die geht nach dem Willen des vor Jahren verstorbenen Ehemannes der Erblasserin an eine Stiftung“, fuhr der Notar fort. „An die Ostpreußenstiftung. Elche stehen und lauschen in die Ewigkeit.“ Er grinste. „Das ist eine Zeile aus dem Ostpreußenlied. Kein Witz!“
„Aber Frau von Strawitz und ich, wir haben uns doch kaum gekannt“, konnte Delphine nur stammeln. „Und jetzt soll ich ihr Haus erben?“
Der Notar zuckte die Schultern. „Sie sagte mir bei unserem Termin, sie habe nirgends mehr Verwandte. Nur eine Geistes- und Seelenverwandte. Und damit meinte sie wohl Sie.“
Delphine fehlten die Worte.
„Also, Frau Kunstmann, machen wir einfach weiter“, fuhr der Notar fort. „Ich gebe Ihnen jetzt Ihre Unterlagen: Eine beglaubigte Abschrift des notariellen Testaments, das Protokoll der Testamentseröffnung, einen aktuellen Grundbuchauszug und die Nummer des Kontos, dessen Erbin Sie sind. Mit diesen Unterlagen können Sie die erforderlichen Schritte in die Wege leiten, damit Sie Ihr Erbe antreten können. Und hier wären dann auch noch die Schlüssel zu Ihrem Haus. Ich hoffe, Sie werden glücklich darin. Ach ja“, fügte er an, während er Delphine die Hand reichte und sie sanft aus dem Sessel in die Höhe zog. „Mein Beileid auch noch, falls ich das vergessen haben sollte.“ Damit geleitete er sie aus dem Zimmer.
Draußen auf der Straße wusste Delphine noch immer nicht, wie ihr geschehen war. Fassungslos starrte sie auf den Hausschlüssel, während winzig kleine Schneeflocken vom Himmel fielen und wie Sternchen in ihrem Haar hängen blieben.
Was der Wetterbericht schon seit Tagen vorhergesagt hatte, trat nun ein. Ein weißes Weihnachtsfest hatten die Meteorologen versprochen, ein heftiges Tief, das die gesamte Republik von Norden her überziehen sollte. Dass dieses Tief sich allerdings bedeutend schwerwiegender auswirkte als angenommen, las Delphine auf den Nachrichtentafeln der U-Bahn, mit der sie nach Hause fahren wollte. Auf diese Weise umging sie eine weitere Begegnung mit Professor Erasmus und den Tauben. Hamburg und Lübeck meldeten bereits mehr als einen halben Meter Schnee. Dort hatte es in den frühen Morgenstunden zu schneien begonnen. Schwere, klebrige Flocken, die das Tief über der Nordsee als nasse Polarluft aufgenommen hatte und nun abwarf. Es drohte ein Verkehrschaos.
Noch immer wie betäubt, legte Delphine in ihrer Wohnung die Unterlagen und den Schlüssel für das Haus erst einmal auf den Schreibtisch, neben ein Buch mit Windbachbildern. Einen Moment lang blieben ihre Gedanken an dieser zufälligen Anordnung hängen. Der Schlüssel zum Werk Windbachs! Wenn sie den nur fände!
Sie schaltete den Computer ein, um ein Bahnticket zu ihrer Mutter zu buchen. Schon auf der Startseite standen die Breaking-News des Tages: Strommasten im Münsterland unter der Schneelast umgeknickt. Bahnverkehr in den nordwestlichen Landesteilen vollständig lahmgelegt.
Delphine öffnete die Homepage der Bahn. Dort erschien die Warnung, dass ab sofort keine Züge mehr Richtung Nordwesten zu buchen waren. Darüber hinaus wurden Fahrgäste, die bereits im Besitz eines solchen Tickets für den heutigen Tag waren, gebeten, ihre Reise nicht anzutreten. Ungläubig schüttelte Delphine den Kopf, dann wechselte sie zu den Seiten der Fernsehnachrichten. Auch hier stand die Warnung der Bahn: Möglichst keine Reise nach Nordwesten anzutreten. Besser zu Hause zu bleiben. Auch auf den Straßen drohte ein Chaos. Dazu wurden Bilder norddeutscher Städte gezeigt, die unter Schneemassen versanken, und Beiträge über Massenkarambolagen auf Autobahnen.
Eigentlich hatte Delphine vorgehabt, ihrer Mutter nur per SMS ihre Ankunftszeit mitzuteilen. Bis dahin hatte sie gehofft, einen klareren Kopf zu haben, um von der Erbschaft erzählen zu können. Nun aber blieb ihr nichts anderes übrig, als anzurufen. Vorsichtshalber drehte sie sich vom Schreibtisch weg und blickte zum Fenster hinaus ins Schneetreiben, damit sie den Schlüssel und die Hausunterlagen nicht sah.
Ihre Mutter hatte den Wetterbericht nicht nur gehört, sondern sie stand selbst schon bis zu den Knien im Schnee. „Dann werden wir in diesem Jahr Heiligabend wohl getrennt feiern müssen“, stellte Delphine fest. „Ich kann ja kommen, wenn sich alles wieder beruhigt hat. Und dafür etwas länger bleiben.“ Wahrscheinlich war das gar keine schlechte Lösung. Auf diese Weise konnte Delphine die Ereignisse erst einmal noch etwas sacken lassen. Sie hatte ja selbst noch nicht richtig begriffen, was sie gerade erlebte.
„Ja, schon“, antwortete Delphines Mutter. Aber sie klang zögerlich. „Wobei, eigentlich ist es so …“ Und dann erzählte sie Delphine, dass sie vor kurzem einen Mann kennengelernt und eigentlich geplant hatte, mit ihm über Silvester auf eine Nordseeinsel zu fahren, da Delphine in den letzten Jahren die Jahreswende sonst auch nicht in ihrem Elternhaus verbracht hatte. „Aus der Nordseeinsel wird ja nun wahrscheinlich nichts“, schloss sie. „Also, wenn du willst – wir können gern zu dritt hier feiern.“ Delphine war sprachlos. Ihre Mutter hatte einen Freund! Damit hätte sie nie im Leben gerechnet! „Wir … wir können ja mal sehen …“, antwortete sie ausweichend. Dabei war eigentlich klar, dass dies für sie keine Option war. Für einen Moment überlegte sie, ob sie ihrer Mutter nicht doch erzählen sollte, dass sie plötzlich Hausbesitzerin war. Sie ließ es aber. So am Telefon, zwischen Tür und Angel – dafür war alles einfach noch zu unwirklich.
Sie musste ein paar Einkäufe machen, für die Feiertage und sicherheitshalber auch für ein paar Tage darüber hinaus. Das Wetter schien sich zu einer nationalen Katastrophe auszuwachsen. Durch die umgeknickten Strommasten kam es immer wieder zu unerwarteten Stromausfällen, die nicht nur sämtliche Verkehrswege blockierten, sondern hier und da auch schon das Telefonnetz lahmlegten. Delphine nahm dies zum Anlass ihr Handy gleich ganz auszuschalten. Den Abend allein verbringen und sich ganz in Ruhe klar darüber werden, dass sie ein Haus geerbt hatte – das war genau das, was sie jetzt brauchte!
Als es dunkel war, zündete sie eine Kerze an und stellte sie vor das Foto ihres verstorbenen Vaters. Und eine zweite Kerze stellte sie auf - für Frau von Strawitz. Danach begann sie sich etwas zu essen zu machen. Sie hatte eine Flasche Rotwein gekauft, schließlich war Heiligabend. Während sie beim Kochen die ersten Schlucke trank, spürte Delphine, wie ihr der Alkohol zu Kopf stieg.
Sie legte eine CD auf. Weihnachtsmusik deutscher Komponisten aus dem 17. Jahrhundert. Die Namen Heinrich Schütz und Dietrich Buxtehude hatte sie natürlich schon mal gehört. Johann Philipp Krieger und Johann Theile hingegen waren ihr bis zum letzten Jahr, wo ihre damals im achten Monat schwangere Freundin Nina Delphine die CD geschenkt hatte, vollkommen unbekannt gewesen.
„Das musst du mal hören, das ist spannend. Vor allem das Schlaflied im zweiten Teil“, hatte Nina sie auf die Kantate von Johann Theile hingewiesen. Nina hatte gerade ihre Promotion in Anglistik hinter sich gebracht. Irgendwas zur Literatur unter Cromwell, im 17. Jahrhundert also. „In England wäre man damals dafür aufgeknüpft worden. Wegen Zauberei! Und das in einer Weihnachtskantate!“
Mit einem Ohr lauschte Delphine von der Küche in ihr Wohn-, Schlafund Arbeitszimmer hinüber. Die Musik war harmonisch und melodisch und hatte etwas Hypnotisierendes – aber auch etwas Treibendes. Sie lullte ein und agitierte zugleich. Anstatt einzuschläfern, versetzte sie den Zuhörer eher in eine Art Trance.
„Schlaf, du Perle, schlaf, mein Zaphir,
schlaf, du günstiger Rubin.
Schlaf, mein Demant, schlaf, mein Sardis,
schlaf, mein heller Chrysolin,
schlaf, mein Herzkarfunkelstein,
schlaf, mein Amethistchen, ein!“
Delphine musste grinsen. Offenbar hatten nicht nur ihre Freundinnen Kinder, die nicht schlafen wollten. Schon die Gottesmutter Maria hatte offenbar dieses Problem mit ihrem Kindelein gehabt.
Delphine drehte die Kochplatte etwas herunter und ging, ihr Rotweinglas in der Hand, in ihr Wohn-, Schlaf- und Arbeitszimmer. Sie ließ das Stück erneut laufen.
„Schlaf, mein Seelchen, ich will holen
Tulpen, Nelken, Amarinth,
Tausendschönchen, Feldviolen,
schlaf, du wertes Menschenkind.
Allerliebstes Jesulein,
schlaf bei solchen Blumen ein!“
Die stark betonte erste Taktzeit wirkte wie ein Rad, das die Musik antrieb. Delphine begann sich im Rhythmus mitzuwiegen.
„Schlaf, mein Lorbeer, schlaf, mein Röschen,
schlaf, mein grüner Rosmarin.
Schlaf in meinem sanften Schösschen,
schlaf, mein schimmrender Jasmin,
schlaf mein süßer Hyacinth,
schlaf, du zarter Jungfraun Kind!“
Und dann wieder die dritte Strophe:
„Schlaf, du Perle, schlaf, mein Zaphir …“
Auf den Herdplatten kochten die Nudeln über. Delphine eilte in die Küche.
Nina hat Recht, dachte sie, während sie die Nudeln abgoss. Der Text klang wirklich nach Zauberei, zumindest nach Esoterik: nach den geheimen Kräften der Edelsteine und der Pflanzen und Kräuter. Im Mittelalter hatte den Frauen ihr Wissen um die Heilkräfte der Pflanzen den Verdacht eingetragen, Zauberei zu betreiben. Und wenn man wollte, konnte man den Text dieser Kantate durchaus als eine Art Hexenrezept betrachten, als eine magische Anleitung. Hochspannend war das! Denn es handelte sich ja um eine Kantate mit christlicher Intention. Andererseits, überlegte Delphine, hatten Glaube und Aberglaube auch immer schon zusammen gehört. Es war kein Zufall, dass man die Geburt des Gottessohnes zum Zeitpunkt des heidnischen Festes der Wintersonnenwende feierte. Und so wie Weihnachten und die Weihnachtsfeiertage bis zum Dreikönigstag am 6. Januar eine Zeit der hohen christlichen Feste war, so fielen in genau jene Zeit die sogenannten Rauhnächte, die im Volksglauben als magische Nächte galten.
Eine heftige Windböe fegte über das Dach. Delphine sah auf. Den ganzen Tag hatte es nun durchgeschneit. Mittlerweile häuften sich kleine Schneeberge an Delphines Fenstern. Draußen war es stockfinster geworden. Anstatt aber die Deckenlampe einzuschalten, zündete Delphine weitere Kerzen an. Dann holte sie ihr Tablett mit dem Essen herüber, schenkte Rotwein nach und hob ihr Glas.
„Frohe Weihnachten, Delphine“, prostete sie sich selbst zu. „Und frohe Weihnachten, Frau von Strawitz. Wo immer Sie jetzt sein mögen!“
Mit dem Tablett auf den Knien saß Delphine auf dem Sofa und aß. Das Licht der Kerzen spiegelte sich in den dunklen Fenstern. Je mehr Delphine dem Rotwein zusprach, umso mehr entfaltete die Musik der Weihnachtskantate in Delphines Ohren ihren beschwörenden Charakter. Sie lullte ein und gleichzeitig regte sie an. Vor allem aber bewirkte sie eins:
Sie rückte die Erinnerung an ihren Besuch beim Notar an diesem Morgen in den Hintergrund. Eine Wirkung, für die Delphine dankbar war.
Die CD lief im Endlosmodus. Die Rotweinflasche war zu zwei Dritteln leer. Plötzlich erklang vom Fenster her ein heftiger Schlag. Delphine schrak auf. Offenbar war sie eingenickt. Bei brennenden Kerzen! Sie blickte zum Fenster, versuchte zu erkennen, was an ihr Fenster geschlagen haben mochte. Zunächst sah sie nur die Flammen, die sich vor der schwarzen Fläche spiegelten. Dann schimmerten mit einem Mal zwei leuchtende Kreise auf der anderen Seite der Scheibe. Delphine schrie leise auf. Jetzt pochte es leise am Fenster, begleitet von einem kaum hörbaren Miauen. Eine Katze saß auf dem Fensterbrett und schlug mit der Pfote gegen die Scheibe. Eine nachtschwarze Katze. Sie sah immer noch mit funkelnden Augen ins Zimmer.
Delphine ließ die Decke, die sie im Halbschlaf auf dem Sofa über sich gezogen hatte, zu Boden gleiten, lief zum Fenster und riss es auf. Augenblicklich kam die Katze herein, zusammen mit einer Wolke eisiger Luft und einiger Schneekristalle, die an ihren Pfoten und in ihrem Fell hingen. Sie sprang auf Delphines Schreibtisch, blieb dort stehen und sah Delphine an. Im Kerzenlicht erkannte Delphine, dass es sich um ein nachtschwarzes, großes Tier handelte. Vermutlich ein Kater. Seine Pupillen waren weit geöffnet.
„Nero?“, flüsterte Delphine. Das war ja unglaublich! Seit Wochen hatte sie den Kater nicht gesehen. Wo kam er jetzt her?
„Nero“, flüsterte Delphine noch einmal.
Der Kater schüttelte sich, wobei er ein paar letzte Schneekristalle versprühte. Dann hockte er sich hin und begann sich zu putzen.





























