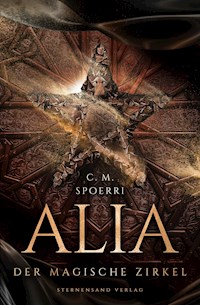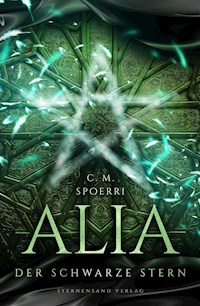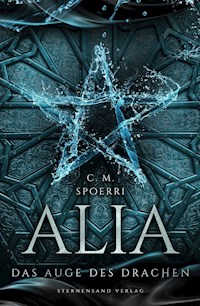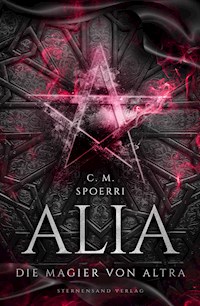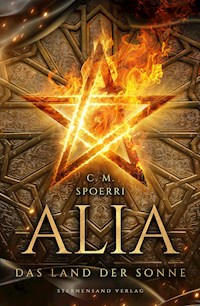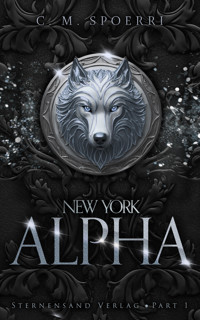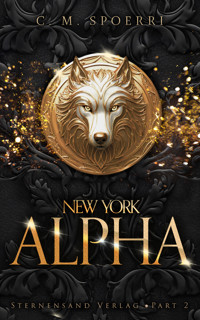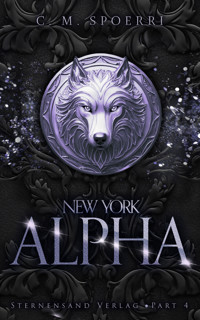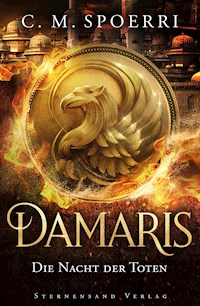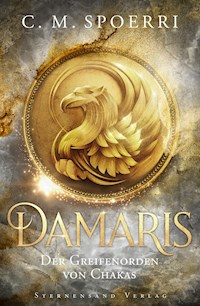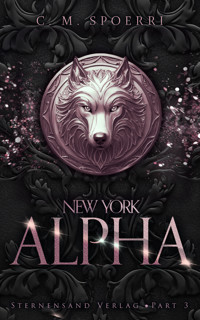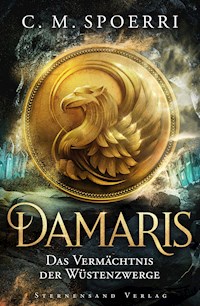Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sternensand Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Was ist ein Winterstern? Ein magisches Artefakt? Ein verwunschener Ort? Eine verzauberte Person? Oder etwas, das gar nicht greifbar ist? Lasst euch in fremde Welten entführen, lernt fantastische Legenden kennen, kämpft für die Gerechtigkeit, Liebe oder Freiheit, erlangt Ruhm und Ehre, erfahrt, was wirklich zählt im Leben. Dies ist eine Fantasy-Anthologie, die euch zum Lachen, Lieben, Gruseln, Träumen, Hoffen und Bangen einlädt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titel
Impressum
Vorwort
Jasmin Aurel – Gewispert
Jamie L. Farley – Verloren
Tara Florents – Entflammt
Christina Krüger – Schneeweiß
Juliane Maibach – Windstill
Regina Meißner – Vergangen
Anne Neuschwander – Allein
Janine Prediger – Bleich
Madeleine Puljic – Erwählt
Miriam Rademacher – Ahnungslos
Veronika Rothe – Ganz
Maya Shepherd – Vereist
Nele Sickel – Getäuscht
C. M. Spoerri – Selbstlos
Henrik Sturmbluth – Ruhmreich
Sabrina Weisensee – Hölzern
Dank
Weitere Titel aus unserem Verlagsprogramm
Jasmin Aurel, Jamie L. Farley, Tara Florents, Christina Krüger, Juliane Maibach, Regina Meißner, Anne Neuschwander, Janine Prediger, Madeleine Puljid, Miriam Rademacher, Veronika Rothe, Maya Shepherd, Nele Sickel, C. M. Spoerri (Hrsg.), Henrik Sturmbluth, Sabrina Weisensee
Winterstern
(Anthologie)
Fantasy
www.sternensand-verlag.ch
1. Auflage, Februar 2017
© Sternensand-Verlag GmbH, Zürich 2017
Umschlaggestaltung: Alexander Kopainski | www.kopainskiartwork.de
Lektorat / Korrektorat: Martina König | Sternensand Verlag GmbH
Titelillustrationen: lolo2013| fotolia.de
Illustrationen Seitenränder: Cattallina | fotolia.de
Illustrationen Geschichtenende: lolo2013| fotolia.de
Illustrationen Autorenbilder: lolo2013| fotolia.de
Satz: Sternensand Verlag GmbH
Satz: Sternensand Verlag GmbH
ISBN (Taschenbuch): 978-3-906829-32-6
ISBN (epub): 978-3-906829-33-3
Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Vorwort
Diese Anthologie wurde anlässlich eines Schreibwettbewerbs zum Thema ›Winterstern‹ verfasst. Zahlreiche Autoren haben sich von dem Begriff inspirieren lassen. Entstanden sind zauberhafte Kurzgeschichten, die die Leser in mystische, magische, gruselige und romantische Welten entführen. Sie spiegeln nicht nur die unzähligen Interpretationsmöglichkeiten eines Wortes wider, sondern auch die unterschiedlichen Persönlichkeiten, Vorlieben, Leidenschaften und Fantasien unserer Autorinnen und Autoren.
Aus über 160 eingereichten Kurzgeschichten ist es uns gelungen, einen schönen, abwechslungsreichen Fantasy-Mix zusammenzustellen. Ich bin sicher, dass für jeden Geschmack etwas dabei sein wird und schöne Lesestunden auf euch warten.
Viel Vergnügen mit ›Winterstern‹ wünscht
Corinne Spörri (Herausgeberin)
Übersicht über die mitwirkenden Autoren:
Jasmin Aurel - Gewispert
Jamie L. Farley - Verloren
Tara Florents - Entflammt
Christina Krüger - Schneeweiß
Juliane Maibach - Windstill
Regina Meißner - Vergangen
Anne Neuschwander - Allein
Janine Prediger - Bleich
Madeleine Puljic - Erwählt
Miriam Rademacher - Ahnungslos
Veronika Rothe - Ganz
Maya Shepherd - Vereist
Nele Sickel - Getäuscht
C. M. Spoerri - Selbstlos
Henrik Sturmbluth - Ruhmreich
Sabrina Weisensee - Hölzern
Jasmin Aurel – Gewispert
Über die Geschichte:
Als Ethan im Kaminzimmer seines guten Freundes Gabriel einschläft, hat er eine unheimliche Begegnung.
London, 1893
Es war einer dieser düsteren Tage im Februar, an denen der Winter nie zu enden schien.
Ich war zu jener Zeit bei Gabriel zu Gast, einem meiner engsten Freunde seit Kindertagen. Er war Musiker und wie stets nach dem Abendessen ließen wir uns in seinem Musikzimmer nieder, er am Klavier, ich vor dem Kamin.
Wir tranken ein Glas Wein und ich rutschte tiefer in den Sessel. Gabriels Diener Adrian reichte Tee.
Die zarte Melodie des Instruments, die knisternde Wärme der Flammen – schon nach wenigen Minuten fiel ich in tiefen Schlaf.
»Ethan«, flüsterte es.
Nur mit Mühe öffnete ich die Augen. Meine Lider waren schwer wie Blei.
»Schlaf nicht ein. Wenn wir einschlafen, war alles nur ein Traum.«
Mit einem Seufzen drehte ich den Kopf zur anderen Seite, wollte nicht aufwachen. Ich war müde, so müde …
»Schlaf nicht ein«, flüsterte es erneut.
Ich öffnete die Augen.
»War denn alles nur ein Traum?«
Ich fror. Der Kamin war düster und kalt.
Verwirrt richtete ich mich auf. Mein Atem nahm in der eisigen Luft Gestalt an.
Der Raum lag in Dunkelheit. Alle Lichter waren erloschen, lediglich ein paar wenige Kerzen flackerten noch.
Mein Freund war mit dem Oberkörper auf das Klavier gesackt.
»Gabriel! Gabriel, was ist mit dir?« Erschrocken trat ich zu ihm, rüttelte an seiner Schulter, fühlte seinen Puls.
Sein Arm rutschte dabei über die Tasten, erzeugte krude Missklänge.
Gabriel atmete, doch er war bewusstlos. Seine Haut fühlte sich kalt an, als wäre er tot.
»Ethan«, flüsterte es.
Weißer Nebel kroch über den Teppich auf mich zu, kringelte sich in Schlieren und Schleifen, löste sich auf, um mich zu umhüllen.
Mein Schuh stieß gegen eine Teetasse. Adrians Finger berührten sie noch, er selbst lag bäuchlings auf dem Boden. Die Kanne war zerbrochen und der Tee tränkte den Teppich. Auch der Diener war nicht bei Bewusstsein, fühlte sich kalt und leblos an.
»Sie träumen«, flüsterte es.
Langsam hob ich den Blick.
Dort stand Annabel. Träge zog der Nebel seine Bahnen um sie, als wäre sie das Zentrum seiner Kraft.
»Annie.« Ich bekam kaum Luft. Das konnte nicht sein. »Das ist unmöglich.«
Sie lächelte. Sie trug das zarte Spitzenkleid, in dem sie beerdigt worden war.
»Das ist ein Traum«, erkannte ich und doch klang es wie eine Frage.
»Nicht ganz.«
Ein Kichern huschte durch den Raum und sie war fort.
Verwirrt drehte ich mich im Kreis. Wie war das möglich? Annabel, Gabriels Schwester, meine Annie … meine Verlobte.
Ich spürte einen Luftzug. Im Flur flackerte ein warmes Licht auf.
»Annie?«
Das hier war nicht echt.
Ich hörte sie singen.
Aber Annie konnte nicht mehr singen. Sie war tot, begraben, schon seit ein paar Jahren.
»Das Eis zerbricht, ein Splitter gar,
Bohrt sich in dein Herz, für immer da.«
Was war das für ein Lied?
Früher hatte Annie viel gesungen. Bei jeder Gelegenheit hatte sie am Klavier gestanden, mit dem Gabriel sie begleitete. Sie hatte wie ein Engel gesungen und ich hatte sie nie stärker angebetet.
Tatsächlich glaubte ich, jedes ihrer Lieder zu kennen.
Wie ich mich doch irrte …
Ich verließ den Raum, rannte in den Flur.
Hinter der Ecke huschte Licht über die Wand wie Flammenschein.
»Er schmilzt nicht, nein, er brennt und sticht,
Verdunkelt deiner Seele Licht.«
Der Nebel war hier dichter, ich torkelte blind durch ihn hindurch.
Plötzlich stand ich im zweiten Stock vor dem Gästezimmer.
Wie war ich die Treppe hinaufgekommen?
Annie stand vor der offenen Tür und starrte auf mein Bett. Der Nebel kräuselte sich zu ihren Füßen. Sie trug ihr Haar offen, ein blonder Schleier.
Einen Wimpernschlag später stand sie im Zimmer.
Traurig blickte sie auf die Fotografie auf dem Nachttisch, die sie selbst zeigte.
Sie wiegte sich leicht und summte die eingängige Melodie der Strophe. Die Töne vibrierten in meinem Kopf und schmerzten unerträglich.
»Annie, bitte hör auf damit!«, flehte ich sie an, hielt mir die Ohren zu.
Das Summen erstarb. Langsam drehte sie sich zu mir um, sah mich aus großen Augen an.
»Hörst du das Wispern?«, flüsterte meine Annabel. »Es ruft mich zurück, ich sollte nicht hier sein.«
Ich hörte nur sie, sie, sie.
»Du bist tot«, beharrte ich. Als würde diese Tatsache dadurch an Wirklichkeit gewinnen. Dabei wünschte ich mir nichts mehr, als dass es nicht der Wahrheit entspräche.
»Suche nach dem Winterstern«, sagte sie und machte einen Schritt auf mich zu. »Er ist nicht fern.«
Wie bitte?
Ich nickte unsicher, weil ich nicht wusste, was ich sonst tun sollte.
Winterstern? Was redete sie nur?
Da stand sie vor mir, meine Annie. Sie sah nicht aus wie ein Geist. Sie war lebendig, atmete, bewegte sich.
Wie konnte es ein Traum sein? War es echt? War ich wahnsinnig? Hatte ich ihren Tod nur geträumt? War sie ein Spuk? Ein Gespenst? Eine Manifestation des Wahnsinns?
Vorsichtig hob ich die Hand. Meine Finger berührten schon fast die weiße Spitze ihres Ärmels, als sie sich ruckartig abwandte und vor sich hin murmelte.
»Schürt ein Fieber, treibt dich in die Nacht,
Wo die Finsternis ist an der Macht.
Schürt ein Fieber, treibt dich in die Nacht,
Wo die Finsternis ist an der Macht.
Schürt ein Fieber, treibt dich in die Nacht,
Wo die Finsternis ist an der Macht …«
Sie wiederholte es immer und immer wieder, schneller und schneller.
»Was ist der Winterstern?«, fragte ich laut, um sie zu übertönen.
Sie hielt inne und drehte sich von mir weg, löste sich im Nebel auf.
Ich blieb allein zurück, blickte hilflos um mich.
Wenn das ein Traum war, warum wachte ich dann gottverdammt noch mal nicht endlich auf?
Ich fror, fühlte Schmerzen. Was für eine elende Sorte Traum sollte das sein?
Doch am meisten schmerzte mein Herz …
Nichts geschah. Sogar meine Taschenuhr, die neben dem Bild von Annie auf dem Nachttisch lag, stand still. Die Zeiger bewegten sich nicht. Kein Ticken, nicht das geringste Geräusch drang an mein Ohr.
Mit einem Mal fühlte ich mich einsam.
Was hatte ich getan, dass mir so etwas widerfuhr?
Da hörte ich sie wieder singen.
Die Melodie drang die Stufen herauf, hing in der Luft wie Annabels Parfum.
»Hörst du das Wispern, gar nicht fern?
Suche nach dem Winterstern, Winterstern.
Hörst du das Wispern, gar nicht fern?
Suche nach dem Winterstern, Winterstern.«
Ich folgte dem Ursprung ihrer Stimme bis in die Eingangshalle.
»Ich höre dich. Rede mit mir! Was ist der Winterstern?«
»Hast du ihm von uns erzählt?«
Kerzengerade aufgerichtet, stand sie mitten in der Halle, die Hände in den Stoff ihres Kleides gekrallt.
Ich wusste, was sie meinte. Sie sprach von ihrem Bruder und unserer heimlichen Verlobung.
»Nein, Annie. Wir wollten es ihm gemeinsam sagen und dann … dann konnten wir es ihm nicht mehr gemeinsam sagen.«
Weil ihr das Leben genommen worden war. Und allein hatte ich es nicht geschafft.
»Wieso hast du es ihm nicht nach der Beerdigung gesagt?«
Sie schien fast wütend darüber.
Ich war ein solcher Nichtsnutz, ich erzürnte sogar einen Geist, der mich heimsuchte.
Ich seufzte. »Wozu sollte ich ihm auch noch diesen Schmerz zufügen? Wir haben alle genug gelitten, Annie.«
Sie schwieg.
»Außerdem … außerdem ist unser Geheimnis das Einzige, was mir geblieben ist«, gestand ich in die Stille hinein.
Das war selbstsüchtig und die reine Wahrheit.
So dringend brauchte ich etwas Kostbares von ihr, das mir allein gehörte und mir niemand mehr nehmen konnte. Wenn auch sonst nichts blieb von unserer heimlichen Liebe, dann wenigstens das.
Wenn ich meine Erinnerungen teilte, waren sie nicht mehr mein allein. Sie war mein, und dann nicht mehr.
»Annie, ich habe dich so vermisst«, presste ich gequält hervor, hob erneut die Hand, um sie zu berühren.
Wenn ich sie doch nur spüren könnte, ihre Wärme …
Annie hob den Blick. Blutige Tränen liefen ihr aus den Augen. Ein Schnitt, hauchdünn, zeichnete sich quer über ihre Kehle … und begann zu bluten.
Das Blut lief erst langsam und dann in Strömen.
Es sollte spritzen, doch es lief stetig und unaufhaltsam aus ihr heraus, ohne einen Puls, ohne einen Herzschlag.
So viel Blut, dass es nicht mehr rot war, sondern schwarz wurde.
Voller Entsetzen wich ich vor ihr zurück.
»Nein!«
Es war überall.
Blut, Blut, B L U T!
Ein Meer aus Blut!
Es färbte ihr Kleid, strömte über den Boden, machte ihn glitschig, breitete sich immer weiter aus.
Es sprudelte in Wellen über meine Schuhe, tränkte meine Hose, nässte mein Bein.
Ich hatte Wärme erwartet, doch es war kalt.
Eisig wie der Tod.
Erschrocken wich ich zurück, rutschte aus, stürzte hart auf die Fliesen.
Annie krallte ihre Hände in die Haare und schrie.
Ich schrie.
Hielt die Arme in purem Grauen schützend vor meine Augen, konnte nicht hinsehen. Meine Ohren knackten und bluteten.
Zu laut, zu schrecklich …
STILLE.
Mein Herz hämmerte gegen meine Brust.
S T I L L E.
Blut, kalt wie der Tod.
STILLE. STILLE. STILLE.
Ich fürchtete mich davor, die Augen zu öffnen. Was würde ich sehen?
S
T
I
L
L
E
.
In diesem Moment bemerkte ich, dass ich die Luft anhielt.
Vorsichtig atmete ich aus und anschließend wieder ein. Erst dann ließ ich die Arme sinken.
Ich war allein.
Mondlicht fiel durch die Fenster in die Eingangshalle. Der Boden war mit Erde und braunem, vertrocknetem Laub bedeckt, das knirschte, als ich mich erhob.
Kein Blut. Kein Gespenst.
Wie um mich zu verhöhnen, schlug die große Standuhr neben der Treppe elf Uhr. Bei jedem Schlag glühte ein warmes Licht in ihrem Inneren auf und erlosch sogleich wieder.
Was war das?
Der letzte Schlag erklang, das Licht pulsierte ein letztes Mal, dann verglomm es und auch der Ton verklang in der Halle.
Ich wandte mich von der Uhr ab und betrachtete meine Hände.
Kein Blut.
Ich scharrte im Laub. Auch die Fliesen in der Eingangshalle waren unter der Erde sauber.
Kein Blut.
Es war nur ein Traum gewesen. Oder ein Traum in einem Traum. Oder ein Albtraum in einem Albtraum? Oder war es doch schon wieder die Wirklichkeit?
Dong … Dong … Dong … Dong …
Wieder schlug die Uhr.
Ich drehte mich um.
Dong … Dong … Dong … Dong …
Bei jedem Schlag glühte wieder etwas im Inneren des Gehäuses.
Die Standuhr war alt und kaputt. Sie funktionierte schon lange nicht mehr. Gabriel ließ sie nur deshalb in der Halle stehen, weil er ihre Optik mochte. Sie konnte nicht schlagen. Die Uhr war tot.
Dong … Dong … Dong … Dong …
Zwölf Mal.
Mitternacht.
Als ich im Sessel eingeschlafen war, war es früher Abend gewesen. Innerhalb von Minuten waren die Stunden auf dieser stehenden Uhr verflogen.
Der letzte Schlag hallte nach, diesmal erlosch das Glühen nicht.
Ich trat an die Uhr, fuhr mit den Fingerkuppen an ihrer Kante entlang, bis ich den Verschluss fand, mit dem man die Glastür zum Pendel öffnete.
Aus der Nähe erkannte ich, dass das Glühen hinter dem Pendel herrührte.
Ich öffnete die Glastür und sah genauer hin.
Hinter dem Pendel fehlte die Rückwand. Und was dort glühte, war die Sonne, deren Strahlen durch die bunten Blätter eines Baumes fielen.
Golden und warm und hell und einladend …
Ich schob das Pendel zur Seite und stieg in die Standuhr.
Nun stand ich unter dem Baum im Garten. Es war Herbst und erstaunlich warm. Friedlich segelte ein Blatt an mir vorbei zu Boden. Erleichtert atmete ich ein, die Luft roch würzig nach Laub und Regen und Sonnenschein.
Der Albtraum war vorbei. Endlich.
»Annie?«, rief ich lächelnd. »Bist du hier?«
»War denn alles nur ein Traum?«, trug mir der Wind zu.
»Komm heraus! Es ist wunderschön hier!«
Ich drehte mich im Kreis, hielt das Gesicht ins Sonnenlicht und fiel kopfüber in ein Grab.
Erde und schmutziger Schnee bröckelten von den Rändern der ausgehobenen Grube auf mich herab.
Benommen setzte ich mich auf und blickte unter mich.
Ich lag auf Annabels Sarg. Er war mit Eisblumen überzogen, Schneeflocken legten sich auf das Holz, auf mich, auf mein Haar und mein Gesicht.
Mit einem Schrei sprang ich auf und versuchte aus dem Grab zu klettern, krallte mich in die gefrorene Erde, in das scharfkantige Eis.
Mit blutenden Händen kroch ich aus dem offenen Grab in das schneebedeckte Gras.
Dort blieb ich liegen, rollte mich auf den Rücken.
Kahl und trostlos hingen die Äste des Baumes über mir.
Kein buntes Blätterdach, keine Sonne.
Statt des Himmels sah ich dort die Decke der Eingangshalle in Gabriels Haus.
Es war dunkel und kalt. Ich lag auf den blanken Fliesen.
Ich keuchte, ich schluchzte. Mein Atem stieg wieder vor mir auf, sichtbar wie Nebel.
Nebel. Er kroch auf mich zu, breitete sich um mich herum aus wie die endlose See in der Nacht.
»Wind und Himmel, sternenklar,
Folge ihnen, sie sind für dich da«, flüsterten die trüben Schleier.
Ich wollte nichts mehr davon hören, stand auf und wankte aus der Halle, zurück zum Musikzimmer.
Mein Herz schmerzte, meine Seele weinte.
Nein … ich weinte.
Ich hielt das nicht aus, das war zu viel.
Ich schaffte es nicht zurück.
Im Flur sank ich an der Wand hinab, kauerte mich zusammen und fragte mich, wie ich diesem Albtraum entkommen konnte.
Warum suchte sie mich heim? War das wirklich ihr Geist? Raubte sie mir den Verstand? Wieso tat sie mir das an?
Ich liebte sie doch.
So sehr.
»Schhh«, raunte sie.
Sie saß neben mir auf dem Boden, wieder unversehrt. Sie sah so lebendig aus! So warm und echt. Sie lächelte sogar.
»Suche den Winterstern, Ethan.«
Den hatte ich schon wieder vergessen.
»Den Winterstern«, krächzte ich verzweifelt. »Sag mir doch, was das ist. Wie soll ich ihn sonst finden?«
»Du weißt es längst. Ich habe es dir bereits verraten.«
Verständnislos starrte ich sie an. Ich wusste überhaupt nichts.
»Leb wohl, Ethan«, flüsterte sie, legte ihre Hand auf meine Wange und küsste mich.
Mit einem Ruck wachte ich auf.
Panisch sprang ich aus dem Sessel und blickte wie im Wahn um mich.
Wo war sie? Wo war der Nebel? Wo war Annie?
Das Feuer brannte, es war warm und hell. Adrian räumte das Teegeschirr zusammen.
Gabriel unterbrach sein Lied und runzelte die Stirn. »Ethan? Geht es dir gut?«, fragte er besorgt.
Sprachlos starrte ich ihn an. Zweifellos musste ich wie ein Irrer auf ihn wirken.
Endlich fing ich mich, räusperte mich und kam mir töricht vor. Ein Traum …
»Es war nur ein Traum.«
»Muss ja höllisch gewesen sein«, brummte Gabriel und widmete sich wieder dem Instrument.
»Scheint so.«
Ich wollte mich gerade wieder setzen, als ich die Töne erkannte, die er da unbedarft erklingen ließ.
Die Melodie! Es war das Lied, das sie die ganze Zeit gesungen hatte!
Und Gabriel streute die Töne einfach so in den Raum, ohne etwas davon zu ahnen. Er summte dabei leise vor sich hin.
Ich kannte den Text. Ich hatte dieses Lied noch nie zuvor gehört, doch ich wusste die Worte.
Wie war das möglich?
»Was ist das für ein Lied?«, verlangte ich etwas zu vehement zu wissen.
Das Stirnrunzeln vertiefte sich.
»Winterstern«, sagte Gabriel lediglich.
Winterstern!
»Wie … wie geht das Lied?«, fragte ich aufgeregt und vergaß all das Grauen.
Wie blind und dumm ich war! Sie hatte es mir verraten! Es war ein Lied! Es war ein Lied, bei Gott!
»Ist wirklich alles in Ordnung?«, fragte nun auch Adrian. Vermutlich fragte er sich, ob er seinen Herrn vor meinem hysterischen Anfall beschützen musste.
»Alles bestens, wenn Gabriel mir nur dieses Lied vorsingt!«
Die beiden tauschten einen sichtlich irritierten Blick. Ich musste mich zusammenreißen. So konnte ich nicht weitermachen.
Trotz meines wahnhaften Verhaltens begann Gabriel zu spielen und sang leise dazu.
»Das Eis zerbricht, ein Splitter gar,
Bohrt sich in dein Herz, für immer da.
Er schmilzt nicht, nein, er brennt und sticht,
Verdunkelt deiner Seele Licht.
Hörst du das Wispern, gar nicht fern?
Suche nach dem Winterstern, Winterstern.
Hörst du das Wispern, gar nicht fern?
Suche nach dem Winterstern, Winterstern.
Schürt ein Fieber, treibt dich in die Nacht,
Wo die Finsternis ist an der Macht.
Wind und Himmel, sternenklar,
Folge ihnen, sie sind für dich da.
Hörst du das Wispern, gar nicht fern?
Suche nach dem Winterstern, Winterstern.
Hörst du das Wispern, gar nicht fern?
Suche nach dem Winterstern, Winterstern …«
Er ließ den letzten Akkord fast schon fragend ausklingen.
Das Lied war der Winterstern. Und meine Aufgabe war es, den Winterstern zu finden!
Was bedeutete das?
»Hat das Lied irgendwas mit Annie zu tun?«, fragte ich. »Wieso spielst du das?«
Gabriel zuckte zusammen, als hätte ich ihn geschlagen.
Wir sprachen eigentlich fast nie über seine Schwester, seit jenem Tag. Zumindest nicht derart unvermittelt.
»Sie mochte das Lied. Schon als Kind. Ich empfand es ja immer als etwas morbid und düster. Es fiel mir heute einfach wieder ein.« Er überlegte. »Sie besaß sogar eine Spieluhr mit dieser Melodie, wenn ich mich recht entsinne.«
Es fiel mir wie Schuppen von den Augen.
»Wo ist diese Spieluhr?«
Er gab sie mir und ließ mich damit allein.
All die Zeit hatte sie in einer der Kisten mit Annies persönlichen Habseligkeiten gelegen, ohne dass ich davon gewusst hatte.
Wie im Fieber pochte mir das Herz in der Brust. Jeden Moment würde es zerspringen.
»Ich habe ihn gefunden, Annie. Ich habe dich verstanden«, flüsterte ich leise. »Ich habe den Winterstern gefunden.«
Der Winterstern war das Lied, und das Lied war in der Spieluhr.
Was würde geschehen, wenn ich sie aufzog?
Sie war hübsch, hatte die Form einer geschlossenen weißen Rosenknospe unter Glas. Schwer lag sie in meiner Hand. Die Farbe war stellenweise abgeblättert. Sie war alt, war aber sichtlich geliebt und gut behandelt worden.
Diese Spieluhr hatte Annie gehört.
Der Gedanke schnürte mir die Kehle zu.
Ich hielt etwas in der Hand, das sie geliebt hatte.
Nach ihrer Beerdigung hatte ich keinen ihrer persönlichen Gegenstände als Erinnerungsstück haben wollen. Was sollte mir ein Tuch oder eine Kette schon an Trost spenden? Es waren nur Gebrauchsgegenstände.
Ich behielt lediglich die Fotografie und ihre Briefe, die sie mir nach Edinburgh geschrieben hatte, wo ich Medizin studiert hatte.
Egal, wohin ich reiste, ihr Bild und ihre Worte reisten stets mit mir.
Ich war noch nicht in der Lage, mich von ihnen zu trennen.
Noch weniger war ich bereit, eine neue Liebe zu finden …
In meinem Herzen klaffte ein Loch, das nichts und niemand zu füllen vermochte. An diesem Ort lag alles in scharfen Scherben. Nicht einmal ich selbst konnte ihn betreten, ohne mich zu verletzen.
Doch nun hatte ich endlich etwas von ihr. Einen Gegenstand mit Bedeutung, etwas Echtes. Mehr als eine Erinnerung, die von Tag zu Tag verblasste und langsam verloren ging.
»Hörst du das Wispern, gar nicht fern? Suche nach dem Winterstern, Winterstern«, murmelte ich die Worte.
Beinahe ehrfürchtig zog ich die Spieluhr auf, erweckte sie zum Leben und stellte sie auf der staubigen Kiste ab. Was auch immer nun passierte, ich war bereit.
Silbrig erklang die Melodie des Wintersterns. Die Rose drehte sich unter dem Glas, öffnete mit jeder Umdrehung ihre Blütenblätter etwas weiter.
Darin lag ein zusammengefaltetes Stück Papier.
Die Spieluhr wurde langsamer, die Melodie erstarb.
Ich starrte noch immer auf das Geheimnis, das sie in ihrem Innersten verborgen hatte.
Was war es?
Ich wusste nicht, was ich erwartet hatte. Vielleicht eine erneute Heimsuchung. Flüsternden Nebel. Blutdurchtränktes Laub.
Aber sicher keinen zusammengefalteten Zettel.
Er erschien mir so profan und normal, dass es beinahe grotesk war.
Das Glas ließ sich leicht anheben. Sachte ergriff ich das Papier und faltete es auf.
Dort stand winzig klein in Annies Handschrift geschrieben:
Mein Ethan,
Du sagtest mir, dass es Dir jedes Mal unerträglich erscheint, wenn Du mich wieder verlassen und mit dem Zug nach Edinburgh fahren musst, um zu Deinem Studium zurückzukehren. Und auch mich schmerzt es immer wieder aufs Neue, mich von Dir zu trennen. Deine Besuche sind einfach zu kurz, die Zeit bis zu unserem Wiedersehen zu lang. Deshalb möchte ich Dir etwas von mir mitgeben.
Wann immer Du diese Melodie hörst, fühle Dich geküsst, mein Liebster. Wir sehen uns bald wieder.
Ich schenke Dir meinen Winterstern.
Deine Annabel
Mit zitternden Händen zog ich die Spieluhr erneut auf.
Über die Autorin:
Jasmin Präger wurde 1985 in Bietigheim-Bissingen geboren. Mit dem Schreiben begann sie als Kind mit einem Tagebuch über die wilden Abenteuer ihres Rabaukenkaters, das sie aufwendig illustrierte und heute noch besitzt. 2000 war sie Preisträgerin der ›7. Baden-Württembergischen Literaturtage‹ in Calw.
2004 reichte sie auf Drängen ihrer Deutschlehrerin eine Kurzgeschichte beim ›4. Landeswettbewerb für Deutsche Sprache und Literatur‹ ein, wurde Preisträgerin und bekam den Schillerpreis.
Danach tobte sie sich hauptsächlich mit Fanfictions und RPGs aus, doch in Wahrheit schlägt ihr Herz für ihre eigenen Geschichten. Wenn sie gerade nicht in der Welt ihrer Charaktere unterwegs ist, verbringt sie ihre Freizeit am liebsten mit ihrem Pudel Fips, Büchern, Rockkonzerten, klassischer Gitarre und Kunst.
Derzeit lebt sie in Calw im Nordschwarzwald und arbeitet an einem Romanprojekt.
Kontakt:
www.facebook.com/jasminaurel
Jamie L. Farley – Verloren
Über die Geschichte:
Am letzten Herbsttag jeder Dekade findet das Wintersternfest statt, an dem es möglich ist seine verstorbenen Liebsten wiederzusehen. Das Fest ist die letzte Chance des Assassinen Dûhirion, sich endgültig von seiner Geliebten zu verabschieden. Doch wird er als Dunkelelf in der Oberstadt geduldet?
Elanors Kopf lag ruhig auf seiner Brust, ihre nackte Haut schmiegte sich warm und vertraut an seine. Dûhirion strich ihr sanft durch das lange braune Haar. In Nächten wie diesen fühlte es sich ganz normal an, mit ihr zusammen zu sein.
»Hast du je von der Wintersternnacht gehört?«, fragte die Waldelfin leise mit halb geschlossenen Augen. »Sie findet in jedem zehnten Jahr statt, in den verbleibenden Stunden des letzten Herbsttages.«
Dûhirion blinzelte verschlafen. »Hm? Ich denke nicht, nein.« Er fuhr damit fort, ihr über den Kopf zu streichen. »Winterstern … so nennen deine Leute den Blauen Mond, oder?«
»Ja, die Waldelfen haben den Namen geprägt, aber inzwischen hat ihn der Volksmund übernommen. Weißt du, was ihn besonders macht? Sein Licht lässt die Grenze zwischen dem Reich der Toten und dem der Lebenden verschwinden. Die Seelen der Verstorbenen können das Jenseits verlassen und bis zum Sonnenaufgang unter uns wandeln.«
Elanors Finger wanderten über seine Brust und zeichneten sanft die tiefen Narben nach, die sich weiß von seiner dunkelgrauen Haut abhoben. Dûhirion brummte entspannt und schloss die Augen wieder.
»In dieser Nacht ist es möglich, seine verstorbenen Liebsten wiederzusehen«, sagte sie weiter und tippte gegen sein Brustbein. »Nicht als Geisterscheinung, sondern als Person aus Fleisch und Blut, wie zu Lebzeiten. Es ist ein wunderschönes Fest mit Tanz und Gesang. Die Städte werden herrlich dekoriert, alles ist hell erleuchtet.«
»Seltsam, dass ich nie davon gehört habe«, murmelte er träge.
»Nun … Dunkelelfen sieht man eher selten. Man würde sie dulden.«
Dûhirion öffnete überrascht sein sehendes Auge. »Würde man?«
Elanor nickte. »In dieser Nacht spielt das Blut keine Rolle. Aber die wenigsten Dunkelelfen wissen davon. Das ist eine Möglichkeit für die anderen Völker, sie vom Fest fernzuhalten.« Sie schüttelte den Kopf und schnaubte amüsiert. »Wenn es nach einigen Angehörigen meines Volkes ginge, würde das Fest ohnehin nur von uns Waldelfen gefeiert werden. Sie waren schon mürrisch, als Hochelfen und Menschen diesen Brauch übernommen haben. Jetzt feiert jeder die Wintersternnacht, sogar die Zwerge. Unsere Tradition ist nicht mehr einzigartig.«
»Welch grausames Schicksal«, spottete Dûhirion.
Elanor kicherte. »Mehr als du glaubst. Die meisten Waldelfen halten sich für etwas ganz Besonderes. Ich … würde meine Eltern beim kommenden Fest gern wiedersehen.«
Er hörte den Zweifel in ihrer Stimme. »Aber?«
Elanor seufzte. »Es gibt Voraussetzungen, um an der Zeremonie teilnehmen zu können«, entgegnete sie. »Man benötigt einen persönlichen Gegenstand des Toten und muss durch Liebe mit ihm verbunden sein. Und zuletzt braucht man ein spezielles Amulett. Es ist geweiht, mit rituellen Runen versehen und wirkt wie ein Leuchtfeuer für die suchende Seele.«
»Und … da liegt das Problem?«, fragte Dûhirion.
»Ich habe die Eheringe von Mama und Papa, aber die Amulette sind teuer«, antwortete Elanor mit einer Spur von Traurigkeit. »Und ehrlich gesagt fürchte ich mich davor, meinen Eltern gegenüberzutreten.«
»Du musst ihnen nichts von uns erzählen«, sagte er rasch.
Die Waldelfin schwieg für eine Weile. »Vermutlich wissen sie es ohnehin. Wer kann sagen, ob sie uns nicht wirklich vom Jenseits aus beobachten?«
»Ich hoffe nicht. Es lägen viel zu viele Augen auf mir«, erwiderte der Dunkelelf belustigt.
»Sie werden es verkraften. Außerdem wissen wir doch beide, dass du mich mit schwarzer Magie manipuliert und zu deiner Marionette gemacht hast. Das werden sie mir verzeihen«, sagte Elanor und boxte ihm sacht gegen den Oberarm, als er darüber lachte.
* * *
Bleiches Mondlicht fiel in das Zimmer und warf einen bedrohlichen Schatten auf das Bett. Leise näherte sich der Assassine seinem schlafenden Opfer und setzte ihm den Dolch an den Hals.
Der Stahl schnitt tief. Warmes Blut tränkte seine Handschuhe und Ärmel der schwarzen Assassinenkluft.
Ruckartig riss der Mann die Augen auf. Seine Hände schnellten hoch und drückten hilflos auf den Schnitt. Ein nasses Gurgeln drang aus seiner durchtrennten Kehle. Dickflüssige, rote Laute quollen zwischen seinen Lippen hindurch.
Ein schwerer, metallischer Geruch stieg dem Assassinen in die Nase und füllte seinen Mund mit dem Geschmack von Kupfer. Ungerührt beobachtete er den Todeskampf des Mannes. Als der Körper endlich erschlaffte, holte er den Kontrakt aus einer Tasche und befestigte ihn mit dem Dolch an der Brust des Opfers. So war es in der Gilde üblich.
Auf dem Vertrag war lediglich das Zeichen von Umbra abgebildet: ein schwarzer Vogelschädel. Die Menschen sollten wissen, dass es eine Schattenklinge gewesen war, die diesem Mann das Leben genommen hatte.
Eine ebenso einfache wie effektive Taktik, um Angst zu schüren.
Der Assassine warf sich die weite Kapuze über, die am Kragen seines Mantels befestigt war, und verließ den Tatort unauffällig. Er musste auf der Hut sein, die Oberstadt wurde besonders nachts streng bewacht. In den Schatten der Häuser wartete er darauf, dass sich eine Lücke zwischen den einzelnen Wachpatrouillen auftat, um ungesehen zu verschwinden.
Über einige Schleichwege erreichte er die breite Treppe, die von der noblen Oberstadt in das Elendsviertel führte. Als er zur Ausführung seines Auftrags aufgebrochen war, hatte er die beiden Wachposten, die diese Grenze sicherten, betäubt und stellte nun zufrieden fest, dass das Schlafmittel noch immer wirkte.
Er verlangsamte seine Schritte und trottete die Stufen hinab. Aschegrube nannten die Einwohner diesen Stadtteil verächtlich, in Anspielung auf die Dunkelelfen, die gezwungen waren, hier zu leben. Der ganze Dreck der Oberstadt floss hierher, die Luft war erfüllt von einem unerträglichen Gestank.
Der Mörder stieg über einen Obdachlosen hinweg, der am Fuß der Treppe lag und schlief. Alkohol mischte sich mit dem Geruch von Urin und Erbrochenem. Irgendjemand hatte ihm die Ohren abgeschnitten, die Wunden sahen frisch aus und waren entzündet. Das Leben eines Dunkelelfen war weniger wert als das eines tollwütigen Straßenköters. Ihnen die Ohren zu verstümmeln oder abzutrennen, war eine beliebte Methode anderer Elfenrassen, ihnen zu zeigen, dass sie nicht zu ihnen gehörten. Eine räudige Grauhaut verdiente es nicht, elfische Merkmale zu tragen.
Der Assassine erreichte seine Hütte und Erleichterung überkam ihn, als er die Tür hinter sich schloss. Das Adrenalin versiegte in seinen Adern und sein Körper wurde taub. Er spürte die Kälte in seinen Knochen und begann unkontrolliert zu zittern. Das Blut an seinen Händen wog schwer, in seinen Ohren echoten dumpf die gurgelnden Sterbenslaute seines Opfers. Er wollte raus aus der blutigen Kleidung, wollte sie und seine Schuld abstreifen und fortwerfen.
Gelähmt stand er in der Dunkelheit und alles, was er hörte, war sein Herz, das gegen seine Rippen hämmerte, als wollte es aus seinem Knochenpanzer brechen. Ein Schrei hallte ohrenbetäubend durch seinen Verstand, doch blieb ihm im Hals stecken. Er presste die Kiefer aufeinander, die Handballen auf seine Schläfen und wartete darauf, dass es vorbeiging.
So etwas passierte häufiger. Das war normal. Es würde gleich aufhören. Er zählte innerlich bis zehn.
Zwei schlanke Arme legten sich um ihn und Elanors Stimme durchdrang sanft seine Panik.
»Schht. Alles ist gut, Dûhirion«, flüsterte sie. »Du bist zu Hause. Ich bin bei dir, Liebster.«
Sein Zittern ließ etwas nach. Sie sprach seinen Namen aus, um ihn daran zu erinnern, wer er war. Er war kein Werkzeug von Umbra. Nicht etwas, sondern jemand.
Liebster. Geliebter.
Elanor führte ihn in einen Nebenraum und entkleidete ihn behutsam. Stück für Stück nahm sie die schmutzige Kleidung von ihm und half ihm anschließend, in die Badewanne zu steigen. Das Wasser war überraschend warm. Angenehmer Seifengeruch verdrängte den Gestank des Todes. Sie wusch ihn sorgfältig und Dûhirion entspannte sich.
»Ich bin der Toten müde«, murmelte er.
Die Waldelfin legte eine Hand an seine Wange. »Bald«, sagte sie leise. »Wir werden von hier fliehen. Weg von dieser Stadt, ihren verfluchten Einwohnern und der Gilde. Wir werden frei sein.«
Wenn er ihr doch nur glauben könnte. Niemand entkam Umbra lebend. Die Gilde war mächtig und weltweit vernetzt. Entweder diente man ihr oder man starb durch sie. Es gab keine Alternative.
Elanor küsste ihn zärtlich. »Ich liebe dich«, flüsterte sie.
Dûhirion wollte den Kuss erwidern, streckte seine Hände nach ihr aus und griff ins Leere. Der Druck ihrer Lippen auf seinen verschwand. Das Wasser wurde kalt und der Seifengeruch wich dem von Schmutz und Moder. Er öffnete die Augen, starrte ins dunkle Zimmer und erinnerte sich.
Elanor war seit drei Jahren tot, dahingerafft von der Schwindsucht. Sie war einsam in einem Krankenlager gestorben. Ausgerechnet in ihren letzten Stunden hatte er nicht bei ihr sein können. Ein Auftrag der Gilde hatte ihn zu weit fortgeführt.
Es gab niemanden, an dem er sich dafür rächen, auf den er seine Wut lenken konnte. Er hatte den Moment gefürchtet, in dem er sie für immer verlor, und als der Tag gekommen war, war etwas in ihm zerbrochen. Etwas, das nur durch sie ein Ganzes gewesen war.
Schwerfällig stieg er aus der Badewanne und kleidete sich an. Eine verschlissene, dunkelbraune Hose und ein ergrautes Leinenhemd, seine Füße blieben nackt.
Unter einer losen Bodendiele holte er eine verschlossene Schatulle aus ihrem Versteck. Dûhirion ließ sich auf seiner Holzpritsche nieder und öffnete den Deckel der kleinen Truhe. Das Wintersternamulett, das sie von ihrem Onkel geschenkt bekommen hatte, und ihr Lieblingsring lagen darin. Elanor hatte gewusst, dass ihre Zeit gekommen war, als sie ihm die Schatulle gegeben hatte. Sie hatte gewusst, dass er sie auf ihrem letzten Weg nicht begleiten konnte. Es war ihre Abschiedsbotschaft, ein letzter Gruß und das Versprechen auf ein Wiedersehen.
Er legte sich das Amulett um den Hals. Die Wintersternnacht, die er seit drei Jahren ungeduldig erwartete, würde in einer Woche sein.
Aus der Spiegelung im Fenster gegenüber starrte ihn ein Fremder an. Er hatte kurzes schwarzes Haar, das ihm nass in die Stirn fiel, und die charakteristische anthrazitfarbene Haut der Dunkelelfen. Ungezählte Narben bedeckten seinen Körper. Sie waren Zeugen der Grausamkeiten, die er durch Umbra erfahren musste. Jede von ihnen eine Erinnerung an jahrelange Misshandlung und Gewalt. Sein linkes Auge war blind. Milchig-weiß und trüb verlor es sich in der Leere, während das sehende ihn mit stechend roter Iris fixierte. Das Gesicht war eine Maske, sein Blick hart und kalt.
Warum wusste er, wie man ein Leben nahm, aber nicht, wie man eines schenkte?
Dûhirion hatte Erfahrung damit, wie tief er eine Klinge in das Fleisch seines Opfers senken musste, um das Herz zu durchbohren. Er kannte den Verlauf aller wichtigen Schlagadern und wie weit sie unter der Haut lagen. Er wusste, wie lange er einen Hals zudrücken musste, bis der Körper aufgab. Er kannte hunderte Wege, um ein Leben zu beenden.
Er hätte nicht gezögert, hätte er nur gewusst, wie man ein Leben rettete.
* * *
»Wie waren sie?«, fragte Dûhirion leise. »Deine Eltern, meine ich.«
Elanor zuckte mit den Schultern. »Mein Vater war Händler, meine Mutter Schneiderin. Von ihr habe ich das Handwerk gelernt. Sie führten gemeinsam eine kleine Schneiderei, die mein Onkel nach ihrem Tod übernommen hat.« Eine kurze Pause entstand und sie fügte wehmütig hinzu: »Sie waren herzensgute Elfen und ich vermisse sie sehr.«
»Darf ich fragen, wie sie gestorben sind?«, sprach der Dunkelelf vorsichtig.
Elanor schlug die Augen nieder. »Ein Überfall«, antwortete sie. »Sie haben gemeinsam Stoffe auf dem Markt gekauft und sind in einen Hinterhalt geraten. Die Räuber haben sich wahrscheinlich mehr erhofft und sie aus reiner Wut über die karge Beute getötet. Hätten sie den Wert der Stoffe gekannt, würden meine Eltern vielleicht noch leben.«
Dûhirion schwieg.
»Was ist mit deinen Eltern?«, fragte Elanor.
»Meinen Vater kenne ich nicht«, erwiderte er gleichmütig. »Und meine Mutter war nicht willens, einen Bastard großzuziehen. Sie hat mich an Umbra verkauft.«
Elanor hob bestürzt den Kopf. »Deine … deine eigene Mutter war es, die dich dieser Assassinengilde ausgesetzt hat?«
»Es hat ihr Geld eingebracht und war somit ergiebiger, als mich zu ertränken. Letztendlich lief es aber auf das Gleiche hinaus. Die Ausbildung ist ebenso tödlich wie die Gilde selbst. Nur wenige überleben sie und dürfen sich am Ende Schattenklinge nennen.«
Erneut legte sich Stille über die beiden Elfen und gerade als Dûhirion glaubte, Elanor wäre eingeschlafen, sprach sie wieder.
»Wenn du die Chance hättest … würdest du die Gilde verlassen?«
»Ja«, antwortete er, ohne zu zögern.
Sie nickte abwesend, wie zur Bestätigung seiner Antwort. »Dann lass uns von hier verschwinden!«
Dûhirion blinzelte überrascht. »Was?«
»Lass uns gehen!«, wiederholte Elanor ernst. »Raus aus der Stadt, raus aus diesem Leben. Wir fangen irgendwo neu an.«
»Elanor …«
»Natürlich werden wir einiges vorbereiten müssen«, unterbrach die Waldelfin ihn eilig. »Wir brauchen Gold, einen genauen Plan … Wenn es eine Zukunft für uns geben soll, dann findet sie nicht hier statt.«
Es klang verrückt. Es klang unmöglich. Es klang nach der Hoffnung, nach der er immer gesucht hatte. Soweit er zurückdenken konnte, hatte ihn sein Pfad durch Dunkelheit geführt. Schon als Knabe hatte er lernen müssen, dass sein Leben entbehrlich war. »Du gehörst uns«, war das Erste gewesen, das sein Ausbilder zu ihm gesagt hatte. »Du bist unsere Waffe. Merk dir das! Du bist weder Elf noch Mann oder Lebewesen. Du bist unsere Waffe. Wenn wir dir befehlen, zu töten, dann töte! Wenn du die Hand schneidest, die dich führt, werden wir dich bestrafen. Wenn du stumpf wirst, entsorgen wir dich.«
Seinen ersten Mord hatte er im Alter von zehn Jahren begangen. Er verfolgte ihn bis heute in seinen Träumen. »Du wirst schweigen«, hatten sie gesagt. »Wir sorgen dafür, dass du uns niemals verraten wirst. Weder unter Folter noch unter dem Einfluss von Magie. Was auch immer sie dir antun werden, du wirst schweigen.«
Dûhirion hatte standgehalten und war zu Umbras Waffe, einer Schattenklinge, geworden. Er hatte als ihr Werkzeug existiert, hatte stumpf funktioniert. Dunkelheit war alles gewesen, was er gekannt hatte. Er war weit in sie vorgedrungen, hatte sich von ihr verschlingen lassen und war selbst zu ihr geworden.
Bis er Elanor kennengelernt hatte. Sie hatte beobachtet, wie er sich auf dem Markt mit einem Bäcker gestritten hatte, der sich geweigert hatte, ihm Brot zu verkaufen. Unerwartet war sie an seine Seite getreten, hatte das Brot erworben und es ihm vor den ungläubigen Augen des Bäckers in die Hände gedrückt. Aus dieser zufälligen Begegnung hatte sich eine Freundschaft entwickelt, und aus ihr war Liebe entwachsen.
Sein Leben lang war ihm beigebracht worden, dass das, was er fühlte, falsch war. Mitleid, Zuneigung, Fürsorge – alles, was ihn emotional an eine andere Person binden konnte. Gefühle waren eine Schwäche, und Schwäche bedeutete seinen Tod. Er hatte sie tief in sich vergraben, Mauern um sein Inneres errichtet und so getan, als würde er nicht merken, dass es ihm die Seele zerfetzte.
Dann hatte ihn die Elfin zum ersten Mal geküsst und seine gesamte Welt hatte sich verändert. Sie wurde zu dem strahlenden Licht, das ihn aus der Dunkelheit führte.
Mit ihrer Beziehung brachen sie alle Regeln. Dunkelelfen hatten keine Rechte, die übrigen Völker – Menschen, Zwerge, andere Elfenrassen – hatten sie aus der Gesellschaft ausgestoßen. Ihnen wurde kein normales Leben zugebilligt. Eine Waldelfin und ein Dunkelelf als Liebende waren bestenfalls ein Skandal und schlimmstenfalls brachten sie ihr Todesurteil über sie beide.
Allein der Kuss wäre ein Grund, Elanor aus der Oberstadt zu verbannen und Dûhirion für die nächsten Jahre in den Kerker zu werfen. Und er wollte sich nicht ausmalen, was geschehen würde, sollte Umbra je von Elanor erfahren.