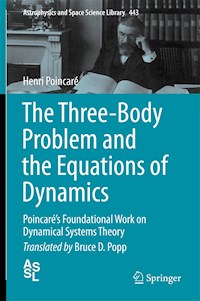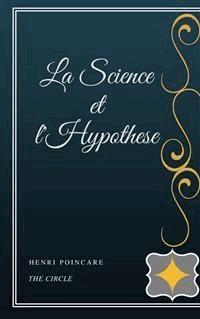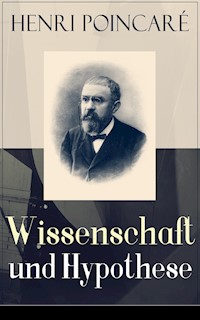
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Wissenschaft und Hypothese" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Das Werk gliedert sich in vier Teile. "Zahl und Größe"(Teil I.) beschäftigt sich zuerst mit der Möglichkeit von Mathematik. Ist Mathematik bloß ein tautologisches Unternehmen, ein System analytischer Urteile, welche alle auf Identität zurückführen? "Der Raum" (Teil II.) beschäftigt sich mit Geometrie (welche er nicht gemeinsam mit Mathematik behandelt wissen will). Geometrie entspringt der Erfahrung fester Gegenstände in der Natur, sie ist aber keine Erfahrungswissenschaft - sie idealisiert diese Körper und vereinfacht damit die Natur. Poincaré stellt verschiedene Geometrie-Axiomensysteme vor, bezeichnet sie als "Sprachen". "Die Kraft" (Teil III.) widmet sich zunächst der Mechanik und stellt die Grundfrage, ob ihre Grundprinzipien veränderbar seien - Poincaré stellt die Empirie britischer Tradition der kontinentalen deduktiven Methode gegenüber. Der letzte Teil "Die Natur" beginnt mit einer Erkenntnistheorie. Poincarés Erkenntnisquelle ist zunächst einzig das Experiment und die Verallgemeinerung, er erkennt, dass diese nicht frei von Weltanschauung ist und "…man darf daher niemals eine Prüfung von der Hand weisen…". Henri Poincaré (1854-1912) war ein bedeutender französischer Mathematiker, theoretischer Physiker, theoretischer Astronom und Philosoph. Poincarés Werk zeichnet sich durch Vielfalt und hohe Originalität aus; zu seiner außergewöhnlichen mathematischen Begabung kam auch ein hohes Maß an Intuition, doch auch Zurückhaltung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wissenschaft und Hypothese
Inhaltsverzeichnis
Vorwort.
Wenige Forscher sind sowohl in der reinen als in der angewandten Mathematik mit gleichem Erfolge schöpferisch tätig gewesen, wie der Verfasser des vorliegenden Werkes. Niemand war daher mehr als er berufen, sich über das Wesen der mathematischen Schlußweisen und den erkenntnistheoretischen Wert der mathematischen Physik im Zusammenhange zu äußern. Und wenn auch in diesen Gebieten die Ansichten des einzelnen zum Teil von subjektiver Beanlagung und Erfahrung abhängen, werden doch die Entwicklungen des Verfassers überall ernste und volle Beachtung finden, um so mehr, als sich derselbe bemüht, auch einem weiteren, nicht ausschließlich mathematischen Leserkreise verständlich zu werden, und ihm dies durch passende und glänzend durchgeführte Beispiele in hohem Maße gelingt.
Die Erörterungen erstrecken sich auf die Grundlagen der Arithmetik, die Grundbegriffe der Geometrie, die Hypothesen und Definitionen der Mechanik und der ganzen theoretischen Physik sowohl in ihrer klassischen Form als in ihrer neuesten Entwicklung.
In betreff der gewonnenen Resultate muß auf das Werk selbst verwiesen werden. Um den Standpunkt des Verfassers zu bezeichnen, wird es genügen, einige charakteristische Sätze herauszugreifen, deren Gehalt man allerdings nur im Zusammenhange des Ganzen erfassen wird:
„Der Verstand hat von dieser Macht (d. i. der Geisteskraft, welche überzeugt ist, sich die unendliche Wiederholung eines und desselben Schrittes vorstellen zu können) eine direkte Anschauung, und die Erfahrung kann für ihn nur eine Gelegenheit sein, sich derselben zu bedienen und dadurch derselben bewußt zu werden“ (S. 13).
„Die geometrischen Axiome sind weder synthetische Urteile a priori noch experimentelle Tatsachen; es sind auf Übereinkommen beruhende Festsetzungen bez. verkleidete Definitionen. Die Geometrie ist keine Erfahrungswissenschaft; aber die Erfahrung leitet uns bei Aufstellung der Axiome; sie läßt uns nicht erkennen, welche Geometrie die richtige ist, wohl aber, welche die bequemste ist. Es ist ebenso unvernünftig zu untersuchen, ob die fundamentalen Sätze der Geometrie richtig oder falsch sind, wie es unvernünftig wäre zu fragen, ob das metrische System richtig oder falsch ist“ (S. 51, 73 u. 138).
„Das Trägheitsgesetz, das in einigen besonderen Fällen erfahrungsmäßig bewiesen ist, kann ohne Furcht auf die allgemeinsten Fälle ausgedehnt werden, weil wir wissen, daß in diesen Fällen die Erfahrung das Gesetz weder bekräftigen noch entkräften kann“ (S. 99).
„Das Prinzip der Gleichheit von Wirkung und Gegenwirkung darf nicht als ein experimentelles Gesetz, sondern muß als eine Definition angesehen werden“ (S. 102).
„Die Erfahrung kann den Prinzipien der Mechanik als Grundlage dienen und dennoch ihnen niemals widersprechen“ (S. 107).
„Die Prinzipien der Mechanik sind Übereinkommen und verkleidete Definitionen. Sie sind von experimentellen Gesetzen abgeleitet; diese Gesetze sind sozusagen als Prinzipe hingestellt, denen unser Verstand absolute Gültigkeit beilegt“ (S. 140).
„Wenn man das Prinzip von der Erhaltung der Energie in seiner ganzen Allgemeinheit aussprechen und auf das Universum anwenden will, so sieht man es sich sozusagen verflüchtigen, und es bleibt nichts übrig als der Satz: Es gibt ein Etwas, das konstant bleibt“ (S. 134).
„Das Experiment ist die einzige Quelle der Wahrheit; die mathematische Physik hat die Aufgabe, die Verallgemeinerung so zu leiten, daß der Nutzeffekt der Wissenschaft vermehrt wird“ (S. 144).
„Jede Verallgemeinerung setzt bis zu einem gewissen Grade den Glauben an die Einheit und die Einfachheit der Natur voraus. Es ist nicht sicher, daß die Natur einfach ist“ (S. 152).
„Die mathematische Wissenschaft hat nicht den Zweck, uns über die wahre Natur der Dinge aufzuklären. Ihr einziges Ziel ist, die physikalischen Gesetze miteinander zu verbinden, welche die Erfahrung uns zwar erkennen ließ, die wir aber ohne mathematische Hilfe nicht aussprechen können“ (S. 212).
„Es kümmert uns wenig, ob der Äther wirklich existiert; wesentlich ist nur, daß alles sich abspielt, als wenn er existierte, und daß die Hypothese für die Erklärung der Erscheinungen bequem ist“ (ibid.).
„Was die Wissenschaft erreichen kann, sind nicht die Dinge selbst, sondern es sind einzig die Beziehungen zwischen den Dingen; außerhalb dieser Beziehungen gibt es keine erkennbare Wirklichkeit“ (S. XIII).
Man wird bemerken, daß wir damit wieder auf Kants Ausspruch zurückkommen, wonach der Verstand die Gesetze nicht aus der Natur schöpft, sondern sie dieser vorschreibt und die oberste Gesetzgebung der Natur in uns selbst, d. h. in unserm Verstände liegt, oder auf Goethes Wort: „Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis“, das man auf den gleichen Gedanken beziehen wird, wenn man sich die Relativität aller Erkenntnisse zum Bewußtsein bringt. Solchen allgemeinen Aussprüchen kommt eine hohe subjektive Bedeutung zu, denn sie befriedigen in gewissem Sinne unser Bedürfnis nach einem Abschlüsse der Forschung und Erkenntnis. Für den empirischen Forscher aber gibt es keinen derartigen Abschluß; jeder allgemeine Ausspruch bedarf für ihn der ständigen Prüfung an der Hand der Erfahrung und hat für ihn nur so lange Gültigkeit, als er sich in Übereinstimmung mit der Erfahrung befindet, mag es sich um eine allgemeine Denknotwendigkeit unseres Geistes oder um einen speziellen Lehrsatz der exakten Wissenschaft handeln. Denn für solche Erfahrung sind nicht nur die eigentlichen Beobachtungen der Natur maßgebend, sondern auch die inneren Erfahrungen des menschlichen Verstandes. Nichts zeigt klarer, wie sehr der letztere der Ausbildung, der Verfeinerung und der Vervollkommnung fähig ist, als die Geschichte der Mathematik im letzten Jahrhundert. Die eigenen Schöpfungen des menschlichen Verstandes geben hier wieder das Erfahrungsmaterial, auf dem sich weitere Forschungen aufbauen; manche Wahrheit, die für alle Zeiten sicher begründet schien, wird heute in ihrer Gültigkeit beschränkt oder auf neue „einwandfreie“ Weise erschlossen ; und wir sind nicht sicher, daß nicht neue Zweifel und neue Einwände unsere Nachkommen zu erneuten Anstrengungen in gleicher Richtung veranlassen werden.
Auch wer sich nicht auf diesen rein empirischen Standpunkt stellt, wird das Bedürfnis empfinden, die leitenden Grundgedanken auf den oft verschlungenen Wegen der exakten Wissenschaften zu verfolgen, und er wird sich gern der Führung des Verfassers anvertrauen, um die üppig wuchernden Ranken beiseite zu biegen, die sich zwischen den festen Stämmen unserer Erkenntnis verbindend ausbreiten, und sich dadurch den freien Ausblick zu wahren. Die scheinbar spielende Leichtigkeit, mit welcher dies Ziel durch den Verfasser meist erreicht wird, war es, wodurch wenigstens mein Interesse an dem Werke besonders geweckt wurde.
Nicht so sehr auf die gewonnenen Resultate ist im vorliegenden Werke das Hauptgewicht zu legen, sondern auf die Methode der Behandlung; und die vom Verfasser befolgte Methode ist dieselbe, welche bei Erforschung der Grundlagen von Geometrie und Arithmetik in den letzten Dezennien zu so reichen und vorläufig befriedigenden Ergebnissen geführt hat. Sie besteht darin, daß man eine erfahrungsmäßig zulässige Hypothese, deren Zusammenhang mit ändern Voraussetzungen zu untersuchen ist, durch eine Annahme ersetzt, die zwar auch unser logisches Denken befriedigt, aber nicht mit der Erfahrung in Einklang steht, und daß man dadurch die gegenseitige Abhängigkeit verschiedener Hypothesen oder Axiome zu evidenter Anschauung bringt.
Dem Fachmann ist ein großer Teil der Entwicklungen (zumal der späteren Kapitel) aus anderen Schriften des Verfassers bekannt, aber auch ihm wird eine zusammenfassende Darstellung willkommen sein. Ganz besonders gebe ich mich der Hoffnung hin, daß in einer Zeit, wo so leicht der Sinn für den Zusammenhang unserer Erkenntnis unter der Hingabe an die Einzelforschung leidet, die nachfolgenden Darlegungen für die studierende Jugend emeutV er-anlassung bieten mögen, sich dem Studium der Grundlagen und der Grundbegriffe unserer Wissenschaft zu widmen.
Zur Erreichung dieses Zieles habe ich der deutschen Ausgabe zahlreiche Anmerkungen hinzugefügt, die teils einzelne Stellen des Werkes näher erläutern, teils durch literarische Nachweisungen dem Leser die Mittel zu weiterem Studium der besprochenen Fragen an die Hand geben. Auf irgendwelche systematische Vollständigkeit kam es dabei nicht an. Besonders dort konnten diese Bemerkungen kürzer gehalten werden, wo ich wegen weiterer Ausführungen auf andere Werke des Verfassers verweisen konnte.
Wenn es gelungen sein sollte, der oft bilderreichen Sprache des Verfassers auch bei der Übertragung ins Deutsche gerecht zu werden, so hat daran meine Frau einen wesentlichen Anteil, indem sie die eigentlich technische Arbeit der Übersetzung durchgeführt hat.
München, im Januar 1904. F. Lindemann.
Einleitung.
Für einen oberflächlichen Beobachter ist die wissenschaftliche Wahrheit über jeden Zweifel erhaben; die wissenschaftliche Logik ist unfehlbar, und wenn die Gelehrten sich hie und da täuschen, so geschieht es nur, weil sie die Regeln der Logik verkannten.
„Die mathematischen Wahrheiten werden durch eine Kette untrüglicher Schlüsse aus einer kleinen Anzahl evidenter Sätze abgeleitet; sie drängen sich nicht nur uns, sondern der ganzen Natur auf. Sie fesseln sozusagen den Schöpfer und gestatten ihm nur zwischen einigen verhältnismäßig wenig zahlreichen Lösungen zu wählen. Einige Experimente werden dann genügen, um zu erfahren, welche Wahl er getroffen hat. Aus jedem Experimente können durch eine Reihe mathematischer Deduktionen eine Menge Folgerungen hervorgehen, und auf diese Weise läßt uns jedes Experiment einen Winkel des Weltalls erkennen.“
So ungefähr denken sich viele Leute, besonders die Schüler, welche die ersten physikalischen Begriffe kennen lernen, den Ursprung der wissenschaftlichen Gewißheit. So fassen sie die Rolle des Experimentes und der Mathematik auf. Und dieselbe Auffassung hatten vor hundert Jahren viele Gelehrte, welche in ihren Träumen die Welt konstruieren und dabei der Erfahrung möglichst wenige Materialien entlehnen wollten.
Als man ein wenig mehr nachdachte, bemerkte man, «in wie großer Platz der Hypothese eingeräumt war; man sah, wie der Mathematiker ihrer nicht entraten kann und wie der Experimentator sie noch weniger missen kann. Darauf fragte man sich, ob wohl dieses Gebäude solid genug wäre, und man glaubte, daß ein Hauch es stürzen könnte. Derartig skeptisch urteilen, hieße oberflächlich sein. Entweder alles anzweifeln oder alles glauben, das sind zwei gleich bequeme Lösungen; die eine wie die andere erspart uns das Denken.
Anstatt eine summarische Verurteilung auszusprechen,, müssen wir mit Sorgfalt die Rolle der Hypothese prüfen; wir werden dann erkennen, daß sie notwendig und ihrem Inhalte nach berechtigt ist. Wir werden dann auch sehen, daß es mehrere Arten von Hypothesen gibt, daß die einen verifizierbar sind und, einmal vom Experimente bestätigt, zu fruchtbringenden Wahrheiten werden; daß die anderen, ohne uns irrezuführen, uns nützlich werden können, indem sie unseren Gedanken eine feste Stütze geben; daß schließlich noch andere nur scheinbare Hypothesen sind und sich auf Definitionen oder verkleidete Übereinkommen und Festsetzungen zurückführen lassen.
Diese letzteren finden wir hauptsächlich in der Mathematik und in den ihr verwandten Wissenschaften. Gerade hieraus schöpfen diese Wissenschaften ihre Strenge; diese Übereinkommen sind das Werk der freien Tätigkeit unseres Verstandes, der in diesem Gebiete kein Hindernis kennt. Hier kann unser Verstand behaupten, weil er befiehlt; aber verstehen wir uns recht: diese Befehle beziehen sich auf unsere Wissenschaft, welche ohne dieselben unmöglich wäre; sie beziehen sich nicht auf die Natur. Sind diese Befehle nun willkürlich? Nein, denn sonst würden sie unfruchtbar sein. Das Experiment läßt uns freie Wahl, aber es leitet diese Wahl, indem es uns hilft, den bequemsten Weg einzuschlagen. Unsere Befehle werden also gleich denen eines absoluten, aber weisen Fürsten sein, der zuerst .seinen Staatsrat befragt.
Manche sind darüber verwundert, daß man gewissen fundamentalen Prinzipien der Wissenschaft den Charakter freier konventioneller Festsetzungen beilegen soll. Sie haben übermäßig verallgemeinern wollen und dabei vergessen, daß Freiheit nicht Willkür ist. Sie gelangten so zu dem sogenannten „Nominalismus“ und sie fragten sich, ob der Gelehrte sich nicht durch seine Definitionen betrügen läßt und ob die Welt, die er zu entdecken glaubt, nicht einfach nur durch die Willkür seiner Laune geschaffen ist.1) Bei diesem Standpunkte wäre die Wissenschaft sicher begründet, aber sie wäre ihrer Tragweite beraubt.
Wenn dem so wäre, so wäre die Wissenschaft ohnmächtig. Nun haben wir aber jeden Tag ihren Einfluß vor Augen. Das könnte nicht der Fall sein, wenn sie uns nicht etwas Reelles erkennen ließe; aber was sie erreichen kann, sind nicht die Dinge selbst, wie die naiven Dogmatiker meinen, sondern es sind einzig die Beziehungen zwischen den Dingen; außerhalb dieser Beziehungen gibt es keine erkennbare Wirklichkeit.
Zu dieser Erkenntnis werden wir gelangen, aber bis wir so weit sind, müssen wir die Reihe der Wissenschaften, von der Arithmetik und der Geometrie an bis zur Mechanik und experimentellen Physik, durchgehen.
Welcher Art ist die Natur der mathematischen Schlußweise? Ist sie, wie man gewöhnlich glaubt, wirklich deduktiv? Eine tiefergehende Analyse zeigt uns, daß sie es nicht ist, daß sie in gewissem Grade an der Natur der induktiven Schlußweise Anteil hat und gerade dadurch so fruchtbringend ist. Sie bewahrt deshalb nicht weniger ihren Charakter absoluter Genauigkeit; das haben wir zuerst zu zeigen.
Indem wir jetzt eines der Hilfsmittel genauer kennen, welches die Mathematik dem Forscher an die Hand gibt, haben wir einen anderen fundamentalen Begriff zu analysieren, nämlich denjenigen der mathematischen Größe. Finden wir sie in der Natur vor oder sind wir es, die sie in die Natur hineinlegen? Riskieren wir nicht im letzteren Falle, alles zu verderben? Wenn wir die grob organisierten Angaben unserer Sinne mit dieser außerordentlich komplizierten und feinen Vorstellung vergleichen, welche die Mathematiker als Größe bezeichnen, so müssen wir gezwungenermaßen einen Unterschied bemerken; diesen Rahmen, in welchen wir alles einfügen wollen, haben wir selbst hergestellt; aber wir haben ihn nicht auf gut Glück gemacht, wir haben ihn sozusagen nach Maß angefertigt und darum können wir die Tatsachen hineinbringen, ohne ihrer Natur das Wesentliche zu nehmen.
Ein anderer Rahmen, den wir der Welt anpassen, ist der Raum. Woher stammen die ersten Grundlagen der Geometrie? Sind sie uns durch die Logik auferlegt? Lobatschewsky hat das Gegenteil bewiesen, indem er die nicht-Euklidische Geometrie schuf. Ist der Raum uns durch unsere Sinne offenbart? Ebenfalls nicht, denn der Raum, den uns unsere Sinne zeigen können, unterscheidet sich absolut von dem geometrischen Raume. Hat die Geometrie ihren Ursprung in der Erfahrung? Eine gründlichere Erörterung zeigt uns, daß dies nicht der Fall ist. Wir schlußfolgern also, daß die Grundlagen nur Übereinkommen sind; aber diese Übereinkommen sind nicht willkürlich, und wenn wir in eine andere Welt versetzt würden, welche ich die nicht-Euklidische Welt nenne und die ich mir vorzustellen versuche, so müßten wir zu anderen Übereinkommen gelangen.
In der Mechanik werden wir zu analogen Schlußsätzen geführt und wir sehen, daß die Prinzipe dieser Wissenschaft, obgleich sie sich direkt auf das Experiment stützen, ebenfalls an dem konventionellen Charakter der geometrischen Postulate beteiligt sind. Bis hier triumphiert der Nominalismus, aber wir kommen zu den eigentlichen physikalischen Wissenschaften. Da ändert sich das Schauspiel; wir treffen eine andere Art von Hypothesen und wir sehen deren ganze Fruchtbarkeit. Ohne Zweifel erschienen uns zuerst die Theorien hinfällig, und die Geschichte der Wissenschaft beweist uns, daß sie vergänglich sind: sie sind aber dennoch nicht ganz vergangen , von jeder ist etwas übriggeblieben. Dieses Etwas muß man sich bemühen herauszusuchen, weil nur dieses und dieses allein der Wirklichkeit wahrhaft entspricht.
Die Methode der physikalischen Wissenschaften beruht auf der Induktion, welche uns die Wiederholung einer Erscheinung erwarten läßt, wenn die Umstände sich wiederholen, unter welchen sie sich das erste Mal darbot. Wenn alle diese Umstände sich auf einmal wiederholen könnten, so könnte dieses Prinzip ohne Gefahr angewendet werden: aber das wird niemals Vorkommen; einige dieser Umstände werden immer fehlen. Sind wir absolut sicher, daß sie ohne Wichtigkeit sind? Gewiß nicht. Das kann wahrscheinlich sein, es kann aber nicht wirklich gewiß sein. Darum spielt der Begriff der Wahrscheinlichkeit eine bedeutende Rolle in den physikalischen Wissenschaften. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung ist also nicht nur ein Zeitvertreib oder ein Führer für die Baccaratspieler, und wir müssen versuchen, ihre Prinzipe fester zu begründen. In dieser Beziehung kann ich nur unvollkommene Resultate geben; so sehr widerstrebt der unbestimmte Instinkt, welcher uns den Begriff der Wahrscheinlichkeit fassen läßt, der Analyse.
Nachdem wir die Bedingungen, unter welchen der Physiker arbeitet, studiert haben, hielt ich es für richtig, ihn dem Leser bei der Arbeit zu zeigen. Dazu nahm ich einige Beispiele aus der Geschichte der Optik und derjenigen der Elektrizität. Wir werden sehen, von wo die Ideen Fresnels und diejenigen Maxwells ausgegangen sind, und welche unbewußten Hypothesen Ampère und die anderen Begründer der Elektrodynamik machten.
H. P.
1 Vergl. Le Roy, Science et Philosophie (Revue de Métaphysique et de Morale 1901).
Erster Teil.Zahl und Größe.
Erstes Kapitel.Ober die Natur der mathematischen Schlußweisen.
I.
Die Möglichkeit der Existenz einer mathematischen Wissenschaft scheint ein unlösbarer Widerspruch in sich zu sein. Wenn diese Wissenschaft nur scheinbar deduktiv ist, woher kommt ihr dann diese vollkommene Un-widerlegbarkeit, welche niemand zu bezweifeln wagt? Wenn im Gegenteil alle Behauptungen, welche sie aufstellt, sich auseinander durch die formale Logik ableiten lassen, warum besteht die Mathematik dann nicht in einer ungeheueren Tautologie? Der logische Schluß kann uns nichts wesentlich Neues lehren, und wenn alles vom Prinzipe der Identität ausgehen soll, so müßte auch alles darauf zurückzufuhren sein. Dann müßte man also zugeben, daß alle diese Lehrsätze, welche so viele Bände füllen, nichts anderes lehren, als auf Umwegen zu sagen, daß A gleich A ist.
Man kann ohne Zweifel zu den Axiomen zurückgehen, welche an der Quelle aller dieser Betrachtungen stehen. Wenn man meint, sie auf das Prinzip des Widerspruches nicht zurückfuhren zu können, wenn man noch weniger in ihnen erfahrungsmäßige Tatsachen sehen will, welche an der mathematischen Notwendigkeit keinen Anteil haben, so hat man doch noch immer den Ausweg, sie den synthetischen Urteilen a priori einznreihen. Das heißt aber nicht, die Schwierigkeit lösen, sondern ihr nur einen Namen geben; und wenn selbst die Natur der synthetischen Urteile für uns kein Geheimnis wäre, so würde der Widerspruch nicht hinfällig, er würde nur hinausgeschoben; die syllogistische Beweisführung bleibt unfähig, den gegebenen Voraussetzungen irgend etwas hinzuzufugen; diese Voraussetzungen reduzieren sich auf einige Axiome, und man könnte in den Folgerungen nichts anderes wiederfinden.
Kein Lehrsatz würde neu sein, bei dessen Beweis nicht ein neues Axiom in Frage käme. Die logische Durchführung könnte uns nur die unmittelbar evidenten Wahrheiten geben, welche der direkten Anschauung entlehnt sind. Sie wäre nichts anderes als ein überflüssiges Zwischenglied der Betrachtung; und würde man auf diese Weise nicht dahin kommen sich zu fragen, ob dieser ganze syllogistische Apparat nur dazu dient, um zu verschleiern , inwieweit wir der Anschauung etwas entlehnt haben?
Der Widerspruch wird uns noch mehr auffallen, wenn wir irgend ein mathematisches Buch aufschlagen; auf jeder Seite wird der Verfasser die Absicht ankündigen, einen schon bekannten Satz zu verallgemeinern. Kommt dieses nun daher, daß die mathematische Methode vom Besonderen zum Allgemeinen fortschreitet, und wie kann man sie dann deduktiv nennen?
Wenn endlich die Wissenschaft der Zahl rein analytisch wäre, oder wenn sie von einer kleinen Anzahl synthetischer Urteile nach analytischer Methode ausgehen könnte, so vermöchte ein genügend starker Verstand mit einem Blicke scheinbar alle Wahrheiten zu übersehen; was sage ich! man könnte sogar hoffen, eines Tages eine hinreichend einfache Sprache zu erfinden, um sie so auszudrücken, daß sie auch einem gewöhnlichen Verstandesvermögen ebenso unmittelbar einleuchten.
Wenn man es ablehnt, diese Folgerungen zuzulassen, so muß man doch zugeben, daß die mathematische Überlegung an sich eine Art schöpferischer Kraft enthält und sich dadurch von der syllogistischen Schlußweise unterscheidet.
Der Unterschied muß sogar tiefgehend sein. Wir werden zum Beispiel den Schlüssel zu dem Geheimnisse nicht in dem öfteren Gebrauche des Gesetzes finden, nach welchem eine und dieselbe eindeutige, auf zwei gleiche Zahlen angewandte Operation zu gleichen Resultaten führt.
Alle diese Schlußweisen, mögen sie nun auf den eigentlichen Syllogismus zurückfiihrbar sein oder nicht, bewahren den analytischen Charakter und sind ebendadurch ohnmächtig.
II.
Der Streit ist alt; schon Leibniz suchte zu beweisen, daß 2 und 2 gleich 4 ist; wir wollen seine Darlegungen ein wenig untersuchen.
Ich setze voraus, daß man die Zahl 1 definiert habe, und ebenso die Operation x + 1, welche darin besteht, einer gegebenen Zahl x die Einheit hinzuzufügen.
Diese Definitionen kommen, wie sie auch beschaffen sein mögen, für die folgende Betrachtung nicht in Frage.
Ich definiere hierauf die Zahlen 2, 3 und 4 durch die Gleichungen:
Ich definiere ebenso die Operation x + 2 durch die Beziehung:
Dieses vorausgesetzt, haben wir:
also:
Man wird nicht ableugnen können, daß diese Beweisführung eine rein analytische ist. Fragt man jedoch irgend einen Mathematiker, so wird er sagen: „Das ist keine eigentliche Beweisführung, sondern eine Verifikation“. Man hat sich darauf beschränkt, zwei rein konventionelle Definitionen einander zu nahem, und hat ihre Identität festgestellt; man hat nichts Neues gelernt. Die Verifikation unterscheidet sich genau vom wirklichen Beweise, weil sie rein analytisch und unfruchtbar ist. Sie ist unfruchtbar, weil die Schlußfolgerung nur die Übersetzung der Voraussetzungen in eine andere Sprache ist. Der wirkliche Beweis dagegen ist fruchtbar, weil die Schlußfolgerung einen allgemeineren Inhalt hat, als die Voraussetzungen.
Man kann sogar sagen, daß gerade die exakten Wissenschaften die Aufgabe haben, uns von diesen direkten Verifikationen zu entlasten.
III.
Wir wollen den Mathematiker bei der Arbeit beobachten und versuchen, einen Einblick in seine Denkweise zu gewinnen.
Der Versuch ist nicht ohne Schwierigkeit; es genügt nicht, ein Werk auf gut Glück aufzuschlagen und darin den nächstbesten Beweis zu zergliedern.
Wir müssen zuerst die Geometrie ausschließen, denn hier wird die Frage durch die schwer zugänglichen Probleme verwickelt, welche sich auf das Wesen der Postulate, auf die Natur und den Ursprung der Raumvorstellung beziehen. Aus analogen Gründen können wir uns nicht an die Infinitesimal-Rechnung wenden. Wir müssen den mathematischen Gedanken da suchen, wo er rein geblieben ist, das ist in der Arithmetik.
Auch dabei muß man noch auswählen; in den höchsten Gebieten der Zahlentheorie haben die mathematischen Elementarbegriffe bereits eine solche Entwicklung durchgemacht, daß es schwer fallt, dieselbe zu analysieren.
So dürfen wir erwarten, die gesuchte Erklärung in den Anfängen der Arithmetik zu finden, aber gerade in den Beweisen der allerelementarsten Lehrsätze kommt es vor, daß die Verfasser der klassischen Abhandlungen das geringste Maß von Genauigkeit und Schärfe anwenden. Man kann ihnen daraus keinen Vorwurf machen; sie gehorchen einer Notwendigkeit; die Anfänger sind nicht für die wirkliche mathematische Strenge vorbereitet; sie würden darin nur unnütze und langweilige Spitzfindigkeiten sehen; man würde seine Zeit verlieren, wenn man sie zu früh anspruchsvoller machen würde; sie müssen schnell den Weg durchlaufen, welchen die Begründer der Wissenschaft langsam durchmessen haben, aber immer dabei die schon zurückgelegten Strecken im Auge behalten.
Warum ist eine so lange Vorbereitung notwendig, um sich an diese vollkommene Strenge zu gewöhnen, welche, wie man glauben möchte, alle gut veranlagten Köpfe sich selbst auferlegen sollten? Darin liegt ein logisches und psychologisches Problem, das wohl des Nachdenkens wert ist.
Wir können uns dabei nicht aufhalten, es liegt unserem Gegenstände fern; alles, was ich hervorheben möchte, ist, daß wir, um unser Ziel nicht zu verfehlen, die Beweise der elementarsten Lehrsätze von Anfang an durchgehen müssen und ihnen nicht die grobe Form lassen, welche man ihnen gibt, um die Anfänger nicht zu ermüden, sondern diejenige, welche einen geübten Mathematiker befriedigen kann.1)
Definition der Addition. − Ich setze voraus, daß man zuvor die Operation x + 1, welche darin besteht, daß man die Zahl 1 einer gegebenen Zahl x hinzufügt, definiert hat.
Diese Definition, welcher Art sie auch sei, wird in der Fortsetzung unserer Entwicklungen keine Rolle spielen.
Es handelt sich jetzt darum, die Operation x + a zu definieren, welche darin besteht, die Zahl a zu einer gegebenen Zahl x hinzuzufügen.
Setzen wir voraus, man hätte die Operation:
x + (a − 1)
definiert, so wird die Operation x + a durch die Gleichung:
definiert sein.
Wir werden also wissen, was x + a bedeutet, wenn wir wissen, was x + (a − 1) bedeutet, und da ich am Anfang vorausgesetzt habe, man wisse, was x + 1 bedeute, so wird man successive und „durch rekurrierendes Verfahren“ die Operationen x + 2, x + 3 etc. definieren können.
Diese Definition verdient einen Augenblick unsere Aufmerksamkeit, sie unterscheidet sich durch ihre besondere Natur von der rein logischen Definition, und derartig besondere Definitionen werden uns noch oft begegnen. Die Gleichung (1) enthält tatsächlich eine unendliche Anzahl von verschiedenen Definitionen, deren jede nur einen Sinn hat, wenn man die vorhergehende kennt.
Eigenschaften der Addition. − Associatives Gesetz. − Ich behaupte, daß:
und das ist nichts anderes, abgesehen vom Unterschiede in der Bezeichnungsweise, als die Gleichung (1), durch welche ich soeben die Addition definiert habe.
so wird man daraus ableiten, daß:
oder infolge der Definition (1):
Das beweist, durch eine Reihe von rein analytischen Schlüssen, daß der Lehrsatz für γ + 1 richtig ist.
Commutatives Gesetz. − 1. Ich behaupte, daß:
2. Ich behaupte, daß:
Der Inhalt der Behauptung ist folglich durch rekurrierendes Verfahren sicher gestellt.
Definition der Multiplikation. − Wir definieren die Multiplikation durch die Gleichungen:
Die Gleichung (2) umfaßt wie die Gleichung (1) eine unendliche Anzahl von Definitionen; wenn sie a × 1 definiert hat, so erlaubt sie successive a × 2, a × 3 etc. zu definieren.
Eigenschaften der Multiplikation. − Distributives Gesetz. − Ich behaupte, daß:
(a + b) × c − (a × c) + (b × c).
Die Behauptung ist wiederum durch rekurrierendes Verfahren bewiesen.
Commutatives Gesetz. − Ich behaupte, daß:
2. Ich behaupte, daß:
IV.
Ich halte jetzt mit dieser einförmigen Aufeinanderfolge von Entwicklungen inne. Aber gerade diese Einförmigkeit läßt das Verfahren besser zur Geltung kommen, das einförmig ist und das wir bei jedem Schritte wiederfinden.
Wir haben soeben gesehen, wie man sich dieses Verfahrens bedienen kann, um die Regeln der Addition und Multiplikation zu beweisen, d. h. die Regeln der algebraischen Rechnung; diese Rechnung ist ein Werkzeug, das sich in weit umfassenderem Maße zu Umformungen eignet als der einfache logische Schluß; aber sie ist noch ein rein analytisches Werkzeug und nicht fähig, uns etwas Neues zu lehren. Wenn die Mathematik kein anderes hätte, so würde sie alsbald in ihrem Vorwärtskommen aufgehalten werden; aber sie findet neue Hilfsquellen in demselben Verfahren, d. h. in der rekurrierenden Schlußweise, und so kann sie weiter vorwärtsschreiten.
Bei näherer Prüfung findet man auf Schritt und Tritt diese Art der Schlußweise, sei es in der einfachen Gestalt, welche wir ihr soeben gaben, sei es in einer mehr oder weniger veränderten Gestalt.
Hier haben wir die mathematische Schlußweise in ihrer reinsten Form, und es ist für uns notwendig, sie näher zu prüfen.
V.
Die Haupteigenschaft des rekurrierenden Verfahrens besteht darin, daß es, sozusagen in einer einzigen Formel zusammengedrängt, eine unendliche Anzahl von Syllogismen enthält.
Um sich darüber besser klar zu werden, will ich einen dieser Syllogismen nach dem anderen darlegen; sie folgen aufeinander − man gestatte mir dieses Bild − wie Kaskaden.
Es sind, wohlverstanden, hypothetische Syllogismen.
Der Lehrsatz gilt für die Zahl 1.
Ist er richtig für 1, so ist er auch richtig für 2.
Er gilt also für 2.
Ist er richtig für 2, so gilt er auch für 3.
Er gilt also für 3, und so weiter.
Man sieht, daß die Schlußfolgerung eines jeden Syllogismus dem folgenden als Unterlage dient.
Ja, noch mehr: die Folgesätze aller unserer Syllogismen können auf eine einzige Formel zurückgeführt werden:
Wenn der Lehrsatz für n − 1 gilt, so gilt er auch für n.
Man sieht also, daß man sich bei dem rekurrierenden Verfahren darauf beschränkt, die Unterlage des ersten Syllogismus und die allgemeine Formel darzulegen, welche alle Folgesätze als besondere Fälle enthält.
Diese Reihe von Syllogismen, welche niemals enden würde, wird so auf einen Satz von wenigen Linien reduziert.
Es ist jetzt leicht verständlich, warum jede besondere Folgerung eines Lehrsatzes, wie ich es oben dargelegt habe, durch rein analytisches Verfahren verifiziert werden kann.
Wenn wir, anstatt zu zeigen, daß unser Lehrsatz für alle Zahlen gilt, nur vor Augen führen wollen, daß er z. B. für die Zahl 6 gilt, so wird es genügen, die fünf ersten Syllogismen unserer Kaskade aufzustellen; wir würden neun brauchen, wenn wir den Lehrsatz für die Zahl io beweisen wollten, für eine größere Zahl würden wir noch mehr brauchen; aber wie groß auch diese Zahl sei, wir würden sie schließlich immer erreichen, und die analytische Verifikation würde möglich sein.
Und wenn wir auch noch so weit in dieser Weise fortschreiten würden, so könnten wir uns doch niemals bis zu dem allgemeinen Lehrsätze erheben, der für alle Zahlen anwendbar ist und welcher allein der Gegenstand der Wissenschaft ist. Um dahin zu gelangen, bedürfte es einer unendlichen Anzahl von Syllogismen; es müßte ein Abgrund übersprungen werden, welchen die Geduld des Analysten, der auf die formale Logik als einzige Quelle beschränkt ist, niemals ausfullen könnte.
Ich fragte zu Anfang (vgl. S. 2), weshalb man sich nicht einen Verstand vorstellen könnte, der stark genug wäre, mit einem Blicke die Gesamtheit der mathematischen Wahrheiten zu erfassen.
Die Antwort ist jetzt erleichtert; ein Schachspieler kann vier Züge im voraus berechnen, vielleicht auch fünf, aber wenn man ihm auch Außerordentliches zutraut, so wird er sich immer nur eine endliche Zahl zurech tlegen können; wenn er seine Fähigkeiten auf die Arithmetik anwendet, so wird er nicht im Stande sein, sich deren allgemeine Wahrheiten mit einer einzigen direkten Anschauung zum Bewußtsein zu bringen; um zu dem kleinsten Lehrsätze zu gelangen, kann er nicht das rekurrierende Verfahren entbehren, weil dies ein Werkzeug ist, welches uns erlaubt, vom Endlichen zum Unendlichen fortzuschreiten.
Dieses Werkzeug ist immer nützlich, denn es erlaubt uns, mit einem Satze so viele Stationen zu überspringen, wie wir wollen, und erspart uns dadurch lange, ermüdende und einförmige Verifikationen, welche sich bald als unbrauchbar erweisen würden. Aber dieses Werkzeug wird unentbehrlich, wenn man den allgemeinen Lehrsatz im Auge hat, dem wir uns durch analytische Verifikationen unaufhörlich nähern, ohne ihn jemals zu erreichen.
ln diesem Gebiete der Arithmetik kann man meinen, von der Infinitesimal-Rechnung weit entfernt zu sein; und dennoch spielt, wie wir soeben gesehen haben, die Idee des mathematischen Unendlich schon eine hervorragende Rolle, und ohne sie würde es keine Wissenschaft geben, weil es nichts Allgemeines geben würde.
VI.
Das Urteil, auf welchem die Entwicklung durch das rekurrierende Verfahren beruht, kann in andere Formen gesetzt werden; man kann z. B. sagen, daß es in einer unendlichen Menge von verschiedenen ganzen Zahlen immer eine gibt, welche kleiner ist als alle übrigen.
Man kann leicht von einer Aussage zur anderen übergehen und sich so der Einbildung hingeben, als hätte man die Legitimität des rekurrierenden Verfahrens bewiesen. Aber man wird immer auf ein Hindernis stoßen, man wird immer zu einem unbeweisbaren Axiom gelangen, welches im Grunde nichts weiter ist als der zu beweisende Satz, in eine andere Sprache übersetzt.
Man kann sich daher der Schlußfolgerung nicht entziehen, daß das Gesetz des rekurrierenden Verfahrens nicht auf das Prinzip des Widerspruchs zurückführ-bar ist.
Zu diesem Gesetze können wir nicht durch die Erfahrung gelangen; die Erfahrung könnte uns z. B. lehren, daß das Gesetz für die zehn, für die hundert ersten Zahlen richtig ist, sie kann nicht die unendliche Folge der Zahlen erreichen, sondern nur einen größeren oder kleineren, aber immer einen begrenzten Teil dieser Zahlenfolge.
Wenn es sich jedoch nur darum handelt, so würde das Prinzip des Widerspruchs genügen; es würde uns gestatten, immer so viele logische Schlüsse zu entwickeln, wie wir wollen; nur wenn es sich darum handelt, eine unendliche Anzahl in eine einzige Formel zusammenzufassen, nur vor dem Unendlichen versagt dieses Prinzip, und genau an diesem Punkte wird auch die Erfahrung machtlos. Dieses Gesetz, welches dem analytischen Beweise ebenso unzugänglich ist wie der Erfahrung, gibt den eigentlichen Typus des synthetischen Urteils a priori. Man kann andrerseits darin nicht bloßes Übereinkommen sehen wollen, wie bei einigen Postulaten der Geometrie.
Warum drängt sich uns dieses Urteil mit einer unwiderstehlichen Gewalt auf? Das kommt daher, weil es nur die Bestätigung der Geisteskraft ist, welche überzeugt ist, sich die unendliche Wiederholung eines und desselben Schrittes vorstellen zu können, wenn dieser Schritt einmal als möglich erkannt ist. Der Verstand hat von dieser Macht eine direkte Anschauung, und die Erfahrung kann für ihn nur eine Gelegenheit sein, sich derselben zu bedienen und dadurch derselben bewußt zu werden.
Aber, wird man einwenden, wenn das rohe Experiment das rekurrierende Verfahren nicht rechtfertigen kann, ist es dann nicht ebenso, wenn die Induktion dem Experimente zu Hilfe kommt? Wir sehen succes-sive, daß ein Lehrsatz richtig ist für die Zahl 1, für die Zahl 2, für die Zahl 3 u. s. w.; das Gesetz ist evident, so sagen wir; und es ist das ebenso berechtigt wie bei jedem physikalischen Gesetze, das sich auf Beobachtungen stützt, deren Zahl zwar sehr groß, aber immer endlich ist.
Man kann nicht verkennen, daß hier eine auffällige Analogie mit den gebräuchlichen Verfahrungsweisen der Induktion vorhanden ist. Aber es besteht ein wesentlicher Unterschied. Die Induktion bleibt in ihrer Anwendung auf die physikalischen Wissenschaften immer unsicher, weil sie auf dem Glauben an eine allgemeine Gesetzmäßigkeit des Universums beruht, und diese Gesetzmäßigkeit liegt außerhalb von uns selbst. Die mathematische Induktion dagegen, d. h. der Beweis durch rekurrierendes Verfahren, zwingt sich uns mit Notwendigkeit auf, weil er nur die Betätigung einer Eigenschaft unseres eigenen Verstandes ist.2)
VII.
Wie ich schon erwähnt habe, bemühen sich die Mathematiker immer, die Sätze, welche sie erhalten haben, weiter zu verallgemeinern; so (um nicht andere Beispiele zu suchen) haben wir eben die Gleichung:
bewiesen; und wir haben uns derselben bedient, um daraus die Gleichung:
abzuleiten, welche offenbar allgemeiner ist.
Die Mathematik kann daher, wie die anderen Wissenschaften, vom Besonderen zum Allgemeinen fortschreiten.
Hierin liegt eine Tatsache, welche uns am Anfang dieser Darlegung unverständlich erschienen wäre, aber welche jetzt für uns nichts Geheimnisvolles hat, nachdem wir die Analogie zwischen dem rekurrierenden Beweise und der gewöhnlichen Induktion festgestellt haben.
Ohne Zweifel, die mathematisch-rekurrierende Schlußweise und die physikalisch-induktive Schlußweise beruhen auf verschiedenen Grundlagen, aber ihre Wege laufen parallel; sie schreiten in demselben Sinne fort, d. h. vom Besonderen zum Allgemeinen.
Gehen wir darauf noch etwas näher ein. Um die Gleichung:
zu beweisen, genügt es, zweimal die Regel:
anzuwenden und zu schreiben:
Die Gleichung (2) ist so auf rein analytischem Wege aus der Gleichung (1) abgeleitet; sie ist demnach nicht ein bloßer.Spezialfall derselben; sie ist etwas anderes.
Man kann daher nicht sagen, daß man im eigentlich analytischen und deduktiven Teile der mathematischen Entwicklungen im gewöhnlichen Sinne des Wortes vom Allgemeinen zum Besonderen übergeht. Die beiden Seiten der Gleichung (2) sind einfach verwickeltere Kombinationen als die beiden Seiten der Gleichung (1), und die Analyse dient nur dazu, die Elemente, welche in diese Kombinationen eingehen, zu trennen und ihre gegenseitigen Beziehungen zu studieren.
Die Mathematik kommt also „durch Konstruktionen“ vorwärts, sie „konstruiert“ immer verwickeltere Kombinationen. Indem sie dann durch die Analyse dieser Kombinationen, die man als selbständige Gesamtheiten bezeichnen könnte, zu ihren ursprünglichen Elementen zurückkehrt, wird sie sich der gegenseitigen Beziehungen dieser Elemente bewußt und leitet daraus die Beziehungen zwischen diesen Gesamtheiten selbst ab.
Das ist ein rein analytisches Vorgehen, aber nicht ein Vorgehen vom Allgemeinen zum Besonderen, denn die Gesamtheiten können offenbar nicht so angesehen werden, als wären sie von speziellerer Natur wie ihre Elemente.
Man hat mit Recht diesem Prozesse der Konstruktion eine große Wichtigkeit beigelegt, und man hat darin die notwendige und hinreichende Bedingung für die Fortschritte der exakten Wissenschaften erkennen wollen.
Notwendig? ohne Zweifel; aber hinreichend? nein!
Damit eine Konstruktion nützlich sein kann, damit sie nicht nur eine überflüssige Anstrengung des Verstandes darstellt, damit sie jedem als Sprungbrett dienen kann, der sich höher erheben will, muß sie vor allem eine Art Einheit besitzen, welche erlaubt, darin etwas anderes zu sehen als die bloße Anhäufung von Elementen.
Oder genauer: man muß einen Vorteil darin erkennen, daß man lieber die Konstruktion als die einzelnen Elemente betrachtet.
Welcher Art kann dieser Vorteil sein?
Warum z. B. soll man sich lieber mit einem Polygon beschäftigen, das doch stets in Dreiecke zerlegbar ist, als mit diesen Elementar-Dreiecken?
Offenbar, weil es Eigenschaften gibt, die den Polygonen mit einer beliebigen Anzahl von Seiten zukommen und die man unmittelbar auf irgend ein besonderes Polygon anwenden kann.
Meistens dagegen wird man sie nur um den Preis sehr langwieriger Bemühungen dadurch wiederfinden, daß man direkt die Verhältnisse der Elementar-Dreiecke studiert.
Wenn das Viereck etwas anderes ist als zwei aneinandergelegte Dreiecke, so liegt dies daran, daß das Viereck zur Klasse der Polygone gehört
Eine Konstruktion wird nur interessant, wenn man sie an andere, ähnliche Konstruktionen anreihen kann, so daß alle zu einer gemeinsamen Klasse gehören.
Überdies muß man die Eigenschaften dieser Klasse ableiten können, ohne sie einzeln nacheinander für jedes Individuum der Klasse aufzustellen.
Um dahin zu gelangen, muß man notwendigerweise vom Besonderen zum Allgemeinen aufsteigen, indem man eine oder mehrere Stufen weiterklimmt.
Das analytiscde Verfahren „durch Konstruktion“ nötigt uns nicht herabzusteigen, aber es läßt uns auf demselben Niveau.
Wir können uns nur durch die mathematische Induktion erheben, welche allein uns etwas Neues lehren kann. Ohne die Hilfe dieser Induktion, welche in gewissem Sinne von der physikalischen Induktion verschieden, aber fruchtbar wie diese ist, würde die Konstruktion nicht im Stande sein, eine Wissenschaft aufzubauen.
Schließlich wollen wir bemerken, daß diese Induktion nur möglich ist, wenn eine und dieselbe Operation unendlich oft wiederholt werden kann. Deshalb wird die Theorie des Schachspiels niemals eine Wissenschaft werden können, denn die verschiedenen Züge einer und derselben Partie haben keine Ähnlichkeit untereinander.
Zweites Kapitel.Die mathematische Größe und die Erfahrung.
Wenn man wissen will, was die Mathematiker unter einem Kontinuum verstehen, muß man nicht bei der Geometrie anfragen; der Geometer sucht sich immer die von ihm studierten Figuren mehr oder weniger darzustellen, aber seine Darstellungen sind für ihn nur Hilfsmittel. Er macht Geometrie mit nur im Raume vorgestellten Linien ebenso gut wie mit der Kreide auf der Tafel; auch muß man sich hüten, Zufälligkeiten, welche oft ebenso unwichtig sind wie die Farbe der Kreide, all-zuviel Bedeutung beizulegen.
Der reine Analytiker hat diese Klippe nicht zu furchten. Er hat die mathematische Wissenschaft aller fremden Elemente entkleidet und er kann auf die Frage antworten: was ist eigentlich dieses Kontinuum, mit dem die Mathematiker arbeiten? Viele von ihnen, welche über ihre Kunst nachdenken, haben bereits geantwortet, z. B. Herr Tannery in seiner „Introduction k la thdorie des fonctions d’une variable.“
Gehen wir von der Stufenleiter der ganzen Zahlen aus; zwischen zwei aufeinanderfolgende Stufen schieben wir eine oder mehrere Zwischenstufen ein, dann zwischen diese neuen Stufen wieder andere und so fort ohne Ende. Wir haben so eine unbegrenzte Anzahl von Gliedern; das sind die Zahlen, welche man als Brüche oder als rationale, bezw. kommensurable Zahlen bezeichnet. Aber dies ist nicht alles; zwischen diese Glieder, welche doch schon in unendlicher Anzahl vorhanden sind, muß man noch wieder andere einschalten, welche man als irrationale oder inkommensurable Zahlen bezeichnet.
Bevor wir weiter gehen, machen wir erst eine Bemerkung. Das so aufgefaßte Kontinuum ist nur eine Ansammlung von Individuen, die in eine gewisse Ordnung gebracht sind; allerdings ist ihre Anzahl unendlich groß, aber sie sind doch voneinander getrennt. Das ist nicht die gewöhnliche Vorstellung, bei der man zwischen den Elementen des Kontinuums eine Art inniger Verbindung voraussetzt, welche daraus ein Ganzes macht und wo der Punkt nicht früher als die Linie existiert, aber wohl die Linie früher als der Punkt. Von der berühmten Formulierung „das Kontinuum ist die Einheit in der Vielheit“ bleibt nur die Vielheit übrig, die Einheit ist verschwunden. Die Analytiker haben deshalb nicht weniger Recht, ihr Kontinuum so zu definieren, wie sie es tun, denn nur mit dem so definierten Kontinuum arbeiten sie, wenn sie die höchste Strenge ihrer Beweise erreichen wollen. Aber das ist genug, um vorläufig einzusehen, daß das eigentliche mathematische Kontinuum etwas ganz anderes ist als das Kontinuum der Physiker oder dasjenige der Metaphysiker.
Man wird vielleicht sagen, daß sich die Mathematiker, welche sich mit dieser Definition begnügen, durch Worte betrügen lassen, daß man in einer knappen Form aus-drücken müßte, was jede dieser dazwischen liegenden Stufen bedeute, daß man erklären müßte, wie man sie einzuschalten hat, und beweisen müßte, daß es möglich ist dieses auszuführen. Aber das würde unbillig sein; die einzige Eigenschaft dieser Stufen, welche bei ihren Überlegungen2) benutzt wird, ist diejenige, daß jede sich vor oder hinter einer anderen befindet; diese Eigenschaft allein darf deshalb bei Definition der Stufe benutzt werden.
Also braucht man sich nicht über die Art und Weise zu beunruhigen, wie man diese Zwischenglieder einzuschalten hat; andererseits wird niemand daran zweifeln, daß diese Operation möglich ist, es sei denn, er vergäße, daß dieses letztere Wort in der Sprache der Mathematik einfach so viel bedeutet als „frei von Widersprüchen“.
Unsere Definition ist gleichwohl noch nicht vollständig, und nach dieser allzulangen Abschweifung komme ich jetzt darauf zurück.
Definition der inkommensurablen Zahlen. − Die Mathematiker der Berliner Schule haben mit Vorliebe den Gedanken vertreten, daß man diese kontinuirliche Stufenleiter der gebrochenen und irrationalen Zahlen aufbauen könne, ohne sich anderer Bausteine zu bedienen als ganzer Zahlen. Bei dieser Anschauungsweise würde das mathematische Kontinuum nur eine Schöpfung des Verstandes sein, mit der die Erfahrung nichts zu tun hat.3)
Der Begriff der rationalen Zahl schien ihnen keine Schwierigkeit zu bereiten, sie haben sich hauptsächlich bemüht, die inkommensurable Zahl definieren zu wollen. Aber ehe ich eine entsprechende Definition gebe, muß ich eine Bemerkung einflechten, um dem Erstaunen zuvorzukommen, das sie unfehlbar bei solchen Lesern hervor-rufen würde, welche mit den Gewohnheiten der Mathematiker wenig vertraut sind.
Die Mathematiker studieren nicht Objekte, sondern Beziehungen zwischen den Objekten; es kommt ihnen deshalb nicht darauf an, diese Objekte durch andere zu ersetzen, wenn dabei nur die Beziehungen ungeändert bleiben. Der Gegenstand ist für sie gleichgültig, die Form allein hat ihr Interesse. Wenn man dieses nicht im Auge hätte, würde es unverständlich bleiben, wie man mit dem Namen einer inkommensurablen Zahl ein bloßes Symbol bezeichnet, d. h. etwas, das gänzlich verschieden von der Idee ist, welche man sich von einer Größe macht, die doch meßbar und greifbar sein sollte.
Die gemeinte Definition kann etwa in folgender Weise gefaßt werden4):
Man kann auf unendlich viele Weise die kommensurablen Zahlen derart in zwei Klassen einteüen, daß irgend eine Zahl der ersten Klasse größer ist als irgend eine Zahl der zweiten Klasse.
Es kann eintreten, daß unter den Zahlen der ersten Klasse eine vorkommt, welche kleiner ist als alle anderen; wenn man z. B. in die erste Klasse alle Zahlen einreiht, die größer als 2 sind, und 2 selbst und in die zweite Klasse alle Zahlen, die kleiner als 2 sind, so ist es klar, daß 2 die kleinste Zahl unter allen in der ersten Klasse ist. Die Zahl 2 wird dann als Symbol dieser Einteilungsart gewählt werden können.
Im Gegensätze hierzu kann es Vorkommen, daß unter den Zahlen der zweiten Klasse eine auftritt, die größer ist als alle anderen; das ist z. B. der Fall, wenn die erste Klasse alle Zahlen umfaßt, die größer als 2 sind, und die zweite alle Zahlen, die kleiner als 2 sind, und 2 selbst. Auch hier kann die Zahl 2 als Symbol dieser Einteilungsart gelten.
Aber es kann ebenso gut Vorkommen, daß man weder in der ersten Klasse eine Zahl kleiner als alle anderen, noch in der zweiten eine Zahl größer als alle anderen finden kann. Nehmen wir z. B. an, daß man in die erste Klasse alle kommensurablen Zahlen stellt, deren Quadrat größer als 2 ist, und in die zweite alle, deren Quadrat kleiner als 2 ist. Man weiß, daß es keine Zahl gibt, deren Quadrat genau gleich 2 ist. Es gibt dann offenbar in der ersten Klasse keine Zahl kleiner als alle anderen, denn wie nahe das Quadrat einer Zahl auch der 2 komme, man wird immer eine kommensurable Zahl finden können, deren Quadrat der Zahl 2 noch näher kommt.
Bei dieser Betrachtungsweise ist die inkommensurable Zahl
nichts anderes als das Symbol dieser besonderen Einteilung der kommensurablen Zahlen; und jeder Einteilungsart entspricht so eine kommensurable Zahl, welche ihr als Symbol dient, oder es entspricht ihr keine kommensurable ZahL.
Aber wenn man sich hiermit begnügen wollte, so würde man zu sehr den Ursprung dieser Symbole vergessen; es bleibt unaufgeklärt, wie man dahin gekommen ist, ihnen eine Art konkreter Existenz zuzusprechen; und beginnt andererseits die Schwierigkeit nicht ebenso schon bei den gebrochenen Zahlen selbst? Würden wir den Begriff dieser Zahlen haben5), wenn wir nicht im voraus einen Gegenstand kennen würden, den wir uns als bis ins Unendliche teilbar, d. h. als ein Kontinuum vorstellen?
Das physikalische Kontinuum. − Man kommt so dazu, sich zu fragen, ob der Begriff des mathematischen Kontinuums nicht einfach der Erfahrung entnommen ist. Wenn dem so wäre, so würden die rohen Angaben der Erfahrung, die eben unsere Empfindungen sind, der Messung zugänglich sein. Wir könnten versucht sein zu glauben, daß es wirklich so ist, denn man hat in neuerer Zeit versucht, sie zu messen, und sogar ein Gesetz formuliert, daß unter dem Namen des Fechnerschen Gesetzes bekannt ist und nach welchem die Empfindung proportional dem Logarithmus des Reizes sein soll.6)
Aber wenn man die Experimente genauer prüft, durch welche man dieses Gesetz zu begründen suchte, wird man zu einer ganz entgegengesetzten Folgerung geführt. Man hat z. B. beobachtet, daß ein Gewicht A von zehn Gramm und ein Gewicht B von 11 Gramm identische Empfindungen hervorriefen, daß das Gewicht B ebensowenig von einem 12 Gramm schweren Gewichte C unterschieden werden konnte, daß man aber leicht das Gewicht A vom Gewichte C auseinanderhielt.
Die groben Erfahrungsresnltate können also durch folgende Beziehungen ausgedrückt werden:
und diese können als Formulierung des physikalischen Kontinuums betrachtet werden.
Das ist aber absolut unverträglich mit dem Prinzipe des Widerspruchs, und die Notwendigkeit, diesen Mißklang zu beseitigen, hat uns dazu geführt, das mathematische Kontinuum zu erfinden. Man wird also zu dem Schlüsse genötigt, daß dieser Begriff in allen seinen Teilen durch den Verstand geschaffen ist, aber daß die Erfahrung uns dazu Veranlassung gegeben hat.
Wir können nicht glauben, daß zwei Größen, welche einer und derselben dritten gleich sind, nicht untereinander gleich sein sollen, und dadurch werden wir dazu gebracht vorauszusetzen, daß A sowohl von B als von C verschieden sei, daß aber die Unvollkommenheit unserer Sinne uns nicht erlaubte, sie auseinanderzuhalten.
Die Schöpfung des mathematischen Kontinuums. − Erstes Stadium. − Um uns über die Tatsachen Rechenschaft zu geben, konnten wir uns bisher damit begnügen, zwischen A und B eine kleine Anzahl von Gliedern einzuschalten, deren jedes für sich blieb. Was geschieht nun, wenn wir irgend ein Werkzeug zu Hilfe nehmen, um der Schwäche unserer Sinne nachzuhelfen, wenn wir uns z. B. eines Mikroskopes bedienen? Glieder, welche wir nicht voneinander unterscheiden konnten, wie soeben A und B, erscheinen uns jetzt vollkommen getrennt, aber zwischen A und B, die jetzt voneinander getrennt sind, läßt sich ein neues Glied D ein schalten, das wir weder von A noch von B unterscheiden können. Trotz der Anwendung der vollkommensten Methoden werden die groben Resultate unserer Erfahrung immer den Charakter des physikalischen Kontinuums an sich tragen mit dem Widerspruche, der davon unzertrennlich ist. Wir werden dem nur entgehen, indem wir ohne Aufhören neue Glieder zwischen die schon unterschiedenen hineinschieben, und diese Operation muß bis ins Unendliche fortgesetzt werden. Wir würden nur begreifen können, daß man dabei irgendwo aufhören müsse, wenn wir uns ein Werkzeug ausdenken, das hinreichend mächtig wäre, um das physikalische Kontinuum in diskrete Elemente zu zerlegen, wie das Teleskop die Milchstraße in einzelne Sterne auflöst. Aber das können wir uns nicht vorstellen; in der Tat, nur durch Vermittlung unserer Sinne bedienen wir uns unserer Werkzeuge. Mit dem Auge beobachten wir das durch das Mikroskop vergrößerte Bild, und folglich muß dieses Bild immer den Charakter der Gesichtsempfindung behalten und folglich auch denjenigen des physikalischen Kontinuums.
Nichts unterscheidet eine direkt beobachtete Länge von der Hälfte dieser Länge, wenn letztere durch das Mikroskop verdoppelt wird. Das Ganze ist dem Teile homogen; dadurch entsteht ein neuer Widerspruch oder, besser gesagt, es würde ein solcher entstehen, wenn die Anzahl der Glieder als endlich vorausgesetzt wäre; es ist in der Tat klar, daß der Teil, welcher doch weniger Glieder enthält als das Ganze, dem Ganzen nicht ähnlich sein kann.
Der Widerspruch hört auf, sobald die Anzahl der Glieder als unbegrenzt angesehen wird; nichts verhindert uns, z. B. die Gesamtheit der ganzen Zahlen als ähnlich der Gesamtheit der geraden Zahlen anzusehen, welche doch nur einen Teil der ersteren bilden, und wirklich gehört zu jeder ganzen Zahl eine gerade Zahl, welche von der ersteren das Doppelte beträgt
Aber nicht bloß, um diesem Widerspruche zu entgehen, welcher in der Erfahrungstatsache enthalten ist, wird der Verstand dazu geführt, den Begriff eines Kontinuums zu schaffen, welches durch eine unendliche Anzahl von Gliedern gebildet wird.