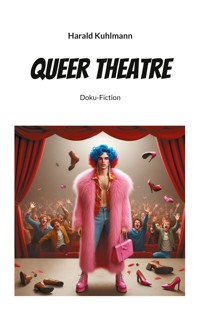Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Autobiographie des Schauspielers und Theaterautors Harald Kuhlmann
Das E-Book Wo die Glocken hängen wird angeboten von und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Theater, Schauspieler, Film
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dies Memoirenwerk gründet ausnahmslos auf wahren Begebenheiten mit echten Personen (einige Namen wurden geändert) und lässt es sich angelegen sein, nicht zu literarisieren. Der Autor erlaubt sich jedoch, um den Erzählfluss nicht zu hemmen, inhaltliche Verknappungen, kleinere Fiktionalisierungen und bittet, wo er sich geirrt haben sollte, um Kritik und Respekt.
Lange Zeit war Hannover das Zentrum der Welt für mich, die Gegend um Marktkirche, Ballhof und Knochenhauerstraße, wo der geschiedene Ehemann meiner Mutter, den ich Pappa nannte, eine Gastwirtschaft von fragwürdigem Ruf betrieb. Hier verkehrten in den Fünfzigerjahren die Nutten und Penner der Altstadt, eine verkommene Gegend damals, aber auch Schauspieler und das bühnentechnische Personal des nahgelegenen Theaters. Für sie alle war Fritze Strunk eine Institution, weil sie hier anschreiben lassen konnten. Und wenn er, schon meist angeschickert, bis spät in die Nacht hinterm Tresen stand, fühlte man sich geborgen. Es wurde gesungen, gegrölt und gelacht, die Musicbox spielte die neusten Schlager und je mehr Lüttje Lagen übern Tresen gingen, kam es nicht selten vor, dass auch schon mal eine unbefugte Hand in die Kasse griff: Ihm war's egal. Ein Mensch mit weitem Herzen. Ich hatte ihn gern.
Meine Mutter machte ihm die Hölle heiß und zeigte auf jede erdenkliche Art ihm ihre Geringschätzung, obschon sie es nicht als Zumutung empfand, halbtags in der übel beleumdeten Kneipe sich durch Schwarzarbeit ein bisschen die Rente aufzubessern und nebenbei noch ein wenig die Chefin zu spielen. Sie hatte bei der übereilten Scheidung damals auf jede Abfindung, jeden Anteil am gemeinsam Erwirtschafteten verzichtet und fühlte sich jetzt, nachdem mein Vater im Krieg gefallen war, benachteiligt.
Ob Walter Kuhlmann, den sie grade noch rechtzeitig, bevor der Fronturlaub gestrichen wurde, geheiratet hatte, mich jemals zu Gesicht bekam, konnte nie endgültig geklärt werden. Meine Mutter war nun Kriegerwitwe, aber schon kurz nach Ende des Krieges, wir wohnten in Badenstedt, einem Vorort von Hannover, hatte sie einen neuen Freund und machte unmissverständlich klar, dass sie, eine resolute Mittdreißigerin, sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen würde. Ein heranwachsender Sohn aus erster Ehe sowie eine Tochter aus vorehelichem Fehltritt, meine Halbgeschwister, unterstützten sie dabei. Auch väterlicherseits gab es Halbgeschwister, die ich aber, auf Betreiben meiner Mutter, niemals kennenlernen durfte.
Nach den Fotos zu urteilen, die ich noch von ihm habe, war mein Vater ein gutaussehender Mann. Athletischer Körperbau, die Frauen waren hinter ihm her. Er hatte in verschiedenen Berufen gearbeitet, zuletzt als Kraftfahrer für die Molkerei in Hannover, und besaß mit seinem Kumpel Fritze Strunk ein gemeinsames Automobil. Mit dem wurden Ausflüge unternommen: zu Sportveranstaltungen, Pferderennen, vielleicht auch nach Bad Salzuflen, dem Geburtsort meiner Mutter, oder Leopoldshöhe, wo Strunk herstammte. Genaues weiß ich darüber nicht. Mein Vater hatte den unschätzbaren Vorteil, ein waschechter Hannoveraner zu sein. Stammgast in der erwähnten Altstadtkneipe, verbrachte er dort viel Zeit, um nach Feierabend nicht nach Hause zu müssen, wo seine Familie auf ihn wartete. Ja, und irgendwann ist es dann wohl passiert, dass mein Vater seinem Kumpel die Frau ausgespannt hat! Diesem war es fast so egal wie späterhin der fremde Griff in seine Ladenkasse, die Ehe war sowieso zerrüttet. Zunächst beließ man die Verhältnisse wie sie waren, aber dann brach der Krieg aus. Die Männer wurden einberufen. Das Auto wurde verkauft.
1943 war es keineswegs komfortabel, in Hannover das Licht der Welt zu erblicken. Am 9. Oktober hatte die Royal Air Force mit über fünfhundert Flugzeugen den bislang schwersten Angriff auf die Stadt geflogen. Kuhlmann war an der Front in Rumänien, Strunk in Griechenland. Die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt kümmerte sich darum, dass meine Mutter ihr Kind in dem Harzer Luftkurort Lautenthal entbinden konnte, im Hotel Waldschlösschen. Dies geschah am 1. Dezember. Zwei Tage später fuhr meine Mutter mit mir auf dem Arm zurück ins schwer verwüstete Hannover, der Krieg sollte noch anderthalb Jahre dauern. Ich aber hatte fortan unter dem Makel zu leiden, kein waschechter Hannoveraner zu sein. Mein Vater hat es, glaube ich, nie erfahren. Er fiel am 26. April 1944. Fritze Strunk kam aus Kriegsgefangenschaft zurück.
Durch Baukostenzuschuss an den Eigentümer und persönliche Gewerkleistungen schaffte sich der Kriegsheimkehrer die alte Existenzgrundlage neu und eröffnete mit Hilfe der hannoverschen Brauerei Gilde-Bräu und anderer Zulieferanten seine „Rheinische Bierstube“ wieder, die schnell zur meist frequentierten Kneipe der Altstadt wurde. Im selben Haus befand sich eine Pferdemetzgerei, welche das Gekröse der geschlachteten Tiere zum Ausdünsten in den Hof hing, was immer entsetzlich stank. Ein Haus weiter der jüdische An- und Verkauf von Altkleidern, Ziegler. Sein Bruder Cygler machte am Marstall einen An- und Verkauf von Schmuck und Uhren auf. Die Gegend belebte sich allmählich, blieb aber auf lange Zeit ein Slum, bis der Marshallplan aus Knochenhauerstraße und Goldenem Winkel rund um die Kreuzkirche eine saubere, öde mittelamerikanische Kleinstadt machte, wo ehedem Fachwerk vorherrschend gewesen war. Das Leibniz-Haus in der Schmiedestraße wurde abgerissen und später am Holzmarkt rekonstruiert, die Marktkirche bekam ein neues Dach. Im Ballhof, einer ehemaligen Jugendherberge und Versammlungsort der Hitlerjugend, eröffnete im Lauf des Jahres 1946 das Landestheater seinen Spielbetrieb, ein für mich folgenreiches Ereignis, aber ich war ja noch nicht einmal drei Jahre alt. Die erste Ehefrau meines Vaters streute das Gerücht, ich sei gar nicht von ihm, und verklagte meine Mutter auf Herausgabe der Sachen, die sich noch in ihrem Besitz befanden, in Sonderheit Wäsche, Schuhe, die Anzüge meines Vaters, seine Armbanduhr, Manschettenknöpfe und anderes mehr, lauter Dinge, für die auf dem Schwarzmarkt wegen Überangebot keinesfalls Höchstpreise zu erzielen waren. Die Keiferei der beiden Frauen vor Gericht ist meine früheste Erinnerung, ich muss etwa vier oder fünf gewesen sein. Meine Mutter setzte sich durch; wir gewannen den Prozess, und gegen die üble Nachrede, ich sei ein untergeschobenes Kind, gab es den immerhin evidenten Beweis meiner roten Haare. Auch Walter Kuhlmann war rothaarig gewesen. Richard, sein Bruder, tröstete meine Mutter in ihrem Herzenskummer und half ihr bei den Beschwernissen der Nachkriegszeit, sonst aber schlug sich die Familie eher auf die Seite der ersten Frau, die Meta hieß. Der Name, den man mir gegeben hatte, war Klaus-Harald, – gottlob kein Naziname!
Die Währungsreform im Juni 48 ließ den Schwarzmarkt abflauen, man konnte jetzt wieder etwas für sein Geld kaufen. Jedermann erhielt 40 Deutsche Mark. Im selben Jahr war meine Großmutter mütterlicherseits, genannt Uffel-Oma, in Bad Salzuflen gestorben, und ich fuhr mit meiner Mutter zur Beerdigung. Der pomphafte Leichenwagen mit gedrechselten Säulen, schwarzen Troddeln und Glaswänden, gezogen von zwei Rappen mit Federbüschen, machte gewaltigen Eindruck auf mich, ebenso das katholische Begräbniszeremoniell. Zwar erinnere ich mich nicht, aber es müsste eigentlich auch meine Halbschwester Edith dabeigewesen sein, die mit Uffel-Oma zusammengewohnt hatte, als deutsche Hilfskraft bei den Briten im Offizierskasino angestellt und dort schwanger geworden war. Sie war im siebten oder achten Monat, – kann gut sein, dass sie sich geschämt hat, als ledige Mutter auf der Beerdigung zu erscheinen! Ihr Freund Eddie schenkte mir Kekse, Bonbons und Schokolade. Ein liebenswerter Mensch, ich kann mich bis heute an ihn erinnern. Allerdings wechselte meine Schwester ihre Freundschaften ziemlich oft, und erst am Jüngsten Tag wird sich zeigen, auch weil sie selbst ein Geheimnis daraus macht, wer nun der Vater des Kindes ist, das sie am 18. Januar 1949 zur Welt brachte: meine liebe Nichte Karin.
Die multilateralen Beziehungen meiner Schwester brachten Vorteile für sie wie für mich, und ich verehrte Gigi‚ wie wir sie später nach dem berühmten Film mit Leslie Caron nannten, lange Zeit überschwänglich. Unsere Mutter wandte sich angewidert ab und versuchte mit allen Mitteln, meine Anhänglichkeit an sie zu unterbinden. Mit meinem Halbbruder Gerhard verband mich zeitlebens eine sublime Abneigung. Es dauerte nicht lange, bis Gigi einen Ehemann gefunden und die Hurerei aufgegeben hat. Sie wurde dann legal Mutter.
Wir wollten weg aus Hannover-Badenstedt, wo sich Fuchs und Hase Gutenacht sagten, und meine Mutter drängte ihren Ex, uns eine Wohnung zu besorgen. Fritze Strunk musste bannig Baukostenzuschuss auf den Tisch legen für zwei Zimmer inklusive separater Küche, Balkon und Badbenutzung in einer kriegsbeschädigten Wohnung, die eilig wiederhergestellt worden war und die wir uns mit einem älteren, ständig missgelaunten Ehepaar Schmidt teilen mussten. Bruder Gerhard zog mit uns dort ein, weil er in der Nähe, am Welfenplatz, eine Lehre als Autoschlosser angefangen hatte. Er wechselte aber hernach zu seinem Vater in die Kneipe als Büfettier. Der neue Freund unsrer Mutter – Hermann, ein Artist – war inzwischen abgehalftert. Sie hatte sich den (natürlich verheirateten) Gesellen der Pferdemetzgerei als Intimfreund ausgesucht, sein Name war Fritz Kronenjäger, – sie hatte es nun mal mit den Fritzen!
Die Zeit war reif (1950), dass ich eingeschult werden musste; ich war eigentlich schon überfällig. In der Kleiderkammer des Sozialamts bekam die Kriegswaise einen Anzug mit kurzen Hosen verpasst, hohe Schnürschuhe, Schirmmütze sowie einen Schulranzen und eine Zuckertüte. Die Volksschule am Bonifatiusplatz hatte die Ehre, mich aufzunehmen, und gleich in der Ersten Klasse blieb ich sitzen. Das Wort verhaltensauffällig kannte man damals noch nicht, aber ständig wurde meine Mutter von der Klassenlehrerin einbestellt, weil ich wieder jemanden brachial vertobackt hatte. Zu dem Spottvers ROTE HAARE, SOMMERSPROSSEN kam nun noch SITZEN GEBLIEBEN, KARTOFFELN GERIEBEN, und es war dies der Beginn einer langen Kette von Demütigungen, in die so manche Perle eingefügt zu haben meine Mutter nicht unschuldig ist. Sie war als Alleinerziehende überfordert und, selber haltlos und labil, versuchte sie durch Strenge mir gegenüber das wettzumachen, was ihr an Einsicht fehlte. Wenn sie keinen Mann hatte, wurde sie unbeherrscht und sentimental, häufig von Migränen geplagt. Eine Operation an der Schilddrüse brachte nicht den erhofften Erfolg, außerdem hatte sie große Probleme mit ihren (Gold-) Zähnen. Zu der Zeit, von der hier die Rede ist, war sie Anfang vierzig und immer noch eine gutaussehende Frau. Jedenfalls, der Sitzenbleiber wurde hart bestraft, und so manchen Kleiderbügel schlug sie auf mir kaputt.
Fritz Kronenjäger war plötzlich gestorben. Ehefrau und Geliebte lieferten sich auf der Trauerfeier ein Blickduell, wieder war meine Mutter ohne Mann. Sie fing an zu rauchen und zu trinken, zog durch die Kneipen in der Altstadt. Ein ums andre Mal fiel mir die Aufgabe zu, für meine besoffene Mutter den Abschleppdienst zu spielen, und manchmal nutzte ich ihr schlechtes Gewissen, wenn ich sie wieder irgendwo aufgegabelt hatte, um ihr 65 Pfennig aus den Rippen zu leiern: den Eintrittspreis für die Nachmittagsvorstellung im Goethehaus (heute ein Pornokino). MEIN GROSSER FREUND SHANE mit Alan Ladd und DER GEBROCHENE PFEIL mit Jeff Chandler waren Filme, die mich stark beeindruckt haben. Chandler kam sogar zur Premiere und hielt Autogrammstunde. Ich hatte mir bei Woolworth für 10 Pfennig sein Foto gekauft und schob es ihm übern Tisch. Er nahm es, schüttelte den Kopf – was mich tief verletzte! – und kritzelte seinen Namen drauf. Für diese Schmach gab ich meiner Mutter die Schuld. Warum, konnte ich auch nicht genau sagen.
Als in unserer neuen Wohnung in der Voßstraße Schwamm festgestellt wurde, musste der Fußboden herausgerissen und erneuert werden. Wir zogen für eine Zeitlang ganz in die Knochenhauerstraße, wohin meine Mutter ja eh halbtags schwarzarbeiten ging. Oberhalb der „Rheinischen Bierstube“ lag eine geräumige Wohnung, dort lebten wir jetzt zu fünft. Fritze Strunk hatte inzwischen ein Dienstmädchen eingestellt, sie hieß Helga. Obwohl um die Ecke (in der Schuhstraße) geboren, kam sie aus Alvesrode am Deister, wohin ihre Familie in Kriegszeiten evakuiert worden war. Eine echte Landpomeranze und strunzdumm, machte sie sich an meinen Bruder heran. Der hatte sich mittlerweile zum begehrtesten Junggesellen der Altstadt gemausert, sah gut aus, fuhr ein fesches Motorrad und viele junge Mädchen suchten die Bekanntschaft mit mir, weil ich einen so attraktiven Bruder hatte. Gerhard war jedoch eher stieselig und verstand es durchaus nicht, seine Vorzüge zu nutzen. Helga ließ sich von ihm ein Kind machen und hat ihn, sehr zum Leidwesen unsrer Mutter, geheiratet. Die lebenslange Fehde zwischen den beiden Frauen wurde zum Melodram.
Einmal im Jahr ist in Hannover Schützenfest, man sagt: das größte der Welt. Fritze Strunk als beliebtester Kneipenwirt der Altstadt war selbstverständlich mit einem Bierzelt auf dem Schützenplatz vertreten, unterstützt von der ganzen Familie. Auch ich machte mich nützlich. Und alle, alle sind sie gekommen, die Stammgäste aus der Knochenhauerstraße: die Nutte Gisela und Marga, die Gitarrenspielerin (sie konnte so ergreifend MAMATSCHI, SCHENK MIR EIN PFERDCHEN singen), und Willi-der-Puppenspieler, ein Bauchredner, der stets einen abgewetzten Gehrock trug. Strunk senior und junior schenkten Lüttje Lagen aus, das hannoversche Nationalgetränk, meine Mutter machte die Kasse, Edith den Bratwurstgrill und Helga wusch die Gläser. Während dieser Zeit war die „Rheinische Bierstube“ geschlossen.
Obwohl in der Grundschule I. Klasse sitzen geblieben, befanden meine alleinerziehende Mutter, deren Prügelattacken etwas nachgelassen hatten, und mein älterer (Halb-)Bruder, auf dessen Meinung sie große Stücke hielt, mich doch leidlich intelligent genug, um die Mittelschule zu besuchen. Ich wurde für die Eignungsprüfung angemeldet und bestand auch. Fortan besuchte ich für zwei Jahre (ab 1955) die Werner-von-Siemens-Schule und lieferte exzellente Noten. Dies hatte ich meinem Klassenlehrer, Herrn Sohns, zu danken, für den ich hier gern eine Flagge hissen möchte. Er meinte, wiewohl ein Kind der Unterschicht, könne ich ohne weiteres die Oberschule schaffen, und machte mir Mut in einem Vier-Augen-Gespräch. Meine Mutter allerdings, die immer, wenn es um Autoritäten ging, sehr schüchtern wurde, war nur schwer davon zu überzeugen, meine guten Noten dem Schuldirektor der Lutherschule, einem mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium, vorzulegen. Die Umschulung war jedoch umstandslos möglich, so beeindruckt war Dr. Fornaschon von meinen Zensuren, und da die höhere Schule im Lehrplan langsamer voranging, hatte ich denselben Stoff noch einmal. Zunächst gab es keine Probleme, meine Noten waren gut bis durchschnittlich, doch spätestens als ich in Mathe von Zwei auf Vier absackte, verfolgte mich das Unheil in Gestalt von Oberstudienrat Puppel, einem autoritären Zackzack-Pädagogen und Alt-Nazi. Wir hatten ihn auch in Physik, Chemie und Sport, – ich beschloss, diese Fächer interessieren mich einfach nicht! Aber mit drei Fünfen im Zeugnis hätte ich nicht versetzt werden können, wenn mein Kamerad Siegbert Siewert nicht hingegangen wäre und unter meinem Namen den Freischwimmer im Goseriede-Bad gemacht hätte (dies die Voraussetzung, um wenigstens in Sport keine Fünf zu bekommen). So quälte ich mich vier Jahre hin, bis zur Mittleren Reife: mit dem Ergebnis, dass ich bis heute nicht schwimmen kann und jede Denkanstrengung, die mit Zahlen zu tun hat, mir Panik verursacht. Ach, wäre ich doch bei Lehrer Sohns geblieben!
Endlich, meine Mutter hatte einen neuen Freund. Er hieß Willy Andresen und kam aus Elmshorn. Er war frisch geschieden, und sie hatten sich über eine Annonce kennengelernt. Er besuchte uns in der soeben sanierten Wohnung in der Voßstraße und wäre beinah mit unserem nicht sanierten Balkon abgestürzt. Onkel Willy, wie ich ihn fortan nennen musste, war ein umgänglicher Mensch, gelernter Schlachter und roch immer ein bisschen nach rohem Fleisch. Aber er hatte ein ungewöhnliches Hobby: Er las Bücher, war Mitglied im Bertelsmann-Lesering und brachte auch meine Mutter dazu, diesem beizutreten. Onkel Willy konnte aber nur am Wochenende kommen, weil er in Hamburg bei der PRO fest angestellt war. Meine Mutter und ich fuhren also ein ums andere Wochenende nach Schleswig-Holstein; schon das Umsteigen vom Zentralen Hamburger Omnibusbahnhof in die S-Bahn nach Altona hatte für mich Sensationswert. Zum ersten Mal sah ich eine Weltstadt, und erst recht nach dem Besuch des Übersee-Museums in Bremen fiel ich allmählich von dem Glauben ab, dass Hannover das Zentrum der Welt sei. Onkel Willy brachte frischen Wind. Er wohnte in Elmshorn, Timm-Kröger-Straße, in einer Doppelhaushälfte zusammen mit seiner Mutter, die nie anders als schlecht über ihn redete. Und dann, ganz plötzlich war es aus! Keine Briefe, keine Besuche mehr. Es war der Verdacht aufgetaucht (oder hatte sich bestätigt), Onkel Willy hätte noch ein Verhältnis mit einer jüngeren Frau.
Unser absturzgefährdeter Balkon vertrieb uns endgültig aus der frisch sanierten, baukostenbezuschussten Wohnung. Wir zogen in die Rolandstraße 4, natürlich mit Hilfe von Fritze Strunk, und hatten endlich einen sicheren Balkon und ein eigenes Bad. Meine Mutter und ich nahmen unsern Alltagstrott, ohne Onkel Willy, wieder auf. Die Widmungen in den Büchern, die er ihr geschenkt hatte, wurden herausgeschnitten. Sie hatte das Rauchen und Trinken, mit gelegentlichen Ausnahmen, tapfer drangegeben, konnte es aber immer noch nicht lassen, in der „Rheinischen Bierstube“ die Chefin zu spielen, bis die Hochzeit ihres Sohnes Gerhard ihr einen letzten großen Auftritt ermöglichte, der schließlich ihren Sturz und die Vertreibung von dieser Bühne zur Folge hatte. Helga, die Landpomeranze, war die neue Primadonna.
Knochenhauer-/Ecke Ballhofstraße, ich gehe ein wenig zurück in der Chronologie, befand sich die Parfümerie Krieter, und ich hatte die Gewohnheit angenommen, bei der netten, kinderfreundlichen Verkäuferin im Laden zu sitzen und mit ihr zu plaudern. Sie schenkte mir mehr Aufmerksamkeit als meine Mutter, die sich oft tagelang kaum um mich kümmerte, dann aber, wenn ich wieder etwas ausgefressen hatte, mit drakonischen Strafmaßnahmen ihre Erziehungsgewalt wiederherstellte. Einmal war ich sogar an einem Einbruch in ein Zigaretten- und Spirituosenlager beteiligt gewesen, der Fall kam vor Gericht. Fräulein Siering, die kleine Parfüm-Verkäuferin, für die ich hier ebenfalls eine Flagge hissen möchte, zeigte Verständnis für den lümmelhaften, rothaarigen Herumtreiber, der ich damals war, und ich lohnte es ihr, indem ich fünf Mark aus der Ladenkasse stahl. Sie tat so, als hätte sie's nicht bemerkt, und lud mich ein, sie in die Mittagspause zu begleiten, die sie stets bei ihrer Mutter verbrachte. Und dies war nun wirklich der Beginn einer wunderbaren Freundschaft: Martha Siering, eine einfache, ungebildete Frau Mitte fünfzig, deren Bedeutung für meine Jugendzeit zu ermessen ein ganzer Fahnenwald nicht ausreichen würde und die wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass ich mich lebenslang zu älteren Frauen hingezogen fühlte, wenn überhaupt. Sie wohnte Marienstraße 57, oben unterm Dach, im Parterre befand sich das Beerdigungsunternehmen Leyendecker. Meine Mutter, die sofort eine Rivalin verspürte, untersagte mir jeden Umgang mit ihr. Wir trafen uns heimlich.
Zur Adventszeit brachte das Landestheater jedes Jahr ein Weihnachtsmärchen, und ich lungerte vorm Ballhof herum in der Hoffnung, eine Eintrittskarte geschenkt zu bekommen. „So, liebes Kind“, sagte eine bejahrte Matrone, bei der ich Erfolg gehabt hatte, „jetzt geh schön nach Hause und sag deiner Mutter, dass dich Frau Bürgermeister Weber ins Theater mitgenommen hat!“ Auf diese schlawinerhafte Art gelang es mir, die Stücke gleich mehrmals zu sehen, doch ein irgendwie höher geartetes Interesse stellte sich nicht ein. Eigentlich fand ich Märchen blöd. Was ich aber keineswegs blöd fand, sondern raffiniert, war die Künstlichkeit des Theaters: Hier machten Menschen andern was vor, und die taten so, als würden sie das glauben! Man durfte also einvernehmlich lügen. Diese weit über mein Milieu hinausgreifende soziale Verabredung war mir neu, bisher hatte ich Theater nur zu Hause kennengelernt, aber solche Melodramen als einvernehmlich gelogen einzustufen, davon war ich weit entfernt. Meine Mutter, die oberste Giftmischerin, und ihre zukünftige Schwiegertochter schenkten sich nichts! Es war am 28. September 1956, ich war noch keine dreizehn Jahre alt, als ein wichtiges Ereignis stattfand. Nicht der finale Zusammenstoß zwischen Aschenputtel und Lucrezia Borgia, nein, das Stück hieß COLOMBE (von Jean Anouilh).
Ich trallerte wie so oft mit ein paar Spielkameraden auf dem Ballhof-Vorplatz herum, die Eingangstür zum Foyer des Theaters stand offen und Leute gingen hinein. Elf Uhr vormittags, der Einlass wurde nicht kontrolliert. Wir Kinder mischten uns unbemerkt unter die Leute, ich schmuggelte mich in die erste Reihe. In der Mitte des Zuschauerraums mit dem hannoverschen Stadtwappen an der Rückwand stand ein Regiepult. Die Generalprobe beginnt. Auf der Bühne eine alte Schauspielerin in einer Theatergarderobe, umgeben von ihren Kreaturen. Madame Alexandre, dargestellt von Fridel Mumme, malträtiert in schrillen Tönen ihre Garderobiere (Sonja Karzau), ihren Sekretär (Günther Neutze) und ihren Sohn, den Heinz Bennent spielt. Was war da jetzt echt und was künstlich? In diesem Stück wurde, anders als in den Märchen, nicht dem Publikum zugezwinkert, hier wurde nicht einvernehmlich gelogen. Das war echt, um Gotteswillen! Aber so dumm, meine Mutter mit Madame Alexandre gleichzusetzen, war ich nicht. In der Pause stand ein Mitarbeiter der Regie auf, ich glaube, es war Karlheinz Streibing, und sagte, die Generalproben des Landestheaters seien nur für Mitglieder, nicht für deren Kinder. Egal, ich hatte genug gesehen! Auf dem Umweg über meine kleine Parfüm-Verkäuferin ging ich zu meiner Mutter und teilte ihr mit: „Ich will Schauspieler werden.“ Sie antwortete: „Nur über meine Leiche!“ Aber ich wusste ja eh, dass ich meine Mutter hintergehen muss, um ans Ziel zu kommen.
Dienstmädchen Helga musste die niedrigsten Arbeiten machen: täglich das Damen- und das Herrenklo putzen, Küche und Gastwirtschaft sowie die Wohnung darüber, in der sie ein kleines Dienstmädchenzimmer bewohnte, säubern, nass aufwischen oder zumindest staubsaugen, die Betten machen, Wäsche zur Wäscherei bringen und wieder abholen, gelegentlich auch einkaufen und beim Kochen helfen. Dies tat sie zunächst ohne Murren, aber das Aschenputtel erfocht sich mit den Waffen einer Frau ihre kleinen Vorteile. Und als feststand, dass sie schwanger war, wurde eine ältere Hilfskraft, Frau Weitzel, hinzugezogen, die sich bald eine Aufgabe daraus machte, mich zu erziehen. Immer öfter kam es vor, dass Helga meiner Mutter Widerworte gab, die natürlich für ihren Lieblingssohn Gerhard ganz andere Pläne hegte, als ihn an ein doofes Landei zu verschleudern. Mein Bruder hatte sich, ohne dass ich groß etwas davon mitbekam, im Urlaub in der Schweiz einen Traum erfüllt und den Flugschein für Kleinflugzeuge gemacht. Die Ambitionen meiner Mutter, die gern zum Prahlen neigte, schossen in die Höhe. Sie erzählte es überall herum. Die Bräute der Altstadt hofierten mich umso mehr, als sie vernahmen, zu dem feschen Motorrad meines Bruders käme nun auch noch die Aussicht auf eine Pilotenkarriere hinzu, doch man stelle sich die Enttäuschung vor, als sich kurz danach herumsprach, ihr Traumprinz würde das Aschenputtel heiraten!
Meine Mutter, als sie von der Schwangerschaft erfuhr, nannte das Aschenputtel ein hergelaufenes Stück Scheiße, und wäre mein Bruder nicht beherzt dazwischengetreten, es wäre zu Handgreiflichkeiten gekommen. Fritze Strunk hielt sich – wie immer! – aus allem raus, und ich bewunderte ihn dafür. Irgendwelche Reaktionen meiner Schwester Edith sind mir nicht bekannt, sie war ja selbst ein vorehelicher Fehltritt. Strunk hatte ihr seinen Namen gegeben, erbberechtigt war sie nicht. Dieser Umstand war natürlich Helga nicht verborgen geblieben, und sie hatte sich wohl gedacht: Eh, eh ... nicht mit mir! Die Landpomeranze ließ sich keineswegs für dumm verkaufen, zäh und verbissen erkämpfte sie sich ihr Unglück.
Es wurde nun alles für eine Hochzeit in die Wege geleitet, aber um auch kirchlich, das heißt: in der Marktkirche zu Hannover, heiraten zu können, brauchte der Bräutigam eine anerkannte Konfession. Dies war in der Nazizeit unterblieben, und Hitlerjunge Gerhard musste nachträglich Konfirmandenunterricht nehmen. Er wurde dann (soviel ich weiß, von Pastor Altpeter) im Nachhinein getauft und konfirmiert. Helga war evangelisch-lutherisch getauft, – ob sie ebenfalls nachsitzen musste, weiß ich nicht. Die Ziviltrauung fand im Standesamt Köbelingerstraße statt, Trauzeugen waren Gretchen Weitzel und Horst Zeiler, ein Halbbruder der Braut. Deren Eltern kamen aus Alvesrode angereist, die Strunkschen Verwandten aus Leopoldshöhe/ Kreis Lippe-Detmold. Sie alle sollten ein Schauspiel erleben, dessen Höhepunkt nicht das fröhliche Wiedersehen, nicht die Trauungszeremonie in der Marktkirche, nicht die Hochzeitsgala in der „Rheinischen Bierstube“, sondern der totale Nervenzusammenbruch meiner Mutter war.
Bereits angetrunken, verfolgte sie ihren Liebling mit demonstrativer Zärtlichkeit und Schmeicheleien, von ihm mühsam abgewehrt, aber immer setzte sie noch einen drauf, bis er sie schließlich grob anblaffte: „Jetzt lass mich endlich in Ruhe!“ Das war zuviel für ihre aufgewühlte Seele. Mit ihren Goldzähnen blitzend, den Tränen nahe, warf sie sich über ihn wie eine verschmähte Geliebte: „Aber ich bin doch deine Mutter!“ Für einen Moment hielt die Hochzeitsgesellschaft, peinlich berührt, den Atem an, nur die Musicbox spielte weiterhin BABALU von Caterina Valente, die Platte hatte ich selbst gedrückt. Weibliche Verwandte kümmerten sich um meine Mutter und führten sie hinauf in die Wohnung, wo sie sich ein bisschen aufs Bett legen sollte, um sich zu beruhigen. Aber da kannten sie meine Mutter schlecht, jetzt ging es erst richtig los. Sie war eine grandiose Melodramatikerin und konnte Szenen machen, die noch lange im Gedächtnis blieben. „Er war mein liebster Sohn, liebster Sohn ...“, schluchzte sie, warf die Unterarme vors Gesicht und wühlte sich wehklagend in das ausgeräumte Wäschefach eines Kleiderschranks. Ich stand daneben, ich fing auch an zu heulen. Die Verwandten versuchten vergeblich, mit ihr zu argumentieren, – nein, sie wollte nichts hören! „Warum behandelt er mich so? Womit habe ich das verdient?“
Seit jener Zeit fing ich an, meine Mutter zu verachten, wenngleich sie sich später für diesen Auftritt bei mir entschuldigt hat. „Natürlich habe ich dich auch lieb“, sagte sie begütigend, aber das machte es nur noch schlimmer. Jedenfalls, die melodramatische Szene endete damit, dass sie mir befahl: „Zieh dich an! Wir gehen nach Hause.“ Und wieder einmal fiel mir die Aufgabe zu, meine besoffene Mutter abzuschleppen. Es war März oder April, und in der Knochenhauerstraße lag noch Schnee.
Bald darauf heiratete, sehr zum Nachteil für mein Kindergemüt, auch Fräulein Siering, die kleine Parfüm-Verkäuferin. Sie hieß jetzt Thiemann und wohnte am Schwarzen Bären, später am Hirtenweg. Hier wie dort habe ich sie besucht, es gab Streuselkuchen mit Kakao, aber ihren Ehemann hat sie mir nicht vorgeführt, – wahrscheinlich hätte ich ihn umgebracht!
Die Handelsschule Buhmann in der Prinzenstraße hatte in ihren Räumen ein Filmkunst-Studio eingerichtet, das Kino Uhlenhorst, dort konnte man für wenig Geld alte Filme sehen. Hier traf ich mich jetzt mit Martha, Fräulein Sierings Mutter, für die – ich sagte es schon – ein ganzer Fahnenwald nicht ausreichen würde ... etc. Wir schauten, bestaunten und diskutierten Filme wie TABU von Friedrich Wilhelm Murnau, PANZERKREUZER POTEMKIN von Eisenstein, METROPOLIS von Fritz Lang und DER GOLEM von/mit Paul Wegener, heute allgemein zugängliche Klassiker, aber damals für Hannover exklusive Raritäten. Und Frau Siering war noch aus einem anderen Grund interessant für mich: Sie wohnte Tür an Tür mit Horst Reckers, Schauspielstudent der Niedersächsischen Hochschule für Musik und Theater. Seine blonde Freundin Gisela Dreyer kam oft und brachte ihm etwas zu essen, nahm seine Wäsche oder putzte für ihn die Treppe. Mit Reckers sollte ich wenig später mein erstes Gespräch haben über die Berufsaussichten als Schauspieler. Er war der Prototyp des deutschen Jünglings und wurde ratzfatz ans Landestheater engagiert (erste Rolle: Ferdinand in EGMONT), dann ging er nach Stuttgart. Die Dreyer hatte zunächst eine Tanzausbildung gemacht und lieferte 1958 als Abschlussarbeit einen furiosen TANZ AUF DEN GLÜHENDEN PANTOFFELN von Béla Bartók (Matinee im Ballhof), dann sattelte sie um auf Schauspiel. Einfach fabelhaft, was für aufregende Leute ich bei Frau Siering kennenlernen konnte, – dieser schlichten, ungebildeten Frau! Doch so sehr ich die Werbetrommel für sie rührte, meine Mutter sah den Umgang mit ihr nicht gern. Immerhin ein Fortschritt.
Nach der Geburt ihres ersten Kindes war Helga, wenn auch missachtet von ihrer Schwiegermutter, die unangefochtene Königin im Laden. Dem Töchterlein wurde der Name Linda gegeben, und ihr Liebreiz führte zu einem gewissen Einlenken bei meiner Mutter. Als dann auch noch Onkel Willy, längst abgeschrieben und verworfen, wieder angekrochen kam, war das Glück perfekt. Er hatte wohl seine Verhältnisse geordnet, arbeitete nicht mehr als Metzger bei der PRO in Hamburg, sondern als Kraftfahrer für verschiedene Speditionsunternehmen. Ein Augenleiden, das er vom vielen Lesen bekommen hatte, musste operiert werden, für Bücher interessierte er sich aber nur noch am Rande. Jede Woche kamen von ihm zwei bis drei Briefe, meine Mutter schrieb zurück und im Sommer fuhren wir alle drei in die Holsteinische Schweiz. Onkel Willy in die Augenklinik nach Malente-Gremsmühlen, ich wurde im Kinderheim „Haus Bremen“ in Scharbeutz abgeliefert. Ich schrieb sehnsüchtige Postkarten an Frau Siering, aber sie konnte mir auch nicht helfen. Ich begann, meine Mutter zu hassen, richtete aber mein Verhalten so ein, dass sie keinen Grund fand, mich zu bestrafen.
Meine schulischen Leistungen wurden nach und nach immer schlechter. Oberstudienrat Puppel, den ich nicht anders als eine Geißel der Menschheit nennen kann, verfolgte mich mit seinem Grimm. Er schrieb eine mathematische Gleichung an die Tafel und rief ganz gezielt mich, der sich nie in seinem Unterricht meldete und, wenn Klassenarbeiten geschrieben werden sollten, zu Hause blieb, ausgerechnet mich rief er auf, diese Gleichung zu lösen. Ich konnte es nicht. „Na, da haben wir ja einen erwischt!“, ätzte er, und ich fand mich als Kind der Unterschicht mit Absicht vor meinen Mitschülern gedemütigt. Jedoch, wir hatten auch liebenswürdige Lehrer: allen voran Dr. Werner, unser Klassenlehrer, bei dem ich eine Zwei in Deutsch bekam.
Nachdem Onkel Willys Augenlicht repariert worden war, wollte er meine Mutter auf eine Tour im LKW nach Süddeutschland mitnehmen, bis Lörrach ging die Fahrt. Ich wurde zu den Eltern von Frau Weitzel in Pflege gegeben, einem alten Ehepaar, das der evangelisch-reformierten Kirche, also den Calvinisten, angehörte. Wenn ich mich recht erinnere, war dies auch wieder in den Großen Ferien. Die Zeit reichte indes völlig aus, mich massiv religiös zu beeinflussen. Meine Mutter hatte – überflüssig zu erwähnen – nicht die leiseste Ahnung, wem sie mich da anvertraute. Ihre Lebensgier setzte andere Prioritäten, und mein Wunsch, zu Frau Siering in Pflege zu dürfen, der wurde abgewiesen. Ich musste nun lernen, was Beten heißt und den Namen Gottes nicht zu missbrauchen. Ich lernte, meine Gedanken zu kontrollieren und mir selber, wenn ich gedanklich eine Sünde begangen hatte, nicht zu verzeihen. Dies feine Gift sollte über Jahre hin wirksam bleiben und schuf die Grundlage für meine spätere Verstrickung in die Netze der Zeugen Jehovas. Gott sei Dank, ich machte mich frei davon, – aber nie so ganz, denn nichts klebt hartnäckiger als Moraltheologie.
Überflüssig zu erwähnen auch, dass die Sache mit Onkel Willy bald wieder vorbei war. Die Gründe wurden mir nicht mitgeteilt. Es gibt ein Foto von meiner Mutter, auf dem wäscht sie ihre Füße im Rhein bei Lörrach. Die Fotos mit Onkel Willy drauf wurden zerrissen. Bücher schenkte man sich nicht mehr, es mussten keine Widmungen herausgeschnitten werden. Von Zeit zu Zeit meldete er sich nochmal, die Hoffnungen meiner Mutter blühten wieder auf und fielen in sich zusammen. Sie fuhr fort, unverdrossen auf Bekanntschaftsanzeigen zu antworten.
Mein Schulfreund Siegbert Siewert hatte den Rinderwahnsinn oder eine ähnliche Krankheit (ADHS). Im Unterricht zappelte er ständig herum, konnte sich schlecht konzentrieren und kriegte manchmal Wutanfälle wie ein Berserker. Er verstand es großartig, sich kleine Vorteile zu erschleichen. Zum Beispiel erlangte er die Aufsicht über das Kartenzimmer, reklamierte mich als seinen Assistenten, und wir brauchten somit nicht in der Pause auf den Schulhof zu gehen. Die Wartung und Pflege des Kartenmaterials war schnell erledigt, dann rauchten wir eine und hechelten die Pauker durch. Irgendwann äußerte Siegbert den Wunsch, Schauspieler zu werden, was ich eine Unverschämtheit fand, denn diese Absicht hatte ich für mich reserviert. Wir neigten beide zum Extravaganten und Exklusiven, kokettierten wohl auch damit, schwul zu sein, hatten jedoch keine Ahnung, wie das geht. Mit anderen Worten: Wir hörten die Glocken läuten, wussten aber noch nicht, wo sie hängen.
Unser Deutschlehrer Dr. Werner, genannt Reinhold das Nashorn (nach dem Comic von Loriot), ermunterte uns alle, gegen geringes Entgelt der Jugend-Volksbühne beizutreten und regelmäßig Aufführungen von Oper, Schauspiel und Ballett zu besuchen. Meine Mutter war einverstanden, und ich erhielt ein moderates Taschengeld. Meine Leistungen in der Schule indes wurden dadurch nicht besser, außer Theater interessierte mich bald gar nichts mehr, und auch Siegberts Noten waren nicht die allerbesten. Sein Vater war irgendein hohes Tier bei der Bundeswehr und hatte zur Bedingung gemacht, bevor er seinen Berufswunsch unterstütze, müsse Siegbert das Abitur machen. Das tat er dann auch. Ich wurde, weil ich nach der 10. Klasse abgehen wollte, trotz mieser Noten versetzt. Siegbert musste die Klasse wiederholen und verlor vier wertvolle Jahre bis zum Abitur, dann noch drei weitere auf der Hochschule für Musik und Theater. Ich wählte einen andern Weg.
Es war eine Aufführung von DER TOLLE TAG ODER FIGAROS HOCHZEIT, inszeniert von Hans Bauer, die mich sehnsuchtsvoll erkennen ließ, wo die Glocken hängen, sodass meine Segel sich blähten vom Wind Paraklet. Die Jahre 1958 bis 61 brachten mir ein liebliches, volles Geläute – das Ballhof-Ensemble war spitze in dieser Zeit! –‚ und mein Schiff nahm mächtig Fahrt auf. Heinz Bennent als Figaro war ganz und gar identisch mit mir, sein Witz, seine Leichtigkeit und überhaupt die Aura dieses Komödianten, dass ich mir dachte: „Weshalb muss ich Schauspieler werden? Ich bin es.“ Um ein Haar, und ich wäre auf die Bühne gesprungen. Bedauerlicherweise war ich erst fünfzehn (und das Stück nicht jugendfrei).
Ich besorgte mir jetzt einen Schülerausweis und konnte fast immer an der Abendkasse, geöffnet eine Stunde vor Beginn, eine Restkarte zum halben Preis ergattern. So sah ich alle Inszenierungen im Schauspiel, manche auch mehrmals, – ob jugendfrei oder nicht, niemand achtete darauf! Nur das Kartenkontingent der Jugend-Volksbühne wurde nach solchen Kriterien ausgelost, aber ich wollte nicht immer bloß ZAUBERFLÖTE, NUSSKNACKER oder WILHELM TELL sehen, sondern die richtig bösen, verbotenen Stücke von Strindberg, Anouilh, Lorca und Pirandello, deshalb trat ich dort bald wieder aus. Vor allem die wunderbar flirrenden, atmosphärischen Inszenierungen von Hans Bauer, obschon ich manches nicht verstand, prägten sich meinem Kindergemüt tief ein. Er galt als Spezialist für das Poetische, aber jede seiner Arbeiten wurde von dem hannoverschen Kritiker Gerd Schulte rigoros verrissen. Die Aufführungen waren dann schlecht besucht.
Die Zeit kam, dass ich konfirmiert werden sollte, und ich meldete mich in der Lukas-Kirche zum Konfirmandenunterricht an. Der fand im Gemeindebüro Zietenstraße statt, wir waren ein undisziplinierter Haufen. Pastor Dr. Petersmann nahm mit uns die Zehn Gebote durch, die Abendmahlslehre und was man sonst noch braucht, um ein guter Christ zu sein. Zum Dank beschossen wir ihn mit Papierkügelchen und klebten Kaugummis auf seinen Stuhl. Zur Konfirmation wählte er für mich den Spruch NICHT DER BEWAHRTE MENSCH IST GOTTES ZIEL MIT UNS, SONDERN DER BEWÄHRTE. Zu einem persönlichen Gespräch zwischen uns kam es allerdings erst, als ich mit meiner Mutter und Frau Siering (für die ich endlich eine offizielle Einladung durchgesetzt hatte) zu Hause beim Kaffeetrinken saß, und er bei uns klingelte, um seine Runde zu machen. Er sprach ein paar Worte mit den Erwachsenen und wollte sich dann meine Bücher ansehen. Wir gingen in mein Zimmer, und ich zeigte ihm, was ich so las. Nun ging mir endlich auf, was für ein lieber Mensch er war, und ich bitte ihn übers Grab hinaus um Verzeihung, dass ich geraume Zeit später – schon unterm Einfluss der Zeugen Jehovas – aus der Kirche ausgetreten bin.
Dem Laienspielkreis der Lukas-Kirche, geleitet von Diakon Breuer, blieb ich trotz Kirchenaustritt weiterhin treu und konnte auch Siegbert Siewert dafür begeistern. In dem Stück KONOPKA des ostpreußischen Dichters Willy Kramp standen wir gemeinsam auf der Bühne von Jugend- und Gemeindezentren in Steinhude, Fallingbostel und Neustadt am Rübenberge. Die Titelrolle spielte ein charismatischer Junge namens Hajo Deiters, in den wir alle schrecklich verliebt waren. Siegbert gab einen kauzigen Totengräber und mühte sich wacker mit dem ostpreußischen Dialekt; was ich spielte, habe ich vergessen. In dem Krimi PARKSTRASSE 13, einem Laienspiel für Fortgeschrittene, hatte ich als Ganove Paul Mieke einen überregionalen Erfolg. Weitere Mitglieder der Gruppe waren Ina Reinecke, die auf der Calenberger Straße einen Buchladen hatte, und ihre Freundin Gabrielle Spaeth, die auch dort als Buchhändlerin arbeitete und später, um ihren Kleinverlag „Leibniz-Bücherwarte“ über Wasser zu halten, zusätzlich eine Putzstelle annahm. Ja, und nicht zu vergessen: Herbert Werdermann, etwas älter als der Durchschnitt von uns, Haus- und Verlagsbote bei der „Hannoverschen Allgemeinen“. Er versuchte erfolgreich, mich zu verführen. Damals eine Straftat, denn ich war minderjährig. Frau Siering jedoch, der ich ihn vorstellte, optierte auf ihn als Bräutigam für ihre jüngste Tochter Marthchen. Daraus wurde nichts.
Das kategorische Nein meiner Mutter zu meinen Berufsabsichten weichte allmählich auf angesichts meiner Erfolge als Laiendarsteller, und eines Tages, als ich von der Schule nach Hause kam, hatte sie sich dazu hinreißen lassen, mir die Goldmann-Ausgabe von Goethes FAUST neben den Abendbrotteller zu legen. Auch hörten wir jetzt manchmal gemeinsam Hörspiele: IN EINEM GARTEN IN AVIANO, die rührselige Liebesgeschichte zwischen einem blinden Mädchen und einem farbigen US-Soldaten, die meiner Mutter Tränen abpresste, oder DIE BRANDUNG VOR SETUBAL (mit Tilla Durieux). Ich wusste aber, dass ich mich nicht darauf verlassen durfte. Meine Mutter war unberechenbar, und die Stimmung konnte jederzeit umschlagen. Deshalb hatte ich mich, ohne ihr etwas zu sagen, zur Aufnahmeprüfung an der Hochschule für Musik und Theater angemeldet. Ein Vorgespräch mit dem Leiter Hanns-Günther von Klöden war positiv verlaufen, ich glaubte mich meiner Sache völlig sicher. Doch es kam anders.
Die Prüfungen dauerten zwei bis drei Tage, und ich schwänzte dafür die Schule. Meine Mutter merkte nichts. Sie ging wieder halbtags arbeiten am gewohnten Ort, nachdem eine Aussöhnung mit ihrer Schwiegertochter stattgefunden hatte, und ich war, was man damals ein Schlüsselkind nannte. Das Prüfungsergebnis war günstig für mich. Als ich der Kommission erklärte, meine alleinerziehende Mutter sei dagegen, dass ich Schauspieler werden will, sagte man mir, ich solle am nächsten Tag wiederkommen und meine Mutter mitbringen. Das war es, was ich hatte erreichen wollen. Wenn die Autoritäten gesprochen haben würden, müsste sie sich unterordnen und niemals wieder würde es kleinliche Bedenken geben. Es gelang mir, sie zu beeindrucken, und mein mit subtilem Hass unterfüttertes Ultimatum erstaunte und bestürzte sie. Sie ging am nächsten Tag wirklich mit. Sie hörte sich an, was ihr die Prüfungskommission zu sagen hatte. Leider, es war nicht ganz in meinem Sinne.
„Ihr Sohn ist sehr begabt“, sagte Klöden, „und es lohnt sich, ihn auszubilden.“ – „Aber wird er davon auch leben können?“, wandte meine Mutter schüchtern ein. Die Kommission lächelte. „Schauspieler ist heutzutage ein Beruf wie jeder andere. Machen Sie sich keine Sorgen! Ihr Sohn ist erst siebzehn, er hat ja noch viel Zeit. Er würde von dem Jahrgang, so wie er sich jetzt zusammensetzt und aus wesentlich Älteren besteht, an die Wand gedrückt werden. Wir möchten ihm vorschlagen, nächstes Jahr, wenn er die Mittlere Reife vollendet hat, wiederzukommen und erneut die Prüfung zu machen.“ Damit war für den Moment der Fall erledigt. „Gut“, sagte meine Mutter noch, bevor ich sie wegzog, „dann will ich ihm keine Steine in den Weg legen. Und es gehört sicher auch etwas Glück dazu, Erfolg zu haben.“ So viel Weisheit hatte ich ihr gar nicht zugetraut, aber was das Wichtigste war: Sie hielt sich an ihr Versprechen. Denn sie hätte mir, wenn sie gewollt hätte, noch manche Steine in den Weg legen können. Volljährig wurde man damals erst mit einundzwanzig.
Die Spielzeit im Ballhof eröffnete 1960 (traditionell am 28. August, dem Geburtstag Goethes) mit MISS SARA SAMPSON von Lessing. Rosemarie Gerstenberg war eine brillant rasende Marwood, Herbert Werdermann und ich saßen in der ersten Reihe und kriegten einen Schluckauf vor Begeisterung. Als ich sie sechs Wochen später als Paola in UM LUCRETIA von Giraudoux sah, inszeniert von Hans Bauer, war sie noch viel großartiger. Ich wagte es, ihr zu schreiben, mit Kuvert für die Rückantwort, und im Gegensatz zu Theaterkünstlern von heute, die sich prominent glauben, antwortete sie sofort. Überhaupt kein Problem, ich könne sie jederzeit nachmittags besuchen: nur nicht, wenn sie abends Vorstellung habe. Sie wohnte an der Hildesheimer Straße in einem Haus, welches sie von Hansjörg Felmy untergemietet hatte. Ich sprach ihr dieselben Rollen vor wie zur Aufnahmeprüfung, und sie fand alles Mist. „Leg dich auf den Boden!“, befahl sie. Verdattert gehorchte ich und dachte, hoffentlich kommt jetzt nichts Schlimmes. Sie kniete sich auf meinen Bauch: „Schrei!“ Ich schrie. „Lauter!“ Ich schrie wie am Spieß. „Vergiss dein Zwerchfell nicht!“ Es mündete in eine gewaltige Brüllerei von uns beiden, die mich glücklich machte und erschöpft, deren Zweck zu begreifen aber ich mir keine Mühe gab und den mir zu erklären Rosemarie Gerstenberg für überflüssig hielt. Alles, was sie sagte, war Gesetz. Ich studierte mit ihr den Knaben Wagenlenker aus FAUST II: HALT, ROSSE! / HEMMET EURE FLÜGEL / FÜHLET DEN GEWOHNTEN ZÜGEL / MEISTERT EUCH, WIE ICH EUCH MEISTRE waren Verse, die mich in den nächsten Wochen und Monaten bis in den Schlaf verfolgten. Textkritik und Verständnis für das Umfeld der Rolle waren nicht gefragt. Ich glaube, ich habe den FAUST II bis heute nie ganz gelesen! Aber dies alles war auch nicht so wichtig: Hauptsache, ich gehörte dazu, und ich war (schon jetzt) ein richtiger Schauspieler. Die Gerstenberg unterrichtete mich kostenlos. Im Laienspielkreis der Lukas-Kirche sprach sich herum, dass ich ihr Schüler sei, und ich wurde entsprechend hochnäsig. Nach einem halben Jahr endete ihr (Teilzeit-)Vertrag am Landestheater Hannover, sie ging nach Zürich ans Schauspielhaus und nach Frankfurt.
Wir hielten sporadisch den Kontakt über all die Jahre. Ich sah sie mal hier, mal da in großen Rollen und mit bekannten Regisseuren arbeiten: Buckwitz, Piscator, Herbert Kreppel, doch sie wurde niemals film- oder fernsehberühmt. Nach Hannover kam sie zunächst nicht wieder; erst unter der Intendanz von Franz Reichert, aber da war ich längst woanders. Als ich sie Anfang der Neunzigerjahre in ihrer Wohnung in Stuttgart besuchte, nun schon Rentnerin, lobte sie meine darstellerischen Bemühungen in einem Fernsehspiel, das zuvor gesendet worden war, verriss aber unbarmherzig eine NORA-Aufführung am Schauspiel Stuttgart, in der ich ebenfalls mitwirkte. Alles, was sie sagte, war Gesetz.
Über eine Bekanntschaftsanzeige in dem Blatt „Heim und Welt“ hatte meine Mutter einen Mann aus der Nähe von Büdingen kennengelernt, das liegt in Hessen. Die Korrespondenz mit ihm wirkte wie ein warmer Regen aufs Gemüt der über Fünfzigjährigen, das ein wenig zu verkümmern drohte, und aufgrund des von ihr abgegebenen Versprechens, mir keine Steine in den Weg zu legen, brachte ich mehr Verständnis auf für ihre Situation. Sie setzte alles auf eine Karte, und wir fuhren hin.
Der Mann behandelte meine Mutter wie eine Bittstellerin. Er lebte in leicht angesifften Wohnverhältnissen auf dem Dorfe, eine weibliche Verwandte sorgte für das Nötigste. Für eine Übersiedelung meiner Mutter nannte er als Hauptbedingung, dass sie einen Teil ihrer Rente abgeben soll; dies jedoch lehnte sie entschieden ab. Nach einem mühsam durchgehaltenen Kaffeetrinken bei ihm zu Hause, zogen wir uns in den nahgelegenen Gasthof zurück, wo er eine Übernachtung für uns reserviert hatte, um dort zu Abend zu essen. Die Suppe, die auf den Tisch kam, war dünn wie Spülwasser. Das gab meiner Mutter den Rest. „Los, wir reisen ab! Und zwar sofort!“, beschlossen wir einstimmig und gingen, ohne uns noch extra zu verabschieden, zum Bahnhof. Spät in der Nacht waren wir zurück in Hannover. Ich möchte bloß wissen, was an dem Briefwechsel mit diesem Kerl so betörend war, dass meine Mutter darauf hereingefallen ist! Sie hatte tagelang ein verweintes Gesicht. Mit der nächsten Bekanntschaft funktionierte es etwas besser: Onkel Rudolf aus Rinteln, er hatte sogar ein Auto und einen Garten. Meine Mutter liebte die Gartenarbeit, aber ihre Rente abgeben, nein, das wollte sie auch hier nicht. „Wieso denn?“, haderte sie. „Er müsste mir etwas zahlen. Schließlich arbeite ich doch für ihn!“ Onkel Rudolf nahm es mit Humor, und die Beziehung hielt sich über einige Jahre. Sein Auto war ein starkes Argument.