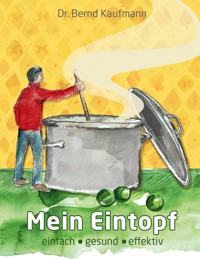Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: verlag regionalkultur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Anno 1715: Im Todesjahr des französischen Sonnenkönigs Ludwig XIV. nimmt nach der Aufhebung des Edikts von Nantes die Verfolgung protestantischer Christen auch im erst kürzlich zu Frankreich gekommenen Elsass bedrohliche Formen an. Viele sehen als einzigen Ausweg die Flucht ins Ungewisse, ins kriegsverwüstete alte Reich. Dem jungen Jos Stelter und seiner Familie, Anhänger der Mennoniten, steht eine beschwerliche Reise voller Gefahren bevor. Sie begeben sich auf eine von tragischen Schicksalsschlägen überschattete Suche nach Heimat und Akzeptanz. Immer neue Herausforderungen gilt es zu bestehen. Letztendlich führt es sie in die Pfalz, ins Herzogtum Pfalz-Zweibrücken. Dort erhält Jos die einmalige Chance das Schicksal seiner Familie und seiner Glaubensbrüder entscheidend mitzubestimmen. Doch die immense Verantwortung lastet schwer auf seinen Schultern. Kann er sie wirklich tragen? Oder hat sein Handeln am Ende schwerwiegende Konsequenzen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 763
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernd Kaufmann
Wohin sollen wir ziehen?
Historischer Roman
Titel: Wohin sollen wir ziehen?
Autor: Bernd Kaufmann
Herstellung: verlag regionalkultur
Satz: Melina Lamadé, vr
Umschlaggestaltung: Charmaine Wagenblaß, vr
EBUB-Erstellung: Charmaine Wagenblaß, vr EPUB-ISBN: 978-3-89735-028-1
Die Publikation ist auch als gedrucktes Buch erhältlich. 432 Seiten, Broschur. ISBN 978-3-95505-368-0.
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, ist ohne die schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und daher strafbar. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in elektronischen Systemen. Autoren noch Verlag können für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieses E-Books entstehen.
Alle Rechte vorbehalten.
© 2024 verlag regionalkultur
verlag regionalkulturHeidelberg – Ubstadt-Weiher – Stuttgart – Speyer – Basel
Verlag Regionalkultur GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 2 • 76698 Ubstadt-Weiher • Telefon (07251) 36703-0 • Fax 36703-29E-Mail: [email protected] • Internet: www.verlag-regionalkultur.de
Inhaltsverzeichnis
Prolog
I. Die Reise
II. Keschbacher Hof
III. Gymnasium illustre
IV. Am Staden
V. Die Beschuldigung
VI. Abschied
VII. Der Kindsvater
VIII. Landesökonomiekommission
Epilog
Personen
Zum Autor
Prolog
Bitterkalt war der Winter gewesen, kälter als in den Jahren zuvor. Hat das übliche Quantum Obdachloser, dem er alljährlich wiederkehrend ein eisiges Ende zu bereiten pflegte, ein weiteres Mal übertroffen. Hat sich beispielhaft und schandvoll eingefügt in den Zeitreigen des Klimaphänomens, das spätere Generationen die Kleine Eiszeit nennen werden. War für das vom Kriegsgetümmel ausgezehrte Volk überaus beschwerlich, kräftezehrend, krankmachend gewesen. Hat sich als ein epochemachender Todeswinter eingeschrieben in den Fabelfundus der Geschichten aus alter Zeit, die dereinst an schneereichen Winterabenden erzählt und am warmen Ofen mit wohligem Gruseln erlauscht werden.
Und obwohl jetzt der Sommer von Süden her nahte, zunehmend leichter die alpine Barriere überwand, die Oberrheinische Tiefebene zu vereinnahmen begann, war es frostig und ungemütlich geblieben im zerzausten Elsässer Land. Im Todesjahr des vierzehnten Ludwig aus dem Geschlecht der Kapetinger1, den sie auf der Île-de-France2 Louis le Grand3nannten, herrschte eine trübe, fast eisige Stimmung. Wenn die auch nicht ausschließlich vom Wetter beeinflusst und nicht jedes Landeskind in gleichem Ausmaß von ihr betroffen war. Viele atmeten erleichtert auf, denn die schlimmen Jahre schienen vorüber. Die unausgesetzte Abfolge der Schrecknisse war wohl tatsächlich beendet, wenn zutraf was gewöhnlich gut unterrichtete Kolporteure4von Tür zu Tür trugen. Ein rechter Friede war darum aber nicht eingekehrt. Dass es kein Morden, keine blutigen Schlachten, keine Belagerungen, Plünderungen, Einquartierungen mehr geben sollte, war für die meisten Zeitgenossen unglaubhaft, unvorstellbar. Denn es lebte niemand im ganzen Heiligen Römischen Reich, der sich an eine längere Zeit des Ausbleibens kriegerischer Ereignisse erinnern konnte. Auch nicht in seinem ehemaligen Gebiet, dem Elsass5, das sich im Zuge einer brutalen Eroberung, euphemistisch Reunion6geheißen, der Sonnenkönig einverleibt hatte, der nur sich allein für den Staat7 hielt, alle anderen Einwohner Frankreichs für seine Schuldner.
So blieb der einfache Bauers- oder Bürgersmann besorgt. Er betete, dass die Ruhe halten möge, opferte in banger Furcht seinem Gotte ohne Säumnis den vorgeschriebenen Tribut und kam auch den übrigen Pflichten seines Standes gewissenhaft nach. Er erfreute sich an einem bescheidenen Mahl und den gemeindlichen Vergnügungen seines Sprengels, beäugte dabei misstrauisch alles Fremde, alle Fremden, Nichtzugehörigen, Andersartigen, Andersgläubigen. Darum spürten die einen die Wärme des Spätfrühlings in mitmenschlicher Gemeinschaft, während sich die anderen, in kaltherziger Ablehnung ausgeschlossen, wenn nicht gar ausgestoßen, nach Aufnahme, Gleichheit und Anerkennung sehnten. Sie hätten sich allein schon mit gnädiger Duldung begnügt. Wenn es aber nicht sein sollte, wenn man sie nicht leben lassen wollte, nicht gemeinsam mit ihnen oder wenigstens neben ihnen, dann blieb den Ungeliebten nur der Auszug, die Auswanderung. Aber wohin?
1 Stammhaus aller Könige Frankreichs von Hugo Capet (940–996) bis Louis Philippe (1773–1850).
2 Insel Frankreichs, alte Bezeichnung für den Großraum Paris.
3 Ludwig XIV. (1638–1715 Haus Bourbon, Nebenlinie der Kapetinger) der Sonnenkönig, in Frankreich auch Louis le Grand genannt.
4Bücher und Schriften vertreibende Hausierer.
5 Das Elsass war seit der Aufteilung des Karolingischen Frankenreiches erst Teil des Lotharischen Reiches (Lotharingien), dann des Ostfränkischen Reiches und später des Heiligen Römischen Reiches.
6 Reunionspolitik Ludwigs XIV.: Annexion von Gebieten des HRR unter dem Deckmantel einer vorgeblichen Wiedervereinigung (Reunion).
7L‘état c´est moi. („Der Staat bin ich.“) Angeblicher Ausspruch Ludwigs XIV.
I. Die Reise
Johannes Stelter hatte lange geschwiegen. Ruth wusste, worum die Gedanken ihres Mannes kreisten und warum er stoisch, fast reglos, in seinen Bierkrug starrte. Eine sehr schwierige und weitreichende Entscheidung stand bevor. Die wollte gut überlegt sein. Aber es war jetzt hohe Zeit, diese Entscheidung zu treffen, so oder so. Mit jedem Tag, den sie länger warteten, spitzte sich ihre Lage zu. Es konnte zum einen schnell gefährlich werden, zum anderen könnten sie sogar noch einiges von dem kümmerlich wenigen Geld verlieren, das sie für ihr kleines bäuerliches Anwesen erhandelt hatten. Wenn jetzt nur noch ein einziger ihrer Freundesfamilien auch entschied zu gehen, vergrößerte sich die Zahl der angebotenen Gehöfte, und ein jeder bekam darum weniger für das seinige. Johanns Stelter nahm den Kopf hoch und sah Ruth mit sorgenvoller Miene an. Sie wusste, dass die Entscheidung gefallen war und er sie sogleich verkünden würde. Auch Jos, ihr jugendlicher Sohn, sah gespannt auf den Vater. Nur die kleine Katharina stocherte desinteressiert weiter in ihrer Schüssel herum. Aber auch selbst sie, die Achtjährige, wusste, dass eine einschneidende Änderung ihrer aller Lebensverhältnisse bevorstand. Johannes Stelter räusperte sich und sagte mit zittriger Stimme:
„In Ordnung. Wenn es nicht sein soll, dass wir hier leben können, wenn Gott uns an einem anderen Platz sehen will, gehen wir.“ Nach einigem Zögern sagte er dann: „Wir ziehen ins Reich, natürlich, gehen aber nicht ins Badische. Dort ist es immer noch zu unruhig. Wir gehen weiter nördlich hinüber. Dann sehen wir weiter.“
Jos, eigentlich und mit vollem Namen Johannes Joseph Stelter, sah den Vater ungläubig an. Die jugendliche, ansonsten makellos glatte Stirn des Sohnes, über der rechten Augenbraue mit einem kleinen Leberfleck gezeichnet, hatte sich sorgenvoll in Falten gelegt. Der Ansatz der dunkelblonden Haare rückte dadurch tiefer ins Gesicht, was ausdrückte, dass er glaubte, nicht richtig verstanden zu haben. Die etwas zu schmalen dunklen, bräunlichen Augen waren im Schreck weit aufgerissen, so dass zu begrüßen gewesen wäre, sie blieben auch fürderhin so. Der melancholische Mund mit den nicht sehr üppigen blassen Lippen stand dabei offen, was etwas einfältig wirkte. Während ihm Gedanken des Entsetzens durch den Kopf schossen, streckte Jos das noch kindlich weiche Kinn mit dem kaum sichtbaren Grübchen vor, als wollte er dem Vater trotzig widersprechen. Was aber niemals geschehen würde. Hatte Jos wirklich richtig verstanden?
„Herr Vater, Ihr meint, wir gehen wirklich ins Land des Krieges, des Hungers und der brennenden Dörfer? Dorthin wo es so fürchterlich ist, wie Ihr immer erzählt habt?“ Vater Stelter sah seinen Sohn an und nickte: „Ja, mein Sohn. Aber der Krieg ist vorbei. Viele sind gestorben. Das Land braucht Menschen, die es bewirtschaften können. Dort werden auch wir jetzt Frieden und eine neue Heimat finden.“
Jos dachte: ‚Dorthin sollen wir ziehen? Zu den Rindenfressern, zu den Zollwütigen?‘ Was des Vaters Entscheidung verhieß, war Hunger, Kälte, ein Leben unter fremden Menschen und beherrscht von einer Obrigkeit, deren Willkür sie schutzlos ausgesetzt sein würden. Auf drei Meilen gab es dort vier Grenzen und immerzu lebte man in der Furcht, unversehens auf das Herrschaftsgebiet eines dem Hexenwahn verfallenen Fürsten zu geraten. Aber es wäre ein Leben. Wenn sie blieben, passierte früher oder später ein Unglück. Als er dies bedachte, war sich Jos sicher, dass der Vater die richtige Entscheidung getroffen hatte. Und darum sah der Sohn ein, dass es sein musste, dass sie die liebgewonnene Scholle verlassen mussten.
Was hatten sie hier nicht alles auszuhalten gehabt. Mit abgrundtiefem Hass und unnachgiebiger Härte wurden sie von ihren Feinden verfolgt, die sie Ketzer, Rottengeister, Umstürzler riefen, weil sie an der gottgewollten Weltenordnung rüttelten, wie jene meinten. Vor allem die ihnen religiös am nächsten stehenden Protestanten, Reformierte und Lutheraner, stellten den Wiedertäufern, wie sie von jenen genannt wurden, unbarmherzig nach, verfolgten sie teilweise mit unverhohlenem Vernichtungswillen. Dass nun auch die Altgläubigen, für die jegliche Abweichung vom allumfassenden katholischen Glauben Teufelszeug war, ihre Anstrengungen in königlichem Auftrag steigerten, wenn sie die Täufer auch nur loswerden, nicht gar austilgen wollten, ließ den Mennoniten kaum Raum zum Leben. Jos war alt genug, das zu wissen. Nicht lange und er würde getauft werden. ‚Wenn es bloß bald so weit ist‘, dachte er. Denn er wollte in ihrer Gemeinschaft aufgenommen sein, dazugehören, auch wenn es lebensgefährlich war, denn sie waren fast schutzlos. Gewalt in jeglicher Form, sogar zur Selbstverteidigung, lehnten die Gefolgsleute Jakob Ammanns grundsätzlich ab. Jos war in dieser Hinsicht doch vielleicht noch nicht ganz reif für die Aufnahme in die Gemeinde, wenn er sich das ehrlich eingestand. Denn die Wunden der letzten Rauferei mit den Söhnen der Nachbarshöfe spürte er noch immer, die Kratzer und Beulen. Davon, dass er sich geprügelt hatte, die Beleidigungen nicht einfach hinnahm, durften die Eltern nichts wissen. Aber er hatte auch Freunde unter der Jugend im Dorf und im nahen Städtchen. Besonders die Mädels mochten ihn, seit sein Flaum unter der Nase dunkler geworden war. Auch reizte sie die Aura des Verfemten, die Jos umgab.
Einmal hatte Jos eine der hitzig aufgeregten Bauerstöchter, von der er sich mit herausfordernden Blicken zu einem verschwiegenen Treffen eingeladen fühlte, bei ihren Gänsen besucht. Sie tat überrascht als er bei ihr auftauchte, schlug in gezierter Scheu die Augen nieder. Als sie aber merkte, dass Jos nur schüchtern herumdruckste und verlegen mit einem Fuß auf den anderen trat, keine Anstalten machte das erwünscht Verdorbene zu tun, lächelte sie spöttisch und sah ihn so aufreizend an, dass er sich in seiner Unentschlossenheit wie ein albernes Kind vorkam. Da nahm er seinen Mut zusammen, ging geradewegs auf sie zu, küsste sie keck auf den Mund und schlang einen Arm um ihre Hüfte. Erschrocken über seine eigene Kühnheit hielt Jos den Atem an, gewärtig im nächsten Augenblick den kräftigen Schlag einer flachen Hand im Gesicht zu spüren. Stattdessen erwiderte die Schöne wie in erlöster Ungeduld seine keusche Liebkosung mit stürmischer Zärtlichkeit. Ihre geschändeten Lippen ließen die frechen nicht ziehen, ihre Zunge suchte spielerisch die seine, zugleich griff sie mit beiden Händen leidenschaftlich in sein halblanges, über Stirn und Nacken fallendes Haar. Jos umfasste sie nun auch mit dem anderen Arm, zaghaft, grünschnäblig ungelenk, fast ohne Berührung. Sie aber presste sich so heftig an ihn, dass er die Wärme und Konturen ihres voll erblühten weiblichen Körpers spürte, unterlegt von bebendem Verlangen. Mit gelinder Bestürzung und jäh ausbrechendem Achselschweiß erkannte Jos, dass er es mit keiner unbedarften Liebesnovizin zu tun hatte. Ihm wurde bange. Geschmeidig wollte er sich von ihr lösen, aber sie setzte nach. Als er sich darum energisch aus ihren Armen befreite, schaute sie ihn pikiert an. Mit einer verlegen hin gestotterten Ausrede machte er sich davon. Die wüsten Beschimpfungen, die sie ihm nachrief, erfüllten seine Brust mit heißer Scham. Dass die Sache böse hätte enden können, wurde Jos erst deutlich als er daran dachte, was die lokalen Amtsgewalten mit ihm angestellt hätten, wäre das wütende Geschrei der Verschmähten von jemandem wahrgenommen und als Hilferuf ausgelegt worden. Denn hier, wo sie jetzt lebten, im Silbertal, waren Jos’ Leute ohne rechtliches Gehör jeglichen Bösartigkeiten ausgeliefert.
Auf Beistand der Obrigkeit konnten sie nicht hoffen, auf Gesetz und Recht sich nicht berufen. Aber hier waren sie daheim, kannten sie sich aus, kamen bei allem Missvergnügen irgendwie zurecht. Jedes Haus, jeden Baum, jeden Hügel, jeden Tümpel, jede Lichtung kannten sie, Jos dazu noch die entlegensten Schlupfwinkel. Auch die Menschen, die Nachbarn, selbst wenn sie nicht freundlich gesinnt waren, so waren sie doch vertraut. Man wusste zumeist, wie man mit ihnen umzugehen hatte, kannte ihre Eigenheiten und Vorlieben, wusste zu unterscheiden zwischen den Niederträchtigen und Anständigen. Sollten sie das, bei aller Beschwernis, nun hinter sich lassen? Einfach fortgehen? In die Fremde ziehen, in eine neue, unbekannte Welt? Traurigkeit und Angst, auch wenn er es sich nicht eingestehen wollte, verbanden sich mit dem Gedanken, die Heimat verlassen zu sollen. Es war doch schön hier. Und sie wurden jeden Tag satt. Er wusste, dass dies nicht überall so war. Warum ließ man sie denn nicht in Frieden? Niemandem hatten sie je einen Schaden zugefügt.
Vom Vater wusste Jos, dass auch ihre Verfolger an den einzigen, an den barmherzigen christlichen Gott, an Jesus Christus glaubten. Und der am Kreuz für sie alle gestorben war, hatte Nächstenliebe gepredigt! So konnte es jeder, der wollte, aus der von Luther übersetzten Heiligen Schrift herauslesen. In den schönen Kirchen, egal welcher Konfession, wurde viel von Liebe und Vergebung gesprochen, gebetet und Buße getan. Aber scheinbar nur mehr mit dem Maul, nicht mit dem Herzen. Jos verachtete die Kirchgänger, auch wenn der Vater Verständnis für die Schwächen der Menschen aufbrachte. Jos hielt das Glaubensbekenntnis der Schweizer Brüder und die mennonitische Lebensführung für christusgerechter, insgeheim für besser und reiner als die aller anderen. Eingeschlossen sich selbst und seine eigene Lebenshaltung. ‚War dem so?‘ Er grübelte und kam zu dem Schluss, dass er ganz schön eingebildet war, hoffärtig gar, wie die Ältesten zu sagen pflegten, wenn sie jemanden als dünkelhaft und anmaßend beurteilten. Von dieser Sünde, die der proklamierten Schlichtheit im Denken und Handeln, einem Hauptbestandteil ihrer Lehre, widersprach, war niemand ganz frei, auch von Jos’ Leuten nicht, das wusste er. Er zieh sich der Selbstgerechtigkeit und schämte sich ein bisschen.
Vater Stelter hatte das kleine bäuerliche Anwesen verkauft, das, im Dörfchen Eckerich8unweit von Markirch9gelegen, ihnen die letzten Jahre ein trauliches Heim gewesen war. Hier hatte er geglaubt seine Familie in Sicherheit gebracht zu haben, als er mit seiner jungen Frau gleich nach Jos’ Geburt aus der Gegend zwischen dem Säntis und dem großen See hergezogen kam. Mit viel Fleiß und Schweiß und mit Herzblut, wie man so sagte, hatte er aus einer verlotterten, mehr Binsen und Quecken als Korn tragenden Ackerwirtschaft eine blühende Hofstatt gemacht. Aber nirgends schienen sie willkommen und auf Dauer geduldet. Was sich zuerst nur in schiefen Blicken und wortloser Zurückhaltung der Alteingesessenen äußerte, schlug, angestachelt von den Eiferern auf den Kanzeln, bald um in pure Ablehnung. Viele ihrer Mitmenschen schikanierten sie und trieben übermütigen Spott mit ihnen, der sich zunehmend in perfiden Bosheiten ausdrückte. Da die Leute sich neuerdings dafür in größeren Gruppen zusammenrotteten und vor tätlichen Angriffen nicht zurückschreckten, drohte eine regelrechte Mordlust aufzukommen. Dass sich dabei die Reformierten und Lutheraner besonders hervortaten, erfüllte sie mit besonderer Bitternis. Waren sie denn nicht auch Kinder der Reformation?
Der Zugang zum Buch des Glaubens vereinte die Mennoniten mit allen Menschen evangelischen Glaubens. Sie vernahmen und gehorchten dem geschriebenen Wort, Buchstabe für Buchstabe. War es denn da nicht nur konsequent, wenn erst dann, wenn der Verstand einsetzte, wenn das Wort Gottes aus eigener Erkenntnis Eingang in den Geist des Einzelnen finden konnte, ein Jeder für sich selbst entscheiden durfte, welcher christlichen Gemeinschaft er angehören wollte? War es nicht ein Zeichen der Selbstbestimmung in bestem lutherischen Sinn, wenn der Mensch nicht als Säugling auf seine Glaubenszugehörigkeit festgelegt wurde, sondern frei blieb, bis er denken und urteilen konnte? Aber selbst, wenn man darüber geteilter Ansicht war. Was war so verwerflich an ihrer Lehre, dass sie ihren getreuen Anhängern Verfolgung und sogar Tod einbringen konnte? Warum mussten sie stets um ihre Existenz zittern, immer aufs Neue eine sichere Bleibe suchen? Und als im letzten Jahr der allerchristlichste König10entschied, jedem Protestanten im Lande die Ausübung seiner Religion zu verbieten, war für Vater Stelter endgültig der Zeitpunkt erreicht, auch hier auf immer Abschied zu nehmen. Johannes Jakob Stelter konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, wie sie in dem nun französischen, streng römisch-katholischen Land, weiterleben sollten. Auch wenn er es gern gemocht hätte. Andere Glaubensbrüder, ja sogar der große Jakob Ammann11, der Wichtigste der Ältesten, nach dessen Vorbild sich Johannes Stelter ansonsten in allen Lebensbereichen richtet, wollten ausharren. „Soll der König im fernen Versailles befehlen was er will, irgendwann wird er sich der Macht des Kaisers doch beugen müssen“, sagte Ammann. „Schließlich ist das Elsass spätestens seit dem Vertrag von Ribemont12unstreitig Reichsgebiet und Erblande großer Königsgeschlechter, wie das der Staufer und sogar das der jetzigen Herrscher, der Habsburger. In Hagenau steht die schönste, einst wichtigste Pfalz des ganzen Reiches.“ An diese Vorhersagen konnte Johannes Stelter nicht glauben, er hielt es für Wunschdenken. Zu schwach waren für ihn nach dem langen Krieg das zersplitterte Reich und besonders der Kaiser in Wien13. Und die Kaiserpfalz in Hagenau hatte König Louis längst bis auf den letzten Stein schleifen lassen, ausgemerzt für alle Zeiten, zum Zeichen, dass nie wieder ein römischer König und Kaiser von hier aus regieren würde. Zu seinem Sohn sagte Vater Stelter, wie beiläufig, indem er das Kummet des Braunen, den er soeben ausgeschirrt hatte, ein letztes Mal mit Schwung an die Wand des Stalls hängte und im Tone dessen, der genau wusste, worüber er sprach: „Warte nur ab, Junge. Wir sind nicht die Ersten der Unseren, die ins Reich ziehen. Gerade weil es dort so schlecht geht, so viele gestorben sind in den langen Kriegen, ist Platz für uns. Und wir werden auch nicht die Letzten sein.“ Dass sein Vater so mit ihm sprach, fast schon wie mit einem ihm gleichwertigen Manne, machte Jos stolz. ‚Wenn er mich so ernst nimmt‘, glaubte er ‚wird er mich bestimmt bald für tauffähig erklären‘.
Am nächsten Morgen, noch vor Sonnenaufgang, mussten sie vom Hof verschwunden sein. In tiefer Nacht, vor Tagesanbruch, mussten sie sich davonstehlen wie Diebe. Der neue Eigentümer, ein Steiger aus den nahen Silberminen, war ein gestrenger Mann. Der hatte gedroht die Stelters fortjagen zu lassen, wenn er sie bei Tageslicht noch anträfe. Für ihn, einem katholischen Elsässer, hatte sich mit dem guten Geschäft, das er mit dem Kauf des Hofes gemacht hatte, der Anschluss seiner Heimat an das Königreich Frankreich bereits voll ausgezahlt. Dabei konnte er darauf verweisen, dass nicht er und seinesgleichen sich anpassen mussten, sondern mit der Reunion die Verhältnisse sich ihnen angepasst hätten. Aber gerade, weil er ohne eigenes Zutun zu den Siegern gehörte, verachtete er die Stelters nur umso mehr. Vater Stelter hat weniger bekommen für den kleinen Acker, die Kate und den Stall, als er selbst einst bezahlen musste. Und damals war die Kate undicht, der Stall hatte gar nicht gestanden, und weder Vieh noch Frucht war vorhanden oder gesät gewesen. Jetzt ließen sie eine Kuh, zwei Sauen und einen Eber, Hühner und Gänse zurück. Und auf dem Halm stand die Frucht bereit zur Ernte in vier bis sechs Wochen, längstens. Aber nur deshalb hatten sie überhaupt einen Käufer finden können. Im Herbst würde kaum jemand bereit sein auch nur ein paar Gulden für das Anwesen zu zahlen. Wenn es dann nicht sowieso zu spät wäre.
‚Gut, dass sich der Vater wenigstens ausbedungen hat, den Braunen und den Karren zu behalten‘, dachte Jos beim Bepacken ihres kleinen Wagens. So konnten sie Hausrat und den gesamten, im Haus vorhandenen Proviant mitnehmen, heimlich auch noch zwei oder drei lebende Hühner.
Nur kurz war ihre Nachtruhe gewesen. Mutter Ruth hatte gar nicht geschlafen. Sie, die zierliche, hatte, während die anderen ruhten, alles vorbereitet zur Reise, die wenigen Kleider sorgfältig in eine der beiden Truhen verstaut, in die andere das Geschirr, so dass es nicht zerbrach, auch die sonstige Habe.
Schwarz zeichnete sich der hügelige Kamm der Berge ins Tiefblau der Sommernacht, als Jos in aller Herrgottsfrühe vor die Tür trat. Der Vater war schon dabei ihr Werkzeug sowie die Pflugschar und alle anderen transportablen Gerätschaften auf die niedere Pritsche zu heben. Jos sprang hinzu, um behilflich zu sein. Vater Stelter tätschelte seinen Filius aufs Haupt. Er war stolz auf den Sohn, weil er sich anstellig zeigte und ihm nichts zu viel wurde. Jos, der das überhaupt nicht mochte, wenn es seine Mutter tat, genoss dieses stumme Zeichen der Anerkennung seines Vaters. So wie dieser, ein Hüne von Mann und gleichzeitig ein sanftmütiger, jedoch keineswegs einfältiger Mensch, wollte er auch einmal werden. Beide gingen sie ins Haus zurück. Der Vater legte dabei seinen Arm auf Jos’ Schulter.
Auch die Mutter lächelte als sie eintraten, obschon es doch eigentlich dafür gerade heute Morgen nur wenig Grund gab. Sie schöpfte aus dem Kessel vom ausglimmenden Feuer jedem eine Schale fette, heiße Fleischbrühe. Jos’ Schwesterchen nörgelte ein wenig, nahm aber schließlich nach gutem Zureden die wärmende Stärkung zu sich. So saßen sie einen Augenblick beisammen, in aller Frühe, wie sie es so oft des Abends getan hatten, im Sommer vor dem Haus, im Winter drinnen am Feuer. Und auch jetzt breitete sich sofort die wohlige Atmosphäre bescheidenen Familienglücks aus. ‚Warum nur können uns die Leute nicht in Frieden leben lassen‘, dachten dabei in diesem Moment alle Vier zugleich ‚es ist zum Verzweifeln‘. Nach dem kurzen Innehalten trieb die Geschäftigkeit der Mutter sie an mit der Arbeit fortzufahren. Mutter Stelter spülte die Trinkgefäße im Bottich, verstaute sie und suchte danach das Restliche zusammen, das sie noch mitnehmen wollten. Jos packte unterdessen, mit dem Vater, die letzten Sachen auf den Wagen. ‚Nur nichts vergessen‘, sagte er sich. ‚Bloß nichts von dem, wofür wir noch Platz haben, diesem raffgierigen Leuteschinder schenken.‘ Wütend war Jos auf den neuen Hausherrn, hätte am liebsten das ganze teure Holz und die schmiedeeisernen Beschläge abgerissen und mitgenommen, alles was er mit dem Vater in den letzten Jahren verbaut hatte in Haus und Stall. In seinem Zorn hatte Jos zu guter Letzt aber doch noch die Brunnenpumpe, die der Vater, begeistert von der Effizienz dieser neuerlichen Erfindung, für sauer verdientes Geld angeschafft hatte, von ihrem Kolben befreit. Der neue Besitzer sollte vergeblich den schweren, geschmiedeten, jedoch geschmeidig zu handhabenden Schwengel bedienen und auf Wasser hoffen. Bis der Steiger den Mangel erkannt und behoben hatte, würde sicherlich eine gewisse Zeit vergehen und ihm darum eine Menge Verdruss bereiten. Diese kleine Gemeinheit tat Jos dem Silberkotz, wie er ihn nannte, mit grimmiger Schadenfreude an, ohne deswegen von irgendwelchen Gewissenbissen geplagt zu werden.
Zusammen mit seinem eigenen kleinen Besitz verbarg er den Pumpenkolben in einem Tuch. Er verknotete es sorgfältig und verstaute das Paket zuunterst auf ihrem Wagen.
Ungesäumt verließen sie, als alles verpackt war, das schützende Haus und machten sich auf den Weg. Einen wehmütigen Blick warf die Mutter zurück, wehrte jedoch ab, als Vater Stelter seine Frau trösten wollte:
„Lass nur, Lieber. Mit Menschen, die uns nicht wollen, will auch ich nicht zusammenleben. Und um das Haus ist es mir nicht schade. Auch wenn das Trienchen hier geboren ist. Wir können überall leben, wenn wir nur zusammen sind. Wenn wir nicht getrennt werden. Das ist meine einzige Sorge.“
Sie waren früh aufgebrochen, kein Schimmer des kommenden Morgens bleichte den Himmel, jedoch nicht früh genug. Am Ende der Dorfstraße standen vier schemenhafte Gestalten oberhalb der Böschung als der Weg durch eine kaum merkliche Erhebung schnitt. Sie hatten die Ausziehenden hier erwartet, um sie zum Abschied zu verhöhnen. Es war der Sohn des neuen Hofbesitzers mit seinen Kumpanen. Johlendes Geschrei empfing sie: „Teufelskack – Täuferpack! Teufelskack – Täuferpack!“ Mit langen Weidenruten neckten die Halbwüchsigen von oben herab das Zugpferd. Über den Köpfen von Mutter und Tochter, die als einzige auf dem Wagen saßen, fuchtelten sie mit den Rutenspitzen herum, strichen ihnen übers Gesicht und lachten dazu, wenn sie missmutig abwehrende Bewegungen hervorriefen. Jos wollte gegen die um Jahre älteren Burschen anstürmen, musste vom Vater, im letzten Moment am Arm gefasst, zurückgehalten werden. Das befeuerte den Übermut der Tobenden umso mehr. „Komm nur Kleiner, hol dir eine Tracht, wenn du dich traust. Mach uns das Vergnügen.“
Mit vor Wut tränenden Augen starrte Jos den Vater an. Er schämte sich in diesem Augenblick für ihn. Wieso ließ der sich ohne Gegenwehr so erniedrigen? Vater Stelter schien die Gedanken seines Sohnes erraten zu haben. Er sagte, wobei er wiederum seinen Arm auf Jos’ Schulter legte: „Man muss sich verteidigen, wenn man in Gefahr ist. Dann braucht es Mut. Wir sind nicht in Gefahr, nicht heute Morgen. Diese dummen Jungen fühlen sich stark. Aber gleich schon, wenn alles vorbei ist, dämmert ihnen, dass sie sich unanständig benommen haben und das schlechte Gewissen vergällt den armen Bübchen den ganzen schönen Tag.“
Noch während dies gesagt wurde, war, wie zur Bestätigung, am abnehmenden Getöse bereits die eintretende Lustlosigkeit der Stänkerer zu bemerken. Gleich darauf erstarb das Geschrei, abgelöst von übellaunigem Gemaule, das sich zu Schimpf und Zank auswuchs. Anscheinend hatte ihnen der Anstifter zu viel versprochen. Nun fingen sie Streit mit ihm an, da er sie ohne ein lohnendes Vergnügen um den Schlaf gebracht hatte. Die Stelters konnten ohne weitere Behelligung das Dorf verlassen. Jos dachte an den Pumpenkolben, auf dem sie saßen, und seine Wut verflog im Nu wie ein schlechter Wind.
Es ging nach Norden, zuerst aber mehr nach Osten. Die aufziehende Sonne spiegelte sich im Nass des jungen Tages, brach sich in den Tautropfen, säumte den Wegesrand mit einer funkelnden Glasperlenkette. Zwischen den Feldern und kleinen Wäldchen schimmerte mitunter in der Ferne blank und grau, gleich einem polierten Silberbarren aus den nahen Minen, die Wasserfläche des mächtigen Flusses hindurch. In der klaren Luft zeigten sich die schwarzen Berge des Badischen Waldes zum Greifen nah. Sogar die mächtige Kontur des Feldbergs wurde sichtbar. Sobald die Sonne gänzlich aufgegangen war, verflog die Kühle und die Kraft des Frühsommertages eroberte mit voller Stärke den Tag. Mit der Wärme und Helligkeit kehrte die Freude am Dasein in die Gedankenwelt der Auszügler zurück, wenn auch die Zukunftsängste unterschwellig vorhanden blieben, sich nicht ins endgültige Vergessen drängen ließen.
Vater Stelter wusste nicht, ob er froh sein oder sich vom Kummer um das künftige Wohlergehen seiner Liebsten verzehren lassen sollte. Sein Innerstes lag im Wechselstreit der Gefühle. Froh war er darüber, endlich aufgebrochen und damit den Drangsalen des berüchtigten lutherischen Predigers von Schlettstadt entkommen zu sein, der ihnen mit übelsten Beschuldigungen und Aufstachelung ihrer Nachbarn das Leben im Dorf verekelt hatte. Aber Sorge bereitete ihm die Unsicherheit darüber, sich mit dem Ziel ihrer Wanderung eventuell falsch entschieden zu haben. War es denn nicht eigentlich unverantwortlich, in eine verlassene, ja, wie man hörte, ganz verödete Gegend zu ziehen? Hier, im noch jungen Herrschaftsgebiet des alten Franzosenkönigs blühte das Land wieder auf nach der Kriegszeit, die mehr als ein Menschenleben angedauert hatte. Wogegen im Reich immer noch Armut herrschte und gehungert wurde. Und besonders in dem Landstrich, den dieser dreiste Louis, dieser Alles-mir-Ludwig, im Erbstreit nicht hat behalten dürfen und darum unbarmherzig zerstören ließ, sollten sich die Menschen tatsächlich von Rinde und Gras ernähren, wie erzählt wurde. Es war wirklich zum Verzweifeln.
Noch ganz in der Grübelei begriffen vernahm Vater Stelter plötzlich den liebreizenden Gesang eines Zaunkönigs, der direkt vor ihnen im Gebüsch zu sitzen schien. Sofort hellte sich seine Stimmung auf und neuer Lebensmut erfasste ihn. ,Wenn es auch schwer wird‘, sagte er sich ‚mit unserer Tüchtigkeit werden wir es schon schaffen. Hauptsache der Landesherr lässt uns hinein und die Pfaffen werden nicht gar zu frech‘. Den Seinen, die schweigsam in scheinbar ähnlichen Betrachtungen versunken waren wie der Familienvater, rief er aufmunternd, die Fröhlichkeit bewusst übertreibend, zu:
„Schaut euch an, wie die Sonne lacht. Der Herr schenkt uns einen wunderschönen Tag, auf dass wir unverzagt auf seinem Weg voranschreiten.“ Und beschwingt forderte Vater Stelter seine Frau auf: „Roseruth, stimme ein Liedlein an!“
Lächelnd, da er sie beim Kosenamen gerufen hatte, was ihr anzeigte, dass es ihm gut ging, begann Ruth mit ihrer schönen Altstimme zu singen:
„Gott hat den Vöglein Stimm’ verliehen, drum singen sie sein heilig’ Lied ...“ Dann fiel auch das Trienchen ein, dann Johannes Senior und endlich auch, nachdem sein Vater ihn angestupst hatte, Johannes Junior, den sie stets nur Jos nannten. Und hielte sie nicht die Sorge vor der Zukunft gefangen, hätte sie die Lebenslust vollständig mitgerissen und sie hätten womöglich noch einen Reigen getanzt. So aber genossen sie den glücklichen Augenblick und in ihrer Brust spross zaghaft eine Knospe Zuversicht.
*
Am zweiten Abend hatten sie die Gegend um Benfeld erreicht. Das Städtchen an der Ill erlebte einen Aufschwung wie seit dem späten Mittelalter nicht mehr. Der Tabakanbau machte riesige Fortschritte und verschaffte der Bevölkerung im Umland zunehmend ein ordentliches Auskommen. Dem einen mehr, dem anderen weniger, je nach Stand und Stellung. Frieden war ungewöhnlich lange schon. Eine neue Zeit brach an, stimmte die Menschen froh und machte sie duldsam. Die meisten jedenfalls. Denn Spuren der Gesinnung des Polemikers Prueckner14, der hier gewirkt und sich mit Angriffen und Aufstachelungen gegen die Glaubensbrüder der Stelters schon einhundertfünfzig Jahre zuvor besonders hervorgetan hatte, waren erhalten geblieben. Dass sein Geist in den Köpfen mancher Einwohner sogar sehr lebendig war, wurde ihnen sogleich vorgeführt.
„Wer seid Ihr? Woher kommt Ihr? Was habt Ihr hier zu suchen?“ wurden sie von einem Unsichtbaren mit kaum verhohlener Feindschaft grob angeherrscht. Das war mit der schrillen Stimme eines übereifrigen Hauswarts gesprochen, der ungehorsame Schulbuben zurechtweist. Wenn sie nicht dem Fürsten des Landes gehörte, der diese Gegend hier als sein Privatbesitz betrachten durfte, war es eine gelinde Ungehörigkeit, einen ehrbaren Mann auf diese Weise anzupöbeln. Verwundert blickten sich die Stelters um, suchten den unfreundlichen Zeitgenossen zu entdecken. Da schoss wie ein Springteufel, keine zehn Schritte von ihnen entfernt, plötzlich der massige Oberkörper des Krakeelers hinter einem Ginsterbusch hervor. Der Mann hatte einen puterroten Kopf und stand neben der Straße erhöht auf einem kleinen Erdbuckel. Die Unterhälfte des Menschen blieb vom Gestrüpp verdeckt. Trotzdem hätten sie ihn in der baumlosen Gegend eigentlich schon aus einiger Entfernung bemerken müssen. Hat der sich hier verborgen und ihnen aufgelauert?
Jos’ achtjähriges Schwesterchen Katharina, Trienchen gerufen, klammerte sich vor Schreck an ihren großen Bruder. Wie sie es immer tat, wenn sie sich vor fremden Menschen fürchtete.
‚Was soll das?‘, fragte sich Johannes Stelter. ‚Werden hier alle Fremden in dieser Weise begrüßt?‘ Laut antwortete er: „Wir sind ehrbare Christenmenschen, wie Ihr auch ...“ fügte aber leise hinzu, nur hörbar für die Seinen: „... hoffentlich.“
Der nun ganz ins Licht trat und mit vollem Antlitz sichtbar wurde, war ein Mann von beachtlichem Wuchs. Er war ein Städter, wie aus seiner Kleidung ersichtlich war, und kein armer. Ein untergeordneter Flurwächter war er bestimmt nicht. Er baute sich vor ihnen auf, als wollte er eine Predigt halten. Dabei blickte er mit unverhohlener Geringschätzung auf die kümmerliche Reisegesellschaft zu seinen Füßen herab. Gleichzeitig wirkte er aber auch nervös. Hatte er etwas zu verbergen?
‚Bist du auch sorgfältig gewandet, so doch von anmaßenden Manieren, mein Lieber. Dein Verhalten ist das eines Flegels und passt nicht zu deiner Hülle biederer Bürgerlichkeit. Du scheinst ein rechter Philister zu sein, ein Gauner obendrein‘, dachte Vater Stelter.
Er löste sich von den anderen und trat auf den Unbekannten zu. Der mochte ein Mittvierziger sein, war überdurchschnittlich groß, beleibt, mit Doppelkinn, dicken Wulstlippen und Knollennase, die Karikatur eines grob gewirkten Schlachtermeisters. Scheinbar war ihm die überraschende Begegnung nicht angenehm. Die Vorbeikommenden hatten ihn bei irgendetwas gestört. Sogleich erriet Johannes Stelter auch wobei. Ein beißender, charakteristischer Aasgeruch stieg ihm in die Nase, als er auf der Erhebung dem Manne gegenüberstand. Ein blutiges Bündel, das unweit entfernt im Gras lag, war denn auch die Ursache für den Gestank. Der Mann hatte hier mit Schlingen gejagt. Mehrere tote Kleintiere, Kaninchen, Marder und Iltisse lagen zu seinen Füßen, bestimmt schon vor einige Tagen in den Fallen verendet.
‚Ein Wilddieb der niedrigsten Sorte. Und anstatt sich zu schämen, wenn er ertappt wird, greift er die Zeugen seiner Untat auch noch an.‘ Um dem Zusammentreffen aber die Spannung zu nehmen, sagte Stelter freundlich: „Seid gegrüßt, hoher Herr. Wir sind auf dem Weg ins Niederbadische. Ich soll in Bruchsal eine Küsterstelle annehmen. Jakob Stifter, mein Name.“ Schon während er das sprach, dachte er: ‚Das war dumm. Wieso mach ich denn die Flunkerei so ausführlich? Der wird doch bestimmt misstrauisch dadurch.‘ Aber nachdem er die Erklärung vernommen hatte, wurde der Großsprecher kleinlaut, schien beruhigt. War ihm sein Verhalten nun wirklich peinlich oder war er tatsächlich überzeugt. Jedenfalls stand er mit hochrotem Kopf vor seinem Gelege und blickte Vater Stelter betreten an, während er versöhnlich sprach:
„Na dann ist es ja gut. Entschuldigt meine unwirsche Fragerei. Neuerdings zieht durch unsere Gegend öfters ketzerisches Teufelsgezücht, Gottesleugner, Wiedert...“ Er brach ab, setzte dann aber schnell hinzu: „Aber die erkennt man ja eigentlich sofort an ihren finsteren, verschlagenen Gesichtern. Das hätte mir doch gleich auffallen müssen, dass Ihr ehrliche Leute seid. Also entschuldigt nochmals.“ Und sich mit der flachen Hand vor den Kopf schlagend, als hätte er das Wichtigste vergessen, stellte er sich vor: „Ich bin Martin Matthias Kurzich mit Namen. Zunftmeister der Schmiede, hier in Benfeld.“ Sichtlich arbeitete es im Innern des Zunftmeisters. Johannes Stelter befürchtete schon, er hätte seine Lüge doch noch erkannt, als sich das Gesicht seines Gegenübers aufhellte. An alle gewandt verkündete er mit voller Stimmenmacht: „Ich schick euch eine kleine Stärkung, sobald ich heimgekehrt bin. Macht mir die Freude und nehmt die gute Gabe an. Ich werdet doch sicher hier bei uns in der Nähe nächtigen, oder?“
‚Gefährlich, gefährlich‘, dachte Vater Stelter und antwortete: „Besten Dank, hochedler Meister. Aber wir haben noch gut eine Stunde Weges vor uns, bis wir rasten können. Und wir sind versorgt.“
Als der Zunftmeister nach kurzem Stutzen und augenscheinlich etwas ärgerlich über die Zurückweisung mit nachlässigem Gruß entschwunden war, sagte der Vater: „Puh, das war knapp. Wir müssen sehen, dass wir so schnell als möglich weiterkommen.“ Das Trienchen sagte:
„Das ist ein böser Mann. Der kommt bestimmt noch mal zurück, um uns etwas anzutun.“ Ihre Umklammerung von Jos hatte sie zwar aufgegeben, hakte sich zum Gehen aber fest bei ihm unter und wollte jetzt nicht mehr bei der Mutter auf dem Wagen sitzen.
Vater Stelter ließ sich nichts anmerken. Aber Trienchens Gefühl beschlich nun auch ihn selbst. ‚Weiter runter bis an den Rhein‘, dachte er. ‚Da können wir uns zur Not irgendwo am Ufer im tiefen Busch verstecken‘.
Quer durch die Wiesen und Felder, auf kaum sichtbaren Wegen, zogen sie dem großen Fluss entgegen, der gut eine Stunde entfernt lag. Sie wollten sich verbergen und vor erneuten Begegnungen mit den hiesigen Einwohnern schützen, bis sie das Umland verlassen hatten. Die Leute konnten sie sogar unabsichtlich verraten. Es war schon Abend, aber es wollte und wollte nicht dunkel werden. Diese Jahreszeit, am Übergang vom Frühling zum Sommer, wenn es am Tage besonders lange hell ist, eignet sich vorzüglich zum Reisen. Aber für die Stelters war das jetzt ein Nachteil, denn die spät einsetzende Dämmerung erschwerte es ihnen im lichten Bewuchs der Rheinauen ausreichenden Schutz vor Entdeckung zu finden. Immer tiefer drangen sie ins hohe Gebüsch der Uferwiesen vor. Sie rochen bereits das nahe Wasser, als Hufgetrappel hörbar wurde.
„Da kommen sie!“ rief Jos, ein wenig zu laut. „Duckt euch!“ befahl Vater Stelter und legte einen Finger auf den Mund zum Zeichen, dass alle schweigen sollten. Dem Braunen griff er mit der Hand über die Nüstern, drückte ihn sanft nach unten. Das Pferd gehorchte als wäre es darauf dressiert worden.
Der Hufschlag wurde lauter. Es waren drei oder vier Reiter, stellte Vater Stelter fest. Sie suchten verteilt in weitem Umkreis und riefen sich ihre Wahrnehmungen zu: „Hier ist nichts.“ Ein anderer: „Aber ich habe doch gerade noch eine Stimme gehört.“ Dann offensichtlich der Zunftmeister Kurzich, dem sie begegnet waren: „Sie können noch nicht weit sein. Es ist eine Familie, Eltern mit zwei Kindern, vier insgesamt, die kommen nur langsam voran.“ Mit bildhafter Ankündigung dessen, was sie ihnen antun wollten, wenn sie die Gesuchten gefunden hätten, feuerten sie sich gegenseitig an.
„Wir werden sie im Rhein taufen, so wie es am Jordan gemacht wird. Mit dem ganzen Körper eintauchen, aber schön langsam, nicht so schnell wieder hochkommen lassen. Das wird ein Spaß.“ Ein anderer: „Nee, viel zu schonend. Mit Stalljauche müssen wir sie taufen.“
Dazwischen immer wieder halblaute Absprachen, so dass Vater Stelter nicht alles verstehen und darum nicht abschätzen konnte, was sie vorhatten. Aber sie kamen näher und näher. Das Trienchen zitterte vor Angst, klammerte sich mit beiden Händen so fest an ihren Bruder, dass ihr Griff ihm Schmerzen bereitete. Jos strich ihr beruhigend übers Haar, obwohl ihm selbst das Herz zum Herausspringen pochte. Mutter Stelter umarmte beide Kinder, bedeckte sie, so gut es ging, mit ihrem Körper, wollte sie vor den Anfeindungen der Welt beschützen. Mit Bangen sah sie zum Korb mit den beiden Hühnern. Die waren so still, als spürten sie die drohende Gefahr, blickten nur scheu umher ohne einen Ton von sich zu geben. In immer engeren Kreisbewegungen kamen die Greifer näher.
Mit monströsen, langen Schatten wurden die Silhouetten der Häscher wie urzeitliche Fabelwesen im abendlichen Sonnenlicht zwischen dem Gesträuch sichtbar. Schon konnten ihre Opfer, die sich in Todesangst gekrümmt auf den nassen Boden pressten, neben dem Schnauben der Pferde das Hecheln der Kerle selbst hören. Die waren mordlustig erregt, sogen gierig den Geifer wieder ein, der ihnen in boshafter Vorfreude aus den Mäulern troff. So dicht waren sie aber nicht mehr nur zu hören. Ihre bedrohliche enge Nachbarschaft wurde fühlbar, riechbar. Ein penetrant würziger Geruch mischte sich in den lieblich süßen Duft der Blumen und Kräuter am Flussufer. Scheinbar hatte Meister Kurzich seine Gesellen von der Esse weg zur Menschenjagd rekrutiert. Das waren keine parfümierten Edeldomestiken. Ihre Ausdünstungen verrieten den schwitzenden Schwerarbeiter gleich ihren Reittieren, die vom Herangalopp in Hitze gebracht waren.
Geruch kann Erkennungsmerkmal sein. Wie der Teufel am schwefligen Gestank, der Heilige an der ihn umwehenden Osmogenesia15 zu erkennen ist, so bringt auch feiges Kriechertum eine eigene Note hervor. Es ist der ranzige Mief der Gelegenheitsbestie, die den Amtsmächtigen, den Großkopferten zu gefallen sucht und darum mit Leidenschaft verhöhnt, quält und auch mordet, wenn es nützlich erscheint.
Die Meute kam den Gesuchten so nahe, dass Vater Stelter glaubte, jetzt wäre es um sie geschehen. Gerade wollte er sich erheben, um ihnen in aufrechter Haltung die Stirn zu bieten, als der Schmiedemeister ausrief: „Also, auf zu den Bergen. Bestimmt haben sie sich in die andere Richtung verdrückt. Ich will, dass wir sie finden und den Alten bestrafen, wenn er sich nicht bekehren lässt.“ Woraufhin die Übrigen sofort ihre Pferde wendeten und sich vom Versteck der Stelters abwandten. Als von ihren Jägern nichts mehr zu hören und zu sehen war, erhoben sie sich. Die Dämmerung hatte nun in vollem Umfang eingesetzt, womit sie fürs Erste in Sicherheit waren. Trotzdem zogen sie weiter. Vater Stelter ging voraus, den Weg suchend, während Jos das Pferd am Zügel führte. Trienchen musste wieder auf den Wagen zur Mutter zurück, die sie in den Arm nahm und wärmte. Kurz darauf war das Kind eingeschlafen.
Der Weg wurde zunehmend sumpfiger. Sie drohten im Schlamm zu versinken und unrettbar festzusitzen. Ohne fremde Hilfe würden sie sich dann nicht befreien können. Den Umständen sich beugend machten sie Rast und wollten die Nacht bis zum ersten Tagesgrauen dort, wo sie sich gerade befanden, verbringen. Etwas Wärmendes würde es heute natürlich überhaupt nicht geben. Ein Feuer anzuzünden, verbot sich von selbst, wäre in der Feuchtigkeit rundherum auch schwierig gewesen. Mit Speck und Brot stillten sie den Hunger, der sich nun erst meldete, und begaben sich zur Ruhe. Die Pritsche ihres Wagens bot ihnen ein leidlich bequemes und warmes, weil trockenes Lager. Wobei die körperliche Nähe zueinander nicht nur die Glieder wärmte, sondern auch die Seelen.
*
Eine erste Gefahr war überstanden, wenn man das Höhnen der unreifen Burschen beim Auszug der Stelter aus Markirch lediglich als einen unfreundlichen Abschiedsgruß wertete. Aber auch das hätte schlimm ausgehen können. Nur die Besonnenheit des Vaters hatte verhindert, dass Jos zu Schaden gekommen war. Die Attacke des Schmiedemeisters und seiner Gesellen hingegen hätte sogar tödlich enden können. Darum wurde es für jeden von ihnen eine unruhige Nacht, wenn sie vor Erschöpfung auch sofort in den Schlaf fielen.
Immer wieder erwachte Jos in der Dunkelheit und wusste nicht sogleich, wo er sich befand. Er sah in einen klaren Sternhimmel, vernahm unbekannte Geräusche, deren Ursprung er nur schwer oder gar nicht deuten konnte, roch das nahe Wasser und spürte die feuchte Kühle, die von ihm ausging. Neben ihm schnarchte der Vater. Dazwischen hörte er die regelmäßigen Atemzüge seiner Mutter und auch die, von leisem Wimmern begleiteten, der Schwester. In ihren Schlaf war die Angst gemischt, das spürte Jos deutlich. Aber noch bevor er sich über Trienchens angeschlagene Verfassung tiefere Gedanken machen konnte, schlief er selbst wieder ein. Wilde Träume begleiteten jede kurz Schlafphase. Einmal sah er den Meister Kurzich auf einem weißen Flügelross zurückkehren, allein, ohne seine Kumpane. Er war geräuschlos herangeschwebt. Ungeschickt wie Sancho auf seinem kleinen Eselchen, saß der Zunftmeister auf dem Fabelwesen, das wunderlicher Weise unter der übermäßigen Last nicht sofort zusammenbrach. Der Meister lachte höhnisch, lautlos, das Gesicht mit dem weit aufgerissenen Maul zu einer entsetzlichen Fratze verzogen. Mit süßlichem Falsett in der Stimme verkündete er: „Ihr seid in mein Reich eingedrungen, habt mich bei meinen Geschäften gestört. Nur mit dem Tod könnt ihr diese Schuld tilgen.“ Wieder erwachte Jos, diesmal schweißgebadet, sah sich um und bemerkte zu seiner Erleichterung, dass alles ruhig war, weiterhin tiefe Nacht und nur das Quaken der Frösche signalisierte, dass bald der Morgen grauen würde. Er schlief wieder ein. Aber der Albtraum war noch nicht zu Ende. Noch immer bedrohte sie der Meister. Jetzt hub er an, sie mit dem Gewicht seines massigen Körpers zu zermalmen. Die Stelters stürzten von dannen, ließen die ganze Ausrüstung und auch ihren Wagen mit dem Braunen im Stich. Behänd verfolgte sie der Zunftmeister, trieb sein fliegendes Reittier mit raunendem Geflüster an, kraulte ihm die Ohren, schmatzte vor Vergnügen, kicherte, röhrte zuweilen wie ein brunftiger Hirsch. Die Zweige der Pflanzen schlugen den Fliehenden ins Gesicht. Sie stolperten blindlings ins Ungewisse, traten in unsichtbare Bodenlöcher, fielen, erhoben sich mit Mühe, immer kraftloser werdend, die Kleider vollgesogen, durchtränkt von der schwarzen kalten Brühe des über die Ufer schwappenden Rheines. In panischer Angst rannten sie immer weiter, verloren sich aus den Augen, riefen sich vergebens, bis alles vorbei war. Jos stürzte zu Boden, zum wievielten Male, blieb ausgepumpt und müde liegen. Der Fluss war dicht vor ihm, ja eigentlich lag er bereits in ihm. Eine unbekannte Gewalt zog ihn immer tiefer hinein. Er spürte, wie der Grund unter ihm schwand, er keine Haftung, keinen Halt mehr fand. Zuerst versuchte er noch zu schwimmen, obwohl er das nie gelernt hatte, und es wollte auch nicht gelingen. Immer öfter versank er ganz, musste Wasser schlucken, spie es aus so gut er konnte, hustete, verschluckte sich, krächzte in Todesangst.
Er hatte es also nicht geschafft am Leben zu bleiben. Er spürte, dass seine Kleider vollständig durchtränkt und darum schwer waren wie Blei. Aber trotzdem konnte er atmen, wenn ihm auch ununterbrochen ein dünnes Rinnsal in den Mund lief und er sich nur durch ständiges Ausspucken vorm Ertrinken bewahren konnte. Vor seinen halb geöffneten Augen schlangen sich die langen dünnen Arme tausender grüner Ungeheuer ineinander. ‚Träume ich oder bin ich tatsächlich tot? Ist das die Wirklichkeit? Und wenn der Tod die Wirklichkeit ist, soll ich darum traurig sein?‘ Nur der Wille, die Eltern und sein Schwesterchen vom gleichen Schicksal zu bewahren, trieb ihn an, vollständige Klarheit zu erlangen.
Jos riss die Augen auf und sah über sich den langen Zweig eines dicht belaubten Baumes, dessen Ende seine Nase berührte, und von dem aller Tau der Blätter wie aus einem Trichter in seinen Mund floss. Jos schlug ihn beiseite und schaute sich um. Er sah seinen Vater sich mühsam aus einer feuchten Decke schälen und erheben, während das Trienchen in den Armen der schlafenden Mutter selig weiterschlummerte.
‚Ja, also dann war die Wiederkehr des Zunftmeisters gar nicht geschehen? Nur ein Traum?‘ Verwirrt suchte Jos sich zu erinnern. Als sich die Gewissheit einzustellen begann, dass alles nur ein böser Alb gewesen war, überkam ihn Erleichterung. ‚Dem Herrgott sei Dank!‘ Er schüttelte sich, um die schweren Traumgesichter endgültig zu verbannen, froh darüber, dass alles war, wie es war. Er dachte an das gestern Vorgefallene und wie sie in der Nacht herumgeirrt und sich schließlich dort, wo sie vollkommen orientierungslos stehen geblieben waren, zur Ruhe gebettet hatten.
Tatsächlich hatte es sie in eine Blättergrotte, eine grüne Höhle, verschlagen. Jedenfalls konnte man den dichten Pflanzenwuchs, von dem sie umgeben waren und der sich sogar teilweise über ihren Köpfen zusammenschloss, dafür nehmen. Um sie herum quakte, grillte und zirpte das Sumpfgetier in unzähligen Wasserlöchern, anscheinend emsig bestrebt sich gegenseitig zu überbieten. Daneben gluckste und raschelte, wuselte und platschte es, so dass man gewahr wurde, mit zahllosen Lebewesen Tuchfühlung zu haben, von denen aber nur die wenigsten sichtbar wurden. Es roch modrig. Von den triefend nassen Pflanzen tropfte das Wasser auf einen übervollgesogenen Erdboden, sammelte sich in jeder Vertiefung und da es nirgends hin ablaufen konnte, blieb es unbewegt stehen, bot Myriaden von Stechmücken die ideale Grundlage unablässiger Vermehrung. Kühl war es in der Nacht gewesen, feucht und klamm waren Kleider und Bagage. Allen fröstelte, besonders das Trienchen zitterte vor Kälte nach dem Erwachen. Mit Bewegung kämpften sie dagegen an, schlugen die Arme um den Körper, gingen in die Hocke, streckten sich. Sie tappten mit den Füßen auf der Stelle, was allerdings nur das Wasser aufspritzen ließ und ihr schwammig gewordenes Schuhwerk noch mehr durchweichte.
Das Licht der ersten Sonnenstrahlen brachte angenehme Wärme, besserte die Stimmung der Stelters, weckte ihre Lebensgeister, mobilisierte aber auch zugleich die blutsaugenden Insektenweibchen, die sich in wildem Rausch auf die nackten Hautflächen ihrer Opfer stürzten. Hätte es noch eines Antriebes bedurft, die Umgebung des ungastlichen Benfelds zu verlassen, war er nunmehr gegeben.
‚Hier ist es paradiesisch‘, dachte Jos ‚aber entschieden zu nass‘. Er beobachtete die Umgebung, wie auch Vater Stelter. Der jedoch in erster Linie, um die allgemeine Lage zu erkunden. Sie schienen in Sicherheit. Einzig bemerkbare Kreaturen der göttlichen Schöpfung um sie herum waren Vögel und Insekten. Blieben sie selbst unbehelligt, wenn man die steten Angriffe der lästigen Blutsauger ausnahm, behelligten sie ihrerseits mit ihrer Anwesenheit aber die hier angestammten Bewohner, vor allem die fliegenden, die ihre Nester auf dem Boden bauten. Zuvörderst die Regenpfeiffer machten sich bemerkbar, erhoben hörbaren Protest, meckerten kreischend, um die Störer zu verjagen, die ihrem Bau zu nahekamen.
‚Selbst die Tiere wollen uns nicht‘, dachte Jos. ‚Aber es ist die Zeit der Aufzucht. Sie haben ja Recht. Vielleicht sollten auch wir uns tatkräftiger wehren‘.
Nachdem sie sich der morgendlichen Drangsal entledigt hatte, schafften sie es aus eigener Kraft, wenn auch mit erheblicher Anstrengung, dem Sumpfland zu entkommen. Dabei war die Muskelkraft aller Familienmitglieder gefordert. Selbst Trienchen musste mitschieben und drücken, denn ihren Braunen hatte der lange Aufenthalt seiner Hufe im Wasser zugesetzt. Das Pferd hatte Schnupfen, was sich darin äußerte, dass ihm der Rotz aus den Nüstern troff und es vor Schlappheit nicht wie gewohnt kraftvoll ziehen konnte. „Armer Brauner“, sagte Mutter Ruth „hast in den letzten Tagen viel zu schuften gehabt. Da ist man gleich anfällig, wenn man kalte Füße bekommt.“ Sie hatte das in einem Ton gesagt, zart, voll Mitgefühl und Wärme, als spräche sie zu einem ihrer Kinder. Dabei holte sie einen Apfel hervor, der mit zu ihren kostbarsten Speisevorräten gehörte. Sie gab ihn dem Tier, um dem Leidenden etwas von der Schwere seiner Bedrängung mit dem unverhofften Genuss einer Lieblingsspeise zu nehmen, so wie sie es eben machte, wenn ein Familienmitglied zu kränkeln begann. Denn der Braune war längst Familienmitglied geworden, und darum nickte Vater Stelter zustimmend als er das sah.
Sie nahmen ihre Wanderung wieder auf, machten zur Schonung des Braunen öfters kleine Pausen, blieben aber in kurzer Distanz zum Rhein. Mit seiner stetig fortlaufenden dicht bewachsenen Uferzone würde ihnen der Fluss zur Not noch mindestens für eine ganze Tagesstrecke den schon bewährten Unterschlupf bieten. Langsam, aber stetig entfernten sie sich von Benfeld, gewannen einen ordentlichen Abstand, bis am Nachmittag in der Ferne die Turmspitze des Straßburger Münsters auftauchte.
„Die große Stadt müssen wir meiden“, sagte der Vater. „Wir versuchen uns am Ufer durchzuschlängeln. Wenn wir die Stadt auf der anderen, der den Bergen zugewandte Seite umgehen wollten, verlören wir ein bis zwei Tage.“ Er sagte das mehr zu sich selbst, denn er allein bestimmte auf welchen Wegen sie reisten.
Je näher sie der alten Reichsstadt kamen, je mehr bevölkerten sich die Straßen und Wege. Und wenn sie auch unbehelligt blieben, breitete sich in ihrem Inneren doch ein beklemmendes Gefühl der Unsicherheit aus. Alle Vier rechneten jeden Augenblick mit einem Zwischenfall, wenn auch keiner seine Befürchtungen aussprach. Das Trienchen blieb auf dem Wagen bei der Mutter, bedeckte sich trotz des warmen Tages mit der Decke, wollte von niemandem gesehen und beachtet werden.
Da es heute nicht nur warm, sondern hier in der freien Ebene auch besonders trocken war, stand mannshoch in feinen Wölkchen der vom lebhaften Verkehr aufgewirbelte Staub über der sandigen Straße. Der graugelbliche Dunst markierte zwischen den grünen Wiesen und den kurz vor der Reife zitronengelb schimmernden Kornfeldern weit sichtbar die Windungen der vor ihnen liegenden Wegstrecke.
Jos ging neben dem Vater, der aufmerksam die Leute studierte, denen sie begegneten. Es waren meist Bauern, die ihnen vom Markt aus der Stadt entgegenkamen. Manche grüßten freundlich, die Übrigen waren in Gedanken versunken oder sahen über sie hinweg. Einige Wenige warfen ihnen verächtliche Blicke zu, tuschelten miteinander. Ein oder zwei drohten mit geballter Faust, blieben aber weit entfernt.
Und die, die sie am unfreundlichsten betrachteten, waren meist Angehörige der ärmeren Schichten, wie Johannes Stelter feststellte. Das erbitterte ihn. Warum nur gerade die, die doch auch unter der Obrigkeit litten? ‚Wahrscheinlich tröstet es sie, erleichtert ihnen ihr schweres Schicksal, wenn sie erkennen, dass es Menschen gibt, die offensichtlich noch weniger gelten als sie selbst. Mit heftigster Empörung würden die Stallknechte und Tagelöhner es von sich weisen, wollte man ihnen erklären, dass ich von gleichem Stande bin wie sie, oder als freier Bauer gar von höherem. Und um ihre geringe Vorzugsstellung zu unterstreichen und auszukosten, tun sie hochmütig und wollen uns ihre Verachtung spüren lassen. Wie unsinnig das doch ist, wie dumm‘. Reisende der oberen Schichten, wohlhabende Reiter oder Passagiere in bequemen Kutschen waren selten zu sehen, Geistliche gar nicht. ‚Gott sei Dank‘. Vater Stelter hing seinen Gedanken nach.
Jos sah zu seinem Erzeuger hoch. Ungefragt ein Gespräch zu beginnen, gehörte sich nicht für einen unmündigen Knaben. Da der Vater aber nicht, wie sonst üblich, den Wissensdurst seines Sohnes schon im Vorfeld erriet und bediente, sprach der ihn, nachdem er eine Weile vergeblich abgewartet hatte, ehrfürchtig an: „Herr Vater, warum sehen uns einige der Leute, denen wir begegnen, so böse an? Sie schauen als glaubten sie, wir wollten ihnen etwas antun oder sie bestehlen.“ Vater Stelter legte seinem Jungen den freien Arm über die Schulter. Mit um Verständnis werbender Stimme sagte er: „Wir sind Fremde hier, noch dazu Durchreisende. Das ist es.“ Jos konnte das nicht verstehen, denn überall gab es Durchreisende, denen in der Regel höflich begegnet wurde, wie er es selbst oft beobachtet hatte. Zögerlich entgegnete er: „Reisende gibt es doch überall. Die vielen Kaufleute zum Beispiel. Über deren Kommen freuen sich die Leute.“
Sein Vater versuchte es ihm zu erklären, während er selbst das, was er sagte, nachdenklich prüfte: „Na ja, auf Reisen sind wir auch. Aber, weißt du, wir reisen mit Sack und Pack, mit allem Hab und Gut, eigentlich wie Heimatlose, nicht wie reisende Kaufleute.“ Dann überlegte er, sprach es aber nicht aus: ‚Ja, wie Heimatlose. Das sind wir ja auch. Eigentlich kommen wir daher wie fahrendes Volk, wie eine Gauklertruppe, wie die Zigeuner. Kann man den Leuten ihr Misstrauen darum denn übelnehmen?‘.
Jos empfand plötzlich mit großem Erschrecken, dass die Zurücksetzung, der sie in ihrem Dorfe ausgesetzt gewesen waren, nichts Ungewöhnliches und Vorübergehendes war, sondern dass sie scheinbar mit einem bleibenden Makel behaftet waren, der sie überallhin begleitete. Enttäuschung erfasste ihn. Nirgendwo werden sie den anderen, den Normalen, gleichgestellt sein. Immer werden sie, sein Vater, seine Mutter und das Trienchen, wird er selbst, Zeit seines Lebens, zu einer Gruppe Minderwertiger gezählt werden, nie völlig gleichberechtigt. Und das wird auch dort nicht anders sein, wo sie hinziehen. Da war er sich sicher. Lohnte es sich dann überhaupt fortzugehen? Ja, es war schwierig gewesen in dem Dorf, in dem sie bis vorgestern gelebt hatten. Aber sie hatten ein schützendes Dach über dem Kopf, waren unter sich, wenn sie unter sich sein wollten. Wird es dort, wo sie hingehen, in der Fremde, im alten Reich, auch so sein?
Jos schwieg. Und auch sein Vater schwieg. Zum ersten Male dachte Johannes Stelter Senior über das Los der Menschen nach, die auch er bisher immer abfällig als Landstreicher, Müßiggänger und Beutelschneider bezeichnet hatte. Und ihm kam das Fragwürdige, das Abgründige dieser Einordnung, dieses Vorurteils, zu Bewusstsein.
‚Allein aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer Gruppe kann man den Menschen doch nicht abschließend beurteilen, nicht wissen ob der Einzelne ein guter oder schlechter, ein ehrbarer oder böser Zeitgenosse ist‘, sagte er sich. ‚Wieso nehmen viele Leute an, bloß weil wir auf der Straße leben, und das sogar nur für eine kurze, begrenzte Zeit, dass wir unehrliche Menschen sind, beäugen uns mit Argwohn?‘ Wut stieg in ihm auf. Am liebsten hätte er dem Nächsten tatsächlich etwas angetan, aus reiner Böswilligkeit. Noch während er das dachte, fühlte Johannes Stelter, was in den Köpfen derer vorgehen musste, die Zeit ihres Erdendaseins auf der Straße lebten, den Ausgestoßenen, den Verachteten, Verhöhnten, die ohne Skrupel beschimpft, betrogen, nicht selten gar geprügelt wurden, geprügelt werden durften, weil sie das Gesetz nicht schützte. Er begriff mit einem Male und verstand, dass diese Menschen von einem unbändigen Hass auf die Selbstgerechten, Hochnäsigen, Satten, beseelt sein mussten, die ihnen täglich das Leben schwer machten, sie schäbig behandelten, quälten und demütigten. Und sogleich wunderte er sich, wie wenig man von wirklichen Verbrechen hörte, dass nicht mehr vorkam an Mord, Raub, Betrug und Brandstiftung, dass diese armen Kreaturen die erniedrigende Behandlung hinnahmen und nur wenig ausrichteten gegen ihre Peiniger. Johannes Stelter konnte sich nun vorstellen, selbst alle diese Taten zu vollbringen, über die er bisher mit kopfschüttelndem Unverständnis nachgedacht und über ihre Urheber mit nur unzureichend unterdrückter Selbstgerechtigkeit geurteilt hatte. ‚Dabei sind das doch auch Gottes Geschöpfe, wie wir, wie alle Menschen. Auch Muselmanen, Chinesen und Zigeuner sind Gottes Kinder. Und auch ... Mörder, Räuber und Diebe. Ja, und natürlich auch die schlimmen Hetzer, Hasser und Folterknechte, Henker und sonstigen Peiniger.‘ Der alte Stelter war vollständig entgeistert, fast wäre er stehengeblieben, hätte sich am liebsten hingesetzt, da ihm die Knie weich wurden. Die Erkenntnis der letzten Minuten schockierte ihn. Verblüfft darüber, diese Überlegungen niemals zuvor angestellt zu haben, fing er an zu schwitzen. Auf der Haut kribbelte es, sein Blut schien mit verdoppelter Vehemenz durch die Adern zu schießen, der Kopf wurde ihm heiß, das Herz pochte merklich stärker und schneller.
Jos hatte seinen Vater beobachtet. Am Mienenspiel in dessen Gesicht hatte er ablesen können, dass in seinem Kopf einiges vorgegangen sein musste. Des Vaters voller Bart, der von Ohr zu Ohr reichte, aber dem der Schnurrbart fehlte, war, während sein Besitzer selbstvergessen nachgedacht hatte, hin und her gewandert, so dass die Spitzen einige Male fast die breite Krempe des Hutes berührt hatten.
Jos wartete darauf, dass der Vater etwas sagen würde. Nach einer ganzen Weile sprach der dann auch, mit ernster Stimme, doch in sehr aufgeräumter Stimmung: „Mein Junge, urteile nicht über die Menschen, ohne den Einzelnen genauer zu kennen. Man darf nie verallgemeinern, nie von der Zugehörigkeit zu einer Gruppe auf den Charakter eines ihrer Mitglieder schließen.“ Pathetisch hatte der Vater gesprochen. Jos wusste, dass dies eine Belehrung war, wie sein Vater sie schon öfters vorgenommen hatte, wenn sie des Abends beim Schein des Herdfeuers in der Kate gesessen hatten, meistens im Winter. Er antwortete: „Ja, Herr Vater. Ich will es mir merken.“ Nach einer Weile: „Gilt das immer und für alle Menschen?“ Jetzt überlegte Johannes Stelter Senior einen Moment und antwortete dann mit fester Stimme: „Ja, immer und für alle, ohne Ausnahme. Insbesondere für die unteren Stände, die Armen.“ „Auch für die Reisenden?“ Jos wollte sichergehen. „Ja, besonders für die Reisenden, die Heimatlosen, die Zigeuner, die Ausgestoßenen überhaupt.“ Und fügte dann, nur einen Atemzug später, noch an: „Auch für Türken16 und Juden, für alle, gerade wenn die anders sind als wir, anders aussehen als wir und anders glauben als wir.“
*
Sie kamen an eine Weggabelung. Es war die letzte Möglichkeit, das riesige Straßburg auf der den Bergen zugewandten Seite zu umgehen. Wie geplant ließ Vater Stelter den Abzweig links liegen und zog weiter parallel zum Rhein entlang. Bald waren in der nachmittäglichen Hitze neben dem riesigen Münster auch flimmernde Umrisse normaler Bauten und die mächtige Stadtmauer zu erkennen.
Bevor sie sich zwischen der Stadt und dem großen Fluss hindurchschlängelten, was sie an diesem Tage sowieso nicht mehr schaffen konnten, wollten sie sich etwas ausruhen und ordentlich herrichten. Auch darum, um sich in ihrer Erscheinung deutlich von dem wirklich fahrenden Volk zu unterscheiden. Sie suchten sich einen geeigneten Platz für die Nacht. Heute könnten sie ein Feuer entzünden, ohne aufzufallen, denn sie würden nicht die einzigen sein, die außerhalb der ehrwürdigen Mauern Straßburgs nächtigten. Im weiten Umkreis sah man am aufsteigenden Rauch, dass die ersten Flammen bereits an den Spänen bleckten. Hier lagerten umherziehende Krämer mit ihren Karren, auf Wanderschaft befindliche Handwerksburschen, die aus ihren Rucksäcken lebten, auch wirkliche Gaukler mit Bühnenwagen und Bärenkäfigen, sowie Fuhrleute mit schweren Zweispännern, die sich ihr Nachtlager bauten, weil sie es sich nicht leisten konnten, in einer bequemen Herberge zu logieren.
Als die abendliche Dämmerung fast schon in finstere Nacht übergegangen war und die Stelters sich einigermaßen eingerichtet hatten, gerade dabei waren, sich auf die warme Suppe zu freuen, trat ein zwielichtig aussehender Geselle zu ihnen heran. Vater Stelter erhob sich. Das Trienchen klammerte sich sofort wieder an Jos fest, verschwand fast hinter seinem Rücken, suchte sich unsichtbar zu machen.
Die Figur des Mannes wurde vom Schein ihres kleinen Feuers nur unvollständig erleuchtet. Allein Umrisse waren zu erkennen, ein langer dunkler, wohl blauer Rock, Stulpenstiefel in schmutzig weißen Beinkleidern und ein zerbeulter Dreispitz auf dem Kopf des Menschen. Von der Person selbst war kaum etwas zu sehen. Wie die angestrahlte Hülle eines seelenlosen Dämons stand sie da, wirkte bedrohlich. Als der Mann das bemerkte trat er einen Schritt weiter vor und wurde dadurch in seiner ganzen Gestalt sichtbar. Das Trienchen ließ entsetzt einen halb erstickten Schrei hören.
Der Kerl sah brutal aus. Irgendetwas hatte ihm das halbe Kinn weggerissen, so dass sein Mund auf der einen Seite den untersten Punkt des Gesichts markierte, während die andere Hälfte unversehrt schien. Ein Auge hing freischwebend in der Luft, jedenfalls kam es dem Betrachter so vor. Der Mann selbst war riesig, überragte den Vater um Haupteslänge. Dazu schien er kräftig und noch jung an Jahren. Er grüßte brummend: „...n’ Abend, Leute.“
‚Das ist ein rechter Strauchdieb‘, dachte Johannes Stelter. ‚Sieht nicht so aus als verdient er mit einem ehrlichen Handwerk sein Brot. Will sehen, dass er schnell wieder abzieht‘. Er grüßte zurück, jedoch bereit die Seinen diesmal auch handgreiflich zu verteidigen: „Gesegneten Abend. Womit können wir zu Diensten sein.“
Der andere sah sich stumm um, musterte die Versammelten, versuchte scheinbar herauszufinden mit welcher Art von Leuten er es zu tun hatte. Dann sagte er: „Ihr habt ein schönes Feuerchen. Und gleich gibt es etwas Warmes in den Bauch, wenn ich recht vermute. Würdet ihr einem einsamen Wanderer einen Platz an eurer Seite einräumen?“ Hatte er die ersten beiden Sätze noch mit unverblümter, fast aufdringlicher Unbekümmertheit geäußert, kam der letzte höflicher, mit weicherer Stimme aus ihm heraus. Ein Anflug von Lächeln umspielte dabei seine zerschmetterten Züge, was sie noch grauenhafter wirken ließ.
Vater Stelter wollte abwehren, suchte nach einer Ausrede. Seine Frau hatte sich unterdessen von der Feuerstelle erhoben und legte ihrem Mann beruhigend die Hand auf den Unterarm. Sie nickte dem Fremden mit einladender Geste freundlich zu: „Setzt Euch zu uns, Herr Soldat. Wo eine Suppe für Viere reicht, reicht sie auch für Fünfe.“ Erstaunt, fast sprachlos, sah Johannes Stelter sein Eheweib an. Ruth lächelte.
Der Eingeladene legte sofort sein Felleisen ab und machte es sich am Feuer bequem. Er kramte einen verbeulten Blechnapf hervor, dazu einen vom langen Gebrauch schwarzglänzend gewordenen Holzlöffel.
Trotz des warmen Sommerabends suchten sie alle die Nähe zum Feuer. Jeder spürte die feuchte, schleichend aufkommende Kühle vom nahen Fluss.