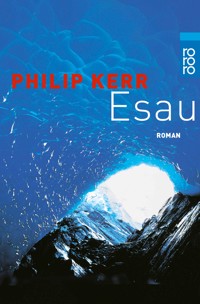9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Bernie Gunther ermittelt
- Sprache: Deutsch
Die Wahrheit in einem Wald voller Lügen Lang und bitterkalt ist der russische Winter des Jahres 1943. Erst im März wird es wärmer. Da wittern die ausgehungerten Wölfe im Wald von Katyn etwas im angetauten Boden: Knochen. Menschliche Gebeine. Goebbels will die Nachricht von einem Kriegsverbrechen der Russen für seine Propaganda nutzen. Die Sache muss jedoch hieb- und stichfest sein. Also schickt er Privatdetektiv Bernie Gunther dorthin, um in dem Fall zu ermitteln. Doch in Smolensk treibt auch die Heeresgruppe Mitte ihr Unwesen. Nicht nur unschuldige Menschen fallen ihr zum Opfer, sondern bald auch die Wahrheit ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 712
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Philip Kerr
Wolfshunger
Roman
Über dieses Buch
Die Wahrheit in einem Wald voller Lügen
Lang und bitterkalt ist der russische Winter des Jahres 1943. Erst im März wird es wärmer. Da wittern die ausgehungerten Wölfe im Wald von Katyn etwas im angetauten Boden: Knochen. Menschliche Gebeine.
Goebbels will die Nachricht von einem Kriegsverbrechen der Russen für seine Propaganda nutzen. Die Sache muss jedoch hieb- und stichfest sein. Also schickt er Privatdetektiv Bernie Gunther dorthin, um in dem Fall zu ermitteln. Doch in Smolensk treibt auch die Heeresgruppe Mitte ihr Unwesen. Nicht nur unschuldige Menschen fallen ihr zum Opfer, sondern bald auch die Wahrheit ...
Vita
Philip Kerr wurde 1956 in Edinburgh geboren. 1989 erschien sein erster Roman «Feuer in Berlin». Aus dem Debüt entwickelte sich die Serie um den Privatdetektiv Bernhard Gunther. Für Band 6, «Die Adlon-Verschwörung», gewann Philip Kerr den weltweit höchstdotierten Krimipreis der spanischen Mediengruppe RBA und den renommierten Ellis-Peters-Award. Kerr lebte in London, wo er 2018 verstarb.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2014
Copyright © 2014 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«A man without breath» Copyright © 2013 Philip Kerr
Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung Maria Jose Rivera, Lisa Howarth/Trevillion Images
ISBN 978-3-644-21471-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Danksagung
Motto
Teil 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Teil 2
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Schlussbemerkung
Dieser Roman ist ein kleines Zeichen meines Danks an Tony Lacey, der mich überhaupt erst zum Schreiben brachte. Und an Marian Wood, der mich dazu brachte weiterzumachen.
«Volk ohne Religion, das ist so wie Mensch ohne Atem.»
Joseph Goebbels in seinem einzigen veröffentlichten Roman Michael
Teil 1
Kapitel 1
Montag, 1. März 1943
Franz Meyer am Kopfende des Tisches stand auf, senkte den Blick, berührte das Tischtuch und wartete auf Stille. Mit den hellen Haaren, den blauen Augen und den klassischen Gesichtszügen, die aussahen, als wären sie von Arno Breker gemeißelt worden, dem bedeutendsten deutschen Bildhauer der Gegenwart und Hitlers erklärtem Liebling, entsprach er auf jeden Fall nicht dem Klischee eines Juden. Die halbe SS und der halbe SD waren äußerlich viel semitischer als er. Meyer holte tief und beinahe euphorisch Luft, grinste breit und verlieh damit seiner Erleichterung und Lebensfreude Ausdruck. Dann hob er sein Glas und prostete den vier Frauen zu, die mit uns rings um den Tisch saßen. Keine von ihnen war Jüdin, und doch sahen sie nach den rassischen Stereotypen, die das Propagandaministerium so gerne verbreitete, mit ihren großen Nasen, dunklen Augen und sogar noch dunkleren Haaren ziemlich jüdisch aus. Einen Moment lang schien Meyer von Gefühlen übermannt zu werden, und als er endlich wieder reden konnte, standen ihm Tränen in den Augen.
«Ich möchte meiner Frau und ihren Schwestern für die Anstrengungen danken, die sie für mich unternommen haben», sagte er. «Was ihr getan habt, erforderte großen Mut, und ich kann euch gar nicht sagen, wie wichtig es für die im Gebäude der ehemaligen Behörde für Wohlfahrtswesen der Jüdischen Gemeinde Untergebrachten war, zu wissen, dass so viele Leute hergekommen sind, um zu demonstrieren.»
«Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie uns nicht auch eingesperrt haben», sagte Meyers Frau Siv.
«Sie sind es eben gewohnt, dass die Leute ihren Befehlen gehorchen», sagte seine Schwägerin Klara. «Darum waren sie völlig überfordert.»
«Morgen gehen wir wieder in die Rosenstraße», beharrte Siv. «Wir werden nicht ruhen, ehe alle anderen dadrin auch freigelassen wurden. Alle zweitausend. Wir haben gezeigt, wie viel wir erreichen können, wenn die öffentliche Meinung mobilisiert wird. Darum müssen wir den hohen Druck aufrechterhalten.»
«Ja», sagte Meyer. «Und das werden wir tun. Bestimmt. Aber nun möchte ich einen Toast ausbringen. Auf unseren neuen Freund Bernie Gunther. Wären er und seine Kollegen bei der Wehrmacht-Untersuchungsstelle für Verletzungen des Völkerrechts nicht gewesen, würde ich wohl immer noch festsitzen. Und wer weiß, was dann mit mir passiert wäre?» Er lächelte. «Auf Bernie.»
Wir saßen zu sechst in dem kleinen, gemütlichen Esszimmer in der Wohnung der Meyers in der Lützowstraße. Als jetzt vier von ihnen aufstanden und mir schweigend zuprosteten, schüttelte ich nur den Kopf. Ich war mir nicht sicher, ob ich Franz Meyers Dank verdient hatte. Außerdem war der Wein, den wir tranken, ein anständiger deutscher Rotwein. Ein Spätburgunder, lange vor dem Krieg gekeltert. Seine Frau und er hätten ihn wohl lieber gegen etwas Essen getauscht, statt ihn an mich zu verschwenden. Wein – vor allem ein ordentlicher deutscher Rotwein – war dieser Tage fast unmöglich zu bekommen in Berlin.
Höflich wartete ich, bis sie auf meine Gesundheit getrunken hatten. Dann stand ich auf, um meinem Gastgeber zu widersprechen. «Ich bin nicht sicher, ob ich behaupten darf, viel Einfluss auf die SS zu haben», erklärte ich. «Ich habe lediglich mit ein paar Polizisten gesprochen, die Ihre Demonstration überwacht haben. Sie haben mir gesagt, dass vermutlich die meisten der bei der Fabrikaktion vom Samstag Inhaftierten schon in wenigen Tagen wieder freigelassen werden.»
«Das ist unglaublich», sagte Klara. «Aber was bedeutet das jetzt, Bernie? Glauben Sie, die Behörden werden wirklich die Deportationen einstellen?»
Ehe ich meine Meinung kundtun konnte, ging die Sirene für den Fliegeralarm los. Wir schauten uns überrascht an; es war fast zwei Jahre her, seit der letzte Fliegerangriff von der Royal Air Force geflogen wurde.
«Wir sollten in den Luftschutzbunker gehen», sagte ich. «Oder wenigstens in den Keller.»
Meyer nickte. «Ja, da haben Sie recht», sagte er fest. «Ihr solltet alle gehen. Falls es kein blinder Alarm ist.»
Ich holte meinen Mantel und den Hut von der Garderobe und wandte mich an Meyer.
«Aber Sie kommen doch wohl mit, oder?», fragte ich ihn.
«Juden ist der Zutritt zu den Bunkern verboten. Vielleicht ist Ihnen das bisher nicht aufgefallen. Gibt ja auch keinen Grund, dass Sie es hätten bemerken können. Ich glaube, seit wir angefangen haben, den gelben Stern zu tragen, gab es keinen Fliegeralarm.»
Ich schüttelte den Kopf. «Nein, das habe ich nicht gewusst.» Ich zuckte mit den Schultern. «Und wo gehen die Juden dann hin?»
«Zum Teufel natürlich. Wenigstens hoffen die darauf.» Dieses Mal war Meyers Lächeln sarkastisch. «Außerdem wissen die Leute, dass das hier die Wohnung eines Juden ist, und da das Gesetz vorschreibt, die Türen und Fenster offen zu lassen, wenn man die Wohnung verlässt, ist das auch gleichzeitig eine Einladung an Diebe, vorbeizuschauen und uns zu bestehlen.» Er schüttelte den Kopf. «Darum bleibe ich lieber hier.»
Ich schaute aus dem Fenster. Auf der Straße unter uns waren bereits Hunderte Leute unterwegs. Wir durften keine Zeit mehr verlieren.
«Wir gehen ohne dich nirgendwohin, Franz», sagte Siv. «Lass einfach deinen Mantel hier. Wenn sie deinen Stern nicht sehen, müssen sie dich für einen Deutschen halten. Du kannst mich ja tragen und sagen, ich wäre ohnmächtig geworden, und wenn ich meinen Pass zeige und sage, ich bin deine Frau, wird niemand nachfragen.»
«Sie hat recht», sagte ich.
«Und wenn ich eingesperrt werde, was dann? Ich wurde gerade erst freigelassen.» Meyer schüttelte den Kopf und lachte. «Außerdem ist es vermutlich ohnehin falscher Alarm. Hat uns der dicke Hermann nicht versprochen, dass Berlin die am besten verteidigte Stadt Europas ist?»
Das schreckliche Heulen draußen ging weiter – eine mechanische Sirene, die das Ende der Nachtschicht an den rauchenden Schloten der Hölle verkündete.
Siv Meyer setzte sich wieder an den Tisch und faltete die Hände. «Wenn du nicht gehst, bleibe ich auch.»
«Ich auch», erklärte Klara und setzte sich neben sie.
«Wir haben keine Zeit für Diskussionen», sagte Meyer. «Ihr solltet gehen. Alle.»
«Er hat recht», drängte ich, denn jetzt konnten wir bereits das Dröhnen der Bomber in der Ferne hören; offensichtlich war es kein Fehlalarm. Ich öffnete die Tür und winkte den vier Frauen, mir zu folgen. «Los jetzt», sagte ich.
«Nein», sagte Siv. «Wir bleiben.»
Die beiden anderen Schwestern schauten sich nur kurz an, ehe sie sich wieder neben ihren jüdischen Schwager setzten. Ich zog den Mantel an und schob die Hände in die Taschen, um zu verbergen, wie sehr sie zitterten. Schließlich hatte ich gesehen, was unsere eigenen Bomber mit Minsk und Teilen Frankreichs angerichtet hatten.
«Ich glaube nicht, dass sie gekommen sind, um Propagandaflugblätter abzuwerfen», bemerkte ich. «Diesmal nicht.»
«Stimmt, aber sie sind auf keinen Fall hinter Zivilisten wie uns her», sagte Siv. «Sie werden das Regierungsviertel ansteuern. Sie wissen doch von dem Krankenhaus hier in der Nähe, und die RAF wird bestimmt nicht riskieren, das Katholische Krankenhaus zu treffen, oder? So sind die Engländer nicht. Sie sind hinter denen in der Wilhelmstraße her.»
«Wie sollen sie aus siebenhundert Metern Höhe wissen, wo die ist?», hörte ich mich widersprechen.
«Sie hat recht», sagte Meyer. «Nicht der Westen der Stadt ist ihr Ziel. Sie wollen in den Osten. Was bedeutet, dass es ganz gut ist, dass heute Nacht keiner von uns in der Rosenstraße ist.» Er lächelte mich an. «Sie sollten gehen, Bernie. Wir kommen schon zurecht, Sie werden sehen.»
«Ich vermute, Sie haben recht», sagte ich und beschloss, wie die anderen den Fliegeralarm zu ignorieren. Ich zog meinen Mantel aus. «Jedenfalls kann ich Sie hier nicht alleine lassen.»
«Warum nicht?», fragte Klara.
Ich zuckte mit den Schultern. Letzten Endes war es natürlich so: Ich konnte mich kaum aus dem Staub machen und dennoch weiterhin in den hübschen braunen Augen Klaras gut aussehen, was mir ziemlich wichtig war. Aber ich hatte nicht das Gefühl, ihr das jetzt sagen zu können. Noch nicht.
Einen Moment lang spürte ich, wie meine Brust sich schmerzhaft zusammenzog, weil meine Angst mich nach wie vor fest im Griff hatte. Dann hörte ich Bomben detonieren und atmete auf. Wenn man damals, während des Ersten Weltkriegs, vom Schützengraben aus die Granaten explodieren hörte, bedeutete das meistens, dass man in Sicherheit war. Man sagte nämlich, dass man die nicht hört, die einen tötet.
«Klingt eher, als würde der Norden von Berlin das meiste abkriegen», sagte ich und lehnte mich an den Türrahmen. «Die Raffinerie in der Thaler Straße, nehme ich an. Das ist dort das einzige lohnenswerte Ziel. Aber ich finde, wir sollten uns zumindest unter den Tisch hocken. Nur für den Fall, dass eine verirrte Bombe …»
Ich glaube, das war das Letzte, was ich sagte, und vermutlich verdanke ich dem Umstand mein Leben, dass ich im Türrahmen stand. Denn in diesem Augenblick schien das Fensterglas zu tausend Tropfen aus Licht zu zerschmelzen. Einige der alten Wohnhäuser in Berlin waren für die Ewigkeit geschaffen, und ich erfuhr später, dass die Bombe, die das Haus in die Luft jagte, in dem wir waren – nicht zu vergessen auch das Krankenhaus in der Lützowstraße –, mich auf jeden Fall getötet hätte, wenn ich nicht den Türsturz über meinem Kopf und die stabile Eichentür im Rücken gehabt hätte, die das Gewicht des Stützbalkens von mir abhielt. Siv Meyer und ihren drei Schwestern jedenfalls brachte er den Tod.
Danach herrschten Dunkelheit und Stille, bis auf das Pfeifen eines Wasserkessels, der irgendwo auf der Herdplatte stand. Obwohl das auch genauso gut einfach das Lärmen meiner geplatzten Trommelfelle gewesen sein könnte. Es war so, als hätte jemand das elektrische Licht ausgeschaltet und mir dann den Boden unter den Füßen weggezogen. So musste es sein, mit einer Kapuze über dem Kopf am Galgen zu baumeln. Ich weiß nicht mehr genau … aber ehe ich mit meinen von der Detonationshitze ausgedörrten Lungen um Hilfe stöhnen konnte, war ich eine Weile davon überzeugt, dass die Tür, die auf meinem Gesicht lag, der Deckel meines eigenen verdammten Sargs war.
Ich hatte die Kripo im Sommer 1942 verlassen und mit stillschweigender Duldung meines alten Kollegen Arthur Nebe bei der Wehrmacht-Untersuchungsstelle für Verletzungen des Völkerrechts angefangen. Als Kommandant der SS-Einsatzgruppe B in Smolensk, wo Zehntausende russischer Juden ermordet worden waren, wusste Nebe selbst das eine oder andere über Kriegsverbrechen. Ich bin sicher, es gefiel seinem Berliner schwarzen Humor, dass ich mich zu einer Organisation alter preußischer Richter hingezogen fühlte, von denen die meisten unerschütterliche Nazigegner waren. Sie waren dem humanitären Völkerrecht verpflichtet, wie es in der 3. Genfer Konvention von 1929 niedergeschrieben worden war, und glaubten, es gebe für die Armee – jede Armee – eine anständige und ehrenvolle Art, Krieg zu führen. Nebe muss es ziemlich lustig gefunden haben, dass eine juristische Körperschaft innerhalb des deutschen Oberkommandos der Wehrmacht existierte, die sich nicht nur weigerte, Parteimitglieder in ihren Reihen zu dulden, sondern auch jederzeit darauf vorbereitet war, beachtliche Ressourcen für die Ermittlung und Strafverfolgung von Verbrechen einzusetzen, die von und gegen deutsche Soldaten verübt wurden: Diebstahl, Plünderung, Vergewaltigung und Mord. Und manchmal führten diese Verfahren zu einem Todesurteil für die Täter. Ich fand es selbst irgendwie lustig, aber ich bin wie Nebe aus Berlin, und es ist ja allgemein bekannt, was für einen merkwürdigen Humor wir Berliner haben. Im Winter 1943 musste man lachen, wenn sich die Gelegenheit dazu ergab, und ich weiß nicht, wie ich sonst eine Situation beschreiben soll, in der ein Unteroffizier der Wehrmacht wegen der Vergewaltigung und Ermordung eines russischen Bauernmädchens hingerichtet wird, während eine Einsatzgruppe der SS gerade fünfundzwanzigtausend Männer, Frauen und Kinder ermordet hat. Ich glaube, die Griechen haben ein Wort für diese Art von Komödie, und wenn ich nur ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bei der Klassikerlektüre in der Schule aufgebracht hätte, wüsste ich das Wort jetzt auch.
Die für die Untersuchungsstelle tätigen Richter sahen keinen Grund, ihre moralischen Standards nicht hochzuhalten, nur weil die deutsche Regierung keine moralischen Standards mehr hatte. Die Griechen hatten auch dafür einen Begriff, und den kannte ich sogar. Allerdings müsste man der Fairness halber dazusagen, dass ich erst wieder lernen musste, ihn zu buchstabieren. Sie nannten dieses Vorgehen ethisch, und für mich fühlte es sich gut an, meinen Verstand mit den Kategorien Richtig und Falsch zu beschäftigen, denn damit gelang es mir, ein Gefühl von Stolz aufrechtzuerhalten, das Bewusstsein, wer ich war. Zumindest für eine Weile.
Die meiste Zeit war ich damit befasst, den Richtern der Behörde zur Hand zu gehen. Einige von ihnen kannte ich noch aus der Weimarer Zeit. Es ging vor allem darum, die Aussagen von Zeugen aufzunehmen oder neue Fälle für die Behörde zu finden. Siv Meyer hatte ich über eine Frau namens Renata Matter kennengelernt, mit der ich gut befreundet war und die im Adlon arbeitete. Siv spielte im Orchester des Adlon Klavier.
Ich hatte Renata am 28. Februar im Hotel getroffen, also am Tag nach jenem Samstag, an dem in Berlin die letzten Juden – immerhin einige zehntausend Menschen – festgenommen worden waren, um sie in die Ghettos im Osten zu deportieren. Franz Meyer hatte man an seinem Arbeitsplatz in der Osram-Glühbirnenfabrik in Wilmersdorf festgenommen. Früher jedoch war er Arzt gewesen, und so hatte er sich als Sanitäter auf einem deutschen Lazarettschiff wiedergefunden, das im August 1941 vor der norwegischen Küste von einem britischen U-Boot angegriffen und versenkt wurde. Der Leiter meiner Behörde, Johannes Goldsche, hatte damals versucht, den Fall zu untersuchen, allerdings vergeblich, da man zu dem Zeitpunkt davon ausging, es hätte keine Überlebenden gegeben. Als Renata Matter mir also Meyers Geschichte erzählte, machte ich mich sofort auf und besuchte seine Frau in ihrer Wohnung in der Lützowstraße.
Es war ein ordentlicher Fußweg von meiner eigenen Wohnung in der Fasanenstraße aus. Genauso weit war es bis zu der Synagoge, in der viele Berliner Juden auf dem Weg zu ihrem ungewissen Schicksal im Osten festgehalten wurden. Meyer war bisher nur deshalb dem Arrest entkommen, weil er in Mischehe mit einer Deutschen verheiratet war.
Angesichts des Hochzeitsfotos auf dem Biedermeierbuffet konnte man sich denken, was sie aneinander fanden. Franz Meyer war auf absurde Art attraktiv und ähnelte frappierend Franchot Tone, dem Filmschauspieler, der früher mit Joan Crawford verheiratet war. Siv war einfach schön, und daran war nichts absurd. Viel wichtiger war, dass dies auch auf ihre drei Schwestern Klara, Frieda und Hedwig zutraf. Die drei waren ebenfalls da, als ich ihre Schwester zum ersten Mal traf.
«Warum ist Ihr Mann nicht schon vorher mit der Sache zu uns gekommen?», fragte ich Siv Meyer über einer Tasse Ersatzkaffee, der so ziemlich der einzige Kaffee war, den die Leute jetzt noch anbieten konnten. «Der Vorfall ereignete sich bereits am 3. August 1941. Warum ist er erst jetzt bereit, darüber zu sprechen?»
«Sie wissen bestimmt nicht besonders viel darüber, wie es ist, als Jude heutzutage in Berlin zu leben», sagte sie.
«Da haben Sie recht. Ich habe keine Ahnung.»
«Kein Jude will irgendwie Aufmerksamkeit auf sich ziehen, indem er zum Beispiel Teil einer Ermittlung ist. Selbst wenn es um eine gute Sache geht.»
Ich zuckte mit den Schultern. «Das kann ich verstehen», sagte ich. «Den einen Tag ist man Zeuge für die Wehrmacht-Untersuchungsstelle und am nächsten Gefangener der Gestapo. Andererseits weiß ich, wie es ist, im Osten Jude zu sein, und wenn Sie Ihren Mann davor bewahren wollen, dort zu enden, hoffe ich für Sie, dass Sie mir die Wahrheit sagen.»
«Sie waren im Osten?»
«Minsk», sagte ich. «Man hat mich zurück nach Berlin und zu dieser Behörde geschickt.»
«Was geht da draußen vor sich? In den Ghettos? Den Konzentrationslagern? Man hört so viele unterschiedliche Geschichten darüber, was genau diese Umsiedlungen bedeuten.»
Ich zuckte mit den Schultern. «Ich glaube, die Geschichten kommen nicht mal annähernd an den Horror heran, der in den Ghettos im Osten stattfindet. Und übrigens: Es gibt keine Umsiedlung. Da draußen warten nur Hunger und Tod.»
Siv Meyer seufzte und wechselte dann stumm einen Blick mit ihren Schwestern. Mir gefiel es auch, ihre drei Schwestern anzuschauen. Es war eine angenehme Abwechslung, mal eine attraktive und eloquente Frau zu befragen statt eines verletzten Soldaten.
«Ich danke Ihnen für Ihre Ehrlichkeit, Herr Gunther», sagte sie. «Man hört so viele Lügen.» Sie nickte ernst. «Da Sie so ehrlich sind, will ich auch ehrlich sein. Der Hauptgrund, weshalb mein Mann bisher nicht über den Untergang der SS Hrosvitha von Gandersheim berichtet hat: Er wollte Dr. Goebbels nicht antibritische Propaganda frei Haus liefern. Natürlich sieht es nach seiner Festnahme so aus, als wäre das seine einzige Möglichkeit, nicht in einem Konzentrationslager zu landen.»
«Wir haben nicht besonders viel mit dem Propagandaministerium zu tun, Frau Meyer. Nicht, solange es sich verhindern lässt.»
«Ich bezweifle nicht, dass Sie das, was Sie sagen, auch so meinen, Herr Gunther», sagte Siv Meyer. «Nichtsdestotrotz sind britische Kriegsverbrechen gegen deutsche Lazarettschiffe eine gute Propaganda.»
«Das ist die Sorte von Geschichte, die jetzt besonders nützlich ist», fügte Klara hinzu. «Nach Stalingrad.»
Ich musste zugeben, dass die beiden vermutlich recht hatten. Die Kapitulation der 6. Armee am 2. Februar in Stalingrad war so ziemlich die größte Katastrophe gewesen, die die Nazis erlitten hatten, seit sie an die Macht gekommen waren. Und Goebbels’ Rede am 18. Februar, mit der er den Totalen Krieg ausrief, hätte bestimmt hervorragend Vorfälle wie das Versenken eines deutschen Lazarettschiffs gebrauchen können, um zu unterstreichen, dass es für die Deutschen jetzt kein Zurück mehr gab. Sieg oder Untergang.
«Sehen Sie», sagte ich. «Ich kann Ihnen nichts versprechen, aber wenn Sie mir sagen, wo man Ihren Ehemann festhält, gehe ich direkt dorthin und schaue nach ihm, Frau Meyer. Wenn ich glaube, dass an seiner Geschichte irgendwas dran ist, setze ich mich mit meinen Vorgesetzten in Verbindung und sehe zu, ob wir ihn nicht als Kronzeugen für eine Untersuchung frei bekommen.»
«Er wird im Haus der jüdischen Gemeinde in der Rosenstraße festgehalten», sagte Siv. «Wir kommen mit.»
Ich schüttelte den Kopf. «Das geht schon in Ordnung. Ich weiß, wo das ist.»
«Sie verstehen nicht», sagte Klara. «Wir gehen so oder so alle dorthin. Um gegen Franz’ Festnahme zu protestieren.»
«Ich glaube, das ist keine so gute Idee», sagte ich. «Sie werden bestimmt festgenommen.»
«Viele Frauen werden dort hingehen», sagte Siv. «Sie können nicht alle von uns festnehmen.»
«Warum nicht?», fragte ich. «Falls Sie es nicht bemerkt haben, aber die haben auch alle Juden festgenommen.»
Ich hörte neben meinem Kopf Schritte und versuchte, die schwere Holztür von meinem Gesicht zu schieben. Aber meine linke Hand war eingeklemmt, und die rechte tat zu sehr weh, um sie zu benutzen. Jemand schrie etwas, und ein oder zwei Minuten später spürte ich, wie mein Körper ein Stück rutschte, weil der Schutt, auf dem ich lag, wie Geröll an einem Berghang nachgab. Dann wurde die Tür angehoben, und ich konnte meine Retter sehen. Das Wohnhaus war fast komplett verschwunden, und alles, was das Mondlicht in sein kaltes Licht tauchte, war ein hoher Kaminschlot, von dem einige Heizungsrohre abgingen. Mehrere Hände legten mich auf eine Trage, und ich wurde von dem rauchenden Schuttberg mit Beton, tropfenden Wasserleitungen und Holzbrettern hinuntergetragen und mitten auf der Straße abgelegt, wo ich den perfekten Blick auf ein brennendes Gebäude in der Ferne und die Strahler der Berliner Flak hatte, die weiter den Himmel nach feindlichen Flugzeugen absuchten. Schließlich durchdrang die Sirene die klare Nachtluft, und ich konnte auch die Schritte der Menschen hören, die schon wieder aus dem Bunker hochkamen und sich ansahen, was von ihren Häusern übrig geblieben war. Ich fragte mich, ob meine Wohnung in der Fasanenstraße noch stand. Nicht dass ich dort irgendwas Wertvolles aufbewahrte. Fast alles von Wert war inzwischen verkauft oder auf dem Schwarzmarkt eingetauscht worden.
Behutsam drehte ich den Kopf erst in die eine, dann in die andere Richtung, bis ich mich schließlich in der Lage sah, mich, auf einen Ellbogen gestützt, aufzurichten. Aber ich konnte kaum atmen; meine Lunge war immer noch voller Staub und Rauch, und die Anstrengung führte zu einem heftigen Hustenanfall, der erst nachließ, als ein Mann, den ich irgendwie zu kennen glaubte, mir einen Schluck Wasser gab und danach eine Decke über mich breitete.
Etwa eine Minute später hörte ich einen lauten Schrei, und der Kaminschlot kam direkt dort runter, wo ich vorhin noch gelegen hatte. Der Staub von dem Einsturz hüllte auch mich ein, weshalb ich weiter die Straße hinuntergetragen und neben anderen abgestellt wurde, die bereits auf medizinische Betreuung warteten. Klara lag jetzt neben mir, weniger als eine Armlänge entfernt. Ihr Kleid war kaum in Mitleidenschaft gezogen, die Augen standen offen, und ihr Körper war unversehrt. Ich rief mehrmals ihren Namen, ehe mir schließlich dämmerte, dass sie tot war. Es schien mir unglaubwürdig, dass so viel von ihrer Zukunft – sie konnte kaum älter als dreißig gewesen sein – innerhalb weniger Sekunden einfach verschwunden war.
Andere Leichen wurden neben ihr auf der Straße abgelegt. Ich konnte nicht erkennen, wie viele es waren. Schließlich setzte ich mich auf und schaute nach Franz Meyer und den anderen, aber die Anstrengung war zu viel für mich, ich ließ mich zurücksinken und schloss die Augen. Und verlor das Bewusstsein, nehme ich an.
«Gebt uns unsere Männer zurück.»
Man konnte sie schon drei Straßen weiter hören. Eine große, wütende Menge Frauen hatte sich versammelt, und als wir in die Rosenstraße einbogen, fiel mir die Kinnlade runter. Ich hatte seit Hitlers Machtergreifung nichts Vergleichbares auf den Straßen von Berlin erlebt. Und wer hätte gedacht, dass das Tragen eines hübschen Huts und einer Handtasche die beste Methode war, um sich für den gewaltlosen Widerstand gegen die Nazis zu rüsten?
«Lasst unsere Männer frei!», rief der Mob aus Frauen, während wir uns durch die Menge drängten. «Lasst unsere Männer jetzt frei!»
Es waren viel mehr Frauen, als ich erwartet hätte – vielleicht einige hundert. Sogar Klara Meyer wirkte überrascht, allerdings nicht so sehr wie die Polizisten und die SS, die das Haus der jüdischen Gemeinde bewachten. Sie umklammerten nervös ihre Maschinenpistolen und Gewehre und flüsterten den Frauen, die ihnen am nächsten standen, Flüche und Beleidigungen zu. Trotzdem sahen sie geradezu ängstlich aus, wohl weil sie ignoriert wurden oder ihnen die Beleidigungen mit gleicher Münze heimgezahlt wurden. Das entsprach nicht der Ordnung der Dinge. Wer eine Waffe hat, kann darauf bauen, dass die Leute tun, was er von ihnen will. Das ist Regel Nummer eins, wenn man Nazi ist.
Das Gebäude der jüdischen Gemeinde in der Rosenstraße, in der Nähe vom Alexanderplatz, war ein grauer Granitbau im wilhelminischen Stil und stand direkt neben einer Synagoge – die einst zu den ältesten in Berlin gehört hatte und im November 1938 von den Nazis zerstört worden war. Quasi in Spuckdistanz befand sich das Polizeipräsidium, wo ich einen Großteil meiner Zeit als Erwerbstätiger zugebracht hatte. Ich mochte vielleicht nicht mehr für die Kripo arbeiten, aber ich hatte es geschafft, nach meiner Entlassung die Marke zu behalten, jenes messingfarbene Abzeichen also, das den meisten deutschen Bürgern so viel Respekt einflößte.
«Wir sind anständige deutsche Frauen!», rief eine Frau. «Dem Führer und dem Vaterland treu ergeben. So dürfen Sie mit uns nicht reden, Sie kleiner, frecher Mistkerl!»
«Ich kann mit jeder so sprechen, die so fehlgeleitet ist, einen Juden zu heiraten», hörte ich einen der uniformierten Polizisten – einen Unteroffizier – sagen. «Gehen Sie heim, meine Damen. Sonst wird auf Sie geschossen.»
«Ihnen gehört aber mal gehörig der Hintern versohlt, Sie Würstchen», sagte eine andere Frau. «Weiß Ihre Mutter eigentlich, dass aus Ihnen so ein arroganter Welpe geworden ist?»
«Sehen Sie?», fragte Klara triumphierend. «Die können unmöglich uns alle erschießen.»
«Können wir nicht?», schnarrte der Unteroffizier. «Wenn wir den Befehl zum Schießen bekommen, kann ich Ihnen versprechen, dass Sie zuerst dran sind, Oma.»
«Bleiben Sie ganz ruhig, Unteroffizier», sagte ich, zückte meine Polizeimarke und hielt sie ihm vors Gesicht. «Es gibt wirklich keinen Grund, zu diesen Damen so grob zu sein. Schon gar nicht an einem Sonntagnachmittag.»
«Ja, Herr Kommissar», sagte er eifrig. «Entschuldigen Sie vielmals.» Er nickte über die Schulter zum Gebäude. «Gehen Sie da rein?»
«Ja», sagte ich und wandte mich an Klara und Siv. «Ich versuche, die Sache schnellstmöglich zu erledigen.»
«Wenn Sie dann so freundlich wären, drin nachzufragen», sagte der Unteroffizier. «Wir brauchen Befehle. Uns hat keiner gesagt, was wir tun sollen, außer, die Leute aus dem Gebäude heraushalten. Vielleicht schildern Sie die Situation mal bei denen da drinnen.»
Ich zuckte mit den Schultern. «Klar, Unteroffizier. Aber nach dem, was ich hier so sehe, machen Sie Ihre Sache großartig.»
«Ach, echt?»
«Sie wahren den Frieden, oder nicht?»
«Ja.»
«Den können Sie wohl kaum wahren, wenn Sie anfangen, auf diese Frauen zu schießen, stimmt’s?» Ich lächelte ihn an und klopfte aufmunternd auf seine Schulter. «Meiner Erfahrung nach sieht die beste Polizeiarbeit nach nichts aus und ist schnell vergessen.»
Ich war auf den Anblick, der mich im Innern erwartete, nicht vorbereitet. Der Gestank war unerträglich: Ein Gemeindehaus ist nun einmal nicht darauf eingerichtet, als Durchgangslager für zweitausend Gefangene herzuhalten. Männer und Frauen mit Erkennungsmarken an einer Schnur um den Hals wie bei der Kinderlandverschickung standen vor einem Waschraum Schlange, der keine Tür hatte. Andere waren zu fünfzigst oder sechzigst in einem Büro eingepfercht und mussten alle stehen. Wohlfahrtspakete – viele vermutlich von den Frauen vor der Tür hergebracht – türmten sich in einem anderen Raum. Es ging recht ruhig zu. Nach beinahe einem Jahrzehnt Naziherrschaft waren die Juden klug genug, sich nicht zu beklagen. Nur der Polizeiwachtmeister, der für diese Leute verantwortlich war, schien sein Schicksal beklagen zu wollen, während er auf seinem Klemmbrett Liste um Liste nach Franz Meyers Namen absuchte, ehe er mich zu einem Büro im ersten Stock führte. Unterwegs entrollte er den spitzen Stacheldraht seines Leids.
«Ich weiß nicht, was ich mit den ganzen Leuten machen soll. Niemand hat mir auch nur ein Wort gesagt. Wie lange sie hier sein werden. Wie ich es ihnen bequem machen soll. Wie ich auf die verdammten Weiber reagieren soll, die nach Antworten verlangen. Das ist gar nicht so leicht, das sag ich Ihnen. Alles, was ich habe, ist das Zeug, das schon hier war, als wir gestern einrückten. Das Toilettenpapier war schon nach einer Stunde alle. Und der Himmel allein weiß, wie ich die Leute ernähren soll. Am Sonntag hat doch kein Geschäft auf.»
«Warum machen Sie nicht die Futterpakete auf und geben den Leuten das?», fragte ich.
Der Wachtmeister sah mich ungläubig an. «Das kann ich nicht machen», sagte er. «Die Pakete sind doch privates Eigentum.»
«Ich glaube, die Leute, denen die Pakete gehören, werden nichts dagegen haben», sagte ich. «Solange sie nur was zu beißen kriegen.»
Wir fanden Franz Meyer in einem der größeren Büros, wo er mit fast hundert anderen Männern eingepfercht war. Der Wachtmeister rief Meyers Namen auf und verzog sich dann, immer noch grummelnd, um über das nachzudenken, was ich ihm bezüglich der Pakete vorgeschlagen hatte. Ich sprach derweil im vergleichsweise ruhigen Flur mit meinem potenziellen Kronzeugen. Ich erklärte ihm, dass ich für die Wehrmacht-Untersuchungsstelle arbeitete und warum ich gekommen war. In der Zwischenzeit schien der Protest der Frauen vor dem Gebäude noch an Lautstärke zuzunehmen.
«Ihre Frau und Ihre Schwägerinnen sind draußen», berichtete ich. «Sie haben mich erst darauf gebracht, Sie rauszuholen.»
«Bitte richten Sie ihnen aus, sie sollen heimgehen», sagte Meyer. «Hier drin ist es sicherer als da draußen, vermute ich.»
«Ich stimme Ihnen zu. Aber sie werden wohl kaum auf mich hören.»
Meyer grinste. «Ja, das kann ich mir vorstellen.»
«Je eher Sie mir erzählen, was auf der SS Hrosvitha von Gandersheim passiert ist, umso schneller kann ich mit meinem Chef sprechen und dafür sorgen, dass Sie hier rauskommen.» Ich zögerte. «Jedenfalls, wenn Sie bereit sind, eine Aussage zu machen.»
«Das ist vermutlich meine einzige Chance, einem Konzentrationslager zu entkommen, richtig?»
«Oder Schlimmerem», fügte ich hinzu, weil es offenbar eines etwas größeren Anreizes bedurfte.
«Also, das nenne ich mal ehrlich.» Er zuckte mit den Schultern.
«Das verstehe ich dann mal als ein Ja?»
Er nickte, und die folgenden dreißig Minuten verbrachten wir damit, seine Aussage bezüglich dessen aufzunehmen, was genau sich vor der Küste Norwegens im August 1941 zugetragen hatte. Nachdem er unterschrieben hatte, drohte ich ihm mit dem Finger.
«Indem ich hierhergekommen bin, habe ich für Sie meinen Hals riskiert», erklärte ich ihm. «Sie lassen mich lieber nicht hängen. Wenn ich mitkriege, dass Sie Ihre Geschichte anders erzählen, bin ich weg. Verstanden?»
Er nickte. «Und wieso riskieren Sie eigentlich Ihren Hals für mich?»
Das war eine gute Frage, auf die er vermutlich eine gute Antwort verdient hatte. Aber ich wollte lieber nicht erzählen, dass der Freund eines Freundes mich um Hilfe gebeten hatte, wie es ja oft zu jener Zeit in Deutschland passierte. Und ich wollte erst recht nicht erwähnen, wie attraktiv ich seine Schwägerin Klara fand oder dass ich was wiedergutzumachen hatte, weil ich den Juden bisher nicht gerade eine Hilfe gewesen war.
«Sagen wir einfach, ich mag die Tommies nicht besonders. Wollen wir es dabei belassen? Außerdem kann ich Ihnen nichts versprechen. Es kommt ganz auf meinen Chef Richter Goldsche an. Wenn er glaubt, Ihre Aussage kann bei den Ermittlungen bezüglich eines britischen Kriegsverbrechens hilfreich sein, kann er und nur er das Außenministerium davon überzeugen, dass es ein Weißbuch wert ist. Ich kann das nicht.»
«Was ist ein Weißbuch?»
«Eine offizielle Veröffentlichung der deutschen Seite zur Beleuchtung eines Vorfalls, der eine Verletzung internationalen Kriegsrechts darstellen könnte. Die Untersuchungsstelle bereitet alles auf, aber es ist das Außenministerium, das den Bericht dann veröffentlicht.»
«Das klingt, als könnte es eine Weile dauern.»
Ich schüttelte den Kopf. «Sie haben Glück, denn die Behörde und der Richter haben viel Macht, selbst in Nazideutschland. Wenn der Richter mir die Geschichte abkauft, haben wir Sie schon morgen wieder zu Hause.»
Kapitel 2
Mittwoch, 3. März 1943
Sie brachten mich in das Staatskrankenhaus im Friedrichshain. Ich litt unter einer Gehirnerschütterung und einer Rauchvergiftung; das mit der Rauchvergiftung war ja nichts Neues, aber wegen der Gehirnerschütterung riet mir der behandelnde Arzt, ein paar Tage dazubleiben. Ich habe Krankenhäuser schon immer verabscheut. Für meinen Geschmack bieten sie einfach zu viel Realitätsnähe. Aber ich war wirklich müde. Wenn man von der RAF bombardiert wird, kann das schon mal passieren. Darum kam mir der Ratschlag dieses Milchbubis von einem Aspirinjünger sehr gelegen. Ich fand nämlich, ich hatte es verdient, mal eine Weile die Füße hochzulegen und meinen Mund zu halten. Außerdem war ich im Krankenhaus sehr viel besser dran als in meiner Wohnung. Im Staatskrankenhaus bekamen die Patienten immer noch was zu essen, was ich von meinem Zuhause nicht gerade behaupten konnte.
Von meinem Fenster aus hatte ich einen hübschen Blick rüber zum Georgen-Friedhof, aber das störte mich nicht. Das Böhmische Brauhaus lag auf der anderen Seite der Landsberger Allee, weshalb immer ein intensiver Hopfengeruch in der Luft hing. Ich kann mir kaum etwas Besseres vorstellen, um die Erholung eines Berliners zu beschleunigen, als den Geruch nach deutschem Bier. Nicht dass wir davon in den Bars der Stadt besonders viel zu sehen bekamen. Das meiste in Berlin gebraute Bier ging direkt zu unseren tapferen Kameraden an der russischen Front. Aber ich konnte nicht behaupten, dass ich ihnen ein paar Krüge Bier nicht gönnen würde. Nach Stalingrad war anzunehmen, dass sie den Geschmack von zu Hause brauchten, um weiter bei Laune zu bleiben. Es gab im Winter 1943 nicht vieles, womit man einen Soldaten aufbauen konnte.
Jedenfalls hatte ich es sehr viel besser als Siv Meyer und ihre Schwestern, die alle tot waren. Die einzigen Überlebenden waren Franz Meyer und ich, und ihn hatten sie ins Jüdische Krankenhaus gebracht. Wohin sonst? Die größere Überraschung war, dass es überhaupt noch ein Jüdisches Krankenhaus gab.
Ich blieb nicht ohne Besucher. Renata Matter kam, um nach mir zu sehen. Sie war es auch, die mir erzählte, meine Wohnung sei unversehrt. Außerdem erzählte sie mir das von den Meyerschwestern. Darüber war sie auch sehr betrübt, und als gute Katholikin hatte sie bereits den Morgen damit verbracht, für ihre Seelen zu beten. Die Neuigkeit hatte sie so sehr erschüttert wie damals jene, dass der Priester von St. Hedwig, ein gewisser Bernhard Lichtenberg, ins Gefängnis gesteckt worden war und dann nach Dachau geschickt wurde, wo bereits – wie sie sagte – zweitausend Priester interniert waren. Zweitausend Priester in Dachau war ein ziemlich deprimierender Gedanke. Das ist das Problem mit Besuchern am Krankenbett. Manchmal wünscht man sich einfach, sie hätten sich nicht die Mühe gemacht, vorbeizukommen, um einen aufzumuntern.
So ging es mir auf jeden Fall mit meinem anderen Besucher, einem Kommissar von der Gestapo namens Werner Sachse. Ich kannte Sachse von meiner Zeit am Alex, und er war für einen Gestapo-Offizier in Wahrheit kein so übler Kerl. Aber ich wusste, dass er nicht hergekommen war, um mir einen Stollen zu schenken und mich zu ermutigen. Er trug die Haare so sorgfältig zurückgekämmt, dass sie wie die Linien im Notizbuch eines Zimmermanns aussahen, und dazu einen schwarzen Ledermantel, der bei jeder Bewegung wie Schnee unter den Stiefeln knirschte. Außerdem eine schwarze Mütze und eine schwarze Krawatte. Ich fühlte mich sofort unwohl.
«Ich möchte gern die Messingbeschläge und ein Satinfutter», sagte ich. «Und ein offener Sarg wäre auch in Ordnung.»
Sachse sah mich sichtlich verwirrt an.
«Dann muss ich wohl annehmen, dass Ihre Lohnstufe keinen schwarzen Humor ermöglicht. Nur schwarze Krawatten und Mäntel.»
«Sie wären überrascht.» Er zuckte mit den Schultern. «Wir haben bei uns in der Gestapo auch unsere Witze.»
«Klar haben Sie die. Allerdings werden sie vor dem Volksgerichtshof in Moabit als Beweise gehandelt.»
«Ich mag Sie, Gunther, darum sage ich Ihnen auch, dass Sie solche Witze lieber unterlassen. Vor allem nach Stalingrad. Heutzutage nennt man das Unterwanderung, und das kann Sie den Kopf kosten. Letztes Jahr haben sie für solche Witze drei Leute pro Tag hingerichtet.»
«Haben Sie denn nicht davon gehört? Ich bin krank. Ich hatte eine Gehirnerschütterung und kann kaum atmen. Wenn sie mir den Kopf abschneiden, werde ich es vermutlich gar nicht bemerken. Das ist meine Verteidigungsstrategie, falls es zum Prozess kommt. Auf welcher Gehaltsstufe sind Sie im Moment, Werner?»
«A3. Warum fragen Sie?»
«Ich habe mich nur gefragt, warum ein Mann, der pro Woche sechshundert Mark verdient, den ganzen weiten Weg hierher kommt, um mich zu warnen, ich solle nicht die Moral der Truppe unterwandern. Gesetzt den Fall, dass so was nach Stalingrad überhaupt noch existiert.»
«Das war nur eine freundliche Warnung. Im Vorbeigehen quasi. Aber deshalb bin ich nicht hier, Gunther.»
«Sie werden doch kaum hier sein, um ein Kriegsverbrechen zu gestehen, Werner. Jetzt noch nicht.»
«Das würde Ihnen gefallen, was?»
«Ich frage mich, wie weit wir damit kommen würden, ehe sie uns beiden den Kopf abschneiden.»
«Erzählen Sie mir von Franz Meyer.»
«Der ist auch krank.»
«Ja, das weiß ich. Ich komme gerade aus dem Jüdischen Krankenhaus.»
«Wie geht es ihm?»
Sachse schüttelte den Kopf. «Es geht ihm wirklich gut. Er liegt im Koma.»
«Sehen Sie? Hatte ich doch recht. Ihr Dienstgrad ermöglicht keinen Humor. Man muss heute ja mindestens Kriminalrat sein, ehe sie einem erlauben, wirklich lustige Witze zu reißen.»
«Die Meyers standen unter Beobachtung, haben Sie das gewusst?»
«Nein. Ich habe nichts bemerkt. Jedenfalls nicht, wenn Klara dabei war. Sie war eine wahre Schönheit.»
«Ja, das mit ihr ist wirklich eine Schande, da bin ich Ihrer Meinung.» Er zögerte. «Sie waren zweimal in der Wohnung der Meyers. An dem Sonntag und später nochmal am Montagabend.»
«Das ist korrekt. Hey, ich darf wohl nicht davon ausgehen, dass die V-Leute, die die Meyers beobachtet haben, auch umgekommen sind?»
«Nein, sie sind noch am Leben.»
«Zu schade.»
«Aber wer sagt Ihnen, dass es V-Leute waren? Es war keine verdeckte Operation. Ich gehe mal davon aus, dass die Meyers wussten, dass wir sie beobachtet haben. Auch wenn Sie zu blöd waren, es zu bemerken.»
Er zündete zwei Zigaretten an und steckte mir eine in den Mund.
«Danke, Werner.»
«Vielleicht sollte ich Ihnen verraten, dass ich es war, der mit ein paar anderen Jungs von der Gestapo Sie großen, hässlichen und dummen Bastard von dem Schutthaufen gezogen hat, bevor der Kamin runterdonnerte. Es war die Gestapo, die Ihr Leben gerettet hat, Gunther. Sie sehen also, dass wir wirklich Sinn für Humor haben. Das Vernünftigste wäre nämlich gewesen, Sie einfach dort liegen zu lassen.»
«Ehrlich?»
«Ehrlich.»
«Danke. Ich schulde Ihnen was.»
«Das habe ich mir auch gedacht. Darum bin ich hier und will über Franz Meyer reden.»
«Also gut. Machen Sie Ihren Scheinwerfer an, richten Sie ihn direkt auf mich.»
«Ich will nur ein paar ehrliche Antworten. Wenigstens das schulden Sie mir.»
Ich nahm einen kurzen Zug von der Zigarette und nickte. «Ein richtiger Sargnagel, diese Zigarette.»
«Was hatten Sie in der Lützowstraße zu suchen? Und sagen Sie nicht, Sie waren dort nur zu Besuch.»
«Als Franz Meyer von der Gestapo abgeholt wurde, hat seine Frau drauf gesetzt, dass die Wehrmacht-Untersuchungsstelle für ihn die Kohlen aus dem Feuer holt. Er war der einzige überlebende Zeuge eines Kriegsverbrechens, das von einem U-Boot der Tommies verübt wurde. Die haben nämlich 1941 eins von unseren Lazarettschiffen an der Küste Norwegens bombardiert. Die SSHrosvitha von Gandersheim. Ich habe seine Aussage aufgenommen und dann meinen Chef überzeugt, den Befehl für seine Freilassung zu unterzeichnen.»
«Und was sprang dabei für Sie heraus?»
«Das ist mein Job, Werner. Man stößt mich auf ein mögliches Verbrechen, und ich versuche, der Sache auf den Grund zu gehen. Sehen Sie, ich will gar nicht leugnen, dass die Meyers mir sehr dankbar waren. Sie luden mich zum Abendessen ein und spendierten ihre letzte Flasche Spätburgunder, um Meyers Freilassung aus dem jüdischen Gemeindehaus in der Rosenstraße zu feiern. Wir hoben gerade die Gläser, als die Bombe einschlug. Aber ich kann auch nicht leugnen, dass es mir persönlich Vergnügen bereitet hat, den Tommies eins auszuwischen. Scheinheilige Scheißkerle. Laut deren Aussage war die Hrosvitha von Gandersheim nur ein Truppentransport und gar kein Lazarettschiff. Zwölfhundert Männer sind ertrunken. Soldaten, kann schon sein, aber sie waren alle verletzt und auf dem Weg zurück nach Deutschland. Seine Aussage liegt bei meinem Chef Richter Goldsche auf dem Schreibtisch. Sie können sie gerne lesen und überprüfen, ob ich die Wahrheit sage.»
«Ja, das habe ich bereits getan. Aber warum sind Sie nicht in den Luftschutzbunker gegangen wie die anderen?»
«Meyer ist Jude. Er darf nicht in den Bunker.»
«Schon klar, aber was war mit den anderen? Die Frau, ihre Schwestern – von denen war keine jüdisch. Sie müssen zugeben, das ist ein bisschen verdächtig.»
«Wir haben erst nicht geglaubt, dass der Fliegeralarm echt war. Darum haben wir beschlossen, oben zu bleiben.»
«Verständlich.» Sachse seufzte. «Den Fehler wird wohl keiner von uns ein zweites Mal machen. Berlin ist eine einzige Ruine. St. Hedwig ist ausgebrannt. Der Prager Platz wurde vollständig zerstört. Die britische Luftwaffe hat mehr als eintausend Tonnen Bomben abgeworfen. Und zwar auf zivile Ziele. Also das nenne ich mal ein verdammtes Kriegsverbrechen. Wenn Sie schon dabei sind, könnten Sie das auch gleich ermitteln, ja?»
Ich nickte. «Ja.»
«Haben die Meyers irgendwas über Fremdwährungen erzählt? Schweizer Franken zum Beispiel?»
«Sie meinen, für mich?» Ich schüttelte den Kopf. «Nein, mir wurde nicht mal ein lausiges Päckchen Zigaretten angeboten.» Ich runzelte die Stirn. «Wollen Sie damit andeuten, diese Mistkerle hatten Geld?»
Sachse nickte.
«Also, mir haben sie davon nichts angeboten.»
«Fiel in irgendeinem Zusammenhang der Name Wilhelm Schmidhuber?»
«Nein.»
«Friedrich Arnold? Julius Fliess?»
Ich schüttelte den Kopf.
«Das Unternehmen Sieben vielleicht?»
«Nie davon gehört.»
«Dietrich Bonhoeffer?»
«Der Pastor?»
Sachse nickte.
«Nein, an seinen Namen hätte ich mich bestimmt erinnert. Worum geht’s bei der Sache, Werner?»
Sachse zog an seiner Zigarette, schaute verstohlen zu dem Mann im Nebenbett und zog seinen Stuhl näher heran. So nah, dass ich sein Klar-Klassik-Rasierwasser riechen konnte. Selbst an einem Gestapomann war dieser Duft eine angenehme Abwechslung zu den muffigen Verbänden, der Pisse auf den Fensterscheiben und vergessenen Bettpfannen.
«Unternehmen Sieben war der Plan, mit dem sieben Juden die Flucht aus Deutschland in die Schweiz gelingen sollte.»
«Sieben wichtigen Juden?»
«Nein, gar nicht mal. Alle wichtigen Juden haben Deutschland längst verlassen oder sind … nun, sie sind weg. Nein, das hier waren sieben ganz normale Juden.»
«Ich verstehe.»
«Natürlich sind die Schweizer mindestens genauso antisemitisch wie wir und rühren keinen Finger, solange sie kein Geld kriegen. Wir glauben, die Verschwörer wurden verpflichtet, eine große Summe Geld aufzubringen, damit diese Juden sich selbst versorgen können und nicht dem Schweizer Staat auf der Tasche liegen. Das Geld wurde in die Schweiz geschmuggelt. Unternehmen Sieben war jedoch ursprünglich Unternehmen Acht, und damals gehörte Franz Meyer dazu. Wir hatten ihn unter Beobachtung, weil wir hofften, dass er uns zu den Mitverschwörern führen könnte.»
«Wirklich zu schade.»
Werner Sachse nickte. «Ich glaube Ihnen Ihre Geschichte», sagte er.
«Danke, Werner, das weiß ich zu schätzen. Ich gehe trotzdem davon aus, dass Sie meine Taschen nach Schweizer Franken durchsucht haben, als ich da auf der Straße lag.»
«Selbstverständlich. Als Sie auftauchten, habe ich echt gedacht, wir wären auf eine heiße Spur gestoßen. Stellen Sie sich meine Enttäuschung vor, als ich feststellen musste, dass Sie eine reine Weste haben.»
«Das sage ich ja immer wieder, Werner. Es gibt nichts Enttäuschenderes als die Erkenntnis, dass unsere Freunde und Nachbarn nicht unehrlicher sind als wir selbst.»
Kapitel 3
Freitag, 5. März 1943
Ein paar Tage später gab der Arzt mir noch etwas mehr Aspirin, riet mir, ich solle viel an die frische Luft gehen, damit meine Atemwege sich weiter erholten, und schickte mich nach Hause. Berlin war ja für seine Luft weithin berühmt, aber so frisch war sie nun auch wieder nicht. Jedenfalls nicht, seit die Nazis an der Macht waren.
Zufällig war dies auch der Tag, an dem die Behörden den noch immer im jüdischen Gemeindehaus ausharrenden Juden mitteilten, sie dürften jetzt nach Hause. Ich konnte das im ersten Moment nicht glauben, und ich konnte mir vorstellen, dass es den Männern und Frauen, die wieder auf freien Fuß kamen, noch viel unglaublicher vorkam. Die Behörden gingen sogar so weit, einige der Juden, die bereits deportiert worden waren, ausfindig zu machen und nach Berlin zurückzuschicken, wo sie wie die anderen freigelassen wurden.
Was war hier eigentlich los? Was ging in den Köpfen der Regierungsmitglieder vor? War es etwa möglich, dass die Nazis nach der verheerenden Niederlage von Stalingrad die Sache nicht mehr im Griff hatten? Oder hatten sie wirklich auf den Protest von tausend fest entschlossenen deutschen Frauen gehört? Das schien der einzig logische Schluss zu sein. Zehntausend Juden waren am 27. Februar festgenommen worden, und von diesen waren weniger als zweitausend in die Rosenstraße gebracht worden. Einige waren ins Konzerthaus Clou in die Mauerstraße überstellt worden, andere in die Ställe einer Kaserne in der Rathenower Straße. Die meisten hatte man in die Synagoge in der Levetzowstraße in Moabit gebracht. Aber nur in der Rosenstraße, wo man die Juden sammelte, die mit Deutschen verheiratet waren, war es zu Protesten gekommen, und nur dort wurden die Juden freigelassen. Soweit ich später gehört habe, wurden alle Juden aus den anderen Sammelstellen in den Osten deportiert. Aber wenn der Protest wirklich eine Wirkung zeigte, warf das eine wichtige Frage auf: Was wäre passiert, wenn es schon vorher zu Massenprotesten gekommen wäre? Offenbar hatte die erste organisierte Opposition gegen die Nazis in den ganzen zehn Jahren tatsächlich auch zum Erfolg geführt.
Das war die eine Ernüchterung. Die andere war, dass Franz Meyer bestimmt in dem jüdischen Gemeindehaus in der Rosenstraße geblieben wäre, wenn ich nicht eingegriffen hätte, und seine Frau und deren Schwestern wären mit den anderen Frauen vor der Tür geblieben. In dem Fall hätten alle den Bombenangriff überlebt. Vielleicht hätten sie kein Dach mehr über dem Kopf gehabt, aber ja, sie hätten überlebt, das war ziemlich gut vorstellbar. So viel Aspirin kann man gar nicht schlucken, um diese Art von Zahnschmerzen zu besänftigen.
Ich verließ das Krankenhaus, aber ich ging nicht nach Hause. Jedenfalls nicht auf direktem Weg. Ich nahm die Ringbahn Richtung Nordwesten zum Gesundbrunnen. Um meine Arbeit wieder aufzunehmen.
Das Jüdische Krankenhaus im Wedding bestand aus sechs oder sieben modernen Gebäuden an der Ecke Schulstraße und Iranische Straße und lag direkt neben dem St.-Georg-Krankenhaus. So überraschend wie die Tatsache, dass es in Berlin überhaupt ein Jüdisches Krankenhaus gab, war die Entdeckung, dass es sich um eine moderne, relativ gutausgestattete Einrichtung handelte. Da Ärzte und Patienten Juden waren, wurde das Gelände außerdem von einer Abordnung der SS bewacht. Ich hatte mich kaum an der Pforte ausgewiesen, als ich auch schon feststellen durfte, dass auch die Gestapo hier eine kleine Filiale aufgemacht hatte. Einer der Offiziere der Gestapo fungierte gleichzeitig als Leiter des Krankenhauses: Dr. Walter Lustig.
Als ich auf Lustig traf, stellte sich heraus, dass wir uns schon mehrfach in der Vergangenheit begegnet waren. Er war ein strenger Schlesier – das sind immer die unangenehmsten Preußen – und hatte früher das Medizinaldezernat im Polizeipräsidium am Alex geleitet. Wir hatten uns nie gemocht. Ich mochte ihn nicht, weil ich mir nichts aus wichtigtuerischen Männern machte, die sich aufführten wie ranghohe preußische Offiziere, ohne deren Größe zu haben. Er glaubte wahrscheinlich, dass ich ihn nicht mochte, weil er Jude war. Aber in Wahrheit begriff ich erst jetzt, als ich ihm in dem Krankenhaus begegnete, dass er Jude war. Der gelbe Stern auf seinem weißen Arztkittel ließ daran keinen Zweifel. Er mochte mich nicht, weil er der Typ war, der so ziemlich niemanden mochte, der unter ihm stand und nach seinen hohen akademischen Standards ungebildet war. Am Alex hatten wir ihn immer Doktor Doktor genannt, weil er Universitätsabschlüsse sowohl in Medizin als auch in Philosophie hatte und nie vergaß, die anderen Leute subtil daran zu erinnern.
Jetzt schlug er die Hacken zusammen und verbeugte sich steif, als käme er geradewegs vom Paradeplatz an der preußischen Militärakademie.
«Herr Gunther», begrüßte er mich. «Nach so vielen Jahren treffen wir uns also wieder. Welchem Umstand verdanken wir dieses zweifelhafte Vergnügen?»
Es sah nicht danach aus, als hätte sein neuer, niedriger Status als Angehöriger einer ausgestoßenen Rasse irgendwas an seinem Verhalten geändert. Ich konnte fast die Wichse glänzen sehen, mit der er seinen Oberlippenbart zur Räson gebracht hatte. Seine Blasiertheit hatte ich nicht vergessen, aber offenbar hatte ich seinen Atem vergessen, der selbst einen Mann mit Atembeschwerden zwang, mindestens einen halben Meter Abstand zu halten.
«Schön, Sie zu sehen, Dr. Lustig. Hier haben Sie sich also versteckt. Ich habe mich schon gefragt, was aus Ihnen geworden ist.»
«Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Gedanke Sie nächtelang wachgehalten hat.»
«Nein. Nicht im Geringsten. Ich schlafe wie ein Baby. Trotzdem freue ich mich, Sie wohlauf anzutreffen.» Ich schaute mich um. Es gab ein paar hebräisch wirkende Einrichtungsdetails an den Wänden, von den kantigen, astronomischen Kunstwerken der Nazis jedoch, die sie gerne überall dort aufhängten, wo etwas den Juden gehörte oder von ihnen benutzt wurde, war nichts zu sehen. «Hübsch haben Sie es hier, Doktor.»
Lustig verneigte sich erneut, und dann schaute er demonstrativ auf seine Taschenuhr. «Jaja, aber Sie wissen schon, tempis fugit …»
«Sie haben einen Patienten, Franz Meyer. Er wurde am Montagabend oder am Dienstag in den frühen Morgenstunden hergebracht. Er ist der Kronzeuge für einen Fall, in dem ich im Auftrag der Wehrmacht ermittle. Ich würde ihn gern sehen, wenn das geht.»
«Sie sind nicht mehr bei der Polizei?»
«Nein.» Ich reichte ihm meine Visitenkarte.
«Dann haben wir offensichtlich etwas gemeinsam. Wer hätte sich das je vorstellen können?»
«Das Leben bietet den Lebenden so manche Überraschung.»
«Das trifft insbesondere auf diesen Ort zu, Herr Gunther. Die Adresse?»
«Meine oder die von Herrn Meyer?»
«Die von Herrn Meyer selbstverständlich.»
«Lützowstraße 10, Charlottenburg.»
Barsch wiederholte Lustig den Namen und die Adresse vor der attraktiven Krankenschwester, die neben uns aufgetaucht war. Sofort und ohne dass man sie explizit darauf hinweisen musste, eilte sie in das Büro hinter dem Empfang und suchte in einem großen Aktenschrank nach der Patientenakte.
Er schnipste bereits mit seinen fetten Fingern in ihre Richtung. «Komm schon, komm schon, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit.»
«Wie ich sehe, sind Sie so beschäftigt wie immer, Herr Doktor», sagte ich. Die Schwester kam zurückgeeilt und gab ihm eine Akte.
«Das ist zumindest eine Art Zuflucht», murmelte er und überflog die Notizen. «Ja, jetzt erinnere ich mich an ihn. Armer Kerl. Sein halber Kopf ist weg. Wie er immer noch am Leben sein kann, übersteigt mein medizinisches Fachwissen. Er liegt im Koma, seit sie ihn hergebracht haben. Möchten Sie ihn gerne sehen? Vielleicht ist Zeitverschwendung ja eine institutionelle Angewohnheit bei der Untersuchungsstelle für Verletzungen des Völkerrechts? Das wäre dann nicht anders als damals bei der Kripo.»
«Wissen Sie, ich würde ihn wirklich gerne sehen. Und sei es nur, um zu überprüfen, ob er auch so viel Angst vor Ihnen hat wie sie, Doc.» Ich lächelte seine Krankenschwester an. Meiner Erfahrung nach sind Schwestern – besonders die hübschen – immer ein Lächeln wert.
«Also gut.» Lustig ließ ein Aufstöhnen hören und schritt entschlossen den Flur entlang. «Kommen Sie mit, Herr Gunther», rief er mir über die Schulter zu. «Setzen Sie sich in Bewegung. Wir müssen uns beeilen, wenn wir Herrn Meyer noch so antreffen wollen, dass es ihm möglich ist, den alles entscheidenden Hinweis zu geben, der Ihnen bei den Ermittlungen weiterhilft. Offensichtlich hat mein eigenes Wort in dieser Zeit nur sehr wenig Gewicht.»
Wenige Sekunden später standen wir vor einem Mann mit einer dicken Narbe unter seinem missmutig verzogenen Mund, die wie eine dritte Lippe aussah.
«Und das ist der Grund, warum das so ist», fügte der Arzt hinzu. «Kriminalkommissar Dobberke. Dobberke ist Chef des Gestapobüros hier im Krankenhaus. Ein sehr wichtiger Posten, mit dem man für unsere Sicherheit sorgt und dafür, dass wir der gewählten Regierung treu ergeben bleiben.» Lustig übergab dem Gestapomann meine Visitenkarte. «Das hier ist Herr Gunther. Hat früher am Alex gearbeitet und ist jetzt bei der Wehrmacht-Untersuchungsstelle. Er wünscht, sich selbst davon zu überzeugen, ob einer unserer Patienten in der Lage ist, eine Aussage zu machen, die eine Kehrtwende für die militärische Rechtsprechung bedeuten könnte.»
Wir gingen auf eine Station, wo sich Männer in verschiedenen Stadien der Gesundung aufhielten. Es schien kaum notwendig zu sein, aber alle Patienten trugen einen gelben Stern auf ihren Pyjamas und Bademänteln. Sie sahen unterernährt aus, aber im Berlin dieser Zeit war das nicht ungewöhnlich. Es gab in dieser Stadt wohl kaum jemanden – egal ob Jude oder Deutscher –, der nicht eine anständige Mahlzeit hätte vertragen können. Manche von ihnen rauchten, manche redeten, und einige spielten Schach. Keiner schenkte uns besonders viel Aufmerksamkeit.
Meyer lag hinter einem Wandschirm im letzten Bett, unter einem großen Fenster, von dem aus man auf einen gepflegten Rasen und einen rund eingefassten Teich blickte. Nicht dass er in der Lage zu sein schien, diesen Anblick zu genießen. Er hatte die Augen geschlossen, und sein nicht mehr ganz runder Kopf war bandagiert. Der Schädel erinnerte mich an einen platten Fußball. Aber selbst mit dieser üblen Verletzung sah er erstaunlich gut aus. Wie ein angeknackster Jüngling am Pergamonaltar.
Lustig überprüfte die Reflexe, fühlte den Puls des bewusstlosen Patienten und nahm die Temperatur. Dabei behielt er die Schwester ständig im Auge und schaute nur flüchtig auf das Krankenblatt, ehe er laut «ts, ts» machte und dabei den Kopf schüttelte. Es war die Art Verhalten eines Arztes, die sogar einem Viktor Frankenstein peinlich gewesen wäre.
«Das habe ich mir schon gedacht», sagte er. «Der ist nur noch Gemüse. Das ist jedenfalls meine Prognose.» Er strahlte. «Aber machen Sie ruhig weiter, Herr Gunther. Tun Sie sich keinen Zwang an. Sie können den Patienten so lange befragen, wie Sie möchten. Erwarten Sie nur keine Antworten von ihm.» Er lachte. «Besonders nicht, solange Kommissar Dobberke an Ihrer Seite lauert.»
Und dann war er verschwunden und ließ mich mit Dobberke allein.
«Das war ein rührendes Wiedersehen.» Ich fügte erklärend hinzu: «Früher waren er und ich im Polizeipräsidium Kollegen.» Ich schüttelte den Kopf. «Ich kann nicht behaupten, dass die Zeit oder die Umstände ihn irgendwie milde gestimmt haben.»
«Er ist kein so übler Kerl», meinte Dobberke großzügig. «Für einen Juden, meine ich. Das macht der Ort mit ihm.»
Ich setzte mich zu Franz Meyer auf die Bettkante und seufzte. «Ich glaube auch nicht, dass dieser Kerl hier in naher Zukunft mit irgendwem reden wird. Außer mit dem heiligen Petrus», sagte ich. «Seit 1918 habe ich keinen Mann mehr mit so einer Kopfverletzung gesehen. Es sieht aus, als hätte jemand auf eine Kokosnuss eingehämmert.»
«Sie haben da am Kopf auch eine ordentliche Beule», sagte Dobberke.
Ich berührte verlegen meinen Kopf. «Mir geht’s gut.» Ich zuckte mit den Schultern. «Warum wird es überhaupt betrieben? Das Krankenhaus, meine ich.»
«Das ist das Auffangbecken für Sonderlinge», sagte er. «Ein Sammellager. Sehen Sie, die Juden hier sind ein merkwürdiger Haufen. Waisen mit unklarer Herkunft, einige Kollaborateure, ein paar Juden sind die Schoßhündchen von irgendeinem Bonzen und stehen unter dessen Schutz, einige haben versucht, Selbstmord zu begehen …»
Dobberke bemerkte die Überraschung, die sich auf meinem Gesicht abzeichnete, und zuckte mit den Schultern.
«Ja, genau, Selbstmörder», sagte er. «Man kann ja wohl jemanden, der halbtot ist, kaum in einen Zug zur Deportation treiben, oder? Das macht mehr Probleme, als es nutzt. Darum schicken sie die Jids her, wir päppeln sie auf, und dann, sobald es ihnen wieder gutgeht, steckt man sie in den nächsten Zug Richtung Osten. Das wird auch mit dem armen Kerl hier passieren, falls er noch mal die Kurve kriegt.»
«Dann ist niemand hier richtig krank?»
«Himmel, nein.» Er zündete sich eine Zigarette an. «Ich erwarte ohnehin, dass sie die Einrichtung bald schließen. Man erzählt sich, Kaltenbrunner habe schon ein Auge auf das Gebäude geworfen.»
«Das sollte doch zu schaffen sein. So ein hübscher Ort? Das werden ein paar schicke Büros.»
Nach dem Tod meines alten Chefs Reinhard Heydrich war Ernst Kaltenbrunner der neue Chef des Reichssicherheitshauptamts geworden, aber was er mit einem eigenen jüdischen Krankenhaus anfangen wollte, blieb mir ein Rätsel. Vielleicht seine eigene Trinkerheilanstalt, aber den Gedanken behielt ich mal lieber für mich. Werner Sachses Rat, aufzupassen, was ich sagte, war quasi mit dem roten Klebestreifen des Geheimdiensts versehen. Nach Stalingrad war jeder – vor allem aber ein Berliner wie ich, für den schwarzer Humor eine Berufung war – vermutlich besser beraten, wenn er die Lippen verschlossen hielt.
«Wird er es bekommen? Kaltenbrunner, meine ich?»
«Ich habe nicht die geringste Ahnung.»
Weil ich was anderes sehen wollte als Franz Meyers übel zugerichteten Kopf, trat ich ans Fenster. Erst da fiel mir der Blumenstrauß auf seinem Nachttisch auf.
«Das ist ja mal interessant», sagte ich und nahm die Karte, die neben der Vase lag. Keine Unterschrift.
«Was ist?»
«Die Narzissen hier», sagte ich. «Ich bin auch gerade aus dem Krankenhaus gekommen, und mir hat keiner Blumen geschickt. Und doch hat dieser Kerl frische Blumen. Noch dazu von Theodor Hübners Blumenladen in der Prinzenstraße.»
«Und?»
«In Kreuzberg.»
«Ich verstehe leider nicht …»
«Das war früher der Kaiserliche Hoflieferant. Ist es noch, soweit ich weiß. Was wiederum bedeutet, dass der Laden teuer ist. Sehr teuer.» Ich runzelte die Stirn. «Was ich aber vor allem sagen will, ist, dass nur wenige Leute frische Blumen vom Hübner bekommen. Egal ob hier oder anderswo.»
Dobberke zuckte nur mit den Schultern. «Seine Familie muss sie wohl geschickt haben. Die Juden haben immer noch mehr als genug Geld unter der Matratze, das weiß doch jeder. Ich war im Osten, in Riga. Sie hätten mal sehen sollen, was diese Mistkerle alles in der Unterwäsche mit sich rumschleppen. Gold, Silber, Diamanten. Alles Mögliche.»
Ich lächelte geduldig und vermied die Frage, wie genau es dazu gekommen war, dass Dobberke in der Unterwäsche irgendwelcher Leute nach Wertsachen gesucht hatte.
«Meyers Familie waren Deutsche», sagte ich. «Außerdem sind inzwischen alle tot. Sie wurden durch dieselbe Bombe getötet, die bei ihm einen neuen Scheitel gezogen hat. Nein, jemand anders muss die Blumen geschickt haben. Ein Deutscher. Jemand mit Geld und Geschmack. Jemand, der immer nur das Beste bekommt.»
«Nun, er verrät Ihnen jedenfalls nicht, woher er die Blumen hat», bemerkte Dobberke.
«Nein», stimmte ich zu. «Er sagt gar nichts, richtig? Da hat Dr. Lustig wohl recht.»
«Ich könnte der Sache auf den Grund gehen, wenn Sie das für wichtig halten. Vielleicht kann eine der Schwestern sagen, wer die Blumen geschickt hat.»
«Nein», sagte ich fest. «Vergessen Sie’s. Das ist so eine alte Angewohnheit von mir, von früher, als ich noch Ermittler war. Manche Leute sammeln Briefmarken, andere Postkarten und Autogramme. Ich sammle eben belanglose Fragen. Es versteht sich von selbst, dass die Antworten auf diese Fragen den wahren Wert ausmachen.»
Ich blickte ein letztes Mal nachdenklich zu Franz Meyer hinüber. Jetzt erst wurde mir bewusst, dass genauso gut ich jetzt mit einem halben Schädel in diesem Bett liegen könnte, und zum ersten Mal seit langer Zeit hatte ich das Gefühl, wirklich Glück gehabt zu haben. Ich weiß nicht, wie man das sonst nennen soll, wenn eine Bombe der britischen Luftwaffe vier umbringt, einen fünften zum Krüppel macht und man selbst kaum mehr als eine Beule am Kopf davonträgt. Und allein die Vorstellung, dass das Glück mir mal wieder hold gewesen war, ließ mich lächeln. Vielleicht hatte mein Leben gerade eine entscheidende Wendung genommen. Es war nicht nur dieser Umstand. Auch der erfolgreiche Protest der Frauen in der Rosenstraße und dass ich nicht Teil der 6. Armee in Stalingrad gewesen war, beflügelte mich.
«Was ist so lustig?», fragte Dobberke.
Ich schüttelte den Kopf. «Ich habe nur gerade gedacht, dass im Leben das Wichtigste ist – und deshalb sollte man all sein Tun darauf ausrichten –, am Leben zu bleiben.»
«Ist das eine Ihrer Antworten?», wollte Dobberke wissen.
Ich nickte. «Ich denke, das ist vielleicht sogar die wichtigste Antwort von allen. Finden Sie nicht auch?»
Kapitel 4
Montag, 8. März 1943