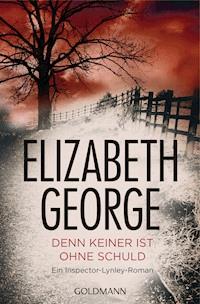11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Talent, Leidenschaft und Disziplin: Ohne diese drei Eigenschaften ist für Elizabeth George eine literarische Karriere nicht denkbar. In diesem faszinierenden Buch beweist die Bestsellerautorin, dass sie das Handwerk des Schreibens nicht nur selbst perfekt umsetzt. Sie kann ihr profundes Wissen auch so praxisorientiert, anschaulich und unterhaltsam vermitteln, dass man dieser großen Geschichtenerzählerin begeistert folgt. Als Beispiele dienen ihr dabei neben ihren eigenen Romanen und ihrem Werdegang als Autorin auch die Werke zahlreicher bedeutender Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Eine ebenso unterhaltsame wie inspirierende Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
»Ich finde es jedes Mal faszinierend und irritierend zugleich, jemandem zu begegnen, der der Ansicht ist, dass man Schreiben nicht lernen kann. Ehrlich gesagt, ich verstehe diese Auffassung nicht.
Ich glaube seit langem, dass der Schreibprozess aus zwei unterschiedlichen, aber gleich wichtigen Hälften besteht: Die eine hat etwas mit Kunst zu tun, die andere mit handwerklichem Können. Zweifellos kann man Kunst nicht lehren. Niemand kann einem anderen Menschen die Seele eines Künstlers verleihen, die Sensibilität eines Schriftstellers oder den leidenschaftlichen Drang, Worte zu Papier zu bringen, der die Gabe und der Fluch derjenigen ist, die Lyrik und Prosa verfassen. Doch es ist lächerlich und kurzsichtig zu glauben, dass man die Grundzüge der Erzählkunst nicht lehren kann.«
So die Bestsellerautorin Elizabeth George im Vorwort zu »Wort für Wort«, ihrer ebenso lehrreichen wie unterhaltsamen Schreibschule. Ein Buch, das einerseits klar gegliedertes Handbuch für alle ist, die mehr über das Handwerk des Schreibens wissen wollen. Und das andererseits einen intimen Blick in die private Schreibwerkstatt einer der Meisterinnen der Kriminalliteratur ermöglicht.
Autorin
Akribische Recherche, präziser Spannungsaufbau und höchste psychologische Raffinesse zeichnen die Bücher der Amerikanerin Elizabeth George aus. Ihre Fälle sind stets detailgenaue Porträts unserer Zeit und Gesellschaft. Elizabeth George, die lange an der Universität »Creative Writing« lehrte, lebt heute in Seattle im Bundesstaat Washington, USA. Ihre Bücher sind allesamt internationale Bestseller, die sofort nach Erscheinen nicht nur die Spitzenplätze der deutschen Verkaufscharts erklimmen. Weiter Informationen unter www.elizabeth-george.de.
Die Inspector-Lynley-Romane in chronologischer Reihenfolge:
Mein ist die Rache
Gott schütze dieses Haus
Keiner werfe den ersten Stein
Auf Ehre und Gewissen
Denn bitter ist der Tod
Denn keiner ist ohne Schuld
Asche zu Asche
Im Angesicht des Feindes
Denn sie betrügt man nicht
Undank ist der Väter Lohn
Nie sollst du vergessen
Wer die Wahrheit sucht
Wo kein Zeuge ist
Am Ende war die Tat
Doch die Sünde ist scharlachrot
Wer dem Tode geweiht
Glaube der Lüge
Nur eine böse Tat
Bedenke, was du tust
Wer Strafe verdient
Was im Verborgenen ruht
Außerdem lieferbar:
Meisterklasse. Wie aus einer guten Idee ein perfekter Roman wird
Wort für Wort. Die Kunst, ein gutes Buch zu schreiben
Elizabeth George
Wortfür Wort
oderDie Kunst, ein gutes Buch zu schreiben
Aus dem Amerikanischenvon Elke Hosfeld
Goldmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2004 unter dem Titel »Write Away. One Novelist’s Approach to Fiction and the Writing Life« bei HarperCollins Publishers Inc., New York
Die Darstellung der Fotos in diesem Band geschieht mit freundlicher Genehmigung von Elizabeth George.
Neuausgabe März 2022
Copyright © der Originalausgabe 2004 by Susan Elizabeth George
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2004 Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München
Covermotiv: FinePic®, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Redaktion: Peter Kultzen
An · Herstellung: Sebastian Strohmaier
ISBN 978-3-641-28866-2V001
www.goldmann-verlag.de
Für Tom und Dannielle, die so vieles ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Ich finde es jedes Mal faszinierend und irritierend zugleich, jemandem zu begegnen, der der Ansicht ist, dass man Schreiben nicht lernen kann. Ehrlich gesagt, ich verstehe diese Auffassung nicht.
Ich glaube seit langem, dass der Schreibprozess aus zwei unterschiedlichen, aber gleich wichtigen Hälften besteht: Die eine hat etwas mit Kunst zu tun, die andere mit handwerklichem Können. Zweifellos kann man Kunst nicht lehren. Niemand kann einem anderen Menschen die Seele eines Künstlers verleihen, die Sensibilität eines Schriftstellers oder den leidenschaftlichen Drang, Worte zu Papier zu bringen, der die Gabe und der Fluch derjenigen ist, die Lyrik und Prosa verfassen. Doch es ist lächerlich und kurzsichtig zu glauben, dass man die Grundzüge der Erzählkunst nicht lehren kann.
Diese Annahme kommt der Überzeugung nahe, dass kein künstlerisches Medium gelehrt werden kann. Das hieße aber auch, dass kein künstlerischer Beruf über Werkzeuge und Techniken verfügt, die ein Anfänger lernt und dann verfeinert, bevor er den Sprung vom Handwerk in die Kunst wagt. Auf der anderen Seite würden diejenigen, die behaupten, dass Schreiben nicht erlernbar ist, vermutlich sofort einräumen, dass jemand die Grundlagen der Bildhauerkunst, der Öl- und Aquarellmalerei, der Komposition usw. sorgfältig studieren muss, bevor er sich als Meister auf einem dieser Gebiete bezeichnen kann. Dieselben Leute gehen wohl auch davon aus, dass alle, von Michelangelo bis zu Johann Sebastian Bach, ein wenig Unterricht in dem Bereich hatten, in dem sie sich auszeichneten.
Und das trifft, klipp und klar gesagt, auch für das Schreiben zu. Dennoch neigt man dazu, diese Logik über Bord zu werfen, wenn es um den Roman, das Gedicht oder die Kurzgeschichte geht. So habe ich auf den Reisen, die ich in den vergangenen fünfzehn Jahren um meiner Bücher willen unternommen habe, Länder kennen gelernt, wo die Menschen ernsthaft glauben, dass Schreiben ein geheimnisvoller Vorgang ist, den man entweder intuitiv erfasst oder gar nicht.
In den Vereinigten Staaten haben wir es besser. Es gehört seit langem zu unserer Tradition, dass Schriftsteller ihr handwerkliches Können an die Neulinge ihrer Zunft weitergeben. Aus diesem Grund bleiben der Roman, das Gedicht und die Kurzgeschichte wichtige Bestandteile unserer lebendigen literarischen Tradition. Schreiben ist in Amerika keine aussterbende Kunstform, weil die meisten der hier veröffentlichten Schriftsteller klug genug sind zu begreifen, dass sie die Talente, die in ihre Fußstapfen treten, fördern müssen. Saul Bellow, Philip Roth, Toni Morrison, Maya Angelou, Joyce Carol Oates, John Irving, Wallace Stegner, Michael Dorris, Ron Carlson, Thomas Kenneally, Oakley Hall – sie alle waren auch einmal Lehrer oder sind es immer noch. Ihre Anwesenheit im Klassenzimmer entmystifiziert den Prozess des Schreibens. Sie vermitteln, was sie wissen, und tragen zur Stärkung und Verbesserung unseres Handwerks bei.
Um handwerkliches Können geht es hier. Nicht um Kunst, die, wie schon erwähnt, nicht gelehrt werden kann. Auch nicht um Leidenschaft oder Disziplin, die wichtig sind, aber leider ebenso wenig gelehrt werden können. Natürlich wird niemand allein durch das Handwerk zu einem Shakespeare, William Faulkner oder einer Jane Austen. Aber es kann eine entscheidende Hilfe sein oder, bildlich gesprochen, die Erde, in die ein angehender Schriftsteller den Samen seiner Idee pflanzen kann, damit er wächst und zu einer Geschichte erblüht.
Darum geht es also in diesem Buch. Da ich seit einigen Jahren Seminare für kreatives Schreiben abhalte, glaube ich an die Macht des Handwerks. Mehr noch, ich glaube, dass handwerkliches Können für die meisten Schriftsteller ausschlaggebend ist. Eine gründliche Kenntnis der Techniken und Werkzeuge unseres Gewerbes kann uns aus mancherlei Schwierigkeiten heraushelfen. Ohne diese Kenntnis sind wir auf Gedeih und Verderb einer Muse ausgeliefert, die sich genau in dem Augenblick launisch zeigen kann, wo wir auf ihre Beständigkeit angewiesen sind. Handwerkliches Können wird nicht jedes Problem lösen, dem ein Schriftsteller begegnet, wenn er ein Kunstwerk schafft. Aber es wird helfen, eine Reihe von Hürden zu überwinden, denen er ohne Schulung nur schwer gewachsen ist.
Obwohl mein Buch zum Teil denen anderer Schriftsteller gleichen mag, wird vieles davon verschieden sein. Das kommt daher, dass jeder von uns dem Grundwissen, das wir über die Jahre angesammelt haben, einen eigenen Anstrich gibt. Ich kann nur erzählen, was ich für richtig halte, was ich tue und was dabei herauskommt. Kurz und gut, ich kann nur mein Vorgehen beim Schreiben offen legen und dazu ermutigen, eine eigene Vorgehensweise zu entwickeln.
Doch damit wir uns nicht falsch verstehen: Das Entwickeln einer solchen Vorgehensweise bedeutet, das Handwerk zu erlernen, weil eben dieser Vorgang dem handwerklichen Können entspringt.
Was die Kunst des Schreibens betrifft, sie ist und bleibt ein Geheimnis. Sie verdankt sich einer momentanen Inspiration und dem erregenden Gefühl, sich von einer Idee mitreißen zu lassen.
Die Kunst fängt an, wenn man mit dem Handwerk vertraut geworden ist.
ERSTER TEILEin Überblick über das Handwerk
1Die Geschichte besteht aus den Figuren
Mache ich mir etwas vor, wenn ich mich für eine »kreative Künstlerin« halte? Kann ich überhaupt eine kreative Künstlerin sein, wenn ich auf eine so akademische und methodische Art vorgehe?
Tagebuch eines Romans, 25. Juni 1997
Auf meinem Schreibtisch liegt eine große Platte aus Plexiglas, unter die ich allerlei Krimskrams geschoben habe, der mich inspirieren oder aufheitern soll, wenn mich tiefe Verzweiflung packt und ich mich frage, warum ich mich schon wieder auf ein so schwieriges Projekt eingelassen habe. Dazu gehören eine Kopie von John Steinbecks Brief an Herbert Sturz über den Roman Früchte des Zorns – seine Kommentare über Kritiker rufen bei mir stets ein Lächeln hervor –, Bilder von meinem Hund, von mir selbst, wie ich albern grinsend neben einer Figur von Richard dem Dritten aus Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett in London stehe, und mehrere Zitate von Schriftstellern zu dem einen oder anderen Thema. Einer dieser Autoren ist Isaac Bashevis Singer, der 1978 in einem Interview mit Richard Burgis sagte:
Wenn Menschen zusammenkommen – beispielsweise auf einer kleinen Party –, sprechen sie immer über den Charakter. Sie sagen, der hat einen schlechten Charakter und der einen guten; der hier ist ein Dummkopf und der da ein Geizhals. Die Gespräche bestehen aus Klatsch. Alle analysieren den Charakter. Es scheint, als sei die Analyse des Charakters die höchste Form menschlicher Unterhaltung. Und in der Literatur erfolgt sie, anders als beim Klatsch, ohne Namen von wirklichen Personen zu nennen.
Die Schriftsteller, die nicht über ihre Figuren reden, sondern über Probleme – soziale oder andere Probleme –, rauben der Literatur ihr eigentliches Wesen. Sie hören auf zu unterhalten. Wir allerdings lieben es aus irgendwelchen Gründen, über den Charakter einer Person zu reden und ihn zu ergründen. Das liegt daran, dass jeder Charakter verschieden und der menschliche Charakter das größte Rätsel ist.
Damit will ich nun beginnen, wenn ich den Grundstein für meine Erforschung unseres Handwerks lege: mit den Romanfiguren.
Nicht mit der Thematik?, mögt ihr verwundert fragen. Nicht damit, woher ein Schriftsteller seine Ideen bekommt? Was ein Autor mit den Ideen macht? Wie ein Schriftsteller aus seinen Themen eine Erzählung formt?
Dazu kommen wir später. Aber wenn ihr nicht versteht, dass eine Geschichte aus den Figuren besteht und nicht nur aus der Idee oder dem Thema, dann könnt ihr selbst dem genialsten Einfall kein Leben einhauchen.
Was uns nach der Lektüre eines guten Romans vor allem im Gedächtnis haften bleibt, sind die Personen. Das liegt daran, dass Ereignisse – sowohl im realen Leben als auch in der Fiktion – bedeutsamer werden, wenn wir die Menschen kennen, die von ihnen betroffen sind. Erhält die Katastrophe ein menschliches Antlitz, berührt sie uns tiefer; wir lassen uns sogar zu Handlungen bewegen, an die wir vorher nur beiläufig gedacht haben. München 1972, die Achille Lauro, Pan Am 103, Oklahoma City, der 11. September… Wenn diese Tragödien menschlich werden, weil man sie mit wirklichen Personen verbindet, die sie überlebt haben oder durch sie gestorben sind, prägen sie sich unauslöschlich im kollektiven Bewusstsein einer Gesellschaft ein. Am Anfang sehen wir ein Ereignis in den Nachrichten, doch gleich darauf stellen wir uns die Frage »Wer?«.
Im Roman ist das nicht anders. Der Prozess gegen Tom Robinson ist in seiner Ungerechtigkeit kaum erträglich, verstörend und herzzerreißend, doch wir erinnern uns an diese Verhandlung wegen Tom Robinsons stiller Würde und Atticus Finchs heroischer Verteidigung, die im sicheren Wissen erfolgt, dass sein Klient aufgrund der Zeit, des Orts und der Gesellschaft, in der sie beide leben, schon im Vorhinein verurteilt ist. Der Roman Wer die Nachtigall stört erreicht damit die Höhe der zeitlos klassischen Literatur, und das verdankt er nicht dem Thema der Unschuld der Kindheit inmitten einer abstoßenden Umwelt voller Vorurteilen und Brutalität, sondern seinen Figuren. Das gilt für jedes große Buch, und die Namen der Männer, Frauen und Kinder scheinen heller am Firmament der Literaturgeschichte als die Geschichten, in denen sie eine Rolle spielten: Elizabeth Bennett und Mr. Darcy, Jem und Scout Finch, Captain Ahab, Hester Prynne, Sherlock Holmes, Heathcliff, Ebenezer Scrooge, Huckleberry Finn, Jack-Ralph-and-Piggy, Hercule Poirot, Inspektor Morse, George Smiley, Anne Shirley, Laura Ingalls … Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Mit Ausnahme der letzten ist keine einzige Figur eine wirkliche Person. Doch alle von ihnen existieren, weil der Autor sie so erschaffen hat.
Haben wir einmal mit einem Roman begonnen, dann lesen wir vor allem weiter, weil wir wissen wollen, was mit den Figuren geschieht. Damit wir uns aber ernsthaft um diese Schauspieler in dem Drama auf den gedruckten Seiten vor uns sorgen, müssen sie für uns zu leibhaftigen Menschen werden. Ein Ereignis allein kann eine Geschichte nicht zusammenhalten. Ebenso wenig wie eine Reihe von Ereignissen. Nur die Personen, die Ereignisse bewirken, und Ereignisse, die Personen berühren, können das erreichen.
Wenn ich meine Figuren erschaffe, versuche ich mich an einige Grundregeln zu halten. Da wäre zuerst einmal die Erkenntnis, dass wirkliche Menschen Fehler haben. Wir sind alle unfertige Produkte auf diesem Planeten Erde; keiner von uns ist physisch, emotional, spirituell und psychisch perfekt. Das sollte auch für unsere Romanfiguren gelten. Niemand will etwas über vollkommene Charaktere lesen. Da kein Leser vollkommen ist, wird er sich in seiner Freizeit nur äußerst ungern mit einer Geschichte über ein Individuum beschäftigen, das mit einem Satz den Gipfel der seelischen, körperlichen und geistigen Vollendung erreicht. Würde sich jemand eine solche Person, die in jeder Hinsicht ermüdend perfekt ist, zum Freund oder zur Freundin wünschen? Vermutlich nicht. Also sollte eine Romanfigur, die in einem Bereich perfekt ist, in einem anderen unvollkommen sein.
Sir Arthur Conan Doyle hat das verstanden, was einer der Gründe ist, warum sein Sherlock Holmes mehr als hundert Jahre überlebt hat. Holmes hat den perfekten Intellekt. Der Mann ist buchstäblich eine Denkmaschine. Doch gefühlsmäßig ist er ein schwarzes Loch, unfähig zu einer längeren Beziehung mit irgendjemandem außer Dr. Watson, und obendrein nimmt er Drogen. Er hat eine Reihe ziemlich schrulliger Angewohnheiten und ist unerträglich hochmütig. Als ein Charakter »bündel« streift er unvergesslich durch die Seiten von Conan Doyles Geschichten. Folglich ist es schwer vorstellbar, dass irgendein Leser von englischer Literatur nicht weiß, wer Sherlock Holmes ist.
Im wirklichen Leben werden wir alle auf dem einen oder anderen Gebiet von Selbstzweifeln geplagt. Das ist allen Menschen gemeinsam. Also wünschen wir uns in der Literatur Charaktere, die Fehler machen, Irrtümer begehen und sich von Zeit zu Zeit schwach fühlen – und das ist die zweite Richtschnur, an die ich mich zu halten versuche, wenn ich eine Figur erfinde.
Als Beispiel wollen wir die bedauernswerte Erzählerin in Rebecca betrachten. Sie ist eine junge Frau, die ihre Anziehungskraft auf den reichen und schwermütig vor sich hin brütenden Maxim de Winter nicht erkennen kann. Völlig verängstigt geht sie durchs Leben, so sehr, dass sie die Scherben einer kleinen Statue, die sie in ihrem eigenen Haus umgestoßen hat, in einer Schreibtischschublade versteckt, damit sie keinen Ärger bekommt! Wir zucken erschreckt zusammen, als sie das tut. Aber wir können uns auch in ihre menschliche Natur hineinversetzen, weil wir alle Momente erlebt haben, in denen wir daran zweifelten, wer und was wir sind, und uns fragten, ob wir für eine andere Person wirklich liebenswert sein können. Wir identifizieren uns mit dieser Erzählerin und sorgen uns so sehr um sie, dass wir am liebsten Beifall klatschen würden, als sie schließlich zu sich kommt und der schrecklichen Mrs. Danvers – der Haushälterin auf Manderley, die die Erinnerung an Rebecca hochhält–ins Gesicht sagt: »Ich bin jetzt Mrs. de Winter«. Natürlich brennt Manderley bis auf die Grundmauern ab, und das ist wirklich bedauerlich. Aber die Figuren leben weiter.
Sie tun das, weil der Roman gut geschrieben ist; sie haben sich im Verlauf der Geschichte entwickelt und verändert, und das ist die dritte Regel, von der ich mich leiten lasse. Die Figuren lernen etwas aus dem Fortgang der Ereignisse, und der Leser ebenso, weil der Charakter einer fiktiven Person nur langsam enthüllt und jeweils nur eine Schicht freigelegt wird.
Während sie so verfährt, weiß die Autorin, dass die Figuren in ihren Konflikten und Wirrungen, ihrem Unglück und Elend interessant sind. Sie interessieren uns leider nicht, wenn sie glücklich und zufrieden sind. Das Elend lässt sie in die Grube fallen, aus der sie im Fortgang des Romans herausklettern. Das Glück beraubt sie einer Geschichte.
Wer diese Wahrheit bezweifelt, sollte die folgende Reihe von Figuren betrachten, die mir in einem Kurs für kreatives Schreiben vorgestellt wurden, den ich vor einigen Jahren abgehalten habe.
Eine meiner Studentinnen hatte sich einen Privatdetektiv ausgedacht, der in Boston arbeiten sollte. Sie brachte ihre ersten Seiten zur Begutachtung mit in die Klasse. Dort begegneten wir dem Privatdetektiv und seiner Schwester, ihrer Mutter und ihrem Stiefvater. Der Privatdetektiv entstammte einer großen irischen Familie. Seine Schwester arbeitete für ihn. Er und seine Schwester kamen gut miteinander aus; sie waren so etwas wie dicke Freunde. Am St. Patrick’s Day, mit dem der Roman beginnt, gehen der Privatdetektiv und seine Schwester in tiefer Verbundenheit zum Haus ihrer Mutter, um dort zu Abend zu essen. Sie lieben ihre Mutter und würden um alles Cornedbeef und allen Kohl von County Clare kein Abendessen am St. Patrick’s Day in Boston versäumen. Dazu ist ihre Mutter eine hervorragende Köchin, die beste Köchin, die es jemals gegeben hat. Aus ihrer glücklichen Kindheit erinnern sie sich an die Mahlzeiten rund um den alten Küchentisch, das Murmeln der Familiengespräche in dem Raum voller Essensdüfte. Nun also gehen sie zum Haus ihrer Mutter hinüber, und die erste Person, der sie begegnen, ist ihr Stiefvater. Er ist ein wundervoller Mann. Sie verehren ihn. Durch ihn wurde ihre Kindheit zum Paradies. Er heiratete ihre Mutter, als sie Witwe wurde, was dem sehnlichsten Wunsch der Kinder entsprach …
An dieser Stelle im Kapitel konnte man nur noch beten, dass jemand vorbeikäme und den Leser von diesen Figuren erlöste. Warum? Weil es keinen Konflikt gab. Es gab nur Friede, Freude, Eierkuchen. Oh Mann! Es gab keine Geschichte.
Folglich solltet ihr euren literarischen Figuren Fehler verleihen, Selbstzweifel erlauben, für ihre Entwicklung und Veränderung sorgen und sie in Konflikte verstricken. Wenn ihr das begriffen habt, könnt ihr anfangen, die Figuren selbst zu entwerfen.
Beachtet bitte, dass ich das Wort Entwurf verwende. Denn ihr seid hier sowohl der leitende Architekt als auch der Generalunternehmer, und das ist neben der geschickten Handhabung der Sprache der kreativste Teil des ganzen Schreibprozesses.
Wenn ich eine Figur entwerfe, beginne ich mit ihrem Namen. In meiner Art zu denken und zu schreiben ist es unmöglich, eine Figur ohne Namen zu erschaffen. Der Name, den ich wähle, ist nicht beliebig. Er ist das erste Handwerkszeug, das ich benutzen kann, um zu offenbaren, wer und was meine Schöpfung ist, und jeder Schriftsteller ist dumm, der das nicht erkennen will und einfach irgendeinen altbekannten Namen über die Person stülpt, ohne zu spüren, dass der Name von großer Bedeutung ist. Namen können dem Leser fast alles andeuten. Wie Anne Bernays und Pamela Painter in ihren Schreibübungen für Schriftsteller Was wäre, wenn ausführen, können Namen Charakterzüge widerspiegeln (Ebenezer Scrooge, Uriah Heep, Roger Chillingsworth, Mr. Knightley). Sie können auf die soziale und ethnische Herkunft verweisen (Captain Ross Poldark, Tom Joad, Mrs. van Hopper, Maxim de Winter, Winston Nkata). Sie können den Ort, die geographische Lage andeuten (Hank wird auf einer Farm leben und sich wahrscheinlich nicht in Harvard aufhalten), das Verhalten oder sogar Ereignisse, die in der Geschichte erst später stattfinden.1 Namen haben einen Einfluss darauf, wie der Leser einer Figur gegenüber empfindet. Sie machen es auch für den Schriftsteller leichter, eine fiktive Person zu erschaffen.
Betrachten wir Folgendes aus den Annalen meiner eigenen literarischen Geschichte. Als ich Im Angesicht des Feindes schrieb, schuf ich eine hart gesottene und zielstrebige Karrierefrau, die ich Eve Bowen nannte. Für mich war das ein schöner, kantiger, energischer Name. Ein sachlicher Name. Es fiel mir nicht schwer, damit zu arbeiten, um die Figur Eve Bowen zum Leben zu erwecken. An ihrer Seite sollte ihr Mann stehen. Ich wollte, dass er ihr ebenbürtig ist und sich von ihrer erfolgreichen politischen Karriere nicht einschüchtern lässt. Er sollte stark sein, ein erfolgreicher Unternehmer, der aus der Arbeiterklasse stammt, in Newcastle aufgewachsen ist, sich hochgearbeitet und seine Herkunft samt Akzent hinter sich gelassen hat. Dummheit und Unfähigkeit sollte er einfach nicht ertragen können.
Also fing ich mit seinem Namen an. Ich nannte ihn Leo Swann. Dann setzte ich mich an den Computer, starrte über zwanzig Minuten auf den Bildschirm und konnte nichts über ihn schreiben, bis ich erkannte, dass ich ihm den falschen Namen gegeben hatte, weil eine Figur namens Leo Swann nicht wie der Mann sein konnte, den ich im Sinn hatte. Als ich seinen Namen zu Alexander Stone verändert hatte – Alex Stone –, konnte ich damit arbeiten. Dieser Name vermittelte mir den Eindruck von Stärke; er klang nach Entschlossenheit und Durchsetzungsvermögen. Anders als Leo Swann. Und, wichtiger noch, ich glaubte nicht, dass Leo Swann in der Lage war, einem Leser diesen Eindruck zu vermitteln.
Wenn ich den Namen einer Figur gefunden habe, analysiere ich sie. Hierauf gehe ich später noch ausführlicher ein. Zunächst mag es genügen zu sagen, dass diese Analyse mit einigen grundlegenden Fakten beginnt, die sich bald zu einem umfangreichen Bericht ausweiten. In diesem Bericht werde ich zum Psychiater der fiktiven Person, zu ihrem Psychoanalytiker, Bewährungshelfer und Biographen, weil ich der Ansicht bin, dass ich meine Charaktere umso abgerundeter und unverwechselbarer gestalten kann, je mehr ich über sie weiß, bevor ich den Roman schreibe.
Sinn und Zweck dieser Vorarbeiten, die im Vergleich zum eigentlichen Schreiben des Romans wie Kinderkram erscheinen mögen, wurzeln in meiner Überzeugung, dass man eine literarische Figur nicht zum Leben erwecken kann, wenn sie oder er nicht schon vor Beginn des Buchs lebendig ist. Wenn ich eine Figur nicht kenne, bevor ich sie der Feuerprobe des Plots aussetze, weiß ich einfach nicht genau, wie sie auf das Geschehen reagieren wird, oder ich falle, was genauso schlimm ist, auf die alten, immer gleichen Muster zurück, um diese Reaktion zu erläutern. In Wirklichkeit jedoch reagieren wir auf unsere Lebensumstände alle verschieden. Ebenso sollten es die Romanfiguren tun.
Das gilt besonders für die Art, wie wir sprechen; der Entwurf einer fiktiven Person hilft mir zu verstehen, wie sie reden wird – sowohl im eigentlichen Dialog als auch in ihrer Erzählsprache, wenn ich mich entscheide, eine Szene aus ihrer Perspektive darzustellen. Die Worte, die eine Figur benutzt, die Syntax, die ihr eigentümlich ist, und ihr Sprachstil werden so zu einem weiteren Werkzeug, um dem Leser ihren Charakter zu enthüllen. Im Dialog wird eine Romanfigur nicht nur ihre Ansichten und ihre Persönlichkeit veranschaulichen; auch ihr Bildungsgrad, ihr wirtschaftlicher Hintergrund, ihre Haltung (einer der wesentlichen Bestandteile der Charakterisierung), ihr Glauben, Aberglauben, ihre Krankheiten und vieles andere werden sich im Dialog offenbaren. Doch das kann nur dann funktionieren, wenn ich überhaupt weiß, was offenbart werden soll, das heißt, wenn ich die Figur erfunden habe, bevor ich ihr die Worte in den Mund lege.
Wenn die Geschichte aus den Figuren besteht, dann erschaffen die Dialoge die Figuren. Sehen wir uns die folgende gekürzte Szene aus Harper Lees Wer die Nachtigall stört an.
»Sind Sie der Vater von Mayella Ewell?«, lautete die nächste Frage.
»Na, wenn ich’s nicht bin, kann ich nichts mehr dagegen tun, meine Alte ist tot«, war die Antwort.
Richter Taylor hob den Kopf, setzte seinen Drehstuhl in langsame Bewegung und schaute den Zeugen mild an. »Sind Sie der Vater von Mayella Ewell?«, fragte er in einem Ton, der das Gelächter im Saal plötzlich verstummen ließ.
»Ja, Sir«, antwortete Mr. Ewell demütig.
»Sie erscheinen das erste Mal vor Gericht, nicht wahr?«, fuhr Richter Taylor wohlwollend fort. »Ich entsinne mich nicht, Sie je hier gesehen zu haben.« Der Zeuge bestätigte das durch ein Nicken. »Nun, dann wollen wir zunächst Folgendes klarstellen: Solange ich den Vorsitz führe, wird in diesem Saal niemand mehr irgendwelche zotigen Bemerkungen zu irgendeinem Thema machen. Verstehen Sie?«
Mr. Ewell nickte ein zweites Mal, hatte jedoch offensichtlich kein Wort verstanden. Richter Taylor seufzte. »Also bitte, Mr. Gilmer«, sagte er.
»Danke, Sir … Mr. Ewell, würden Sie uns bitte in Ihren eigenen Worten sagen, was am Abend des einundzwanzigsten November geschah?«
Jem grinste und strich sich die Haarsträhne aus der Stirn. »In Ihren eigenen Worten« war Mr. Gilmers Warenzeichen. Wir fragten uns oft, was er eigentlich befürchtete. Konnte man sich denn anderer Worte bedienen als der eigenen?
»Also, am einundzwanzigsten November bin ich abends mit ’ner Ladung Kleinholz aus’m Wald gekommen, und gerade wie ich am Zaun bin, höre ich Mayella im Haus drin kreischen wie ’ne gestochene Sau …«
Richter Taylor warf dem Zeugen einen scharfen Blick zu, vermochte aber wohl keine böse Absicht in diesem Ausdruck zu erkennen, denn er verfiel wieder in Apathie.
»Um welche Zeit war das, Mr. Ewell?«
»Kurz bevor die Sonne unterging. Also, wie gesagt, Mayella hat geschrien, als wenn sie Jesus überschreien wollte…« Ein zweiter Blick des Richters ließ Mr. Ewell jäh verstummen.
»Ja? Sie hat geschrien?«, fragte Mr. Gilmer.
Mr. Ewell sah ängstlich auf den Richter. »Also, Mayella hat ’nen Mordskrach gemacht, und da hab ich mein Holz hingeschmissen und bin so fix gerannt, wie ich nur konnte. Aber ich bin in den Zaun gerannt. Aus dem musste ich mich erst wieder rauswursteln, und dann bin ich ans Fenster gerannt, und da…« Mr. Ewells Gesicht wurde scharlachrot. Er erhob sich und deutete auf Tom Robinson. » Und da hab ich den schwarzen Nigger auf meiner Mayella bocken sehen!«
Bei Richter Taylors Gerichtsverhandlungen ging es immer so ruhig zu, dass er kaum je von seinem hölzernen Hammer Gebrauch machen musste. Diesmal aber hämmerte er volle fünf Minuten. Atticus war nach vorn geeilt und sagte etwas zu ihm. Mr. Heck Tate stand in seiner Eigenschaft als erster Gerichtsbeamter von Maycomb County mitten im Gang und versuchte, den Aufruhr im Saal zu dämpfen. Hinter uns erklang das zornige, halb erstickte Stöhnen der Farbigen.
Hochwürden Sykes zupfte Jem am Ärmel. »Mr. Jem, das ist nichts für Miss Jean Louise. Gehen Sie lieber mit ihr nach Hause. Mr. Jem, hören Sie doch!«
Jem wandte den Kopf. »Los, Scout, verschwinde. Dill, du gehst jetzt mit Scout nach Hause.«
»Dazu musst du mich aber erst bringen«, sagte ich in Erinnerung an das salomonische Urteil unseres Vaters.
Jem bedachte mich mit einem wütenden Blick und beugte sich dann zu Hochwürden Sykes. »Ich glaube, sie kann hier bleiben, Hochwürden. Sie versteht’s sowieso nicht. «
Ich war tödlich beleidigt. »Natürlich verstehe ich jedes Wort. Was du verstehst, verstehe ich schon lange. «
»Ach, sei still. Sie versteht’s wirklich nicht, Hochwürden. Sie ist ja noch nicht mal neun.«
Die schwarzen Augen von Hochwürden Sykes schauten uns besorgt an. »Weiß Mr. Fink, dass ihr hier seid? Diese Verhandlung ist nichts für Miss Jean Louise und auch nichts für euch Jungens.«
Jem schüttelte den Kopf. »Wir sitzen ja so weit weg, dass er uns nicht sehen kann. Ist schon gut, Hochwürden. «
Ich wusste, dass Jem gewinnen würde. Er war felsenfest entschlossen, nicht von hier fortzugehen. Für Dill und mich bestand also keine Gefahr – es sei denn, dass Atticus heraufschaute. Wir waren nämlich nicht so weit von ihm entfernt, wie Jem behauptete.
Während der Richter den Hammer betätigte, saß Mr. Ewell selbstgefällig im Zeugenstand und betrachtete sein Werk. Mit ein paar Worten hatte er fröhliche Ausflügler in eine erregte, dumpf grollende Menge verwandelt, die langsam durch Richter Taylors Hammerschläge hypnotisiert wurde. Allmählich verminderte sich die Lautstärke des Pochens, bis schließlich das einzige Geräusch im Saal ein schwaches Pink-Pink-Pink war: Der Richter hätte ebenso gut mit einem Bleistift klopfen können.
Als Richter Taylor die Zügel wieder fest in der Hand hatte, lehnte er sich im Stuhl zurück. Er wirkte plötzlich erschöpft, man sah ihm sein Alter an. Mir fiel ein, dass Atticus gesagt hatte, Mrs. Taylor und ihr Mann küssten sich nicht oft. Nun ja, er war wohl nahezu siebzig.
»Es liegt ein Antrag vor«, sagte Richter Taylor, »die Öffentlichkeit oder zumindest Frauen und Kinder von der weiteren Verhandlung auszuschließen – ein Antrag, dem vorläufig nicht entsprochen wird. Die Leute sehen gewöhnlich das, was sie sehen wollen, und hören das, was sie hören wollen, und sie haben das Recht, auch ihre Kinder dem auszusetzen. Eines kann ich jedoch mit allem Nachdruck versichern: Die Anwesenden werden alles, was sie sehen und hören, schweigend hinnehmen, oder sie werden den Saal verlassen – aber nicht, bevor ich sie samt und sonders wegen Ungebühr vor Gericht bestraft habe. Und Sie, Mr. Ewell, werden bei Ihrer Zeugenaussage wenn möglich im Rahmen des christlich-englischen Sprachgebrauchs bleiben. Fahren Sie fort, Mr. Gilmer. «2
Auf diesen Seiten entsteht fast ausschließlich durch den Dialog ein anschauliches Bild von Bob Ewell: dumm, rassistisch, ungebildet, hasserfüllt, obszön und hemmungslos … Dagegen erleben wir den vornehmen Reverend Sykes und den klugen und standhaften Richter Taylor, die auch nur durch den Dialog dargestellt werden. Wir erfahren etwas über diese Figuren durch ihre Worte, und die Autorin tut nichts anderes, als die Szene darzustellen, wobei sie ganz genau weiß, wer diese Männer sind und wofür sie stehen. Und das wollen wir alle mit unseren Dialogen erreichen: dass auch beim Leser jeder Zweifel ausgeräumt wird.
Doch es gibt noch andere Mittel, die man benutzen kann, um einer Person Substanz zu geben. Wenn wir die Gelegenheit nutzen (nur wenn sie sich bietet), etwas aus der Vergangenheit der Figur zu erzählen, vertiefen wir das Bild, das der Leser von ihrem Charakter hat. Sehen wir uns an, wie Toni Morrison die Verletzlichkeit ihrer Hauptfigur Sethe aus Menschenkind durch zwei entscheidende und qualvolle Begebenheiten aus Sethes Vergangenheit verdeutlicht.
Die 124 war böse. So tückisch wie ein Kleinkind. Die Frauen im Haus wussten das, und die Kinder auch. Jahrelang fand sich jeder auf seine Weise mit der Bosheit ab, aber im Jahre 1873 litten bloß noch Sethe und ihre Tochter Denver darunter. Großmutter Baby Suggs war tot, und die Söhne, Howard und Buglar, waren schon mit dreizehn fortgelaufen – als nämlich ein Spiegel bereits beim bloßen Hineinsehen in tausend Scherben zersprang (das war das Zeichen für Buglar) und als zwei winzige Handabdrücke im Kuchen auftauchten (da reichte es Howard). Keiner der Jungen wartete so lange, bis er noch mehr sah; wieder einmal einen Kessel voller Kichererbsen in einem dampfenden Haufen auf dem Fußboden; oder in einer Linie vor die Türschwelle gestreute Kekskrümel. Sie warteten nicht einmal eine der stillen Zeiten ab: die Wochen, ja, Monate, in denen es keine Störung gab. Nein. Beide flohen auf der Stelle – sobald das Haus diejenige Untat beging, die sie nicht ein zweites Mal ertragen oder miterleben wollten. Binnen zweier Monate, mitten im tiefsten Winter, ließen sie ihre Großmutter Baby Suggs, ihre Mutter Sethe und ihre kleine Schwester Denver ganz allein in dem schiefergrauen Haus an der Bluestone Road zurück. Damals trug es noch keine Nummer, weil Cincinnati noch nicht so weit reichte. Ja selbst Ohio nannte sich erst seit siebzig Jahren Staat, als zuerst der eine Bruder und dann der andere sich Füllmaterial aus einer Steppdecke in die Mütze steckte, seine Schuhe in die Hand nahm und sich dem lebhaften Hass, den das Haus gegen die beiden empfand, klammheimlich entzog.
Baby Suggs hob nicht einmal den Kopf. Von ihrem Krankenbett aus hörte sie, wie sie gingen, aber nicht darum lag sie still. Ihr war ohnehin unbegreiflich, dass ihre Enkelsöhne so lange gebraucht hatten, um zu merken, dass nicht alle Häuser so waren wie das an der Bluestone Road. In der Schwebe zwischen der Widerwärtigkeit des Lebens und der Bosheit der Toten konnte sie weder Interesse dafür aufbringen, vom Leben zu lassen, noch dafür, es zu leben, geschweige denn für die Furcht von zwei Jungen, die sich davonstahlen. Ihre Vergangenheit war ebenso gewesen wie ihre Gegenwart – unerträglich –, und da sie wusste, dass der Tod alles andere als Vergessen bewirkte, nutzte sie das bisschen Kraft, das ihr noch blieb, um sich Gedanken über Farben zu machen.
»Bring mir ein bisschen Lavendelblau, wenn du hast. Wenn nicht, dann Rosa.«
Und Sethe war ihr mit allem zu Diensten, von Stoffen bis hin zu ihrer eigenen Zunge. Der Winter in Ohio war besonders garstig, wenn man Lust auf Farbe hatte. Allein der Himmel sorgte für Dramatik, und sich für das einzige Vergnügen im Leben auf den Horizont von Cincinnati zu verlassen, war in der Tat verwegen. Drum taten Sethe und ihr Mädchen Denver für sie, was sie konnten und was das Haus zuließ. Gemeinsam führten sie einen mechanischen Kampf gegen dessen unverschämtes Benehmen: gegen umgeworfene Nachttöpfe, Klapse aufs Hinterteil und Schwaden verpesteter Luft. Denn sie verstanden die Quelle der Empörung ebenso gut wie sie die Quelle des Lichts kannten.
Baby Suggs starb, kurz nachdem die Brüder – ohne das geringste Interesse an einem Abschied oder am Abschied ihrer Großmutter von der Welt – davongelaufen waren, und unmittelbar darauf beschlossen Sethe und Denver, der Qual ein Ende zu machen, indem sie den Geist riefen, der sie so plagte. Vielleicht, so dachten sie, half ein Gespräch, ein Meinungsaustausch oder so etwas. Drum fassten sie sich an den Händen und sagten: »Komm raus. Komm raus. So komm doch schon. «
Die Anrichte tat einen Satz nach vorn, sonst tat sich nichts.
»Sicher ist Grandma Baby schuld, dass er nicht will«, sagte Denver. Sie war zehn und immer noch böse auf Baby Suggs, weil sie gestorben war.
Sethe schlug die Augen auf. »Das bezweifle ich«, sagte sie.
»Warum kommt er dann nicht?«
»Du vergisst, wie klein er ist«, sagte ihre Mutter. »Sie war ja kaum zwei, als sie starb. Zu klein, um zu verstehen. Fast noch zu klein zum Sprechen. «
»Vielleicht will sie nicht verstehen«, sagte Denver.
»Vielleicht. Aber wenn sie nur käme, könnt ich ihr alles erklären.« Sethe ließ die Hand ihrer Tochter los, und gemeinsam schoben sie die Anrichte an die Wand zurück. Draußen peitschte ein Kutscher sein Pferd zum Galopp an; das hielten die Leute aus der Gegend für notwendig, wenn sie an der 124 vorüberkamen.
»Für ein Baby hat sie starke Zauberkräfte«, sagte Denver.
»Nicht stärker als meine Liebe zu ihr«, antwortete Sethe, und da war sie wieder: die einladende Kühle unbehauener Grabsteine; und der, den sie aussuchte, um sich auf Zehenspitzen dagegenzulehnen, die Beine weit offen wie ein Grab. Rosa wie ein Fingernagel war er und von glitzernden Einschlüssen durchzogen. Zehn Minuten, sagte er. Wenn du zehn Minuten Zeit hast, mach ich ihn umsonst.
Zehn Minuten für zwölf Buchstaben. Hätte sie mit noch einmal zehn ein »Innigst geliebtes« dazubekommen? Sie hatte nicht daran gedacht, ihn zu fragen, und es quälte sie noch immer, dass es vielleicht möglich gewesen wäre – dass sie für zwanzig Minuten, sagen wir eine halbe Stunde, alles auf den Grabstein ihrer Kleinen hätte eingemeißelt bekommen, jedes Wort, das sie den Prediger beim Begräbnis hatte sagen hören (und sicherlich alles, was es dazu zu sagen gab): Innigst geliebtes Menschenkind. Bekommen hatte sie das eine Wort, das zählte, und damit hatte sie sich zufrieden gegeben. Sie meinte, es müsse genügen, sich zwischen den Grabsteinen von dem Steinmetzen bespringen zu lassen, unter den Augen seines kleinen Sohnes, in dessen Gesicht uralter Ärger und ganz junge Lust geschrieben standen. Das müsste doch genügen. Genügen, um einem weiteren Prediger, einem weiteren Abolitionisten und einer von Abscheu erfüllten Stadt Rede und Antwort zu stehen.
Sie baute auf den Frieden ihrer eigenen Seele, hatte dabei aber die andere vergessen: die Seele ihrer Kleinen. Wer hätte gedacht, dass ein dummes kleines Baby so viel Wut in sich haben konnte? Sich unter den Augen des Steinmetzensohns zwischen den Grabsteinen bespringen lassen zu müssen, war noch nicht genug. Sie musste nicht nur ihr Dasein in einem Haus fristen, das vor der Wut des Babys über seine durchschnittene Kehle zitterte; die zehn Minuten, die sie gegen den morgenrotfarbenen, von Sternensplittern durchzogenen Stein gedrückt dastand, die Beine so weit offen wie das Grab, waren auch noch länger als ein Leben und lebendiger, pulsierender als das Kindsblut, das ihre Finger überzog wie Öl.3
Sethes Gedanken beim Erwerb des Grabsteins – integraler Bestandteil der Erzählung und nicht nur eine von diesen hilflos eingeschobenen Rückblenden, die der Ruin des literarischen Anfängers sind – lassen uns den tiefen Schmerz im Herzen der Romanfigur spüren. Sie hat sich innerlich entfernt, distanziert vom eigenhändigen Mord an ihrem Kind. Genau diese Loslösung von ihrer schrecklichen Vergangenheit macht sie verletzlich. Wichtiger noch, es macht sie glaubhaft und unvergesslich.
Und noch einmal: Toni Morrison hätte diese Szene mit Sethe nicht erschaffen können, wenn sie die Situation und den Charakter ihrer Figur nicht vorher gut genug gekannt hätte, um zu wissen, dass Sethe in diesem Moment distanziert statt zornig oder dergleichen sein wird – ganz gleich, wie die Autorin sich selbst verhalten würde.
Einen Charakter vorher zu erfinden hilft dem Romanschriftsteller, überzeugend mit einer fremden Erzählstimme über Erfahrungen zu schreiben, die ganz anders als die eigenen sind. Wenn ein Autor eine Figur vorher erschafft, kann es ihm gelingen, die Person zu übernehmen, die Grenzen zwischen sich selbst und seinen Geschöpfen aufzulösen, wodurch es ihm leichter fällt, in ihre Haut zu schlüpfen und ihre Erfahrungen zu vermitteln.
Persönliche Eigenarten und vielsagende Details füllen dann mögliche Lücken aus. Annie Wilkes’ plötzliche Dämmerzustände in Stephen Kings schauerlichem und humorvollem Misery verbinden sich mit ihrer bizarren Wahl von Kraftausdrücken (»du schmutziges Vögelchen«) und malen das Porträt einer Wahnsinnigen, die kein Leser so leicht vergessen wird. Mr. Bridges Reaktion auf den heranziehenden Tornado in Evan Connells meisterhaftem Roman Mrs. Bridge nebst der sanften Duldsamkeit von Mrs. Bridge sagt viel mehr und mit größerer Wirkung, als es jeder kritische Bericht seitens des Autors vermocht hätte. Da sitzen die Bridges und verzehren entschlossen ihr Abendessen im Restaurant des Country Club, derweil es evakuiert wird und der Tornado auf sie zurast: Mr. Bridge, der sich weigert, das Thema der herannahenden Katastrophe auch nur anzuschneiden, während er sein Essen hinunterschlingt, und Mrs. Bridge, die hilflos kichert und »Oh, mein Gott« ruft. So kann man nur schreiben, wenn man seine Charaktere kennt. Wenn man weiß, wer sie sind und wie sie reagieren werden, kann man sich auch besser vor einer möglichen Schreibblockade schützen.
Lasst mich nun wiederholen, an was ich glaube, bevor es weitergeht.
Die Figuren erschaffen die Geschichte.
Die Dialoge erschaffen die Figuren.
Soll eine literarische Figur echt und lebendig wirken, muss man sie vorher gründlich kennen lernen, die Funktionen des Dialogs verstehen und sorgfältig ausgewählte, vielsagende Details verwenden.
Viel zu merken? Ja. Aber in diesem Buch erzähle ich euch, wie ich das alles in die Praxis umsetze.
2Der Schauplatz der Geschichte
Was soll ich nun tun? Das ist die entscheidendeFrage. Muss ich nach England zurückkehren undan die Plätze gehen, wo die Geschichte spielt,nur damit ich festen Boden unter den Füßen bekomme? Etwas sagt mir, dass ich es tun muss.
Tagebuch eines Romans, 10. Mai 1994
Bevor wir uns in diesem Überblick mit dem Plot beschäftigen, wollen wir uns dem Schauplatz zuwenden, der, gründlich erforscht und geschickt eingesetzt, nicht nur Teil einer Figur, sondern auch ein Schlüssel zum Plot sein kann. Der Schauplatz kann eine Quelle von Ideen sein, wenn der Autor sich selbst an den Ort des Geschehens begibt. Außerdem kann er Charaktere, Thematik und vieles andere mehr erhellen.
Um sicherzugehen, dass wir uns richtig verstehen, will ich diesen Begriff erst einmal definieren. Einfach ausgedrückt ist der Schauplatz dort, wo die Geschichte spielt. Darüber hinaus bezeichnet er jeden Ort, an dem die einzelnen Szenen der Geschichte spielen. Wie alle anderen Instrumente unseres Handwerks hat er mehrere Aufgaben.
Vor allem schafft er eine Atmosphäre. Der Schauplatz fördert nicht nur das Verständnis des Lesers, um welche Art von Roman es sich handelt, er ruft auch Stimmungen hervor. Und da es eine der Absichten des Schriftstellers ist, beim Leser emotionale Reaktionen zu bewirken, bietet sich der Schauplatz als geeignetes Mittel an. Betrachten wir die Beschreibung des Schauplatzes aus einem der letzten Kapitel in meinem Roman Denn bitter ist der Tod. Das Buch beginnt in England, in dem finstergrauen Nebel von Cambridge, einem Gifthauch, der aus den umliegenden Mooren aufsteigt und alles auf schattenhafte Gestalten reduziert. Hier, am Ende des Romans, kehrt der Nebel zurück.
Am nächsten Morgen lag der Nebel schwer auf der Stadt. Autos, Lastwagen, Busse und Taxis krochen durch die feuchten Straßen. Fahrräder glitten wie Schemen durch die Düsternis. Vermummte Fußgänger auf den Bürgersteigen versuchten dem von Dächern, Fenstersimsen und Bäumen tropfenden Wasser auszuweichen. Es war, als hätte es die zwei Tage Wind und Sonnenschein nicht gegeben.
»Widerlich«, sagte Barbara Havers in ihrem erbsengrünen Mantel, mit einer pinkfarbenen Wollmütze auf dem Kopf. Sie schlug mit den Armen und stampfte mit den Füßen, während sie zu Lynleys Wagen gingen. Die blonden Fransen auf ihrer Stirn kräuselten sich in der Feuchtigkeit. »Kein Wunder, dass Philby und Burgess zu den Sowjets übergelaufen sind«, sagte sie. »Bei dem Klima.« »Genau«, sagte Lynley. »Moskau im Winter. Das war schon immer mein Traum.«1
Die Düsternis der ersten Romankapitel – Vorbote künftiger Verwicklungen – hüllt die Stadt wieder einmal ein. Doch diesmal spielt sie nicht die Rolle des Auslösers der Verwechslung (der Mörder bringt Georgina Higgins-Hart um, weil er sie für Rosalind Summers hält, ein Irrtum, der sich dem Nebel am Anfang des Buchs verdankt). Vielmehr dient sie nun als Hintergrund der Verzweiflung, vor dem die letzten Augenblicke des Dramas ablaufen.
Diese Art von Schauplatz ist weit verbreitet und wird auch häufig in Literaturseminaren behandelt: der Schauplatz als Metapher. Aber er kann auch dazu dienen, den Charakter einer Figur zu offenbaren.
Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, wir sind, was wir anziehen, sammeln, lesen und so weiter. Wir sind die Umgebung, in der wir leben und arbeiten. Dasselbe gilt für die Figuren. Ihre individuellen Schauplätze können dem Leser Bände erzählen, ohne dass der Schriftsteller etwas direkt berichten muss. Darauf verweist auch der bekannte Ausspruch aus den Schreibkursen: »Darstellen, nicht berichten.« Durch die Umgebung einer Figur stellt man dar, wer sie ist. Alles Übrige wird vom Leser gedeutet.
Betrachten wir im folgenden kurzen Abschnitt aus dem Roman Die Krone des Kolumbus, wie gekonnt Michael Dorris und Louise Erdrich den Schauplatz einsetzen, um die Persönlichkeit einer Figur zu verdeutlichen.
Ich fuhr langsam am Haus vorüber, hielt jedoch nicht an. Unten brannten alle Lichter, und ich sah Roger kurz durchs Fenster. Er war auf dem Weg in die Küche und hatte etwas in der Hand, was nach der Sonntagsausgabe der »New York Times« aussah. Ich fuhr einmal um den Block und blieb an der Einbiegung zu seiner Straße stehen. Ich schalt mich alles Mögliche – zuerst, weil ich überhaupt hergekommen war, und dann, weil ich mich nun, da ich einmal hier war, nicht entschließen konnte. Ich schloss einen Pakt mit dem Schicksal. Wenn Roger inzwischen nicht aus der Küche gekommen war, würde ich nach Hause fahren, ihm eine Karte mit einer Entschuldigung schicken und mein Leben weiterleben. Ich würde ihn den Buchrezensionen, der Kunstkritik und dem Feuilleton überlassen und meine Gefühle in den Griff kriegen. Ich würde bei Ben und Jerry’s anhalten und mir eine Kalorienbombe genehmigen, einen doppelten Schoko-Milchshake. Ich würde Grandma zu einem Kartenspiel herausfordern und endlich einmal gewinnen. Ich würde diesen dämlichen Artikel über Kolumbus schreiben und mich dann weniger vorhersagbaren Dingen zuwenden.
Die Haustür stand offen. Rogers Silhouette war der Richtung zugewandt, aus der ich kommen würde. Er winkte.
Ich hupte, und prompt würgte ich den Motor ab.
Aber im Ernst, wer könnte diesem Roger Williams widerstehen? Was hatte er zu essen im Kühlschrank für den Fall, dass ich vorbeikam? Nicht einfach nur Brie. Dänischen Brie. Und auf dem Plattenteller? Nicht den üblichen Bach, sondern das Album von Aretha Franklin, das ich ihm zum Geburtstag geschenkt hatte, noch dazu in der Lautstärke, die mir gefiel.
Hier stand ein Mann, der seine Kompromissbereitschaft geradezu herausschrie.
Violet hingegen schrie sich einfach nur die Seele aus dem Leib, von dem Augenblick an, als ich den Sicherheitsgurt um ihren Kindersitz löste und sie ins Haus ihres Vaters brachte. Mit ihren zusammengekniffenen Augen, dem durchgestreckten Rücken und dem weit geöffneten Mund war sie der Inbegriff des Protests, wild tobende Wut, das Alte Testament in seinem ganzen Zorn. Ich wiegte sie an meiner Brust, summte ihr ins Ohr, zog ihr vor lauter Verzweiflung sogar ganz vorsichtig das rechte Augenlid hoch, damit sie sehen konnte, dass ich es war – die vertraute Nahrungsquelle –, die sie da so beschimpfte. Doch dieser Einbruch der Realität verstärkte nur ihre Hysterie.
»Es liegt nicht an dir«, beruhigte ich Roger, der belämmert dastand. So hatte er sich seine erste Begegnung mit der Frucht seiner Lenden ganz offensichtlich nicht vorgestellt.
»Woran denn?«, übertönte er Violets Lärm.
»An der fehlenden Bewegung«, erklärte ich ihm. »Sie mag das Auto, wenn der Motor unter ihr ruckelt. Sie liegt nicht gern still. Lass mich einen Moment lang mit ihr allein. Sie ist überreizt. «
Auch Nash war ein empfindliches Baby gewesen, hatte alarmiert auf jedes unerwartete Geräusch, jede Lichtveränderung oder Berührung reagiert. Bei ihm hatte nur totale sensorische Deprivation funktioniert, die schnelle Rückkehr in den Mutterleib. Jetzt, als ich im hell erleuchteten Flur von Rogers Haus stand, war selbst ich überwältigt. Die blank polierten, hellen Holzdielen reflektierten die laserdünnen Strahlen des futuristischen Kronleuchters. Auf dem Orientteppich an der mir gegenüberliegenden weißen Wand pulsierten sattes Rot und Schwarz. Aretha forderte Gehör, und der unverwechselbare Geruch von gedünsteten Zwiebeln und Knoblauch hing in der Luft.
»Bin gleich wieder da«, rief ich und verschwand im Wandschrank. Hinter der geschlossenen Tür wurden die Töne und Gerüche und die erstaunliche Beleuchtung von Rogers Welt durch weiche, dicke Wolle gedämpft. An teuren Holzbügeln hing eine ganze Reihe von Mänteln herab, in dicken, leicht muffigen Schichten. Selbst in der Dunkelheit konnte ich die Ordnung spüren. Zwischen Rogers Lebensstil und meinem lagen Welten. Bei mir hatte nicht mal Tupperware geholfen. In meinem Haus gab es keinen Wandschrank, in den Violet und ich hineingepasst hätten, schon gar nicht aufrecht stehend, ohne das Chaos durcheinander zu bringen, ohne hohe Stapel halb gelesener Zeitschriften umzustoßen oder über diverse, nicht zusammenpassende Schuhe zu stolpern. Roger wusste genau, wo sich jeder Gegenstand befand, den er besaß. War etwas kaputtgegangen, wurde es noch am gleichen Tag repariert. Unerwünschte Geschenke wurden sofort umgetauscht, alte Kleider gebündelt und von einer karitativen Organisation abgeholt, und da Roger niemals etwas aus einem Impuls heraus erstand, benutzte er auch alles, was er kaufte.
Violet beruhigte sich ganz allmählich, wie ein Drachen, der nach einem heftigen Windstoß auf die Erde zurückschwebt, und ich nutzte die Gelegenheit, um mich innerlich vorzubereiten. Dieser geschlossene Wandschrank war im Vergleich zu dem, was mich erwartete, eine Erholung. Roger hatte sein aus dem achtzehnten Jahrhundert stammendes Haus komplett renoviert, alle Zwischenwände im Erdgeschoss herausgeschlagen und ein offenes Areal geschaffen, das nur durch schulterhohe Regale und Möbelstücke unterteilt war, deren Design von allen Seiten ansprechend wirkte. Der frei stehende Herd, über dem ein Garten von Kupfertöpfen herabhing, war von überall zu sehen, und die Farbschattierungen seiner Polstermöbel, Läufer und metallgerahmten Bilder folgten, von der Vordertür zur Hintertür, dem Spektrum von dunkel nach hell. Es gab keinen Gegenstand, der einfach so herumlag, kein Buch, das nicht an seinem Platz stand. Wenn die aktuelle Ausgabe des »American Scholar«, von »Daedalus« oder »Caliban« unordentlich auf dem Glasbeistelltisch herumlag, konnte man darauf wetten, dass Roger gerade wieder ein neues Gedicht oder einen Artikel veröffentlicht hatte.
»Psst«, flüsterte ich Violet zu. »Sei nett zu Daddy. Er ist nicht an Schreihälse gewöhnt.« Ihr Gesicht war jetzt entspannter, doch immer noch misstrauisch. Eine falsche Bewegung meinerseits, eine Unterbrechung des wiegenden Rhythmus meiner Arme, und ich würde dafür bezahlen.2
Am Ende dieser Einführung in Rogers Haus wissen wir viel über den Mann. Wir erfahren auch etwas über die Erzählerin und durch ihre Reaktion auf Rogers persönliche Umgebung – sein »Platz«, wenn man so will – über die Art ihrer Beziehung. Wir können in gewisser Weise voraussagen, wie die Dinge sich für sie entwickeln werden. Wir können vermuten, wie die Dinge in der Vergangenheit gelaufen sind. Indem Dorris und Erdrich einen Schauplatz wählen, der überhaupt nicht allgemein gehalten, sondern ausgesprochen individuell gefärbt ist, erfüllen sie ihre Aufgabe leichter und besser, als wenn sie sich auf langwierige Erklärungen verlassen würden, um das zu tun, was der Schauplatz rasch erledigt.
Schließlich kann der Schauplatz auch im Kontrast zu dem Geschehen stehen, das sich dort abspielt. Dadurch verstärkt der Autor die emotionale Reaktion, die er beim Leser erzielen will. In ihrem Roman Der Beigeschmack des Todes lässt P. D. James zum Beispiel einen grausigen Doppelmord in der stillen Sakristei einer Kirche stattfinden. Zuerst beschreibt sie die Kirche durch die ehrfürchtigen Augen der älteren Frau, die gekommen ist, um in der Marienkapelle für Ordnung zu sorgen. Mit ihr betreten wir eine Welt, in die das hier nicht zu passen scheint: zwei Leichen mit durchgeschnittenen Kehlen. Und überall Blut. Eine Menge Blut.
Ähnlich kontrastiert T. Jefferson Parker seinen Schauplatz geschickt mit dem entsetzlichen Ereignis in Feuerkiller. Statt der vertrauten Elemente christlicher Andacht wie bei P. D. James wählt er etwas ganz Einfaches: die Farbe Weiß.
Der Läufer der Treppe wechselte seine Farbe von Grün zu Weiß, wo es zum zweiten Stock hinaufging. Shephard empfand einen Hauch von Leichenhaus-Atmosphäre, als er dort oben war. Das makellose Weiß war ihm einfach zu viel. Er rief noch einmal.
Die ganze Etage war ebenso geräumig wie farblos. Der weiße Teppich führte in einen großen Vorraum, dessen Wände, Möbel und selbst der Kamin alle fleckenlos weiß waren. Im Gegensatz zum Dämmerlicht im Parterre unten war dieser Vorraum durchflutet vom Licht der Sonne, das durch zwei Westfenster ungehindert einfiel, weil es keine Vorhänge gab. Auf dem Fußboden bildeten sich Rautenmuster aus Sonnenlicht auf dem Teppich. Shephard bemerkte wieder, wie seinerzeit oft als Kind, dass im direkten Sonnenschein in einem Zimmer Staubpartikelchen nach oben fliegen statt nach unten, wie man logischerweise erwarten würde. Er ging über den Teppich hinüber zu einer weißen Doppeltür am anderen Ende des Raumes. Er drückte sie auf und sah sich vor weiteren Teppichflächen, die sich bis hinein in den großen Schlafraum fortsetzten.
Shephard fand, dies sei das hellste Zimmer, das er in seinem ganzen Leben gesehen hatte. Ein cremefarbenes Kanapee stand an der linken Wand. Darüber hing ein weiß gerahmter Spiegel, der seinerseits noch mehr Weiß in den ganzen Raum spiegelte. In der Mitte stand ein überbreites Bett. Der Mangel an Farbe schien es noch mehr zu vergrößern. Shephard unterlag für einen Moment der Vorstellung, sich in einem einzigen Gips-Kabinett zu befinden. Als er seine Hand auf das Bett drückte, fühlte sich der weiche Stoff an, als passe er nicht zu alledem.
Er stand in der Tür zum Bad und blickte in sein eigenes lebensgroßes Spiegelbild. An einer verspiegelten Trennwand vorbei ging es nach rechts zu einer Toiletten-Ecke mit zwei großen Waschbecken – Armaturen aus weißem Porzellan! –, einem wandbreiten Spiegel davor, einem weißen Holzwandschrank neben dem WC und einem blitzenden Bidet. Er wandte sich zurück zur Tür, ging wieder an dem großen Eingangsspiegel vorbei und gelangte in einen ähnlichen Raum: weiße Wände, weiße Fliesen. Aber statt WC und Bidet war hier die ganze Breitwand entlang eine Badewanne, und Shephards erste Reaktion bei ihrem Anblick war: Jesus, Maria, wenigstens etwas, das nicht weiß ist.
Denn es lag etwas in der Badewanne, das unverkennbar nicht weiß war.
Er blieb an der Tür stehen und lehnte sich an die Wand und spürte, wie Schweiß in wahren Bächen aus seinen Poren schoss. Er ging hinauf ins Schlafzimmer. Dort stand er eine Weile und atmete heftig. Und dann lief sein Hirn erst einmal eine Menge Umwege. In Form von Fragen. Wann war Jane Algernon wohl erwacht? Hatte Cal sein Futter gestern Abend gefressen? Warum fliegt Staub aufwärts? Wen interessiert das? Und dann war da das Problem mit seiner Pistole. Er zog sie, steckte sie wieder ein, zog sie wieder: Irgendwie fühlte er sich besser, wenn sie in seiner Hand lag, als er zurück ins Bad ging und sich der Wanne näherte.
Der Gegenpol zu all dem Weiß hier ringsum war eine nackte Frau. Sie war von Feuer so schlimm geschwärzt, dass sie zusammengeschrumpft aussah wie eine vogelähnliche Kreatur. Ein Flugsaurier vielleicht, mit Klauen an den Enden der schwachen Flugarme, mit aufgedunsenem Hinterleib, verkürzten Hinterbeinen, die unanständig gespreizt waren und so aussahen, als könnten sie sich höchstens an einem Zweig festhalten oder sich im Flug eng an den Körper anlegen. Er erblickte ein schmales Gesicht, in dem nur noch die Augenhöhlen und der Mund erkennbar waren. Eine der winzigen Hand-Klauen war ins Ende der Zugstange eines Duschvorhangs verkrallt, die ebenfalls bis zur Mitte verkohlt war. Der Duschvorhang selbst lag zerknüllt in einem weißen Korb-Abfallbehälter.
Wer Entdeckungen solcher Art macht, ist sich immer zuerst einmal seiner eigenen Nutzlosigkeit bewusst. Und so wie er vor kurzem auf das schlafende Geheimnis der Jane Algernon hinuntergesehen und nicht gewusst hatte, was er tun sollte, blickte er jetzt auf diese tote Frau hinunter