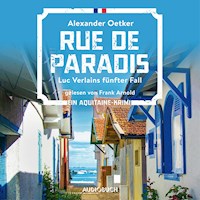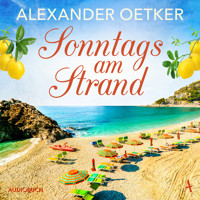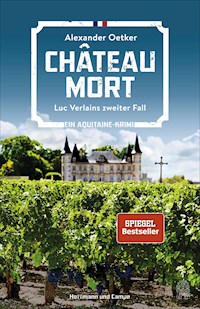Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Profilerin und die Patin
- Sprache: Deutsch
Knallharte Thriller-Kost aus Frankreich: Teil 3 der ebenso actiongeladenen wie authentischen Thriller-Reihe um die ungleichen Zwillingsschwestern Zara und Zoë, die Europol-Profilerin und die Mafia-Patin Seit dem Tod ihres Vaters hat die korsische Mafiosa Zoë endgültig alle Brücken zu ihrer Zwillingsschwester Zara abgebrochen – denn die Europol-Profilerin ist für diesen Tod verantwortlich. Als Zoë vom Oberhaupt der korsischen Mafia auf einen schwer bewachten Goldtransport angesetzt wird, scheint das ein äußerst lukrativer Job zu sein. Was die Patin nicht weiß: Ihr Boss wird vom arabischen Clanchef Shokran Al-Hamsi erpresst, dessen Bruder dank Zoë im Koma liegt. Jetzt ist Al-Hamsi mindestens so sehr auf das Leben der Mafiosa aus wie auf das Gold. Will Zoë überleben, hat sie nur eine Chance: ihre verhasste Zwillingsschwester Zara … Bestseller-Autor und Frankreich-Kenner Alexander Oetker liefert mit seiner Thriller-Reihe um die beiden verfeindeten Zwillingsschwestern neben rasanter Spannung auch immer wieder hochaktuelle Insider-Einblicke. Die Frankreich-Thriller mit Zara und Zoë sind in folgender Reihenfolge erschienen: Zara und Zoë – Rache in Marseille Zara und Zoë – Tödliche Zwillinge Zara und Zoë – Die Tochter des Paten
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexander Oetker
Zara und ZoëDie Tochter des Paten
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Seit dem Tod ihres Vaters hat die korsische Mafiosa Zoë endgültig alle Brücken zu ihrer Zwillingsschwester Zara abgebrochen – denn die Europol-Profilerin ist für diesen Tod verantwortlich. Als Zoë von ihrem Boss auf einen schwer bewachten Goldtransport angesetzt wird, scheint das ein lukrativer Job zu sein. Doch im Hintergrund zieht der arabische Clanchef Shokran Al-Hamsi die Fäden, dessen Bruder dank Zoë im Koma liegt. Jetzt ist Al-Hamsi mindestens so sehr auf das Leben der Mafiosa aus wie auf das Gold. Will Zoë überleben, hat sie nur eine Chance: ihre verhasste Zwillingsschwester Zara …
Inhaltsübersicht
Prolog
Chiara Bolatelli
Le Monde
Zoë
Zara
Maman
Navarro
Le Monde
Zoë
Bolatelli
Zoë
Rui Vicentes
Zoë
Carlos Zuffa
Zoë
Chiara
Anruf auf Mobiltelefon +3368927923
Zoë
Zara
Benito Bolatelli
Zoë
Eilig einberufene Telefonkonferenz über verschlüsselte Leitung
Zara
La Provence Onlineausgabe
Carlos Zuffa
Xavi
Navarro
Zoë
Zara
Ahmed Shalid Al-Haroun
Xavi
Isaakson
Chiara
Carlos Zuffa
Zara
Zoë
Isaakson
Zoë
Shokran Al-Hamsi
Isaakson
Anruf auf Mobiltelefon +3384629467
Chiara
Zoë
Carlos Zuffa
Anruf auf +39366046829
Shokran Al-Hamsi
Zara
Bolatelli
Navarro
Ahmed Shalid Al-Haroun
Xavi
Zara
Isaakson
Zoë
Isaakson
Zoë
Zoë
Isaakson
Zoë
Anruf auf +316423236223
Navarro
Stefan von Hardenberg
Isaakson
Docteur Giraud
Serge Clignancourt
Ahmed Shalid Al-Haroun
Shokran Al-Hamsi
Stefan von Hardenberg
Serge Clignancourt
Stefan von Hardenberg
Shokran Al-Hamsi
Ahmed Shalid Al-Haroun
Fernsehschaltung BFM TV
Zara
Le Monde
Restaurant Chez Fred, Plage de l’Estagnol, Provence, Frankreich
Prolog
Shokran Al-Hamsi
Er hasste diesen Geruch. Das altehrwürdige Schloss mitten auf dem Marktplatz an den Bergen von Cagnes-sur-Mer, das er gekauft hatte, um den Franzosen ein Schnippchen zu schlagen. Früher hatte es hier nach altem Wein gerochen oder nach dem, was sein Koch für ihn gekocht und sein Butler ihm anschließend serviert hatte. Kaviar, Hummer, Gänsestopfleber.
Nun roch es hier nach Krankenhaus. Er ekelte sich davor, er ekelte sich vor diesem Geruch, er ekelte sich davor, diese Räume nur zu betreten.
Und er hätte schwören können, dass es dem Butler genauso ging. Borniertes Arschloch in seiner livrierten Uniform. Er hätte ihn am liebsten gefeuert, doch nach französischem Recht hatte der alte Sack Kündigungsschutz. Was für ein Land.
Er stand auf dem Balkon des Schlosses, unter ihm ging es steil hinab, die Steine des Baus waren direkt mit den Felsen verbunden, die dem Ort seinen Halt gaben. Vor ihm, tief unten, breitete sich ein Abhang aus, alte Olivenbäume wechselten sich mit Palmen ab, erst weiter hinten waren wieder Häuser zu sehen, die Häuser des neu gebauten Ortsteils von Cagnes-sur-Mer, dem Teil, der direkt am Strand lag, dahinter das endlose Blau des Mittelmeers.
Vorgestern war er aus Doha kommend in Nizza gelandet. Früher hatte er es kaum abwarten können, aus der Wüste wieder ins gelobte Land zu fliegen, wo ihn alles erwartete, was er unter seinesgleichen nicht haben konnte: Koks in Hülle und Fülle, guten alten Wein, für dessen Konsum sie ihn in Katar einsperren würden – natürlich nur offiziell, inoffiziell soffen sie alle –, und die schönen Ärsche der Nordafrikaner.
Seit dem Vorfall aber zögerte er seine Reisen nach Frankreich so lange hinaus, wie es eben ging. Lieber noch ein Geschäftsmeeting in Doha, lieber noch ein verlängertes Abendessen. Doch irgendwann hatte er es nicht mehr hinauszögern können – die Geschäfte warteten –, viel mehr noch: der entscheidende Schlag gegen alles, was ihn in diese Lage versetzt hatte.
Er löste sich von diesem Anblick des Abhangs und hörte seine eigenen lauten Schritte auf dem alten Steinboden. Er ging die Treppe hinauf in die zweite Etage. Sie hatten ihn dorthin gebracht, dann musste Shokran ihn nicht so oft sehen. Leise öffnete er die gewaltige Holztür, die in ihren Angeln knarrte. Das Licht in dem Raum war schummrig. Hier roch es wie auf einer Intensivstation. Die junge schwarze Krankenschwester senkte den Kopf, als sie ihn kommen hörte. Sie suchte ihre Utensilien zusammen und ging leise aus dem Raum, ohne ihn anzusehen. So hielt sie es stets.
Er trat näher heran und kniff die Augen zusammen. Der andere, der ihm so ähnlich sah, saß in dem Bett mit den weißen Streben, eines, wie es auf allen Intensivstationen der Welt gab, ein riesiges Gestell, das mehr den Maschinen diente als dem Häufchen Mensch, das darin lag. Links neben dem Mann standen die großen weißen Apparate, die ihn am Leben erhielten. Die Bildschirme spuckten sekündlich neue Daten aus. Daten, die das Leben in kalte Zahlen pressten. Atmung, Herzschlag, Sauerstoffsättigung. Die Zahlen zeigten an, dass er funktionierte – theoretisch jedenfalls. Praktisch war er ein Toter mit offenen Augen und röchelnder Lunge. Der weiße Schlauch führte in seinen Hals und steuerte seine Atmung, der Schlauch, der in seinen Bauchraum führte und ihn ernährte, war von der Bettdecke verborgen.
»Silas«, flüsterte Shokran. Er flüsterte sonst nie, es passte nicht zu ihm. Hier aber konnte er nicht anders. Er wagte es nicht, ihn zu berühren, nicht mal an der blassen Hand, die ein Stück unter der Bettdecke hervorschaute.
»Silas«, sagte er noch einmal leise und schüttelte wieder den Kopf. »Ich werde alles tun, damit du gehen kannst. Alles. Aber diese Angsthasen hier, sie wollen dich nicht gehen lassen.« Die offenen Augen seines Zwillingsbruders zeigten keine Regung, sie waren nur starr und weit wie bei einem Fisch. Die Kugel hatte das Licht aus ihm herausgepustet, doch sie hatte nicht genau genug getroffen, um ihm auch das Leben zu nehmen. Oder – und darüber dachte er häufiger nach als ihm guttat – hatte sie genau das gewollt: Einen lebendigen Toten aus seinem Bruder zu machen?
Nur einmal in seinem Leben war Shokran Al-Hamsi bisher auf einer Intensivstation gewesen.
Damals hatte er in ein anderes Gesicht gesehen, ein Gesicht, das er vielleicht mehr geliebt hatte als dieses hier. Damals waren die Augen des Mannes geschlossen gewesen – sie sollten sich nie wieder öffnen. Die Täterin war dieselbe.
Sie würde sterben. Für damals – und für heute.
Chiara Bolatelli
Berlin-Friedrichshain, Deutschland
Die Schlange war ewig lang, sie reichte von der alten Bahnbrücke, auf der eben ein gedrungener roter Zug entlangrumpelte, an dem Cash- und Carry-Supermarkt vorbei bis zu dem riesigen Gebäude, das einem Bunker glich, einem finsteren Trutzbau mit zugemauerten und blinden Fenstern, dem man sich eigentlich gar nicht nähern mochte, hätte man nicht gewusst, was einen drinnen erwartet.
Doch Chiara war den ganzen Weg an der Schlange vorbeimarschiert. Dort vorne war der Eingang, sie ging aufrecht, zielstrebig, während die anderen mürrisch in der Kälte ausharrten. Kurz vor der Tür fing sie einen Blick auf, ein Gesicht, markant, stechend blaue Augen, volles Haar, doch sie musste sich auf ihre Füße konzentrieren, auf dem rutschigen Pflaster, und so verlor sie den Kontakt zu seinen Augen wieder, umdrehen wollte sie sich nicht mehr.
Nur schnell rein. Nicht warten. Nicht eine einzige Minute. Während die anderen Menschen zwei Stunden hier draußen standen. Es war bequem auf diese Weise. Vor allem aber, und das machte sie besonders stolz, hatte sie all das ganz allein bewerkstelligt. Hatte Freunde gefunden, die einflussreich oder wenigstens hip genug waren, dass sie sich nicht wie alle anderen in diese stundenlange Warteschlange einreihen musste, bis ihr die Füße abgefroren waren – Herrgott, das hier war Berlin und nicht die milde Côte.
Sie hatte es ohne ihren Vater geschafft, irgendwo anzukommen. Ohne seine Kontakte, ohne seinen Schutz, ohne sein Geld.
Keine Frage, sie liebte ihn – auch wenn sie ihn nicht mochte, weil er tat, was er tat. Aber sie hatte ihr ganzes Leben lang etwas ohne ihn schaffen wollen, ohne den Paten, ohne den Mann, der sie behütet, beschützt und verhätschelt hatte. Sicher, es war nicht mehr, als ohne Schlange zu stehen stehen in einen Klub zu kommen – aber hey, dies hier war immerhin der berühmteste Techno-Schuppen der Welt.
Der Türsteher mit Bart und Piercings, das Gesicht tätowiert wie ein Mann mit ernsthaften Problemen, erkannte sie schon aus der Ferne, sein von Berufs wegen finsteres Gesicht hellte sich auf, und er machte Platz, sie klatschten einander lässig ab, sie fühlte sich für einen Moment, als würde sie in Sex and the City mitspielen, dann schwang die Tür auf, und die ersten Bässe dröhnten heraus, sie trat ein, ging zur Garderobe, umarmte auch dort zwei oder drei gute Bekannte, und schon war sie drinnen, mitten im Dunkel, in der Bassmaschine, wo die Stroboskope um sie herum zuckten, als wollten sie sie verschlingen, sie gleichsam in sich aufnehmen.
Sie holte sich ein Club-Mate, der Barkeeper füllte den Wodka oben in die Flasche, alles ging aufs Haus, sie nahm das Getränk und ging auf die Tanzfläche, denn das allein war das Ziel: die Bewegung, das Vibrieren, das Sichauflösen in dieser Menge, die im Gleichklang Ekstase findet. Sie kann sich vorstellen, mit Zoë hier zu tanzen. Zoë liebt dieses Aus-seiner-Haut-fahren, dieses Sich-gehen-Lassen, niemand sieht dabei so wild und zugleich anmutig aus wie sie. Eine Stunde später ist Chiara schweißnass, ihr Trägertop klebt ihr auf der Haut, die Arme hat sie hochgereckt, den Kopf nach hinten geworfen, so tanzt sie mit geschlossenen Augen. Als sie sie wieder öffnet, steht da der Mann vor ihr, sein Lächeln mehr der Blick eines Raubtiers, doch sein Haar und seine Augen erkennt sie sofort wieder, der Blick vor der Tür, sie wusste es dort schon, unterbewusst nur, aber sie war schon vor der Tür bereit.
Sie zieht ihn heran, er greift hinter sie, legt seine Hände auf ihren Rücken, als wäre sie nackt, sie fühlt seine Kraft, sie riecht ihn, sie zieht seinen Kopf heran, die Musik wird lauter, schneller, der erste Kuss ist wie ein Knall, sie lassen einander nicht mehr los, er könnte sie zerdrücken, ohne Frage, doch sie könnte es auch, merkwürdig, sie hat noch gar nichts genommen. Sie hasst diesen Scheiß, das Kokain, sie nimmt es nur, wenn das Wochenende nicht enden soll.
Nach einer Stunde der Besinnungslosigkeit ändert sie den Plan, sie will ihn, diesen Mann, der noch nicht zwei Worte gesagt hat. Sie nimmt seine Hand, ihr Kopf macht eine Bewegung nach oben. Er nickt nicht, lässt sich einfach von ihr fortziehen. Sie holen ihre Jacke von der Garderobe, er hat nichts weiter dabei. Sie gehen in die Kälte hinaus, der Türsteher sieht ihnen nach, sie zieht ihn wieder heran und küsst ihn, zum ersten Mal in frischer Luft, zum ersten Mal unter dem Mond, sein Gesicht schimmert nun noch anziehender. Er muss frieren, denkt sie.
»Frierst du?«
Er schüttelt den Kopf. Sie gehen ein Stück, dann stoppt er und zeigt auf den Bus, der am Straßenrand parkt. Sie jauchzt auf, ein Bulli, ein alter Bus, wie die, die die Windsurfer auf Korsika haben, nur glänzt dieser hier, als sei er brandneu, dabei muss er vierzig Jahre alt sein, mindestens.
»Kannst du fahren?«
»Ich bin total nüchtern«, sagt er. »Ich wohne ganz in der Nähe.«
Ihr ist es egal, am liebsten würde sie ihn direkt in diesem Bus vögeln.
Sie steigt ein, er steht draußen, sie dankt ihm, weil sie glaubt, er wolle die Tür schließen. Das Gerät sieht sie erst eine Millisekunde, bevor es dunkel wird um sie, ein Taser, sie zuckt zusammen, die Blitze leuchten erst auf, als sie schon auf das Armaturenbrett sackt.
Carlos Zuffa setzt sie aufrecht und schnallt sie an, dann steigt er auf der Fahrerseite ein und fährt los, hinein in die Nacht. Das Adlergestell, eine der wichtigsten Ausfallstraßen Berlins, ist gänzlich leer, hier könnte noch eine Polizeikontrolle lauern, aber er erreicht die Stadtautobahn, nimmt den Ring um die Stadt und biegt dann auf die Autobahn gen Süden. Auf dem ersten menschenleeren Parkplatz steigt er aus und trägt sie in den Kofferraum, dort verschnürt er sie und verklebt ihr den Mund. Er will seine Ruhe haben, es wird eine lange Fahrt.
Er setzt sich wieder hinter das Lenkrad, trinkt noch einen Red Bull und schaltet die CD ein. The xx dringt aus den Lautsprechern, das Gitarrenriff und die Drum Machine werden verhindern, dass er einschläft.
Le Monde
von Christian Latour, Paris
mit AFP.
Die Lage des französischen Staatshaushalts ist besorgniserregend – erst recht, seit die Rentenreform des Präsidenten durch die anhaltenden Proteste der Gelbwesten und der Gewerkschaften ins Stocken geraten ist.
Deshalb erwägt der Finanzminister nun einen ganz und gar ungewöhnlichen Schritt: Er will Teile der französischen Goldreserve verkaufen. Informanten unserer Zeitung sprechen von einem Anteil bis zu 0,5 Prozent der gesamten Reserve.
Erstmals soll dabei ein privater Käufer zum Zuge kommen. Die Banque de France und das Finanzministerium hüllen sich in Schweigen, doch Gerüchten zufolge könnten die Interessenten vom Golf stammen. Besonders Scheichs aus Katar engagieren sich seit Längerem in Frankreich, der Hauptstadt-Fußballklub Paris Saint-Germain ist seit 2011 in der Hand einer katarischen Investorengruppe.
Allein aus Sicherheitsgründen wird sicher erst nach dem Verkauf bekannt gegeben, wer den Zuschlag erhalten hat.
Schon einmal, im Jahr 2004, entschied der damalige Wirtschaftsminister Nicolas Sarkozy, dass im Zeitraum von 2004 bis 200920 Prozent der nationalen Goldreserve verkauft würden. Damals war der Goldpreis auf einem Tiefstand. Im Zuge der Finanzkrise stieg der Wert wieder, doch die Verkaufspreise des Staates waren bereits fixiert. So erzielte Frankreich bei diesem Verkauf einen Verlust von über zehn Milliarden Euro.
Diesmal soll sich dieses Debakel nicht wiederholen – der Verkauf findet bei einem absoluten Höchststand des Goldpreises statt: Für die Goldbarren mit einem Gewicht von 15 Tonnen kann der Finanzminister einen Erlös von einer halben Milliarde Euro erzielen.
Zoë
Via del Mercato, Ventimiglia, Italien
Sie hatte wahnsinnig lange geschlafen. Endlich ging das wieder. Nach der Beerdigung ihres Vaters war sie sofort in ein Flugzeug gestiegen und nach Vietnam gereist. Doch in dem buddhistischen Kloster im Schatten des Fansipan-Berges hatte sie nicht die Ruhe gefunden, die sie gesucht hatte. Das war, ehrlich gesagt, eine ziemliche Untertreibung. Sie hatte sechs Tage am Stück nicht geschlafen, weil sie nicht aufhören konnte zu hassen. Schließlich, als sie dachte, sie würde verrückt, fuhr sie nach Hanoi und stieg ins Flugzeug nach Hause. Sie konnte nicht gut weglaufen. Das war ihr noch nie gelungen.
Auch in Vietnam war sie eine Woche wie eine lebende Leiche durch die Straßen gelaufen, die Augen hinter ihrer Sonnenbrille verborgen. Die Sonne war keine Wohltat wie sonst, sondern sie brannte, verhöhnte sie mit der Lebensfreude, die sie in diesen Frühlingstagen verbreitete.
Doch dann hatte sie sich dem Schmerz gestellt, war hinaufgefahren nach Èze und hatte sein Grab besucht. Der Name auf dem Stein – in diesem Moment erst hatte sie es verstanden. Den Verlust begriffen. Seinen Namen gegen den Wind gerufen, hier oben auf dem Berg, unter ihr das Panorama des glitzernden Mittelmeeres. Und endlich hatte sie geweint.
In dieser Nacht hatte sie zum ersten Mal wieder geschlafen. Ihr Leben hatte einen Rhythmus aufgenommen, einen langsamen Rhythmus, viel langsamer als vorher. Sie hatte keine Aufträge angenommen, hatte ihr Handy ausgeschaltet, hatte keine Nachrichten mehr empfangen.
Sie wollte einfach nur sein: Hier, in dieser kleinen Stadt im Schatten der Seealpen, den Kieselstrand zu ihren Füßen, die alten italienischen Bauten, deren Fenster zum Meer hinaus gingen, die kleinen Restaurants mit ihrer günstigen Pasta und ihre kleine Bar, die den besten Espresso der Welt servierte. Nach Wochen hatte sie zum ersten Mal wieder gelächelt.
Sie war allein. Und genoss es. Ab und zu ging sie zu Gianluca in seine Wohnung, schlief mit ihm, dann ging sie wieder. Er drängte sie nicht, als spürte er, dass sie dann für immer gehen würde.
Sie betrat die Markthalle, dieses alte Ungetüm aus schweren Stahlbalken, die als Dachstreben dienten, der Putz bröckelte von den Wänden. Doch was die Händler auf ihren Tischen aufgebaut hatten, ließ ihr Herz jedes Mal höherschlagen. Sie kochte jeden Tag, kaufte sich die besten Produkte, Fisch, Fleisch, Meeresfrüchte, frisches Gemüse – und stand dann stundenlang am Herd, trank eine Flasche Rotwein allein – und dachte dabei an ihren Vater, der nichts so geliebt hatte wie gutes Essen.
Sie begrüßte den Fischhändler und betrachtete die Goldbrassen und Wolfsbarsche, doch heute wollte sie ein vegetarisches Risotto kochen, so hatte sie entschieden.
»Domani«, sagte sie ihm. Morgen. Der alte Mann mit der weißen Schürze lachte und griff nach einem pulpo, um ihn der nächsten Kundschaft anzupreisen.
Sie zog weiter, vorbei an der macelleria, hinter deren Glasscheibe verführerische Steaks lagen und herrliche Koteletts. Aber dann: sechs, sieben Stände mit Obst und Gemüse, deren Auslagen um die Wette strahlten: dunkelrote Tomaten, sattgelbe Paprika, lila Artischocken und hellgrüne Wassermelonen – es war ein Fest. Sie beugte sich hinab, um an einem Korb mit Austernseitlingen zu riechen, die würde sie nehmen für ihr Risotto.
»Hundert Gramm davon, bitte«, sagte sie zu der jungen Frau mit den langen dunklen Haaren. Die wog die Pilze ab und verstaute sie in einer Papiertüte, Zoë zahlte, nahm die Tüte und ging weiter. Nur noch den parmigiano, dachte sie und strebte dem Käsehändler entgegen, der seine Waren am Ausgang der Halle feilbot, als sie erst das Geräusch hörte und dann das Raunen, das durch die Reihen der Händler lief. Sie alle sahen nach oben, doch da war nichts weiter als das geschlossene Dach. Wo kam der Lärm denn her? Ein Knattern, ohrenbetäubend, sie erkannte es sofort. Rotorblätter, ein Helikopter, er musste sehr nah sein und sehr tief fliegen. Ein Helikopter, mitten im Zentrum von Ventimiglia? Sie straffte sich, ihre Hand fuhr in den Hosenbund, wo der kleine Revolver steckte, den sie beim Einkaufen stets mit sich führte, die Beretta war für diese Gelegenheiten einfach zu schwer und auffällig. Sie wandte sich schnell um, suchte die Ausgänge ab. Hatten sie sie gefunden? Wer sollte es sonst sein, wenn nicht die Polizei?
Gianluca hatte nichts gesagt – aber würden sie einem einfachen Carabinieri sagen, dass sie die meistgesuchte Verbrecherin des Nachbarlandes enttarnt hatten? Sicher nicht.
Sie nahm den Ausgang, am Käsehändler vorbei, bog in die Via Roma und erschrak: Der Helikopter setzte in diesem Moment auf, mitten auf dem Parkplatz vor der Polizia di Stato, neben dem Rathaus, keine fünfzig Meter von ihr entfernt. Die Rotoren ließen Sand auffliegen, altes Papier sauste durch die Luft. Unwillkürlich senkte Zoë den Kopf, weil der Staub in ihre Augen wehte. Sie verbarg sich hinter der Häuserecke, neben ihr standen die Italiener und starrten das Flugobjekt an. Sie sah genauer hin, die Hand immer noch an der Waffe. Es war kein Polizeihubschrauber, kein beschrifteter jedenfalls, vielleicht ein ziviler. Geheimdienst? Spezialeinheit? Wer würde sonst auf dem Parkplatz der Polizei landen?
Die Tür wurde aufgeschoben, und ein Mann stieg aus, in schwarzem Anzug, die Augen hinter einer Fliegerbrille verborgen. Sie stockte und konnte den Blick nicht von ihm lösen.
Wie konnte das sein? Sie sah sich um, da, dort hinten, da stand ein anderer Mann, Lederjacke, weißes T-Shirt, den Blick fest auf sie gerichtet. Sie war zu leichtsinnig geworden. Verdammt. Wenn sie sie gefunden hatten, hätten auch die Bullen sie finden können.
Der Mann im Anzug ging auf sie zu, sie hatten jeden ihrer Schritte verfolgt. Er blieb vor ihr stehen, sie konnte seine Augen nicht sehen, er sah aus, als würde er lächeln, sein Anzug hatte keine einzige Falte, er schwitzte nicht, wahrscheinlich empfand er gar nichts.
»Mademoiselle, würden Sie mich bitte begleiten? Er will Sie sehen.«
»Ich will aber ihn nicht sehen«, antwortete sie.
Normalerweise hätte er sie gepackt und mitgeschleift – oder sie direkt hier erschossen. Doch der Mann nahm seine Brille ab, die dunkelbraunen Augen blickten sie bittend an, und nun merkte sie, wie müde er aussah, gräuliche Augenringe auf dunklem, von der korsischen Sonne verbranntem Teint.
»Es geht nicht um einen Auftrag«, sagte der Mann. »Es ist wirklich dringend. Es geht um seine Familie. Bitte, kommen Sie.«
Sie überlegte nicht lange, nickte nur. Er ging los, sie folgte ihm, der Helikopter hatte die Rotoren nicht ausgeschaltet. Sie bückten sich, je näher sie kamen, um dem Sog zu entgehen. Zoë wusste, dass die halbe Stadt ihnen nachsah, sie würde sich hier nicht mehr blicken lassen können. Er stieg ein, sie kletterte ihm nach und nahm neben ihm an der Tür Platz. Die Schiebetür wurde von außen von dem Mann in der Lederjacke zugedrückt, er würde hierbleiben, dachte sie. Nur ein paar Sekunden, dann wurde das Geräusch noch lauter, und der Helikopter hob ab. Der Parkplatz, die Markthalle, der Fluss, die alte Kirche auf dem Berg, Gianlucas Wohnung, mehr und mehr sah sie von Ventimiglia von oben, ein herrlicher Ausblick, den sie so noch nie gehabt hatte, dann beschrieb der Hubschrauber eine Kurve und flog übers Meer gen Süden. Südwesten. Sie hatte keinen Zweifel, wohin er fliegen würde.
»Was haben Sie in der Tüte?«, fragte der Mann im Anzug, die Sonnenbrille hatte er wieder aufgesetzt.
»Austernpilze«, sagte sie und betrachtete die Papiertüte, als könne sie es selbst nicht glauben. Sie hatte sie ganz vergessen.
»Lecker«, sagte der Mann.
Sie flogen nicht zu hoch, sie konnte die Wellen unter sich erkennen, ein weißes Segelboot, das Richtung San Remo kreuzte. Sie hielten sich am Küstenstreifen, sie konnte den Grenzübergang nach Menton erkennen, nun waren sie in Frankreich.
Sie dachte, dass sich der Fischhändler morgen wundern würde, weil sie nicht auftauchte.
Zara
Restaurant Chez Fred, Plage de l’Estagnol, Bormes-les-Mimosas, Provence, Frankreich
Der Hubschrauber flog so tief und war so laut, dass die Zikaden für einen Moment verstummten – vielleicht waren sie auch einfach nicht mehr zu hören. Genau hinter der Düne hielt er sich über dem Strand, bevor er eine Kurve beschrieb und sich gen Süden wandte.
Sie sah diesem schwarzen Ungetüm lange nach. Nirgendwo hatte sie eine Registriernummer erkennen können, was merkwürdig war. Aber sie dachte nicht weiter daran.
Sie sah wieder auf ihren Tisch, auf den leeren Teller, die leere Wasserkaraffe. Es war das Abschiedsmahl gewesen, noch einmal die Spezialität des Hauses: Eine riesige Languste, einem Hummer ähnlich und noch besser in der Qualität, dazu eine Krustentier-Velouté und al dente gegarte Spaghetti. Es war ein Festmahl gewesen. Sie stand auf und ging zu der Bar. Es wurde Zeit für den Abschied. Ihr Flug ging in drei Stunden von Nizza.
Sie war drei Tage hier gewesen. Sie vermisste Stefan und ihre Tochter, Amélie.
»Maman«, sagte sie, »ich muss langsam los.«
Ihre Mutter wusch gerade Gläser ab, hinter dem Tresen in der Holzhütte, nebenan brutzelten die Grillmeister am offenen Feuer, auf dem Steaks lagen, diese riesigen Côtes de Bœuf, außerdem Doraden neben den Langusten, von denen sie eben eine verspeist hatte. Alles wurde hier auf dem Holzfeuer gegrillt.
»Es war so schön, dass du hier warst. Ich glaube, Papa ist sehr glücklich, wenn er spürt, dass du mir geholfen hast.«
Sie wischte sich rasch über die Augen, doch Zara hatte die Tränen gesehen.
»Wirst du hier klarkommen?«
»Na hör mal, ich bin ja wohl ein echter Gastronomieprofi«, sagte ihre Mutter entrüstet. »Aber im Ernst: Dein Vater hat hier so ein tolles Team aufgebaut, das wird ein Kinderspiel. Ich freue mich sehr auf die Saison.«
Ihre Mutter hatte nicht gezögert. In den Wochen, nachdem Papa erschossen worden war, stand das Restaurant am Strand – sein Restaurant – vor einer ungewissen Zukunft. Maman hatte sie zwei Wochen nach ihrer gemeinsamen Rückkehr nach Berlin zur Seite genommen. »Ich muss das machen«, hatte sie erklärt. »Natürlich werde ich euch vermissen. Besonders die Kleine. Aber es gibt keine andere Option. Ich muss das tun. Für ihn. Und außerdem weißt du, wie sehr ich das Meer und das Licht vermisst habe.«
Zara hatte nicht versucht, sie aufzuhalten. Also hatte ihre Mutter den kleinen Koffer gepackt, den sie damals genommen hatte, um vor ihrem Mann zu fliehen, hatte sich in den Flieger nach Nizza gesetzt und kurzerhand das Restaurant in der Provence übernommen. Nun hatte Zara sie zum ersten Mal besucht und gesehen, dass alles perfekt zusammenpasste: Maman war eine genauso gute Gastgeberin, wie es ihr Mann gewesen war. Zara hatte sie beobachtet, wie sie von den Köchen das richtige Anrichten der Teller lernte, wie sie sich mit Winzern traf, um den perfekten Rosé für den Sommer auszusuchen, wie sie die alten Stammgäste in Empfang nahm und all die Beileidsbekundungen mit unerschütterlicher Freundlichkeit ertrug. Sie blühte auf, es war nicht zu übersehen. Zara hatte ihr bei den betriebswirtschaftlichen Aspekten geholfen, nachdem sie sich die Bücher angesehen hatte. Kein Zweifel, ihr Vater hatte das alte Verbrecher-Gen längst abgelegt. Die Bücher waren picobello geführt, er zahlte seine Steuern, das Geschäft lief so gut, dass er jedes Jahr reichlich Gewinn gemacht hatte. Und nun war Maman die neue Chefin.
»Ich gehe noch mal kurz an den Strand.«
Ihre Mutter lächelte sanft.
»Genieß es.«
Das Restaurant hatte bis zu dem plötzlichen Tod ihres Vaters Zaras Namen und den ihrer Schwester getragen. Maman hatte den Namen sofort geändert – in Gedenken an Fred. Es lag in einem großen Pinienwald genau an der Düne: Ein Strandbistro, das nur im Sommer geöffnet war, Ende Oktober wurde alles zusammengeklappt und in einem Container verstaut, nun aber war es die pure Idylle: aus gelb bespannten Stühlen an Holztischen unter blauen Sonnenschirmen. Die Gutbetuchten kamen aus Toulon, aus Hyères, sogar aus Nizza und Marseille, um die Spezialitäten des Hauses zu genießen. Und der Clou: Einer der schönsten Strände der Côte d’Azur lag direkt hinter der Düne. Sie musste nur eine kleine, über einen Holzbohlenweg erreichbare Anhöhe hinauf, schon erstreckte sich vor ihr die sichelförmige Bucht, die ihr jedes Mal den Atem stocken ließ vor Schönheit.
Der Sand war so weiß wie auf den Malediven, und der Kontrast war enorm: zu dem hellblauen Wasser des Mittelmeeres, das hier so warm war wie selten sonst an dieser Küste, weil die Bucht durch einige vorgelagerte Inseln und ihre spezielle Form besonders geschützt lag. Noch war der Strand ziemlich leer, für die Bewohner der Provence war es längst noch keine Badezeit. Doch im Sommer würde sich hier Sonnenschirm an Sonnenschirm reihen, dann wäre es ein buntes Panoptikum, eine Mischung aus Einheimischen und Urlaubern, und ein bunter Mischmasch aus Gesprächen und Kinderjauchzen würde über der Bucht liegen. Sie ging ein Stück die Düne entlang und zog dann ihre Ballerinas aus, um mit ihren Füßen den Sand zu spüren. Er war erstaunlich kalt. Sie beobachtete die Segelboote und eine kleine Motorjacht, die in der Bucht vor Anker lagen. Die hohen Mittelmeerkiefern am Rande der Bucht bildeten das i-Tüpfelchen auf diesem Panorama.
Sie war noch nicht oft hier gewesen. Viel zu spät hatte sie herausgefunden, dass Zoë dieses Bistro für ihren Vater gekauft hatte. Doch seit diesem ersten Tag, vor etwas mehr als einem Jahr, als sie über die Düne getreten war, hatte sie gespürt, dass hier nun ein kleines Stück Heimat lag. Sie hatte bisher nichts von diesen Begriffen gehalten. Sie hatte keine Heimat gehabt, nie. Nicht den schäbigen Wohnblock in Nizza-Nord, nicht die Universitäten in fernen Ländern, nicht einmal die schicke Altbauwohnung im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg.
Die Heimat war in ihrem Kopf. Dort, wo sie ruhig in ihrem Geiste war. Wenn sie mit Amélie zusammen war, mit Stefan und ihrer Maman. Und nun auch hier, an diesem Strand in der Provence.
Daran hatten die schrecklichen Ereignisse vor wenigen Monaten nichts geändert. Es war hier passiert, an Freds liebstem Ort. Und beide Schwestern waren dabei gewesen.
Zoë schob sich in Zaras Gedankenwelt.
Sie hatte nichts mehr von ihr gehört.
Sie wusste, die Funkstille rührte daher, dass ihre Zwillingsschwester auf der Skala ihrer emotionalen Reaktion auf den Tod des Vaters noch nicht alle Stufen der Trauer durchlaufen hatte.
Das Leugnen war zwar nicht möglich gewesen, es war schlicht nicht möglich, den Tod zu leugnen, wenn er als Kugel in den Kopf des eigenen Vaters drang und das Blut über den trockenen, sandigen Boden lief.
Aber da war die Wut. Ja, Zoë war sehr wütend, es lag in ihrer Natur, sie war schon immer voller Wut gewesen. Doch nun richtete sich der Hass wieder auf Zara, und sie hätte sich nicht gewundert, wenn Zoë ihr die Schuld an seinem Tod gab.
Und das Verhandeln. Zara hatte gehört, dass Zoë auf dem Friedhof in Èze gewesen war. Maman hatte sie dort gesehen, aber sie hatte sich hinter einem Stein verborgen. Sie wollte nicht, dass Zoë sich ertappt fühlte.
Und die Depression. War Zoë traurig? Sicher, es wäre eine ganz normale Sache. Trotzdem fiel es Zara schwer, sich Zoë anders vorzustellen als nur wütend.
Und schließlich die Akzeptanz: Erst, wenn Zoë den Tod akzeptiert hätte, ihn als unumkehrbar hinnehmen würde, erst dann würde sie Zara vergeben können.
Aber so weit war es lange noch nicht.
Zara wandte den Blick schnell von dem Paradies zu ihren Füßen ab und ging zurück über die Düne.
Maman
Restaurant Chez Fred, Plage de l’Estagnol, Bormes-les-Mimosas, Provence, Frankreich
Sie gab ihr die Hand, weil sie wusste, dass sie keine Umarmung zulassen würde. Das hatte sich nicht verändert, nicht in den langen Jahren im kalten Berlin und nicht am tragischsten aller Tage, hier auf diesem schönsten Flecken Erde.
Zara nahm ihre kleine Reisetasche und ging von dannen, ohne sich umzudrehen. Sie würde auf dem Parkplatz in ihr gemietetes Auto steigen und zum Flughafen fahren – und dann wäre sie wieder in ihrer Welt der Polizisten und Terroristen, der Bombenanschläge und Tarnungen.
Sie würde diesen Ort nicht vermissen. Gewiss nicht. Sie vermisste nichts, wenn sie zu tun hatte und in ihrer Welt war.
Wie eigentümlich diese junge Frau doch war.
Sie trat aus der Bar und ging hinüber zur Küche, die direkt neben dem Grill stand. Christelle, eine alte Frau aus Bormes-les-Mimosas, war dabei, die Nudeln für die Langusten zu kochen. Hier war sie am liebsten, weil sie das Kochen liebte – und am besten vergessen konnte. Sie nahm sich ein großes Brett und begann, das rohe Gemüse zu schneiden. Die Paprika, den Blumenkohl, den Staudensellerie, die Radieschen, die Gurken. Alles zusammen würde nachher mit grünem und rotem Salat auf einer großen Platte serviert werden, in der Mitte eine Schale der unnachahmlichen Anchoïade provençale, einer Paste, die eigentlich nur aus Sardellen und Knoblauch bestand und von den Gästen des Restaurants Chez Fred als Vorspeise geliebt wurde.
Hatte Fred diese Vorspeise auch so geliebt? Oder hatte er die Spaghetti mit den Langusten vorgezogen? Wenn sie sich an den Mann erinnerte, mit dem sie Jahre in der kleinen Wohnung in dem maroden Wohnblock in Nizza gelebt hatte, hätte sie schwören können, dass er die riesigen Steaks vorgezogen hätte, die hier als Côtes de Bœuf auf Holzkohle kross gegrillt wurden. Doch alles, was sie hier vorgefunden hatte, bewies ihr: Sie kannte diesen Mann nicht mehr, diesen Fred, der eben nicht mehr der Verbrecher von damals gewesen war, sondern ein respektierter und respektabler Gastgeber, ein Geschäftsmann, gar ein Mann von Welt.
Deshalb könnte es auch gut sein, dass es genau diese Vorspeise aus Gemüse war, die er am meisten geliebt hatte.
Sie würde es sich nie verzeihen, dass sie nicht früher in den Süden gereist war. Um ihn wiederzusehen.
Sie hätte ihn in diesem Restaurant treffen können. Mit ihm hier arbeiten. Die Gäste begrüßen. Am Abend am Strand sitzen und ein Glas Wein trinken, wenn die Besucher alle gegangen waren.
Sie hätte sich neu in ihn verliebt. Keine Frage.
Jetzt war es zu spät.
Sie hatte Zoë auf dem Friedhof von Èze getroffen, vor einigen Wochen. Sie war gekommen, um Blumen zu bringen, doch am Eingangstor war ihr Blick zu Freds Grab gewandert. Dort hatte Zoë gekniet. Sie hatte sich verborgen und ihre Tochter beobachtet. Die Tränen waren aus deren Augen geflossen wie ein steter Strom, sie waren auf den Boden gefallen, während sie geschluchzt, geweint, geschrien hatte.
Sie war nicht zu ihr gegangen. Sie hatte sich schlicht nicht getraut. Sie hatte Zoë verraten. Und Fred.
Sie hatte Zara nichts von Zoës Tränen erzählt. Ihre Zwillingsschwester hätte es nicht verstanden. Sie hatte Zara nach dem Mord an Fred nicht weinen sehen. Hatte sie sie jemals weinen sehen?
Navarro
Hôtel de Police, 2 Rue Antoine Becker, Marseille, Frankreich
Ich wünsche dir einen schönen Tag, chéri«, sagte Isabel und gab ihm einen langen Kuss.
Die kleine Sophie saß auf der Rückbank und verzog das Gesicht. »Hört auf damit«, quengelte sie, aber gleich darauf grinste sie. Er stieg aus und öffnete ihre Tür, um sich auch von ihr zu verabschieden.
»Ich würde Bouillabaisse zum Diner machen, einverstanden?«
»Du würdest mich zum glücklichsten Mann der Welt machen«, sagte er durch das offene Beifahrerfenster.
»Das bist du doch eh schon, du hast uns zurück«, rief sie lachend, ehe sie den Motor aufheulen ließ und davonbrauste.
Es stimmte, er war der glücklichste Mann der Welt.
Vor drei Monaten noch hatte er in seiner Einzelzelle im Gefängnis von Toulon gesessen. Verhaftet wegen schwerer Körperverletzung oder versuchten Mordes, der genaue Tatvorwurf war vom procureur noch nicht näher definiert worden. Nach acht schlaflosen Nächten hatte er eines Morgens seinen Wärter gebeten, ihn in die Kapelle zu bringen.
Kapelle, Moschee, Tempel, der Raum war alles in einem. Ein karges Kämmerlein mit einem Kreuz an der Wand, die für die Christen gedacht war.
Er hatte niedergekniet und gebetet. Er erinnerte sich ganz genau an seine Worte, wie eingebrannt hingen sie in seinem Hirn.
»Ich bin ganz unten, Herr, ganz unten. Es gibt keinen Ausweg mehr. Ich habe keine Kraft und keine Hoffnung. Ich bitte dich. Sende mir nur ein Zeichen, dass ich nicht aufhören darf. Bitte. Nur ein Zeichen.«
Am nächsten Tag hatte sein Anwalt an die Zellentür geklopft, das Hab und Gut von Navarro hatte er schon aus dem Safe geholt und in einer Tasche dabei.
»Wir gehen«, hatte er gesagt. »Der Staatsanwalt hat die Klage fallen gelassen. Shokran Al-Hamsi hat Ihre Aussage bestätigt, wonach ein anderer Mann auf seinen Bruder geschossen hat.«
Navarro war sprachlos gewesen. Er hatte sich aufgerichtet, in einem Moment ein kleines Häufchen Elend, im nächsten ein freier Mann.
Der Anwalt hatte ihn in dem kleinen Fischerort Les Goudes vor den Toren Marseilles herausgelassen, gerade, als die Sonne über der Île Maïre unterging. Navarro hatte sich die Tränen weggewischt, die er vor Rührung vergossen hatte. Dann hatte er leise angefangen, vor sich hin zu pfeifen.
Am nächsten Tag hatte er sich in den Zug gesetzt und war nach Paris gefahren. 3 Rue de Sèvres. Er hatte vor ihrer Wohnung gewartet, bis Isabel am Abend von der Arbeit gekommen war. Er hatte gedacht, sie würde ihn davonjagen, aber sie war ganz sanft gewesen, hatte ihn hereingebeten. Sie bräuchte Zeit, hatte sie gesagt. Aber ja, sie denke an ihn. Viel sogar.
Er hatte kurz mit Sophie spielen dürfen. Dann bat Isabel ihn, zurückzufahren, zurück nach Marseille. Er dürfe sie nicht drängen, sie würde sich melden.
Im Auto dachte er, er würde wieder nächtelang nicht schlafen können, das Damoklesschwert der endgültigen Trennung über ihm. Doch er schlief – voll von innerem Frieden und Zuversicht. Und er war gar nicht wirklich verwundert, als es drei Tage später vor seiner Cabane hupte. Isabel war schon ausgestiegen, die kleine Sophie rannte auf ihn zu. Neben dem Auto standen vier große Koffer. Sie waren zurück.
Seit diesem Tag, vor zwei Monaten, lebten sie wieder zusammen, in der kleinen Hütte am Hafen, die Navarro erst nach der Trennung für einen Schnäppchenpreis gekauft hatte – in dem Glauben, er würde hier alleine leben. Bis zu seinem unseligen Ende.