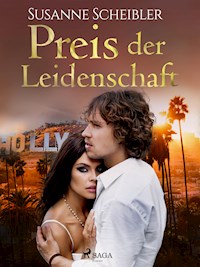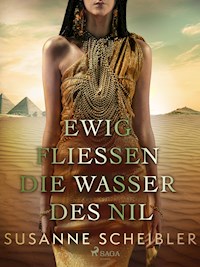Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Avignon im 14. Jahrhundert. Das Findelkind Isabelle wurde vor einem Kloster abgelegt und von Nonnen großgezogen, doch man munkelt, Isabelle sei von edler Herkunft. Ihren kargen Lebensunterhalt verdient das schöne Mädchen in einer Herberge. Doch eine folgenschwere Begegnung mit der Herzogin von Valence ändert Isabelles Schicksal schlagartig... -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Susanne Scheibler
Zauberhafte Isabelle
Roman
Saga
Zauberhafte Isabelle
Zauberhafte Isabelle
Copyright © 2021 by Michael Klumb
vertreten durch die AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de)
Die Originalausgabe ist 1989 im Goldmann Verlag erschienen
Coverbild/Illustration: Shutterstock, common media
Copyright © 1989, 2021 Susanne Scheibler und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726961263
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
1
Die Kutsche rumpelte über den ausgefahrenen Weg. Es war rasch dunkel geworden. Ein leichter Wind trieb ein paar Wolken über den Himmel. Im Wageninneren war es heiß und stickig. Gilberte hätte gern ein wenig frische Luft hereingelassen. Aber dann würde die Herzogin erwachen, und im Augenblick war Gilberte froh, daß ihre Herrin schlief und sich nicht mit ihr unterhalten wollte.
Gilberte fand es schöner, still dazusitzen und an Paris zurückzudenken. An das Leben am Hofe König Karls IV., die Feste und Turniere und die prächtigen Säle des königlichen Palastes. Ein Jammer, daß diese Zeit vorüber war und man nun nach Schloß Beaumont zurückkehrte, wo die Tage so träge und monoton dahinflossen. Wenigstens empfand es Gilbertes neunzehnjährige Jugend so.
Der Kutscher ließ ein paarmal seine Peitsche über die vier Pferderücken sausen. Außer ihm saßen noch zwei Männer auf dem Bock, kräftige Gestalten in weiten Mänteln, die Gesichter braungebrannt. Sie gehörten zu den insgesamt zehn Bogenschützen, die die Herzogin nach Paris begleitet hatten. Die anderen waren heute morgen mit dem übrigen Gefolge nach Beaumont vorausgeritten, um die Ankunft Johanna von Valances zu melden.
Die Kutsche schwankte nun einen Hohlweg hinunter. Jeannot stieß plötzlich einen zornigen Fluch aus. Die Pferde wieherten und versuchten, zur Seite auszubrechen.
Die Herzogin schreckte aus dem Schlaf hoch. »Was ist los?«
Im gleichen Augenblick ging ein harter Ruck durch das Gefährt, und es legte sich schräg auf die Seite. Knirschend brach ein Rad. Jemand schrie: »Herunter vom Kutschbock, aber schnell, wenn euch euer Leben lieb ist!«
»O Madame«, flüsterte Gilberte zitternd. »Ein Überfall! Das sind Banditen!«
Johanna von Valance blickte aus dem Fenster. Sie gewahrte sechs, nein, acht schattenhafte Gestalten, die aus dem dichten Strauchwerk zu beiden Seiten auf die Straße sprangen. Quer über dem Weg lag ein Baumstamm. Der Kutscher Jeannot kletterte als erster vom Bock. Einer der Banditen versetzte ihm einen Faustschlag. Jeannot taumelte zur Seite. Er hatte noch seine Peitsche in der Hand und hob sie, um seinem Angreifer einen Schlag zu versetzen. Ein anderer fiel Jeannot in den Arm. Eine stählerne Klinge blitzte auf, dann stieß Jeannot einen gurgelnden Schrei aus und stürzte.
Das Folgende ging sehr rasch. Die acht Banditen fielen über die beiden Bogenschützen her. Es gab ein wildes Handgemenge. Die Leute der Herzogin wehrten sich wakker, aber die Übermacht war zu groß. Robert fiel als erster, ein Messer zwischen den Rippen. Dann warf Bastien plötzlich die Arme hoch. Er versuchte vergeblich, auf den Füßen zu bleiben, und brach zusammen.
Gilberte schrie gellend auf, als nun die Tür der Kutsche aufgerissen wurde und rohe Männerfäuste sie ins Freie zerrten. Die Wolken hatten den Mond freigegeben. Sein Licht beschien die drei Toten, die auf dem Boden lagen. Zwei der Banditen waren gleichfalls verletzt worden. Einer blutete aus einer Wunde am Arm, der andere lehnte abseits an einem Baumstamm und hielt sich stöhnend die Seite.
Alle acht waren verwegen aussehende Gestalten in abgerissener Kleidung. Ihre Gesichter waren maskiert.
Die Herzogin war ebenfalls aus der Kutsche geholt worden. Jemand hatte ihr die Haube heruntergerissen. Zwei andere nahmen ihr johlend den Schmuck ab: die Ringe, den goldenen Gürtel, der mit Edelsteinen besetzt war, die Ohrgehänge und Ketten. Sogar die perlenverzierten Diamantagraffen an den Schuhen wanderten in die Taschen der Straßenräuber. Ein Bandit mit braunem Lederkoller und einem großen schwarzen Schlapphut spannte die Pferde aus. Aus der Kutsche wurde die Truhe mit den Kleidern geholt und die Schatulle, in der die Herzogin Geld und noch mehr Schmuck aufbewahrte.
»Los, zieh das aus«, befahl einer der Banditen und griff nach Gilbertes blauem Kleid. Sie wehrte sich, und der dünne Stoff zerriß unter den rohen Fäusten.
Die Männer lachten. »Seht euch mal die Kleine an. Ein niedlicher Happen!«
Gilberte wollte davonlaufen, aber ein großer Mann mit halblangen schwarzen Haaren hielt sie fest. Seine Augen funkelten unter den schmalen Schlitzen der Larve. »Hier geblieben, mein Täubchen! So was wie dich hat mir gerade noch gefehlt!«
Angstvoll versuchte sie, seinen frechen Händen auszuweichen. Da tauchte der Bandit mit dem Lederkoller auf, der zuvor die Pferde ausgespannt hatte. Er riß Gilbertes Angreifer zurück. »Dafür haben wir keine Zeit. Los jetzt!« Seine Stimme klang befehlsgewohnt. Offenbar war er der Anführer der Bande.
Der Schwarzhaarige murrte: »Wir können sie doch mitnehmen. Und die Alte auch. Vielleicht gibt’s noch ein zusätzliches Lösegeld. Sie soll doch eine Herzogin sein. Ich habe gehört, wie du gestern mit Grand Jacques darüber . . .«
Weiter kam er nicht. Der Mann mit dem Lederkoller versetzte ihm eine gewaltige Ohrfeige. »Lösegeld? Genauso gut können uns auch die Soldaten des Königs wie die Hasen jagen und am nächsten Baum aufknüpfen. Wir verschwinden, habe ich gesagt!«
Und sie verschwanden tatsächlich. Sie nahmen die Pferde mit, den Schmuck, das Geld – alles, was nur irgendwie von Wert erschien, selbst die Überkleider der Herzogin. Johanna von Valance hatte zwar heftig protestiert, als sie sich ihres mit Perlen und Goldfäden bestickten Gewandes aus schilfgrüner Lyoneser Seide entledigen mußte – aber genützt hatte es nichts.
»O Madame«, sagte Gilberte schluchzend, nachdem die Schritte der Banditen und das Trappeln der Pferdehufe in der Nacht verklungen waren, »was haben wir für Glück gehabt. Ich dachte, ich sterbe vor Angst, noch bevor diese Lumpen Hand an mich legen konnten.«
Die Herzogin näherte sich den drei am Boden liegenden Gestalten, beugte sich zu ihnen hinunter und untersuchte sie flüchtig. »Tot«, murmelte sie. »Alle drei . . .«
Gilberte weinte heftiger. »Der arme Jeannot. Er war immer so fröhlich. Und Bastien . . .«
»Schweig!« sagte die Herzogin. »Zum Jammern ist es zu spät. Laß uns lieber überlegen, wie wir hier fortkommen. Am besten warten wir den Sonnenaufgang ab.«
»O nein«, flüsterte Gilberte zitternd. Sie warf einen scheuen Blick zu den Toten hinüber. »Ich fürchte mich, Madame . . .«
»Unsinn. Die Lebenden, die uns etwas hätten tun können, sind fort. Und die Toten können uns nichts anhaben.«
Dessen war Gilberte freilich nicht so sicher. Sie hatte zu viele schreckliche Geschichten gehört von den Geistern der Verstorbenen, die des Nachts umherirrten, weil sie keine Ruhe fanden. Wahrscheinlich würden das auch Jeannot und die beiden Bogenschützen tun, nachdem sie auf so schreckliche Weise umgekommen waren! Es sei denn, sie hatten selbst im Tode noch zu viel Respekt vor ihrer Herrin, so daß sie es nicht wagten, ihr als Geister unter die Augen zu treten.
Dieser Gedanke beruhigte Gilberte ein wenig.
2
Immer, wenn Isabelle am Morgen vor die Tür trat, freute sie sich über den Blick, der sich ihr bot: die Wälder am Horizont, die noch im Morgennebel verschwimmende Linie der Hügel, die Felder und Wiesen. Das Dorf lag in einer Senke. Isabelle konnte von ihrem höhergelegenen Platz nur die Dächer und die Kirchturmspitze sehen.
Manchmal hatte Isabelle dann das Gefühl, den hölzernen Wasserzuber einfach fallen lassen zu müssen, die Arme auszubreiten und barfuß, mit wehendem Rock und aufgelöstem Haar in diesen Morgen hineinzulaufen, so weit ihre Füße sie trugen, um dann irgendwo hinter einer Weißdornhecke zu liegen und in den Himmel zu träumen, der an diesem Tag wieder genau so tiefblau war wie Isabelles Augen.
Isabelle seufzte. Sie hatte wenig Zeit zum Träumen. Der Gasthof »Zum schwarzen Schwan« lag an der Straße nach Avignon. Es kamen viele Reisende durch, Händler, Soldaten, vornehme Herrschaften mit Gefolge – und manchmal auch fahrendes Volk, das Madame Margot je nach Laune mit groben Scheltworten fortschickte oder gnädigerweise in der leerstehenden Scheune kampieren ließ.
Ja, Madame Margot und ihre Launen! Es war nicht einfach, sie zu ertragen. Es gab Tage, an denen Isabelle am liebsten auf und davon gegangen wäre. Aber wohin? Zurück ins Kloster von St. Claude, wo die Nonnen sie vor siebzehn Jahren in einer regnerischen Aprilnacht als hilfloses, schreiendes Bündel auf der Türschwelle gefunden hatten?
Es war Isabelle nicht schlecht gegangen im Kloster. Aber das Leben dort war ihr zu ernst, zu eingeengt. Und die Schwestern in der strengen Ordenstracht der Karmeliterinnen waren ihr immer ein wenig wie steinerne Standbilder erschienen, ähnlich den Heiligenfiguren, die unten im Dorf die Brücke über die Isère flankierten.
Entschlossen nahm Isabelle den hölzernen Zuber wieder auf. Nein, ins Kloster zurück wollte sie nicht. Und wenn sie woanders hinging . . . Nun, es war fraglich, ob sie es dort besser anträfe als im »Schwarzen Schwan«. Irgendein Haar in der Suppe fand sich immer.
Als Isabelle vom Brunnen ins Haus zurückkehrte, kam Madame Margot gerade die Stiege aus ihrer Schlafkammer herunter. Vielleicht war sie früher einmal hübsch gewesen. Aber das mußte lange her sein, eine ganze Ewigkeit. Jetzt war Margot Bertrand nur noch fett. Auf dem Kopf trug sie eine weiße Haube, unter der das grau-schwarze Haar unordentlich hervorquoll. Ihr mächtiger Körper steckte in einer Jacke aus grobem Tuch und einem Rock, dessen Saum sie hochgebunden hatte.
Auf Isabelles Morgengruß hatte Margot nur ein mürrisches Knurren. Sie schlurfte in die Küche und stocherte in dem mächtigen Herd herum, dessen Feuer sommers wie winters nie ausging. »Ist die Suppe fertig?«
»Gewiß.« Isabelle stellte den Wasserzuber ab und nahm eine der irdenen Schalen vom Bord. Da hinein schöpfte sie aus einem rußgeschwärzten Eisenkessel die Morgensuppe, die jeden Tag den Auftakt zu Madame Margots Frühstück bildete. Es folgten Hasenpastete und ein Stück Kapaun in Weinsoße. Madame Margot aß schmatzend und mit größtem Wohlbehagen. Zwischendurch wischte sie sich die fettigen Finger an ihrem Rock ab.
Isabelle beschäftigte sich unterdessen mit dem Aufräumen und Säubern der Schankstube, in der – sehr zu des Mädchens Unbehagen – bereits Messire Paul, Margots Ehemann, vor einem Humpen Wein saß.
Früher hatte Isabelle den schmächtigen Mann mit dem Gesicht eines traurigen Eichhörnchens recht gern gehabt. Er war der einzige, der hin und wieder einen kleinen Schwatz mit ihr hielt oder sie lobte, wenn sie etwas besonders gut gemacht hatte. Aber allmählich war aus dem mageren, kindhaften, scheuen Ding, das Madame Margot vor drei Jahren aus dem Karmelitenkloster geholt hatte, ein bildschönes Mädchen geworden. Ein Mädchen mit einem straffen jungen Körper, geschmeidigen Bewegungen und dem zarten, makellosen Teint der Rothaarigen.
Ein großes Wundern überkam Paul Bertrand, als er Isabelle betrachtete, wie sie da, von der Morgensonne beschienen, auf dem Boden kniete. Wie war es nur möglich, daß ein solches Geschöpf in seinem Hause lebte? Wo mochte es herkommen? Wer mochten seine Eltern gewesen sein?
Isabelle hatte inzwischen ihre Arbeit beendet, ging zur Hintertür und leerte den Wassereimer mit kräftigem Schwung. Dann kam sie zurück und schlenkerte ihre nassen Hände. »Ihr eßt ja gar nichts, Messire Paul. Habt Ihr keinen Appetit?«
Bertrand starrte sie noch immer an. Was für schöne Zähne sie hatte! Und dieser rote Mund . . . Die Kehle wurde ihm trocken. Er streckte die Hand aus. »Setz dich zu mir, dann schmeckt es mir besser.«
Sie wollte zurückweichen, aber er hielt sie fest und zog sie zu sich heran. In seinem schmächtigen Körper steckte erstaunlich viel Kraft, und ehe es sich Isabelle versah, saß sie neben ihm auf der Bank. »Ich bitte Euch, Messire, laßt mich los! Was soll Madame Margot denken?«
»Madame Margot ist nicht hier!« Bertrand grinste und versuchte, Isabelle zu küssen.
Sie wehrte sich nach Leibeskräften. »Nicht! Seid doch vernünftig! Wie oft soll ich Euch noch sagen . . .« Sie stieß gegen den Tisch. Der Humpen mit Wein kippte um und kollerte auf den Boden. Diesen Moment benutzte das Mädchen, um aufzuspringen. »Seht Ihr, das kommt davon. Der gute Wein! Und ich habe gerade saubergemacht. O Messire, warum könnt Ihr mich auch nicht in Ruhe lassen! Eines Tages wird Madame Margot dahinterkommen, und natürlich wird sie mir die Schuld geben und mich hinauswerfen.«
»Pah, in dem Fall bin ich auch noch da«, sagte Paul Bertrand großspurig.
Trotz allem mußte Isabelle lachen. »Als ob Ihr gegen Eure Frau aufzumucken wagtet!« Sie hob den Humpen auf, holte einen Lappen vom Schanktisch und begann, den verschütteten Wein aufzuwischen.
Bertrand beugte sich nach vorn. »Im Ernst, Isabelle, warum läufst du mir immer davon? Ich könnte dir . . .«
Er verstummte, weil in diesem Augenblick Madame Margot eintrat. Sie blieb auf der Schwelle stehen und stemmte die fetten Arme in die Hüften. »Was könntest du, Paul Bertrand?«
»Ich . . . oh . . . ich sprach nur gerade mit Isabelle darüber, daß ich nächste Woche zum Markt nach St. Claude fahre. Ich könnte ihr etwas mitbringen, wenn sie etwas braucht.«
»Sie braucht nichts«, sagte Madame Margot streng und streckte ihr Doppelkinn vor. »Außerdem hältst du das Mädchen mit deinem Geschwätz von der Arbeit ab. Es könnte schon längst fertig sein.«
»Ich bin fertig, Madame!« Isabelle richtete sich auf. »Soll ich jetzt die Quitten pflücken?«
»Meinetwegen. Aber schlaf nicht ein dabei. Und steck dir deine Zöpfe auf. Wie du wieder aussiehst mit deinen halb aufgelösten Haaren! Wie ein liederliches Frauenzimmer!« Madame Margot sah Isabelle nach, wie sie mit ihrem wiegenden Schritt zum Schanktisch ging und den Lappen zurückbrachte. Bei allen Heiligen, dieses Ding wurde alle Tage reizvoller. Man mußte ein Auge auf sie haben, und auf Messire Paul!
In diesem Augenblick pochte es an die Vordertür.
»Wer kann das sein?« fragte Paul und stand auf.
Die Ankömmlinge waren Gilberte und die Herzogin. Sie wankten mit zerrissenen Schuhen und wirren Haaren in die Schankstube. Die Herzogin war in eine Decke gewickelt, unter der ihre staubigen Unterkleider hervorsahen. Sie sank sofort erschöpft auf eine Bank.
»Wer seid Ihr? Was wollt Ihr?« fragte Madame Margot barsch, während ihr Mann von einer zur anderen blickte.
Gilberte nannte ihre Namen und erzählte, was ihr und ihrer Herrin in der vergangenen Nacht passiert war. »Jetzt sind wir schon seit dem Hellwerden unterwegs«, schloß sie, »und sind keiner Menschenseele begegnet. Gott, waren wir froh, als wir endlich Euer Haus sahen.«
»Ja, wir sind weit und breit die einzige Herberge auf dem Weg nach Avignon«, nickte Paul und machte einen Kratzfuß nach dem anderen in Richtung der Herzogin. »Schrecklich, diese Banditen, man sollte sie alle aufhängen! Aber nun erholt Euch von dem Ausgestandenen. Ich werde Euch sofort ein Bad bereiten lassen und ein kräftiges Essen. Und mein bestes Zimmer sollt Ihr auch . . .« Er brach ab, weil er einen vernichtenden Blick von Madame Margot auffing.
»Du bist doch ein Dummkopf, Paul Bertrand! Woher willst du wissen, ob uns die beiden nicht ein Lügenmärchen auftischen? Oder habt Ihr Geld, um die Zeche zu bezahlen?«
Die Herzogin hob den Kopf. »Natürlich nicht. Meine Kammerfrau sagte Euch doch, daß wir ausgeraubt worden sind. Ich wollte Euch bitten, einen Boten nach Schloß Beaumont zu senden, damit man uns hier abholen kommt. Dann werdet Ihr Euer Geld erhalten.«
»Oder Ihr seid inzwischen bei Nacht und Nebel verschwunden«, sagte Madame Margot störrisch. Ihre fetten Hängebacken bebten. »Ich kenne die Herzogin nicht. Aber seit wann reist eine Dame von Stand ohne Gefolge, nur mit einem Kutscher und zwei Knechten durch das Land? Ihr müßt zugeben, daß das reichlich sonderbar klingt.«
»Aber es ist die Herzogin«, rief Isabelle in diesem Augenblick. Sie hatte sich bis jetzt in dem dämmrigen Hintergrund des Hauses gehalten, wo weder die Herzogin noch Gilberte sie bemerkt hatten. Nun kam Isabelle nach vorn. Die Sonne, die durch eines der spitzbogigen Fenster fiel, ließ ihr Haar kupfern schimmern. »Bitte, bleibt«, sagte sie zu Johanna von Valance und wandte sich dann wieder an Madame Margot. »Ich kenne sie, weil sie einmal in St. Claude die Ostermesse besuchte. Dort habe ich sie gesehen.«
Paul Bertrand war es gewöhnt, daß Isabelle von seinen Gästen angestarrt wurde. Die auffallende Schönheit des Mädchens erregte bei jedem, der es zum erstenmal sah, Staunen. Aber so wie die Herzogin und ihre Kammerfrau hatte noch niemand auf Isabelles Anblick reagiert. Gilberte war zurückgewichen und bekreuzigte sich. »Jesus Maria . . . nein! So etwas gibt es nicht!«
Die Herzogin war leichenblaß geworden. Sie hielt sich am Tisch fest. »Beatrice«, murmelte sie und schloß die Augen, so, als müsse sich Isabelle, wenn sie sie wieder öffnete, gleich einer Geistererscheinung in Luft auflösen.
Isabelle stützte sie. »Was ist Euch, Madame? So setzt Euch doch. Messire Paul, schnell, einen Schluck Wasser.«
Die Herzogin winkte ab. »Nein, nein, es ist schon vorüber.« Sie hatte die Augen wieder geöffnet und starrte Isabelle an. »Wer . . . wer bist du, mein Kind?«
Das Mädchen machte einen Knicks. »Ich heiße Isabelle St. George und bin hier Magd. Meinen Nachnamen habe ich von den frommen Schwestern des Karmel, weil sie mich am Tage des heiligen Georg vor der Tür ihres Klosters gefunden haben.«
»Ein Findelkind also?«
»Ja, Euer Gnaden. Geht es Euer Gnaden wirklich besser? Oder soll ich Euch eine Kompresse machen? Im Kloster hab’ ich etwas Krankenpflege gelernt.«
»Bemüh dich nicht, mein Kind. Ich fühle mich ganz wohl. Es waren wohl nur die Strapazen der vergangenen Stunden. – Herr Wirt?«
»Ja, Madame?« Paul Bertrand kam eilfertig herangewieselt.
»Bekommen wir jetzt ein Zimmer und etwas zu essen? Oder habt Ihr immer noch Bedenken?«
»Gewiß nicht, Euer Gnaden. Ihr müßt meiner Frau verzeihen, sie ist immer ein wenig mißtrauisch. Kein Wunder, wenn so viele schlechte Menschen in der Welt herumlaufen. Mörder und Diebe, die sich nicht scheuen, friedliche Reisende zu überfallen und auszuplündern.«
»Wenn ich Euer Gnaden nun das Zimmer zeigen darf? Es ist unser bestes!« Madame Margot schwenkte jetzt um wie eine Wetterfahne. Ihr rotes Gesicht war eitel Wohlwollen. »Euer Gnaden werden doch über Nacht bleiben?«
»Vermutlich«, erwiderte die Herzogin. »Es sei denn, man holt uns noch heute nachmittag hier ab. Aber das wird kaum möglich sein. Ein guter Reiter braucht bestimmt vier bis fünf Stunden nach Beaumont.«
»Ich werde sofort einen Knecht losschicken«, versprach Madame Margot. »Und du, Isabelle, kümmere dich um heißes Wasser für ein Bad und ein kräftiges Essen.«
3
»Beim Himmel, Madame, mir schwirrt der Kopf! Wie ist das nur möglich, eine solche Ähnlichkeit! Im ersten Augenblick glaubte ich, die Toten stünden aus ihren Gräbern auf.« Gilberte lehnte sich mit dem Rücken gegen die eisenbeschlagene Tür, die Madame Margot soeben von draußen hinter sich geschlossen hatte. »Aber Ihr wart auch ganz fassungslos.«
»Wahrhaftig, das war ich«, sagte die Herzogin. »Ich habe noch nie solch ein Spiel der Natur erlebt. Dieses Mädchen gleicht Beatrice de Marville wie ein Ei dem anderen. Nur die Stimme klingt ein wenig tiefer.«
»Wenn Seine Gnaden der Herzog sie gesehen hätte . . . Ich glaube, ihr Anblick hätte ihn mit einem Schlage von seiner Trauer geheilt. Wißt Ihr was, Madame Johanna? Wir sollten das Mädchen mitnehmen und ihm präsentieren.«
»Meinst du, Gilberte? Wäre ein solcher Anblick nicht vielmehr schmerzlich für ihn?«
»Aber nein, Madame, warum? Wie lange ist Gräfin Beatrice jetzt tot? Drei Jahre und noch etwas darüber. Und in all den Jahren hat Euer Sohn keine Frau mehr angeschaut. Es wird Zeit, daß sich das ändert. Er ist Euer einziger Sohn, und wenn er nicht bald daran denkt, sich zu vermählen, werdet Ihr niemals Enkelkinder haben und keinen Erben für die Herzogskrone.«
»Mein Sohn ist dreißig Jahre alt. Er kann auch noch in zwei oder drei Jahren heiraten.«
»Wer sagt Euch, daß er bis dahin anderen Sinnes ist als heute? Er scheint entschlossen, seiner toten Braut die Treue zu halten! Und je mehr er sich in diesen Gedanken verrennt, desto schwerer wird es für ihn, sich eines Tages davon zu lösen.«
Johanna von Valance seufzte. Gilberte sprach nur das aus, was sie selbst in vielen bangen Tagen und Nächten gedacht hatte. Seit Beatrice de Marville drei Wochen vor der Hochzeit einem Lungenfieber erlegen war, lebte Roger nur noch in der Erinnerung. Anfangs hatte die Herzogin seine Trauer um das schöne und liebenswürdige Mädchen voll verstanden, ja, sogar geteilt. Aber nachdem nun so viel Zeit dahingegangen war, fand sie sie unnatürlich und beängstigend. In Paris gab es ein Mädchen, das die Herzogin sehr gern als Gattin ihres Sohnes gesehen hätte. Gwendoline hieß es, die einzige Tochter des Grafen von Morgan. Sie war Hofdame bei der Königin und schien Johanna von Valance durchaus geeignet, die Erinnerung an eine Tote aus Rogers Herzen zu verdrängen. Wie kam Gilberte nur auf den Gedanken, dies könne eine Küchenmagd viel besser und viel gründlicher erreichen?
»Du übertreibst«, sagte Madame Johanna unwirsch. »Gesetzt den Fall, der Herzog bekommt dieses Mädchen zu Gesicht. Gesetzt, die Ähnlichkeit mit Beatrice fällt ihm auf – wie, denkst du, soll es weitergehen? Soll sich mein Sohn in sie verlieben? Soll eine Küchenmagd am Ende die Herzogskrone von Valance erhalten? Oder sollen Rogers Söhne den Querbalken des Bastards in ihrem Wappen führen?«
»Weder – noch, Madame! Verzeiht, doch denkt Ihr nicht ein wenig weit voraus? Ich meinte nur . . .« Gilberte brach ab und lächelte halb schlau, halb zaghaft. »Es dauert mich, wie Euer Sohn in dieser ungesunden Trauer sich vergräbt, und mehr noch, wie Ihr Euch darüber sorgt. Ist es nicht so, daß Euer Sohn die Tote höher stellt als alle Lebenden? Für ihn ist sie die Schönste, Edelste, ein überirdisches Geschöpf, das keinen Fehler hatte. Er vergißt dabei, daß Beatrice, als sie noch lebte, ein Mensch war wie wir anderen auch. Ein Mensch mit Schwächen, Launen! Liebenswert durchaus, doch keineswegs das makellose Denkmal, das er von ihr in seinem Herzen errichtet hat. Wir müssen dieses Denkmal stürzen, Euer Gnaden! Und dafür scheint mir jenes Mädchen gut.«
»Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Du hoffst, der Herzog würde sich in sie verlieben als in das Abbild seiner Beatrice – und dann erkennen, daß sie nur ein Mädchen ist wie tausend andere auch.«