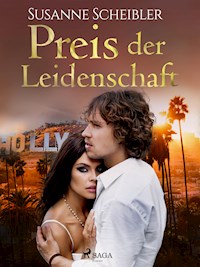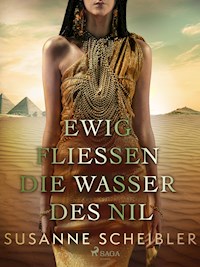Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Caroline Mon Amour – eine Lovestory im Zeitalter NapoleonsEs ist Liebe auf den ersten Blick, als sich die junge Deutsche Caroline und der französische Offizier Pierre zum ersten Mal begegnen. Doch die Romanze findet ein abruptes Ende, als Pierre nach Spanien versetzt wird. Getrieben von blinder Liebe macht sich Caroline auf die Suche nach ihrem Angebeteten. Dabei muss sie jedoch feststellen, dass das Schicksal so manchen Umweg für sie vorgesehen hat...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 920
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Susanne Scheibler
Caroline Mon Amour
Roman aus der Zeit Napoleons
Saga
Caroline Mon Amour
Caroline Mon Amour
Copyright © 2021 by Michael Klumb
vertreten durch die AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de)
Die Originalausgabe ist 1988 im Ed. Meyster Verlag erschienen
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1988, 2021 Susanne Scheibler und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726961218
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
1
Caroline wußte nicht genau, was sie erwartet hatte, als sie an diesem frühen Septembermorgen beim Brühler Tor auf einer niedrigen Steinmauer saß, um den Einzug des Kaisers der Franzosen mitzuerleben, aber auf jeden Fall nicht diesen unscheinbaren, in eine zu enge, schmucklose Uniform gepreßten Mann.
So hatte sie sich Napoleon nicht vorgestellt!
Er war weder das verhaßte korsische Ungeheuer, das Carolines Landsleute in ihm sahen, noch der von kaiserlicher Glorie umgebene Herrscher Frankreichs.
Unter den Deputierten der Stadt Erfurt, die mit dem Magistrat erschienen waren, Napoleon zu begrüßen, entdeckte Caroline den grauen Kopf ihres Vaters. Der Schneidermeister Jakob Weikersheim war groß, hager, mit einem scharfgeschnittenen Gesicht. Seine Lippen waren fest zusammengepreßt, und Caroline ahnte, was er in diesem Augenblick empfand: Scham, Widerwillen, Ohnmacht.
Er war kein Franzosenfreund — wie sollte er auch!
Vor zwei Jahren hatte er zu denen gehört, die die kampflose Kapitulation der Festung Erfurt vor den französischen Truppen laut und deutlich einen Akt der Feigheit und der Schande genannt hatten, und sein einziger Sohn Gottfried war mit neunzehn Jahren am Landgrafenberg bei Jena, als er auf preußischer Seite gegen die Franzosen kämpfte, so schwer verwundet worden, daß er ein halbes Jahr später nach langem Siechtum daheim starb.
Da hatten schon die Franzosen in Erfurt das Regiment geführt, ein hartes Regiment mit immer drückender werdenden Steuerlasten und Repressalien.
Caroline schrak zusammen, als vor ihr die französischen Soldaten, die die Straße säumten, zu schreien anfingen: »Vive l’empereur! Vive l’empereur!« Der Ruf pflanzte sich fort, allerdings keineswegs so brausend und begeistert, wie es der kleine Mann auf dem weißen Pferd erwartet haben mochte. Die meisten Zivilisten — es waren ohnehin nicht allzu viele, die die Schaulust hergetrieben hatte— schwiegen.
Caroline sah, daß Bürgermeister Weißmantel dem Franzosenkaiser die Schlüssel der Stadt auf einem roten Samtkissen überreichte. Er nahm sie entgegen und richtete nun seinerseits ein paar Worte an den Magistrat und die Deputierten der Bürgerschaft. »Wir freuen Uns, in Unserer kaiserlichen Domäne Einzug zu halten. Dies ist ein großer Tag, denn es geschieht zum ersten Mal in der Geschichte dieser Stadt, daß sie so viele gekrönte Häupter in ihren Mauern beherbergt. Noch heute werde ich den Kaiser Rußlands hier begrüßen und mit ihm die Könige von Württemberg und Neapel, Sachsen und . . . «
Was Napoleon sonst noch sagte, wurde von dem einsetzenden Glockengeläut der Erfurter Kirchen und den Salutschüssen von der Zitadelle Petersberg übertönt.
Caroline fand, daß Napoleon eine harte, ein wenig flache Stimme hatte. Außerdem sprach er einen starken Akzent; das hörte selbst sie, da sie das elegante schnelle Französisch ihres Lehrers Monsieur Frambonnet gewohnt war. Besonders das rollende »R« fiel ihr auf. Während Napoleon Bonaparte nun durch das Brühler Tor in die Stadt einritt, warf er einen Blick in die Menge am Straßenrand. Er betrachtete die französischen Soldaten, die Spalier standen, und hob grüßend die Hand an den Zweispitz. Dann sah er über die Schaulustigen hin, und für einen Augenblick streifte sein Blick das junge Mädchen, das auf der Steinmauer saß, die einen Obstgarten zur Straße hin begrenzte.
Entgegen der herrschenden Mode trug Caroline das flammend rote Haar glatt gescheitelt und im Nacken aufgesteckt. Ihr Vater duldete es nicht, daß sie sich eine Frisur à la Parisienne schneiden ließ, mit kurzen, in die Stirn gekämmten Locken. Und auch die Kleider, wie sie jetzt modern waren, mit Dekolletés, die mehr enthüllten als verbargen, aus dünnen, fast durchsichtigen Schleierstoffen und mit hochgeschürzten Taillen, gefielen Meister Jakob nicht. Deshalb trug Caroline an jenem wolkenverhangenen Vormittag des 27. September 1808 ein Kleid aus veilchenfarbenem festen Tuch, dessen weiter Rock mit endlosen Metern weißer Zackenlitze besetzt war. Es hatte einen kleinen züchtigen Ausschnitt und ein enganliegendes Mieder. Caroline haßte dieses Kleid, weil es altmodisch und bieder war, aber sie hatte es heute morgen zähneknirschend angezogen, wohl wissend, daß ihr Vater ihr sonst nicht gestattet hätte, den Einzug des französischen Kaisers mitanzusehen.
Und nun auf einmal traf sie Napoleons Blick, ein, zwei Sekunden nur, während er die Lippen zu einem kleinen Lächeln verzog.
Und da, ganz plötzlich, erschien er Caroline nicht mehr wie ein dicker, mißmutiger Korporal auf einem viel zu großen, viel zu herausgeputzten Pferd. Es lag an seinen Augen. Funkelnd waren sie, grau-grün und von einer unsagbar wachen, brennenden Aufmerksamkeit.
Unwillkürlich hielt Caroline den Atem an. Und sie begriff, daß dieser kleine Mann mit den glanzlosen dunklen Haaren unter dem Zweispitz in der Tat etwas Besonderes hatte.
Sie war zu jung und wußte zu wenig von den Menschen, als daß sie es hätte definieren können. Sie spürte sie nur, diese sonderbare Anziehungskraft, die Napoleon Bonaparte auf andere auszuüben imstande war. Dieselbe Anziehungskraft, die den unbekannten kleinen Korsen von einst, den glücklosen Jakobinergeneral und Schützling Robespierres, mittellos und eher lächerlich in den Augen der nachrevolutionären Jeunesse dorée, befähigt hatte, seine Soldaten so für sich zu begeistern, daß sie Sieg um Sieg erfochten, und die ihn schließlich bis auf den französischen Thron gebracht hatte.
Caroline kannte Napoleons Geschichte; sie hatte sie aus den Erzählungen ihres Vaters erfahren und aus langen Gesprächen mit Leonhard Vogel, mit dem sie seit dem Frühsommer verlobt war.
Leonhard, zehn Jahre älter als sie und Bibliothekar an der Erfurter Universität, haßte Napoleon, den Verräter der Revolution, wie er ihn nannte. Vom Sansculotten-General zum Kaiser der Franzosen, zum Okkupator, der fast ganz Europa unterworfen hatte und mit gierigen Händen nach immer mehr, nach immer Größerem griff — wahrlich ein Aufstieg, der schaudern machte.
Aber doch gleichzeitig bewundern, dachte Caroline in diesem Augenblick — und schämte sich sofort dieser Empfindung.
Wieso bewundern! Diesen Mann doch nicht, der ihre Heimat zur kaiserlichen Domäne erklärt hatte, dessen Stellvertreter Kontributionen über Kontributionen aus ihren Landsleuten herauspreßten, dessen Soldaten sich hier breit machten und überall einquartierten, dessen Spitzel das Land überzogen und dessen Kontinentalsperre gegen England Handel und Wirtschaft zum Erliegen brachte.
Ich bin eine Gans, dachte Caroline und senkte den Kopf. Bloß weil er mich angesehen und gelächelt hat . . .
Die Männer lächelten sie oft an, wenn sie auf den Markt ging, um einzukaufen, oder in die Kirche. Die Soldaten riefen ihr Komplimente nach, und die Lakaien der vornehmen Herrschaften, bei denen sie gelegentlich die Kleider ihres Vaters ablieferte, versuchten jedesmal, ihr die Wangen zu tätscheln oder sie sogar zu küssen.
Caroline wußte, daß sie darüber hätte verärgert sein müssen; aber es freute sie, daß sie hübsch war, viel hübscher beispielsweise als Friederike von Rodenbach, die doch eine Baronesse war und dennoch neben ihr, der Schneiderstochter, mit den viel zu krausen hellblonden Haaren und dem rötlichen Gesicht eher wie ein pummeliges Mädchen vom Lande wirkte.
Indessen war der Franzosenkaiser weitergeritten.
Die kaiserlichen Garden, die ihn begleiteten, waren ein schier endloser Zug zu Fuß und zu Pferde. Voran schritten die Musikanten. Das harte Stakkato der Trommeln gab den Rhythmus für den dröhnenden Marschtritt der Grenadiere an. Trompeten und Hörner schmetterten, und auf den Spitzen der Fahnenstangen funkelte der Kaiseradler. Caroline war von ihrem Mäuerchen gesprungen und wurde von den Zuschauern mitgerissen, die den Soldaten in die Stadt nachdrängten. Im Rückwärtsschauen sah sie, daß ihre Mutter und Hermann, der Schneidergeselle ihres Vaters, dicht hinter ihr waren. Ludwig, der vierzehnjährige Lehrjunge, war im Getümmel verschwunden.
Als zwei dicke Männer sich ziemlich rücksichtslos an Caroline vorbeischoben und ihr dabei einige Rippenstöße versetzten, kämpfte sich Hermann zu ihr durch. »Bleibt an meiner Seite, Mamsell Caroline«, sagte er. »Ich will Euch schon den Weg freihalten. Nicht, daß Euch noch ein Leid geschieht.«
Sie lächelte dem Buckligen mit dem schütteren blonden Haar zu. »Danke, Hermann, ich passe schon auf.«
»Habt Ihr den kaiserlichen Marschall Ney und Joachim Murat, den König von Neapel gesehen? Sie waren herausgeputzt, daß man jeden von ihnen für die Kaiser hätte halten können.«
»O ja. Daneben sah Napoleon wie ihr Pferdepfleger aus. Aber es ist ja bekannt, daß er sich aus äußerlichem Staat nicht viel macht.« Sie rümpfte die hübsche Nase. »Ich glaube allerdings nicht, daß eine prunkvolle Uniform ihn eindrucksvoller erscheinen ließe.«
»Um Himmels willen, sagt nicht so laut etwas Abfälliges über den Kaiser. Wenn Euch jemand hört . . . Heutzutage sind schon Leute wegen harmloserer Bemerkungen ins Gefängnis gekommen.«
Hermann nahm ihren Arm und zog sie mit sich durch das Gedränge an den Straßenrand. »So, hier kommen wir ungehindert voran.«
Er winkte Carolines Mutter zu, die von ihnen abgedrängt worden war. »Hierher, Frau Meisterin! Hier sind wir!«
Marie Weikersheim, eine hübsche, mollige Frau Ende der Dreißig, kämpfte sich zu ihnen durch. »Du siehst ganz erhitzt aus, Caroline. Hier, leg das um, damit du dich nicht erkältest.« Sie nahm ihr grünwollenes Umschlagtuch ab und gab es ihrer Tochter.
»Aber jetzt frieren Sie, Mama . . . « protestierte Caroline.
»Unsinn. Ich habe ein warmes Kleid an.«
»Wo ist denn Vater? Ich dachte, er käme mit uns heim.«
»Er muß noch mit zu den Graden, wo dem Kaiser ein Huldigungsschreiben der Universität überreicht wird.« Marie Weikersheim verzog den Mund. »Das wird deinen Vater hart ankommen. Die ganzen Tage hat er darüber gemurrt, daß man ihn in die Deputation der Bürgerschaft gewählt hat. Hoffentlich redet er sich nicht um Kopf und Kragen.« Sie seufzte. Sie kannte das cholerische Temperament ihres Mannes am besten, hatte sie doch selbst oft genug darunter leiden müssen.
Aber da sie von sanfter, duldsamer Gemütsart war, hatte sie es hingenommen wie so vieles in ihrer Ehe. Sie war keine, die laut aufbegehrte; nicht einmal, als ihr einziger Sohn starb, hatte sie groß gejammert, geschweige denn mit dem Schicksal gehadert. Sie hatte Gottfried bis zu seinem bitteren Ende gepflegt und darum gebetet, daß er ihr erhalten bliebe. Aber Gott hatte es anders beschlossen, und Marie Weikersheim wäre es nie in den Sinn gekommen, an seinen Zulassungen zu rütteln.
Caroline war anders, ungestümer, manchmal sogar bedenkenloser. Es lag nicht am Überschwang ihrer siebzehn Jahre. Sie war einfach — Marie konnte es nicht besser ausdrükken, weil sie es so empfand —, sie war einfach lebendiger als andere Menschen. Sie fühlte intensiver und lebte intensiver, und Marie dachte manchmal, daß der Herrgott aus dieser einen Tochter im Grunde hätte zwei machen können, soviel Kraft und Ursprünglichkeit steckten in ihr.
Marie warf Caroline einen liebevollen Blick zu. Das Mädchen ging mit Hermann vor ihr her und redete lebhaft auf ihn ein.
Der Bucklige blieb stehen und wandte sich erheitert zu ihr um. »Habt Ihr das gehört, Frau Meisterin? Ich soll Mamsell Caroline heute nachmittag begleiten. Sie hofft, daß der Meister ihr dann erlaubt, auch den Einzug des Zaren von Rußland mitanzusehen. Ich verwette meinen Hosenknopf, daß er es nicht tun wird.«
»Wer wettet, will betrügen«, sagte Caroline lachend. »Außerdem — was sollte ich mit einem Hosenknopf? Aber was meinen Sie, Frau Mutter? Wird der Vater ja sagen, wenn Hermann auf mich achtgibt?« »Ich fürchte, nein, Kind«, erwiderte Marie. »Abgesehen davon wollte Leonhard heute zum Kaffee kommen. Hast du das vergessen?«
Caroline schob die Unterlippe vor. »Dann wird wohl nichts daraus. Schade . . . «
»Da Zar Alexander von Rußland zwei Wochen in unserer Stadt bleibt, hast du gewiß noch Gelegenheit, ihn zu sehen«, meinte ihre Mutter tröstend. »Es heißt, er logiert im Hause des Fabrikanten Triebel. Das ist ja nicht weit von uns.«
Die Weikersheims bewohnten ein schmalbrüstiges, ockerfarben getünchtes Haus in der Neuwerksstraße, gleich neben der Kirche.
Von außen wirkte es klein und geduckt, war aber dennoch recht geräumig, da es im Viereck um einen großen Innenhof gebaut war. An den rückwärtigen Teil schloß sich ein Garten an, in dem knorrige alte Obstbäume wuchsen.
Über das ganze erste Stockwerk hinweg zog sich auf der Hofseite ein großer Holzbalkon mit geschnitzten Bögen und Geländern, die von wild wucherndem Geißblatt bewachsen waren. Dazwischen blühten in großen Holzkästen üppig die Geranien und zauberten rote Farbflecken in das Grün.
Caroline liebte ihr Elternhaus mit den dunkel gewachsten, knarrenden Holzfußböden und der breiten Treppe, die ins Obergeschoß hinaufführte. Die große Diele roch immer ein wenig nach Äpfeln, die ihre Mutter im Winter auf den Wäscheschränken lagerte, und nach den Rosenblättern, die Marie selbst trocknete und in kleinen Beuteln zwischen die gestapelten Leintücher legte.
Hier war Carolines bevorzugter Spielplatz der Kinderzeit gewesen. Zusammen mit Gottfried hatte sie in den Truhen gestöbert, in denen ihre Mutter alte Kleider und allen möglichen Krimskrams aufbewahrte.
Carolines Zimmer befand sich hinter der Schlafkammer ihrer Eltern, aber man konnte es auch vom Balkon aus betreten.
Es war hell und sonnig, da es außer der Balkontür noch zwei Fenster besaß, von denen man auf den Garten blikken konnte. Genau darunter befand sich die Geißblattlaube, an deren rundem Tisch die Familie in der warmen Jahreszeit den Nachmittagskaffee einzunehmen pflegte. Meister Jakob liebte es, dort auch abends seinen Schoppen Wein zu trinken oder das Bier, das die Lehrjungen in einem großen Deckelkrug aus dem Gasthof »Zum Schwarzen Adler« holten.
In dieser Laube war Caroline zum ersten Mal von Leonhard geküßt worden. An einem Sonntag nach dem Kirchgang war es gewesen, und anschließend hatte er, wie es sich gehörte, bei ihren Eltern um ihre Hand angehalten.
An diesem Tag hatten sie nicht wie sonst in dem kleinen Speisezimmer gegessen, sondern in der großen Vorderstube, die im Winter nur zu den Festtagen geheizt und auch im Sommer lediglich bei besonderen Anlässen benutzt wurde.
Während der Essensvorbereitungen war Leonhard rasch nach Hause gegangen und mit seiner Mutter wiedergekommen. Malwine Vogel war eine magere, kleine Frau, die seit dem Tod ihres Mannes vor acht Jahren nur schwarze Kleider trug. Sie hatte Caroline umarmt und »mein liebes Kind« genannt. Aber ihre kleinen dunklen Augen waren dabei kühl geblieben.
Später hatte Caroline mit Leonhard einen Spaziergang durch den Garten gemacht. Der Wein war ihr zu Kopf gestiegen, sie fühlte sich ein wenig benommen und gleichzeitig sonderbar überdreht. Sie hatte sich an Leonhards Arm gehängt, den Kopf an seine Schulter gelehnt und erwartet, daß er sie wieder küssen werde.
Er hatte es auch getan, aber als Caroline die Arme um seinen Hals schlang und sich in einer jähen Gefühlswallung an ihn preßte, hatte er sie sacht von sich geschoben.
»Ach, Caroline«, hatte er gemurmelt, »du bist so süß, und ich bin sehr glücklich . . . «
Für einen Augenblick hatte sie trotz seiner Worte Enttäuschung empfunden. Warum sagte er das — statt es ihr zu zeigen? Warum küßte er sie wie eine kleine Schwester mit sanften, festgeschlossenen Lippen und nicht wie ein Liebhaber? Er liebte sie doch, er wollte sie heiraten, und irgendwie mußte doch jetzt alles anders zwischen ihnen sein . . .
Dabei hatte sie es ganz gern, wenn Leonhard sie küßte. Es rief einen angenehmen kleinen Schauer in ihr hervor, eine prickelnde Wärme, doch es war nicht das, was sie sich unter einer großen, himmelstürmenden Liebe vorgestellt hatte.
An diesem Tag kam Leonhard bald nach dem Essen. Da der Wind die Wolken vertrieben hatte und die Sonne hervorgekommen war, hatte Marie den Kaffeetisch in der Laube gedeckt. »Es wird wohl das letzte Mal in diesem Jahr sein«, meinte sie, als sie den Teller mit dem aufgeschnittenen Hefezopf brachte. »Ich wundere mich sowieso darüber, daß wir diesmal so lange schönes Wetter haben. Es ist noch warm wie im Sommer, dabei haben wir in der nächsten Woche schon Oktober.«
Die alte Hausmagd Ernestine schenkte den Kaffee ein.
Man hörte wieder die Glocken läuten und die Böllerschüsse vom Petersberg, und Meister Jakob, der bis dahin in der »Neuen allgemeinen Weltbühne« gelesen hatte, faltete die Zeitung zusammen und warf sie auf den Tisch.
»Er ist also da, der Zar«, sagte er stirnrunzelnd. »Welch ein Jammer, daß es nicht regnet — oder noch besser hagelt! Blitz und Donner sollten vom Himmel fahren . . . «
»Das würde auch nichts an seiner Ankunft ändern«, erwiderte Leonhard Vogel. Er war ein großer, schlanker Mann mit nach vorn gebeugten Schultern. Braunes Haar fiel ihm in die blasse Stirn. Nervös zerkrümelte er ein Stück Hefezopf zwischen den Fingern. »Essen Sie doch, Leonhard«, meinte Marie mit ihrem sanften Lächeln. »Ich habe ihn mit Rohrzucker gebacken, nicht mit dem Syrupzeug, das man heutzutage aus Runkelrüben herstellt. In der Speisekammer haben wir noch einen halben Sack echten Zucker. Hoffentlich reicht er, bis man wieder neuen zu kaufen kriegt.«
Meister Jakob lachte unfroh. »Da hören Sie’s, Leonhard, was die Sorgen der Frauen sind. Als ob Napoleons verfluchte Kontinentalsperre nicht andere und weitaus größere Unbilden über uns gebracht hätte! Man kriegt kein anständiges Manchestertuch mehr, kein Indigo, keine Maschinen aus England, und die Kolonialwaren, deinen albernen Zucker mitgerechnet, Marie, sind im Preis um das Anderthalbfache gestiegen. Wenn das so weitergeht, wird eine Fabrik nach der anderen zumachen, und Not und Elend werden über die Leute hereinbrechen. Und da werfen sie jetzt das Geld zum Fenster hinaus, um die Urheber all dieses Unglücks auch noch zu feiern.« »Sie haben recht, Meister Jakob«, pflichtete Leonhard ihm bei. »Aber noch schlimmer, scheint mir, ist die beschämende geistige Knechtschaft, in der wir leben. Ich habe sagen hören, daß man Herrn von Dacheröden, den Präsidenten der Akademie gemeinnütziger Wissenschaften, vor den Geheimdienst zitiert hat. Monsieur Charles Schulmeister wirft ihm vor, er habe einen Auszug aus Fichtes ›Reden an die Deutsche Nation‹, die er in Berlin gehalten hat, auf der Akademie verbreitet. Es sei aber ein Unding, in einer kaiserlichen Domäne wie Erfurt den Gedanken des Deutschtums und der Erneuerung deutscher Vaterlandsliebe zu pflegen. Herr von Dacheröden konnte sich nur vor dem Gefängnis retten, indem er auf eine Ausgabe des Pariser ›Moniteur‹ hinwies, in dem vor Jahresfrist eben diese Rede von Fichte lobend erwähnt worden war, da sie in der Hauptsache die Förderung der Volksbildung beinhaltet.«
Meister Jakob schlug mit der Hand auf den Tisch, daß die Tassen klirrten. »Ja, es ist weit gekommen mit uns! Nicht nur, daß die Franzosen uns mit ihren ewigen Kontributionen und Requisitionen das Fell über die Ohren ziehen — sie erwarten auch noch, daß wir ihnen dafür die Hände küssen.«
Caroline unterdrückte einen Seufzer. Konnten der Vater und Leonhard denn nie über etwas anderes reden! Freilich war es bitter, was geschah, und sie hätte es lieber heute als morgen gehabt, daß die Franzosen auf Nimmerwiedersehen verschwanden. Aber durch das ewige Jammern wurde es nicht anders. Man vergällte sich nur selbst die Tage damit, die man mit erfreulicheren Dingen hätte anfüllen können. »Außerdem steht in der Zeitung, daß die Einquartierungen bei der Zivilbevölkerung verdoppelt werden sollen«, knurrte Meister Jakob. »Gott gebe, daß dieser Kelch an uns vorübergeht. Unser Gottfried würde sich im Grabe herumdrehen, wenn Franzosen unter unserem Dache lebten.«
»Nun, es sind auch Menschen!« platzte Caroline heraus. »Und die meisten wären sicherlich viel lieber in ihrer Heimat als bei uns. Schließlich sind sie nicht freiwillig hergekommen, sondern müssen genauso gehorchen wie seinerzeit Gottfried, als sie ihn zu den Soldaten geholt haben.«
»Caroline!« Meister Jakob starrte seine Tochter mißbilligend an. »Wie kannst du das vergleichen. Gottfried hat für sein Vaterland gekämpft!« »Und die Franzosen tun das auch«, fiel sie ihm unerschrocken ins Wort. »Jedenfalls redet man ihnen das ein, und sie glauben es dummerweise. Neulich hat Monsieur Frambonnet Friederike von Rodenbach und mir von den Schlachten von Austerlitz, Preußisch Eylau und Friedland erzählt, in denen der Zar Alexander mit den Österreichern und Preußen noch gegen Napoleon gekämpft hat. Es sind Abertausende dabei gefallen. Und zwei Wochen später haben sich der Zar und Napoleon auf einem Floß auf der Memel getroffen und sind — von einer Stunde zur anderen — die besten Freunde geworden. Die Toten waren also ganz umsonst gestorben. Aber ganz gewiß hat man ihnen vorher weisgemacht, daß sie für eine gute Sache kämpfen.« »Monsieur Frambonnet!« Meister Jakob spie den Namen förmlich aus. »Ich kann mir schon vorstellen, was dir der Franzose vorgeredet und wie er den Verrat des russischen Zaren in eine grandiose Entscheidung verkehrt hat!«
Er wandte sich an seine Frau. »Da siehst du, Marie, was du angerichtet hast mit deinem dummen Stolz! Mußte Caroline denn unbedingt zusammen mit der Baronesse Rodenbach erzogen werden? Mußte sie dieselben Lehrer haben, die ihr nur Irrmeinungen und Flausen in den Kopf gesetzt haben? Bloß weil du einmal bei der Baronin in Diensten gestanden hast und sie gnädigerweise Carolines Patin geworden ist?« Marie Weikersheims hübsches Gesicht hatte sich mit Röte überzogen. »Aber Jakob . . . Caroline hat dank der Güte der Baronin viel lernen dürfen — mehr als wir ihr sonst hätten ermöglichen können.«
»Ja — und du hast dich gespreizt wie eine Glucke!« polterte Meister Jakob weiter. »Meine Tochter, die alle Tage ins Stadthaus der Rodenbachs geht, um mit der Baronesse zu lernen! Und im Sommer wurde sie mit der Kutsche nach Gut Hochheim geholt wie ein vornehmes Fräulein . . . Jetzt sehen wir ja, was dabei herausgekommen ist!«
Er trank seinen Kaffee aus und schob die Tasse mit dem blauen Zwiebelmuster zurück. »Es ist kühl geworden, laßt uns ins Haus gehen. Mir ist der Nachmittag sowieso verleidet.«
Caroline half ihrer Mutter, den Tisch abzuräumen. Den Abwasch würde die alte Ernestine erledigen. Die Männer saßen derweil pfeiferauchend im Erkerzimmer.
Caroline holte sich ihre Strickarbeit und setzte sich dazu.
Was für ein langweiliger Tag, dachte sie und unterdrückte ein Gähnen. Während sie das rote und grüne Seidengarn durch den Batist zog, blickte sie unter halbgesenkten Lidern zu Leonhard hin.
Warum fragte er ihren Vater nicht um Erlaubnis, mit ihr noch eine Weile Spazierengehen zu dürfen? Hatte er kein Verlangen danach, mit ihr allein zu sein?
In diesem Augenblick sagte ihr Verlobter: »Wenn Sie nichts dagegen haben, Meister Jakob, würde ich mit Caroline gern auf einen Sprung bei meiner Mutter vorbeischauen.«
Ihr Vater runzelte die Stirn. »Muß es gerade heute sein?
Die Stadt ist unruhig und voller Menschen . . . «
»Es sind ja nur ein paar Schritte bis zu uns, und Mutter hat Caroline schon eine ganze Weile nicht gesehen. Wir werden ein bißchen musizieren, und nach dem Nachtmahl bringe ich sie wohlbehalten nach Hause zurück«, versprach Leonhard.
Die Vogels bewohnten ein behäbiges, etwas düsteres Haus in der Schlösserstraße. Leonhard und Caroline hatten es fast erreicht, als neben ihnen eine von zwei Braunen gezogene Kutsche hielt. Hinter dem Fenster erkannte Caroline das runde, sommersprossige Gesicht der Baronesse Rodenbach, die ihr lebhaft zuwinkte.
Friederike trug ein modisches grünes Musselinkleid, das sie noch fülliger erscheinen ließ, als sie ohnehin war. Sie öffnete die Tür und sprang auf die Straße, bevor der Lakai, der hinten auf dem Wagen stand, ihr behilflich sein konnte.
»Gerade wollte ich zu euch!« rief sie mit ihrer hellen Stimme. »Mama und Papa haben mich nach Hochheim geschickt. Sie kommen später nach, weil sie noch den Reifentanz der Böttcher vor den Graden ansehen wollen. Himmel, war das ein Tag! Ich bin ganz taub von all dem Schießen, Trommeln und Lärmen.«
Sie nickte Leonhard zu, der seinen Hut gezogen hatte und sich leicht verneigte. »Ah, der Herr Bibliothekar! Kommen Sie, steigen Sie ein, ich wollte Caroline sowieso abholen. Unsere Weimaranerhündin Betsy hat Welpen bekommen, acht Stück, die muß ich ihr unbedingt zeigen.«
»Das wird heute leider nicht möglich sein, Baronesse«, sagte Leonhard in seiner zurückhaltenden Art. »Nicht, daß ich die Freundlichkeit Ihrer Einladung nicht zu schätzen wüßte — aber ich war mit Caroline auf dem Weg zu meiner Mutter . . . «
»Ach, das können Sie ein anderes Mal nachholen. Sie haben keine Ahnung, wie süß die kleinen Hunde sind! Nicht wahr, Caroline, du möchtest sie doch auch sehen? Mama hat gesagt, du kannst dir einen aussuchen, sie schenkt ihn dir.«
»Bitte, Leonhard!« mischte sich Caroline ein. »Wenn du willst, besuchen wir morgen deine Mutter. Aber laß uns jetzt nach Hochheim fahren. Es ist ja noch früh.«
Wie ihre Augen bettelten! Ach, sie wußte wohl, daß er ihr meist ihren Willen tat, wenn sie ihn auf diese Weise ansah. »Also gut, wenn es dein und der Baronesse Wunsch ist . . . «
Es hätte nicht viel gefehlt, und sie wäre ihm auf der Straße um den Hals gefallen. Friederike kicherte, als er hastig einen Schritt zurücktrat, und dachte — übrigens nicht zum ersten Mal: Stockfisch! Er ist ein Stockfisch! Mon dieu, was hat Caroline sich nur dabei gedacht, daß sie seinen Antrag annahm! Die beiden passen doch überhaupt nicht zusammen.
Es war schon über eine Stunde dunkel, als Caroline und Leonhard endlich Gut Hochheim verließen.
Sie saßen nebeneinander auf der mit pflaumenblauem Samt bezogenen Bank der Kutsche, und Caroline schob mit einem Anflug schlechten Gewissens ihre Hand unter die von Leonhard.
»Bist du jetzt böse, weil wir so lange geblieben sind? Aber die kleinen Hunde waren wirklich zu reizend. Und als die Baronin uns zum Nachtmahl einlud, hätten wir schlecht ablehnen können. Ach, und die zwei neuen Ballkleider, die Friederike bekommen hat! Sie sind ein Traum, und Friederike schaut ganz süß darin aus, findest du nicht? Was denkst du, wie sollen wir den kleinen Hund nennen, den ich mir ausgesucht habe? Filou? Oder Taps? Er sieht so tapsig aus mit seinen großen Pfoten. Aber natürlich bleibt er nicht so, deshalb paßt Filou am Ende besser . . . Nun sag doch endlich was!«
»Was soll ich sagen?« erwiderte er lächelnd. »Du redest ja in einem fort.«
Sie lehnte den Kopf an seine Schulter. »Verzeih. Komm, gib mir einen Kuß, und dann sag mir, daß du nicht böse bist. Ich hab’ dir doch angesehen, daß du in Hochheim auf heißen Kohlen gesessen hast.«
Als er sie auf die Wange küßte, umfaßte sie sein Gesicht und zog es zu sich herunter. »Küß mich richtig!« verlangte sie mit geschlossenen Augen. Da berührte er ihre Lippen.
Es war ein sehr zärtlicher, beinahe andächtiger Kuß, dennoch enttäuschte er Caroline.
Sie blinzelte zu Leonhard hoch. »Warum bist du eigentlich immer so . . . so . . . « Sie verstummte. ›So langweilig‹, hätte sie beinahe gesagt. Aber das wäre natürlich furchtbar häßlich gewesen. Leonhard war nicht langweilig. Er war sehr klug und belesen, er wußte viele wissenswerte Dinge, und er war der netteste, anständigste Mensch, den sie kannte.
»Wie — so?« fragte er. »Wie bin ich denn in deinen Augen?«
»Ach, hör nicht hin, was ich rede. Du bist schon recht, Leonhard. Nur ich bin manchmal unvernünftig. Da ist es ganz gut, daß du anders bist.«
Sie nahm seine Hand und legte sie gegen ihre Wange. Trotzdem, dachte sie, ein bißchen leidenschaftlicher könnte er schon sein. Schließlich liebt er mich doch, und im nächsten Sommer wollen wir heiraten.
In diesem Augenblick rief Fritz, der Rodenbachsche Kutscher, auf dem Bock zornig: »Wollt ihr wohl aus dem Weg gehen, ihr Bande . . . «
Die beiden Braunen, die bis dahin gemächlich dahingetrabt waren, wieherten und gingen hoch, als er hart an den Zügeln riß. Die Kutsche schwankte ein paarmal von einer Seite auf die andere und kam dann zum Stehen.
Wieder schrie Fritz, und die schreckerstarrte Caroline hörte ein, zwei dumpfe Schläge.
Im nächsten Moment wurde die Kutschentür an ihrer Seite aufgerissen, und ein Mann schwang sich herein.
Er trug eine blaue Uniform mit langen Rockschößen und hielt eine Pistole in der Hand. Ehe Caroline es sich versah, hatte er ihren Arm ergriffen und sie ins Freie gezerrt.
Leonhard war aufgesprungen. Er wollte sich auf ihren Angreifer sturzen, doch da warfen sich von der anderen Seite zwei weitere Soldaten auf ihn und rissen ihn zurück. Einer der Männer versetzte ihm mit dem Kolben seines Karabiners einen so heftigen Schlag über den Kopf, daß er das Bewußtsein verlor und zu Boden stürzte.
Die beiden Männer zogen ihn vollends aus der Kutsche und ließen ihn liegen.
Sie hatten auch Fritz niedergeschlagen. Er hing halb über dem Kutschbock und rührte sich nicht.
»Geld her!« zischte der Mann, der Caroline aus der Kutsche geholt hatte. Er sprach deutsch mit einem starken französischen Akzent.
» Vite, vite!«
»Aber ich habe nichts . . . ich bin doch nur . . . um Gottes willen, laßt mich los!«
Sie roch den Branntweinatem des Mannes, als er ihr die Kette mit dem kleinen goldenen Kreuz vom Hals riß und den Inhalt ihrer gestickten Tasche einfach auf den Weg schüttete. Ein Schlüssel, ein feines Spitzentaschentuch und ein kleiner Kamm kamen zum Vorschein.
Der Franzose stieß einen unterdrückten Fluch aus.
Seine beiden Kumpane hatten sich indessen Leonhards Geldbörse bemächtigt. Auch sie fluchten gottserbärmlich, als sie die paar Kupfermünzen und den einzigen Silbertaler darin entdeckten. Sie hatten wohl in der eleganten Kutsche der Rodenbachs ebenso elegante Reisende vermutet.
Die beiden kamen zu Caroline hinüber. Einer faßte in ihr Haar und riß ihren Kopf zurück. »Merveilleux!« sagte er grinsend. »Was für eine hübsche rothaarige Katze!«
Er hatte ein hageres, spitznasiges Gesicht. Seine Zähne waren schadhaft und fleckig.
Caroline schlug ihm auf die Hand, als er nach ihrer Brust griff. Sie wehrte sich und trat um sich, als der andere sie von rückwärts um die Taille faßte und hochhob. Das Mieder ihres Kleides zerriß.
In diesem Augenblick näherte sich von der Stadt her rasches Hufgetrappel.
»Hilfe!« schrie Caroline. »Zu Hilfe!« Ihre Stimme erstickte, als der Hagere ihr seine Hand auf den Mund preßte.
»Laß sie!« rief der dritte. »Verdammt, wir müssen verschwinden!« Caroline wurde so rasch losgelassen, daß sie zu Boden stürzte und für einen Augenblick benommen liegen blieb. Sie hörte, wie ihre Angreifer hastig im Unterholz neben der Straße verschwanden.
Gleich darauf verstummte das Hufgetrappel, und sie gewahrte, wie ein Mann aus dem Sattel eines Schimmels sprang.
»Mon dieu, was ist passiert?« Ihr unbekannter Retter beugte sich über sie.
»Wir . . . sind überfallen worden«, stammelte Caroline. »Um Gottes willen, was ist mit Leonhard?«
Sie kam taumelnd auf die Füße und lief zu ihrem Verlobten.
Er schlug gerade mit einem Stöhnen die Augen auf. Blut sickerte aus der Wunde an seinem Kopf. »Caroline . . . « murmelte er. Dann entdeckte er ihr zerrissenes Kleid und fuhr hoch. »Was haben die Schweine mit dir gemacht?«
»Nichts, Leonhard«, sagte sie und brach vor Erleichterung, daß er lebte, in Tränen aus. »Sie sind fort. Dieser Herr hier ist zur rechten Zeit gekommen.«
Sie merkte, wie der Unbekannte auf ihre Brüste blickte, und raffte hastig das Kleid zusammen. »Wir sind Ihnen zu großem Dank verpflichtet, Monsieur . . . «
Er verneigte sich. »Ich bin der Chevalier de Lancourt, Pierre de Lancourt, Leutnant der Reitenden Jäger der Garde.« Er hatte eine angenehme Stimme, blitzende schwarze Augen und schwarze Locken, die unter dem roten Tschako hervorquollen. Ein Oberlippenbärtchen gab ihm einen verwegenen Anstrich. Als Caroline sich aufrichtete, sah sie, wie groß er war, mindestens einen halben Kopf größer als Leonhard.
»Danke, Herr Leutnant. Sie haben uns wirklich aus einer schrecklichen Gefahr gerettet.«
Er lachte auf sie herunter. »Leider habe ich gar nichts getan. Dabei hätte es mir großes Vergnügen bereitet, die Halunken, die Sie überfallen haben, auf meine Degenspitze zu spießen. Es wäre die gerechte Strafe gewesen, daß sie eine so bezaubernde junge Dame in Angst versetzt haben. Schade, daß sie vor meinem bloßen Anblick die Flucht ergriffen haben.«
»Oh, es waren aber drei«, sagte Caroline.
»Für Sie, Mademoiselle, hätte ich es mit zehn solcher Burschen aufgenommen.«
»Lieber nicht, Herr Leutnant. Es war schon schlimm genug, daß man meinen Verlobten und den Kutscher niedergeschlagen hat.«
Sie sprachen französisch miteinander, und Pierre de Lancourt meinte: »Man könnte denken, Sie stammten aus Paris, Mademoiselle. Zumindest haben Sie dort unsere Sprache erlernt, nicht wahr?«
»Mein Lehrer, Monsieur Frambonnet, ist aus Compiègne. Ich selbst war noch nie in Frankreich.«
Leonhard war inzwischen aufgestanden. Er schwankte und hielt sich an der Kutsche fest. »Was . . . was ist mit Fritz?« Ihm war noch sehr elend zumute, und in einer ganz und gar unvernünftigen Aufwallung ärgerte es ihn, daß ausgerechnet dieser schneidige Franzose sie aus ihrer prekären Lage befreit hatte.
Er wollte nach vorn zu dem Kutscher, doch Pierre de Lancourt kam ihm zuvor. Er schwang sich auf den Bock und drehte den Körper des Bewußtlosen so, daß er ihn ansehen konnte. Dann legte er ihn auf die Bank zurück.
»Der hat ebenfalls einen ordentlichen Hieb abbekommen. Aber es sieht so aus, als käme er allmählich zu sich.«
Fritz stöhnte und bewegte sich. Als er die Augen aufschlug und das fremde über sich gebeugte Gesicht sah, wollte er mit einem Schrei hochfahren, doch Pierre drückte ihn sacht zurück. »Bleiben du liegen . . . « sagte er in gebrochenem Deutsch. »Gleich werden besser . . . «
Dann wandte er sich zu Leonhard und fügte auf französisch hinzu: »Sie sollten sich ebenfalls eine Weile niederlegen, Monsieur. Kommen Sie, ich helfe Ihnen in den Wagen.«
Leonhard wollte widersprechen, aber Caroline pflichtete Pierre bei. »Sei vernünftig, Lieber. Sobald du dich ein wenig erholt hast, bringen wir dich zu einem Arzt.«
»Ich brauche keinen Arzt«, protestierte Leonhard. Er betrachtete seine Braut. »Ist dir auch wirklich nichts geschehen?«
»Nein, nein, ich bin mit dem Schrecken davongekommen.« Sie faßte ihn unter den Arm, und gemeinsam mit Pierre brachten sie ihn in die Kutsche, wo Leonhard sich erschöpft auf der Polsterbank ausstreckte.
Caroline blieb bei ihm sitzen und streichelte seine Hand. »Es tut mir so leid. Wenn ich nicht unbedingt nach Hochheim gewollt hätte, wäre das nicht passiert.«
»Mach dir keine Vorwürfe«, murmelte er schwach und schloß die Augen, weil sich alles um ihn drehte.
Gleich darauf erschien Pierre de Lancourt mit dem Kutscher. Er hatte Fritz untergefaßt und schob ihn ebenfalls in die Kutsche.
»So, da ist der zweite Patient. Wir legen ihn auf die andere Bank. Sie, Mademoiselle, müßten dann freilich neben mir auf dem Bock Platz nehmen, aber das ist immer noch besser, als die halbe Nacht hier herumzustehen. Mein Pferd binden wir neben dem Wagen an und zockeln dann langsam und vorsichtig in die Stadt zurück.«
»Das ist nicht nötig, Monsieur«, sagte Leonhard steif. »Sobald ich mich ein wenig besser fühle, kann ich fahren. Wir haben Sie schon lange genug aufgehalten.«
»Ach, ich wollte ohnehin nur mein Pferd ein wenig bewegen, nachdem es heute bei den Paraden nur Schritt gehen durfte. Bleiben Sie liegen, Monsieur, und erlauben Sie mir, Sie und den Kutscher zu einem Arzt zu bringen. Außerdem sollten Sie Anzeige bei der Gendarmerie erstatten.«
»Glauben Sie, das nützt etwas?« fragte Leonhard bitter.
»Die Männer, die uns überfallen haben, waren Soldaten der Grande Armée.«
»Wahrhaftig? Nun, das bedauere ich ganz besonders. Um so entschiedener sollte ich darauf dringen, daß die Sache zur Anzeige gebracht wird, damit man dieses Gesindels habhaft wird.«
»Regen Sie sich nicht auf, Herr Leutnant. Seit wir unter französischer Besatzung leben, sind wir an solche Dinge gewöhnt. Überfälle und Plünderungen sind beinahe an der Tagesordnung.«
»Leonhard!« murmelte Caroline erschrocken. Entschuldigend wandte sie sich an Pierre de Lancourt: »Geben Sie nichts auf das, was er sagt, Herr Leutnant. Offenbar ist mein Verlobter noch etwas verwirrt von dem Schlag, den er bekommen hat.«
Pierre musterte Leonhard mit gerunzelter Stirn. »Ja, offenbar«, meinte er kühl. Dann lächelte er Caroline zu. »Außerdem, wenn ein Mann eine so reizende Fürsprecherin hat . . . Kommen Sie, Mademoiselle, lassen Sie uns fahren.«
Ehe sie auf den Kutschbock steigen konnte, hatte er sie um die Taille gefaßt und mit Schwung hochgehoben. Dann band er sein Pferd an den Wagen und setzte sich neben Caroline. Er ergriff die Zügel, schnalzte mit der Zunge, und gleich darauf zog das Gespann an. In gemächlichem Tempo fuhren sie der Stadt zu.
»Sie haben mir noch gar nicht Ihren Namen genannt«, meinte Pierre nach einer Weile. »Oder doch, warten Sie . . . Ihr Herr Bräutigam nannte Sie Caroline.«
»Ich heiße Caroline Weikersheim . . . « sagte sie. »Und der Name meines Verlobten ist Leonhard Vogel. Er ist Bibliothekar an der Universität.«
»Und Sie sind sehr verliebt in ihn?«
Sein neckender Tonfall machte sie ein wenig befangen.
»Wir wollen im nächsten Sommer heiraten.«
»Der Glückliche!« Pierre seufzte. »Nicht daß ich auf die Ehe erpicht wäre — im Gegenteil, ich bin bis jetzt erfolgreich allen Schlingen entgangen, die man mir legen wollte. Aber die Liebe eines so schönen Mädchens ist schon etwas, um das man einen Mann beneiden kann. Oder lieben Sie den Herrn Bräutigam etwa nicht?«
»Natürlich tue ich das«, erwiderte sie hastig. »Wäre ich sonst mit ihm verlobt?«
»Ihre Eltern haben Sie also nicht dazu gezwungen? Wie schade! Ich gefiel mir schon in der Vorstellung, ich könnte Sie vielleicht aus den Armen eines ungeliebten Mannes befreien, den Ihnen ein rücksichtsloser, uneinsichtiger Vater aufzwingen wollte.«
»Wie wollten Sie das wohl anstellen!« Caroline ging auf seinen scherzhaften Ton ein.
»Oh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Beispielsweise könnte ich mit Ihnen durchbrennen . . . Oder ich könnte Ihren Verlobten im Duell töten. Ich bin ein gefürchteter Degenfechter und ein fast ebenso guter Pistolenschütze.«
»Sie haben sich wohl schon oft duelliert?« »Gelegentlich«, antwortete er wegwerfend. »Allerdings — unser allergnädigster Kaiser schätzt keine Ehrenhändel und noch weniger die Gründe, die ihnen vorausgehen. Er ist sehr auf Moral bedacht.« »Aber er ist doch . . . ich meine, er hat . . . «
»Sie meinen, daß er gelegentlich auch seine Vergnügungen außerhalb des ehelichen Bettes sucht? Nun, was seine Amouren betrifft, so sind sie vermutlich um nichts ausschweifender als die eines braven korsischen Familienvaters, der hin und wieder verschämt aus den ehelichen Banden ausbricht. Aber selbst diese Freiheit will Seine Majestät den übrigen Bonapartes und seinen Vertrauten und Offizieren nicht zugestehen. Sie glauben gar nicht, wie er sich über die zahlreichen Liebhaber seiner schönen Schwester Pauline empört. Oh, da sind schon Teller und Tassen durch die Luft geflogen, wenn er die Fürstin nach St. Cloud befahl, um ihr wegen ihres lockeren Lebenswandels den Kopf zurechtzusetzen.«
»Sie reden sehr offen über Ihren Kaiser . . . «
»Werden Sie’s ihm weitersagen?« fragte Pierre neckend.
»Gewiß nicht, aber . . . «
»Nun, ich bin Leutnant einer Schwadron, die einen Sonderdienst bei Seiner Majestät versieht. Wir sind ständig in seiner Nähe. Einer von uns trägt das Portefeuille des Kaisers, ein anderer das Fernglas. Wo er auch hinkommt, wir galoppieren ihm voraus, um ihm Platz zu schaffen. Und wenn er vom Pferd absteigt, tun wir es ebenfalls, pflanzen das Bajonett auf und marschieren im Geviert, so daß der Kaiser in unserer Mitte ist. Wenn er irgendwo Quartier nimmt, so ist einer unserer Offiziere — ich oder ein anderer, je nachdem, wer gerade Dienst hat — ständig im Nebenraum. Daher weiß ich auch so gut über alles Bescheid, was sich in seiner engsten Umgebung abspielt. Und ich darf mich rühmen, daß der Kaiser ein gewisses Wohlwollen für mich hegt. Er kann sehr kalt und hochfahrend sein, aber er ist es fast nie zu seinen Soldaten. Da ist er immer noch der ›kleine Korporal‹, wie sie ihn in den Tagen des Italien- und Ägyptenfeldzuges genannt haben, einer, der mit ihnen umgeht, als sei er ihresgleichen, der mit ihnen trinkt und sich auch schon mal einen derben Scherz gefallen läßt.«
Er wandte den Kopf. »Aber was reden wir über den Kaiser. Jetzt sind wir schon in der Stadt, und ich weiß noch so gut wie gar nichts von Ihnen.«
»Ach, da gibt es nicht viel zu erzählen. Mein Vater ist Schneidermeister. Er besitzt ein recht gut florierendes Atelier und hat viele der eleganten Roben geschneidert, die Sie in den nächsten Tagen auf den Festlichkeiten zu Ehren Ihres Kaisers sehen werden.«
»Und hat er noch mehr solche hübschen Töchter wie Sie?«
»Nein, ich bin sein einziges Kind, seit mein Bruder . . . Er ist an den Folgen einer Verletzung gestorben, die er in Auerstedt davongetragen hat.«
»Ach . . . « Der Chevalier de Lancourt wirkte einen Augenblick lang betroffen. »Das tut mir leid. Verdammter Krieg! Ich wünschte, er ginge irgendwann zu Ende, und wir hätten einen dauerhaften Frieden.«
»Natürlich unter der Vorherrschaft des französischen Kaisers, nicht wahr?« rutschte es Caroline heraus.
»Ja, warum nicht? Was wäre so schlecht an einem Europa, das unter einer starken Hand vereinigt ist?«
»Würde es Ihnen als Franzose gefallen, wenn ich Frankreich gern unter preußischer oder österreichischer Herrschaft sähe?«
»Ich fürchte — nein.« Pierre lachte. »Aber das liegt vermutlich daran, daß ich so sehr von der Großartigkeit Frankreichs und seines Kaisers durchdrungen bin.« Er legte seine Hand auf ihre, und es war ein merkwürdig prikkelndes Gefühl für sie. Wie gut er doch aussah mit seinen blitzenden Augen und der schlanken Figur im grünen, goldgeschnürten Dolman! Und was für eine weiche, dunkle Stimme er hatte.
»Schade, daß Sie in Erfurt wohnen«, sagte er mit einem halben Lächeln. »Warum kann es nicht Weimar sein oder noch besser Dresden! Ich würde gern noch tagelang mit Ihnen herumfahren, Mademoiselle Caroline, um Sie heimzubringen, und würde es nicht müde werden.«
»Aber ich bin gleich zu Hause. Wenn Sie hier am Hirschlachufer entlangfahren und dann vorn in die Neuwerksstraße einbiegen . . . «
»Sollen wir nicht zuerst unsere beiden Verwundeten zu einem Arzt bringen? Während er sie versorgt, fahre ich Sie heim, Mademoiselle, und hole die zwei anschließend wieder ab.«
Caroline sah ein, daß dies ein vernünftiger Vorschlag war, wenngleich sie sich ein wenig Sorgen über die Reaktion ihres Vaters machte, wenn sie mit einem französischen Offizier nach Hause kam. Andererseits — Papa mußte es ja nicht erfahren. Ihre Eltern waren bestimmt schon zu Bett gegangen, da sie ihre Tochter ja unter Leonhards Obhut bei ihrer zukünftigen Schwiegermutter wähnten. Freilich, das Licht in der Schlafkammer würde noch brennen, wie immer, wenn Caroline nicht daheim war. Ihre Mutter schlief nie, bevor die Tochter nicht in ihrem eigenen Bett lag.
»Kennen Sie einen guten Arzt?« fragte Pierre, und sie nickte zögernd. »Ja, Doktor Immanuel Gellert. Er wohnt am Anger. Biegen Sie vorn links ab und dann wieder rechts in die große breite Straße.«
Wenige Minuten später hielt die Kutsche vor einem etwas düsteren Steinhaus mit einem zweiflügeligen Portal. Pierre de Lancourt sprang vom Bock und betätigte den bronzenen Türklopfer in Form eines Löwenkopfes.
Die Schläge hallten laut durch die Dunkelheit, und es dauerte nicht lange, bis im Oberstock ein Licht entzündet wurde und ein Frauenkopf mit einer weißen Haube hinter dem Fenster erschien. »Was gibt’s?«
»Ich bin’s, Frau Gellert«, rief Caroline hinauf. »Caroline Weikersheim. Ist Ihr Mann zu Hause?«
»Ist bei euch jemand krank?«
»Wir haben zwei Verletzte im Wagen. Ein Überfall . . . «
»Ach Gott, ach Gott . . . « Klirrend flog die Fensterscheibe zu. Es dauerte nicht lange, bis Fanny Gellert die schwere Tür aufschloß. Sie war im Nachtgewand und hatte hastig einen Mantel darübergeworfen. In der Hand trug sie eine Lampe.
Ihr Mann folgte ihr auf dem Fuße. Sein weißer Haarkranz stand wirr von seinem Kopf ab. Er war offenbar noch nicht im Bett gewesen, denn er war vollständig angekleidet.
Pierre de Lancourt hatte indessen Leonhard und Fritz aus dem Wagen geholfen. Der Kutscher hielt sich stöhnend den Kopf, und auch Leonhard protestierte nicht mehr, daß man ihn zu einem Arzt gebracht hatte.
»Kommt herein«, sagte Doktor Gellert. Seine Frau leuchtete ihnen die Steintreppe hinauf und öffnete die Tür zur Ordination.
Es war ein hoher, mit Büchern, unzähligen Ampullen, Deckelgläsern und Phiolen vollgestopfter Raum. In einer Ecke stand, solange Caroline sich erinnern konnte, ein Skelett, dessen Anblick ihr jedesmal einen kleinen Schauer über den Rücken jagte.
Ein dunkler Eichenschrank beherbergte Doktor Gellerts Instrumente und das Verbandszeug.
Der Arzt öffnete ihn und entzündete dann erst einmal mehrere Lampen. Falls er erstaunt war, daß ein französischer Offizier Caroline und die beiden Männer begleitete, so ließ er sich das nicht anmerken.
»Sind Sie ebenfalls verletzt, Monsieur?« fragte er nur und musterte Pierre Lancourt prüfend.
»Nein, glücklicherweise nicht, Monsieur le Docteur. Ich werde jetzt die junge Dame nach Hause fahren und komme auf dem Rückweg wieder vorbei.«
»Gut, gut«, knurrte Doktor Gellert. Da er Caroline seit ihren Kindertagen kannte, duzte er sie immer noch. »Wird Zeit, daß du ins Bett kommst, Mädchen. Du stehst mir nur im Weg herum, und da ich deinem Schatz vielleicht ein bißchen weh tun muß, fällst du mir womöglich noch in Ohnmacht. Das kann ich nicht gebrauchen. Also bringen Sie das Fräulein wohlbehalten heim, Herr Leutnant. Adieu, adieu.«
Leonhard wollte auffahren, sagen, daß er Caroline nach Hause begleiten werde, doch der Arzt drückte ihn auf einen Stuhl. »Ruhe, junger Freund. Erst sehen wir uns mal Ihren Kopf an. Donnerlittchen, das war ein ordentlicher Schlag. Eine Beule wie ein Gänseei und aufgeplatzt ist sie auch noch. Da werden wir ein paar Stiche nähen müssen. Außerdem haben Sie ohne Zweifel eine leichte commotio cerebri davongetragen, und das bedeutet ein paar Tage strenge Bettruhe. Fanny, gib mir mal eine Schüssel mit Wasser und ein paar Leintücher. Und dann halt mir die Lampe.«
Hinter Caroline und Pierre schloß sich die Tür.
Leonhard biß auf die Zähne, als der Doktor die teilweise aufgeplatzte Schwellung abtastete und das verkrustete Blut entfernte. Er wußte, daß er Pierre de Lancourt zu Dank verpflichtet war, gleichwohl empfand er noch immer ein dumpfes Mißtrauen gegen ihn, und es gefiel ihm gar nicht, daß der Franzose jetzt mit Caroline allein war. »Sie hätten Mamsell Weikersheim mit dem Leutnant nicht fortlassen sollen, Doktor«, murmelte Leonhard und stieß zischend den Atem aus, als Immanuel Gellert ein wenig Branntwein auf seine Wunde tupfte.
»Sollte ich sie vielleicht allein in der Dunkelheit nach Hause gehen lassen?« Ungerührt fuhr der Arzt mit der Prozedur fort. »Das brennt, ich weiß. Aber ich kenne nichts Besseres, um eine Wunde sauber zu halten. Gleich ist es vorbei. Dann nähen wir, und anschließend kriegen Sie einen schönen Verband, junger Freund.«
»Sie hätte auf mich warten können. Dann hätte ich sie heimgebracht«, beharrte Leonhard.
»Unsinn. Sie gehören auf der Stelle ins Bett. Ein Mondscheinspaziergang mit dem Fräulein Braut wäre absolut schädlich für Ihren Brummschädel. Außerdem machte der junge Mann einen ganz vernünftigen Eindruck. Nicht alle Franzosen sind Halunken. Ich war als junger Baccalaureus eine Zeitlang in Lyon und Paris, später in England, und überall habe ich die Erfahrung gemacht, daß Schlechtigkeit oder Tugenden nicht auf eine Nation beschränkt sind. Im übrigen ist Mamsell Caroline ein couragiertes Frauenzimmer. Der kann ein junger Mann mit guter Erziehung — und die besaß dieser Offizier zweifellos — nichts anhaben, was sie nicht selber will.« Und er lachte dröhnend.
Das »couragierte Frauenzimmer« hatte währenddessen wieder neben Pierre de Lancourt auf dem Kutschbock Platz genommen. Er hatte sie einfach hinaufgehoben und gemeint: »Das ist netter als in der Kutsche. So können wir noch ein Weilchen plaudern.«
Also saßen sie nun nebeneinander, und Caroline hielt ihr zerrissenes Mieder am Halse zusammen. Lieber Gott, dachte sie besorgt, laß Papa und Mama wirklich schon im Bett sein. Was soll ich ihnen nur über den heutigen Abend erzählen?
»Sie plaudern wirklich reizend«, sagte Pierre in diesem Moment spöttisch.
Sie zuckte zusammen. »Was soll ich denn reden? Ich mache mir Sorgen um meinen Verlobten . . . «
»Der Glückliche! Aber ich schwöre Ihnen, daß ich ihn wohlbehalten bis zu seinem Bett bringen werde. Um den Kutscher kümmere ich mich natürlich auch. Sie brauchen sich also keine Gedanken zu machen, Mademoiselle. Hier, sagten Sie, müssen wir einbiegen?« Er deutete in die Neuwerksstraße, die sie inzwischen erreicht hatten.
»Ja, ich wohne im letzten Haus links neben der Kirche.« Sie beugte sich nach vorn und sah erleichtert, daß die Fenster zur Straße dunkel waren. »Halten Sie bitte ein Stück davor. Ich möchte nicht, daß jemand geweckt wird. Die letzten paar Schritte kann ich zu Fuß gehen.«
Pierre zog an den Zügeln und brachte die Pferde zum Stehen. Danach wandte er sich Caroline zu.
»Ich werde warten, bis Sie im Haus sind. Dann also adieu, Mademoiselle Caroline. Schade, daß wir uns jetzt Lebewohl sagen müssen. Ich wäre gern noch länger mit Ihnen zusammengeblieben.« Er nahm ihre Hände und zog eine nach der anderen an die Lippen:
Hastig wich Caroline zurück. »Lassen Sie das doch!«
Er sah ihr lächelnd in die Augen. »Das Schicksal ist grausam mit mir. Da habe ich nun ein schönes Mädchen aus der Gewalt von Räubern befreit, und es küßt mich nicht einmal zum Abschied. Dabei ist das der übliche Lohn für einen Lebensretter.«
Er sollte sie nicht so ansehen! Und er sollte nicht solche Sachen sagen — nicht mit dieser einschmeichelnden, seidenweichen Stimme!
»Leben Sie wohl, Monsieur. Und ich danke Ihnen. Wirklich, ich danke Ihnen sehr . . . «
Er hob die Hand und strich ihr damit über die Lippen.
»Gib mir meinen Lohn, meine Schöne«, flüsterte er. »Ich habe so große Lust darauf.« Und dann nahm er Caroline einfach in die Arme und küßte sie.
Nie zuvor war sie so geküßt worden. Pierre de Lancourt ergriff Besitz von ihrem Mund und öffnete ihn mit seiner Zunge, während er ihren Kopf zurückbog. Seine rechte Hand umfaßte ihr Haar, und seine Linke tastete über ihren Hals und dann tiefer, wo das zerrissene Kleid ihre nackte Haut freigab.
Caroline spürte, wie Pierres Zunge über ihre Zähne glitt und dann in ihren Mund eintauchte.
Sie stieß einen kleinen Laut aus, der Überraschung, Abwehr und gleichzeitig Entzücken war. Pierre saugte sich an ihren Lippen fest, und sie hatte das Empfinden, plötzlich in Feuer getaucht zu sein.
Ohne daß sie es wußte und wollte, legte sie die Arme um seinen Hals und preßte sich an seine Brust.
Ach, es war so unglaublich, und es erregte sie auf eine nie gekannte Weise. Niemals hätte sie geahnt, daß ein Kuß, daß die Umarmung eines Mannes so sein konnte. Oder doch — sie hatte es geahnt und vermißt, wenn Leonhard sie küßte. Sie hatte jedesmal das Empfinden gehabt, daß er ihr etwas ganz Wunderbares, Verrücktes vorenthielt. O Gott, Leonhard . . .
Als Pierre sie losließ, starrte Caroline ihn aus großen, glänzenden Augen an.
»Meine Schöne . . . « sagte er leise, und sie sah in seinem Gesicht, daß auch ihn dieser Kuß verwandelt hatte.
Sein Blick glitt tiefer, zu ihren halb entblößten Brüsten, und er streckte die Hand aus, um sie zu berühren.
»Komm«, murmelte er. »Komm wieder her zu mir . . . «
»Nein«, preßte sie hervor. »Nein, nein, nein . . . « Aber es galt mehr ihr als ihm.
Sie wandte sich um und sprang mit einem Satz von der Kutschenbank auf das Pflaster. Ihr Knöchel knickte um, und sie verspürte einen kleinen scharfen Schmerz. Aber sie achtete nicht weiter darauf, sondern rannte davon.
2
Napoleon Bonaparte, Kaiser der Franzosen, lehnte in einer Fensternische und überflog mit gerunzelten Brauen das Schreiben, das ihm soeben von Major de Brissot, einem Kurier seines Bruders Joseph, aus Spanien überbracht worden war.
Der Kaiser war schlecht gelaunt. Das verrieten der schmale, verpreßte Mund und seine ganze Haltung. Er hatte den Kopf zwischen die Schultern gezogen und trommelte mit der linken Hand ein gereiztes Stakkato auf die Fensterbank.
Draußen regnete es, und das kühle, über Nacht herbstlich gewordene Wetter war nicht dazu angetan, Napoleons Stimmung zu heben.
Dieses Deutschland, dachte er. Vier Monate Winter und acht Monate Regen . . .
Für einen Augenblick empfand er Sehnsucht nach seiner korsischen Heimat mit den hellen, von der Sonne ausgeglühten Felsen, den blauen Buchten und den weißen Häusern im Sonnenglast.
Er meinte, das Rauschen der Brandung zu hören und die salzige, heiße Luft zu schmecken. Selbst den Geruch nach Meer und Hafen, nach blühendem Oleander, Minze und Olivenöl, vermeinte er in der Nase zu haben.
Mit einer ärgerlichen Bewegung wandte er sich ab und warf den Brief seines Bruders auf einen mit allerlei Karten und Schriftstücken bedeckten Tisch.
Dann blickte er Major de Brissot aus funkelnden Augen an. »Der König von Spanien hat es also vorgezogen, seine Hauptstadt Madrid zu verlassen, um sich hinter den Duero zurückzuziehen. Warum?« »Sire«, sagte Brissot zögernd, »ich kenne den Inhalt des Briefes nicht, den Ihr königlicher Bruder an Eure Majestät gesandt hat, aber ich vermute, daß er Ihnen seine Gründe dargelegt hat.
« Napoleon schlug mit der Hand auf den Tisch. »Ich habe Sie gefragt, Major, und ich erwarte eine Antwort von Ihnen! Sie kommen aus dem Hauptquartier meines Bruders, Sie waren in Madrid dabei, als er vor vier Monaten zum König ausgerufen wurde, und Sie kennen die spanischen Verhältnisse aus eigener Anschauung. Genau diese will ich hören.«
»Die Spanier, Sire, sind ein merkwürdiges, schwer zu begreifendes Volk. Ihr königlicher Bruder hat die liberale Verfassung bestätigt, sowie die Inquisition und die provinzialen Zollbehörden abgeschafft — Taten, so meint man, die genügen dürften, um Spanien aufatmen zu lassen. Aber was ist geschehen? Dieses Volk will seine Inquisition behalten, seine Unfreiheit, seine Steuerlasten. Darin ist es sich einig, wiewohl es unter der Herrschaft seines bisherigen Königs uneins und zerstritten war und sich die verschiedensten Interessengruppen auf das Intriganteste befehdeten. Immer hat es in Spanien Rebellion gegeben, und nun auf einmal steht dieses Volk wie ein Mann auf und ruft nach seinen alten Herrschern, denen es angeblich so treu ergeben sei . . . « Napoleon winkte ab. — »Das ist mir hinlänglich bekannt. Ich will wissen, wie die Lage jetzt in Spanien ist.«
»Je nun, Sire . . . Es ist eine verfluchte Sache, einen Guerillakrieg zu führen. Überall, in jedem Dorf, in jedem Haus, hinter jeder Felsnase hocken die Halunken, und ehe man sich’s versieht, kommen sie aus ihren Verstecken, und man hat sie an der Gurgel. Ha, in einer offenen Schlacht, da würden wir schon mit ihnen aufräumen, daß sie beim Davonrennen die Stiefel verlören, die verfluchten Señores, aber wenn sie im Hinterhalt liegen, und man kriegt unversehens ein Messer oder eine Kugel in den Rücken — oder sie springen wie die Affen von den Bäumen und ziehen einem eine Schlinge um den Hals zu . . . Das ist ein Gefühl, als ob man unter Räuber und Wegelagerer gefallen wäre. Wir kämpfen da nicht gegen Soldaten, Sire, sondern gegen ein ganzes fanatisches, verbohrtes Volk. Alte und Jüngelchen sind’s, und ich habe sagen hören, daß selbst ein paar Weiber kochendes Wasser vom Hausdach geschüttet haben, als die Unseren vorübergeritten sind. In Madrid hat König Joseph, Ihr Bruder, Geld unter das Volk auf die Straße werfen lassen, und kaum einer hat sich danach gebückt und es aufgehoben. Haufenweise sind die Silberstükke liegengeblieben, und wer sich doch was genommen hat, den haben seine Landsleute hinterher verprügelt. Die Kollaborateure aber, wie sie die nennen, die es vernünftigerweise mit uns halten, haben sie aufgeknüpft oder in ihren eigenen Häusern geröstet.«
»Hm . . . « Napoleon wanderte unruhig in dem einfenstrigen Kabinett auf und ab. Dieses Spanien wuchs sich zu einem Problem aus. Aber es war eine absolute Notwendigkeit, es fest in die Hand zu bekommen, um die Kontinentalsperre gegen England lückenlos aufrechtzuerhalten. Junot hatte Portugal erobert und den Briten damit einen empfindlichen Schlag zugefügt. Alles hatte sich so gut angelassen. Godoy, der eigentliche spanische Regierungschef, hatte einen so beflissenen Eifer entwickelt, Portugal zwischen Frankreich und Spanien aufzuteilen, Burgos, Valladolid und Victoria waren bereits in französischer Hand gewesen, und im Februar hatte man Murat zum Kaiserlichen Stadthalter in Spanien ernannt. Wenig später waren Pamplona und Barcelona erobert worden, und im März war Murat nach Madrid marschiert. Fünf Wochen später hatte Napoleon in Bayonne zum letzten entscheidenden Schlag ausgeholt: Der spanische König Karl IV. wurde gezwungen, zugunsten des »Kaiserlichen Treuhänders«, wie Napoleon sich nannte, abzudanken, und Kronprinz Ferdinand gleicherweise genötigt, auf seinen Thronanspruch zu verzichten.
Wie sicher war er, Napoleon, da gewesen, die spanische und portugiesische Frage ein für allemal vom Tisch zu haben. Die Berufung Josephs zum spanischen König war nur der Schlußpunkt gewesen. Doch nun zeichneten sich Schwierigkeiten über Schwierigkeiten ab.
Die aufständischen Spanier hatten um britische Unterstützung nachgesucht und erhalten. Portugal, kaum erobert, mußte von Junot aufgegeben werden, nachdem Wellesley mit vierzehntausend Mann gelandet war und die Franzosen bei Vimeiro geschlagen hatte.
Und die Spanier kämpften mit dem Mut der Verzweiflung. Dupont, der mit seinen Divisionen zunächst bis Cordoba gekommen war, hatte sich General Castaños ergeben, so daß die ursprüngliche französische Streitmacht von einhundertzwanzigtausend Mann empfindlich zusammengeschrumpft war.
In aller Eile hatte Napoleon die kampferprobten Korps von Victor, Mortier und Ney von der Elbe abgezogen und auf die iberische Halbinsel geschickt; gleichwohl war ihm klar, daß dies nicht ausreichen würde, um die verlorenen Gebiete zurückzuerobern.
Die Zeit brannte ihm unter den Nägeln. Er mußte selbst nach Spanien, um das Oberkommando über die Armée d’Espagne zu übernehmen, und er mußte weitere Divisionen aufbieten. Dies aber war nur möglich, wenn er sicher sein konnte, daß indessen nicht in Mitteleuropa, geschürt von Österreich und Preußen, ein neuer Kriegsbrand ausbrach.
Verdammter Joseph, dachte Napoleon. Er ist kein Dummkopf, mein Bruder, nein, wahrhaftig nicht. Er muß doch wissen, wie sie alle nur darauf lauern, daß ich Schwäche zeige, um im nächsten Augenblick über uns herzufallen.
Und Joseph weiß nichts Besseres, als den Thron von Neapel zurückzuverlangen, damit er Spanien den Rücken kehren kann. Statt daß er bleibt und kämpft, schreibt er nichts als larmoyantes Gefasel über die grausame Uneinsichtigkeit der Spanier und daß Soult, Masséna und die anderen das Land ausplündern, um sich die Taschen vollzustopfen.
Bei Gott, ich habe eine hervorragende Familie! Louis, der sich nur in Bädern herumtreibt, seine Frau verdächtigt, mit mir im Bett zu liegen, und seine Energie damit vergeudet, sich ständig über mich zu beklagen.
Joseph, dessen einziges Talent offenbar darin besteht, auf eine grämliche Weise sparsam zu sein, Jérôme, der das Geld mit vollen Händen aus dem Fenster wirft, ständig Weibergeschichten hat und durch und durch skrupellos und verlogen ist. Lucien, der mich haßt und hoffentlich endlich seine Ankündigung, nach Amerika zu gehen, wahrmacht. Caroline, der ich nur den unverschämten Mund stopfen konnte, indem ich ihren Gatten Murat zum König von Neapel gemacht habe, Elisa, die nichts als häßlich, boshaft und intrigant ist, und Pauline, die immer schamloser ihre unzähligen Liebschaften pflegt . . .
Der Kaiser verspürte einen schmerzhaften Druck in der Magengegend und preßte für einen Moment die Hand darauf. Dann setzte er sich hinter seinen Schreibtisch.
»Major de Brissot, Sie kehren unverzüglich nach Spanien zurück. Sobald ich meine Angelegenheiten hier geordnet und Seine Majestät, den Zaren von Rußland, verabschiedet habe, werde ich ebenfalls dorthin aufbrechen. Melden Sie das dem König von Spanien. Ich werde dafür Sorge tragen, daß er binnen kürzester Zeit wieder in seine Hauptstadt Madrid einziehen kann.«
Er griff nach der kleinen silbernen Glocke auf einem Tablett und läutete. Gleich darauf trat die Ordonnanz ein.
»Leutnant Pellegrin, der Major erhält ein Quartier, wo er sich ein paar Stunden ausruhen kann. Dann tritt er die Rückreise an. Sorgen Sie für frische Pferde.«
De Brissot salutierte militärisch und verließ den Raum.
Der Kaiser blieb für ein paar Augenblicke allein. Der Magenschmerz war heftiger geworden, und Napoleon ließ sich schwer in den Sessel hinter dem Schreibtisch fallen.
Er fühlte sich elend und müde.
Die ewigen Festivitäten und Empfänge, dazu die diplomatischen Gespräche, alles strengte ihn über Gebühr an. In Spanien, dachte er, wird es besser werden. Wenn ich im Feldlager unter meinen Soldaten bin . . .
Er war kein Mensch, der sich auf dem gesellschaftlichen Parkett wohl fühlte. Die Kunst der gedrechselten Rede, des vorsichtigen Taktierens, der leichten, gefälligen Komplimente war ihm fremd. Er war eher schwerblütig, und noch allzu gut erinnerte er sich der Zeiten, wo er sich als junger Offizier mit leerem Magen und abgetragener Uniform immer deplaziert gefühlt hatte auf den Gesellschaften der Jeunesse doreé.
Man hatte ihn nicht ernst genommen, hatte ihn langweilig und unbeholfen gefunden, und genauso hatte er sich auch gefühlt. Dabei hatte er so darauf gebrannt, dazuzugehören, einer zu sein, auf dessen Wort man achtete.
Ach, und wie glühend hatte er all die jungen Stutzer und Hohlköpfe beneidet, die mit vielen Worten nichts sagen konnten, und die glatten, geschmeidigen Diplomaten mit ihrer Gewandtheit!
Er hatte nur seinen Ehrgeiz gehabt, den verbissenen Willen, sich hervorzutun, damit man ihm endlich, endlich ein wenig mehr Beachtung schenkte.
Manchmal hatte er sich damals selbst gehaßt, weil er klein war und so schrecklich mager und diesen entsetzlichen Akzent sprach, so daß jeder, der zum ersten Mal ein paar Worte mit ihm gewechselt hatte, ihn fragte: »Sie sind aber kein Franzose, Bürger . . . Kommen Sie aus Italien?«
Napoleon Bonaparte, Sohn eines korsischen Hintertreppenanwalts . . . mit 24 Jahren General, mit dreißig Erster Konsul der französischen Republik, vier Jahre später Kaiser . . .