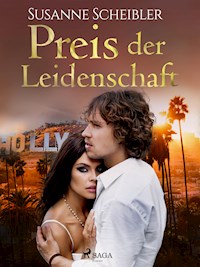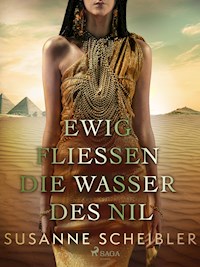Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tanja
- Sprache: Deutsch
Die liebreizende Tanja wächst auf einem Hof hinter dem Ural auf und ist die erste, die sich dem brutalen Gutsherren Gjurin zu widersetzen wagt, woraufhin sie zu fliehen gezwungen ist. In Sankt Petersburg findet sie am Hof Katherinas der Großen Unterschlupf. Die Männer umschwärmen und bewundern sie, doch sie liebt nur einen von ihnen: Andrej.Russland zur Zeit Katherina der Großen: Ein junges Mädchen kann vor seinem bösartigen Gutsherren fliehen und findet sich bald am Hof der Kaiserin wieder. Für Tanja beginnt eine Reise durch die Welt der Liebe und zu sich selbst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 673
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Susanne Scheibler
Tanja
ROMAN
Saga
Tanja
Tanja – Band 1 der Tanja Trilogie
Copyright © 2021 by Michael Klumb
vertreten von AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de)
Die Originalausgabe ist 1976 im Molden Verlag erschienen
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1976, 2021 Susanne Scheibler und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726961133
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
1
Über Nacht war es wärmer geworden, und der Himmel hatte eine sonderbar milchige Färbung, als Tanja ins Freie trat. Der Wind, der von den Ufern des Jenissej herüberkam, fuhr in das wollene Tuch, das das Mädchen um Kopf und Schultern geschlungen hatte.
Ein paar Augenblicke lang stand Tanja ganz still da, den schmalen Kopf wie witternd erhoben, und atmete die Morgenluft ein, die nach Frische und Schnee roch.
Väterchen hatte recht gehabt; er hatte den Wetterumschlag schon vor zwei Tagen prophezeit. „Es wird neuen Schnee geben, ich spür’s in allen Knochen.“ Und dann war er in den Stall neben der Lehmkate geschlurft und hatte unter Ächzen und Fluchen den Tiegel mit dem Dachsfett hervorgekramt, den Mütterchen Olga dort seit Jahr und Tag aufbewahrte. Am Abend hatte er sich dann von ihr den Rücken einreiben lassen, denn nach Meinung von Iwan Antonowitsch Nitenko gab es nichts Besseres gegen Gliederreißen als Dachsfett.
Tanja lachte leise in sich hinein bei dem Gedanken, wie grob er Mütterchen Olga dabei angefahren hatte.
„Heilige Mutter von Kasan!“ hatte er geschrien. „Du reibst an mir herum, als wäre ich ein schmutziges Hemd. Wirst du wohl sanfter mit mir umgehen, du Satansbraten! Großer Gott, was für ein Weib! Als ich sie heiratete, war sie ein sanftes, zartes Schwälbchen. Und jetzt ist sie ein Koloß mit Armen wie ein Pumpenschwengel. Hör auf, sag’ ich, oder willst du mir die Rippen brechen?“
Aber Olga Sergejewna hatte ungerührt weiter das Dachsfett in seine faltige, gelbliche Haut einmassiert und Tanja einen vergnügten Blick zugeworfen. „Er spinnt, dein Väterchen! Ich streichle ihn so sanft wie eine Feder. Aber so sind die Männer! Immer mit dem Maul vorneweg, wenn es ums Saufen geht oder wenn sie sich ihre Weibergeschichten erzählen. Hoh, da sind sie Helden, so stark wie der heilige Georg, als er mit dem Drachen kämpfte. Aber wenn sie einmal ein bißchen Schmerzen aushalten sollen — da heulen sie wie verendende Wölfe.“
Sie hatte Iwan Antonowitsch einen derben Knuff in den Rükken versetzt, der ihm prompt einen markerschütternden Schmerzensschrei entlockte, denn das Reißen in seinen von der Feldarbeit krumm gewordenen Gliedern setzte ihm wirklich höllisch zu. Und Olga Sergejewna hatte über ihr ganzes breites Gesicht gelacht. „Da hörst du’s, Tanjuschka: wie ein verendender Wolf.“
So waren sie, die beiden. So waren sie gewesen, solange Tanja denken konnte. Sie knurrten und schimpften miteinander, aber sie gehörten zusammen wie die zwei Hälften einer Nußschale. Und oft genug, wenn Iwan Antonowitsch mit seiner Tochter allein war, sagte er zu ihr: „Hol’s der Teufel, sie hat eine Zunge, so scharf wie ein Rasiermesser. Aber ihr Herz ist reines Gold, und den Augenblick, wo Vater Matwej uns in der Kirche zusammengegeben hat, hab’ ich noch keine Stunde bereut.“
Und Mütterchen Olga hatte an dem Tag, an dem Tanja und Pawel beschlossen hatten, zu heiraten, und Seine Gnaden, Graf Stepan Stepanowitsch Gjurin, gnädigst seine Einwilligung dazu erteilt hatte, gesagt: „Tanjuschka, mein Schwänchen, dein Pawel ist geradeso, wie dein Papaschka vor zwanzig Jahren war. Du wirst einen braven Mann an ihm bekommen. Einen, der nicht säuft und nicht herumhurt und dich nicht prügelt. Freilich, auch er wird krumm werden und vorzeitig grau von der Arbeit, und vielleicht wird Jelinko, dieser schielende Hund von Verwalter, ihm auch das Nasenbein einschlagen, wie er es deinem Papaschka getan hat, als er vor sechzehn Jahren nicht zulassen wollte, daß Jelinko mich aus dem Wochenbett zur Feldarbeit schleifte. Sie sieht nicht schön aus, so eine plattgedroschene Nase, und eigentlich hat dein Papaschka sie ganz umsonst bekommen, denn ich habe hinterher doch zum Rübenhacken müssen. Aber jedesmal, wenn ich ihn so ansehe, dann denke ich: Das hat er meinetwegen gekriegt. Und dann — ach Gott, Tanjuschka, das klingt sicherlich sehr dumm und einfältig in deinen Ohren —, dann kommt mir diese Nase vor wie der Orden, den Stepan Stepanowitsch zu Ostern in der Kirche trägt. Und dann könnte ich heulen und deinem Väterchen um den Hals fallen. Verrückt ist das, aber es ist so.“
Tanja mußte an Pawels Hütte vorbei, um zum Flußufer zu gelangen, wo der Schnee für das Schneewasser noch rein und sauber war. Im Sommer holten sich die Leibeigenen von Sarodnaja ihr Wasser vom Brunnen, der in der Mitte der armseligen Siedlung aus strohgedeckten Lehmkaten und Holzhütten stand. Im Winter aber, wenn es fror, daß die Bäume in den Wäldern unter dem Frost zersprangen und der Jenissej eine dicke Eisschicht hatte, in die man mühsam mit dem Pickel Löcher hacken mußte, wenn der Herr befahl, ein paar Fische zum Mittagsmahl zu fangen — im Winter mußte man mit geschmolzenem Schnee waschen und Tee und Kascha kochen und den Teig für das Brot anrühren.
Tanja warf einen Blick zu Pawels Behausung hinüber. Die kleinen Fenster waren wie bei den anderen Hütten mit Stofffetzen und Stroh verstopft, um die Kälte zurückzuhalten. Aber aus dem Schornstein kräuselte sich kein Rauch. Pawel war schon gestern mit Jelinko nach Nasimowo gefahren, um Vorräte einzukaufen.
Pawel konnte lesen und schreiben. Er war auf dem vierzig Werst entfernten Taninschen Gut aufgewachsen, und Graf Gjurin hatte ihn vor drei Jahren gekauft, weil er jemanden haben wollte, der, wie er sagte, „Jelinko, dieser betrügerischen Ratte, auf die Finger schlägt, wenn er versucht, sich durch gefälschte Abrechnungen zu bereichern“.
Natürlich trug diese Anordnung nicht dazu bei, in Jelinko eine besondere Vorliebe für Pawel zu wecken. Aber was änderte das schon? Befehl war Befehl — und so mußte Jelinko einmal im Monat mit Pawel nach Nasimowo zum Einkaufen, eine Demütigung, die er nur ertrug, indem er sich, sobald sie in der Stadt waren, mit Wodka vollaufen ließ, so daß er jedesmal, wenn die beiden am nächsten Mittag nach Sarodnaja zurückkehrten, stinkbesoffen war und nicht einmal mehr die Namen seiner Eltern wußte.
Tanja lächelte bei der Erinnerung an Jelinkos letzte Heimkehr. Da hatte er seine eigene Frau nicht mehr erkannt, obwohl es jemanden wie die Jelinkowa im Umkreis von tausend Werst bestimmt kein zweites Mal gab. Ein wandelnder Fettberg war sie, mit einer Nase wie ein Entenschnabel, und ihre Stimme schepperte, als schlüge man rostiges Zinn gegeneinander.
Und diesen Fettberg hatte Jelinko, als Pawel ihn aus dem Wagen zerrte, „Galina, mein süßes Engelchen“ genannt. Das war insofern peinlich, als die Jelinkowa nicht Galina hieß, sondem Marfa. Sie war so wütend geworden, daß man ihr Schimpfen und Schreien über den ganzen Gutshof hörte. Aber auf Jelinko hatte das wenig Eindruck gemacht. Er hatte weiter von seinem süßen Engelchen Galina geschwafelt, bis ihm sein Weib ein Holzscheit über den Kopf schlug. Und noch eine Woche danach hatte man die eiförmige Beule auf seinem kahlen Schädel bewundern können.
Inzwischen hatte Tanja das Flußufer erreicht. Ein paar Augenblicke blieb sie stehen und schaute über die glitzernde Wasserfläche. Noch trieben keine Eisschollen auf dem Jenissej. Es war Oktober, und der lange sibirische Winter dieses Jahres 1761 hatte gerade erst begonnen.
Der Wind war hier stärker. Er zerrte an Tanjas Tuch, und ihre langen schwarzen Haare, die sie in der Mitte gescheitelt und zu zwei dicken Zöpfen geflochten trug, kamen zum Vorschein. Sie warf sie zurück und stellte die beiden mitgebrachten Holzeimer ab. Dann begann sie mit einer großen Kelle den Schnee hineinzufüllen. Die Eimer waren schwer, als sie sie voll hatte. Aber Tanja war kräftig und an Arbeit gewöhnt. Sarodnaja war groß, da gab es immer etwas zu tun, auch für die Kinder der Leibeigenen. Schon als kleines Mädchen wurde Tanja mit ihren Altersgenossen in den Wald zum Beeren- und Pilzesammeln geschickt. Die Mädchen lernten Kühe und Ziegen zu melken, und später halfen sie auf dem Feld und in der Küche.
Die Geschickten von ihnen nahm Jelena Antonowna, die Haushälterin, unter ihre Fittiche. Sie zeigte ihnen, wie man Wolle spann und Linnen bleichte und wunderschöne, farbenfrohe Stickereien anfertigte. Die halbwüchsigen Knaben wurden in die Werkstätten zum Hanfziehen geholt oder in die Ölmühle, wo aus den Sonnenblumenkernen dickes goldgelbes Öl gewonnen wurde. Sie gerbten Felle, fällten mit den Männern zusammen Holz, versorgten das Vieh und fuhren mit den flachen, breiten Booten auf dem Jenissej zum Fischfang.
Heute war Backtag in Sarodnaja. In großen Bottichen wurde der Brotteig angerührt, geknetet und dann zu runden Laiben geformt. Tanja liebte diese Beschäftigung. Sie spürte gern den festen, glatten, aufquellenden Brotteig unter ihren Händen, sie liebte die Wärme, die dem großen Ofen entströmte, das knisternde Feuer und das fröhliche Geschwätz der Mägde.
Heute jedoch empfing sie ein befremdliches Schweigen, als sie die Tür des Backhauses aufstieß. Drei oder vier Frauen, darunter Olga Sergejewna, drängten sich um das vereiste kleine Fenster und spähten auf den Hof hinaus, zwei andere siebten Mehl in einen großen Holzbottich. Alle wirkten sie verstört und geduckt, wie in Erwartung eines Unheils.
Tanja setzte die beiden Eimer ab. „He“, sagte sie, „was ist los? Ihr steht da wie die jungen Lämmer auf dem Feld, wenn es gewittert.“
Lisaweta, eine junge Frau, die mit ihrem Mann die Kate neben den Nitenkos bewohnte, wandte sich um. Sie war drall und gesund und sonst immer die fröhlichste von allen. Jetzt aber hatte sie den gleichen dumpfen Ausdruck der Furcht im Gesicht wie alle anderen Frauen.
„Komm herein, Tanja“, sagte sie unterdrückt. „Und mach die Tür zu.“
Ihre Worte wurden von einem mörderischen Wutgebrüll von draußen übertönt. Es kam aus dem Stall. Dort schrie jetzt ein Mensch auf wie in höchster Todesnot: „Gnade, Herr, Gnade! Es ist nicht meine Schuld. Gott ist mein Zeuge, daß ich die ganze Nacht im Stall war und kein Auge zugetan habe! Ich schwöre es, ich ...“
Die Stimme erstarb in einem Aufheulen, das durch Mark und Bein ging.
Die alte Evtimia ließ das Mehlsieb fallen und schlug ein Kreuz. „Ich habe es euch gesagt“, rief sie mit ihrer dünnen Altweiberstimme, „er wird ihn totschlagen. Alle wird er verprügeln, die ihm heute über den Weg laufen. Gott schütze uns!“
Tanja stand noch immer auf der Schwelle des Backhauses, als gegenüber die Stalltür aufflog. Jefim, der Kutscher, taumelte ins Freie. Sein Gesicht war eine Grimasse der Angst.
„Gnade, Herr!“ schrie er wieder und hielt die Arme schützend über den Kopf. Hinter ihm erschien Stepan Stepanowitsch Gjurin, krebsrot vor Wut, in der Hand eine lederne Hundepeitsche, deren Enden mit kleinen stählernen Kugeln beschwert waren.
„Dir werde ich es zeigen, du Mißgeburt! Meine Jolotschka, mein Pferdchen, hast du krepieren lassen! Gestern noch war sie so munter wie ein Vögelchen, und heute liegt sie tot im Stroh. Dafür bringe ich dich um, du Hundesohn!“ schrie Gjurin, und mit jedem Satz klatschten die Peitschenhiebe auf den alten Mann nieder. Jefim fiel in den Schnee. Seine Jacke hing in Fetzen, Blut lief über den mageren, ausgemergelten Rücken.
„Ich kann nichts dafür, Herr!“ heulte er auf. „Es war eine Kolik, und ich will in alle Ewigkeit verdammt sein, wenn ...“
„Das sollst du auch, du stinkender Lump! Da ... da ... und da ...“ In sinnloser Wut trat Gjurin nach dem am Boden Liegenden und schlug immer wieder mit der Knute auf ihn ein.
Ein paar Pferdeknechte waren in der Stalltür aufgetaucht. Aneinandergedrängt wie Tiere standen sie da, schweigend, angstvoll. Vor einer Stunde war Jolotschka, das Lieblingspferd des Herrn, verendet, und seitdem hatten sie alle vor dem Augenblick gezittert, an dem Gjurin es erfuhr.
Er war ein Teufel. Ein fetter, rotgesichtiger Teufel, der soff und fraß und hurte, und da war niemand in ganz Sarodnaja, der noch nicht Stepan Stepanowitschs Stiefel in seinem Hintern gespürt hätte. Sie haßten ihn, und sie fürchteten ihn. Er war der Herr, und sie waren seine Leibeigenen, und das hieß: weniger als ein Nichts. Ein Haufen Dreck, auf den der Herr spucken und treten konnte. Sie hatten gelernt, den Rücken krumm zu machen und die Hand zu küssen, die nach ihnen schlug.
Was willst du sonst machen, Brüderchen? Beiß die Zähne zusammen und sei still. Einmal hat der Herr es satt, auf dir herumzuprügeln. Einmal läßt er dich liegen und geht weiter. Und es kommen ja auch Tage, wo er guter Dinge ist und dir auf die Schulter klopft und dir womöglich ein paar Rubelchen hinwirft. Und sei froh, wenn er dein Weib und deine Töchter in Frieden läßt. Denn was kannst du tun, wenn er ihnen unter den Rock greift oder sie in sein Bett zerrt? Nichts, Brüderchen, gar nichts. Also halt das Maul und versuch zu übersehen, wenn unter deinen Kindern eines herumläuft, das die gleichen schiefen Augen hat wie Seine Gnaden, Stepan Stepanowitsch Gjurin. Was kann so ein Kindchen schon dafür? Eines Tages ist es da und schreit und will gefüttert werden und gehätschelt. Und wenn es später zu dir Papaschka sagt und mit seinen kleinen Händchen in deinem Bart herumzerrt — ach, Brüderchen, dann vergißt du die schiefen Gjurin-Augen, wenn du ein Herz im Leib hast, und nimmst das Kindchen auf den Arm und läßt dir weiter deinen Bart zausen und von den kleinen Händchen ins Gesicht patschen.
So war das in Sarodnaja, seit Stepan Stepanowitsch Gjurin vor zehn Jahren aus einem Grund, den man hier, so viele tausend Werst von St. Petersburg entfernt, nicht kannte, bei der Zarin Elisabeth in Ungnade gefallen und auf seine sibirischen Besitzungen verbannt worden war.
Vorher hatte Jelinko, der Verwalter, allein das Regiment geführt, aber das war auch nicht besser gewesen. Denn den Herrn spielen, mit der Knute umgehen und saufen und fluchen, das konnte Jelinko genauso gut. Und wem wäre es in den Sinn gekommen, dagegen aufzumucken?
Tags zuvor hatte Gjurin Gäste gehabt. Schon am Vormittag waren sie johlend und schreiend in ihren Schlitten die breite Auffahrt von Sarodnaja hinaufgejagt. Aus der Stadt waren sie gekommen, aus Nasimowo und Jarzewo und von den benachbarten Gütern. Vornehme Herrchen, das sah man auf den ersten Blick an ihren prächtigen Kleidern, den langen Zobelmänteln und Pelzmützen. Sie hatten Frauen bei sich gehabt, und Natascha, die Tochter des Gerbers Bjeluschin, die beim Essen die Speisen auftrug, hatte hinterher erzählt, daß sie noch nie in ihrem Leben so tiefausgeschnittene Kleider gesehen habe. „Ich schwöre euch, die Brüste sind ihnen fast herausgefallen. Und Federn hatten sie im Haar, und mit dem Hintern haben sie gewackelt wie die rossigen Stuten.“
Bis weit in die Nacht hinein hatte hinter den Fenstern des Herrenhauses Licht gebrannt, und das Lachen und Grölen, die Balalaikamusik und das Stampfen der Tanzenden auf dem Dielenboden war bis zu den Katen der Leibeigenen zu hören gewesen.
Heute morgen war Gjurin mit einem gewaltigen Kater aufgewacht. In seinem Kopf dröhnte es, als wäre er damit gegen eine Steinwand gerannt, und nicht einmal die Tatsache, daß in seinem Bett eine hübsche junge Frau lag, die sich beim Erwachen mit ihrem nackten Körper an ihn schmiegte, vermochte seine Laune zu bessern. Er hatte die Kleine weggeschoben wie eine lästige Katze, sich stöhnend aus dem Bett gewälzt und nach seinem Leibdiener Wanja geschrien, daß er ihm eine Schüssel mit kaltem Wasser bringen solle. Prustend und schnaubend hatte Gjurin seinen dicken Kopf hineingesteckt, aber auch davon war ihm nicht besser geworden. „Mutter Gottes“, hatte er gestöhnt, „was für ein Tag! Was habe ich für eine Untat begangen, daß ich so leiden muß! Oh, ich könnte mich in einer Türritze verkriechen wie eine Wanze, daß ich nichts höre und nichts sehe!“
Täte er es nur, hatte Wanja gedacht, während er Stepan Stepanowitsch in die Hosen half, denn natürlich wußte schon das ganze Gesinde von Sarodnaja, daß Jolotschka tot war. Täte er es nur, denn sonst, bei Gott, wird er uns alle zermalmen in seiner Wut.
Wanja kannte am besten die Stimmung seines Herrn, wenn der eine Nacht hindurch Wodka in sich hineingeschüttet hatte, als wäre er ein Faß ohne Boden. Da brauchte er nicht einmal einen Grund, um jeden, der in seine Nähe kam, mit Fußtritten und Maulschellen zu traktieren. Und heute hatte er einen Grund ...
Wanja stand am Fenster und blickte auf den Gutshof hinunter, als Gjurin den alten Kutscher Jefim auspeitschte. Er wird ihn totschlagen, dachte auch er. Und das ist erst der Anfang. Gott sei uns allen gnädig ...
Jefim lag am Boden, die Hände in den Schnee gekrallt. Er schrie nicht mehr. Er wimmerte nur noch bei jedem neuen Hieb, der ihn traf, mit einer ganz hohen, dünnen, kindlichen Stimme, ein armseliges Bündel Mensch, das nicht einmal mehr die Kraft hatte, sich unter dem Schmerz, der wie ein Feuer durch den Körper raste, aufzubäumen. Ein Schleier legte sich über seine Augen. Fern wurde alles, fern und unwirklich. Die Kälte des Schnees, Gjurins Flüche und Beschimpfungen, der hohe, helle Himmel. Und er dachte: Gottesmutter, das ist das Ende. Sei mir gnädig, Gottesmutter.
Daß plötzlich eine helle, klare Mädchenstimme Gjurins Geschrei wie mit einem Messer abschnitt, hörte er nicht mehr.
„Aufhören!“ schrie das Mädchen. „Sofort hörst du auf, du verfluchtes Ungeheuer! Du schiefmäuliger Teufel!“
Es war Tanja. Wie ein von der Sehne geschnellter Pfeil flog sie über den Hof, auf Gjurin zu. Er war herumgefahren und starrte sie an, überrumpelt, ungläubig, als könne er es nicht fassen, daß jemand es wagte, ihn, den allmächtigen Stepan Stepanowitsch Gjurin, einen schiefmäuligen Teufel zu nennen.
Wie eine fauchende Katze sprang Tanja ihn an. Von der Tür des Backhauses aus hatte sie mit den anderen Frauen die widerliche Szene mit angesehen. Sie hatte die Nägel in die Handflächen gekrallt und die Zähne aufeinandergebissen, um nicht aufzuschreien vor Entsetzen und Empörung. „Onkelchen Jefim“ hatte sie den alten Kutscher genannt, seit sie sprechen konnte. Manchmal hatte er ihr ein Spielzeug geschnitzt, ein Holzpferdchen oder viele kleine Puppen, eine immer kleiner als die andere, die man ineinanderstecken konnte, und er hatte die Püppchen mit Farbe bemalt, mit lustigen runden Augen und Sommersprossen, mit blauen, roten und gelben Kopftüchern und bunten Rökken. Er war der erste, der sie auf ein Pferd gesetzt und ihr gezeigt hatte, wie man eine Kibitka fuhr. Und nun lag er da im Schnee, blutend, hilflos, Gjurins sinnloser Vernichtungswut ausgeliefert. Es war unerträglich.
Tanja überlegte nicht, was sie tat. Sie riß Gjurin die Peitsche aus der Hand, und er war immer noch so verdutzt, daß er es geschehen ließ.
„Du Satan!“ schrie Tanja, während ihr die Tränen über das Gesicht liefen. „Man sollte dir die Peitsche auf dem Rücken zerschlagen, du ...“
Sie verstummte, weil jemand sie zurückriß. Es war ihre Mutter. Olga Sergejewnas Gesicht war verzerrt vor Angst. „Tanjuschka, um aller Heiligen willen ...“ Schluchzend warf sie sich vor Gjurin in den Schnee, umklammerte seine Beine und machte Anstalten, seine Stiefel zu küssen.
„Sie ist verrückt, Herr, sie hat den Verstand verloren. Hört nicht auf das, was sie redet, oder straft mich dafür, denn ich habe sie nicht richtig erzogen. Ich habe ihr nicht beigebracht, was man seinem Herrn schuldet.“
Gjurin schüttelte sie ab, als sei sie ein lästiges Insekt. Seine Erstarrung wich. Seine kleinen, tiefliegenden Augen funkelten vor Wut, als er Tanja mit einem rohen Griff an sich heranzog.
„So“, sagte Gjurin heiser, „du willst also meine Peitsche auf meinem Rücken zerschlagen, du kleine Wanze! Nun, das werden wir gleich sehen.“
Seine großen, behaarten Hände umklammerten Tanjas Schultern. Er schüttelte sie, daß sie hin und her baumelte wie eine Puppe. Die Peitsche entfiel ihren Fingern. Olga Sergejewna schrie auf, hell und gellend wie ein sterbendes Tier, als Gjurin mit einem einzigen brutalen Ruck Tanjas Kleid zerfetzte. Dann warf er sie zu Boden. In einer instinktiven Geste der Scham wollte Tanja die Lumpen zusammenraffen, um ihre nackte Brust zu bedecken, doch Gjurin trat ihr auf die Hand. Der Schmerz war höllisch, aber kein Laut kam über Tanjas Lippen.
Gjurin lachte. Er weidete sich am Anblick des halbnackten braunen Mädchenkörpers zu seinen Füßen. Auf den Knien kroch Olga näher und wollte sich über ihre Tochter werfen. Gjurin stieß sie mit dem Fuß beiseite.
„Ein hübsches, zartes Täubchen hast du da zur Welt gebracht, du alte Vettel. Weiß der Teufel, wie du dazu gekommen bist. Aber sie wird nicht lange mehr so hübsch sein. Was meinst du, wie sie aussieht, wenn ihr die Haut in Fetzen herunterhängt? Oder wenn ich ihr die Zunge herausreißen lasse, damit sie es lernt, das Maul zu halten.“
„Herr“, wimmerte Olga, „um aller Heiligen willen, seid barmherzig. Schlagt mich, tötet mich, aber verschont meine Tanjuschka. Sie ist alles, was ich habe!“ Sie war eine Mutter, und sie hätte sich in diesem Augenblick das Herz aus der Brust schneiden lassen, um Tanja zu retten.
Gjurin lächelte plötzlich, ein böses, lüsternes Faunslächeln. „Steh auf“, befahl er. Sein Lächeln war schlimmer, als hätte er Tanja geschlagen. Sie gehorchte stumm und spürte seinen Blick wie eine fressende Säure auf ihrer Haut. Überdeutlich nahm sie alles wahr: ihre Mutter, die die Hände gegen den Mund gepreßt hielt, als wolle sie damit einen Aufschrei unterdrücken. Jefim, der noch immer ohnmächtig dalag, die Hände in den Schnee verkrallt, die Frauen hinter den Fenstern der Backstube und in der Tür, die Knechte, die vor dem Pferdestall und im Hof zusammengelaufen waren, die Gesichter der Bediensteten hinter den Fenstern des Herrenhauses.
Überdeutlich war auch Gjurins Lächeln. Er streckte den Arm aus und berührte Tanjas Hals. Seine Hände glitten tiefer, umfaßten ihre nackte Brust, die schmale Taille, die Hüften.
„Das hat wohl noch kein Mann mit dir gemacht, was? Und geschlafen hast du auch mit keinem?“ Er wandte den Kopf nach Olga Sergejewna. „Oder doch?“
Von hinten umklammerte Olga seine Knie. „Nein, Herr. Sie ist doch gerade siebzehn geworden, ein unschuldiges Kind ...“
Gjurin lachte und streichelte wieder Tanjas Brust. „Das ist gut, das gefällt mir. Ein unschuldiges Kind ... Bitte die Heiligen, daß du dich nicht irrst, Alte. Denn ich werde es herausfinden — heute noch.“
Übelkeit würgte Tanja, aber sie wich nicht zurück. Irgend etwas war in ihr wachgeworden, eine Kraft, von deren Vorhandensein sie selbst bisher nichts gewußt hatte.
Ich habe ihm die Stirn geboten, dachte sie. Ich habe ihm seine Peitsche abgenommen. Ich bin kein Hund, der vor einem aufgehobenen Stein den Schwanz einzieht und davonläuft. Ich bin ein Mensch.
Es war nicht so, daß sie keine Angst gehabt hätte. Aber dieses Neue, Fremde in ihr, dieses Wissen, daß man nicht alles ertragen, nicht alles hinnehmen muß, war stärker. Es steifte ihr den Nacken.
Gjurin spürte es. Er sah ihren Mut und den Widerstand in ihren Augen und packte ihre halbaufgelösten Zöpfe. Mit einem jähen Ruck riß er ihren Kopf nach hinten.
„Das tut weh, nicht wahr, du kleine Kröte! Warum schreist du denn nicht? Du kommst dir wohl sehr großartig vor, weil du keine Miene verziehst? Was hältst du denn davon, wenn ich deinem Mütterchen die Augen ausstechen lasse, jetzt gleich, während du dabeistehst? Ja, nicht wahr, da kriegst du Angst. Da überkommt dich das große Heulen. Soll ich es tun oder lieber dich auspeitschen lassen? Wenn du mich recht darum bittest, überlasse ich dir die Wahl. Na, was ist? Willst du nicht endlich den Mund auftun?“
Ein Zittern ging durch Tanjas Körper. Sie hörte ihre Mutter weinen: „O Gott, hilf uns! Erbarme dich unser, Gott im Himmel!“
Gott? Tanja dachte an Vater Matwej, den alten Popen, der noch immer in Sarodnaja lebte. Gott ist die Liebe, hatte er gesagt. Und den Armen und Elenden gehört Sein Himmelreich.
Warum Sein Himmelreich, das so fern war? Warum half Gott ihnen nicht hier, wo sie litten und Angst hatten? Wenn Er sie liebte, wie brachte Er es dann über sich, das hier aus Seinen goldenen Himmeln droben mit anzusehen? War Er blind und taub für die Tränen von Mütterchen Olga? Taub für den stummen Schrei, der sich in Tanjas Kehle zusammenballte wie ein schmerzender Kloß, daß sie meinte, daran ersticken zu müssen?
Mütterchen Olga die Augen ausstechen ... Und Gott würde zusehen und schweigen! Er sandte keinen Blitz vom Himmel, der Gjurin erschlug. Die Erde tat sich nicht auf, um ihn zu verschlingen. Warum, warum nicht?
„Peitscht mich aus, Herr“, sagte Tanja, und ihr Herz brannte vor Haß und Verzweiflung. Es war falsch gewesen, was sie eben noch gedacht hatte, falsch und dumm. Der Hund, der den Schwanz einzog und davonlief, war klüger als der Mensch, den ein ferner Gott mit Gefühl und Stolz und Würde ausgestattet hatte — und von dem Er sich dann doch abwandte.
„Peitscht mich aus, Herr.“
„Herr?“ wiederholte Gjurin. „Auf einmal wieder bin ich der Herr? Nicht mehr ein schiefmäuliger Teufel? Kein verfluchtes Ungeheuer?“
„Nein, Herr“, sagte Tanja. „Vergebt! Ich wußte nicht, was ich redete. Zerschlagt Eure Peitsche auf meinem Rücken! “
Gjurin lachte. „Vielleicht“, sagte er, „vielleicht tue ich es. Aber nicht heute. Du hast eine hübsche, weiche Haut, du kleine Hure. Noch erscheint sie mir zu schade, um sie durch Peitschenhiebe zu zerfetzen. Bin ich nicht gnädig? Willst du mir nicht danken?“
„Ja, Herr“, sagte Tanja, „ich danke Euch.“
Gjurin tätschelte ihre Brust. „Komm heute abend in die Badestube, damit du nicht nach Stallmist riechst, mein Täubchen. Jelena Antonowna wird dir ein schönes, heißes Bad bereiten, und dann wird sie dich zu mir bringen. Kann sein, daß ich dich morgen auspeitsche oder deinem Mütterchen die Augen ausstechen lasse, oder sogar beides — das liegt an dir. Ganz allein an dir. Du verstehst doch, wie ich das meine?“
Tanja starrte auf seine großen, roten Hände. Ihre Schultern sackten nach vorn. Sie nickte stumm. Dann raffte sie die Fetzen ihres Kleides zusammen und ging langsam über den großen Hof davon.
Am Nachmittag begann es zu schneien. Riesige Flocken waren es, die das Herrenhaus, die Stallgebäude und die Katen der Leibeigenen mit einem wirbelnden weißen Vorhang umschlossen.
Als Pawel Nikolajewitsch Zerkow mit Einbruch der Dämmerung zu seiner Hütte hinüberstapfte, waren die Fußspuren, die bis zu seiner Tür geführt hatten, längst verweht, und der Schnee türmte sich kniehoch vor dem Eingang.
Pawel schaufelte ihn notdürftig frei und stieß die Tür auf. Das sterbende Tageslicht erhellte matt den einzigen Raum mit dem festgestampften Lehmboden und der Ikone in der Ecke unter der roh gezimmerten Bank. Tanja kauerte dort, in ihr wollenes Tuch gehüllt, die Füße angezogen und die Arme um die Knie geschlungen. „Pawel“, sagte sie, ohne sich zu rühren.
Er warf die Tür hinter sich zu. „Tanjuschka! Mein Gott, du bist ja eiskalt. Wartest du schon lange?“
Sie nickte, und er spürte, wie sie in seiner Umarmung zitterte. Er nahm ihre Hände und blies seinen warmen Atem hinein.
„Mein armes Herz, du willst dir wohl den Tod holen! Warte, ich mache Feuer, dann wird dir besser.“ Er zündete die Öllampe auf dem Tisch an und holte einen Armvoll Reisig und Holzscheite aus dem Schuppen, der an die Kate angebaut war.
Tanja beobachtete Pawel, wie er an dem Ofenloch hantierte, das Holz hineinschichtete und Feuer schlug, um es zu entzünden. Die blakenden Flammen zeichneten tiefe Schatten in sein Gesicht.
„Haben sie dir noch nichts gesagt?“ fragte das Mädchen nach einer Weile.
„Doch. Borja und Mischka haben mir geholfen, den Schlitten auszuladen. Sie erzählten es mir.“ Pawel richtete sich auf. Tanja sah, wie er um Fassung kämpfte. Seine Lippen zitterten. Dann wandte er sich ab und preßte die Fäuste gegen die Augen. „O Tanjuschka, warum hast du das nur getan! Du wußtest doch, wie er ist! Verflucht soll er sein, dieser Teufel.“
„Ich habe nicht gedacht“, sagte sie. Ihre Stimme klang dünn. „Kennst du das nicht, Pawel? Daß man einfach irgend etwas tun muß, weil man sonst erstickt?“
Pawel schwieg. Er war ein ruhiger, besonnener Mensch, ein stiller Träumer manchmal, der die Schönheit liebte. Das Licht der Sonne auf den Wassern des Jenissej, die wilde, ungebändigte Unendlichkeit des sibirischen Landes, die Weite des Himmels, die grazile Anmut der jungen Birken, die Poesie einer sonnenwarmen Sommerwiese. Er liebte den Geruch der Erde, die Reinheit frisch gefallenen Schnees, den Schrei eines Raubvogels in der klaren Luft. Er liebte den Frieden und die Gewalt in der Schöpfung, dieses Nebeneinander von Grausamkeit und Größe. Und die Erkenntnis, daß der Mensch nur ein Teil dieses phantastischen, vielschichtigen Getriebes war, hatte ihn demütig gemacht. Nicht demütig vor den Menschen, denn Pawel hatte zu viel nachgedacht, um nicht zu wissen, daß der Mensch, wenn er seine Seele, den Atem Gottes in sich, verlor, zur erbärmlichsten, niedrigsten Kreatur der Schöpfung wurde. Aber doch demütig dem gegenüber, was man so einfach und gleichzeitig so hochtrabend Schicksal nannte.
Tanja war anders. Sie war stolz und wild, voller Ungestüm und rasch und unbedingt in allem, was sie tat und dachte. Irgend etwas tun, weil man sonst erstickt — das galt für sie in Glück und Unglück, in Freude und Verzweiflung. Sie konnte ausgelassen sein wie ein Kind, scheinbar grundlos, aus purer Lust am Leben. Manchmal, wenn sie miteinander im Schilf des Flußufers gesessen hatten, war sie plötzlich aufgesprungen. Sie breitete die Arme aus und lief lachend, mit zurückgeworfenem Kopf den Wellen des Jenissej entgegen, weit hinein in den Strom, bis ihr Kittelkleid naß an ihrem Körper klebte. „Komm mit, Pawel, das ist so schön, das Wasser, die Sonne und der Wind! Ach, Pawel, ich könnte schreien vor Glück, daß ich auf der Welt bin!“ Sie konnte in Tränen ausbrechen um einen aus dem Nest gefallenen Vogel, den sie tagelang versucht hatte zu füttern und der dann doch gestorben war. Sie konnte ungebärdig und trotzig sein wie ein junges Fohlen, wenn Pawel sie verletzt hatte, und dann wieder sanft und still die Arme um seinen Hals legen.
Seine Tanjuschka, sein kleiner wilder, schwarzer Schwan ... Und nun hatte sie Gjurin die Peitsche aus der Hand gerissen, dieses verhaßte Symbol der Herren, und heute nacht würde sie unter ihm liegen, seine gierigen Hände auf ihrem Körper, seinen Atem auf ihrem Gesicht. Sie würde sich die Lippen zerbeißen, um seine widerwärtigen Liebkosungen zu ertragen, und nie würde sie nach jener Nacht wieder das Mädchen sein können, das sie vordem gewesen war.
Pawel stöhnte. Er hatte noch immer das Gesicht mit den Händen bedeckt und wiegte seinen Oberkörper hin und her, als litte er unerträgliche Schmerzen.
Aber da war plötzlich Tanja hinter ihm. Sie umschlang ihn mit den Armen. „Ich weiß nicht, wie ich es aushalten soll, aber ich muß es. Er wird Mütterchen die Augen ausstechen, wenn ich es nicht tue. Darum bin ich zu dir gekommen. Ich will nicht, daß er der erste ist. Ich will wissen, wie Liebe sein kann, bevor er über mich herfällt.“
Sie sprach wie im Fieber, abgehackt und atemlos. „Ich will, daß du es mit mir tust, Pawel. Du hast gesagt, wir sollten warten, bis wir Mann und Frau sind. Aber das gilt nun nicht mehr, Ich will wissen, wie es mit dir ist, damit ich heute nacht daran denken kann, wenn ich es nicht mehr aushalte. Ich werde die Augen schließen und mir einbilden, daß du es bist, der mich umarmt. Ich will mich daran erinnern, was du zu mir gesagt hast. Ich will mich an deine Zärtlichkeit erinnern und an jede Berührung von dir. Wie könnte ich es sonst ertragen!“
„Tanjuschka ...“ Einen Augenblick lang war er versucht, zu tun, worum sie ihn bat. Er drehte sich zu ihr um. Sie war so nah bei ihm, daß er ihren Herzschlag spürte. „Tanjuschka“, sagte er wieder, hilflos und bebend, „das ist doch verrückt. Wir dürfen es nicht. Er wird es merken und es uns beide entgelten lassen. Erinnere dich an Massja.“
Massja war Dienstmagd drüben im Herrenhaus gewesen, ein junges, zartes Ding mit runden, immer ein wenig erstaunt dreinblickenden Augen. Am Abend ihrer Hochzeit mit dem Gärtner Afanasij hatte Gjurin sie zu sich befohlen. Die alten Leute in Sarodnaja erinnerten sich, daß das schon immer so gewesen war: Der Herr hatte das Recht auf die Brautnacht und die unberührte Braut. Freilich machte Gjurin nicht oft davon Gebrauch. Wenn ihm ein Mädchen gefiel, nahm er es sich, ohne auf den Tag ihrer Eheschließung zu warten.
Massja war nicht mehr unberührt gewesen, und Gjurin hatte sie und Afanasij in einem seiner unberechenbaren Wutanfälle vier Tage lang unter freiem Himmel, ausgesetzt der glühenden Julisonne, an einen Pfahl binden lassen. Zwei Wächter hatten dafür gesorgt, daß niemand sie in der Nacht heimlich losband oder ihnen etwas zu essen und zu trinken brachte.
Massja hatte die Tortur nicht überlebt. Sie war ein paar Tage später am Fieber gestorben, und Afanasij war seitdem ein wenig wirr im Kopf. Er arbeitete zwar wieder im Garten, aber er redete mit seinen Blumen und Sträuchern, als wären es Menschen, und wenn er Gjurin sah, warf er sich vor ihm auf den Boden und flehte um Vergebung, daß er „das Eigentum des gnädigen Herrn mit seinen schmutzigen Händen angetastet hatte“ — ein Benehmen, das Gjurin meistens unerhört erheiterte.
„Ich bin nicht Massja“, sagte Tanja. „Sie war immer schwach und kränklich. Außerdem, wer sagt dir, daß Gjurin mit uns dasselbe tun wird? Bei ihm kann man nie etwas voraussagen. Pawel, bitte ... Oder hast du Angst?“
Er schob sie von sich. „Ja, aber nicht um mich. Um dich, Tanjuschka! Ich will nicht, daß dir etwas geschieht.“
„Warum denkst du immer, bevor du etwas tust! Warum tust du es nicht einfach. Ich liebe dich, Pawel. Aber wenn du mich jetzt fortschickst, werde ich dich hassen.“ Wie sie da vor ihm stand mit großen, leidenschaftlichen Augen, war sie alles, was sich ein Mann erträumen konnte. Sie schlang die Arme um Pawels Hals und küßte ihn, unzählige kleine Küsse auf seine Wangen, seine Stirn, seinen Nacken. Pawel spürte das Rauschen seines Blutes, sein Atem wurde rascher. Eine kleine Ewigkeit lang überließ er sich der wilden Sehnsucht, die in ihm aufflammte. Er riß Tanja an sich und öffnete ihren Mund in einem fast gewalttätigen, endlosen Kuß. Dann stieß er sie von sich. „Geh“, sagte er heiser. „Um Gottes willen, geh. Alles andere ist Wahnsinn.“
Sie starrte ihn an, und die Gelöstheit ihres Gesichtes wandelte sich. Es war, als ob alles Leben daraus wiche, aller Glanz, alle Hingabe, alle Zärtlichkeit.
„Du schickst mich fort?“ fragte sie, als könne sie es immer noch nicht ganz begreifen. „Du schickst mich wirklich fort?“
„Es muß sein, Tanjuschka, verstehst du das denn nicht?“ antwortete er gequält. „Es ist doch nur deinetwegen.“
„Nein!“ Ihre Stimme war auf einmal hart und stählern. „Lüg nicht, Pawel Zerkow. Nicht meinetwegen. Du hast Angst vor Gjurin, nur du! Schau mich an! Heute morgen hat er mein Kleid zerrissen, und ich stand nackt da vor allen. Er hat mich in den Schnee geworfen und auf meine Hand getreten, als ich meine Brust bedecken wollte. Und heute nacht wird er über mich herfallen wie ein böses, gieriges Tier. Was kann mir danach noch Schlimmeres geschehen? Sag mir das, Pawel?“
Hilflos stand er da, mit hängenden Armen, und die Qual zerriß sein Inneres. „Es gibt nichts, was ich nicht täte, um das zu verhindern, Tanja. Und wenn ich sterben müßte dafür. Aber wir sind ihm doch ausgeliefert. Er kann tun, was er will.“
„Ja“, sagte sie, immer noch mit dieser fremden stählernen Stimme. „Er kann dich an einen Pfahl binden oder dich auspeitschen lassen oder dir die Hand abhacken. Und davor fürchtest du dich. Gott im Himmel, ich habe nicht gewußt, daß ich einen Feigling heiraten wollte!“
„Tanja!“ Als er einen Schritt auf sie zu machte, wich sie zurück. „Rühr mich nicht an!“ schrie sie. „Du Feigling! Feigling ... Feigling ...“
Ihre Stimme kippte über. Sie riß die Tür auf und rannte, blind vor Tränen, in den Schnee hinaus.
Jelena Antonowna, die Haushälterin von Sarodnaja, war eine hagere Frau mit eng zusammenstehenden Augen. Ihr graues Haar hatte sie zu einem dünnen Zopf geflochten und oben auf dem Kopf zu einem Knoten zusammengesteckt. Der Griff, mit dem sie Tanja die Treppe mit dem geschnitzten Geländer hinaufführte, war fest, so als habe Jelena Antonowna Angst, das Mädchen könne die bleiche, starre Gefaßtheit, mit der es hergekommen war, abschütteln und plötzlich davonlaufen.
In der anderen Hand trug Jelena Antonowna eine Kerze; ihr flackerndes Licht warf die magere Gestalt der Haushälterin als riesengroßen Schatten gegen die Wand.
Am Ende der oberen Galerie klopfte Jelena Antonowna an eine Tür. Sie wurde aufgerissen, und Gjurin erschien auf der Schwelle. Seine Gäste waren am frühen Abend mit viel Geschrei und Schlittengeklingel abgefahren.
Gjurin trug nur eine Hose, darüber einen fleckigen Samtmantel, der über der Brust offenstand.
„Das Mädchen, Euer Gnaden“, sagte Jelena Antonowna und schob Tanja in das große Zimmer mit der bemalten Balkendecke. Der Ofen aus buntlasierten Kacheln strömte große Hitze aus. Neben einem Tisch an der Fensterwand brannten armdicke Kerzen in zwei Kandelabern. Über das Bett im Alkoven, dessen Vorhänge zurückgeschlagen waren, lagen Bärenfelle gebreitet.
Jelena Antonownas dünne Lippen verzogen sich, was wohl ein Lächeln andeuten sollte. Tanja sah, daß ihr die Ecke eines Vorderzahns abgebrochen war. Seltsam, daß man so etwas noch wahrnahm in solchen Augenblicken.
„Haben Euer Gnaden noch einen Wunsch?“
„Nein, du kannst gehen!“ Gjurin hatte wieder getrunken. Man roch es an seinem Atem, und seine Augen waren rotgerändert und glasig. In diesem Zustand war er zumeist menschlicher. Er pflegte dann Wanja, der ihn zu Bett brachte, zu umarmen und auf beide Wangen zu küssen und ihn „mein Söhnchen“ zu nennen. Oder er ließ den alten Kostja ins Herrenhaus kommen und Musik machen und lud jeden, der ihm gerade über den Weg lief, ein, mit ihm zu essen und zu trinken. Er tanzte mit den Hausmägden, steckte den Kindern ein paar Rubel zu, damit sie sich Zuckerzeug kaufen sollten, und sang mit grölender Stimme die Lieder mit, die Kostja auf seiner Balalaika spielte. Und nicht selten brach er dann in Tränen aus und klagte sich an, daß er einen so schlechten, nichtswürdigen Charakter habe.
„Ich weiß es ja, ihr haßt mich alle, und ich habe es nicht besser verdient. Ihr denkt, ich bin ein gemeiner Mensch, ein Misthaufen, ist es nicht so, Brüder? Dabei habe ich in Wahrheit ein Herz wie Butter, und ich liebe euch, ich liebe euch alle, als wäret ihr meine eigenen Kinder. Es ist nur dieser verdammte Jähzorn, der wie ein Teufel in mich hineinfährt und mich Dinge tun läßt, die ich gar nicht tun will. Nur der Teufel ist es, ich schwöre es euch ...“
So ist es eben mit dem Wodka. Er kann aus einem gutmütigen, friedfertigen Menschen einen reißenden Wolf machen und aus einem Stepan Stepanowitsch Gjurin einen sentimentalen Narren.
An diesem Abend freilich hatte er noch nicht so viel getrunken. Gerade ein paar Gläschen, die das Blut wärmten und den Kopf leicht machten. Nachdem die Tür hinter Jelena Antonowna zugefallen war, schenkte er sich ein neues Glas ein, trank, rülpste und wischte sich über den bärtigen Mund. Dann ließ er sich krachend in den Lehnstuhl neben dem Ofen fallen und betrachtete Tanja aus zusammengekniffenen Augen. „Komm her“, befahl er ihr.
Sie gehorchte sofort, immer noch von jener sonderbaren gläsernen Starrheit erfüllt. Alles erschien ihr ein wenig unwirklich, so wie damals, als sie als achtjähriges Mädchen die Leiter hinabgestürzt war und sich den Kopf an einem Stein aufgeschlagen hatte. Das Blut, das über ihr Gesicht gelaufen war, hatte sie entsetzt. Sie hatte geweint und Schmerzen verspürt, die immer heftiger geworden waren, so daß sie gemeint hatte, es nicht mehr aushalten zu können. Und da war auch plötzlich jener sonderbare Schwebezustand über sie gekommen, der alles fern werden ließ und erträglich.
Sie war nicht bewußtlos geworden, und sie erinnerte sich noch genau daran, wie ihre Mutter ihr das Blut abgewaschen und sie zu Bett gebracht hatte und daß sie danach ziemlich krank gewesen war. Aber alles das war wie in einem Nebel an ihr vorübergeglitten; sie hatte es erlebt, und es war doch nicht wirklich gewesen.
So ähnlich empfand sie jetzt. Sie hörte Gjurins Keuchen, als er sie hastig auszog, sie spürte die Berührung seiner gierig tastenden Hände. Er trug sie zum Bett, und sie ließ es geschehen, als erlebe dies alles nicht sie, sondern eine andere, fremde Person.
Aber dann warf er sich über sie, und das Gewicht seines fetten, mächtigen Körpers drückte sie nieder. Er roch nach Schweiß und Wodka, und in diesem Augenblick zerbrach die gläserne Mauer, die sie bis jetzt geschützt hatte. Sie rang nach Atem, weil sie zu ersticken meinte, und versuchte, sich unter Gjurin hervorzuwinden. Sie schrie und krallte die Finger in seine massigen Schultern, und ihre Nägel hinterließen lange, blutige Kratzer. Sie war plötzlich ein in die Enge getriebenes Tier, das kämpft, ohne zu denken, nur von dem einen Instinkt beherrscht: zu vernichten, um nicht selbst vernichtet zu werden.
Als Gjurin in sie eindrang, schrie sie abermals auf. Er preßte seine Hand auf ihren Mund, und sein Gesicht war nah über dem ihren, dieses schweißüberströmte, widerwärtige rote Gesicht, das die Wollust verzerrte.
Ich muß es auslöschen, dachte Tanja. Es war das erste, was sie bewußt dachte, und das einzige, immer wieder, wie ein monotoner Kehrreim.
Sie warf den Kopf hin und her, und sie hatte die Arme ausgebreitet, als habe man sie an ein Kreuz geschlagen. Und dann sah sie den schweren geschmiedeten Leuchter, der neben dem Bett auf einem niedrigen Taburett stand. Und es geschah wie von selbst, daß sich ihre Finger darum schlossen, daß sie den Arm hob und zuschlug, einmal, zweimal, dreimal.
Gjurin stieß einen gurgelnden Laut aus. Sein Mund war weit aufgerissen. Er versuchte sich aufzurichten, aber da legte sich ein Schleier über seine Augen. Sie wurden starr und blicklos, und mit einem dumpfen Stöhnen sackte er zusammen und blieb schlaff über Tanja liegen. Aus einer Wunde an der Schläfe sickerte Blut und tropfte über ihre Hand, die immer noch den schmiedeeisernen Leuchter umklammert hielt.
Pawel Zerkow stand an der Mauer, die das Herrenhaus von Sarodnaja von dem dahinterliegenden Obstgarten trennte.
Er drückte sich in die Türnische und starrte zu dem Fenster hinauf, von dem er wußte, daß es zu Gjurins Schlafzimmer gehörte. Die hölzernen Läden waren von außen geschlossen, und nur durch die Ritzen drang schwacher Lichtschein.
Für eine Weile hatte es zu schneien aufgehört, und der Wind, der vom Fluß kam, war schneidend kalt. Er drang durch Pawels Kleidung, ließ seine Glieder steif und fühllos werden, aber dennoch rührte er sich nicht von der Stelle, sondern blieb stehen, wie er seit fast einer Stunde stand, den Blick auf das Fenster gerichtet, hinter dem er Tanja wußte.
Minutenlang betete er, ein lautloses Gestammel von abgerissenen Sätzen: O Gott, laß es nicht zu. Töte mich, laß mich hier auf der Stelle sterben, aber verhindere dieses Entsetzliche ...
Und dann weinte er wieder wie ein Kind. Die Tränen gefroren noch auf seinen Wangen zu kleinen Eiskristallen, während er sich selbst verfluchte, daß er Tanja heute nachmittag im Zorn hatte fortlaufen lassen. Ich hätte Gjurin töten sollen, dachte er, auch wenn man mich hinterher gehenkt hätte. Was wäre schon daran gelegen.
Aber er wußte, daß er das niemals fertiggebracht hätte. Er konnte keinen Menschen töten, nicht einmal Gjurin. Er war still und geduldig und zum Leiden mehr geschaffen als zum Aufbegehren. Doch jetzt war es nicht nur er, der litt, sondern auch Tanja — und in wieviel schlimmerem Maße! —, und die Vorstellung dessen, was mit ihr geschah, zerschnitt Pawels Herz. Er hieb die Fäuste gegen die Mauer, daß sie bluteten, ohnmächtige Verzweiflung wütete in seinen Eingeweiden wie ein hungriges Tier.
Das Kreischen einer Türangel ließ ihn den Kopf heben. Eine Gestalt schlüpfte durch den Seitenausgang des Herrenhauses ins Freie. Einen Augenblick lang blieb sie reglos stehen. Dann machte sie ein paar taumelnde Schritte vom Haus fort, stolperte, raffte sich wieder hoch, lief weiter, stolperte abermals und blieb schließlich im Schnee liegen, das Gesicht in der Armbeuge verborgen.
Es war Tanja.
Pawel lief zu ihr hin. Als er sie an der Schulter berührte, fuhr sie zusammen und hob den Kopf. Im ungewissen Nachtlicht war ihr Gesicht so weiß wie der Schnee.
„Du bist es“, sagte sie. Ihre Stimme schien ohne Farbe, ohne Leben. Das Haar hing ihr ins Gesicht, ihre Augen hatten einen Ausdruck, der Pawel Angst einflößte.
„Tanjuschka!“ Er faßte unter ihre Arme und zog sie hoch. Ihr Kopf fiel nach vorn. Sie lehnte sich gegen Pawel, als wäre sie zu schwach, um auf den Füßen zu stehen. Er strich ihr das Haar zurück. Sein Herz zitterte vor Schmerz und Mitleid. „Komm, ich bring’ dich nach Hause. Soll ich dich tragen?“
Sie schüttelte den Kopf und atmete mit weitgeöffnetem Mund, als bekäme sie nicht genug Luft. „Nein, ich kann selbst gehen.“
Und dann lief sie ihm voran, mit den steifen, abgezirkelten Bewegungen einer Marionette, immer rascher. Zum Schluß rannte sie, daß Pawel Mühe hatte, ihr in dem tiefen Schnee zu folgen.
Ihre Eltern saßen am Tisch, dicht aneinandergedrängt, als könne ihnen die nahe körperliche Berührung ein wenig Trost, ein wenig Hilfe geben. Bei Tanjas Eintritt sprang Olga Sergejewna auf. Ihr rundes, mütterliches Gesicht war verschwollen vom vielen Weinen. Sie streckte die Arme nach Tanja aus, aber das Mädchen blieb an der Tür stehen. Tanja blickte ihre Mutter an, dann ihren Vater, der stumm und wie ausgehöhlt vor Kummer auf der hölzernen Bank kauerte. Und dann sagte sie ganz ruhig: „Gjurin ist tot. Ich habe ihn umgebracht.“
Olga Sergejewna stieß einen ächzenden Laut aus und stürzte zu Tanja hin. Sie schlang die Arme um sie und preßte sie an sich. Und Tanja klammerte sich an ihrer Mutter fest wie eine Ertrinkende und begann laut zu weinen.
Lange Zeit sagte niemand ein Wort. Olga Sergejewna wiegte ihre Tochter hin und her, als wäre sie noch das Kind, das sie auf ihren Armen getragen, gefüttert und gewickelt hatte, und als Pawel, der blaß im Türrahmen lehnte, eine Bewegung machte, als wolle er Tanja beruhigen, schüttelte sie den Kopf.
„Laß sie. Sie muß jetzt weinen. Es hilft ihr.“
Iwan Antonowitsch hatte das Gesicht in den Armen vergraben. Gjurin ist tot. Die Worte drehten sich wie ein Karussell in seinem Schädel, ohne daß er sie noch recht begriff. Konnte man so etwas denn überhaupt begreifen? Seine Tanjuschka, sein schönes, fröhliches, kluges Kind ...
Die Brust war Iwan Antonowitsch vor Stolz geschwollen, wenn er sie angesehen hatte. Wer in ganz Sarodnaja hatte solch eine Tochter? Und sooft er das gedacht hatte, war es ihm wie ein Wunder Gottes erschienen, daß zwei so durchschnittliche, einfältige Menschen wie er und Olga Sergejewna ein Geschöpf wie Tanja in die Welt gesetzt hatten.
Und nun: Gjurin ist tot. Ich habe ihn umgebracht ...
O Jesus Christ und alle Heiligen, was würde danach mit Tanja geschehen!
Iwan Antonowitsch krümmte sich zusammen. Ihm war ganz übel vor Angst und Entsetzen.
Tanja weinte noch immer. Das Schluchzen stieß sie. Aber allmählich ebbte es ab, und sie wurde stiller. Mütterchen Olga streichelte ihre Schultern und führte sie, ohne die Arme von ihr zu lösen, zur Bank. Es war ganz sonderbar: Seit dem Vorfall am Morgen jammerte Olga wie eine Katzenmutter, der man ihr Junges genommen hatte, aber nun war sie ganz ruhig.
„Setz dich hin“, sagte sie zu Tanja. Und als das Mädchen gehorchte und stumm, mit geschlossenen Augen den Kopf an die Wand lehnte, nahm Olga ihr großes Umschlagtuch von dem Nagel an der Wand und wickelte sich darin ein. „Ich gehe und wecke Michail. Er ist Jefims Sohn, er wird uns helfen.“
Iwan Antonowitsch blickte auf. „Helfen? Wobei?“ Seine Stimme klang rostig.
„Wobei, wobei!“ äffte sie ihn nach. „Hast du Grütze im Kopf? Ein Pferdchen soll er mir geben und einen Schlitten. Oder willst du warten, bis sie Gjurin morgen früh finden? Er ist tot, daran ist nichts mehr zu ändern, und seine verfluchte Seele soll zur Hölle fahren. Aber Tanjuschka lebt, und solange ich noch Atem in der Brust habe, werde ich alles tun, was ich kann, damit sie weiterlebt.“
Sie versuchte, so mit Iwan Antonowitsch zu reden, wie sie es immer tat, aber die schrille, nackte Verzweiflung in ihren Augen strafte ihren Ton Lügen. Sie litt wie er, vielleicht sogar noch schlimmer, denn sie war Tanjas Mutter. Aber, so dachte sie, da hier alles kopflos ist und niemand weiß, was geschehen soll, muß wenigstens ich mein bißchen Verstand zusammenhalten. Später war genug Zeit, sich in eine Ecke zu verkriechen und sich den ganzen Jammer von der Seele zu weinen. Später, wenn Tanja fort und das Leben leer war.
Olga Sergejewna stieß ihren Mann in die Rippen. „Sitz nicht herum, als hätte man dich entmannt, sondern tu etwas. Zünde den Samowar an und back ein paar Mehlfladen mit Speck und Eiern. Sie müssen essen und trinken, bevor sie aufbrechen. Und du, Pawel, gehst hinüber zu dir und packst Decken und Vorräte zusammen. Ich gebe euch, was ich habe, aber je mehr ihr mitnehmt, um so besser ist es.“
Pawel starrte sie an; er war noch immer wie betäubt. „Du meinst, Mütterchen, wir sollen ...“
„Fliehen, was denn sonst! Oder willst du sie allein fortlassen? Oder zusehen, daß man sie tötet, so wie sie Gjurin getötet hat?“
Tanja schauerte zusammen. „Ich wollte es nicht“, sagte sie leise. „Ich wollte nur, daß er mich losließ und still war ... Und dann lag er da, und seine Augen waren weit offen ... Und alles war voll Blut ...“
Olga ging zu ihr hin und zog ihren Kopf an ihre Brust. „Denk nicht mehr daran. Es ist vorbei.“
„Nichts ist vorbei. Sie werden uns jagen wie die Wölfe. Wie Ratten werden wir sein, nirgendwo sicher, nirgendwo zu Hause, immer auf der Flucht und voller Angst.“
„Aber leben sie vielleicht nicht, die Ratten!“ schrie Olga. Sie mußte schreien, weil sie sonst geheult hätte. „Unzählige gibt es, die alt und fett geworden sind. Rußland ist groß und weit, das größte Land der Erde, heißt es. Geht in die Wälder oder nach Westen über das Gebirge. Irgendwo werdet ihr ein Plätzchen finden, wo niemand fragt, wer ihr seid und woher ihr kommt.“
Tanja hob den Kopf. „Und ihr? Was wird aus euch?“
„Was soll schon werden! Wir werden weiterleben wie bisher. Wir wissen nichts, wir haben weder dich noch Pawel gesehen, seit Jelena Antonowna dich in dieses verfluchte Haus geholt hat. Ihr habt das Pferdchen und den Schlitten gestohlen — und fort wart ihr. Michail wird dasselbe sagen — wer will uns beweisen, daß es anders war!“
„Sie hat recht“, sagte Pawel dumpf. „Wir müssen es tun. Und wir haben nicht viel Zeit. Wenn sie Gjurin vor dem Morgen finden ...“ Er schluckte. „Tanjuschka, du hast mich heute einen Feigling genannt, und vielleicht hattest du recht. Aber jetzt ...“
Er blickte Iwan Antonowitsch an. „Ich schwöre dir, Väterchen, ich will sie beschützen, solange ich lebe. Ich will sie lieben, wie ihr sie geliebt habt, und für sie da sein, wie ihr für sie da wart.“
„Großer Gott!“ rief Olga. „Er hält eine Rede, der Idiot, statt zu tun, was ich ihm aufgetragen habe. Was stehst du hier noch herum? In einer halben Stunde müßt ihr fort sein.“ Sie zog Pawel an sich, küßte ihn auf beide Wangen und schlug das Kreuz über ihn. „Gott segne dich, Söhnchen“, sagte sie erstickt. Dann rannte sie hinaus in die Nacht.
Sie brauchte keine großen Überredungskünste anzuwenden, um von Michail Jefimowitsch ein Pferd und einen Schlitten zu bekommen. Tioka hieß das Pferdchen, und Michail sagte, während er es einschirrte: „Es ist zäh und ausdauernd. Sie werden mit ihm über den Schnee fliegen.“
Eigenhändig packte er Stroh in den Schlitten und breitete Dekken und Felle darüber. Dann führte er Tioka am Zügel nach draußen auf die verschneite Straße, damit niemand in Sarodnaja von dem Lärm des Aufbruchs geweckt würde.
Iwan Antonowitsch schleppte die eilig zusammengepackten Vorräte herbei. Dörrfleisch, einen Sack Hirse, Tee, getrockneten Fisch, einen großen Klumpen Fett, Bohnen, Heu und Hafer für das Pferdchen, ein langes, scharfgeschliffenes Messer, ein Beil, einen eisernen Topf und hölzerne Löffel.
Und dies war dann der Abschied. Iwan Antonowitsch umarmte seine Tochter. Die hellen Tränen liefen ihm über die Wangen, und er brachte kein armseliges Wort heraus. Leb wohl, mein Kindchen, du Licht meines Lebens, dachte er nur. Leb wohl, und Gott sei mit dir. Ich werde dich nie wiedersehen.
Michail Jefimowitsch kauerte in einer Ecke im Stall und hielt sich seinen Kopf, denn Mütterchen Olga hatte ihm mit aller Kraft einen hölzernen Rechenstiel darübergeschlagen. „Verzeih mir, mein Söhnchen“, hatte sie gesagt, „aber es muß sein. Morgen sagst du, daß Pawel in den Stall gekommen ist, als du schliefst. Er hat dich niedergeschlagen, um das Pferdchen und den Schlitten zu stehlen. Da mußt du eine Beule vorzeigen können.“
Jetzt stand sie neben dem Schlitten, als Pawel Tanja hineinhob und das Stroh um sie herum feststopfte und die Decken darüberbreitete. Dann kletterte er selbst hinein und nahm die Zügel. „Gott mit euch“, sagte Mütterchen Olga, und ihre Stimme klang ganz klein und dünn. „Meidet die Dörfer, verkriecht euch in den Wäldern, bis ein paar Tage vergangen sind.“
Sie umklammerte Iwan Antonowitschs Arm, als sich der Schlitten in Bewegung setzte. „Mütterchen! Väterchen!“ schluchzte Tanja. Sie krallte die Hände in das Stroh und wäre am liebsten zurückgelaufen. Ihr war, als zerrisse ihr Herz. Tioka trabte über den Schnee, und Tanja sah, wie alles zurückblieb, das Tor von Sarodnaja, die Birkenallee, die Gestalten ihrer Eltern. Klein und kleiner wurde alles, bis es endlich hinter einer Bodenwelle versank, als habe der Schnee es verschluckt.
„Sie sind fort“, sagte Mütterchen Olga. „O Gott, Iwanuschka, sie sind fort. Wie soll ich es nur ertragen?“
Sie fiel gegen Iwan Antonowitschs Brust, und er hielt sie fest, obwohl er selbst wankte, als stünde er im Sturm. So klammerten sie sich aneinander, um einer beim anderen Halt zu finden.
Es hatte wieder zu schneien begonnen, große Flocken wirbelten durch die Luft und verwehten die Schlittenspuren.
Pawel und Tanja fuhren die ganze Nacht und den halben darauffolgenden Tag. Sie hielten sich zunächst in südlicher Richtung, immer in der Nähe des Flusses, um die Orientierung nicht zu verlieren, und mieden, wie Olga Sergejewna es ihnen geraten hatte, die Ansiedlungen der Menschen. Noch wußten sie nicht, wo ihre Flucht enden sollte, noch hatten sie kein Ziel außer dem einen: nur fort, weit fort von Sarodnaja.
Gegen Mittag, als es nicht mehr schneite, hielt Pawel im Wald den Schlitten an. Er baute für Tioka eine Art Unterstand aus dicken Baumästen, in dem sich das Tier, zum Umfallen ermüdet, sofort niederlegte, machte ein Feuer, damit Tanja Tee und eine Suppe aus Hirse, Fett und getrocknetem Salzfleisch kochen konnte, und dann krochen sie beide zusammen in den Schlitten, wühlten sich in das Stroh und schliefen, eng aneinandergedrängt, den Schlaf der völligen Erschöpfung.
Sie erwachten erst in der Dunkelheit, und als sie aufbrachen, hörten sie es zum erstenmal, ganz weit entfernt noch, langgezogen, klagend, heiser: das Heulen der Wölfe.
Tanja war ein Kind Sibiriens. Sie hatte die Wölfe oft gehört in den frostklirrenden Winternächten; sie war daran gewöhnt wie an die eisige Kälte, die das Blut in den Adern gefrieren ließ, und an den Schnee, der sich manchmal bis zu den Dächern der Lehmkaten auftürmte, daß nur noch die Schornsteine herausschauten und man Morgen für Morgen Türen und Fenster freischaufeln mußte.
Aber es ist nicht dasselbe, wenn man das Heulen der Wölfe in der schützenden Geborgenheit seines Daheims hört oder in einem Schlitten, mit dem man durch die gnadenlose Wildnis längs des Jenissej zieht, durch unwegsame Wälder und endlose Ebenen, in denen Himmel und Erde einander am fernen Horizont berühren.
Was ist ein Mensch allein in Sibirien? Nicht mehr als ein Staubkorn, das der Wind verweht — ein Nichts, ausgeliefert allem, das stärker ist als er.
Am Morgen mußten sie Gjurin gefunden haben. Vielleicht auch erst am späten Vormittag, denn die Dienerschaft war es gewöhnt, daß der Herr in den Tag hineinschlief. Inzwischen mußte es ganz Sarodnaja wissen, daß er tot war. Jelinko würde ein oder zwei Männer nach Nasimowo geschickt haben, um den Gendarmerieposten zu benachrichtigen. Und dann würde er sich selbst an die Verfolgung machen, mit einem ganzen Aufgebot von Männern, Schlitten und Hunden.
Vielleicht hatte er zuvor noch die Nitenkos holen lassen: „Sagt mir, wo sie hin ist, eure Tochter mit ihrem dreckigen Liebhaber, oder ich prügle euch eure verfluchten Seelen aus dem Leib.“
O mein Gott, dachte Tanja, nur das nicht. Sie wußte, ihre Eltern würden schweigen, selbst unter den grausamsten Foltern. Aber Jelinko haßte Pawel, und er war ein Mensch, der nicht aufgab, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte. Er würde sie suchen mit der Beharrlichkeit und Schlauheit eines Fuchses — überall. In den Sümpfen im Norden, in den Bergen auf der anderen Seite des Jenissej und in den Wäldern, die sich nach Süden erstreckten, dort, wo sich der Fluß mit der Angara und der Tschuna vereinigte und danach so breit sein sollte wie ein See.
Pawel hatte das gesagt. Er war einmal mit seinem früheren Herrn Graf Tanin dort gewesen. „Vielleicht eine Tagesreise davon entfernt liegt eine Stadt. Krasnojarsk heißt sie. Sie ist sehr groß, mit Steinhäusern und breiten Straßen. Da fragt einen kein Mensch nach dem Woher und Wohin. Wenn wir in Krasnojarsk sind, sind wir in Sicherheit.“
Wenn ...
Das Heulen der Wölfe klang noch immer weit entfernt, aber es war Tanja noch nie so schauerlich erschienen wie in dieser Nacht. Sie verließ ihren Platz im hinteren Teil des Schlittens und setzte sich neben Pawel ins Stroh.
„Glaubst du, sie haben unsere Witterung?“
„Sicher nicht. Sie sind zu weit fort. Außerdem hat der Winter gerade erst angefangen. Da gibt es noch genügend Wild in den Wäldern, das sie jagen können. Für den Menschen sind die Wölfe erst gefährlich, wenn es Mark und Bein friert und sie keine Nahrung mehr finden.“
Pawels Antwort beruhigte Tanja ein wenig. Bestimmt hatte er recht. Gestern noch hatte sie gemeint, ihn zu hassen, aber jetzt war sie froh, daß er bei ihr war.
Sie wollten wieder die Nacht über fahren und am Tag einen Platz zum Schlafen suchen. Michail hatte nicht zuviel versprochen: Tioka war wirklich ein gutes Pferdchen. Um schneller vorwärtszukommen, hatte Pawel den Wald verlassen, und nun trabte es flink und ausdauernd über die verschneiten Ebenen längs des Flußufers.
Die Nacht war still geworden, irgendwann waren auch die Wölfe verstummt, und am Himmel stand ein bleicher, kalter Mond und warf sein Licht auf die glitzernde Schneefläche.
Und dann in der Morgendämmerung, als die Sterne schon verblassen wollten, waren die Stimmen der Wölfe wieder da. Tanja hatte ein wenig geschlafen — nun erwachte sie davon.
Ganz nah klang jetzt das heisere Bellen, das sich zu einem schrillen, kreischenden Heulen steigerte. Und gleich darauf tauchten die grauen Schatten am Waldrand auf.
Der Leitwolf kam zuerst, ein großes, dunkles Tier, gefolgt von vier, fünf anderen. Tioka, das Pferdchen, wieherte grell auf vor Angst. Zitternd, mit zurückgeworfenem Kopf jagte es über den Schnee. Aber was ist ein Panjepferdchen gegen ein Rudel hungriger, blutgieriger Wölfe?
Der Schlitten schwankte hin und her wie ein Schiff im Sturm. Pawel hatte sich aufgestellt und versuchte mit aller Kraft, die Zügel zu halten. Die Wölfe kamen immer näher.
Der Leitwolf war jetzt so dicht heran, daß Tanja seinen hechelnden, weitaufgerissenen Fang sehen konnte. Sie war wie gelähmt vor Entsetzen, und es dauerte eine Weile, bis sie begriff, was Pawel ihr zuschrie.
„Gib mir das Beil! Um Gottes willen, so mach doch! Und dann nimm die Zügel! Hörst du, Tanja, das Beil!“
Es lag hinten im Schlitten, die einzige Waffe, die sie hatten. Pawel nahm sie erst, nachdem Tanja die Zügel ergriffen hatte. „Nicht loslassen“, keuchte er. „Halte sie, so fest du kannst!“
Er wandte sich zurück und wog das Beil in seiner Hand. Er wußte: Wenn es ihm gelang, einen der Wölfe zu töten, würden die anderen über ihn herfallen. Sie würden ihn zerreißen, sich balgen um die blutigen Fleischfetzen und dann auseinanderlaufen, jeder mit seiner Beute im Fang, um sich daran zu sättigen.
Es war die einzige Möglichkeit, ihnen zu entkommen.
Und wenn ich nicht treffe und sie uns einholen, dachte Pawel, was dann? Wenn sie Tioka, das Pferdchen, reißen, sind Tanja und ich genauso verloren in der Wildnis, als hätten uns die Wölfe getötet. Und unser Sterben wird langsamer, qualvoller sein ...
Er umklammerte das Beil und wagte nicht, den Gedanken zu Ende zu denken. Jesus Christ und alle Heiligen, laß mich den Wolf treffen! Ich will nicht sterben! Ich will leben — mit Tanja ...