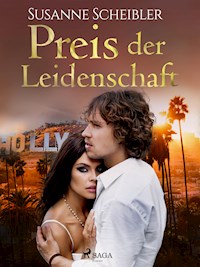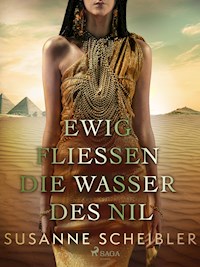Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Lasarows
- Sprache: Deutsch
Russland während der Jahrhundertwende zur Wintersaison: Die wunderschöne Svetlana Lasarow scheint ihren Lebensweg durch die Hochzeit mit Rittmeister Barschewskiy vorgezeichnet zu haben. Doch als sie dem Großfürsten Georg begegnet, ändert sich ihr Leben von einer Sekunde auf die andere: Eine schicksalreiche Liebesgeschichte im Schatten des Thrones und der heranziehenden Revolution beginnt…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Susanne Scheibler
Sturmvogel und Zarenadler
DIE LASAROWS 2. Teil
Saga
Sturmvogel und Zarenadler
Coverbild/Illustation: Shutterstock
Copyright © 2000, 2021 Susanne Scheibler und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726961188
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
1.ּ Kapitel
Auf dem Admirals-Kai und dem Senatsplatz vor dem Winterpalais drängten sich die Menschen. Kopf an Kopf standen sie, von einem dichten Polizeikordon umschlossen.
Kosaken zu Pferde sprengten die prachtvolle gemauerte Uferstraße entlang, kontrollierten auch die Seitenstraßen zum Palast, ob nirgendwo rote Fahnen oder Spruchbänder einer verbotenen Demonstration zwischen der Menge auftauchten und niemand aufrührerische Parolen brüllte.
Aber die Leute waren friedlich. Es gab nur andächtige, erwartungsfrohe Gesichter, trotz des eisigen Windes, der vom Finnischen Meerbusen herüberwehte und jedem Tränen in die Augen trieb. Sie gefroren fast augenblicklich auf den Wangen zu kleinen Eiskristallen an diesem Morgen des 6. Januar 1905, an dem grimmiger Frost herrschte.
In der Nacht war das Thermometer auf minus 32 Grad gefallen, und jetzt, in den Vormittagsstunden, zeigte es immer noch 26 Grad Kälte an.
Auf dem Polizeikommissariat am Apraxin-Markt gingen die Meldungen über die Toten ein, die in der Nacht an den eisigen Temperaturen gestorben waren. Bis jetzt zählte man dreizehn Personen, sieben Männer und sechs Frauen.
Drei von ihnen hatten im Städtischen Armenhaus am Smolnaja-Kai den Tod gefunden, zwei auf dem Warschauer Bahnhof, und die anderen – alles Obdachlose, wie es schien – fand man in schmutzigen Hauseingängen und Hinterhöfen hinter dem Heumarkt, bei den Markthallen und auf den Stufen der zahlreichen St. Petersburger Kirchen, wo sie sich, in ihre armseligen Lumpen gehüllt, in den Windschatten der prächtigen Portale gedrückt hatten.
Dreizehn Tote – nicht viel für diese Nacht, dachte der Polizist German Iwanowitsch Popkow, der die Meldungen entgegennahm. Aber vielleicht hat man noch nicht alle gefunden.
Er goß sich einen Tee ein und lockerte seinen Uniformkragen.
Es war warm in der Amtsstube, denn als German Iwanowitsch seinen Dienst angetreten hatte, hatte er ordentlich Holzscheite in den Eisenofen geworfen, der rechts neben seinem Schreibtisch stand.
Er war froh, daß er hier sein konnte und nicht zum Winterpalast abkommandiert worden war, auch wenn es dort heute eine Menge zu sehen gab.
Am Dreikönigstag fand wie in jedem Jahr die traditionelle Segnung des Newa-Wassers statt, zu der nicht nur der Metropolit von St. Petersburg, sondern alle hohen geistlichen Würdenträger der Hauptstadt und ihrer näheren Umgebung, die Mönche des Alexander-Newskij- und des Nowodewitschi-Klosters in einer feierlichen Prozession zum Fluß zogen, um mit Gesängen und Gebeten die im Frost erstarrte Newa zu segnen.
German Iwanowitsch hörte das Läuten der Glocken. Von allen Petersburger Kirchen mit ihren bunten, in Rot, Blau, Grün und Gold schimmernden Kuppeln und Zwiebeltürmen erklang es, wehte über die Dächer der Paläste und Armenviertel, Kasernen und Akademien bis hinüber zur Petersburger Seite und den anderen Inseln, die durch Brükken mit der Stadt verbunden waren.
Auch der Zar, Seine Majestät Nikolaus II., würde an der Segnung des Newa-Wassers teilnehmen, wie es alle russischen Herrscher seit altersher taten.
Wie es hieß, war er schon gestern aus Zarskoje Selo in die Hauptstadt gekommen, allerdings allein, ohne seine Frau und seine Kinder. Vier Töchter und einen Sohn hatte ›Väterchen‹; German Iwanowitsch hatte sie zweimal gesehen, als sie im letzten Sommer mit ihren Eltern von einem Balkon des Winterpalais’ der Menge auf dem Schloßplatz zugewinkt hatten. Auch die Zarin Alexandra Fjodorowna war dabeigewesen. Sie hatte den gerade ein paar Wochen alten Zarewitsch auf dem Arm getragen.
German Iwanowitsch trank einen Schluck Tee und verzog den Mund. Nicht, daß der Tee ihm nicht geschmeckt hätte, er war geradeso, wie er sein sollte, heiß und süß. Es war die Zarin, die ihm nicht schmeckte. Eine Deutsche, die als hochnäsig verschrien war. Man sah sie selten lächeln, und es hieß, daß sie daran schuld sei, daß ›Väterchen‹ kaum mehr in seine Hauptstadt kam, sondern lieber mit Frau und Kindern wie ein einfacher Gutsbesitzer auf dem Lande lebte.
Alexandra Fjodorowna mochte die russische Lebensart nicht, sagten die Leute, und sie hatte ihren Mann, Gott sei’s geklagt, dazu bewogen, sich immer mehr in die Ruhe und Abgeschiedenheit von Zarskoje Selo zurückzuziehen. Aber ob das klug war in Zeiten wie diesen?
Freilich hatte Seine Majestät genug Berichterstatter, Minister und Staatsräte, die ihm erzählen konnten, was in der Hauptstadt beinahe täglich vor sich ging. Aber ob sie ihm die Lage auch wirklich so bedenklich schilderten, wie sie war? Sagten sie ihm, daß es jeden Tag zu Demonstrationen und Streiks kam, die von den Kosaken niedergeknüppelt wurden? Und daß es überall, an den Universitäten und in den Fabriken, unter den Bauern und armen Leuten, den Intellektuellen und Künstlern, brodelte und gärte?
Freilich, er, German Iwanowitsch Popkow, war Polizist. Er war dazu da, Befehle entgegenzunehmen und sie auszuführen, damit Ordnung und Ruhe herrschten. Aber das alles hinderte ihn nicht daran, sich manchmal zu fragen, warum es denn soviel Armut im großen heiligen Rußland gab. Und wieso die Reichen denn gar so reich sein mußten.
Ihn dauerten die Toten, die in den eisigen Wintern erfroren, weil sie kein Dach über dem Kopf hatten, auch wenn vielleicht Arbeitsscheue und Taugenichtse darunter waren, Strandgut des Lebens, das es nicht geschafft hatte, ein geordnetes, angesehenes Dasein zu führen.
Natürlich gab es auch Kriminelle und Halunken unter ihnen, die, Gott strafe sie dafür, auf ihre Weise versucht hatten, sich durch das Leben zu schlagen, möglichst ohne einen Finger krumm zu machen. Aber es waren auch solche dabei, die unverschuldet in Not geraten waren. Kleinbauern, deren Ernte verdorrt oder im Regen abgesoffen war, so daß sie die Steuern oder die Pacht nicht zu zahlen vermochten, Arbeiter, die aus Krankheit oder Altersgründen ihre Anstellung verloren und denen nur noch die Straße blieb, um dort dahinzuvegetieren, Frauen, deren Männer alles Geld versoffen und ihnen jedes Jahr ein neues Kind machten, für das sie nicht sorgten und das in Dreck und Elend heranwuchs, niemals satt, voller Pusteln und Geschwüre, mit Wassersucht und Ungeziefer behaftet...
German Iwanowitsch hatte sie gesehen, diese Kinder, die erst ein paar Jahre auf dieser beschissenen Erde lebten, mit den Gesichtern von Greisen und Augen, in denen alles Leid der Welt zu liegen schien.
Nein, er war nicht blind, der Polizist German Iwanowitsch Popkow, und manches Mal fiel es ihm verflucht schwer, diese armen Hunde in Gewahrsam zu nehmen und in eine Zelle zu stoßen, nur weil sie aus Hunger gestohlen hatten. Es fiel ihm auch schwer, die ›Politischen‹ auf die gleiche oder sogar noch brutalere Art zu behandeln, weil er sehr wohl wußte, daß sie selten ihres eigenen Vorteils halber eine Veränderung der Verhältnisse anstrebten, sondern um mehr Gerechtigkeit zu erwirken, freilich oftmals mit Mitteln, die auf verheerende Art den Grausamkeiten der ›Ochrana‹, der Geheimpolizei, und ihren Helfershelfern glichen.
Ach, es war oft verteufelt schwer für einen einfachen Polizisten, zwischen Recht und Unrecht zu entscheiden, und eine gelegentlich sehr fragwürdige Ehre, der Staatsgewalt zu dienen.
Immerhin, man schuldete der Obrigkeit als Ordnungshüter Gehorsam. Man hatte sogar einen Eid darauf abgelegt, und so konnte man jeden Tag nur von neuem hoffen, daß diese Obrigkeit nichts Unbilliges von einem verlangte.
Die Glocken läuteten immer noch, und dann schossen sie von der Peter-Paul-Festung Salut – ein Zeichen, daß Seine Majestät, der Zar, sich dem langen Zug der geistlichen Würdenträger angeschlossen hatte, um an der Segnung teilzunehmen.
German Iwanowitsch trat ans Fenster, aber er sah nur den grauen, von schmutzigem Schnee bedeckten Hinterhof vor seiner Amtsstube. Gegenüber standen schmalbrüstige Häuser mit abgeblätterten Fassaden und windschiefen Türen.
Im selben Augenblick ließ eine heftige Detonation die Scheiben klirren. German erschrak und hätte sich um ein Haar zu Boden geworfen. Das war kein Salutschuß gewesen. Das war eine Kartätschenladung, die explodiert war.
Er riß das Fenster auf und wich vor dem Schwall eiskalter Luft zurück, die in die Amtsstube wehte. Atemlos wartete er, ob noch weitere Detonationen folgten. Aber es blieb alles ruhig. Auch das Salutschießen hatte aufgehört; nur die Glocken läuteten noch immer.
German Iwanowitsch lauschte noch ein paar Sekunden nach draußen, dann schloß er das Fenster wieder und kehrte an seinen Schreibtisch zurück.
Irgend etwas war passiert, dessen war er sicher. Aber wann passierte einmal nichts in dieser Stadt, in der es schäumte und kochte wie in einem Topf mit verdorbener Kohlsuppe.
Heilige Mutter von Kasan, dachte German Iwanowitsch, nimmt das denn nie ein Ende? Wieso ist da eine Kartätschenladung abgefeuert worden, vermutlich ebenfalls von der Peter-Paul-Festung? Na ja, auch unter den Kanonieren gibt es Unzufriedene und heimliche Umstürzler, und die hochwohlgeborenen Herren Offiziere können nicht überall ihre Augen haben. Wie schnell ist da eine Kanone mit einer Kartätschenladung bestückt, und hui, rast das Teufelsding in die Menge.
Es ist zum Weinen, heilige Schmerzensmutter! Genügt es denn nicht, daß wir Krieg haben und Tag für Tag gute russische Männer an der japanischen Front fallen? Muß es auch hier noch Tote geben, erschossen, von Bomben zerfetzt, von Kosakenpferden niedergeritten oder zusammengeknüppelt, bis sie ihr Leben aushauchen?
German Iwanowitsch stützte den Kopf in die Hände. Sein breitflächiges, sommersprossiges Gesicht war bedrückt.
Im Sommer hatte er geheiratet, und nun erwartete seine Marja ihr erstes Kindchen. Zur Zeit der Weißen Nächte sollte es geboren werden. Aber in was für eine Welt kam es nur?
Er hatte sich ein Söhnchen gewünscht, doch nun auf einmal dachte German Iwanowitsch, daß ein Töchterchen vielleicht doch besser wäre.
Töchter wurden keine Soldaten, wenn es dem Zaren gefiel, irgendwo Krieg zu führen. Sie wurden auch keine Polizisten, die bei Bombenattentaten und Schießereien ums Leben kommen konnten.
So wie es Awdej Peljagin erwischt hatte. Im letzten Juli war das gewesen, als Minister Plehwe auf der Fahrt zum Bahnhof von einer Bombe zerfetzt wurde.
Mit ihm starb sein Kutscher und wenige Tage später Awdej an seinen schweren Verletzungen. Er war Polizist gewesen wie German, im gleichen Alter wie er, nur daß er noch nicht verheiratet war, sondern eine alte Mutter hinterließ, für die er gesorgt hatte.
Seitdem war die Peljagina sonderlich geworden. Sie schlurfte stundenlang durch die Straßen, gleichgültig, welches Wetter herrschte, und wenn sie irgendwo einen Polizisten entdeckte oder ein Kommissariat, fragte sie nach ihrem Sohn.
»Awdej ist schon so lange fort... Sag mir, Söhnchen, wann er wieder heimkommt. Es schreit zum Himmel, ihn so herumzujagen. Warum schickt ihr keinen, der ihn ablöst. Bitte, laßt Awdej nach Hause. Er wird müde und hungrig sein ...«
German Popkow stieß einen Seufzer aus. Nein, es war sicherlich besser, wenn seine Marja ein Töchterchen bekam ...
Swetlana Pawlowna Soklowa erwachte an diesem Morgen des Dreikönigstages in ihrem Palais auf der Wassiljewskij-Insel, weil Rodja sich neben ihr in den Kissen bewegte.
Sie öffnete die Augen und blickte in das Halbdunkel ihres Schlafzimmers. Die schweren fraisefarbenen Samtportieren vor den Fenstern waren zugezogen und ließen nur wenig Helligkeit herein. Aber das wenige verriet, daß draußen sonniges, frostklares Wetter herrschte.
Wie schön, dachte Swetlana. Dann kann ich nachher mit Fjodorenka zum Eislaufen fahren.
Sie stützte sich auf einen Arm und blickte den Mann neben sich an. Er schlief noch fest; sie hörte es an seinen gleichmäßigen Atemzügen.
Ihr schöner Geliebter ...
Swetlana wurde es selten müde, ihn zu betrachten, seine dunklen lockigen Haare, die ihm in die Stirn fielen, das bräunliche gutgeschnittene Gesicht, das männliche Kinn mit dem Grübchen darin, die langen dunklen Wimpern, die jetzt wie kleine Halbmonde dicht und seidig seine geschlossenen Lider umrahmten.
Swetlana liebte auch Rodjas Hände. Lang und schmal waren sie, aber dennoch kräftig. Künstlerhände, die hinreißende Malereien schufen und die so zärtlich und erregend sein konnten ...
Swetlana drehte sich wieder auf den Rücken und schloß die Augen, um das Glücksgefühl, das in ihr war, voll auszukosten.
Ja, sie war glücklich, und sie hätte nie geglaubt, daß sie es jemals wieder im Leben sein könnte, nachdem sie Georg Alexandrowitsch verloren hatte.
Rodja bewegte sich und blinzelte ein paarmal mit den Lidern. Dann tastete er auf die andere Seite des Bettes hinüber, und ein Lächeln erschien um seinen Mund, als er Swetlanas Haar erfühlte.
Sie wandte den Kopf und drückte ihre Lippen auf seine Hand. »Guten Morgen, mein Liebster.«
Er murmelte etwas Unverständliches und rückte näher an sie heran. Im nächsten Augenblick hatte er sie umarmt und küßte sie auf ihre Halsgrube.
»Guten Morgen, meine Schöne.«
Seit Rodja Masslejew Anfang Dezember nach St. Petersburg gekommen war, waren sie keine Nacht mehr voneinander getrennt gewesen.
Er hatte sich zwar eine Wohnung am Garde-Boulevard, ganz in der Nähe des Alexandergartens, gemietet, wo er sich sein Maleratelier eingerichtet hatte und Besucher empfing, aber jede freie Minute verbrachte er bei Swetlana, sehr zum Entzücken ihres Sohnes Fjodor, der ›Monsieur Rodjon‹, wie er ihn nannte, schon beim ersten Kennenlernen in der kaiserlichen Residenz Liwadja auf der Krim ins Herz geschlossen hatte.
Auch das war Glück in Swetlanas Augen.
Fjodor war Leonid Soklow immer mit einer gewissen Scheu begegnet. Und seit das Kind größer geworden war, hatte es den Fürsten sogar gefürchtet, eine instinktive Furcht, die freilich durch Leonids Sarkasmus und seine Strenge, die Erziehung des Kindes betreffend, genährt worden waren.
Herzlichkeit dem kleinen Jungen gegenüber, der doch immerhin als Leonids Sohn galt und mit dem er sich in der Öffentlichkeit sogar spreizte, war nie von ihm ausgegangen.
Um so enger hatte Fjodor sich dann an Rodja angeschlossen, der fröhlich und unkompliziert mit dem Kleinen umging.
»Hallo, du Lügner!« sagte Swetlana zärtlich, während sie es genoß, daß Rodja sie küßte.
Du Lügner – das war ein oft strapazierter Scherz zwischen ihnen, hatte Rodja doch versprochen gehabt, nach St. Petersburg zu kommen, wenn der erste Schnee fiel. Das hatte er nicht einhalten können, denn es hatte schon Anfang November starke Schneefälle in der Hauptstadt gegeben, bald nachdem Swetlana aus Liwadja hier eingetroffen war.
Natürlich war ihr klargewesen, daß Rodja ihr nicht so schnell folgen konnte, wie er es gewünscht hätte. Er mußte noch auf der Krim bleiben, um die Porträts der Zarenkinder zu vollenden, die Kaiserin Alexandra Fjodorowna bei ihm in Auftrag gegeben hatte.
Aber er war gekommen, wenn auch verspätet – und nur das zählte.
Rodja umfaßte Swetlanas Taille. »Willst du mir mein Versäumnis denn ewig vorhalten?« fragte er heiter.
Sie schüttelte den Kopf. »Ich halte dir gar nichts vor. Wie könnte ich? Wir Frauen sind törichte Geschöpfe, wenn wir lieben. Dann verzeihen wir fast alles.«
»Also liebst du mich?«
Sie lachte leise. »Als ob du das nicht wüßtest!«
»Natürlich weiß ich es. Aber ich kann es trotzdem nicht oft genug von dir bestätigt bekommen.«
Die Pendule auf dem Marmorkamin schlug neunmal, und Swetlana schob Rodja von sich und setzte sich auf.
»So spät schon? In zwei Stunden muß ich im Winterpalais sein. Seine Majestät wünscht meine Anwesenheit bei der Segnung des Newa-Wassers. Die Zeremonie beginnt um halb zwölf. Also laß mich aufstehen.«
Er ließ sie widerstrebend los. »Muß das sein? Immerhin hat die Zarin dich aus dem Hofdienst entlassen, weil du deinen Mann mit mir betrogen hast. Oder hast du das vergessen?«
Sie schwang die Beine aus dem Bett. »Was blieb ihr anderes übrig, nachdem Anna Wyrubowa dich und mich quasi in flagranti erwischt und natürlich nichts Eiligeres zu tun hatte, als ihr Wissen an die Kaiserin weiterzugeben. Die Wyrubowa hat mir seit langem die Zuneigung von Alexandra Fjodorowna geneidet, und nun hatte sie endlich eine Handhabe gegen mich. Vergiß nicht, Leonid war an der japanischen Front, und für einen Menschen wie die Zarin mußte unser Verhältnis unter diesen Umständen doppelt verdammungswürdig sein. Sie wußte ja nicht, wie meine Ehe wirklich war.«
»Denk nicht mehr daran«, bat Rodja, und sie beugte sich zu ihm und küßte seine nackte Brust.
»Meist tue ich es auch nicht. Wirklich, ich bin auf dem besten Wege, dies alles zu vergessen, und das ist dein Verdienst, mein Liebster.«
Er sah ihr nach, wie sie sich ein Negligé überwarf und hinter der Tür des angrenzenden Baderaumes verschwand.
Dort wartete bereits ihre Zofe Jeanette auf sie. Sie hatte das Feuer nachgeschürt und heißes Wasser in die silberne Wanne gegossen. Es duftete nach einer Essenz aus Verbenen und Veilchen, auf deren Zubereitung Jeanette sich wie keine zweite verstand.
Swetlana liebte diesen Geruch, und sie genoß es, eine Weile in dem warmen Wasser zu liegen und sich anschließend von Jeanette beim Ankleiden helfen und sich frisieren zu lassen.
Die Französin steckte Swetlanas schweres blondes Haar im Nacken zusammen und befestigte es mit einer brillantenbesetzten Agraffe.
Swetlana trug noch Schwarz, obwohl sie sich selbst dabei unaufrichtig vorkam. Aber es war erst ein Vierteljahr her, daß sie die Nachricht erhalten hatte, Leonid Soklow sei bei den Kämpfen um Mukden zunächst vermißt worden und, nachdem alle Nachforschungen im Sande verlaufen waren, offensichtlich gefallen. Aber die schwarze Kleidung trug Swetlana nur in der Öffentlichkeit, weil man das von einer Fürstin Soklowa erwartete.
Allerdings – zu trauern vermochte sie nicht einen einzigen Augenblick lang um Leonid. Dazu hatte er ihr zuviel angetan.
Der Schlitten der Fürstin Soklowa traf um elf Uhr vor dem Winterpalais ein. Es war das erste Mal nach dem Bekanntwerden von Leonids Tod, daß sie an einer höfischen Veranstaltung teilnahm.
Als sie die von Marmor und Gold strotzende riesige Eingangshalle betrat, in der sich das Gefolge von Nikolaus II. bereits versammelt hatte, erregte ihr Erscheinen Aufsehen.
Man hatte nicht damit gerechnet, die Soklowa so rasch wieder bei Hof anzutreffen. Hieß es nicht, die Zarin habe sie in Liwadja im Zorn fortgeschickt?
Ihre Majestät hatte natürlich kein Wort über die eigentlichen Gründe verlauten lassen. Aber der Klatsch blühte dennoch. Da und dort war durchgesickert, daß die Soklowa ein Liebesverhältnis eingegangen war. Das hätte ihr die kaiserliche Ungnade zugezogen.
Besonders Eingeweihte wußten auch, um wen es sich handelte, nämlich um diesen fabelhaft aussehenden Kunstmaler Rodja Andrejewitsch Masslejew, der nun ebenfalls in St. Petersburg lebte und bei der Soklowa aus und ein gehen sollte. Wahrlich, ein Bild von einem Mann, auch wenn er leider nur ein Künstler und bürgerlicher Abstammung war.
Ihre Majestät, die Zarin, schien seine Arbeiten außerordentlich zu schätzen. Sie hatte die kleinen Großfürstinnen und den Zarewitsch von ihm malen lassen, und seitdem bestürmte man ihn in der Petersburger guten Gesellschaft um weitere Arbeiten.
Wie man sich erzählte, hatte er schon etliche Aufträge angenommen, unter anderem Porträts der Großfürstin Xenia, einer Schwester Seiner Majestät, und von Natalja Scheremetjewa, der morganatischen Gemahlin vom Zarenbruder Michail Alexandrowitsch.
Swetlana achtete nicht auf das Getuschel hinter ihrem Rücken. Sie nickte einigen Bekannten grüßend zu und wollte sich gerade zu Tatjana Botkina gesellen, die ihr lebhaft zuwinkte, als der Zar auf der Treppe der Botschafter erschien. Begleitet von einigen hohen kirchlichen Würdenträgern und gefolgt von seiner Garde, unter der Swetlana ihren Bruder Jurij entdeckte, stieg er die Stufen hinab. Zar Nikolaus II. trug die Uniform der Preobraschenskij, und Swetlana fand, daß er müde und bedrückt wirkte.
Immerhin erhellte sich seine Miene zu einem freundlichen, beinahe herzlichen Lächeln, als er Swetlana gewahrte. Mit einer für ihn ungewöhnlichen Entschiedenheit kam er auf sie zu.
»Meine liebe Fürstin Soklowa«, sagte er laut genug, daß die Umstehenden es hören konnten, »wie schön, Sie wiederzusehen! Ich hoffe, es geht Ihnen wohl, trotz der tragischen Ereignisse, die hinter Ihnen liegen.«
»Recht wohl, Euer Majestät«, erwiderte sie, während sie den vorgeschriebenen Hofknicks vollführte. »Und ich danke Eurer Majestät für die Ehre, Sie an diesem Tag begleiten zu dürfen.«
»Es war der besondere Wunsch der Zarin«, sagte Nikolaus und fügte eilig hinzu: »Und natürlich auch meiner. Ihre Majestät wollte wissen, wie es Ihnen geht, und ich hoffe, ich kann ihr berichten, daß Sie wohlauf und zufrieden sind.«
»Doch, das bin ich, Euer Majestät«, gestand sie mit einem Lächeln. »Und ich bitte Sie, der Kaiserin meine untertänigsten Grüße zu übermitteln. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an Ihre Majestät denke.«
»Das wird sie zu hören freuen.« Nikolaus verneigte sich leicht und ging dann weiter, um einige andere der Versammelten zu begrüßen.
Pünktlich um halb zwölf hatte der lange Zug des Zaren mit seinen Militärs und Würdenträgern die Troizkij-Brücke erreicht, die die Newa überspannte und die Stadt mit der Petersburger Seite verband. Vorgelagert, auf der Krepost- nyj-Insel, lag die Peter-Paul-Festung.
Für den Zaren hatte man auf der Brücke einen Pavillon errichtet, von dem aus er mit etlichen seiner Begleiter die Zeremonie beobachten konnte. Das kleine Gebäude war beheizt und vor dem eisigen Wind geschützt, der vom Finnischen Meerbusen herüberwehte.
Auch Swetlana wurde, wie es seiner rücksichtsvollen Art entsprach, von Nikolaus II. aufgefordert, ihn in den Pavillon zu begleiten.
Von den Glasfenstern zur Flußseite hin beobachtete sie, wie der Metropolit von St. Petersburg, gefolgt von Vater Theodosius, dem Beichtvater der kaiserlichen Familie, sowie den Metropoliten von Moskau und Kiew, die Brücke betrat. Die ihn begleitenden Mönche stimmten das ›Kyrie Eleison‹ an.
Ihr Gesang wurde übertönt, als man von der Festung Salut schoß.
Und dann erfolgte die Kartätschenexplosion.
Die tödliche Ladung schlug auf der Troizkij-Brücke ein, und Swetlana gewahrte, wie zwei, drei Polizisten von dem Luftdruck in die Höhe gerissen wurden und dann auf das Pflaster stürzten, wo sie liegenblieben.
Zar Nikolaus war blaß geworden. »Was war das?« fragte er verstört. »Was ist da passiert?«
Sie erfuhren es wenige Augenblicke später, als eine Ordonnanz in den Pavillon gestürzt kam. »Ein Attentat!« schrie der junge Offizier schreckensbleich. »Es hat vermutlich Eurer Majestät gegolten!«
Gardisten, soweit sie nicht zuvor schon im Pavillon Platz gefunden hatten, drängten herein und umringten den Zaren, um ihn mit ihren Leibern zu schützen. Der eher schmächtige Mann war hinter ihren großen breitschultrigen Figuren kaum zu sehen.
Nikolaus hob die Hand. »Nein, geben Sie den Weg frei. Ich will sehen, was da draußen geschehen ist.«
Trotz zahlreicher Proteste ging er hinaus und beugte sich gleich darauf über die drei auf dem verschneiten Boden liegenden Männer, um die sich eine Blutlache ausbreitete.
Ein Regimentsarzt war bei ihnen und richtete sich auf, als er den Zaren mit seiner Begleitung gewahrte.
»Sie leben, Euer Majestät«, sagte er und salutierte. »Und soweit ich bis jetzt feststellen konnte, hat keiner von ihnen eine lebensbedrohliche Verletzung davongetragen.«
»Dem Himmel sei Dank«, murmelte der Zar. Er winkte einem seiner Adjutanten. »Graf Medwinskij, kümmern Sie sich darum, daß die drei ins Marien-Krankenhaus gebracht und dort auf das Beste versorgt werden. Ich werde mich selbst davon überzeugen. Die Behandlung soll Professor Juschenskij persönlich übernehmen.«
»Sehr wohl, Euer Majestät.« Der junge Offizier grüßte militärisch und wandte sich ab, um das Nötige zu veranlassen.
Nikolaus Alexandrowitsch warf einen letzten schaudernden Blick auf die drei Verletzten in ihrem Blut. Sie waren bewußtlos, aber als zwei Sanitäter sie aufhoben und auf die mitgebrachten Tragen betteten, stöhnten sie.
Der Zar drehte sich zu einem seiner Gardesoldaten um. »Ich möchte die Namen der Leute wissen. Und man soll den Familien aus meiner Privatschatulle jeweils tausend Rubel zukommen lassen.« Dann kehrte er eiligen Schrittes in den Pavillon zurück.
Draußen begannen die Mönche wieder zu singen, und der Metropolit von St. Petersburg setzte die Segnung des Newa-Wassers fort. Aber es geschah rasch und ohne besondere Feierlichkeit, und als die Zeremonie beendet war, formierte sich sogleich der Zug der Geistlichen und Mönche, um mit dem Zaren und seinem Gefolge die Sicherheit des Winterpalastes aufzusuchen.
Dieses Mal schwiegen die Kanonen, und man konnte die Hochrufe hören, die die Menge hinter dem noch dichter zusammengezogenen Polizeikordon dem Zaren nachsandte. Sie klangen dünn und, so schien es Swetlana, voller Betroffenheit. Der laute Jubel von vorhin, als der Monarch über den Schloß-Kai zur Brücke gezogen war, war verstummt.
Im Winterpalais begab sich Zar Nikolaus sogleich in sein Arbeitszimmer und bat seinen neuen Innenminister, Fürst Swjatopolk-Mirski, Justizminister Murawjew und den Obersten des Heiligen Synod, Konstantin Pobjedonoszew, zu sich.
Er ordnete eine strenge Untersuchung des Zwischenfalls an und reiste nach einem hastig eingenommenen Mittagsmahl nach Zarskoje Selo zurück.
Als Swetlana nach Hause kam, empfing Rodja sie in heller Aufregung. »Dem Himmel sei Dank, dir ist nichts passiert! Einer der Gärtner – ich glaube, er heißt Mitja – war in der Stadt und brachte die Nachricht von einem Attentat mit. Er sagte, es hätte Tote und Verletzte gegeben. Ich wollte mich gerade auf den Weg machen, um nach dir zu suchen.«
Sie umfaßte sein Gesicht mit den Händen. »Die Leute übertreiben – wie immer, wenn ein Unglück geschieht. Eine Kartätschenladung ist explodiert. Aber es ist noch nicht einmal sicher, ob es sich dabei um einen Anschlag gehandelt hat. Ebensogut kann es Nachlässigkeit beim Entladen der Kanonen gewesen sein, als man das Salutschießen vorbereitete. Leider sind drei Polizisten dabei verletzt worden. Aber sie schweben zum Glück nicht in Lebensgefahr.«
Er zog sie an sich und lehnte seine Stirn gegen ihr Haar. »Fjodorenka habe ich nichts gesagt, um ihn nicht zu ängstigen. Aber ich war halb verrückt vor Sorge. Ach, mein Herz, ich glaube, ich könnte es nicht aushalten, wenn dir etwas zustieße.«
Wie gut sie ihn verstand!
Auch sie konnte sich ihr Leben ohne Rodja nicht mehr vorstellen.Sie lächelte ihm zu. »Wo ist Fjodorenka? Ich habe ihm versprochen, mit ihm zum Eislaufen zu fahren.«
Der Eintritt des Kindes enthob ihn einer Antwort. Es stürmte auf seine Mutter zu. »Da bist du ja endlich, Matuschka! Hast du den Zaren gesehen? Hat er mit dir gesprochen?«
Sie hob den Vierjährigen hoch und drückte ihn an sich. »Ja, mein Herzchen. Seine Majestät war wirklich sehr freundlich.«
»Waren die Großfürstinnen bei ihm? Ich habe Anastasia, Maria, Olga und Tatjana so lange nicht gesehen. Seit wir aus Liwadja abgereist sind. Und den Zarewitsch Alexej auch nicht. Ist er immer noch ein so kleines Baby, das man kaum anfassen darf? Wenn sie jetzt in Petersburg sind, kann ich sie vielleicht besuchen.«
Swetlana setzte ihn ab. »Das geht leider nicht, Fjodorenka. Die Zarin und ihre Kinder sind in Zarkoje Selo geblieben. Seine Majestät war allein hier.«
»Dann müssen wir aber bald nach Zarkoje Selo fahren. Anastasia und Maria würden sich bestimmt freuen. Olga und Tatjana sind vielleicht schon zu groß, um mit mir zu spielen. Und Alexej ist noch zu klein.«
»Wir werden hinfahren, wenn die Kaiserin uns einlädt«, erwiderte Swetlana. »Bis dahin mußt du Geduld haben, Fjodorenka.«
»Warum?« wollte er wissen, und sie antwortete:
»Weil die Mitglieder der kaiserlichen Familie bestimmen, ob und wann sie jemanden sehen wollen.«
»Aber wenn ich sie doch sehen will! Kann ich das nicht auch bestimmen?«
»Nein, mein Herzchen. Wir müssen warten, bis Ihre Majestät uns zu sich bittet.«
Fjodor runzelte die kindlich runde Stirn. »Aber ich bin sicher, daß Maria und Anastasia mich gern sehen würden. Anastasia ist zwar dümmer als ich, weil sie noch so gut wie kein Wort französisch kann. Aber sie ist ganz nett, trotz ihrer schrecklichen Verfressenheit. Und Maria läßt mich sogar mit ihrem Puppenhaus spielen. Aber dann muß ich ihr etwas anderes dafür geben. In Liwadja war sie ganz wild auf meine Zinnsoldaten. Sie hat mir schon welche abgeluchst. Sogar meinen französischen Tambourmajor. Wenn ich sie besuche, bringe ich ihr einen russischen Kanonier mit. Dem fehlt ein Bein, aber sonst ist er noch ganz in Ordnung.«
»Ach, Fjodorenka ...« Swetlana unterdrückte ein Lachen. »Man verschenkt doch nichts, was kaputt ist. Und schon gar nicht an die Großfürstin Maria Nikolajewna.«
»Warum nicht?« Er schaute sie aus seinen großen blauen Augen an. Es waren Georgs Augen; Swetlana stellte es jedesmal mit einer Mischung aus Kummer und Freude fest. Wie glücklich wäre Georg Alexandrowitsch über diesen Sohn gewesen! »Ist eine Großfürstin mehr als ein Prinz? Mir hat Maria nämlich mal ihre kaputte Spieldose gegeben. Sie läßt sich gar nicht mehr aufziehen.«
»Eigentlich, Fjodorenka«, mischte Rodja sich ein, »ist nur dann ein Mensch mehr als andere, wenn er besser, klüger, großmütiger oder tapferer ist als die meisten. Aber leider gibt es auch noch gewisse Standesunterschiede. Und da sind die Töchter eines Zaren eben höhergestellt als beispielsweise ein Prinz Soklow. Oder nehmen wir deine Matuschka. Als Fürstin Soklowa hat sie eine gesellschaftliche Stellung, die weit über der eines bürgerlichen Rodion Masslejew liegt.«
»Das finde ich aber nicht gut!« rief Fjodor, und seine Augen blitzten ärgerlich. »Warum ist das so?«
»Ja, warum?« wiederholte Rodja. Es klang ein wenig bitter, und Swetlana legte den Arm um seine Schultern.
»Rojda ist klüger, besser und tapferer als viele andere Menschen, die ich kenne. Darum steht er in meinen Augen auch viel höher als sie. Und das, meine ich, wiegt die dummen Standesunterschiede zehnmal auf. Und jetzt geh, mein kleiner Prinz, und laß dir von Schura etwas Warmes anziehen. Wir fahren zur Kleinen Newka und schauen dort den Eisläufern zu.«
»Nicht nur zuschauen!« protestierte Fjodor. »Wir nehmen unsere Schlittschuhe mit. Wenn ihr mich an den Händen haltet, kann ich nicht hinfallen. Und vielleicht kann ich auch schon ein bißchen allein laufen. Ich muß nur üben. Bitte, Matuschka!«
»Also gut«, gab Swetlana nach. »Aber du mußt mir versprechen, nicht unvorsichtig zu sein.«
»Ich schwöre es, maman«, sagte er mit einer kleinen drolligen Verbeugung und stürmte zur Tür hinaus.
2. Kapitel
Er hieß Georg Gapon und war ein hünenhafter Mensch mit früh ergrautem Haar und einem langen Bart.
Über das Doppelspiel, das er spielte, wußten nur drei Leute bei der Ochrana, der Geheimpolizei, Bescheid. Es waren ein Mann, der sich Ossip nannte, einer, dessen Deckname Pjotr war, und einer der sich sinnigerweise den Namen Nikolaus zugelegt hatte.
Georg Gapon war ein Pope, und bei der Ochrana wurde er als ›Agent provocateur‹ geführt. Im Klartext hieß das, Gapon hatte den Auftrag, die subversiven Elemente, diejenigen, die einen Umsturz wollten, die Sozialisten und aufrührerischen Studentengruppen, die revoltierenden Arbeiter und Bauern, gegen das Zarenregime und die bestehende Ordnung aufzuhetzen und sie zu gesetzwidrigen Aktionen anzustacheln, um sie dadurch ans Messer zu liefern.
Gapon war ein absoluter Glücksfall für die Ochrana. Niemand verstand es besser als er, Unzufriedene mobil zu machen. Keiner war ein erfolgreicherer Demagoge, der es mit grenzenlosem Elan fertigbrachte, eine Demonstration ins Leben zu rufen, die unorganisierten Splittergruppen zu einer straffen Formation zusammenzuschließen und selbst Zögernde auf die Straße zu locken, um mit Spruchbändern und roten Fahnen gegen die bestehenden Verhältnisse zu protestieren.
Ob Studenten oder Arbeiter, ob Mitglieder der sogenannten Intelligenzija oder Bauern – die meisten vertrauten Gapon und folgten seinen revolutionären Protesten.
Nach jener Kartätschenladung, die am 6. Januar explodiert war und der man im Nachhinein keine wie auch immer geartete revolutionäre Absicht unterschieben konnte – die Untersuchungen hatten ergeben, daß es sich lediglich um eine Nachlässigkeit der Kanoniere beim Entladen der Kanonen gehandelt hatte – nutzte Gapon geschickt den Unwillen der Petersburger Studenten und Arbeiter, um sie zu einer großen Demonstration aufzurufen.
Sein Betätigungsfeld war in der Hauptsache die ›Vereinigung russischer Fabrikarbeiter Petersburgs‹, die von ihm gegründet worden war und bereits 25 000 Mitglieder zählte.
Mit Wissen der Ochrana berief er am 8. Januar eine Versammlung ein, in der er eine seiner üblichen zündenden Reden hielt.
»Morgen nachmittag«, so rief er mit fanatisch leuchtenden Augen, »werden wir gemeinsam zum Winterpalais ziehen, um dem Zaren unsere Wünsche vorzutragen. Es sind die Wünsche des ganzen russischen Volkes, Brüder, und wenn wir sie durchsetzen, werden noch eure Kinder und Enkel euch dafür segnen. Ich selbst werde heute noch Nachricht an Väterchen senden und ihn von unserem Kommen in Kenntnis setzen. Er muß und er wird uns anhören.«
»Väterchen Zar muß gar nichts!« rief einer dazwischen, und andere stimmten ihm zu.
»Einen Dreck wird er tun! Man weiß ja, wie so etwas ausgeht. Swjatopolk-Mirski, der neue Innenminister, Gott schlage ihn mit der Krätze, wird Polizei und Armee auf uns hetzen, und wir werden unter den Hufen ihrer Pferde sterben.«
»Nein!« Gapon hatte eine mächtige Stimme, die sich dröhnend über die Einwände erhob. »Dieses Mal werden wir siegreich sein. Und wißt ihr, warum? Wir kommen ohne Waffen und rote Fahnen. Wir bringen statt dessen unsere Frauen und Kinder mit und tragen das Bildnis des Zaren vor uns her. Er soll sehen, daß wir keine Gewalt wollen, dann kann er uns auch nicht mit Gewalt antworten.«
»Du spinnst, Pope!« rief ein kleiner drahtiger Mann und drängte sich nach vorn an den Tisch, von dem aus Gapon sprach. »Hat dir jemand ins Hirn gepinkelt? Frauen und Kinder – pah! Als ob die verfluchten Kosaken davor Halt machten! Auf ihre Bajonette werden sie die Säuglinge spießen und unseren Frauen die Bäuche aufschlitzen, wie sie es seit Jermaks Zeiten getan haben. Wie wollen wir sie hindern, wenn wir keine Waffen mit uns führen?«
»Wir tragen heilige Ikonen vor uns her!« schrie Gapon. »Begreift ihr nicht? Was hat es denn genützt, wenn ihr geflucht und gedroht, um euch geschlagen und geschossen habt? Was haben die Bomben der Anarchisten bewirkt, ihre Sprengstoffattentate? Sie haben einen oder zwei umgebracht, und danach ist ein neuer Schinder an die Stelle der Toten getreten, und alles wurde ärger als vordem.«
Wieder erhob sich Tumult, aber die Stimmen, die Gapon beipflichteten, mehrten sich.
Ein junger Mann, dem die rechte Hand fehlte, tauchte neben dem Popen auf. Er hob den Arm und zeigte seine Verstümmelung.
»Er hat recht. Wenn wir gewaltsam auftreten, sind wir immer die Unterlegenen. Hier, seht, Freunde. Das habe ich dem Säbelhieb eines Husaren zu verdanken, als ich in Charkow mit den aufständischen Bauern ein paar Gutshäuser angezündet habe. Seitdem kann ich nicht mehr in meinem Beruf als Schmied arbeiten. Man braucht zwei Hände dafür. Ich bin jetzt Heizer im Kalinkin-Hospital, und die paar Kopeken, die ich damit verdiene, reichen kaum, mich allein satt zu machen, geschweige denn meine Eltern und meine fünf Geschwister.«
Er deutete auf Gapon. »Ich denke, wir sollten tun, was er vorschlägt. Er hat die Wahrheit gesagt: Wenn wir Gewalt anwenden, wird die Regierung immer mit Gewalt antworten. Das jüngste Beispiel zeigt es. Die Streiks in den Stahlwerken von Putilow, denen sich fast vierhundert andere Fabriken angeschlossen haben, werden mit aller Härte bekämpft. Es gab Massenverhaftungen, und etliche Fabriken wurden von der Polizei gestürmt. Ich weiß nicht, wie viele Tote und Verletzte es dabei wieder gegeben hat. Aber man kann sicher sein, daß es in der Hauptsache die Unsrigen getroffen hat.«
»Du hast es erfaßt, Söhnchen!« Gapon schlug dem jungen Mann auf die Schulter. »Aber gegen Menschen, die Ikonen und Kirchenfahnen vor sich hertragen und als Bittsteller kommen, werden sie nicht mit Gewehren und Kanonen vorgehen.«
Er zog ein Blatt Papier aus der Mappe, die vor ihm auf dem Tisch lag.
»Hört, was ich dem Zaren geschrieben habe. ›Morgen um halb elf werden wir uns vor dem Winterpalais zeigen, um dir die Wünsche der gesamten Nation vorzutragen: Sofortige Einberufung einer verfassunggebenden Versammlung, Verantwortlichkeit der Minister gegenüber dem Volk, Amnestie und Abschaffung aller indirekten Steuern. Schwöre uns, unsere Forderungen zu erfüllen, sonst sind wir bereit, vor deinem Palast zu sterben. Wenn du zögerst und dich nicht dem Volk zeigst, wenn du unschuldiges Blut fließen läßt, zerreißt du die moralische Bindung zwischen ihm und dir!«
Gapon holte tief Luft. »Diesem Appell wird und kann sich der Zar nicht verschließen, wenn wir in aller Demut vor ihn treten. Er ist ein frommer Mann. Er wird einsehen, daß es keinesfalls im Willen Gottes liegt, ein ganzes Volk im Elend zu lassen, während er und seinesgleichen unsere Nöte niemals kennenlernen.«
Zar Nikolaus erhielt Gapons Botschaft noch am selben Abend in Zarskoje Selo. Wie der Pope ihm geschrieben hatte, war der Absendung dieses Briefes eine Abstimmung vorausgegangen, bei der 87 Prozent der Versammelten seinem Vorhaben zugestimmt hatten.
»Welch eine Unverschämtheit!« empörte Zarin Alexandra Fjodorowna sich, als ihr Gatte ihr Gapons Brief gezeigt hatte. »Dieser Mensch wagt es, sich in einem dermaßen hochfahrenden Ton an dich zu wenden, Bedingungen zu stellen, zu drohen ... Du darfst in keinem Fall darauf reagieren.«
Nikolaus warf einen unschlüssigen Blick auf General Foullon, den Polizeipräfekten, den er zu sich gebeten hatte. »Sind Sie derselben Ansicht, General?« Im Grunde verspürte auch er keine Lust, nach Petersburg zu fahren. Es war ihm lästig, und er empfand, wie immer wenn man ihn zu etwas zwingen wollte, nervöse Gereiztheit.
Foullon zuckte mit den massigen Schultern. »Der Pope wird das alles schon in Ordnung bringen«, meinte er wegwerfend. »Er liebt pathetische Auftritte. Aber Gefahr droht nicht von ihm, Euer Majestät.«
»Vielleicht nicht von ihm«, wandte der Zar ein. »Aber bedenken Sie, daß möglicherweise zehn- oder fünfzehntausend Demonstranten vor das Winterpalais marschieren.«
»Auf keinen Fall darfst du dich in Gefahr begeben, Nicky«, sagte die Zarin auf Englisch. »Vielmehr mußt du mit aller Hӓrte und Unnachgiebigkeit diesen Aufrührern gegenüber durchgreifen.«
»Ja, ja. Du hast recht wie immer, meine Liebe«, erwiderte Nikolaus und küßte ihre Hand.
Dann wandte er sich wieder an den Polizeipräfekten. »Völlig ignorieren können wir die Angelegenheit nicht. Man muß Vorsorge treffen, falls es zu Ausschreitungen kommt.«
Foullon nickte und verneigte sich. »Dafür wird Fürst Swjatopolk-Mirski sorgen. Der Innenminister hat solche Situationen im Griff. Wir sind vorgewarnt, und mit größter Wahrscheinlichkeit werden die Demonstranten nicht einmal bis zum Winterpalais kommen.«