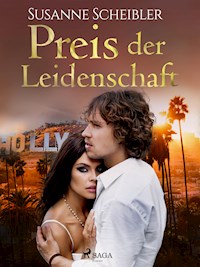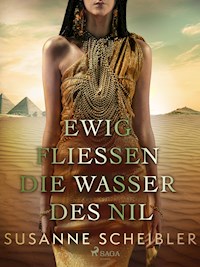
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die langjährige Vertraute der ägyptischen Königin Nofretete, Mirjah, schreibt deren Geschichte nach ihrem Tod nieder. Sie schildert einen Lebensweg, bei dem Freundschaft und Verrat sowie Liebe und Hass nah beieinanderstehen. Bald wird klar, dass auch die Freundschaft der beiden Frauen von Ambivalenzen geprägt ist...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 922
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Susanne Scheibler
Ewig fließen die Wasser des Nil
Saga
Ewig fließen die Wasser des Nil
Ewig fließen die Wasser des Nil
Copyright © 2021 by Michael Klumb
vertreten durch die AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de)
Die Originalausgabe ist 1982 im Goldmann Verlag erschienen
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1982, 2021 Susanne Scheibler und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726961201
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
Nofretete ist tot.
Meine Herrin, meine Freundin, meine Königin, meine Feindin lebt nicht mehr. Sie starb in der Stunde der Morgendämmerung, als die Sothis zum erstenmal nach langer Zeit am bleichen Himmel aufstieg, jenes hellste Nachtgestirn im Lande Kernet, dessen Wiedererscheinen Jahr um Jahr mit dem Anschwellen des Nils zusammentrifft.
Es war die vierte Stunde des ersten Tages im Monat Thot im dritten Regierungsjahr des Knaben Tutanchamun, da meine Königin sich anschickte zu der Reise in das Land des Westens.
Nofretete ist tot.
Während ich diese Worte auf dem Papyrus niederschreibe, spreche ich sie langsam vor mich hin. Es klingt überlaut in der Stille dieses frühen Morgens. Die Stunde der Dämmerung ist so leise. Die Tiere der Nacht sind verstummt, und der Tag mit seinen Stimmen schläft noch.
Nur ich wache, wie ich seit drei Nächten gewacht habe, um Nofretetes Sterben zuzusehen.
Sie war nicht lange krank. So, wie sie 37 Jahre ihres Lebens hatte anfüllen wollen mit allem, was es bereithielt an Lachen und Weinen, an Schönheit und Schande, so war sie am Ende dessen überdrüssig geworden und begehrte fortzugehen.
Sie hat es mir gesagt, als sie sich niederlegte vor drei Tagen. »Mirjah, meine Treue«, hat sie gesagt, »ich verlasse dich nun. Es wird nicht lange dauern, dann kannst du heim.«
Ich wußte gleich, wie sie es meinte, und ich wußte auch, daß es nach ihrem Willen geschah.
Als ich weinte, hat Nofretete gelächelt. »Es ist töricht, traurig zu sein. Sethos wartet auf dich.«
Weder sie noch ich hatten seinen Namen ausgesprochen, seit er im vierten Peret fortgegangen und ich in Achetaton geblieben war - jener sterbenden Stadt, die zerfällt und eines Tages unter dem Sand der Wüste begraben sein wird.
Sethos ist mein Mann. Der einzige Mann, den ich je meinen Bruder genannt und geliebt habe - und der so viele Jahre hindurch sie geliebt hat, meine Königin, meine Freundin, meine Feindin.
Er sagte, daß er krank nach ihr gewesen sei und nun davon genesen. Er bat mich, ihn nach Theben zu begleiten, er drängte, flehte, und als er mein Zaudern spürte, umarmte er mich. »Komm mit mir, Mirjah. Alles wird gut werden. Haben wir nicht den Krug miteinander zerbrochen und sind Mann und Frau?«
Als er mich küßte, mußte ich noch einmal daran denken, daß er auch Nofretete so geküßt hatte und wie sehr ich sie darum gehaßt. Der Gedanke tat nicht mehr weh, und der Haß war fort.
Und im nämlichen Augenblick wußte ich, daß ich sie nicht verlassen konnte.
Ich bin Sethos’ Weib, aber Nofretete ist ein Teil von mir seit jenen frühen Tagen, da wir an der Brust derselben Frau gelegen und getrunken haben.
Diese Frau war meine Mutter Seketa, und Nofretete wurde damals noch Taduchepa genannt und war eine Königstochter in unserer Heimat Mitanni.
Vielleicht hätte ich sie verlassen können in den Tagen ihres Glücks. Im Unglück blieb ich bei ihr.
Denn auch in der Zeit, da ich sie haßte, habe ich sie immer noch geliebt, so wie man sich selbst lieben und hassen kann um dessentwillen, was man tut oder unterläßt.
Taduchepa . . .
Als sie starb, habe ich sie so genannt, zum ersten Mal wieder, seit ich mit ihr nach Ägypten kam. Und ich sah wohl, daß sie es hörte, denn ihr Blick, schon fern und voller Schatten, kam noch einmal für eines Lidschlags Länge zu mir zurück, und ihr Mund lächelte.
Sie nahm es auf die Reise mit, dieses Lächeln, und es löschte die harten Linien aus, die sich um Augen und Mund gekerbt hatten seit den Tagen Semenchkares und Echnatons Abkehr.
Nofretete hat recht: Es ist töricht, zu weinen. Es war ihr Wunsch, zu sterben, und es ist ihr in ihrem Leben so vieles geschenkt worden, was sie wünschte, Gutes und Böses. Warum nicht dieses letzte?
Und dennoch weine ich.
Um sie, um mich, um das, was unwiederbringlich mit ihr fortgegangen und im Schoß der Zeit vergessen sein wird: die Erinnerung an eine Hoffnung, die so lange im Lande Kemet gebrannt und die entzündet ward von ihr, die nun tot ist, und an den Pharao, dessen Namen man nicht mehr nennen darf, weil es ein verfluchter Name sein soll.
Ich weiß es anders, denn ich habe geglaubt und erkannt.
Man wird sagen, es sei eine böse Zeit gewesen, da er, der Pharao mit ihr, seiner Großen Königlichen Gemahlin, das Land Ägypten regierte. Eine Zeit der Gesetzlosigkeit, der Zerstörung. Man wird sagen, sie hätten Ägyptens Gold und seine vollen Kornspeicher, seine Güter und Heiligtümer in den Schmutz getreten. Die Wahrheit wurde in Lüge verkehrt, das Große ins Niedrige, das Erhabene in Erbärmliches verwandelt.
Sie sagen, das Land habe eine Krankheit durchgemacht und sei geschlagen worden vom Zorn der Götter. Darum sei es nötig, die Verursacher dieses Unglücks in alle Ewigkeit zu verdammen. Ihre Standbilder sollen zerschlagen, ihre Namen ausgestrichen werden aus jeglichem Gedächtnis. Und ihre Wohnstätten und Gärten sollen verderben.
So sagen sie: Eje, der einst der Lehrer des Pharao gewesen, und Anchesenamun, seine Tochter. So sagt Bekanchons, der Oberpriester Amuns, und Haremhab, des Pharao Freund und Schwager und nur dank ihm zu Macht und Ruhm aufgestiegen. So sagt das Volk, das seinen König einst umjubelte und Blumen vor Nofretetes Füße warf, wann immer sie sich zeigte.
Ich aber, Mirjah, Tochter der Ägypterin Seketa und des Tesub, Königlicher Speichervorsteher am Hofe von Mitanni, ich weiß es anders. Mich hat der Flügelschlag der Freiheit berührt, ich habe das Licht der Liebe gesehen, das von Echnaton, dem Kranken, Verwirrten und dennoch Erleuchteten, ausging. All das Glühende, Gute, Große - ich habe es gesehen. Und ich sah auch, wie es zu Asche verbrannte.
Aber war es deshalb schlecht - ein Abscheu - und Nofretete, meine Königin, der Dämon, der den Pharao zu allem Üblen verführte?
O nein, es war groß und gut, was sie dem Lande Kemet schenken wollten. Es hätte die Vollkommenheit des Lebens bedeuten können. Aber wie alles, was der Mensch berührt mit seinen zerstörerischen Händen, wurde es zur Umkehrung dessen, was es hätte sein sollen.
Liebe wandelte sich in Eigenliebe, Freiheit in Zügellosigkeit, Gewaltlosigkeit in Laschheit, Brüderlichkeit in grölende Verbrüderung. Doch dies war nicht die Schuld des Pharao und nicht die Nofretetes.
So sage ich, Mirjah, Weib des Sethos, die den Titel trägt: »Wirkliche Freundin der Großen Königin und Echnatons Liebling«, und es ist wahr.
Aber wer wird mich hören? Wer von denen, die nach uns kommen, wird erfahren, wie es wirklich war, da doch alle Inschriften, die von Echnatons Taten zeugen, zerstört worden sind? Und Semenchkare hat Nofretetes Bilder zerschlagen lassen und die Stellen zertrümmern, die von ihr berichteten. Ihr Grab ist verwüstet, dessen Wandmalereien von ihrem Leben erzählten, und Achetaton, diese Stadt, die so sehr ihre und Echnatons Stadt gewesen, wird zerfallen, so daß weder Schrift noch Wort, weder Stein noch Farbe künden werden, was geschah. Und den Lebenden wird Furcht die Lippen verschließen.
Auch ich habe Angst. Die Priester Amuns sind erfinderisch im Ersinnen von Strafen und Foltern, bis man gesteht, daß die Wahrheit Lüge ist und die Lüge Wahrheit. Und gar mancher ist danach in das »Haus des Todes« gekommen.
Dennoch werde ich tun, was getan werden muß.
Ich werde Nofretetes Körper nicht der Verwesung überlassen, noch ihr Gedenken der Schmach.
Ich will niederschreiben auf Papyri, wie alles geschah und was ich gesehen und erlebt habe. Und ich will den Leichnam meiner Herrin einbalsamieren und begraben lassen.
Erst dann kann ich zurückkehren nach Theben, wo alles seinen Ausgang nahm. Und zu Sethos, meinem Mann, den ich liebe.
1
Die Geschicke der Menschen erfüllen sich, wie sie vorgegeben sind. Daran glaube ich.
Noch ehe man den Schoß der Mutter verläßt und den ersten Schrei tut, sind die Bahnen bezeichnet, in denen wir gehen, und niemand möge denken, er könne ihnen entfliehen. Wann wir geboren werden und von wem, mit wem wir leben und was uns widerfährt, ob wir jung zu den Göttern zurückkehren oder ein hohes Alter erreichen - all dies ist vorherbestimmt, und unser Wille vermag nichts daran zu ändern. Wir tragen unser Schicksal mit uns herum wìe die Schnecke ihr Haus und die Muschel ihre Schale.
Oder kann das Kind im Mutterleibe sagen: Ich will nicht als Sklave zur Welt kommen, sondern als König!, und es geschieht? Kann man fordern: Ich will nicht dieses mir zugedachte Leben, sondern ein anderes; ich will nicht zu dieser Zeit geboren werden, sondern später; ich will allein verfügen, was mir widerfährt an Gutem und Bösem, und ich will mir selbst die Menschen aussuchen, mit denen mein Weg verknüpft ist?
Alles ist vorherbestimmt, und wenn wir meinen, es zu ändern, so ist das ein Trugschluß. Denn auch die Änderung unserer Lebensbahn in diese oder jene Richtung stand schon fest, bevor wir geboren wurden. Wir sind an einer Kette festgebunden, in deren Umkreis wir uns frei bewegen können. Das verschafft uns manchmal das Gefühl, Herr unserer selbst zu sein und stolz auf unsere Werke. Es macht auch, daß wir grübeln, sorgen und fragen, was der nächste Tag, das nächste Jahr bringen werden; daß wir durch Opfer und Gebete versuchen, die Götter uns gnädig zu stimmen, damit unser Tun und Trachten zu unseren Gunsten ausschlage und Unheil abgewendet werde - und doch erfüllt sich alles so, wie es muß. Und niemand kann sagen, er habe sein Geschick nach seinem Willen gewendet.
Meiner Schwester Sachmun, die wenige Minuten vor mir geboren wurde, war es bestimmt, zu sterben - und mir, mit Nofretete zu leben. Die Ketten unseres Schicksals sind miteinander verflochten, und sie rissen nicht auseinander, auch nicht in den Tagen meines Hasses.
Sachmun und ich wurden nach ägyptischer Zeitrechnung im ersten Peret, Tag 2 im 21. Regierungsjahr des Pharao Amenophis III. geboren.
Nofretete war fünf Tage jünger, und als sie zur Welt kam, jubelte das Volk in Mitanni, und König Tuschratta ließ Wein und Speisen, Gold und Silber auf den Straßen der Hauptstadt Waschukanni verteilen, denn Taduchepa, wie er die Prinzessin nannte, war das erste Kind von ihm und seiner Gemahlin Juni.
Die Feierlichkeiten dauerten zehn Tage, in denen ganz Mitanni von Wein und Freude berauscht war. Nur im Hause meines Vaters Tesub und meiner Mutter Seketa herrschten Trauer und Verzweiflung.
Meine Mutter war von Königin Juni als Amme ihres Kindes ausersehen. Aber da sie zwei Töchter geboren hatte, fürchtete man, sie habe nicht genügend Milch für die Prinzessin. Deshalb befahl Tuschratta, mich oder meine Schwester zu töten.
Als die Soldaten des Königs in unser Haus eindrangen, warf sich meine Mutter über uns, um uns mit ihrem Leib zu schützen. Der Anführer riß sie hoch, und drei seiner Männer mußten sie festhalten, denn sie wehrte sich wie eine Rasende und schrie: »Laßt mir meine Kinder! Schlagt mich, tötet mich, reißt mir das Herz aus der Brust - aber rührt sie nicht an. Habe ich sie nicht neun Monate in mir getragen, und sind sie nicht Fleisch von meinem Fleisch und Blut von meinem Blut? Wie kann ich eines von ihnen sterben lassen? Habt Erbarmen, bei allen Göttern! Meine Kinder, meine Kinder . . .«
Sachmun und ich lagen nebeneinander in unserem aus Lederschnüren geflochtenen Bett, das ähnlich wie die Binsenkörbchen der Ägypter mit Schlaufen an einem hölzernen Gestell befestigt war. Die Soldaten zerrten Sachmun von meiner Seite und hieben ihr mit einem einzigen Schlag den Kopf ab. Blut spritzte in hohem Bogen heraus, und meine Mutter hat mir erzählt, daß es über mein Gesicht lief und die Tücher tränkte, in die man mich gewickelt hatte.
So war meine Schwester Sachmun der erste Mensch, der um Nofretetes willen sterben mußte.
Meine Mutter Seketa aber weigerte sich, in den Königspalast zu gehen und Nofretete zu stillen. Man mußte sie mit Gewalt von ihrem toten Kind wegreißen und fortschleppen. Einer der Soldaten kam noch einmal zurück und holte mich, sonst wäre ich wohl auch gestorben. Aber dies war keine Tat aus Mitleid oder Menschlichkeit; man fürchtete nur, die Milch meiner Mutter könnte versiegen, wenn nichts sie von ihrem Gram ablenkte. Meine Gegenwart, so hoffte man, werde sie hindern, sich ganz und gar ihrem Schmerz hinzugeben.
So war es denn auch. Außerdem war meine Mutter eine gesunde junge Frau, kräftiger als die vornehmen mitannischen Damen, die durch ihre Herkunft geeignet gewesen wären, das königliche Kind zu stillen. Denn die Milch einer Sklavin oder einer Frau aus dem Volke wäre nicht gut genug gewesen für Nofretete.
Meine Mutter war von edler Abstammung, ihr Vater Vorsteher der alten ägyptischen Hauptstadt Memphis gewesen. Mein Vater Tesub begegnete ihr als Gesandter, der die jährlichen Tributzahlungen für den Pharao nach Ägypten begleitete.
Das Land Mitanni war nämlich seit langer Zeit ein bedrohtes Land, und seine Könige wären ohne den schützenden Arm Ägyptens verloren gewesen. Deshalb sandte Ägypten schon seit den Tagen des ersten Thutmosis Soldaten und Waffen in meine Heimat - aber nicht aus Freundschaft zu seinen Königen oder um das Volk vor Krieg und Vernichtung zu bewahren, sondern weil Mitanni durch seine Lage geeignet ist, Überfälle der Hethiter und Babylonier oder der nördlichen Barbarenvölker auf Ägypten abzufangen.
Einst waren die Mitanner ein kriegerisches und siegreiches Volk gewesen, das sogar das mächtige Babylon eine Zeitlang unterjocht hatte, doch im Lauf der Jahrhunderte hatte sich Mitannis Lebenskraft erschöpft. Seine Frauen waren zart und schmal und hatten Mühe, ihre Kinder auszutragen und zu gebären. Und seine Männer liebten die Wissenschaften und schönen Künste mehr als den Umgang mit Streitkolben, Pfeil und Bogen, Speer und Kupfersense.
Auch mein Vater Tesub war ein sanfter, stiller Mann, der alles Lärmende, Gewalttätige verabscheute und mehr geschaffen schien zum Dulden denn zum Aufbegehren. Deshalb nahm er auch Sachmuns Tod hin wie etwas Unabwendbares, in Geduld und ohne Klagen. Die laute Verzweiflung blieb meiner Mutter vorbehalten.
Als man sie in den Palast brachte, weigerte sie sich, Nofretete an die Brust zu legen. »Wer kann mich zwingen?« schrie sie. »Ihr könnt mich töten, doch damit endet eure Macht. Dann müßt ihr gehen und einer anderen Mutter Kind umbringen, damit eure Prinzessin satt wird.«
Auch weigerte sie sich, Nahrung zu sich zu nehmen, und drohte, von den Mauern des Palastes zu springen, wenn man sie hierbehielte.
Man riegelte sie und mich in einem Zimmer ein und holte eilends einen syrischen Arzt, der sich auf die Zubereitung von berauschenden Tränken verstand, die das Herz leicht und frei machen und das Hirn ohne Willen, jedenfalls für einige Zeit. Es gelang ihm, meiner Mutter gewaltsam ein solches Mittel einzuflößen, und danach wurde sie ruhig.
Allerdings hatte man nicht gewagt, ihr eine größere Menge zu geben, um ihre Milch nicht zu vergiften, sodaß ihr Wille nicht ganz gebrochen war. Und als man die kleine, kaum drei Stunden alte Prinzessin zu ihr brachte, ließ sie sie nicht trinken.
Damals, so hat meine Mutter mir später gesagt, meinte sie Nofretete zu hassen. Sie wünschte nichts sehnlicher, als daß auch sie sterben möge, bis sie in der Nacht, die Sachmuns Tod folgte, die Armseligkeit und Bedürftigkeit dieses königlichen Kindes erkannte, das nicht mehr schrie wie ein gesundes, hungriges Neugeborenes, sondern nur noch leise vor sich hin wimmerte wie ein junges Kätzchen.
Königin Juni hatte drei Tage und drei Nächte in Kindsnöten gelegen und keine Nahrung für ihre Tochter. Sie hatte sehr viel Blut verloren und war so hinfällig, daß man zeitweilig um ihr Leben fürchtete.
Nofretete blieb bei meiner Mutter, freilich mit Bewachern, damit sie dem Kind oder sich selbst nichts antun könne. Man holte meinen Vater in den Palast; er sprach lange mit meiner Mutter, und er war es auch, der ihr Nofretete schließlich in den Arm legte. Sie war sehr klein, mit einem auffallend gewölbten Hinterkopf und riesigen Augen.
Es muß etwas Merkwürdiges von den Augen dieses kaum ein paar Wassermaße alten Kindes ausgegangen sein. Meine Mutter sagte, daß Nofretete schon als Neugebotenes den gleichen dunklen, unergründlichen Blick gehabt habe wie als Fünfzehnjährige, da sie nach Ägypten zog, um verheiratet zu werden und im Goldenen Haus des Pharao zu leben. Ein Blick, der nichts preisgab von ihren Empfindungen und durch die Menschen und Dinge hindurchzusehen schien. Ein Blick aber auch, der niemanden losließ.
Was andere Menschen mit Zorn und vielen Worten durchzusetzen versuchten, erreichte Nofretete oftmals nur, indem sie jemanden ansah, schweigend, mit einem halben Lächeln um die Lippen und diesen großen, bezwingenden Augen.
Meine Mutter war die erste, die ihnen nachgab. Obwohl sie noch immer voll Abscheu und Aufbegehren war über Sachmuns grausamen Tod, obwohl sie noch immer nicht mehr für dieses Kind in ihren Armen empfand als vielleicht einen Hauch von Mitleid, öffnete sie die Verschnürung ihres Kleides und ließ Nofretete trinken.
Vielleicht sollte ich sie in diesem Teil meines Berichtes noch Taduchepa nennen. Aber für mich und jeden, der sie kennt, ist sie seit so vielen Jahren Nofretete, daß der Name Taduchepa fremd und sonderbar anmutet, als gehörte er einer anderen Person.
Deshalb will ich bei Nofretete bleiben. Es ist der Name, den ihr das Volk gab, als sie nach Ägypten kam, der Name aus den Tagen ihres Glücks - und auch wenn er jetzt ausgemerzt worden ist aus allen Standbildern und Inschriften, so wird er doch in der Erinnerung der Menschen bleiben. Die Eltern werden es ihren Söhnen und Töchtern erzählen und diese wiederum ihren Kindern: »Wir hatten einst eine Große Königliche Gemahlin, die aufging wie Atons Sonnenscheibe am Himmel und verschwand, ohne daß einer von uns sagen könnte, was aus ihr geworden ist. Sie soll Böses getan haben und dafür gestraft worden sein. Aber wir haben sie Nofretete genannt - die Schöne, die da kommt -, und weder vor noch nach ihr hat eine Frau neben dem Pharao auf dem Thron gesessen, die so viel Jubel und Bewunderung entfacht hat.«
Das war schon in unseren Kindertagen so. Drei Jahre nach Nofretetes Geburt wurde König Tuschratta und Königin Juni noch eine Tochter geschenkt - Mutnedjemet -, ein kleines, blasses, stilles Geschöpf, und wenn die beiden Prinzessinnen sich mit ihren Eltern dem Volk zeigten, war es immer nur Nofretete, deren Namen die Leute riefen, der sie zuwinkten und die sie anrühren wollten wie die wundertätige Statue der Ischtar von Ninive, die von allerlei Krankheiten und Gebrechen heilen sollte.
Nofretete verwunderte sich niemals über diese Huldigungen. Sie nahm sie hin wie etwas, das ihr zustand.
Selbstverständlich schien auch, daß sie unsere kindlichen Spiele bestimmte, und ich erinnere mich, daß sie sehr zornig werden konnte, wenn nicht alles nach ihrem Willen geschah.
Meine Mutter stillte Nofretete und mich über ein Jahr. Seit dieser Zeit lebten wir zusammen mit meinem Vater im Königspalast von Waschukanni. Es war der Wunsch der Königin, daß ich gemeinsam mit Nofretete aufwüchse. Sie hatte meine Mutter sehr gern, überhäufte sie mit Geschenken und Ehren und hoffte, sie auf diese Weise für den Tod meiner Schwester Sachmun zu entschädigen.
Dennoch hat meine Mutter die grausame Tat nie vergessen. Sie hat so oft mit mir darüber gesprochen, daß mir ist, als hätte ich die Ereignisse bewußt miterlebt und nicht als fünf Tage alter Säugling in meinem Wiegenbettchen, in das man statt Sachmun nun Nofretete gelegt hatte, damit ich sie wärmte. Heute weiß ich auch, daß meine Mutter Nofretete nie geliebt hat. Einzig die Hilflosigkeit des Neugeborenen hatte ihr Erbarmen geweckt; dem heranwachsenden Kind, dessen kühle Anmut seine ganze Umgebung bezauberte, begegnete sie mit abwägendem Mißtrauen.
Ich hingegen, ich liebte Nofretete, so weit ich zurückdenken kann. Ich war ihr getreuer kleiner Schatten, seit wir beide die ersten Schritte taten. Ich weinte, wenn sie Tränen vergoß, ich lachte, wenn sie fröhlich war, und ich erinnere mich noch genau, daß sie es war, die mir den ersten schlimmen Schmerz meines Lebens zufügte.
Mein Vater hatte mir einen kleinen Hund geschenkt. Ich nannte ihn Bothu und war entzückt von seiner tolpatschigen Zärtlichkeit, seinen Possen und seiner Anhänglichkeit. Er begleitete mich auf Schritt und Tritt, und des Nachts schlief er auf einer Matte neben meinem Bett.
Da verlangte Nofretete eines Tages, während wir uns im Innenhof des Palastes damit vergnügten, kleine hölzerne Schiffchen im Seerosenteich schwimmen zu lassen: »Gib mir den Hund. Ich will ihn haben.«
Starr vor Schrecken griff ich nach Bothu und drückte ihn an die Brust. »Aber er gehört mir. Mein Vater hat ihn mir von einer Reise mitgebracht.«
»Alles, was euch gehört, gehört zuallererst meinem Vater!« beharrte Nofretete. »Denn er ist der König, und ich bin seine Tochter. Deshalb habe ich mehr Rechte an Bothu als du. Also gib ihn her.«
Bothu zappelte auf meinem Arm und versuchte, mir mit seiner kleinen heißen Zunge das Gesicht zu lecken, als begriffe er, was man von mir verlangte. Oder er spürte meine Furcht und wollte mich beruhigen. »Nein!« stieß ich hervor. »Niemals!« Und dann lief ich mit Bothu davon.
»Haltet sie auf!« rief Nofretete mit ihrer hellen Stimme den Sklaven zu, die die Tochter des Königs vom frühen Morgen bis zum Abend, wo immer sie war, zu bewachen hatten und mit ihrem Kopf für ihre Sicherheit bürgten. »Haltet sie und nehmt ihr den Hund fort!«
Ich schrie, als zwei große Hände nach mir griffen, und kämpfte wie eine Rasende gegen den Sklaven, der mich in seinen Armen aufgefangen hatte. Ich biß ihn und trat nach ihm, spie in sein gelbes, stumpfes, ölglänzendes Gesicht und konnte doch nicht hindern, daß er mir Bothu entriß. Ich hörte das helle, klagende Winseln meines kleinen Hundes, als der Sklave ihn am Nackenfell packte und Nofretete zuwarf, als sei er ein Bündel Lumpen. Und ich hörte auch das Klatschen des Wassers, als Nofretete ihn in den Teich fallen ließ.
Bothu muß sofort tot gewesen sein. Sein Herz hörte einfach auf zu schlagen. Damals begriff ich das nicht. Ich wußte, daß Hunde schwimmen können, deshalb stürzte ich, als der Sklave mich losließ, an den Teich, durchpflügte mit meinen Armen das Wasser und rief immer wieder: »Bothu! Bothu, mein Liebling, so komm doch!«
Aber er war untergegangen, und Nofretete stand neben mir mit einem bleichen, unkindlichen Gesicht und zusammengepreßten Kiefern. Sie sagte kein Wort, und ihre Augen waren dunkel und unergründlich wie immer.
Es war Mutnedjemet, die mich schließlich an der Hand nahm. »Steh auf, Mirjah. Bothu kommt nicht wieder. Er ist ertrunken.« Ihr blasses kleines Gesicht zuckte; sie war verstört und kämpfte mit den Tränen.
Ich wandte mich zu Nofretete, und mein Kummer schlug in verzweifelten, ohnmächtigen Zorn um. Vielleicht hätte ich sie geschlagen, wenn Mutnedjemet mich nicht mit der ganzen Kraft ihrer kleinen Arme festgehalten hätte. »Warum hast du das getan?« schrie ich. »Er war so fröhlich, ich hatte ihn lieb! Und du hast ihn getötet!«
Nofretete lächelte. »Eben darum. Ich hätte ihn gar nicht behalten. Du hättest ihn zurückbekommen. Ich wollte nur sehen, ob du ihn mir gibst. Aber du hattest ihn lieber als mich.« Dann ging sie davon.
An diesem Abend konnte ich lange nicht einschlafen. Ich weinte um Bothu, und meine Mutter kam zu mir und wiegte mich in den Armen. »Du bekommst einen neuen Hund«, versprach sie mir, doch das vermochte mich nicht zu trösten.
»Ich will keinen«, erwiderte ich schluchzend. »Vielleicht wird sie ihn wieder töten, wenn sie sieht, daß ich ihn liebhabe.«
Das Gesicht meiner Mutter verhärtete sich, und ich erschrak vor dem Haß, der plötzlich aus ihren Augen brach. »Sie ist ein Kind ihrer Sippe. Sie morden, was ihnen im Weg ist. Ihre Geschichte ist blutig, und sie gieren nach Macht. Als König Tuschrattas Vater, Schutarna, starb, folgte ihm sein ältester Sohn Artassumara auf den Thron. Sein Vetter Tuchi ermordete ihn und setzte dem Kind Tuschratta die Krone auf. Er gedachte, in ihm einen Schein-König zu haben, den er nach Belieben lenken konnte. Aber Tuschratta war neunzehn Jahre alt, als er Tuchi erschlug und mit ihm seine ganze Anhängerschaft. Taduchepa ist von seiner Art. Ach, Mirjah, Mirjah, hör auf, sie zu lieben. Ich habe mit Sorge gesehen, wie du ihr zugeneigt bist. Es wird dich nicht glücklich machen. Niemand ist glücklich in der Liebe zu den Mächtigen. Sie nehmen und nehmen - aber sie geben nichts dafür außer vergänglichen Ehren. Heute rühmen sie dich, und morgen überantworten sie dich dem Henker. Ihre Freundschaft ist gleich einer Spur im Wüstensand, ein Windstoß verweht sie. Ihre Schwüre sind wie Spreu, die davonfliegt, sie kennen weder Treu noch Glauben, und wohin ihr Fuß tritt, lassen sie Scherben zurück. Denke an die Worte deiner Mutter, die schon vieles gesehen und gehört hat.«
Meine Tränen flossen noch immer, und nicht nur um meinen armen, kleinen Bothu. Es ging mir auch nahe, was meine Mutter über Nofretete gesagt hatte. Unklar empfand ich den Funken Wahrheit in ihren Worten, und es tat mir weh, denn ich hatte Nofretete immer noch lieb.
Dennoch blieb ich in den nächsten Tagen in den Zimmern, die wir im Palast bewohnten, um ihr nicht zu begegnen, und meine Mutter ließ verbreiten, ich sei nicht wohl.
Da kam Nofretete eines Morgens zu mir. Ich erschrak, als sie mein Zimmer betrat, und sie hieß die Sklaven, die sie begleitet hatten, draußen warten. Dann schloß sie die Tür. »Sieh, was ich dir mitgebracht habe, Mirjah.«
Es war eine kleine Hündin, nicht größer als zwei Fingerspannen, mit langen, weißen Locken.
»Sie heißt Psamet und stammt aus dem Wurf der Lieblingshündin meines Vaters. Ich schenke sie dir.«
Als ich keine Anstalten machte, die Hündin entgegenzunehmen, legte sie sie mir einfach in die Arme. »Vergib mir, Mirjah. Es war schlecht, was ich getan habe. Aber ich war eifersüchtig. Bitte, vergib mir.«
Vergessen waren die Warnungen meiner Mutter, vergessen mein eigener Zorn. Aus Liebe zu mir hatte Nofretete etwas Böses getan; das war, so empfand ich, verzeihlich. Und daß sie es bereute, machte es leicht, ihr wieder gut zu sein.
Psamet war reizend, anschmiegsam und zärtlich. Ich hatte viel Freude an ihr; trotzdem hing ich nicht so an ihr wie an Bothu, der das erste kleine Lebewesen gewesen, was mir allein gehört hatte.
Die heiße Jahreszeit verbrachten wir mit der königlichen Familie und dem ganzen Hof Jahr für Jahr in den nördlichen Bergen, wo König Tuschratta eine Sommerresidenz besaß.
Ich war gern dort, denn wir Kinder hatten mehr Freiheit und durften ungeniert in den weitläufigen Palastgärten herumstreifen. Der König ging viel auf die Jagd, begleitet von seinen Würdenträgern. Auch mein Vater Tesub war dabei, obwohl er es nicht liebte, die Tiere zu töten. Es machte ihm mehr Freude, sie aufzuspüren und zu beobachten. Er erkannte unzählige Vogelarten allein an ihren Stimmen und deutete die Fußspuren von Gazelle und Steinbock, Fuchs und Hase, Wildstier und Antilope. Er liebte Blumen und Gräser und nannte alle beim Namen; er wußte, aus welchen Kräutern man heilende Salben, Säfte und Arzneien gewann, um Krankheiten zu behandeln.
Auch mich lehrte er dies kennen. Ich durfte ihm beim Sammeln und Trocknen der Kräuter helfen, und bald verstand ich mich ebenfalls auf die Zubereitung verschiedener Mischungen, mit deren Aufguß man Fieber senken, Schmerzen lindern und eitrige Ausschläge behandeln konnte.
Ich war sehr stolz auf meine Kenntnisse und bedauerte nur eines: daß ich ein Mädchen war und deshalb niemals den Beruf eines Arztes ergreifen konnte. Denn dies erschien mir damals erstrebenswerter als alles andere.
Mein Vater tröstete mich. »Deine Heilkünste wirst du auch so anwenden können, Mirjah, wenn du erst einen Mann und Kinder hast und einen Haushalt mit vielen Dienern. Du versprichst ein sehr schönes Mädchen zu werden, so daß an Bewerbern kein Mangel sein wird, sobald du ins heiratsfähige Alter gekommen bist. Dann wirst du dich daran freuen, eine Frau zu sein.«
Ich schwieg, weil ich meinem Vater nicht widersprechen wollte. Aber ich vermochte nicht an seine Worte zu glauben. Wie konnte jemand gern ein Mädchen sein?
Ich war damals in dem Alter, in dem meine Brüste sich zu runden begannen. Sie taten mir oft weh, und meine Mutter hatte mir gesagt, daß ich damit rechnen müsse, eines Tages Blutungen zu bekommen, die in regelmäßigen Abständen wiederkehrten. »Es ist das Zeichen, daß du anfängst, erwachsen zu werden, meine Tochter. Eine Frau, die solche Blutungen hat, ist fähig, Kinder zu empfangen und zu gebären.«
Dies alles empfand ich als Last, nicht als Vorzug. Ich schämte mich meiner wachsenden Brüste und verbarg sie unter weiten Kleidern. Und ich fürchtete den Tag, an dem sich zum ersten Mal meine Blutungen einstellen würden. Mir kam das Ganze unsagbar peinlich und entwürdigend vor, und ich meinte auch, daß es schlimm sei, Kinder zu bekommen.
Ich wußte, daß sie im Bauch einer Frau heranwuchsen, und wenn ich einer Schwangeren begegnete, betrachtete ich halb voll Mitleid, halb voll Abscheu ihren aufgetriebenen Leib und stellte mir vor, unter welchen Qualen sie ihr Kind zur Welt bringen mußte.
Nofretete war anders. Sie fand es aufregend, eine Frau zu werden, und lachte mich wegen meiner Schamhaftigkeit und meines Unbehagens über meine körperlichen Veränderungen aus. Sie trug mit Vorliebe hauchdünne Gewänder, durch die ihre hochangesetzten kleinen Brüste, die schmalen Hüften und die weißen Schenkel mit dem dunklen Dreieck in der Mitte schimmerten. Sie hatte immer gern nackt gebadet, aber seit sie entwickelt war, machte es ihr ein besonderes Vergnügen, es vor ihren Sklaven oder den Soldaten der Leibwache zu tun.
»Es ist ihnen verboten, mich anzusehen«, sagte sie mir einmal. »Aber sie tun es dennoch. Sie wissen, daß mein Vater sie deshalb auspeitschen oder sogar töten lassen könnte, aber daran denken sie nicht. Sie starren mich an, und ich spüre, was sie möchten. Ach, Mirjah, Mirjah, was sind Männer doch für Narren.«
In ihrer Stimme und in ihrem Gesichtsausdruck lag etwas, das verriet, wie sehr sie es genoß, daß Männer sich ihretwegen zu Narren machten. Wir waren damals beide zwölf Jahre alt.
Unter den Hauptleuten der Leibwache war einer, der Chasil hieß, ein großer, vielleicht fünfundzwanzigjähriger Mann, stark wie ein Bär, mit behaarter Brust und kräftigen Muskeln. Ich mochte ihn nicht, denn er war großsprecherisch und grausam. Ich erinnere mich, wie er einmal einem Sklaven eine brennende Harzfackel in die Augen stieß, weil der den Wein verschüttete, nach dem Nofretete verlangt hatte. Auch schlug er seine Soldaten wegen der geringfügigsten Kleinigkeit mit seiner golddurchwirkten Offizierspeitsche; sie fürchteten und haßten ihn.
Er brüstete sich damit, daß er einem Stier mit den blanken Fäusten das Genick brechen könne und daß er vor Jahren, als er bei einer westlichen Grenzgarnison stationiert gewesen, bei einem Scharmützel mit den Hethitern hundert Gefangenen die Hände und Füße abgehackt habe, damit sie nicht mehr willkürlich die Grenzsteine zwischen Mitanni und dem Lande Chatti versetzen könnten.
Vor Nofretete allerdings bekam dieser Mann etwas hündisch Ergebenes. Der Blick seiner tiefliegenden, dunklen Augen wurde anbetend, wann immer er sie sah, er sprach leise zu ihr, mit unsicherer Stimme, und ich beobachtete, daß sich seine Hände dabei verkrampften, als wolle er mit Macht etwas unterdrücken.
Nofretete machte sich vor mir und Mutnedjemet lustig über ihn. »Er ist wie ein Tier«, sagte sie. »Ein großes, starkes, dummes Tier, das sich danach sehnt, an die Kette gelegt und dressiert zu werden.« Und um die Wahrheit ihrer Worte zu beweisen, behandelte sie ihn je nach Lust und Laune.
Es gab Tage, an denen sie ihn vollkommen übersah und nicht einmal das Wort an ihn richtete, andere, an denen sie ihm in hochmütigem Ton Befehle erteilte und ihn verspottete, wenn er sie ihrer Meinung nach nicht gut oder rasch genug ausführte, und wieder andere, da sie ihn in Gespräche verwickelte und sogar aufforderte, sich an unseren Unternehmungen zu beteiligen.
Wenn wir mit zwei oder drei leichten Jagdwagen ausfuhren, bestimmte Nofretete zumeist Chasil zu ihrem Begleiter. Häufig war unser Ziel der Platz, wo die Wagenlenker mit den Pferden arbeiteten, und sie befahl, daß wir die Übungsstrecke durchfuhren. Auf dieser waren klobige Holzpfosten in den Boden gerammt, zwischen denen die Wagen mit großer Geschwindigkeit hindurchgelenkt wurden. Sie schleuderten manchmal wild hin und her, was uns veranlaßte, in übermütiges Geschrei und Gelächter auszubrechen.
Nofretete klammerte sich dann an Chasil fest, und jedesmal nach einer solchen Fahrt lobte sie überschwenglich die Kraft und Geschicklichkeit, mit der er die Rosse bändigte.
Auch hatte sie Geschmack am Bogenschießen gefunden und ließ sich und uns darin von ihm unterweisen. Mutnedjemet und ich fanden wenig Gefallen daran; deshalb sonderten wir uns ab, sooft dies möglich war, und beschäftigten uns mit anderen Dingen.
Mutnedjemet, die Stille, in sich Gekehrte, liebte es, alte Märchen und Geschichten zu erzählen. Ich saß dann dabei und malte mit einem Rohr und schwarzer Tusche Fische und Vögel, Gräser im Wind, Psamet, wie sie sich in der Sonne räkelte, oder Mutnedjemet, wie sie da saß, die kindlichen Arme um die Knie geschlungen, das Haar unter einer Kronenkappe verborgen, die immer ein wenig zu groß und zu schwer für sie wirkte.
Ich zeichnete gern, wenn es auch keine Kunstwerke waren, die ich zustande brachte. Es machte mir einfach Freude, den flüchtigen Augenblick, der nicht wiederkehrte, mit dem Zeichenrohr festzuhalten. Ich fand Bilder lebendiger als Geschriebenes, und man konnte durch sie ebenso gut eine Geschichte erzählen wie durch die Aneinanderreihung von Schriftzeichen, die nur wenige zu lesen vermochten.
Einmal zeichnete ich auch Nofretete auf dem Jagdwagen, wie sie die Arme um Chasils Hüften gelegt hatte, um sich festzuhalten. Aber als ich ihr das Bild zeigte, wurde sie zornig und zerriß es.
Ich erinnere mich, daß der Sommer vor unserem dreizehnten Geburtstag Unerträglich heiß war. Nur ganz selten gab es ein Gewitter, das etwas Regen brachte. Danach kamen wieder Perioden von großer Trockenheit. Die Bauern jammerten, daß ihnen die Ernte verdorre, und mein Vater ging mit sorgenvollem Gesicht umher, weil die Kornspeicher nur mehr zur Hälfte gefüllt waren vom vergangenen Jahr und Hunger über das Land kommen würde, wenn sich die Klagen der Bauern bewahrheiteten.
Die Priester in den Tempeln beteten täglich um Regen zu den Göttern, und das Vieh litt Durst, weil viele Bäche und kleinere Flüsse versiegt waren.
Die Hitze machte, daß ich nachts schlecht schlafen konnte und oftmals aufstand und auf die Säulengalerie ging, die sich in halber Höhe um den Teil des Palastes zog, in dem unsere Wohnung war. Die hohen Gewölbe boten Schatten bei Tag, und es wehte immer ein leichter Wind, der Kühlung brachte.
In einer dieser Nächte geschah es, daß ich Nofretete entdeckte. Sie kam aus der Richtung der königlichen Gemächer, in einen dunklen Umhang gehüllt, und ich hätte sie nicht erkannt, wenn nicht der Mond wie eine große, bleiche Scheibe am Himmel gestanden hätte und ihr Gesicht beleuchtete, als sie den Mauerschatten verließ und durch die Pforte schlüpfte, die den Innenhof mit den Gärten verband. Die Wachen, die unterhalb der Galerie patroullierten, sahen sie nicht, denn sie paßte genau den Augenblick ab, da die Männer sich auf der anderen Seite befanden und ihr den Rücken zukehrten.
Ich dachte, daß sie auch nicht schlafen könne, rief sie aber nicht an, um niemanden zu wecken, sondern folgte ihr.
Ich war arglos und hatte nichts anderes im Sinn, als eine Weile mit ihr zu plaudern, damit uns die durchwachten Stunden nicht so lang würden. Doch als ich den Garten erreichte, war von Nofretete nichts mehr zu sehen, und auf mein halblautes Rufen kam keine Antwort.
Ich schlug den Weg zu dem kleinen Pavillon ein, der inmitten eines Hains von Maulbeerbäumen lag. Es war ein offener, von zwölf Säulen getragener Bau, in dem sich Nofretete gern aufhielt. Darum vermutete ich sie auch in jener Nacht dort.
Ich hatte mich nicht geirrt. Sie war da - aber sie war nicht allein. Chasil war bei ihr.
Sie lagen auf dem Ruhebett, der massige, dunkle Körper des Mannes halb über dem schmalen, hellen Nofretetes. Ich sah, was er mit ihr tat, sah ihre geöffneten Schenkel und seine Hand . . .
Nofretete bog sich ihm entgegen. Sie stöhnte und vergrub sein Gesicht zwischen ihren Brüsten. Ihr Umhang lag auf dem Boden. Ihr langes Haar fiel an der Seite des Lagers herab, und sie warf den Kopf hin und her.
Ich starrte auf die beiden verschlungenen, keuchenden nackten Leiber und dachte, daß ich auf der Stelle fortlaufen müsse. Aber ich stand wie festgewachsen, unfähig, mich zu rühren oder etwas zu sagen. Weder Chasil noch Nofretete nahmen mich wahr. Irgendwann schrie Nofretete auf, mit einer hellen, überkippenden Stimme: »Ja . . . ja . . .«
Sie umklammerte Chasils Hand mit ihren Beinen und bäumte sich hoch. Dann fiel sie auf das Lager zurück und lag still. Nur ihr Atem ging noch heftig.
Nach einer Weile versuchte sie, Chasil von sich zu schieben. »Laß mich jetzt. Du bist so schwer, du tust mir weh.«
Er ließ sie nicht los. »Wahrhaftig? Eben noch hatte ich den Eindruck, daß ich dir guttue . . .« Er strich über ihre Hüften, den Leib, die Brüste. Seine Stimme war heiser. »Ach, Prinzessin, meine Prinzessin . . . Willst du mich jetzt ganz haben?«
Nofretetes Gesicht wurde glatt und kalt. »Nein!« Dann glitt sie unter ihm hinweg, stand auf und griff nach ihrem Umhang.
Chasil setzte sich hoch. Schweiß rann über sein Gesicht. »Du bist grausam. Sieh mich an. Ich . . . ich bin verrückt vor Verlangen. Wie soll ich es stillen?«
»Ich weiß es nicht, mein armer Chasil.« Nofretete lächelte und hüllte sich in den dunklen Stoff.
»Bitte«, flehte er. »Bitte . . .« Er wollte sie an sich ziehen, aber sie wich zurück.
»Rühr mich nicht mehr an. Ich muß gehen.« Sie tat ein paar Schritte auf die Säule zu, in deren Schatten ich stand, und meine Erstarrung wich. Ich machte eine Bewegung, um davonzulaufen, aber Nofretete hatte mich schon entdeckt. »Wer ist da?« fragte sie leise und scharf. Dann erkannte sie mich und stieß den Atem aus. »Du, Mirjah . . .«
Ich fühlte mich so beschämt, als sei nicht sie, sondern ich bei etwas Verbotenem ertappt worden. »Es . . . es tut mir leid«, stammelte ich. »Ich sah dich in den Garten gehen. Ich ahnte ja nicht . . . ich wußte nicht . . .«
Weiter kam ich nicht. Mit einem dumpfen Aufschrei war Chasil aufgesprungen und hatte sich auf mich gestürzt. Seine Hand preßte sich auf meinen Mund. »Keine Angst, Prinzessin, sie wird gleich stumm sein. Ich breche ihr den Hals.«
Er drückte mir den Kopf nach hinten, doch da warf sich Nofretete zwischen uns. »Bist du wahnsinnig! Laß sie in Ruhe!«
»Aber sie wird uns verraten!«
»Mirjah? Sei nicht töricht, Chasil. Sie wird schweigen wie du und ich. Geh, ich will mit ihr allein sein.«
Widerstrebend gab er mich frei. Ich rang nach Luft. Seine Hand hatte so fest zugedrückt, daß ich fast erstickt wäre. Vor meinen Augen drehten sich feurige Räder, und ich wäre hingefallen, wenn Nofretete mich nicht gestützt hätte. »Dummkopf!« sagte sie zornig zu Chasil und führte mich zu dem Ruhebett. »Was stehst du noch da? Ich habe dir befohlen zu gehen.«
Chasil warf sich seinen langen Mantel über. »Du begehst einen Fehler, Prinzessin«, murrte er und musterte mich voller Abneigung. »Besser ist es, sie still zu machen. Es gibt Geheimnisse, die keinen Mitwisser dulden.«
Aber dann ging er doch. Wie ein Schatten verschwand er zwischen den Maulbeerbäumen.
Ich saß eine Weile schweigend da, noch immer elend und voller Scham, und die Gedanken in meinem Kopf waren wie aufgescheuchte Vögel. Nofretete und Chasil . . . Ich wußte nicht, was ich sagen, was ich tun sollte.
Auch Nofretete sagte nichts. Dann warf sie mit einer jähen, stolzen Geste den Kopf zurück. »Warum bist du so entsetzt? Nur weil dir noch kein Mann gefallen hat?«
Ich dachte an Chasils rohe Männlichkeit, seinen muskulösen Körper, den Geruch, den er ausströmte, sah Nofretetes zarte Schönheit - und begriff es nicht. »Liebst du ihn denn?« fragte ich schließlich, weil dies mir als einziges das Geschehene begreiflich machte, und bekam ein Lachen zur Antwort.
»Schäfchen! Man muß einen Mann nicht lieben, um sich . . . nun, auf gewisse Weise von ihm angezogen zu fühlen. Verstehst du das nicht?«
»Nein«, erwiderte ich aufrichtig.
»O Mirjah, Mirjah, was für ein Kind du noch bist! Chasil verschafft mir etwas, das ich brauche. Ich wünschte, du hättest Ähnliches erlebt, dann wüßtest du, was ich meine. Aber wie soll ich einem Blinden erklären, was Farbe ist, oder einem Tauben, was Musik? Eines Tages wirst du mit mir einer Meinung sein.«
Sie kam zu mir und nahm meine Hand. »Aber ob du es nun verstehst oder nicht - du wirst mich nicht verraten.«
»Nein, Herrin.« Ich zog die Schultern zusammen. Trotz der Wärme war mir kalt. »Aber ich habe Angst . . . Wenn euch nun jemand anders beobachtet hätte . . . Oder wenn du schwanger wirst von ihm.«
Wieder lachte sie. »Von Chasil? Hast du nicht gehört, wie ich mich ihm verweigerte? Niemals werde ich zulassen, daß er mich in Besitz nimmt. Er ist eine Hand, die mich streichelt, ein Mund, der mich berührt, weil es mir Freude macht, weiter nichts. Ich bin von königlichem Geblüt. Glaubst du im Ernst, ich würde mich ihm hingeben wie eine Dirne aus den Schenken der Vorstadt? Daß er in mich eindringt mit seinem Geschlecht und seinen Samen in mich ergießt? Eher würde ich ihn töten.«
»Aber er ist stark. Er könnte dich zwingen.«
»Mich zwingt niemand zu etwas, das ich nicht will«, entgegnete Nofretete. »Weißt du nicht, was die Priester und Astrologen bei meiner Geburt geweissagt haben? Daß ich eine große Königin sein und über ein mächtiges Reich herrschen werde, mächtiger als Mitanni je gewesen ist? Das ist meine Bestimmung - und nicht, die Geliebte eines Mannes zu werden, der aus einer Bauernkate stammt und den Stallgeruch trotz seiner Offizierspeitsche, seinen goldverschnürten Mänteln, seinen Rosenwassern und parfümierten Ölen nie verloren hat. Und wenn ich dies auch zeitweilig vergesse, so wird es mich doch niemals veranlassen, mich selbst zu vergessen.«
»Also wirst du ihn wieder treffen?« fragte ich angstvoll.
»Gewiß. Und eigentlich ist es gut, daß du jetzt eingeweiht bist. Du wirst mir helfen, nicht wahr, Mirjah? Dann brauchen wir auch keine zufällige Entdeckung mehr zu fürchten. Ach, Mirjah, Mirjah, ich habe dich lieb wie eine Schwester, und nun haben wir ein Geheimnis miteinander, wir beide ganz allein.«
»Und Chasil!« fügte ich hinzu.
»Natürlich, aber er zählt nicht. Du Arme, Liebe, hat er dir sehr weh getan?«
»Nein«, erwiderte ich, obwohl mich mein Hals und die Nase schmerzten. Ich war sicher, daß ich ein paar blaue Flecken hatte, und überlegte, womit ich sie meinen Eltern erklären sollte. Ob man mir glaubte, wenn ich behauptete, daß ich mich in der Dunkelheit gestoßen hätte? Ich hätte mir darüber keine Sorgen zu machen brauchen; es fragte mich niemand danach. Denn mein Vater Tesub wurde am nächsten Tag von einer Schlange gebissen. Es war eine Hornviper, deren Gift tödlich ist.
In der heißen Jahreszeit waren die Unterrichtsstunden, die Nofretete und Mutnedjemet erhielten und an denen ich durch die Güte der Königin teilnehmen durfte, nur auf drei oder vier am frühen Morgen beschränkt. Mehrere Lehrer unterwiesen uns in der Kunst des Lesens und Schreibens, wir lernten fremde Sprachen und Schriften, wobei ich mich besonders in der Kenntnis des Ägyptischen hervortat, weil meine Mutter von meinen frühen Kindertagen an mit mir in der Sprache ihrer Heimat geredet hatte; und wir übten uns in der Kunst des Zeichnens, Musizierens und Tanzens.
Waren wir in der Hauptstadt, kam auch täglich Siri, einer der Priester des Ischtar-Tempels, und weihte uns in die heiligen Mysterien der Religion ein.
Ich muß gestehen, daß dieser Siri mir Unbehagen einflößte. Er war dick und sehr weißhäutig, und sein kahler Schädel glänzte von Öl. Aber er war weder behäbig noch gutmütig, wie man es den Fettleibigen gern nachsagt, sondern strahlte eine für mein Empfinden kaum verhohlene Bedrohlichkeit aus. Bestimmt lag es teilweise an ihm, daß mich seine Erzählungen über unsere Götter weniger mit Glauben und Ehrfurcht erfüllten als mit dumpfem Widerwillen.
Sie kamen mir so irdisch vor, diese Götter, so grausam und machtgierig. Unersättlich verlangten sie durch ihre Priester Opfer: Gold, Silber, Korn, alles, was ein Mensch besaß, und ließen sich damit ihr Wohlwollen erkaufen. Die Ungehorsamen aber, die nicht freudig und vor allem nicht genug opferten, verfolgen sie mit ihrer Rache.
Siri konnte sich nicht genug daran tun, uns diese Rache anhand blutiger und furchterregender Beispiele zu schildern. Dann leuchteten seine runden Augen, und sein schwabbliges Kinn zitterte. Wie hätte ich da die Götter lieben können?
Sie schienen mir kleinlich, bestechlich, gewalttätig, und ich dachte, daß es außer ihnen doch noch irgend etwas anderes geben müßte - ein Wesen, das über allem vergeltungssüchtigem Aufrechnen unserer Verfehlungen und Irrtümer stand, nicht begierig zu strafen, sondern Gnade zu üben, und das die Welt und uns als seine Geschöpfe liebhatte.
Ich hatte mit niemandem über diese Gedanken, die mich sehr bewegten, gesprochen - bis zu jenem Tag, an dem ich mit meinem Vater Tesub nach den morgendlichen Unterrichtsstunden zu den Quellen des Flusses ging, der in den Niederungen die östliche Grenze unseres Landes bildet, um nach Heilkräutern zu suchen.
Wir wanderten aufwärts durch den Wald, der wie eine zweite Mauer die Palastgärten umschloß, und ich hatte meine Hand in die meines Vaters gelegt und versuchte, meine Schritte den seinen anzupassen.
Ich liebte meinen Vater sehr. Wenn ich mit ihm zusammen war, fühlte ich mich glücklich und behütet. Ihm konnte ich alles sagen, er hörte mir zu, als sei ich erwachsen, und gab mir auf alles ernsthaft Antwort. An diesem Tag fragte er mich nach dem Unterricht; ich gestand ihm, wie froh ich sei, daß Siri in der Hauptstadt zurückgeblieben war, und sagte ihm auch den Grund.
Mein Vater unterbrach mich nicht. Auch als ich geendet hatte, schwieg er eine Weile, ehe er mich neben sich auf einen moosüberwachsenen Baumstamm zog, den der Sturm vor Jahren umgebrochen haben mochte.
»Ich verstehe dich gut, Mirjah, mein Kind. Und ich freue mich, daß du nicht zu denen gehörst, die gedankenlos alles annehmen, was man ihnen anbietet, sondern fragst und abwägst. Die Priester sollen Mittler sein zwischen den Göttern und uns Menschen, und einst, in alter Zeit, waren sie es wohl auch, und ihre Rede war erleuchtet von göttlicher Wahrheit. Doch das ist lange her. Der Hunger nach Macht und Geld hat die Priester sich mehr und mehr von ihrer ureigensten Bestimmung entfernen lassen. Darum predigen sie so eifrig den Zorn der Götter, den man nur durch irdische Gaben beschwichtigen könne. Darum versetzen sie das Volk in Angst und Schrecken - und darum sind sie im Grunde mächtiger als der König geworden. Der König kann dir das Leben nehmen, die Priester aber drohen mit ewigen Qualen.«
»Du meinst also, sie reden die Unwahrheit?« fragte ich atemlos.
»Ich meine, daß die Götter größer sind als ihre irdischen Stellvertreter«, sagte mein Vater mit seinem leisen Lächeln, »und auch gütiger. Sieh dich nur um, was sie uns geschenkt haben: den Himmel, die Sonne, den Wald, die Blumen und Vögel. Es gibt soviel Schönes auf der Welt, an dem wir uns freuen dürfen.«
»Aber auch Böses«, entgegnete ich. »Unheil, das die Götter schicken. Dürre Und Seuchen, Elend und Tod.«
»Gutes und Schlechtes im Leben gehören zusammen wie die zwei Hälften einer Nuß«, sagte mein Vater. »Geborenwerden und Sterben sind Anfang und Ende eines Kreises, und es ist töricht, in dem einen nur ein Glück und in dem anderen ein Unglück zu sehen. Was den Menschen nach seiner Geburt erwartet, wissen wir. Eine Spanne Leben auf dieser Erde, angefüllt mit Schwerem und Schönem, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Der Tod aber ist nur die Rückkehr in das Land, von dem wir ausgegangen sind. Es gibt keinen Grund, sich davor zu ängstigen.«
»Und auch vor den Göttern nicht?«
»Wenn man nichts Böses tut, nein«, sagte mein Vater. »Nur vor den Menschen . . .«
Ich dachte an Chasil, wie er heute nacht versucht hatte, mich zu töten, und das Herz lag mir wie ein kalter, scharfkantiger Stein in der Brust. Wie gern hätte ich meinem Vater auch dies anvertraut, aber ich wußte, daß ich es nicht durfte.
Er legte den Arm um mich. »Komm, laß uns weitergehen, Kind. Arta, die Frau des königlichen Mundschenks, leidet seit langem an einem eitrigen Geschwür, das sich nicht schließen will. In Ägypten heilt man so etwas mit einem Schimmelpilz, der auch hier in der Feuchtigkeit der Quellen wächst. Ich habe versprochen, ihr von diesem Pilz mitzubringen.«
Wir standen auf, und in diesem Augenblick geschah es. Im Laub zu unseren Füßen raschelte etwas, ich hörte einen zischenden Laut und sah eine Hornviper mit geöffnetem Rachen blitzschnell auf meinen Vater zustoßen. Ich schrie auf, aber es war schon zu spät. Das Reptil grub seinen tödlichen Giftzahn in den Knöchel meines Vaters.
Er packte die Schlange unterhalb des Kopfes und schleuderte sie weg ins Dickicht, riß das Messer von seinem Gürtel und stieß es tief in den winzigen roten Punkt, den sie ihm zugefügt. Blut floß heraus, und mein Vater drehte das Messer in der Wunde, damit sie stärker blutete, in der Hoffnung, das Gift herauszuschwemmen. Er war so bleich wie vergilbtes Leinen geworden.
»Lauf, Mirjah«, keuchte er, während ich vor Entsetzen wie gelähmt stand. »Zurück zum Palast . . . Hilfe holen . . . schnell!«
Mir war, als fahre ein Schwert durch mein Herz, daß ich meinen Vater jetzt allein lassen sollte. Aber ich gehorchte, weil ich wußte, daß nichts anderes ihn retten konnte und daß kein Augenblick Zeit zu versäumen war.
Also rannte ich den Weg zurück, den wir gekommen waren, rannte wie nie zuvor in meinem Leben, getrieben von herzbebender Angst: Mein Vater darf nicht sterben. O ihr Götter, laßt es nicht zu. Ich habe ihn so lieb. Mein Vater darf nicht sterben . . .
Als ich den Vorhof des Palastes erreichte, fiel ich auf den großen Steinstufen zusammen. Einer der Wachsoldaten half mir auf, und ich stammelte erschöpft und tränenüberströmt, was geschehen war.
Man holte meine Mutter und Amunzu, den Leibarzt des Königs, der befahl, sechs der raschesten Läufer mit drei Sänften herbeizuschaffen. Meine Mutter gab mir zu trinken und kühlte mir das Gesicht mit Wasser, damit ich mich etwas erholte. Sie weinte und jammerte nicht, aber auf dem Weg zurück zu meinem Vater behielt sie mich in ihrer Sänfte in den Armen, und ich hörte sie Gebete murmeln.
Mein Vater lag neben dem Baumstamm, auf dem wir vorhin gesessen hatten, und als Amunzu ihn anrief, antwortete er nicht, noch gab er eine Regung von sich. Sein Bewußtsein hatte seinen Körper verlassen, und ich sah, daß sein Bein, wo ihn die Schlange gebissen hatte, bereits schwärzlich-blau verfärbt und angeschwollen war. Er hatte es selbst mit seinem Gürtel am Oberschenkel abgebunden.
Amunzu befahl seinem Gehilfen, den er mitgebracht, meinem Vater die starren Kiefer auseinanderzupressen und ihm tropfenweise Zuckerrohrgeist einzuflößen, während er selbst zwei Fingerbreit oberhalb des Schlangenbisses mit dem Messer einen Schnitt anlegte und einen zweiten gerade über dem Herzen. Er hatte eine Salbe mitgebracht, die, wie ich später erfuhr, aus dem Fett einer Hornviper und dem Blut einer Schlangenkatze zubereitet wird. Schlangenkatzen sind die einzigen Lebewesen, soviel ich weiß, die gegen das Gift der Viper gefeit sind. Deshalb hofft man, daß ihr Blut auch die Vergiftung aus den Adern eines Gebissenen zieht.
Diese Salbe strich Amunzu auf die Wunde, die die Viper meinem Vater zugefügt, und ebenso auf die beiden Schnitte, die er ihm selbst beigebracht hatte. Dann hieß er seinen Gehilfen, sie mit einem Leinentuch zu bedecken, und trug meinen Vater zu der dritten Sänfte, die von den Läufern leer mitgeführt worden war.
Meine Mutter trat auf Amunzu zu. »Wie sieht es aus? Wird er . . . wird er . . .« Ihre Lippen zitterten, und sie vermochte nicht, den Satz zu Ende zu bringen.
»Ich habe alles getan, um zu verhindern, daß sich das Gift weiter in seinem Körper ausbreitet. Mögen die Götter es gelingen lassen. Das Bein ist allerdings verloren. Ich muß es amputieren, sobald wir zurück sind.«
Im Palast wurde mein Vater in den Pavillon gebracht, wo Amunzu wohnte und die Kranken behandelte. Der Arzt wollte meine Mutter und mich fortschicken, da wir, wie er meinte, doch nicht helfen, sondern ihn höchstens in seiner Arbeit stören könnten, aber meine Mutter bestand darauf, an der Seite meines Vaters zu bleiben.
»Ich will nur bei ihm sitzen und seinen Kopf halten, Amunzu. Du mußt nicht befürchten, daß ich schreie oder ohnmächtig werde. Aber du kannst nicht erwarten, daß ich ihn verlasse, solange noch Atem in ihm ist.«
Ich empfand wie sie, deshalb ließ ich ihre Hand nicht los, als sie der Bahre mit meinem Vater in den Saal folgte, in dem Amunzu seine chirurgischen Eingriffe vorzunehmen pflegte, und er ließ uns beide gewähren.
Sein Gehilfe Pasennes reinigte die Luft mit verbrannter Terebinthe und glühte die chirurgischen Instrumente im Feuer aus.
Noch heute, während ich dies niederschreibe, meine ich, das entsetzliche Geräusch der Knochensäge zu hören, als Amunzu das Bein meines Vaters am Oberschenkel abtrennte. Wie durch einen Schleier sah ich meine Mutter zu Häupten seines Lagers sitzen, seinen Kopf in ihrem Schoß. Unablässig streichelte sie sein Gesicht.
Pasennes hatte ihm einen betäubenden Trank eingeflößt, für den Fall, daß er erwachte. Aber er blieb stumm und starr und sah aus, als sei er gestorben, mit spitzer Nase und gelblichen, eingefallenen Wangen.
Ich hatte grauenvolle Angst, und mir war übel, aber ich kämpfte gegen meine Schwäche, denn ich wollte genauso stark und tapfer wie meine Mutter sein und um keinen Preis Amunzu von der Operation ablenken, indem ich etwa bewußtlos geworden wäre.
Mein Vater verlor viel Blut, bis Amunzu endlich die Hautlappen vernähte und den Beinstumpf in siedendes Öl tauchte, um die Wunde zu reinigen. Danach streute Pasennes Myrrhepulver darüber und legte einen Verband an.
»Ob er überleben wird, kann ich erst sagen, wenn die Nacht vorbei ist«, erklärte Amunzu meiner Mutter, und in diesem Augenblick haßte ich ihn, weil er so kühl und unbeteiligt sprechen konnte. Erst später begriff ich, daß Ärzte so sein müssen, denn in ihrem Leben begegnet ihnen ein so großes Maß an Leid, daß sie es nur ertragen, wenn sie ihr Herz davor verschließen.
Mein Vater lebte noch eine Nacht und den darauffolgenden Tag. Dann starb er, nicht am Schlangengift, sondern weil der Brand in seinen Beinstumpf gekommen war. Er hatte keinen leichten Tod; Fieber schüttelte seinen Körper, es war so heftig, daß er meine Mutter und mich immer nur für wenige Augenblicke erkannte. Manchmal stöhnte er auch oder schrie, und wir begriffen, daß er große Schmerzen litt.
Amunzu kam mehrere Male, um nach ihm zu sehen. Er brachte ihm einen Absud aus der Rinde der roten Weide gegen das Fieber und einen aus Weißdorn und Dattelsirup, um das Herz zu stärken. Aber wir wußten, daß er es nur tat, um nicht unverrichteter Dinge mit einem Schulterzucken wieder fortgehen zu müssen. Wenn eine Wunde brandig wird, gibt es kein Mittel, den Kranken zu retten.
Erst in seiner Todesstunde wurde mein Vater still. Meine Mutter und ich saßen bei ihm und hörten auf seinen Atem, der schwächer und schwächer wurde, manchmal aussetzte und mit einem Rasseln wieder anhub, bis er endlich ganz verstummte.
Als ich begriff, daß mein Vater tot war, gebärdete ich mich wie von Sinnen. Ich schrie und weinte, warf mich über ihn und war nur mit Mühe zu bewegen, mich endlich fortführen zu lassen.
Es ist nicht viel Güte in der Welt; darum ist einer, der sie besitzt, wie ein Licht, das in eine finstere Kammer fällt. Mein Vater Tesub war solch ein Mensch, und deshalb trug ich schwer an seinem Tod.
Ich blieb tagelang in meinem Zimmer und weinte, ich weigerte mich zu essen und wollte niemanden sehen. Bis eines Abends Neferteri, die alte nubische Sklavin, die meine Mutter aus Ägypten mitgebracht hatte, zu mir kam und mich ausschalt.
»Es ist recht, wenn eine Tochter den Vater betrauert«, sagte sie, und ihr schwarzes Doppelkinn bebte vor Entrüstung. »Aber es ist ein Unrecht, das zu den Göttern schreit, wenn sie darüber den Gram ihrer Mutter vergißt. Denkst du, dein Vater ist nur dir allein gestorben? Deine Mutter hat den Gatten verloren, und obwohl ich im allgemeinen von den Männern nicht viel halte und mich jeden Tag glücklich preise, daß ich mir keinen genommen habe, so war der Edle Tesub doch eine rühmenswerte Ausnahme. Wahrlich, es schnürt mir das Herz ab, wenn ich deine Mutter ansehe in ihrem Schmerz, und du verweigerst ihr den Trost, den sie in deiner Umarmung finden könnte. Dein Vater würde sich schämen für deine Selbstsucht.«
Alles an Neferteri war gewaltig - ihre Größe, ihr Umfang, die Stimme, ihr Schelten und ihre Zärtlichkeit. Sie stand den Dienern unseres Haushaltes vor und regierte sie mit Strenge. Ihren schwarzen Augen entging nichts, kein schlecht gewaschenes Leinentuch, kein nachlässig gewischter Fußboden, kein flüchtig gescheuerter Kochtopf. Ihr Mundwerk war gefürchtet, selbst bei den Soldaten des Palastes, und in meinen ersten Lebensjahren hatte ich vor Neferteri genausoviel Respekt wie vor meinen Eltern - wenn nicht noch mehr.
Wenn sie sagte: »Du mußt jetzt schlafen gehen, Mirjah«, dann ging ich. Wenn sie mit ihrer dröhnenden Stimme befahl: »Wirst du wohl die Milch mit Dattelsirup trinken!«, so leerte ich meinen Becher, auch wenn ich es zuvor hartnäckig verweigert hatte. Aber wenn ich mich im Dunkeln fürchtete, weil ein böser Traum mich geplagt, so war es auch Neferteri, die mit der Lampe kam und mich beruhigte: »Meine Gazelle, mein Herzblut, mach die Augen zu. Es geschieht dir nichts, Neferteri ist bei dir.« Und in ihrer Gegenwart schwanden alle Ängste. Ich wußte, sie würde mich verteidigen wie eine Bärin ihr Junges, ob gegen Menschen, Götter oder böse Geister.
An ihrer großen, schwarzen Hand hatte ich die ersten Schritte geübt; sie tröstete mich, wenn ich fiel, und ihre Arme und ihre mächtige Brust waren mir ein sicherer Zufluchtsort.
Neferteri war schlau wie ein Fuchs und neugierig wie eine Katze. Sie lauschte an den Türen, und es geschah wenig im Palast, von dem sie nichts wußte. Wen sie liebte, den liebte sie; für ihn hätte sie gelogen, gestohlen und gemordet. Aber wer vor ihren Augen und ihrem weiten, wunderlichen Herzen, in dem so vieles nebeneinander wohnte, Verrücktes und Weises, Großmütiges und Verschlagenes, keine Gnade fand, dem begegnete sie mit nie versiegendem Mißtrauen.
Mein Vater hatte oft gesagt: »Ein Weib wie Neferteri kann eine rechte Plage sein. Dennoch würde ich sie um alle Schätze des Ischtar-Tempels nicht verkaufen - um ihrer Treue willen.«
Ach, mein Vater . . . Plötzlich lag ich in Neferteris Armen. Ich schämte mich, daß sie mit mir gescholten, und war doch gleichzeitig froh darüber, und meine Tränen flossen zum ersten Mal seit meines Vaters Tod, ohne mir bitter zu schmecken.
Neferteri brachte mich zu meiner Mutter, wir umarmten einander, und es ist wahr, daß das Leid, das man zusammen trägt, leichter wird.
Neferteri sorgte dafür, daß wir uns nicht allzusehr in unserem Kummer abschlossen. Sie behelligte meine Mutter mit Angelegenheiten des Haushaltes, die sie früher ganz allein entschieden hatte. Sie unterhielt uns mit allerlei Nichtigkeiten, die sie, die Götter mochten wissen, woher, erfuhr. Sie zwang uns, zu essen und zu trinken, wann immer sie meinte, daß die Zeit dafür da sei, und sie erstickte jeden Widerspruch mit der Behauptung, daß der Edle Tesub es genauso und nicht anders gewollt hätte.
Überhaupt führte sie den Namen meines Vaters ständig im Munde, und sie erreichte damit, daß es uns vorkam, als sei er nicht für immer, sondern nur für eine gewisse Zeitspanne fern von uns. Und das half uns, so widersprüchlich es vielleicht scheinen mag, ohne ihn zu leben.
Wir gedachten seiner, wir sprachen von ihm und füllten so die Leere, die er hinterlassen hatte, wenigstens teilweise mit unseren Erinnerungen aus.
Ich wurde in diesem Jahr dreizehn Jahre alt, und ich begriff, daß meine Kindheit vorüber war. Durch das, was ich mit Chasil und Nofretete erlebt hatte, war ein Vorhang zerrissen, und der Tod meines Vaters hatte mich jählings gelehrt, wie trügerisch die Sicherheit und das Glück sind, in dem wir uns wiegen. In einem einzigen Augenblick kann es sich in Trauer und Entsetzen verkehren.
In den Gefilden der Kindheit hängen wir dem Märchenglauben an, daß alles, was geschieht, sich irgendwann und irgendwie zum Guten wenden werde. Die Welt der Erwachsenen zerschlägt diese Hoffnung. Ich - ich war erwachsen geworden.
Nun muß ich aber von dem berichten, den ich nach Nofretete und Sethos, meinem Mann, geliebt habe wie einen leiblichen Bruder. Ich habe ihn gekannt in den Tagen seiner Hoffnung, da die Hand seines Gottes ihn berührte, ich habe seine Macht, seine Größe und sein Glück erlebt, da sich alle vor ihm beugten und sein Name bis zu den Sternen reichte, und ich habe seine Armseligkeit und Verlassenheit im Herzen geteilt, als er unterging.