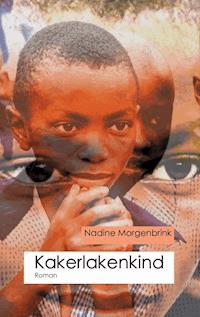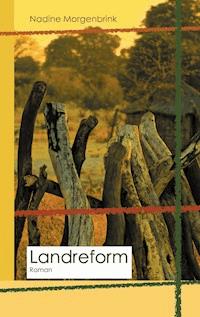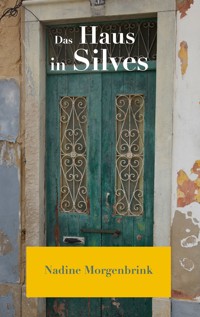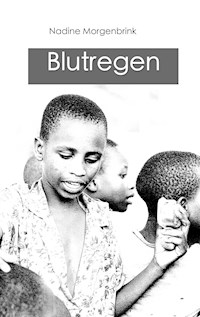Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als auch noch die Alte stirbt, steht das ganze Dorf Kopf. Manche sind sicher, dass der kleine Yaro schuld ist daran. Es ist Zeit, dem Spuk ein Ende zu bereiten. Für Yaro beginnt eine Zeit des Schreckens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für die „verzauberten“ Menschen in Tansania, deren Leben zur Hölle wurde, nur weil sie anders geboren wurden…
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel I: 1951
Kapitel II: 1954
Kapitel III: 1957
Kapitel IV: 1958
Kapitel V: 1962
Kapitel V: 1964
Kapitel VI: 1974
Kapitel VII: 1977
Kapitel VIII: 1999
Kapitel IX: 2000 bis 2005
Kapitel X: 2006
Kapitel XI: 2007
Kapitel XII: 2008
Kapitel XIII: 2009
Kapitel XIV: Später im Jahr
Kapitel XV: Kurz vor dem Jahreswechsel 2009
Kapitel XVI: Silvester 2009
Kapitel XVI: 1. und 2. Januar 2010
Kapitel XVII: Mitte Januar 2010
Kapitel XVIII: Der darauffolgende Tag
Kapitel XIX: Später am Tag
Kapitel XX: Mitte Februar 2010
Kapitel XXI: Tags darauf
Kapitel XXII: Im Sommer
Kapitel XXIII: Mitte August 2010
Kapitel XXIV: Die folgenden Tage
Kapitel XXV: Dar Es Salaam
Epilog
Prolog
Yaro", sagte er schüchtern. So schüchtern wie es ein Teenager seines Alters normalerweise hierzulande nicht sagen würde. Seine Stimme klang belegt.
Obwohl er hier ja in Sicherheit war, wirkte der Junge vorsichtig. Blickte sich um, sortierte erste Eindrücke. Und stellte fest, dass diese Welt anders war als seine. „Und wie weiter?“, wollte der Grenzbeamte am Flughafen wissen. Yaro verstand die Frage nicht. Er hieß Yaro und war der Sohn von Adili und seiner Frau Kamaru. Im Dorf hatten sie ihn früher ab und an Sohn des Mzungu genannt. Yaro bedeutete soviel wie Sohn und Mzungu, so nannte man zu Hause die Menschen europäischer Herkunft. Die Weißen. Er war der Sohn eines besonderen Weißen. Und wohl auch deshalb war er nun hier. An diesem Flughafen, in einer anderen und so bedrückend fremden Welt. In einer Welt, wo niemand Sandalen aus Autoreifen trug. In der seine Kleidung seltsam schäbig wirkte und in einer Welt, in der ihn niemand richtig verstand. „Also dann ist der Vorname Yaro und der Nachname Mzungu, fertig“, sagte der Grenzer in Richtung des deutschen Mannes, der Yaro begleitete. „Und Sie bürgen also für ihn?“, fragte der Bundespolizist nach. „Meine Frau und ich haben alles bereits mehrfach mit dem Kreisverwaltungsreferat besprochen.“ Der Beamte nickte. Yaro verstand kein Wort. Aber er spürte, dass Nikolas ruhig war und wenn Nikolas ruhig war, gab es auch für ihn wenig Grund zur Sorge. Der Polizist hingegen machte keinen allzu freundlichen Eindruck auf ihn. Aber Yaro hatte schon gelernt: In Europa schlägt die Polizei nicht auf Menschen ein, nur weil sie anders sind als andere. In Europa muss man der Polizei auch kein Geld geben, wenn man Schutz und Hilfe sucht. Hier hatte die Polizei die Aufgabe, Verbrechen wirklich aufzuklären. So wie in den Filmen aus Amerika, die im Fernseher bei Onkel Manani liefen. Dann versammelte sich das halbe Dorf auf dem staubigen Platz. Die Männer tranken Bananenbier und die Kinder wurden verscheucht. Etliche Frauen schimpften über die weißen Frauen in den Filmen. Viel zu viel Sex, jammerten sie, während die Männer und iungen Burschen wie gebannt auf den krächzenden Kasten gafften um zu sehen, wie mit quietschenden Reifen Gangster durch die Straßen New Yorks gejagt wurden und hübsche Ladys an Bars Gin tranken. Ach, wie herrlich das war! Und nun war er, Yaro, ein Teil dieser neuen Welt. Das machte ihn etwas fröhlicher. Aber sein gewohntes Leben war nun Vergangenheit, verlorene Vergangenheit.
Am Ausgang neben der Passkontrolle standen noch zwei weitere Polizisten. Und sie alle schienen den Jungen aus Afrika anzustarren.
Verwundert nahmen die Zöllner zur Kenntnis, dass der Junge aus Tansania nur einen kleinen Rucksack bei sich trug. Und selbst der schien kaum gefüllt. Das Wappen von Hertha BSC Berlin prangte ausgeblichen auf der Rückseite. „Aufmachen, bitte“, meinte der eine zu Yaro. Der verstand nicht und sah den Zöllner fragend an. Nikolas übernahm die Konversation. Und wieder erklärte er die ganze Geschichte. „Und wie haben Sie den Burschen dann da rausgebracht?“, fragte der andere Zöllner nun verdutzt nach. „Durch Zufall, ehrlich gesagt“, gab Nikolas an. „Meine Frau stammt aus Tansania, sie gehört zu einer angesehenen Diplomatenfamilie. Ihr Vater hat wirklich viel dazu beigetragen, dass wir den Jungen nun mit nach Deutschland nehmen konnten.“ Deutschland, das hatte Yaro verstanden. Das hatten ihm Nikolas und Zuri beigebracht. Es war ein Wort geworden, das viel mehr für ihn bedeutete, als nur dieses fremde Land weit fort von Afrika. Es war für ihn die Verquickung allen Reichtums mit blühenden Blumen, saftigen Wiesen, gepaart mit reich gedeckten Tischen überall. Geldsegen und Freiheit, das war Deutschland. Und dieser herrliche Rucksack mit der blau-weißen Fahne darauf, das war sein erstes Stückchen Deutschland.
Der Zöllner winkte dann doch noch fröhlich beim Gehen und wünschte Yaro alles Gute. Dann schloss sich eine Schranke und vor ihm tat sich die neue Welt auf. „Zuri wird zu Hause schon auf dich warten“, meinte Nikolas und Yaro nickte, auch wenn er nichts verstand.
-I-
1951
Sie war nun eine Aussätzige. Entweder verzaubert und verhext, besessen und verrückt, obwohl bei klarem Verstand. Oder aber sie hatte es gewagt, auf der Reise in die Stadt… Daran wollte aber niemand glauben. Ein Weißer? Einer der Missionare am Ende? Reisende gab es noch nicht viele, aber immer mehr von ihnen kamen aus dem fernen Europa um in der Serengeti dem Wunsch nach Weite und Freiheit Aug in Aug gegenüberzutreten. Für Geld? Nicht für einen Shilling, beteuerte sie. Nur Hatari, ihr Mann, er glaubte ihr nicht so recht. Hatari war ein angesehner Mann im Dorf. Ein stolzer Mann, der viel zu sagen hatte. Hatari war ein chief. Und Amali brachte ihm nun Kummer.
Das ganze Dorf war gekommen, denn eine Geburt war immer etwas Aufregendes. Die Männer hatten in den Hütten der Frauen nichts verloren. Sie blieben unter sich, aber Hatari war erfreut. Es war die Geburt seines Kindes. Seines dritten Kindes. Würde es ein Junge, so würde er ihn Adili nennen - der Gerechte.
Dann das Wehklagen aus der Hütte Amalis. Die Frauen drängten sich eng um die Schamanin herum. Sie stimmten alle ein in das Klagelied um die Sorge, einem fürchterlichen Fluch erlegen zu sein. Das ganze Dorf heimgesucht von den dunklen Geistern der Ahnen, die auf Rache sannen für längst vergangene Taten. Was auch immer der Grund für ihren Groll war, sie hatten sich nun also Amali und ihr Kind ausgesucht.
Als der Junge das Licht der Welt erblickte, starrten ihn unzählige ungläubige Augenpaare an. Weiß! Das Kind war weiß. Selbst das kleine Büschel Haare, das der Junge auf dem Kopf trug, es war fast weiß. Verwunschen war die Mutter des Kindes! Verwunschen war der Junge selbst und auch die Geburtsstatt!
Amali stimmte anfangs in das Wehklagen mit ein. Es war nicht ihr erstes Kind. Sie hatte Hatari schon eine Tochter geschenkt. Sein anderes Kind stammte von seiner anderen Frau, die am Rande der Siedlung lebte. Amali war Hataris Erstfrau und damit in der glücklichen Lage, viel Einfluss auf ihn nehmen zu können. Er war ein wichtiger Mann, oft tagelang nicht zu Hause. Hatari gehörte zum Ältestenrat und auf ihn hörte das ganze Dorf. Sein Ruf war tadellos. Stark, gerecht. Frei und frei von jedem Makel. Nun wimmerte in der Hütte seiner Frau Amali ein weißes Kind, das rot leuchtende Augen hatte und entweder das Balg eines Weißen oder - und beides kam einer Katastrophe gleich - verwunschen war.
Amali war 1923 zur Welt gekommen. Sie hatte nie das Lesen und Schreiben gelernt. Sie war bei Adilis Geburt schon achtundzwanzig Jahre alt und hatte viel durchgemacht in ihrem Leben. War selbst die Älteste von acht Geschwistern gewesen. Gerne wäre sie in die Schule gegangen. Es gab im Dorf einen Lehrmeister. Aber nur für die Jungen und auch da nicht für alle. Was man zu lernen hatte, lernte man auf dem Acker, bei der Jagd, im Haus oder im Gespräch mit den Älteren. Mädchen gingen ohnehin nicht zur Schule.
Und irgendwann war es für Amali an der Zeit, eine Frau zu werden, so wie es der Ritus vorsah. Sie heiratete den drei Jahre älteren Hatari. Ein stolzer junger Mann. Da war sie vierzehn. Das Leben in der Siedlung war hart und sehr entbehrungsreich.
Die jungen Frauen und Mädchen legten Tag für Tag lange Strecken zurück um Wasser zu holen. Sie wuschen die Kleidung, kochten, hielten die Feuerstellen am Leben und fertigten den bunten Schmuck an. Die Männer hüteten das Vieh und betrieben Landwirtschaft.
Hatari hatte mit der Viehzucht nicht zu viel zu schaffen. Er war viel auf dem weiten Land des Stammes unterwegs um nach dem Rechten zu sehen. Ein Mann wie er hütete das Vieh nicht mehr selbst. Hatari aber war gütig. Er war eingebunden in die traditionellen Anforderungen an das Leben und hielt sich strikt an sie.
Und dieser stolze Mann sah nun, dass das dritte Kind, ein Junge, weiß war. Vierzehn Jahre nach der Heirat und dreizehn Jahre nach dem ersten Kind, das ihm Amali geschenkt hatte, blickte er nun völlig gleichgültig in das Gesicht des Kleinen, den er Adili nannte.
Der schrie das hilflose Schreien eines Neugeborenen und suchte Schutz bei seiner Mutter. Die war aber beschäftigt, das Wehklagen der Nachbarn, Freundinnen und Verwandten zu verstehen. Denn in diesem speziellen Augenblick war sie selbst noch gar nicht in der Lage, ganz und gar zu erfassen, was ihr da widerfuhr. Ihr Körper schmerzte, sie war entsetzlich müde und angeschlagen, wollte nur schlafen. Sie hörte Trommeln und wollte Wasser. Sie musste den Jungen waschen. Sie selbst musste nun etwas trinken. Die Geburt hatte ihr viel Kraft geraubt. Vielleicht - nur ein Gedankenblitz - war dieser weiße Junge ein Erzeugnis ihrer Einbildung, der augenblicklichen Schwäche geschuldet. Aber was sollte dann das Wehklagen der anderen Frauen? Welchen Grund hätten sie gehabt, sich derart in Rage zu schreien, zu stampfen und zu singen, wenn eigentlich alles normal wäre?
Da lag also tatsächlich ein Weißer. Und nur Amali wusste, dass das, was da nun auf sie einprasseln würde, nicht stimmte. Der lange Weg in die Stadt, den sie auf sich genommen hatte, um… ja, warum nur? Es war für die wenigsten verständlich, wie es eine Frau wagen konnte, sich zusammen mit Männern auf die Reise nach Arusha zu machen um dort ihre Waren zu verkaufen. Sie hatte dort das erste Mal eine Zeitung gesehen. Sie war die Frau des stolzen Hatari, durfte daher nicht zurückgewiesen werden. Und Hatari hatte Amali gewähren lassen. Was sollte es schon bedeuten, wenn seine Frau nach Arusha führe um dort Schmuck zu verkaufen. Zusammen mit ihrer älteren Schwester und drei Männern. Allesamt Verwandte. Nun aber dieses Ergebnis! Der weiße Junge musste in der fernen Stadt gezeugt worden sein. Da waren sich die meisten Frauen sicher. Nur Amali wusste genau, dass sie Adili zu dieser Zeit bereits in sich trug, fühlte aber eine derart große Last auf ihren Schultern, dass sie sich nicht getraute, etwas zu sagen. Sie sah die Pfeile aus den Augen auf das Wochenbett schießen. Bitterer Hass, dass da eine ein Kind auf die Welt gebracht hatte, das nicht zu existieren hatte, weil es weiß war. Weiß am Kopf, weiß am Bauch und rot in den Augen.
Hatari drehte sich nach einer kurzen Weile des Verweilens um, brach das Schweigen. „Dies“, so sagte er bestimmt und unmissverständlich, „ist nicht mein Sohn und sie ist nicht mehr meine Frau, denn sie ist verhext.“
Dieser Ausspruch hätte Amalis Todesurteil sein können und wenn es nach der ein oder anderen Frau gegangen wäre, auch hätte sein müssen. Sie alle hatten bis dahin voller Neid auf Amali geblickt, denn sie war die Erstfrau des Kriegerhäuptlings. Damit waren Neid und Missgunst allüberall. Von diesem einen Moment an aber war alles anders. Dass ein männlicher Gast des herrschenden Mannes in der Hütte der Frau nächtigt, das wurde toleriert. Kinder, die aus so einer Nacht hervorgingen, wurden von den Männern in der Regel anerkannt. Ein Weißer aber und noch dazu in der fernen Stadt - das wäre niemals akzeptiert worden.
Hatari aber glaubte nicht einen Augenblick an die Mär mit dem Weißen aus der Stadt. „Diese roten Augen habe ich noch bei keinem Weißen gesehen!“, sagte er. Allzu viele Weiße aber hatte auch er in seinem Leben noch nicht getroffen. Sein Urteil war ein anderes: Amali war verhext worden! Ein böser Fluch der Ahnen lastete scheinbar auf ihr. Und um sich rein zu waschen, musste Hatari ein klares Zeichen setzen. Amali hatte zu verschwinden! Entweder sie ging freiwillig oder sie würde den Zorn der gesamten dörflichen Gemeinschaft zu spüren bekommen.
Amali aber war eine starke Frau. Nach den ersten Momenten des Leidens und Wehklagens scheuchte sie die aufgebrachten Frauen davon und bat, noch einmal mit Hatari alleine sprechen zu dürfen. Ihr war klar, dass die Entscheidung ihres Mannes unumkehrbar war. Sie musste noch einmal mit ihm sprechen dürfen.
Die Nacht war hereingebrochen, Finsternis senkte sich über die Siedlung. Das Vieh stand ruhig beisammen. Überall herrschte Ruhe. Der kleine Adili schlief tief und fest, denn auch für ihn war der erste Tag auf dieser Welt etwas sehr Anstrengendes gewesen. Draußen kratzten Schritte im weichen Sand. Der Verschlag wurde geöffnet und Hatari stand im Raum. Er wirkte nicht mehr freundlich und beschützend stark. Er erschien Amali in dieser Nacht eher barsch und ablehnend. Seine Stärke machte ihr zum ersten Mal Angst.
„Gib mir dein Versprechen, dass ich am Leben bleibe, wenn ich außerhalb der Siedlung eine neue Hütte errichte und mit deinem Jungen dort leben werde“, sagte Amali mit fester Stimme. Hatari senkte den Blick. „Es ist nicht mein Junge“, sagte er nun leise, aber ebenso bestimmt. Fügte dann noch an: „Sieh doch seine Haare, diese leuchtend roten Augen, das ist nicht mein Sohn!“ Amali, die nicht wusste, wie es mit der Situation umzugehen galt, nickte nur und wiederholte ihr Anliegen. „Bitte versprich mir, dass du deine schützende Hand über diesen Jungen und seine Mutter hältst, wenn wir außerhalb der Siedlung leben und deine Nähe von uns auch nicht mehr suchen werden.“ Sie versuchte in der Dunkelheit einen Blick in sein Gesicht zu erhaschen. Aber Hatari starrte weiterhin gebannt auf den Boden. Mit einem Blick erhaschte er im Zucken der Flammen einen Blick auf das friedlich schlafende Kind. Mit der Hand signalisierte er stumm Zustimmung, beugte sich dann noch einmal über den Jungen und wiederholte mit aller Härte: „Er ist nicht mein Sohn!“
Amali spürte den Schmerz tief in ihrer Seele. Nicht Hataris Kind. Auch nicht ihr Kind? Sie war nun eine verstoßene Frau, weil dieses Baby offensichtlich verhext war. Aber es war dennoch das Gebot der Stunde, ihm nicht einfach das Leben auszuhauchen um den Fluch zu bannen… Niemand wusste, warum die Ahnen zürnten. Wer weiß, was geschehen würde, wenn man den kleinen Adili - und der hatte ja bereits einen Namen - einfach so umbrachte? Das stand außer Frage! Nur war ebenso klar, dass der verhexte Junge dem ganzen Dorf Unheil bringen würde, wenn er dort aufwuchs. Niemand konnte ganz sicher sein, ob nicht doch bei der kleinsten Kleinigkeit einer aus dem Dorf käme und Amali und Adili töten würde. Amali musste sich auf Hataris Wort verlassen. Er hatte stumm zugestimmt und eingewilligt. Es war ein Geschäft. Amali würde fortan als Aussätzige leben - vor der Siedlung. Sie war dann nicht mehr ein Teil der dörflichen Gesellschaft.
-II-
1954
Das Leben vor der Siedlung war hart und entbehrungsreich. War es ohnehin nicht einfach für die Menschen in dieser Gegend zu überleben, so musste eine Verstoßene Tag für Tag einen schier unendlichen Kampf gegen die Macht allen Übels führen. Brennholz gegen die Kälte der Nacht und für die Kochstelle. Es stand Amali nicht zu, das Brennholz zu sammeln, das der dörflichen Gemeinschaft gehörte. Das Wasser an der Wasserstelle war nicht mehr ihres. Und wenn sie dort mit Adili auftauchte, warf man ihr böse Blicke zu. Mal waren die Leute offen feindselig, mal nur erstaunt oder verwundert. Dass diese Amali es drei Jahre lang ausgehalten hat mit dem weißen Kind im Schlepptau? Ganz auf sich gestellt, vor den Toren des kleinen Dorfs.
Es gab diese wenigen Tage des Glücks. Da raschelte es nachts vor der Hütte, die kaum gegen Wind und Wetter geschützt war. Sie lag gut fünf Minuten Fußmarsch vom Dorf entfernt in Sand und Staub gebaut. Ohne Schutzwall oder Zaun. Oft hörte Amali in der Dunkelheit wilde Tiere um die hölzerne Hütte ziehen, deren Hunger sie immer näher an die menschlichen Siedlungen trieb. Und Amalis Hütte war der Vorposten einer dieser Siedlungen, ein wehrloser Posten, das einfach einzunehmende Fort vor der eigentlichen Burganlage.
Doch die Nächte des Glücks wurden ebenso mit Rascheln eingeläutet. Amali erkannte den Unterschied sofort. Es waren nicht die schnellen Pfoten der Hyänen oder das träge Poltern der Elefanten, vor dem sie sich am meisten fürchtete. Die Elefanten gehörten zum neuen Serengeti Nationalpark. Aber für die wenigen Menschen, die am Rande des Parks ihre Siedlungen hatten, war es oftmals gefährlich, den Dickhäutern zu nahe zu kommen. Und trieb der Hunger sie an, konnten sie hölzerne Zäune wie Spielzeug umtreten und ganze Hütten zertrampeln. Dennoch machte sich Amali wegen der Elefanten weniger Sorgen als sie sich vor den Menschen ängstigte.
Das Rascheln der guten Nächte klang ein wenig dumpf. Es waren menschliche Schritte. Nie war es hell genug, um zu erkennen, wer da um die Behausung schlich. Nie traute sich Amali aus der Hütte um nachzusehen. Aber immer, wenn es nachts so geraschelt hatte, lag am Morgen etwas vor der Hütte. Einmal etwas Kleidung mit der sie den Jungen anziehen konnte. Einmal Lebensmittel. Wenn das Dorf gefeiert hatte - eine Hochzeit zum Beispiel - dann kamen die Schritte mit Gewissheit in der folgenden Nacht zu ihrer Lehmbehausung. Die Person hielt inne, legte etwas ab und verschwand. Amali hatte seit dem Auszug aus dem Dorf keinen tiefen Schlaf mehr. Sie hörte die Schritte immer. Sie waren kräftig. Schritte eines Mannes, da war sie sicher. Sie getraute sich nicht, auf gut Glück Hataris Namen in die Nacht zu flüstern. Zu groß war ihre Angst, dass der Zauber vorüber wäre und die Schritte nicht mehr kämen. Auch befürchtete sie, dass Adili aufwachen konnte und sein Rufen und Weinen den geheimen Gast vertreiben konnten.
Das erste Mal näherten sich die Schritte in einer wolkenverhangenen Nacht etwa vier Wochen nach Adilis Geburt. Amali hatte sich voller Angst in die hinterste Ecke der neuen, wackeligen Hütte verkrochen. Sie hörte das Scharren bedrohlich näher kommen, erspähte aber keine Schatten oder menschlichen Umrisse vor den aus Reisig bestehenden Seitenwänden. Die Wolken verdeckten den Mond und nicht ein Stern funkelte. Amali aber hörte mit jedem Schritt: Dies war kein Tier, das in der Nacht Schutz vor Sturm und Kälte suchte, es war ein Mensch! Sie drückte Adili fest an sich, gewickelt in Tücher. Die Armut war schrecklich genug und die Einsamkeit bitterer Saft dieses fürchterlichen Zaubers, der auf ihrem Sohn lastete. Das Kind konnte sie dafür nicht hassen, das Band zwischen ihr und Adili war viel zu stark. Sie hielt ihn an sich, sie spürte seinen Herzschlag und verglich mit dem ratternden Uhrwerk ihres Herzens, das leidvoll pumpend auf ein baldiges Ende zu warten schien. Beim ersten Besuch war ihr klar, sie kamen um ein Ende zu setzen - dem Zauber des weißen Kindes, das ausgegrenzt mitsamt der Mutter vor der Siedlung hauste und Amalis Leben damit. Aber nichts von dem, was Amali erwartet hatte, geschah. Es wurde nicht die Behausung in Brand gesteckt oder die Tür aufgerissen und mit einem Speer verletzt und getötet. Es herrschte nur kurze Stille vor der Hütte und dann hörte Amali die dumpfen Schritte wieder in die Nacht verschwinden. Sie getraute sich nicht, aufzustehen und draußen nachzusehen, was es war. Aber als sie am Morgen die Kanne frischer Milch entdeckte und die Wolldecke für Adili, wusste sie, diese Schritte bedeuteten ihr kleines Glück und Segen.
Amali hatte gehört, dass Hatari eine weitere Frau heiraten wollte. Die Alte hatte es ihr erzählt. Draußen an der Wasserstelle. Es war dunkel bereits. Sie getraute sich mit dem weißen Kind nur in der Dunkelheit länger vor ihre Wohnstatt. Da waren die anderen Frauen bereits fort. So war die Gefahr geringer, sich ihren hässlichen Blicken aussetzen zu müssen. Da glänzte auch das Weiße der Haut ihres kleinen Sohnes weniger stark. Sie hatte bald nach der Geburt gemerkt, dass es für Adili nicht gut war, wenn sie ihn der Sonne aussetzte. Auch deshalb entdeckte sie die Dunkelheit für sich. In der Nacht war sie nicht existent. Ein Schatten im Schatten des Dunkel. Kaum wahrnehmbar, die Frau, die mit dem Kind auf dem Rücken und einem Bündel auf den Kopf, die sandigen Wege entlang huschte - auf der Suche nach Brennholz und auf dem Weg zur Wasserstelle. Aus mehr bestand ihr Leben nicht mehr. War sie einst die erste Frau des stolzen Hatari, war sie nun die Mutter des weißen, verzauberten Adili, der man aus dem Weg zu gehen hatte.
Sie sprach so wenig, dass sie alsbald die Wörter schwinden fühlte. Es war zwar bloße Einbildung, aber es schmerzte Amali sehr.
Die Alte, das war eine Frau, der es ähnlich erging, wie Amali selbst. Keiner wusste mehr so recht, weshalb sie nicht wirklich Teil der Gemeinschaft war. Alle wussten, dass die Alte etwas seltsam war, dass in ihrer Jugend etwas gewesen war, das sie wahnsinnig gemacht hatte. Sie rastete immer wieder aus, war von Geistern besessen und es galt, sie zu heilen. Aber alle Versuche scheiterten und so machte man besser einen Bogen um die Alte.
Sie hatte an der Wasserstelle gestanden und ihre Wäsche gewaschen als Amali mit dem kleinen Adili im Schlepptau ankam. Sie sah erschrocken zu ihr hoch. „Das Kind, es ist verzaubert, Liebes“, sagte sie und wunderte sich, warum dies für Amali nun wirklich nichts Neues mehr war. „Ich weiß, deswegen leben wir ja auch außerhalb der Siedlung.“ Amali spürte, dass die Frau wirklich etwas verrückt zu sein schien. Die Alte blickte aus runzeligen Augen auf den kleinen Adili. „Aber der Zaubermensch wird niemandem Unglück bringen, meine Liebe“, fügte sie dann an. „Das sehe ich in seinen lieben, roten Augen.“ Sie wagte sich näher heran. Es war fast komplett dunkel, sodass sie sehr nahe an das Gesicht Adilis herantreten musste, um ihre Aussage noch einmal zu überprüfen. Nur ein dumpfer Schein eines kleinen Feuers an der Wasserstelle gab etwas Licht. „Kein Unglück, aber ein Zaubermensch, Glück stattdessen“, wisperte sie aus zahnlosem Mund hervor, strich mit knöchernen Fingern sanft über das Gesicht des Kindes. Adili sah sie aufmerksam an, ohne zu weinen und schreien. Er schrie viel, weinte lange und reagierte auf andere Menschen immer sehr ängstlich. Menschen bekam er ja nur selten zu Gesicht. Die Alte aber schien er zu mögen, seine Züge wirkten vollkommen entspannt als sie mit rauher Hand sein Gesicht streichelte.
„Hatari heiratet wieder“, sagte sie zu Amali in vollster Klarheit. Diese nickte nur stumm, füllte ihre Kalebasse mit Wasser machte sich auf den Weg zurück zu ihrer Hütte. „Das Feuer darf nicht ausgehen“, sagte sie zur Alten - halb als Entschuldigung, warum sie so rasch wieder aufbrach, halb als Erklärung für Hataris erneute Heirat.
Die Alte blieb an der Wasserstelle alleine zurück, drückte Stofffetzen ins Wasser und setzte sich dann an das kleine Feuer. Sie schien hier draußen übernachten zu wollen, dachte sich Amali auf dem Weg zurück zu ihrer Hütte.
Tage später konnte sie im Dorf die Vorbereitungen für die Hochzeit ausmachen. Wer die Braut war, wusste sie nicht. Im Grunde war es ihr auch egal. Es würde die dritte Frau Hataris sein. Sie durfte im Dorf mit ihm leben und das unterschied sie von Amali.
Der Wind trieb das dumpfe Stampfen des springenden Tanzes bis vor die Siedlung. Amali spürte einen stechenden Schmerz in ihrer Seele. Man hörte Frauen singen und Männer rufen. Sie würden alle ihren herrlich ausladenden Halsschmuck tragen und die Männer ihre dünnen Stäbe als Zeichen der Macht. Und in ihrer Mitte Hatari, stolz und mächtig. Amali betrachtete Adili in seine Decke gekuschelt. Er war nun fast ein Jahr alt. Seinen Vater hatte er noch nie gesehen. Er würde nicht einmal wissen dürfen, wer er war. Irgendwann, wenn er sprechen konnte, würde er fragen, warum er zusammen mit seiner Mutter alleine und verlassen vor der Siedlung lebte. Dann würde sie ihm sagen müssen, dass es an der weißen Haut lag, die wie ein Fluch über ihn gespannt worden war. Dann würde Adili sich unschuldig schuldig fühlen und Amali keine Ahnung haben, wie sie das Kind trösten konnte.
Sie wünschte sich, Adili würde nie das Sprechen lernen.
In der Nacht der Hochzeit konnte man sehr lange noch die Gesänge aus dem Dorf hören. In der Lehmhütte von Amali knisterte nur mehr ein kleines Feuer und sie versuchte, Schlaf zu finden.
Es musste sehr spät oder vielleicht schon früher Morgen gewesen sein, als es an der Tür kratzte. Diesmal wollte sie nachsehen, wer vor der Hütte herumschlich. Adili schlief wieder friedlich und so erhob sie sich vorsichtig. „Wer ist das da draußen?“, krächzte sie in die kalte Nacht. Rasch entfernten sich Schritte. Sie öffnete die Tür ihrer Behausung und ging nach draußen. Die Gestalt, die um die Hütte geschlichen war, hatte sich schon so weit entfernt, dass sie fast hinter einer Sandkuppe verschwunden war. Aber trotz Kopfbedeckung und Wolldecke um den gesamten Oberkörper war sich Amali sofort sicher, es musste Hatari selbst gewesen sein. In der Nacht seiner Hochzeit war er zu ihrer Hütte geschlichen und hatte ihr Essen von der Feier vor die Türe gelegt. Es waren Fleischstücke von einem geschlachteten Rind und Süßigkeiten.
Leise blies Amali ein Dankeschön in die Dunkelheit und schlich vorsichtig wieder zurück in die Hütte und legte sich schlafen.
-III-
1957
Sechs Jahre war Adili bereits alt. Er wusste nun, dass er anders war als die anderen. Er bekam es dauerhaft zu spüren. Tag für Tag: Erblickte er sein Gesicht in der Oberfläche der Wasserstelle, erkannte er einen weißen Jungen. Hob er die Arme zur Sonne, waren sie hell und leuchtend, manchmal rot verbrannt. Amali wusste oft nicht, wie sie das Kind aus der Sonne halten konnte. Seine Haut brannte und schuppte sich. „Der Zaubermensch“, spotteten die anderen Kinder. Sie ließen Adili nicht mit sich spielen. Er durfte nicht hinter die Steine laufen um mit den anderen Jungs zu tollen. Er durfte nicht mit ihnen zur Wasserstelle. Sie ließen ihn nicht mit sich kommen auf der Suche nach Reisig für die Feuerstellen.
Abends saß er oft alleine vor der Wohnstatt seiner Mutter und haderte mit seinem Schicksal. „Warum bin ich so anders als die anderen Kinder?“, fragte er Amali dann ab und an. Sie wusste keine wirkliche Antwort zu geben. „Weil du verzaubert bist und die Ahnen dich auserwählt haben“, sagte sie manchmal, wissend, dass Adili diese Antwort nicht gefallen würde. Wer wollte schon von den Ahnen verzaubert werden, war das doch gleichzusetzen mit verhext zu sein oder verwunschen.
Lernen wollte er. Das Lesen und das Schreiben wollte er beherrschen. Seine Mutter konnte nicht lesen. Seinen Vater kannte er nicht; er wusste nicht, ob er es beherrschte. „Wer ist mein Vater?“, hatte er gefragt. Ein ums andere Mal. Amali hatte es nicht übers Herz gebracht, zu sagen, dass der stolze Hatari sein Vater war, der Krieger, der sich ab und an nachts an ihre Hütte schlich um ihnen Essen zu bringen. Der Dorfchief, der das Sagen hatte und den alle bewunderten - er war Adilis Vater. Und doch blieb es ihm verborgen. „Dein Vater ist fort“, sagte Amali und bat ihren Sohn, nicht mehr zu fragen. Sie selbst litt dabei.
Lesen wollte er lernen und schreiben. Im Sand hatte er eine Seite aus einem Buch oder Magazin gefunden. Amali konnte sich nicht erklären, wie eine Buchseite in diese gottverlassene Gegend gelangen konnte. Es war Text zu erkennen und ein Bild. Es zeigte Männer in der Stadt. Sie trugen Anzüge und Hüte wie sie Adili noch nie gesehen hatte. Auch Amali hatte in ihrem Leben noch nicht viele Gelegenheiten gehabt, auf Menschen der feinen Gesellschaft zu treffen. Die Engländer kamen selten bis in die fernen Winkel des Landes. In Arusha hatte sie ein paar von ihnen gesehen. Aber hier draußen noch nie. Adili starrte wie gebannt auf die Bilder der Menschen auf der Buchseite, die er aus dem Sand ausgegraben hatte. Sie waren weiß. Weiß wie er! Weiß wie das verzauberte Kind, dessen Mutter in einer Lehmhütte außerhalb des Dorfes lebte, weil sie einem Zaubermenschen das Leben geschenkt und damit Leid über die Familie gebracht hatte. „Sind die Männer hier auf dem Bild auch Zaubermenschen?“, hatte Adili gefragt. „Nein, das sind Engländer“, sagte Amali und wollte dem Jungen die Seite aus dem Buch oder Magazin entreißen. Adili aber hütete das Blatt wie einen Schatz. Er fragte seine Mutter nach der Bedeutung der Schriftzeichen und erntete nur Schulterzucken. Auch sie verstand nichts von den Buchstaben und kannte ihre Bedeutung nicht. Es waren Rätsel und für sie gab es keine Möglichkeit, das Rätsel zu knacken. Aber sie wünschte sich so sehr, dass Adili das Lesen lernen konnte.
War es für die Kinder in diesem Landstrich zu dieser Zeit allgemein kaum möglich, lesen zu lernen, so war es für einen weißen Jungen, der von allen gemieden wurde, unvorstellbar. Adili begann alles aus Amali herauszuquetschen. Was ist eine Schule? Was macht ein Lehrer? Wie lernt man das Lesen? Wo muss ich hingehen, damit ich diese Zeichen zu einem Ganzen zusammensetzen kann? Amali konnte ihrem Sohn auf die wenigsten dieser Fragen zufrieden stellende Antworten geben und hatte fast ein schlechtes Gewissen, weil sie ihn durch die Erzählungen über die Schulen in der Stadt erst richtig neugierig gemacht hatte.
Die Seite mit den Buchstaben und dem Bild von den weißen Männern, die Mama Amali Engländer nannte, wanderte in einen Sack aus Rindsleder. Das war Adilis einziges Eigentum. Der bestickte Sack hatte auch eines Morgens vor der Hütte gelegen und Amali hatte dem Himmel für die Güte gedankt.
Die Buchseite war Adilis ganzer Schatz. Sie war sein Ein und Alles und eines Tages würde er auf dieser Seite erfahren, warum er weiß war und was er zu tun hatte um daraus einen Vorteil zu schlagen.
Amali erkannte in ihrem Sohn die Cleverness ihres Mannes Hatari. Er war flink wie er, ebenso kräftig und intelligent. Nur gab es für sie keine Möglichkeit, dies zu fördern. Sie saß mit ihm vor der Siedlung, ohne eigene Rinder, ohne Aufgabe, ohne Geld und ohne Unterstützung. Es war ein Wunder, dass sie überhaupt all diese Jahre überstanden hatten. Adili war gesund und niemals wirklich krank geworden. Viele Kinder starben hier draußen in der Wildnis bevor sie ein Jahr alt waren. Adili hatte überlebt und das auch noch außerhalb der Gesellschaft. Er half der Mutter bei der Feuerholzsuche. Sie lebte von dem, was ihr vor die Hütte gelegt wurde und von den Almosen der Sippe. Sie durfte ab und an das Vieh der anderen hüten. Dafür gab man ihr Milch und Hirse. Und sie nähte Kleidung aus Stoffen zusammen. Das hatte sie schon vor Adilis Geburt gemacht. Besser und schöner als jede andere im Dorf. Niemand nähte schöner als Amali. Hatari schien auch hier seine Segenshand über seine ehemalige Frau zu halten. Ab und an lagen in Lederhäute geworfene Stoffe vor der Lehmbehausung und dann durfte sie nähen. Tage oder Wochen später kamen dann die alten Frauen aus dem Dorf um die fertigen Schürzen zu holen. Sie sprachen wenig, beäugten still und neugierig den Zaubermenschen, der mittlerweile munter um die Hütte herumsprang und sich nicht scheute, sie anzusprechen. Dann ließen sie etwas Mais oder Milch zurück, manchmal sogar Fleisch. Sie dankten im Namen der anderen. „Hatari schickt uns“, sagten sie oft. Und Amali bat die Alten, ihn ebenfalls zu grüßen.
-IV-
1958
Den ganzen Vormittag über war Adili nicht zu sehen gewesen und Amali machte sich Sorgen. Er war in den letzten Wochen immer mal wieder mit anderen Kindern aus dem Dorf unterwegs gewesen. Sie waren neugierig auf das Kind vor der Siedlung. Der Zaubermensch entfaltete eine große Anziehungskraft auf sie. Auch wenn ihre Eltern sie vor den Flüchen der Ahnen gewarnt hatten, sie wollten ihn sehen. Sie wollten mit ihm sprechen und sie erkannten rasch, wie normal Adili im Grunde war. Ein einfacher Junge, der ihre Sprache sprach und der ihr Leben so gerne geteilt hätte. Dies aber blieb ihm weitestgehend verwehrt, weil er nunmal weiß war.
Aber sein Leben hatte sich gebessert. Die Menschen in der Siedlung hatten erfahren, dass es auch in anderen Dörfern Zaubermenschen wie Adili gab. Dass im Dorf seit Adilis Geburt nichts Tragisches geschehen war, sprach nicht unbedingt dafür, dass die Verwünschungen der Ahnen so schlimm sein konnten, als dass man den Jungen vollständig meiden musste. Auch der Bann von Amali als Aussätzige schwand zusehends. Immer häufiger trauten sich nun Frauen aus dem Dorf zu ihr. Ihre Fähigkeit, herrliche Kleidung zu nähen, wurde weiterhin sehr geschätzt und so erfuhr sie allerlei Neues aus dem Dorf und die Leute im Dorf bekamen zu hören, wie normal der weiße Junge doch eigentlich war.
Endlich kam Adili den holprigen Weg herunter gelaufen. Man sah ihn umringt von anderen Kindern. Amali winkte und erkannte schon von weitem, dass die Kinder aufgeregt waren. Dahinter erblickte sie eine Staubwolke. Etwas bahnte sich den Weg durch den Sand. Ein Automobil. Es war das erste Mal, dass ein Wagen in ihre verlassene Gegend kam. Amali hatte in Arusha schon Autos gesehen und war einmal ein Stück auf einem Lastwagen gefahren. Aber in ihrem Dorf war noch nie ein Laster aufgetaucht und ein solches Auto schon gleich dreimal nicht.
Sie rieb sich verdutzt die Augen. Bald kamen die Kinder näher. Großes Geschrei! Der Wagen ratterte heran und aus dem Dorf kamen die ersten Neugierigen. Das Gefährt machte vor Amalis Lehmhütte Halt. Nun war klar, der Zaubermensch war doch etwas ganz Besonderes. Er hatte ein Auto in ihre Siedlung gelockt. Und dieses Automobil machte auch noch just vor der Hütte der Verbannten Halt.
Zwei Weiße stiegen aus dem Wagen aus. Mzungu, Weiße! Die Kinder umringten die beiden Männer sofort. Ein Kind zupfte an ihren Kleidern, ein anderes wollte das blonde Haar in die Finger bekommen.
Das ging solange bis der Ältere laut hustete und die Schar erschrocken zurückwich. In einer unverständlichen Sprache redeten die beiden Männer auf die Kinder ein. Ein Missionar und ein Arzt. Der Arzt sprach Englisch und der Missionar verständigte sich alsbald auf Swahili. Es klang seltsam und für die Kinder lustig, was der Mann von sich gab.
Amali verstand sein Swahili, wenngleich der Mann fremd klang. Sie grüßte die Männer und reichte dem Missionar vorsichtig die Hand. Er schüttelte sie kräftig.
Aus dem Dorf waren nun einige Männer gekommen. Unter ihnen auch Hatari. Er begrüßte die beiden nun ebenfalls. Vor der Behausung Amalis hatte sich mittlerweile das halbe Dorf versammelt und ihre Behausung war für einen Augenblick das Zentrum der ganzen Siedlung geworden. Es galt, den Fremden Milch zu bringen und in Erfahrung zu bringen, was ihr Anliegen war.
Der Missionar erklärte etwas von Education und Schule, von Hygiene und Gottesfurcht. Hatari ließ sich alles bereitwillig erklären ohne wirklich zu verstehen, was der Mann von ihm wollte. Der Andere war ein Arzt aus England, der im Auftrag der Regierung die Kinder untersuchen sollte. Sie seien nicht krank und wenn es ihnen nicht gut gehe, würden sich darum die Schamanen kümmern oder die alten, weisen Frauen, die Kontakt zur Ahnenwelt halten konnten.
Der Arzt schüttelte heftig den Kopf. „Eure Ahnen haben aber kein Chinin gegen Malaria und wissen auch nicht, wie man eine Lungenentzündung heilt oder Tuberkulose erkennt.“ Diese Krankheiten kannte man im Dorf nicht und wenn jemand vom Fieber befallen wurde, war es ein Zeichen aus der Welt der Geister.
Dann schob Amali ihren Sohn vor. „Adili ist sehr wohl irgendwie krank“, sagte sie zu Hatari. „Frag den Weißen, warum Adili weiß ist, so weiß wie sie.“ Adili wusste nicht, wie ihm geschah. Er wurde von Hatari, dem Chief des Dorfs, den er bislang noch nie direkt gesehen hatte, an der Schulter gefasst und in Richtung der beiden weißen Männer geschoben. „Was fehlt ihm?“, fragte er den Arzt. „Er ist verzaubert und daher weiß wie ihr“, fügte Hatari selbst sofort als Erklärung an. Der Arzt nickte, um dann sofort energisch den Kopf zu schütteln. Er sprach mit dem Missionar. Der gab Antwort und erneut erwiderte der Arzt etwas. Niemand im Dorf konnte ihrer englischen Konversation folgen. Dann endlich wandte sich der Missionar an Hatari.
Adili sah den stolzen Krieger aufmerksam an, voller Neid auf dessen Einfluss, dessen Intelligenz und seine Anerkennung. Wenn er gewusst hätte, dass dieser aufrechte Krieger, der stolz seinen Schmuck trug und den Speer als Zeichen der Macht in den blauen Himmel reckte, sein Vater war, er wäre vor Stolz geplatzt. Aber Amali konnte es ihm nicht sagen.
„Es ist Albinismus, aber wie soll ich euch das erklären“, sagte der Missionar. Dann verschwand er hinter seinem Automobil. In der Hand hielt er ein Buch. Adili stieß einen Lauten Schrei aus, so freute er sich, dass der Mann auch so ein Schriftstück besaß. Aber das bestand nicht nur aus einer Seite. Es war voller Seiten. Adili war begeistert. Er löste sich kurz aus der Umklammerung Hataris und rannte in seine Hütte um aus dem kleinen Ledersack seine Seite zu holen.
In der Zwischenzeit hatte der Missionar das Wort Albinismus nachgeschlagen und sagte mühevoll langsam: „Ulemavu wa ngozi“. Aber das rief bei den Dorfbewohnern nur Schulterzucken hervor. Sie blickten sich fragend an. Eine Behinderung des Leders sei es, was Adili da habe. Und weiter sagte der Missionar langsam und mit einem sonderbaren Akzent: „Watoto wengi wanaathirika“. Hatari verstand und gab für die Dorfbewohner weiter: „Viele Kinder haben das.“ Aber die ungläubige Reaktion der Menschen machte schnell klar: Der Junge blieb ein Zaubermensch, dem die Ahnen ein Zeichen auf die Haut gebrannt hatten. Es galt vorsichtig mit ihm zu sein, auch wenn die weißen Medizinleute einen Namen für seinen Zustand hatten.
Adili reckte die Seite empor und sagte zu den englischen Gästen: „Seht mal, ich habe auch so etwas.“ Sie lachten ein wenig. Hatari schob Adili wieder fort von den beiden. Der Arzt aber nahm das Blatt und studierte es. Es war die Seite aus einem Magazin, kaum zusammenhängender Text, da die Seite an einem Ende zerrissen war. „Frage den Jungen bitte, was er sagen wolle“, bat er Hatari. Der wandte sich verdutzt an seinen Sohn. „Der Fremde will wissen, was du mit diesem Stück Papier willst?“, herrschte er Adili an. Der senkte den Blick und sprach leise. „Ich möchte gerne lesen können, was auf dem Papier steht. Will diese geheimen Zeichen entziffern können.“ Hatari fühlte einen Stich in seiner Brust. Es war wie eine schwere Last, die ihn befiel. Einerseits war es unmöglich, dass dieser Junge, der so anders war als alle anderen und der außerhalb der Gemeinschaft lebte, lesen lernen konnte. Auf der anderen Seite wusste Hatari, dass es sein Sohn war. Auch wenn es alle totschwiegen. Die geheime Abmachung. Das ist nicht mein Sohn, die Worte blieben wie ein nicht notiertes Gesetz gültig - für alle im Dorf -, weil Hatari sie ausgesprochen hatte, als er zum allerersten Mal in die roten Augen dieses Zaubermenschen geblickt hatte. Nun wollte dieser Junge lesen lernen. Hatari spürte, dass Adili voller Neugierde war. Er wollte seine Wissbegierde stillen. Der Durst nach Wissen - er war fast spürbar. Amali wagte nicht, etwas zu sagen. Sie schämte sich ein wenig, dass der kleine Adili es gewagt hatte, offen und ehrlich zu sagen, was sein Anliegen war. Dem Stammesführer Hatari gegenüber so ehrlich zu begegnen, war für ein kleines Kind ungewöhnlich.
Der Missionar sprach wieder mit dem Arzt und beide nickten eifrig. Dann wandte sich der Missionar an Hatari. „Wenn du willst, kann der Junge bei uns das Lesen und Schreiben lernen.“ Er erklärte, dass er eine Mission in der Nähe von Loliondo betreibe. Dort gebe es eine kleine Krankenstation, eine Kirche und eine Farm. Und natürlich eine Schule für rund zwanzig Kinder. Man lebte von Geldern aus Großbritannien. Hatari sah skeptisch drein. Andererseits konnte man das weiße Kind so aus dem Dorf bekommen und es würde nicht mehr der Fluch der Ahnen auf ihnen liegen. Wenn er zeitgleich etwas Gutes für Adili tat, würde das doch in aller Interesse sein.
Amali aber blickte sorgenvoll in Hataris Richtung. Sie wollte nicht, dass der Sohn ging. Loliondo war wenigstens drei Tagesreisen entfernt. Mit dem Wagen vielleicht nur zwei. Sie selbst war noch nie dort oben im Norden gewesen. Zu lange hatte Amali nun mit ihrem Sohn alleine vor der Siedlung gelebt. Amali und Adili - konnte man diese Verbindung zwischen Mutter und Sohn einfach so trennen? Und wie lange wäre der Sohn fort?
„Es wird ihm gut gehen und wir bringen ihn ins Dorf zurück, sobald er lesen und schreiben kann“, sagte der Arzt. Hatari willigte ein, auch wenn er spürte, dass es Amali das Herz brechen konnte.
-V-
1962
Hitze durchflutete den Raum aus Holz. Durch die Fenster drang kaum ein Luftzug. Einen Ventilator gab es hier nicht. Der kleine Generator war der Krankenstation vorbehalten. Dort ratterte auch unaufhörlich der Motor. Drei Ventilatoren in den Zimmern der Kranken und ein Kühlschrank wurden damit betrieben.
Therese war schon vier Tage in ihrem Bett. Ihr Vater hatte sich sofort um sie gesorgt. Er bat Gott um Hilfe und spürte doch, dass es irdischer Hilfe bedurfte, sollte Therese wieder genesen. Das Mädchen war zehn, ein Jahr jünger als Adili. Die beiden waren ein Herz und eine Seele. Der weiße Junge und das weiße Mädchen. Sie, weiß, weil Vater und Mutter Weiße waren, er, weil der Zauber der Ahnen auf ihm lastete. Thereses Mutter Barbara war gestorben - kurz nachdem sich der Vater, Pete Williams auf den Weg in die Kolonie gemacht hatte. Pete war von seiner Kirche entsandt worden, im fernen Afrika eine Missionsstation aufzubauen. Es war eine harte Arbeit dort. Aber er verliebte sich in dieses Stückchen trostloser Erde. Sofort und allumfassend. Er lauschte den Gesängen der Kinder. Er spürte das Trommeln in seinen Adern. Er hörte das Singen der Vögel am frühen Morgen, roch die Würze der Feuer und wusste, er würde bleiben. Zu Hause warteten Barbara und Tochter Therese, gerade zwei Jahre alt. Er schrieb ihnen. Tag um Tag und Woche für Woche sandte er Briefe. Immer, wenn sich ihm die Gelegenheit bot, ließ er von Loliondo oder Arusha aus Briefe nach England schicken. Brachte sie selbst auf die Poststationen der Städte, die er besuchte. Er wünschte sich seine Familie bei sich und hatte alle auf der Mission wahnsinnig gemacht als Barbara endlich schrieb, dass sie eine Schiffspassage gebucht hatte. „Auch wenn mein Vater und deine Mutter mir sagten, dass diese lange Reise nach Afrika für Therese fürchterlich gefährlich ist“, hatte sie geschrieben, „halte ich ein Leben ohne dich am Ende nicht aus“. Schlussendlich bezahlte sie die Reise mit ihrem Leben und Therese lebte.
Kurz nach der Ankunft in Daressalam wurde Barbara krank. Sie musste auf der Überfahrt eine böse Virusinfektion bekommen haben. Etwas, das man zu Hause in England in einem Krankenhaus sicherlich in den Griff bekommen hätte. Aber so musste die von Schüttelfrost und Gliederschmerzen geplagte junge Frau zusammen mit ihrer kleinen Tochter und einem Haufen Gepäck noch fast tausend Kilometer weit reisen. Zwar hatte ihr Mann einen Wagen geschickt. Der Fahrer hatte Anweisungen, sie in guten Herbergen unterzubringen. Barbara und Therese bekamen warme Decken und gutes Essen. Die junge Frau hatte das Gefühl, ihre Krankheit würde wieder verfliegen, schob alles auf die lange Seereise und freute sich auf das Wiedersehen mit ihrem geliebten Mann, den sie so vermisst hatte. Doch bald schon nach der Ankunft in der kleinen Missionsstation in der Nähe des Dorfes Loliondo ging es ihr wieder schlechter. Hohes Fieber, Glieder- und Kopfschmerzen, rasende Kopfschmerzen, lähmende Kopfschmerzen. Von Tag zu Tag wurde sie schwächer. Doctor Allister gab ihr Chinin und andere Medikamente. Es konnte Malaria sein, die sie sich auf dem Schiff irgendwo vor der afrikanischen Küste eingefangen hatte. Es konnte aber auch eine andere fiese Viruserkrankung sein. „Diese Schiffe sind voller schrecklicher Dinge“, sagte er zu Pete. Der hatte nur stumm genickt und seiner geliebten kleinen Tochter über die Haare gestrichen. Er wurde zerfressen von Schuldgefühlen.
Nur neun Tage nach der Ankunft in Tansania läuteten auf der Missionsstation die Glocken der kleinen Kirche zum Abschied von Barbara Williams. Sie begruben sie auf einem kleinen, staubigen Hügel hinter der Missionsstation. Pete ließ einen Stein anfertigen. Darauf stand in wackeligen Lettern: Her heart died leaving her England: Barbara Williams 1921-1955. Wann immer er konnte, legte er Blumen auf den Stein oder richtete das kleine Holzkreuz wieder auf, wenn Wind und Wetter ihm zu arg zugesetzt hatten.
Auch Therese kam oft auf den Hügel um ihrer Mutter zu gedenken. Mit den Jahren verblasste allerdings die Erinnerung an sie. Zuerst verschwand die Stimme. Sie hörte ihre Mutter nicht mehr sprechen. Der feine Singsang ihrer liebevollen Stimme verschwand in den Tiefen der Vergangenheit. Dann entschwanden Bewegungen und Bilder. Bald gab es für Therese nur mehr eine wage Vorstellung von ihrer Mutter. Sie lebte fort in den bunten Erzählungen des Vaters. Petes Erinnerungen an die Frau aber speisten sich zumeist aus Erlebnissen vor Thereses Geburt.
Und nun lag die Tochter selbst auf der Krankenstation. Doctor Allister war sich sicher, dass es Malaria war. Diese Bestie, die sich in die kleinsten Mücken schlich und von dort aus ihren unheilvollen Siegeszug antrat. Vor allem Kinder waren ihr Opfer. Mit einem mühelosen Biss in die Knöchel, der ein bisschen juckte, begann es. Dann die ersten Fieberschübe. Der Schweiß rann ihr in Sturzbächen über Gesicht und Nacken. Die Krankenschwester war den ganzen Tag über damit beschäftigt, ihr die Stirn zu tupfen und sie immer wieder aus ihrem durchnässten Tuch zu befreien. Und dann musste man Therese Wasser einflößen. Es strengte das Mädchen an. Adili schmerze der Anblick der leidenden Freundin. Sie war sein Anker geworden. Die Trennung von der Mutter nachdem man ihn auf diese Schule mitgenommen hatte, war hart gewesen. In ihm focht eine bittere Schlacht zwischen Neugierde auf das Lesen und Schreiben und dem Heimweh. Beides hielt sich wacker. Er lernte schnell und begierig, vermisste Mama Amali aber Tag um Tag.
Da nahm den weißen Jungen eines Tages die Tochter des Missionsleiters beiseite. Therese sagte zu ihm: „Du vermisst deine Mom, richtig?“ Er nickte nur. In der Zwischenzeit verstand es Adili ganz passabel auf Englisch zu antworten. „Ich vermisse meine Mom auch sehr“, entgegnete ihm Therese und erzählte Adili die ganze Geschichte. Mit all dem Leid und der Endgültigkeit. „Weißt du, sie kommt nicht mehr wieder. Meine Erinnerung bleibt dieser Stein und das kleine Kreuz auf dem Hügel. Du kannst deine Mutter wiedersehen, wenn wir sie mal besuchen in deiner Siedlung.“ Das würde er zu gerne tun: Mit Therese zusammen zurück in sein Dorf fahren, ihr alles zeigen.
Je mehr sich die beiden Kinder anfreundeten umso mehr merkte er, dass er eine Sonderstellung auf der Missionsstation genoss. Alle behandelten ihn freundlich. Aber sie hatten Respekt vor ihm. Die anderen Kinder hielten Adili für einen Zaubermenschen. Er war weiß. Die Erwachsenen hatten Angst vor dem Einfluss der Ahnen. Wer wusste schon, welche Kräfte in ihm steckten? Die Missionare und Ordensschwestern aus England spürten diese Angst und Scheu der Leute und kümmerten sich daher liebevoll um den Jungen. Es ermangelte ihm an nichts auf der Station. Er bekam immer genug zu essen, trug gute Kleidung und durfte spielen und lernen. Und - für diese Zeit in Afrika sehr ungewöhnlich - sich frei entfalten. Pete Williams hielt schützend die Hand über seinen Schüler. Vom ersten Tag an hatte er gemerkt, dass dieser Junge ausgesprochen intelligent und clever war. Und je enger die Bindung zwischen den beiden wurde, umso deutlicher wurde, dass seine Nähe auch Therese guttat. So ließ er beide gewähren.
„Du musst wieder gesund werden, Therese, hörst du“, bat Adili fast flehend. Die Haut des Mädchens war weiß und glänzte. Ihre Augen wirkten tief eingefallen. „Sie hat schon zu viele Tage nichts mehr gegessen“, sagte die Krankenschwester besorgt. In ihrer Hand hielt sie einen Napf mit Brei. Den reichte sie Adili. „Gib ihr davon“, forderte er den Jungen auf. Der versuchte sein Bestes, aber Thereses Mund öffnete sich kaum. Sie schluckte mühevoll einen winzigen Löffel des gesüßten Breis. Danach drehte sie sich schwach zur Seite und schlief wieder ein. Den Rest des Breis verschlang der immer hungrige Adili selbst.
„Sie hat nichts gewollt. Ich habe es mehrmals versucht.“
„Und dann hast du dich erbarmt“, lachte die Krankenschwester. Er nickte. Sie schickte ihn fort. „Geh wieder ins Schulgebäude, es ist an der Zeit. Du kannst am Abend wieder nach Therese sehen.“
In dieser Zeit konnte sich Adili kaum auf die Buchstaben und Zahlen konzentrieren. Er lernte mit Größeren und Kleineren gemeinsam. Therese war die einzige weiße Schülerin gewesen, die die Schule besuchte. Und nun war außer ihm niemand mehr weiß. Aber die anderen Kinder trauten sich nicht, etwas gegen den weißen Jungen zu sagen, auch wenn er ihnen immer noch suspekt vorkam. Sie wussten, dass er gut mit dem Missionsleiter auskam. Und besonders mit dessen Tochter. Die Jungen taten sich oft schwer mit dieser sonderbaren Konkurrenz. Der verzauberte Junge stand außerhalb ihrer Schulgemeinschaft und war doch ein fester Teil. Adili war anders. Brauchten sie lange um Wort für Wort zu begreifen, eilte er durch die Texte, stellte wissbegierig Fragen und las ganze Bücher binnen weniger Tage.
In den Pausen stand er oft alleine und unterhielt sich mit den Schwestern oder den zwei Lehrern. Die meisten Schüler waren am Anfang ängstlich, noch nie hatten sie einen Schwarzen mit weißer Haut und hellen Haaren gesehen. Alle mussten sie ähnliche Gedanken gehabt haben: Ein verzaubertes Kind!
Seine Freundschaft mit Therese war für Adili so wichtig. Sie spielten auch nach der Schule oft am kleinen Wasserloch oder beobachteten die Tiere. Adili war ein genialer Spurenleser. Etwas, das er eigentlich von seinem Vater hätte lernen müssen. „Aber ich weiß nicht, wer er ist“, hatte er einmal zu Therese gesagt. Es war seine Mutter Amali, die ihm gezeigt hatte, wie man die Spuren der Rinder von denen anderer Tiere unterschied. Und so hatte er schon als kleiner Junge abends an der Wasserstelle des Dorfes gesessen und die Spuren gelesen, die dorthin führten und von dort wieder in die Weite der Savanne. Er erkannte das sanfte Trippeln der Antilopen, den flinken Gang der Raubkatzen und die schweren, dröhnenden Schritte der Gnus. Er erkannte die hektischen Bewegungen der Zebras, wenn sie auf der Flucht schienen um rasch in den Norden zu gelangen.
Und nun musste Adili sehen, wie seine Freundin zitternd kaum das Glas halten konnte. Er war am Abend noch einmal zur Krankenstation gekommen um Therese zu besuchen. Er wollte ihr zu trinken geben. Aber es war kaum mehr als das Benetzen der Lippen möglich, Therese war sehr schwach. „Du musst jetzt Wiedersehen sagen, sie braucht viel Schlaf“, sagte Doctor Allister und begleitete Adili aus dem Raum. Dem Jungen liefen Tränen über das Gesicht.
Sie begruben das zarte Mädchen neben ihrer Mutter. Adili hatte geholfen den Spruch in eine Holztafel zu stemmen. O Lord, much too early, thou decision. In der Zwischenzeit sprach Adili ganz passabel Englisch und verstand viel von dem, was der Priester an Thereses Grab sprach. Er konnte sich darauf aber nicht konzentrieren. Seine Gedanken waren bei dem kleinen Mädchen. Seine Gefährtin, unvorstellbar weit weg und doch so nahe. Nur ein paar Schritte trennten ihn von ihr und doch die unglaublich riesige Schwelle zwischen Leben und Tod, die so schnell überschritten war und unwiderruflich. Adili wusste, dass Therese und ihr Vater Pete nicht an die Ahnen glaubten. Sie sprachen immer vom Himmel, der den guten Menschen als Paradies offenstand. Aber Therese war für Adili nun ein Teil der Ahnen, die aus einer anderen Welt - verborgen wie durch einen unsichtbaren Vorhang aus Wolken, Luft, Wasser und Feuer - zu den Lebenden sprachen, sie beobachteten und beeinflussten. Adili also wusste Therese immer um sich, auch wenn ihr zarter Körper in diesem Erdloch auf dem Hügel hinter der Missionsstation lag.
-V-
1964
Ein junger Mann stand da am Wegesrand. Adili war nun dreizehn Jahre alt. Er ließ den Blick schweifen. Weite. Nichts als wüstenhafte Leere. Dazwischen lagen die Sträucher der Savanne. Hohes Gras in einer Senke. Dort unten lag die Siedlung. Sein Dorf. Mama Amali - wie lange hatte er sie nicht mehr gesehen? Es hatte unzählige gegeben Nächte, in denen er sich gewünscht hätte, seinen Tag mit ihr zu teilen. Er war seiner Mutter unendlich dankbar. Sie hatte ihn einst mit den beiden Engländern auf die Mission ziehen lassen. In stillen Nächten oder im Gespräch mit seiner Schulgefährtin Therese hatte er anfangs ab und an darüber nachgedacht, ob Amali ihn vielleicht auch deshalb hatte ziehen lassen, damit sie selbst wieder zurück in die dörfliche Gemeinschaft konnte. Er kannte bis zu seinem Auszug kein anderes Leben als das der weitestgehenden Isolation. Für ihn waren lange, stille Abende normal. Für Adili war es sonnenklar, dass Amali seine Mutter war und damit das Zentrum seines Kosmos’. Aber Amali hatte vor der Geburt des Zaubermenschen ein anderes Leben geführt. Adili wusste dies. Nicht als ganz kleiner Junge, aber bevor er auszog, um das Lesen und Schreiben zu lernen, da wusste er es schon. Sie war Teil der dörflichen Gemeinschaft gewesen. Und schuldig hatte sich Adili in den stillen Nächten immer wieder gefühlt, denn er wusste, dass es der Zauber war, der auf ihm lastete, der ihr die Teilhabe am Dorfleben verwehrte. Therese hatte ihm gesagt: „Und wenn schon, du Dummkopf… auch wenn deine Mom dich nur hat gehen lassen, damit sie selbst wieder im Dorf leben kann, sie hat dich gehen lassen! Und du hast nun die Möglichkeit, zu lernen, das Leben draußen kennenzulernen.“ Da hatte Adili damals genickt, sich gefreut und erkannt, dass Therese Recht hatte.
Er nahm sein Bündel. Noch immer hatte er die Seite aus dem Magazin bei sich. Aber mittlerweile auch zwei Bücher. Ein leeres mit vielen unbeschriebenen Seiten und eine Bibel. Die hatte ihm Pete Williams zum Abschied mitgegeben. Er wusste, dass er Adili nicht immer auf der Mission halten würde können. Und er wusste, dass dies auch gut so war. Adili sollte nun in seiner Siedlung das Wissen nutzen. Williams und McAllister aber waren sich nicht ganz sicher, wie man den jungen Burschen aufnehmen würde. Er war zwar nun in der Lage, Texte zu lesen und Briefe zu schreiben. Er konnte den Alten den Lauf der Jahreszeiten erklären, Rechenaufgaben durchführen und hatte ein wenig Ahnung von der Biologie. Er hatte McAllister zugesehen wie man Wunden stillte, was man gegen manch Krankheit tun konnte. Aber er war noch immer der weiße Adili, der Zaubermensch. Würde ihn das nicht weiterhin zum Außenseiter machen? Vielleicht hätte ich mitkommen sollen, hatte Williams gedacht, als er Adili an der Straße absetzte, die dem Dorf am nächsten Lag. Aber der Junge hatte darauf bestanden, die letzten Schritte zurück selbst zu gehen.
Er sah die Hütten und die Zäune aus Dornengestrüpp. Dahinter hielten sie nachts das Vieh, sicher vor wilden Tieren wie Hyänen oder Leoparden. Wie lange war es her, dass er diesen Weg zum letzten Mal hinabgestiegen war. Vor seiner Zeit auf der Missionsstation hatte Adili überhaupt kein Gefühl für Zeit gehabt. Kalender oder Uhren, das waren Errungenschaften, die sie in ihrem kleinen Dorf nicht brauchten. Man richtete sich noch immer nach dem Lauf der Sonne und des Mondes.
Da, wo er die Lehmhütte seiner Mutter vermutet hatte, war ein leerer Platz. Amali war also wieder in die Siedlung zurückgezogen. Adili, der mittlerweile fast erwachsen war und oft dachte wie ein Erwachsener, freute sich für seine Mutter. Es war ihr also gelungen, nach seinem Fortgang wieder Teil der dörflichen Gemeinschaft zu werden.
Kinder spielten vor dem Dorf. Kleine Kinder. Er hatte sie noch nie gesehen. Sechs lange Jahre war er fort gewesen. Ohne Nachricht von seiner Mutter und ohne einen einzigen Besuch im Dorf. Aus dem Kind war ein junger Mann geworden. Und doch, da war sich Adili sicher, würden sie ihn alle erkennen. Sofort und augenblicklich.
Als die spielenden Kinder ihn bemerkten, wie er mit seinem Bündel auf dem Rücken, einen langen Stab in der Hand - so wie es sich für einen Mann gehörte - den Weg entlangkam, rannten sie aufgebracht davon. Er konnte ihr Quieken hören, ihre Aufregung sehen und spüren. Ein Weißer, riefen sie. Aber sie erkannten sofort, dass es kein echter Mzungu war, niemand, der aus England oder sonst wo in Europa stammte. Es war ein weißer Schwarzer.
Adilis Schritte wurden langsamer als er sich den ersten Hütten näherte, wusste er doch von früher, dass er im Dorf eigentlich nichts verloren hatte. Ein von den Ahnen verwunschener Zaubermensch brachte Unglück und stand außerhalb der Gesellschaft. Aber sollte er nun warten, bis man ihn einließ? Und außerdem hatte Williams ihn gelehrt, dass der Unfug mit den Verhexungen nicht wahr war. Adili hatte Selbstvertrauen getankt. Er konnte nun lesen und das, so wusste er von früher, konnten im Dorf nur zwei: der Krieger Hatari und der Dorflehrer.
Aber Adili hatte weit mehr gelernt als nur die Fertigkeit des Lesens und Schreibens. Er wusste um die vielen Dinge, die da draußen geschahen. Was die Engländer in Afrika taten. Er war ein gottesfürchtiger Mensch geworden. Medizin und Pflanzenkunde gehörten ebenso zu seinen Lerngebieten wie die Geographie und die Mathematik. Adili fühlte sich stark genug, den Weg ins Dorf zu wagen.
Und da stand er nun inmitten einer Meute kleiner Kinder, die ihn aufgeregt und neugierig bestaunten. Keines dieser Kinder war sechs Jahre alt oder älter. Aber ein Mädchen rief aufgeregt: „Das ist der Zaubermensch von dem Mama Amali erzählt hatte!“ Das Mädchen war etwas älter als die anderen und Adili sprach sie direkt an: „Wo ist Mama Amali?“
Sie zuckte mit den Schultern. Wandte sich dann wieder ab um zu gehen. Es war der Kleinen sichtlich unangenehm, dass sie direkt von Adili angesprochen worden war.
Einige Meter von ihm entfernt, drehte sie sich noch einmal um. „Kommt!“, rief sie den anderen Kindern zu, „schnell, schnell, wir müssen die Leute warnen.“ Dann wandte sie sich an Adili: „Mama Amali ist bei den Ahnen.“
Im Dorf war zu dieser Zeit nichts los. Die Frauen waren in den Strohhütten, bereiteten das Essen zu. Manche Frau half beim Hüten des Viehs. Und die Männer waren allesamt draußen unterwegs, das Vieh zu versorgen. Adili stand mit einem Mal wieder alleine auf dem staubigen Platz. Es fühlte sich schrecklich an als der Satz des Mädchens sein Innerstes erreichte. Amali war bei den Ahnen. Seine Mutter hatte die Welt der Ahnen erreicht und war damit von hier gegangen. Gestorben, ohne ihn noch einmal zu Gesicht bekommen zu haben. Er hatte sich nicht von ihr verabschieden können. Wann war es geschehen? Adili musste vieles erfragen, wusste aber nicht, wer bereit war, ihm zu helfen, da er immer noch eine Art Aussätziger war.
Hatari stand plötzlich vor ihm. Er war wie aus dem Nichts heraus erschienen. Der stolze Krieger war alt geworden. Er wirkte schwach und sah verletzlich aus. „Adili“, sagte er fast sanft und freundlich. „Du hast den Weg zurück ins Dorf gefunden.“
Adili war erschrocken, dass der mächtige Hatari ihn so direkt ansprach. Es erinnerte ihn plötzlich an damals, als die beiden Engländer gekommen waren und um die Erlaubnis baten, den Jungen in die Schule mitnehmen zu dürfen. Wie viel Zeit war doch verstrichen - zumal aus den Augen eines jungen Menschen! Hatari begann ungefragt zu sprechen. „Sie kam ins Dorf zurück, nachdem du mit dem Missionar gegangen warst. Anfangs dachten wir, sie würde wieder aufblühen. Wir gaben Amali Aufgaben und dennoch war ihr Sohn nicht mehr bei ihr. Viele Leute aus dem Dorf hatten noch immer Angst vor ihr, weil sie dem Zaubermenschen das Leben geschenkt hatte. Ich hatte in der Zwischenzeit noch einmal sehr lange mit dem Missionar gesprochen und verstanden, dass du zwar anders bist als alle anderen, aber dass deine Zauberkraft wohl geringer ist, als wir vermuteten. Daher bemühte ich mich nach Kräften, Amali zu helfen. Adili, was ich dir nun sage, das wirst du vielleicht nicht verstehen. Sie ist gestorben, weil du nicht mehr bei ihr sein konntest. Amali kehrte zurück ins Dorf. Ihr Herz aber war immer bei dir. Eines Tages wurde sie krank, bekam hohes Fieber und starb. Es hat ihr das Herz gebrochen, dass du fort warst.“