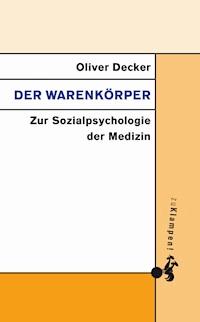Zeitschrift für kritische Theorie / Zeitschrift für kritische Theorie, Heft 42/43 E-Book
Oliver Decker
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: zu Klampen Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die »Zeitschrift für kritische Theorie« ist ein Diskussionsforum für die materiale Anwendung kritischer Theorie auf aktuelle Gegenstände und bietet einen Rahmen für Gespräche zwischen den verschiedenen methodologischen Auffassungen heutiger Formen kritischer Theorie. Sie dient als Forum, das einzelne theoretische Anstrengungen thematisch zu bündeln und kontinuierlich zu präsentieren versucht. Mit Beiträgen von: - Oliver Decker - Helmut Heit - Frank Jablonka - Hyun Kang Kim - Philipp Lenhard - Schierry Weber Nicholsen - Konstantinos Rantis - Ulrich Ruschig - Hans-Ernst Schiller - Rosalvo Schütz - Dirk Stederoth - Christoph Türcke
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zeitschrift für kritische Theorie
Heft 42–43/2016
herausgegeben von Sven Kramer und Gerhard Schweppenhäuser
Zeitschrift für kritische Theorie, 22. Jahrgang (2016), Heft 42–43
Herausgeber: Sven Kramer und Gerhard Schweppenhäuser
Geschäftsführender Herausgeber: Sven Kramer, Leuphana Universität Lüneburg, Institut für Geschichtswissenschaft und Literarische Kulturen
Redaktion: Roger Behrens (Hamburg), Thomas Friedrich (Mannheim), Sven Kramer (Lüneburg), Gerhard Schweppenhäuser (Würzburg), Dirk Stederoth (Kassel)
Redaktionsassistenz: Julia Menzel
Korrespondierende Mitarbeiter: Rodrigo Duarte (Belo Horizonte), Jörg Gleiter (Berlin), Christoph Görg (Kassel), Frank Hermenau (Kassel), Fredric Jameson (Durham, NC), Per Jepsen (Kopenhagen), Douglas Kellner (Los Angeles, CA), Claudia Rademacher (Bielefeld), Gunzelin Schmid Noerr (Mönchengladbach), Jeremy Shapiro (New York, NY)
Redaktionsbüro: Alle Zusendungen redaktioneller Art bitte an das Redaktionsbüro:
Zeitschrift für kritische Theorie
Leuphana Universität Lüneburg
z. Hd. Prof.Dr.Sven Kramer
Scharnhorststraße 1, Geb. 5
D-21335 Lüneburg
E-Mail: [email protected]
Web: www.zkt.zuklampen.de
Erscheinungsweise: Die Zeitschrift für kritische Theorie erscheint einmal jährlich als Doppelheft. Preis des Doppelheftes: 32,– Euro [D]; Jahresabo Inland: 28,– Euro [D]; Bezugspreis Ausland bitte erfragen. Berechnung jährlich bei Auslieferung des Heftes. Das Abonnement verlängert sich automatisch, wenn die Kündigung nicht bis zum 15.11. des jeweiligen Jahres erfolgt. Fragen zum Abonnement bitte an folgende Adresse:
Germinal GmbH,
Verlags- und Medienhandlung,
Siemensstraße 16,
D-35463 Fernwald,
E-Mail: [email protected]
Tel.: 0641/41700
Fax: 0641/943251
Umschlagentwurf: Johannes Nawrath
Layout und Satz: Simon Gogolin; Fakultät Gestaltung, Hochschule für angewandte Wissenschaften, Würzburg-Schweinfurt
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2017
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ›http://dnb.ddb.de‹ abrufbar.
Aufnahme nach 1995, H. 1; ISSN 0945-7313; ISBN: 978-3-86674-499-8
Die Zeitschrift für kritische Theorie erscheint mit Unterstützung der Leuphana Universität Lüneburg und der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt.
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Vorbemerkung der Redaktion
ABHANDLUNGEN
Dirk Stederoth
Eingemessene Bildung. Zur Humankapitalisierung der Bildung und ihrer totalen Verwaltung
Hans-Ernst Schiller
Über das Recht hinaus. Philosophische Aspekte von Gewalt und Frieden
Philipp Lenhard
Staatskapitalismus und Automation. Einblicke in die Kritik der politischen Ökonomie im Spätwerk Herbert Marcuses und Friedrich Pollocks
Ulrich Ruschig
Über den Marxismus der Kritischen Theorie. Horkheimers Aufnahme und Weiterführung von Engels’ »Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft«
Helmut Heit
Das Subjekt der Befreiung. Identitätskritik bei Adorno und Butler im Lichte Nietzsches
Frank Jablonka
In dubio pro mendacio? Kritische lügenhafte Überlegungen zur kritischen Theorie der Gesellschaft
Rosalvo Schütz
Negative Dialektik als positive Philosophie: Wahlverwandtschaften zwischen Schelling und Adorno
Hyun Kang Kim
Souveränität und Allegorie im Trauerspielbuch Walter Benjamins
Shierry Weber Nicholsen
Listening as the Work of Co-Composing: A Note on the Actuality of Adorno’s Musical Thought
EINLASSUNGEN
Die Mitte – ein mythischer OrtOliver Decker im Gespräch mit Christoph Türcke
Dirk Martin
Der Sozialismus als perfektionistischer Liberalismus. Zu Axel Honneths »Idee des Sozialismus«
Konstantinos Rantis
Die Krise der gegenwärtigen griechischen Gesellschaft. Ihre philosophische Kritik und die Umrisse eines interdisziplinären Forschungsprojekts
Kritische Theorie – Neue Bücher des Jahres 2015 in Auswahl
Autorinnen und Autoren
Anmerkungen
Vorbemerkung der Redaktion
Bereits am Vorabend des Nationalsozialismus untersuchte das Frankfurter Institut für Sozialforschung, warum die soziale Revolution ausblieb und die Menschen sich mit Herrschaft identifizierten, anstatt sie zu stürzen. Später, in den USA, fragten die Sozialforscher, was Menschen für antidemokratische Propaganda empfänglich macht. Mit der »F-Skala« wiesen sie auf Charakterdispositionen hin, die bei der Selbstunterhöhlung demokratischer Gesellschaften beteiligt sind. Zur Struktur eines autoritätsgebundenen Charakters gehöre die Identifikation mit der Macht schlechthin, schrieb Adorno damals. Ende der 1950er Jahre sagte er, das »Nachleben des Faschismus« in der Demokratie sei gefährlicher als offen antidemokratische Tendenzen. Mitte der 1960er Jahre veränderte sich die Lage hierzulande mit Gründung der NPD. Adorno, für den »der wiedererwachende Nationalismus« eine der Hauptgefahren darstellte, reagierte u.a. mit dem Vorschlag, »mobile Erziehungsgruppen und -kolonnen […] aufs Land« zu schicken, um dort politischen Unterricht zu leisten. – Was Anfang der 1950er Jahre unter dem Stichwort Authoritarian Personality untersucht wurde, hat bis heute in Deutschland traurige Aktualität. Nach der Eingemeindung der DDR in die BRD führte Wolfgang Pohrt für das Hamburger Institut für Sozialforschung eine Untersuchung durch, die der Frage nachging, ob es Anfang der 1990er Jahre in der Bundesrepublik »eine Disposition zum Faschismus als Gemütsbewegung« gebe. In den Aussagen, denen die Probanden damals zustimmen oder widersprechen konnten, kamen Ressentiments gegen freiheitliche Lebensführung, Ausländer, Asylbewerber und Homosexuelle sowie gegen die Abschaffung europäischer Grenzen zum Ausdruck. Auch die Sorge um das deutsche Weihnachtsfest wurde angesprochen. Bald darauf, 1994, veröffentlichte Kurt Lenk seine Studien zur Ideologie des politischen Konservatismus unter dem Titel Rechts, wo die Mitte ist. Diese Titelzeile scheint auch für die Bewusstseinslage jener Bevölkerungsgruppen zuzutreffen, die Oliver Decker von der Universität Leipzig seit Jahren untersucht. Im Sommer 2016 erschien im Gießener Psychosozial-Verlag das Buch Die enthemmte Mitte. Autoritäre und rechtsextreme Einstellungen in Deutschland, das er zusammen mit Johannes Kies und Elmar Brähler herausgegeben hat. Wofür gehen unsere Landsleute heute auf die Straße? Über die neuesten Entwicklungen sprachen Oliver Decker und Christoph Türcke für die Zeitschrift für kritische Theorie.
In einer weiteren Einlassung setzt sich Dirk Martin mit Axel Honneths Vorschlag auseinander, »die Idee des Sozialismus als Gerechtigkeitstheorie fortzuführen« und prüft, inwieweit dadurch die Perspektive der radikalen Kritik spezifisch kapitalistischer Herrschaftsverhältnisse »preisgegeben wird«. Danach zeigt Konstantinos Rantis, dass Griechenlands unvollständige Modernisierung die Basis seiner gegenwärtigen sozialen Krise ist und stellt einen kritisch-theoretischen Forschungsansatz vor, der Wirtschaftsethik und Religionssoziologie auf historische und soziale Phänomene des Landes bezieht.
In den Abhandlungen analysiert Dirk Stederoth die Vorgeschichte sowie die systematischen Implikationen der derzeitigen Bildungspolitik und -forschung, wobei sich das Humankapital sowie die totale Verwaltung als zentrale Hintergrundideen in der aktuellen Durchsetzung von Bildungsstandards zeigen. Hans-Ernst Schiller thematisiert den Zusammenhang von Gewalt und Frieden, indem er neben rechtsphilosophischen Auseinandersetzungen mit der Gewalt – etwa bei Kant – auch anthropologische – etwa bei Fromm – aufgreift und sie moralphilosophisch einordnet. Philipp Lenhard ediert und kommentiert das Protokoll eines Gesprächs zwischen Marcuse und Pollock aus dem Jahr 1960 und rekonstruiert in einem Kommentar die unterschiedlichen Positionen innerhalb der Kritischen Theorie zu Fragen der Ökonomie und der aktuellen politischen Orientierung. Ulrich Ruschig liest Horkheimers »Autoritärer Staat« als Kritik einer auf Engels zurückgehenden Verkürzung der Marx’schen Kritik kapitalistischer Formbestimmungen gesellschaftlicher Arbeit, die den entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung kritischer Theorie durch die negative Geschichtsphilosophie der Dialektik der Aufklärung geleistet habe. Helmut Heit untersucht das Verhältnis von Subjektkritik und Emanzipation bei Adorno und Butler und nimmt Linien auf, die von Kant über Marx bis zu Nietzsche führen. Frank Jablonka fragt – mit Konzepten aus der Sprachwissenschaft und mit Blick auf Augustinus, Machiavelli, Kant, Marx, Nietzsche, Lenin, Adorno und Habermas –, wie die Lüge zur Sicherung von realer und symbolisch-imaginärer Ordnung bzw. als Mittel der Delegitimierung und der Bekämpfung herrschaftlicher Ordnung funktioniert. Im Anschluss an Manfred Frank und Alfred Schmidt entfaltet Rosalvo Schütz Verbindungen zwischen Schelling und Adorno im systematischen Zusammenhang von Naturbegriff, Subjekt- und Rationalitätskritik und der Konzeption eines denkunabhängigen Seins mit Aufwertung der Sinnlichkeit. Hyun Kang Kim legt das konstitutive Verhältnis von Souveränität und Allegorie in Benjamins Trauerspielbuch dar und interpretiert dabei – im Rückgriff auf Lacan und in Abgrenzung von Schmitt – den Souverän als Allegoriker. Shierry Weber Nicholsen rekonstruiert Adornos Theorie vom Hören neuer Musik im Spannungsfeld von Analyse, ästhetischer Erfahrung und kreativer Selbsttätigkeit der Rezipienten.
In der Redaktion der Zeitschrift für kritische Theorie hat es eine Neuformation gegeben. Wolfgang Bock ist seit Sommer 2015 nicht mehr dabei; dafür arbeiten nun seit Herbst 2015 der Philosoph Dirk Stederoth und seit Sommer 2016 die Soziologin Susanne Martin und der Soziologe Martin Niederauer mit.
ABHANDLUNGEN
Dirk Stederoth
Eingemessene Bildung
Zur Humankapitalisierung der Bildung und ihrer totalen Verwaltung
Unser Bildungssystem erfährt in den letzten 20 Jahren eine der wohl tiefgreifendsten Umwälzungen in seiner Geschichte, insofern deren Eingriffe von einer Systematik geprägt sind, die umfänglicher kaum vorstellbar ist. Wie ein sich selbst fortspinnendes Netz breiten sich die Strukturen dieser sogenannten Reform in alle Winkel des Bildungssektors aus und etablieren bis in diese Winkel hinein eine scheinbar unentrinnbare Faktizität, gegen die aufzubegehren immer sogleich mit dem Vorwurf des Kontrafaktischen konfrontiert. Es ist diese Passung, diese gleichsam wundersame Konformität, die für das rasante Errichten dieses Neubaus verantwortlich ist – ein Neubau, in dem die Kritik an einem errichteten Stockwerk bereits an dem Boden des neuerrichteten verhallt.
Ein durchgängig systematisch errichteter Neubau der Bildung klingt zunächst alles andere als problematisch, zumal am Beginn der Bauarbeiten die Diagnose eines Trümmerhaufens bezüglich der wissenschaftlichen Bestimmung des Bildungsbegriffs steht, wenn Heinz-Elmar Tenorth in seiner Bestandsaufnahme von 1997 davon spricht, dass der Bildungsbegriff »nahezu inflationär in Gebrauch«1 sei und sich in Bezug auf diesen »eine unübersehbare Heteronomie von Betrachtungsweisen konstatieren läßt.«2 Da scheint die errichtete Homogenität als ein Befreiungsschlag für eine Bildungslandschaft, die nunmehr, an klar begründbaren und empirisch fundierten Effektivitätskriterien orientiert, endlich den internationalen Vergleich antreten kann. Allein, es bleibt zu fragen, ob das Fundament dieses neuen Gebäudes dem des berühmten Turmes gleicht, dessen Stadt als Namensgeber für den Startschuss dieser Entwicklung herhalten musste: PISA.
Um zu klären, inwieweit dieses neue Bildungsgebäude auf einem erodierenden Fundament gebaut ist, sei im Folgenden diese Entwicklung in vier Schritten untersucht: einmal im Hinblick auf ihre historischen Hintergründe im Begriff des Humankapitals, zweitens in Bezug auf ihre Zementierung in der Bestimmung von Bildungsstandards, drittens mit dem Fokus auf ihre Realisierung in einer totalen Verwaltung und schließlich in Aussicht auf die Folgen für diejenigen, die von ihr am unmittelbarsten betroffen sind: Menschen.
1. Von Sputnik bis PISA – eine historische Dimensionierung
Wie bereits angedeutet, wird als Startschuss für die Errichtung dieses Neubaus gemeinhin die Ende der 1990er Jahre von der OECD in Auftrag gegebene Vergleichsstudie PISA (Programme for International Student Assessment) angesetzt, die in der Tat in dieser Form ein Novum darstellte, insofern zum ersten Mal die Bildungssysteme der 28 OECD-Staaten (und vier weiterer) einem empirischen Vergleich unterzogen wurden.3 Der genauere Blick offenbart jedoch, dass die Hintergründe für diese Studie bis in die späten 1950er Jahre zurückreichen und der sogenannte »PISA-Schock« letztlich im »Sputnik-Schock« und den Reaktionen auf ihn gründet.
Wie Daniel Tröhler jüngst herausarbeitete,4 bestanden die Reaktionen der USA auf diesen Sputnik-Schock nicht nur in der Gründung der NASA, sondern darüber hinaus in einer Bildungsoffensive, die sich im »National Defense Education Act (NDEA)« (verabschiedet am 2.9.1958) ausdrückt.5 Diese mit hohem finanziellem Aufwand unterstützte Offensive fand ihre internationale Fortsetzung in der Gründung eines OEEC-Komitees (»Committee for Scientific and Technical Personnel, CSTP«), zu dessen wichtigsten Aufgaben die Entwicklung der eher landwirtschaftlich orientierten südeuropäischen Staaten hin zur Industrialisierung zählte. Das entsprechende Projekt, das »Mediterranean Regional Project (MRP)«, machte dann deutlich, was mit dem im Jahre 1960 vollzogenen Übergang von der OEEC (Organization for European Economic Co-operation) zur OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) neben einer Erweiterung der Mitglieder eigentlich intendiert war. Wie Tröhler zeigt, war »›development‹ nicht einfach als Weiter-Entwicklung von Bestehendem gedacht […], sondern als Anpassung an ein Modell, dem gefolgt werden sollte. […] Das Vehikel war der Ausbau und die Umgestaltung des Bildungssystems nach den Vorgaben der OECD.«6 Diese Umgestaltung wurde von der OECD gezielt durch Ausbildung von nationalen Bildungsplanern in Schulungsprogrammen durchgesetzt, in denen die Teilnehmer auf eine konforme Strategie in der Bildungsplanung geeicht wurden.7 Diese Form der indirekten Einflussnahme auf nationale Entwicklungen im Bildungsbereich zeigte ihre Früchte nicht nur etwa in den Bildungsreformen der 1970er Jahre in der BRD, sondern insbesondere seit der mit dem PISA-Schock beginnenden Umgestaltung des Bildungswesens in unserer Gegenwart.8
Doch worin bestand die Bildungstheorie der OECD, in die die nationalen Bildungssysteme eingemessen werden sollten? Aufschlussreich für diese Frage sind die Beiträge einer OECD-Konferenz: »Policy Conference on Economic Growth and Investment in Education«, die vom 16.-20. Oktober 1961 in Washington stattfand, stellen deren Beiträge doch ein frühes Zeugnis9 der gegenwärtig so umfänglich durchgeführten Engführung von Bildungs- und Humankapitaltheorie dar,10 was sich in folgendem Passus deutlich ausdrückt:
»Heute versteht es sich von selbst, daß auch das Erziehungswesen in den Komplex der Wirtschaft gehört, daß es genauso notwendig ist, Menschen für die Wirtschaft vorzubereiten wie Sachgüter und Maschinen. ›Das Erziehungswesen steht nun gleichwertig neben Autobahnen, Stahlwerken und Kunstdüngerfabriken. Wir können nun, ohne zu erröten und mit gutem ökonomischen Gewissen versichern, daß die Akkumulation von intellektuellem Kapital der Akkumulation von Realkapital an Bedeutung vergleichbar – auf lange Dauer vielleicht sogar überlegen – ist.‹«11
Den Grundsätzen der Humankapitaltheorie ganz entsprechend, wird hier das »intellektuelle Kapital« dem »Realkapital« (also »Autobahnen, Stahlwerken« etc.) gleichgesetzt und zu einer ökonomisch verrechenbaren Größe umgedeutet. Nicht nur die Bildungsakteure erscheinen vor dem Hintergrund einer solchen Gleichstellung in einem anderen Licht, wenn von ihnen als »Produktionsfaktor Lehrer« und »Rohmaterial Schüler«12 die Rede ist, sondern auch der Bildungsbegriff wird in diesem Zusammenhang auf die flexible ökonomische Nutzung hin neu orientiert:
»Der Begriff der Allgemeinbildung verlangt aber selbst nach einer neuen Definition. […] Das Ziel muß sein, mit der Allgemeinbildung die Befähigung zu immer neuer Anpassung, zum rationalen Verarbeiten von neuen Situationen zu schaffen und flexible Denkschemata für alle großen Wissenschaftsrichtungen zu stiften.«13
Die Nähe dieser Neudefintion zu der pragmatischen Ausrichtung des Kompetenzbegriffs in unseren gegenwärtigen Debatten, die später noch thematisch werden wird, ist nicht der einzige Faktor, der die Aktualität dieser frühen OECD-Dokumente belegt. Eine wichtige weitere Komponente der Humankapitalisierung der Bildung ist die statistische Erhebung der verrechenbaren Bildungskapitalgrößen, womit eine vollständige Einbeziehung des Bildungswesens in eine ökonomische Gesamtbilanz allererst möglich wird:
»Die Erziehungsplanung sollte ein integraler Bestandteil jeder nationalen Wirtschaftspolitik werden. […] Ein Orientierungssystem von statistischen Standardziffern auszuarbeiten, wie es die Nationalökonomie für den Vergleich von Wirtschaftsentwicklung und Staatsausgaben getan hat, ist als eine der ersten und dringendsten Aufgaben der Erziehungsplanung zu betrachten.«14
Es liegt auf der Hand, dass der seit 2000 jährlich erscheinende Zahlenkoloss Education at a Glance. OECD Indicators15 die internationale Verwirklichung dieser Forderung nach einem standardisierten statistischen Orientierungssystem darstellt.
Vor diesem Hintergrund sind PISA und die gegenwärtige Neustrukturierung des Bildungswesens lediglich die konsequente Umsetzung eines Plans, der als Folge des Sputnik-Schocks erarbeitet wurde und über lange Jahre schrittweise Eingang in die nationalen Bildungssysteme erhalten hat. Da hier nicht die ganze Entwicklung in ihren einzelnen Schritten nachgezeichnet werden kann, sei lediglich auf einen Markstein eingegangen, der für die bundesdeutsche Bildungslandschaft der 1970er- und 1980er-Jahre enorm einflussreich war: den vom Deutschen Bildungsrat erarbeiteten und im Jahre 1970 verabschiedeten Strukturplan für das Bildungswesen.16
Dieses umfangreiche Dokument entfaltet eine planende Gesamtperspektive, die vom Begriff des Lernens über das Curriculum und die Entwicklung der Schulzweige bis hin zur Lehrerbildung, Bildungsverwaltung und -finanzierung reicht. In expliziter Opposition zur Tradition geisteswissenschaftlicher Pädagogik17 wurden die Ziele schulischer Bildung mehr an den für die gesellschaftlichen Anforderungen einschlägigen Qualifikationen orientiert, wobei die Forderung nach einem wissenschaftsorientierten und mithin lebenslangen Lernen die verstärkte Förderung eines Lernens des Lernens implizierte.18 Im Fokus dieser Forderungen stand dabei die Bestrebung, die Schüler und Erwachsenen auf die flexiblen Anforderungen einer rasanten technologischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklung vorzubereiten, der sie nur dann gewachsen seien, wenn sie sich permanent an diese Entwicklungen durch eigenständige Fortbildung anpassen:
»Der Wissenschaftsbestimmtheit des Lernens entspricht formal der Grundsatz vom Lernen des Lernens. Die Bildungsgänge vermitteln nicht nur Kenntnisse und Fertigkeiten, sondern auch die Fähigkeit, immer wieder neu zu lernen […] Die gezielte Förderung der Fähigkeit des Lernens […] wird auch gefordert durch das Tempo der gesellschaftlichen, technisch-wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung sowie durch die Veränderungen der Lebensumstände und der Arbeitsverhältnisse. Die Veränderungen machen Weiterbildung notwendig, sie können auch Lust zum ständigen Weiterlernen wecken, das jedoch selbst gelernt worden sein muß.«19
Diese Forderung nach einer »lustvollen« Selbstanpassung an gesellschaftliche Entwicklungen, die im Kern auf eine selbstständige berufliche Weiterbildung ausgerichtet ist, vollzieht so im Hintergrund eine den OECD-Ideen ganz konforme Amalgamierung von Allgemeinbildung und beruflicher Bildung, worauf auch schon Heydorn in seiner Kritik am Strukturplan hingewiesen hat: »Durch die Wissenschaftlichkeit der Lernprozesse wird der Widerspruch von Allgemeinbildung und beruflicher Bildung über die Methode aufgehoben.«20 Diese Engführung wird uns im weiteren Verlauf noch bei der gegenwärtigen Bestimmung des Kompetenzbegriffs wieder begegnen. Zwei Aspekte des Strukturplans, die uns ebenfalls noch beschäftigen werden, können hier jedoch nicht weiter ausgeführt werden: der Zusammenhang von Bildungsreform und Reform der Verwaltungsstruktur21 sowie die Forderung datenbasierter Bildungsplanung.22
Insofern lassen sich in mehrerer Hinsicht Kontinuitäten zwischen den frühen Bildungsreformbestrebungen der OECD und dem Strukturplan feststellen: die Orientierung von Bildung an gesellschaftlichen, ökonomischen und technischen Anforderungen; eine Engführung von Allgemeinbildung und flexibler beruflicher Anpassungsfähigkeit; die Forderung nach datenbasierter Bildungsplanung und einer ihr entsprechenden Verwaltung. In diesem Sinne kann man mit Lederer feststellen, dass der Strukturplan
»letztlich den Beginn einer sich bis heute stark verschärft habenden ›Ökonomisierung von Bildung‹ [markiert], verstanden als deren überwiegend instrumentell-funktionale Ausrichtung entlang beruflicher, mikro- und makroökonomischer Zwecksetzungen, die sowohl auf das Verständnis des Bildungsbegriffes selbst als auch auf die Aufgabenstellung der Institutionen des Bildungswesens und deren Organisationsformen zielt.«23
Inwieweit man hinsichtlich dieser Tendenz von einer Verschärfung in unserer Gegenwart sprechen kann, sei nun an einem Dokument untersucht, das für die gegenwärtige Bildungsreform einen ähnlichen Stellenwert einnehmen könnte wie der Strukturplan für die 1970er- und 1980er-Jahre: die Expertise Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards24, die 2003 vorgestellt und 2007 publiziert wurde.
2. Bildungsstandards als Grundlage standardisierter Bildung
Anlass dieser vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 2002 in Auftrag gegebenen Expertise war das schlechte Abschneiden deutscher Schulen bei den internationalen Vergleichsstudien TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) und PISA sowie die als Reaktion auf diese Studien von der Kultusministerkonferenz (KMK) bereits 2002 verabschiedeten Bildungsstandards in einigen Fächern. Aufgabe diese Expertise war es demgemäß, »das Konzept der Bildungsstandards fachlich zu klären und eine Rahmenkonzeption dafür vorzustellen, wie Bildungsstandards für das deutsche Schulsystem angelegt sein sollten und wie sie entwickelt und genutzt werden könnten. Dabei soll die internationale bildungspolitische und bildungswissenschaftliche Diskussion berücksichtigt werden.«25 Schaut man dann in der Expertise bei der Definition des Begriffs »Standard« nach, welche bildungswissenschaftliche Diskussion hier gemeint ist, so wird man (nach einer Darstellung der Verwendung von Standards in Großbritannien) unmissverständlich auf eine Quelle hingewiesen, die vor dem Hintergrund des im ersten Abschnitt Erläuterten durchaus interessant ist: die »sehr einflussreiche Schrift ›Schule und Qualität‹«26, die einen internationalen OECD-Bericht aus dem Jahre 1991 (das Original erschien 1989) darstellt.27
Von den drei Forderungen, die dieser OECD-Bericht hinsichtlich der Standards aufstellt, sind die zwei ersten besonders aufschlussreich:
»a) Ein allgemeiner, gesamtgesellschaftlicher Prozeß der Neubewertung und Klärung von pädagogischen Zielen und Wertvorstellungen sollte vorgenommen und Standards darauf begründet werden. […]
b) Statistische Informationen und Indikatoren sollten entwickelt werden, die soweit wie möglich eine echte Diskussion über allgemein anerkannte Fragen erlauben. […]
a) und b) gehen Hand in Hand und verstärken sich gegenseitig.«28
Um den Zusammenhang nochmals klar vor Augen zu führen: Der geforderte »gesamtgesellschaftliche Prozeß der Neubewertung und Klärung von pädagogischen Zielen und Wertvorstellungen« ist also dasjenige, worauf sich Bildungsstandards gründen sollen. Dieser Prozess soll nun allerdings Hand in Hand gehen mit ›Statistischen Informationen und Indikatoren‹, die »eine echte Diskussion« über diese allgemeinen Fragen erlauben. Was hier bereits deutlich anklingt ist die gegenwärtig verstärkt zu verzeichnende Tendenz, Bildungsziele allein aus statistischen Erkenntnissen heraus begründen zu wollen, wobei die Orientierungslinien dieser statistischen Indikatoren an internationalen Standards entlang zu verlaufen haben, was in dem OECD-Bericht unter der Überschrift »Evaluation des gesamten Systems« nochmals deutlich zum Ausdruck gebracht wird: »Ökonomische Indikatoren werden benötigt, um die Effektivität der Ausgaben zu belegen, und noch wichtiger sind Indikatoren für Qualität. Einige meinen, daß es sehr wichtig sei, die nationalen Daten über die verschiedenen Komponenten von Qualität zu bekommen, vorzugsweise in einer Form, die einen internationalen Vergleich erleichtert«29. Dass diese »Einigen« sich letztlich durchgesetzt haben, belegt nicht nur die PISA-Studie, sondern belegen ebenfalls die bereits erwähnten statistischen Berichte Education at a Glance [2000-2015]. OECD Indicators.30
Der Zusammenhang zwischen diesen Tendenzen und der Expertise Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards zeigt sich, wenn deren allgemeine Bestimmung von Standards näher unter die Lupe genommen wird. Diese allgemeine Bestimmung lautet:
»Bildungsstandards, wie sie in dieser Expertise konzipiert werden, greifen allgemeine Bildungsziele auf. Sie benennen die Kompetenzen, welche die Schule ihren Schülerinnen und Schülern vermitteln muss, damit bestimmte zentrale Bildungsziele erreicht werden. Die Bildungsstandards legen fest, welche Kompetenzen die Kinder oder Jugendlichen bis zu einer bestimmten Jahrgangsstufe erworben haben sollen. Die Kompetenzen werden so konkret beschrieben, dass sie in Aufgabenstellungen umgesetzt und prinzipiell mit Hilfe von Testverfahren erfasst werden können.«31
Dies scheint auf den ersten Blick eine typische Form eines wissenschaftlichen Verfahrens zu sein, insofern zunächst allgemeine Ziele bestimmt werden, die dann ihre Konkretion in spezifischen Kompetenzen erfahren, um dann via kompetenzspezifischer Testverfahren die Umsetzung der allgemeinen Ziele zu überprüfen. Schaut man sich dann noch an, dass hier unter allgemeinen Bildungszielen ein »Bild von Individualität als leitend [gilt], in dem […] die Würde des Menschen und die freie Entfaltung der Persönlichkeit oberste Maximen sind«32, dann scheint man der Einschätzung der Expertise recht geben zu müssen, dass Kompetenzen »nichts anderes [beschreiben], als solche Fähigkeiten der Subjekte, die auch der Bildungsbegriff gemeint und unterstellt hatte«33.
Der genauere Blick belehrt jedoch eines Besseren, insofern diese Bestimmung vor dem Hintergrund der konsequenten »Output-Orientierung« gelesen werden muss, die sich die Expertise als Prinzip vornimmt,34 und infolgedessen danach gefragt werden muss, inwieweit sich jene hehren Bildungsziele in testförmige Kompetenzen operationalisieren lassen. Wenn die Expertise gemäß ihrer Output-Orientierung feststellt: »Ohne Ergebniskontrolle würden die Bildungsziele als statische Größen von der tatsächlichen Entwicklung der Schule abgekoppelt werden«35, dann lässt sich vor dem Hintergrund der hierfür notwendigen Operationalisierung allgemeiner Bildungsziele die Frage in umgekehrter Richtung stellen, ob diese Ziele nicht gerade durch eine solche Schwerpunktsetzung auf Testverfahren von der Schulentwicklung abgekoppelt werden, da sich wesentliche Bestandteile dieser Ziele einer testförmigen Operationalisierung möglicherweise gänzlich entziehen. Dieser Frage sei nun etwas näher mit Bezug auf die Mittlerinstanz zwischen allgemeinen Bildungszielen und Testverfahren, den Kompetenzen und Kompetenzmodellen, nachgegangen.
Die Expertise stützt sich auf einen Kompetenzbegriff, der 2001 von Franz E. Weinert in einem Überblicksartikel zur Leistungsmessung in Schulen bestimmt wurde. Er versteht unter Kompetenzen »die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können«36. Diese Definition ist in mehrerer Hinsicht interessant. Zunächst fällt die Fokussierung dieses Kompetenzbegriffs auf das »Problemlösen«37 ins Auge. Dies ist nicht etwa nur deshalb von besonderem Interesse, weil es hier um den Umgang mit Problemen geht, was bei gehöriger Verallgemeinerung des Problem-Begriffs ja noch zureichen könnte, sondern weil die Fokussierung auf die Lösung der Probleme sofort eine Testförmigkeit dieses Kompetenzbegriffs kundtut. Um diese Kritik etwas zuzuspitzen, könnte man sagen, dass ein mündiger Mensch sich weniger dadurch auszeichnet, dass er komplizierten Problemsituationen mit vorschnellen Lösungen begegnet, sondern dass er sie – nur allzu häufig – als Problemsituationen in ihrer Widersprüchlichkeit auszuhalten gelernt hat, um nicht durch überstürzte Lösungen weit schlimmere Problemsituationen hervorzurufen. Eine Fokussierung auf die Lösbarkeit von Problemen beschränkt die Kompetenz auf formalistische Aspekte des Lebens, die in ihrer nur scheinbaren Eindeutigkeit zu eindeutigen Lösungen führen, wobei die nicht-formal sich gestaltenden Teile des Lebens, die in sozialen, politischen und individuellen Beziehungen den wesentlichen Bestandteil darstellen, aus diesem Kompetenzbegriff herausfallen.
Ein zweiter wichtiger Aspekt dieses Kompetenzbegriffs ist, dass er zwei Hauptkomponenten aufweist, wobei die erste die rein »kognitiven« und die zweite die »motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten« betrifft. Hatte Weinert zwischen beiden Komponenten noch keine Abstufung vorgenommen, so stellt die Expertise die kognitive Komponente gerade bezogen auf die Operationalisierbarkeit von Kompetenz in den Vordergrund.38 Verfolgt man über die Expertise hinaus die weitere Entwicklung des Kompetenzkonzeptes, so operiert das DFG-Schwerpunktprogramm »Kompetenzmodelle zur Erfassung individueller Lernergebnisse und zur Bilanzierung von Bildungsprozessen« (geleitet von Eckhard Klieme und Detlev Leutner; Laufzeit von 2007-2013) von vornherein mit einem rein kognitiv orientierten Kompetenzbegriff: »Für das SPP [Schwerpunktprogramm – D.S.] definieren wir Kompetenzen als kontextspezifische kognitive Leistungsdispositionen, die sich funktional auf Situationen und Anforderungen in bestimmten Domänen beziehen.«39 Auch das vom BMBF mit 70 Einzelprojekten reichlich ausgestattete Forschungsprogramm »Kompetenzmodellierung und Kompetenzerfassung im Hochschulsektor (KoKoHs)« (Laufzeit: 2011 bis 2015) bezieht sich auf den Kompetenzbegriff von Weinert, jedoch wird auch hier lediglich die kognitive Komponente in den Blick genommen.40
Nimmt man diese beiden Großprogramme einmal als exemplarisch für die weitere Entwicklung des Kompetenzbegriffs, so kann man bezogen auf die Gleichwertigkeit beider Komponenten, wie sie bei Weinert noch gemeint war, feststellen, dass durch die Anforderungen der Opertionalisierbarkeit des Kompetenzbegriffs eine Halbierung desselben vorgenommen wurde, insofern die »motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten« aufgrund ihrer mangelnden Testförmigkeit nicht mehr in den Blick genommen werden. Detlev Leutner schließlich versucht im rückblickenden Bezug auf das erwähnte DFG-Schwerpunktprogramm diese Komponente dann gänzlich aus dem Fokus zu entfernen, wenn er davon ausgeht, »dass dann, wenn Kompetenzen mithilfe von Tests erfasst werden, neben den kognitiven Anteilen auch affektive Anteile implizit mitgemessen werden.«41 War bereits 2000 in unmittelbarer Reaktion auf die PISA-Studie und dem ihr zugrunde gelegten literacy-Begriff von Rudolf Messner darauf hingewiesen worden, dass mit diesem Begriff die ästhetische und emotionale Dimension von Lesen überhaupt nicht erfasst wird, sondern lediglich dessen kognitiver Aspekt,42 so ist mit Leutners Vorstoß jene Dimension zu einem bloß impliziten Aspekt degradiert.
Doch was bedeutet dies? Nimmt man die Klieme-Expertise ernst, so dienen ja – wie dargelegt – die Testverfahren zur Überprüfung der allgemeinen Bildungsziele. Stellt man nun einen Bezug zwischen diesen Bildungszielen und der aktuellen Reduzierung des Kompetenzbegriffs im Zuge seiner Operationalisierung her, so ergeben sich zwei Möglichkeiten: Entweder wird von der aktuellen Bildungsforschung ernsthaft behauptet, dass für ein Individuum, für das die »Würde des Menschen und die freie Entfaltung der Persönlichkeit oberste Maximen« darstellen, »motivationale, volitionale und soziale Bereitschaften und Fähigkeiten« nur implizit einschlägig sind, was gelinde gesagt grotesk anmutet; oder aber es hat sich im Zuge der testförmigen Operationalisierung des Kompetenzbegriffs hinterrücks – mehr unbewusst als bewusst – ein neues Bildungsziel als leitend eingeschmuggelt, das es allererst aufzuklären gälte. Dies sei im Folgenden versucht.
3. Totale Verwaltung als übergreifende Bildungsidee
Ein relativ vordergründiger Kandidat für eine solche Hintergrunds-Bildungsidee ist die Ökonomie bzw. die Bildung von Humankapital. Diesbezüglich formuliert der OECD-BerichtEducation at a Glance 2008 auch ganz offen, welcher Schwerpunkt gesetzt werden muss: »Eine Hauptaufgabe der Bildungssysteme besteht darin, den Arbeitsmarkt mit dem Ausmaß und der Vielfalt an Kompetenzen zu versorgen, die Arbeitgeber benötigen.«43 Zudem weisen der Humankapital- und der Kompetenzbegriff trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft aus Ökonomie und Bildungsdiskurs wesentliche »Wahlverwandtschaften« auf, wie Jörg Nicht und Thomas Müller herausgearbeitet haben.44 Vergegenwärtigt man sich, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung nicht nur Großprogramme zur Entwicklung von Kompetenzmodellen unterstützt, sondern gleichermaßen Workshops zum Thema »Investitionsgut Bildung«45, dann erhärten sich die Indizien, dass nicht die »Würde des Menschen und die freie Entfaltung der Persönlichkeit« als allgemeines Bildungsziel im Vordergrund stehen, sondern die möglichst passgenaue Versorgung von Unternehmen mit entsprechendem Humankapital. Dies wird auch deutlich an den Begrüßungsworten des Vertreters des BMBF Herbert Diehl zum ebengenannten Workshop:
»Wir alle wissen: Die Forderung von Lissabon, Europa zum wettbewerbsfähigsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen, kann nur erfüllt werden, wenn die notwendigen menschlichen Ressourcen für die Entwicklung unserer Wirtschaft und Gesellschaft heute und in Zukunft zur Verfügung stehen.«46
Das Florieren des europäischen Wirtschaftsraums hängt also an der Verfügbarkeit der Ressource Mensch und das Bildungssystem hat entsprechend die Aufgabe, diese Ressource passgenau zu liefern. Hierbei erfolgt die Lieferung in Form von zugeschnittenen kognitiven Kompetenzen, die in der Klieme-Expertise wie folgt charakterisiert werden: »fachbezogenes Gedächtnis, umfangreiches Wissen, automatisierte Fertigkeiten«47. Es sind diese unmittelbar nutzbringenden Kompetenzen, auf deren Hervorbringung das Bildungssystem real angelegt wird, womit die Schaffung von passgenauem Humankapital zum vornehmlichsten Bildungsziel wird.
Allerdings stellt die angemessene Passung noch ein schwerwiegendes Problem dar. Folgt man dem OECD-BerichtEducation at a Glance 2008, dann sind die Kompetenzen bzw. das Humankapital gerade im internationalen Vergleich noch viel zu wenig standardisiert.48 Um diesem Standardisierungsdefizit zu begegnen, verweisen die Autoren des Berichts auf die »Standardklassifikation der Berufe (ISCO)«49, die zusammen mit den »ISCO-Skill-Levels«, also den Anforderungsprofilen für die einzelnen Berufsbereiche, eine perfekte Matrix für die Standardisierung von Bedarf an und Versorgung mit Humankapital dienen könnten, wenn alle nationalen Wirtschaften sich ihnen vollständig anschließen würden.50
Die Idee, die hier im Hintergrund mitschwingt, ist nicht nur die allgemeine Versorgung gesellschaftlicher und ökonomischer Ansprüche, sondern die betriebswirtschaftliche Verrechnung51 und systematische Verwaltung der Ressource Mensch. Die Zielrichtung, die sich hier abzeichnet, ist somit die umfassende und durchsystematisierte Umsetzung der frühen Planungen der OECD-Bildungspolitik, wie sie im ersten Abschnitt dargelegt wurden. Dabei geht es einmal um die Standardisierung der Rechnungsgröße »Bedarf« durch eine tendenzielle Angleichung der Berufsformen und ihrer Anforderungsstrukturen, die wiederum mit einer entsprechenden Standardisierung der Rechnungsgröße »Ressource« bzw. der Produkte für die Bedarfsdeckung (Humankapital) einhergehen muss, damit beide Größen miteinander verrechenbar werden. Der »Betrieb«, der für die Herstellung dieser Produkte zuständig zeichnet, ist das Bildungssystem in seinen nationalen Ausformungen, also den Abteilungen oder Dependancen dieses Betriebs, deren Qualität in der Produktherstellung permanent vergleichend geprüft werden müssen. Hierzu dienen dann entsprechend die Testverfahren und vergleichenden internationalen Berichte und Studien, die sich idealerweise an den genannten Standards zu orientieren haben. Vor dem Hintergrund dieses aus den geschilderten aktuellen Tendenzen der Bildungsforschung und Bildungsökonomie gespeisten Szenarios lässt sich nun die reale Zielperspektive von Bildungsstandards bestimmen, die sich weniger durch die »Würde des Menschen« oder die »freie Entfaltung der Persönlichkeit« auszeichnet als vielmehr durch die totale betriebswirtschaftliche Verwaltung von Humankapital mit all ihren Komponenten wie Bedarfserhebung, Ressourcenberechnung, Controlling etc. pp.
Ein solchermaßen in die ökonomischen Strukturen eingemessenes Bildungswesen hat direkte Folgen für die Gestalt und den Alltag unserer Bildungseinrichtungen, insofern diese fortschreitend betriebsförmiger werden. Heinz Bude hat diese Entwicklung bezogen auf die Schule als einen Wechsel von Bildungsinstitutionen zu Bildungsorganisationen beschrieben, was einen erheblichen Einfluss auf den Charakter der Bildungseinrichtungen hat:
»Organisationen werden nach ihrem Output in Zielzahlen beurteilt, Institutionen nach der Übereinstimmung mit ihrem Sinn. […] Behandelt man Institutionen wie Organisationen, so ändert sich die Art und Weise der Autorisierung des Wissens. Es haben dann nicht mehr diejenigen das letzte Wort, die die Tradition kennen und die Arbeit vor Ort machen, sondern diejenigen, die die Tests auswerten oder am Computer die Kennzahlen überprüfen.«52
Ein solcher Wandel lässt sich insbesondere auch an der Entwicklung der Universitäten seit der Bologna-Reform verzeichnen, die von einem inflationären Wachstum von Verwaltungs- und Managementstrukturen geprägt ist.53 Es würde zu weit führen, das Dickicht aus Prüfungsverwaltungsstrukturen, dem Einfluss privatwirtschaftlicher Akkreditierungsagenturen, dem exponentiellen Wachstum von Berichtswesen und Qualitätssicherungsmaßnahmen, Drittmittelakquise und Drittmittelmanagement (um nur einige einschlägige Bereiche zu nennen) hier näher auszuleuchten – sicher ist jedoch, dass diese Entwicklung ihren Zenit noch nicht überschritten hat, insofern eine durch das KoKoHs vorbereitete systematische Bilanzierung individueller Kompetenzen an den Universitäten erst noch aussteht, wie auch ein eigendynamisches Auswachsen der Bürokratie zu vermuten ist, wenn das zur Studienzeitorganisation eingeführte »European Credit Transfer and Accumulation System« (ECTS) auch als Berechnungsgrundlage für die Budgetierung von Fakultäten erweitert würde, wie dies bereits an der Universität Amsterdam der Fall ist,54 oder ein vergleichbares System für die Lehrleistung, ein »European Teaching Load and Accumulation System« (ETLAS) sich etablieren sollte.55 Hinsichtlich der Betriebsförmigkeit der Universitäten sind noch einige wenige offene Stellen oder Freiräume auszumachen, die unter dem Banner der Effizienz geschlossen werden können.
Doch nicht nur die Bildungseinrichtungen sind von dieser Entwicklung betroffen, sondern insbesondere diejenigen, die in diesen Einrichtungen gebildet werden sollen sowie diejenigen, die eine solche Bildung übermitteln – kurz: die Menschen als Lehrende und Lernende. Inwieweit eine solch eingemessene Bildung einen Einfluss auf unser Verständnis des Menschen hat, sei noch in einem abschließenden Abschnitt etwas näher thematisiert.
4. Eingemessene Bildung und der maßgerechte Mensch
Herbert Marcuse kann wohl als derjenige Vertreter der Kritischen Theorie gelten, der in seiner Schrift Der eindimensionale Mensch am umfassendsten die Strukturen der Ökonomisierung des öffentlichen und privaten Lebens sowie der »totalen Verwaltung« herausgearbeitet hat. Mit seinem Begriff der »Eindimensionalität« beschreibt er darin die systematische Einebnung des Widerspruchs zwischen individueller und gesellschaftlicher Existenz, wodurch eine Gesellschaft sich zum Totalitären wendet:
»In dieser Gesellschaft tendiert der Produktionsapparat dazu, in dem Maße totalitär zu werden, wie er nicht nur die gesellschaftlich notwendigen Betätigungen, Fertigkeiten und Haltungen bestimmt, sondern auch die individuellen Bedürfnisse und Wünsche. Er ebnet so den Gegensatz zwischen privater und öffentlicher Existenz, zwischen individuellen und gesellschaftlichen Bedürfnissen ein.«56
Der Mechanismus, der diese Einebnung bewerkstelligt, wird von Marcuse mit Rückgriff auf die Psychoanalyse und deren Aufweis der Plastizität und sozialisationsbedingten Formung der Bedürfnisstruktur entwickelt. In dem Kapitel »Der Sieg über das unglückliche Bewußtsein: repressive Entsublimierung«57 zeigt Marcuse, in welcher Weise gesellschaftskonforme Bedürfnisse schon in früher Kindheit geprägt werden und in dieser reduzierten Form keiner Sublimierung in soziale Bedürfnisse mehr bedürfen, weil sie von Grund auf schon gesellschaftskonform ausgebildet wurden. Ohne dies hier weiter vertiefen zu wollen, fragt sich jedoch, inwieweit sich diese Struktur, die zur Erklärung der »Euphorie im Unglück«58 postindustrieller Konsumgesellschaften dient, auf das vorliegende Thema übertragen lässt. Wenn wir spätestens seit dem ersten Satz von Aristoteles’ Metaphysikgleichsam selbstverständlich davon ausgehen, dass ein Streben nach Wissen oder Bildung eine anthropologische Konstante darstellt, so lässt sich vor dem Hintergrund von Marcuses Analysen mit Recht danach fragen, inwieweit dieses Bildungsstreben nicht ebenfalls einer Plastizität unterliegt und mithin einer sozial geprägten Zurichtung unterworfen werden kann.
Führt man sich vor Augen, dass das Land Hessen (wie andere Länder ebenfalls) im Jahre 2007 einen »Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10« mit dem aussagekräftigen Titel »Bildung von Anfang an« herausgegeben hat,59 dann führt dies geradewegs zur Etablierung von kompetenzorientierten Bildungsprogrammen in Kindergärten und -krippen, die bereits auf die schul- und letztlich arbeitsmarktrelevanten Curricula zugespitzt sind.60 Setzen sich die oben ausgeführten Strukturen der Qualitätssicherung und individuellen Leistungsbilanzierung erst bis in die Tiefen frühkindlicher Entwicklung fort, so werden die Kinder ab Beginn ihres bewussten Bildungserlebens mit der Testförmigkeit ihres Bildungsstrebens konfrontiert bzw. »von Anfang an« in die allgemeinen Betriebsstrukturen des Bildungswesens eingemessen.61 Ganz ebenso wie bei Marcuses Analyse einer repressiven Bedürfnisstruktur bereits in der eingepassten Lust eine Form der Unterwerfung liegt,62 fällt eine von Beginn an auf die Teststruktur ausgerichtete Bildungsmotivation diesem repressiven Gestus anheim.63 Wenn Schüler Interesse an Bildungsgegenständen lediglich dann zeigen, wenn sie relevant für zentrale oder sonstige Prüfungen sind, oder wenn Studierende in Eröffnungssitzungen von Seminaren Interesse weit mehr für Anforderungen in puncto Prüfungs- und Studienleistungen zeigen als für die inhaltliche Gestaltung des Seminarplans, dann sind dies erste Früchte einer Entwicklung, deren Fortschritt noch nicht absehbar ist, wenngleich die Zielrichtung immer klarere Konturen annimmt.
Wenn Marcuse hinsichtlich der Bedürfnisstruktur von einer Einebnung des Widerspruchs von individuellen und gesellschaftlichen Bedürfnissen spricht, so lässt sich analog im Bildungsbereich eine fortschreitende Einebnung des Gegensatzes von intrinsischen und extrinsischen Bildungsmotivationen feststellen. Sind die extrinsischen Motivationen wie Prüfungs- und Testverfahren erst einmal solchermaßen, gleichsam von Kindesbeinen an, internalisiert worden, so werden diese fortschreitend zu intrinsischen Motivationen, wobei widersprechende, eigenständig gebildete, vom Bildungssubjekt selbst ausgehende Motivationen tendenziell zum Erliegen kommen. Die Reichweite der Folgen einer solchen Entwicklung kommt aber erst dann deutlich in den Blick, wenn die oben erläuterte inhaltliche Fokussierung der Testverfahren mit einbezogen wird. Wenn ästhetische, emotionale und soziale Kompetenzen aufgrund ihrer mangelnden Operationalisierbarkeit nicht (oder nur unzureichend) in die Testverfahren aufgenommen werden, die Tests jedoch fortschreitend zum hauptsächlichen Bildungsmotivator werden, so verlieren jene Kompetenzen nicht nur an objektiver, sondern insbesondere auch an subjektiver Relevanz.
Aber nicht nur in motivationaler Hinsicht werden die Menschen von dieser Einmessung erfasst, sondern auch was die Bildungsinhalte betrifft. Die mit PISA forcierte Fokussierung auf Lesekompetenz sowie naturwissenschaftliche und mathematische Kompetenzen wird gerade auch vor dem Hintergrund des erwähnten technisch-pragmatischen Verständnisses von Lesekompetenz diejenigen Fächer, die sich an musische, emotionale und soziale Fähigkeiten richten, noch weiter in den Hintergrund drängen. Zudem spielt die oben zitierte domänenspezifische Orientierung des Kompetenzbegriffs dem äußerst kreativen Transfer zwischen solchen Domänen geradezu entgegen. Die Zielrichtung auf »fachbezogenes Gedächtnis, umfangreiches Wissen, automatisierte Fertigkeiten«, wie sie in der Klieme-Expertise für Testverfahren empfohlen wird, verweist zudem den kreativen, eigenständigen, ja querköpfigen Umgang mit Bildungsinhalten auf die hinteren Ränge, wobei (und hier verschränken sich Inhalt und Motivation wieder) zu befürchten ist, dass mit der fortschreitenden Bedeutung, die solche Tests in der individuellen Bildungsbiographie einnehmen, der kreative Quell tendenziell zum Versiegen verurteilt ist bzw. in der motivationalen Bedeutungslosigkeit versickert.
Genau hierin zeigt sich jedoch auch der grundlegende Widerspruch der aktuellen Entwicklungen. Einerseits wird der nach Maßgaben ökonomischer Ansprüche produzierte maßgerechte Mensch erstrebt, dessen Kompetenzen als Humankapital unmittelbar nutzbringend sind und der von vornherein auf diese Ansprüche und Maßgaben hin passgenau gebildet wurde; andererseits jedoch sind es gerade die eigenständigen, widersprechenden und kreativen Motivationen und Leidenschaften, die solche Kompetenzen erst mit Leben füllen und ihnen produktive Gestalt verleihen können. Die gegenwärtigen Entwicklungen haben gerade im Bereich der Kreativität, Emotionalität und Motivation ihren blinden Fleck, insofern nicht bedacht wird, dass auch diese einer Forderung und Förderung bedürfen, ohne die sie fortschreitend verkümmern. Der maßgerechte Mensch mit seinem fachbezogenen Gedächtnis, seinem umfangreichen Wissen und seinen automatisierten Fertigkeiten ist bezogen auf die Bildungsinhalte (infolgedessen auch in Bezug auf mögliche berufliche Inhalte) tendenziell leidenschaftslos und unkreativ, von seiner sozialen Prägung einmal ganz abgesehen. Im Bestreben einer fortschreitenden Kontrolle der Produktion menschlicher Ressourcen wird somit der Ressource selbst, dem Humankapital, der Lebensnerv durchtrennt.
Dieser Widerspruch in den aktuellen Entwicklungen führt aber damit über sich selbst hinaus und stellt sich den geschilderten Tendenzen geradezu entgegen. Der geforderte maßgerechte Mensch, der den ökonomischen Ansprüchen Genüge leisten könnte, ist gerade ein solcher, der aus sich selbst heraus solche Maßgaben immer zu durchbrechen befähigt ist, der also solchermaßen mündig und autonom ist, dass er seine eigene Maßgerechtheit, seine Passung in Gegebenes selbständig reflektieren und überwinden kann, um kreativ, aus eigener Motivation und mit Leidenschaft Neues in den Blick nehmen zu können. Eine solche Mündigkeit – und das kann als das Empfindliche dieser Entwicklung gelten – ist jedoch weder eine anthropologische Konstante noch entwickelt sie sich aus ökonomischen nutzenmaximierenden Anreizen allein: Sie muss gebildet werden, und zwar in Freiräumen, die im Zuge der gegenwärtigen Tendenzen unseres Bildungswesen nach und nach verschüttet werden.
5. Das »Eichmaß freier Gesellschaften« – Ein Ausblick
Angesichts dieser Situation könnte es zur Hoffnung Anlass geben, dass sich jüngst eine »Renaissance der Bildung« abzeichnet, wie der Titel des Themenheftes der Zeitschrift für Pädagogik (Heft 4, 2015) ankündigt: »Bildung – Renaissance einer Leitidee«64. Auch ist der Widerstand gegen die geschilderten Tendenzen ungebrochen, wie die über 3000 Unterzeichner eines von Heinz-Dieter Meyer und Katie Zahedi verfassten Briefes an den OECD-Direktor Andreas Schleicher belegen, der sich kritisch mit den Entwicklungen, die sich im Zusammenhang mit der PISA-Studie ergeben haben, auseinandersetzt. Jedoch stellt sich hier einmal die Frage, ob die Opposition gegenüber einer Verabsolutierung des Bildungsgedankens der OECD sowie eine Renaissance des Bildungsbegriffs allein schon ein alternatives Eichmaß für eine »Erziehung zur Mündigkeit« (Adorno) bilden kann. Legt etwa Andreas Dörpinghaus als ein Vertreter dieser Renaissance ebenfalls einen Schwerpunkt seines Bildungsbegriffs auf eine »begriffliche kritische Distanzleistung«, dann fragt es sich, ob dieses Streben nach Mündigkeit nicht ebenfalls einer kognitiven Halbierung des Bildungsbegriffs folgt.65 Noch bei Heinrich Roth, dem Ahnvater des pädagogischen Kompetenzbegriffs, kommt der affektiv-emotionalen Dimension eine eigenständige Form von Mündigkeit zu, die sich für ihn im Begriff der »Reife« ausdrückt.66 Marcuse geht in seiner späten Schrift Versuch über die Befreiung dann noch einen Schritt weiter, wenn er feststellt, es könne
»die ästhetische Dimension als eine Art Eichmaß für eine freie Gesellschaft dienen. […] Denn die ästhetischen Bedürfnisse haben ihren eigenen sozialen Gehalt; sie sind Ansprüche des menschlichen Organismus, Geistes und Körpers auf eine Erfüllung, die nur im Kampf gegen die Institutionen erzielt werden kann, die durch ihr Funktionieren diese Ansprüche verneinen und verletzen.«67
In diesem Sinne kann das Verweisen auf die Bedeutung der kreativästhetischen Dimension neben der geforderten begrifflich-kritischen Distanznahme als die dringlichste Aufgabe einer solchen möglichen Renaissance der Bildung gelten, die gerade auch gegenüber kognitivistischen Tendenzen im Rahmen und in Folge des klassischen Bildungsbegriffs kritisch reflektiert werden muss.
Darüber hinaus bleibt es gleichwohl fraglich, inwieweit sich gegen die Übermacht ökonomischer Interessen, die die gegenwärtige Bildungsreform begleitet, eine solche Renaissance wird durchsetzen können, oder ob sie nicht im reinen Fachdiskurs verhallt und der Bildungsdiskurs einer Wiederaufnahme des Strebens nach einer nicht-halbierten Mündigkeit weiter harrt. Je nachdem, wie sich die weitere Entwicklung auch gestalten wird, behält die Einschätzung Heydorns uneingeschränkt Gültigkeit:
»Mündigkeit, die sich als verwirklichte Bildung versteht, muß sich selber im Prozeß der Geschichte aushalten, wird ihrem eigenen Widerspruch unterworfen. In der Radikalität des Begriffs ist sie schon vollzogen, ist der Mensch zu sich selbst schon frei geworden, aber seine Füße werden das Pflaster nicht los, auf dem sie gehen.«68
Hans-Ernst Schiller
Über das Recht hinaus
Philosophische Aspekte von Gewalt und Frieden1
I
Das philosophische Problem der Gewalt ist das Problem ihrer Rechtfertigung. Gibt es eine Form von Gewalt, die legitim ist? Die Antwort war bereits im Völkerrecht der Antike denkbar einfach: Legitim ist die Gewalt, die zur Abwehr eines sich vollziehenden oder unmittelbar bevorstehenden gewaltsamen Angriffs dient. Was für Völker gilt, gilt auch für Einzelne. Sie dürfen sich gegen Angriffe auf Leib, Leben und Eigentum zur Wehr setzen. Sie dürfen anderen, die in eine solche Gefahrensituation geraten, beispringen (Nothilfe). Die klassische Sozialphilosophie des bürgerlichen Zeitalters, zum Beispiel bei Thomas Hobbes oder John Locke, hat solche Situationen unter den Begriff des Kriegszustands gefasst. Der Kriegszustand ist entweder identisch mit dem Naturzustand, wie Hobbes behauptet, oder eine unvermeidlich immer wieder drohende Konsequenz aus ihm, wie Locke ausführt. In beiden Fällen ist der Naturzustand definiert als der vorstaatliche Zustand.
Im Naturzustand gibt es Rechte des Individuums, die in der Vernünftigkeit des Menschen begründet sind, aber es gibt keine unabhängige Instanz, die feststellt, wann ein natürliches Recht verletzt ist und wie die Verletzung zu ahnden oder wieder gutzumachen ist. Um der daraus entspringenden Unsicherheit zu entfliehen, müssen die Menschen einen Gesellschaftsvertrag schließen, in dem sie sich darauf einigen, ihr natürliches Recht der Selbstverteidigung und Selbstjustiz an eine unabhängige Instanz zu delegieren. Nach der liberalen Version des Naturrechts, wie sie bei John Locke vorliegt, hat diese Instanz die Aufgabe, die natürlichen Rechte des Menschen – körperliche Unversehrtheit, Leben und Eigentum – zu beschützen. Die Frage, ob dem Gesellschaftsvertrag historische Realität zukommt, wird unterschiedlich beantwortet. Die Denker des 17. Jahrhunderts und auch Rousseau vertraten eine realistische Auffassung, für Kant und John Rawls, den Erneuerer des liberalen Naturrechts im 20. Jahrhundert, war der Gesellschaftsvertrag nur ein Modell, das bei der Prüfung von Gesetzen und Institutionen zugrunde gelegt werden muss.
Mit dem Gesellschaftsvertrag entsteht eine neue Form legitimer Gewalt: die staatliche. Legitim ist diese Gewalt, weil und insofern sie die (explizite oder stillschweigende) Zustimmung jedes Einzelnen der ihr Unterworfenen hat oder haben könnte. Die staatliche Gewalt ist dem Anspruch nach eine monopolistische. Individuen haben ein Gewaltrecht nur noch da, wo sie das staatliche Gewaltmonopol nicht schützen kann, also in Fällen der Notwehr oder der Nothilfe. Auf keinen Fall haben sie ein Recht zu strafen. Möglicherweise haben sie ein Recht zum Widerstand, wenn der Staat die verfassungsmäßigen Rechte nicht achtet, aber ein bloß subjektives Verletzungsgefühl im Einzelfall ist auf keinen Fall ausreichend. Gewaltsamer Widerstand ist der erste Schritt zum Bürgerkrieg, und dessen Bild ist ein Schreckbild, schlimmer als der Krieg unter Staaten. Gewaltsamer Widerstand ist nur legitim, wenn eine systematische Verletzung der natürlichen Rechte vorliegt. Gegen einzelne mutmaßliche Verletzungen, beispielsweise einen Nachrüstungsbeschluss, eine Volkszählung oder einen Abschiebebeschluss, wäre allein ziviler Ungehorsam angemessen.
Das neuzeitliche Naturrecht von Grotius bis Kant ist eine unerhört beeindruckende Anstrengung des Denkens, über die wir auch heute nicht hinausgelangt sind, wenn es um die Legitimation staatlicher Gewalt geht. Es ist aber auch mit schweren Problemen behaftet, von denen das Widerstandsrecht nur eines ist. Weitere Probleme sind die effektive Kontrolle der exekutiven Gewalt oder die Frage nach den sozialen Menschenrechten. Ein spezielles Problem, das die Klassiker des Naturrechts beschäftigt hat, besteht in der Frage des Völkerrechts. Lässt sich das Verhältnis von Staaten, die sich offenbar in einem Naturzustand zueinander befinden, nach dem Muster des Gesellschaftsvertrags regeln? Bevor ich diese Frage aufgreife, möchte ich ein anderes Problem thematisieren. Im Szenario der naturrechtlichen Staatsphilosophie sind Gewalt und Gewaltbereitschaft etwas Vorausgesetztes. Warum finden wir Gewalt oder die Neigung zu Gewalt überhaupt vor?
II
Auch das ist eine philosophische Frage, eine Frage der philosophischen Anthropologie. Die Frage lautet, ob Aggressivität oder gar Destruktivität der Natur des Menschen entstammen oder ob sie unter bestimmten Bedingungen entstehen, die nicht zur condition humaine gehören. Um diese Frage mit hinreichender Aussicht auf Erfolg behandeln zu können, ist es notwendig, zwischen Gewalt, Aggression und Destruktion zu unterscheiden.
Destruktivität ist nicht nur eine affektiv entgrenzte, expressive Gewalt, sondern sie kann auch kalt und wohlüberlegt sein. In jedem Fall hat sie ihr Ziel in sich selbst, der Gewaltakt als solcher gewährt Befriedigung. Insofern unterscheidet sich die destruktive von der instrumentellen Gewalt, die auf ein äußeres Ziel gerichtet ist und nach seiner Erreichung aufhört oder nur noch als Drohung vorhanden ist.2 Beispiele solcher instrumentellen Gewalt sind etwa ein Banküberfall oder die Unterwerfung eines Volkes, das zur Sklavenarbeit herangezogen wird. Instrumentelle Gewalt scheint die Chance zu bieten, rational eingrenzbar zu sein, so dass auch nur das Maß an Gewalt eingesetzt wird, das zur Erreichung des Ziels notwendig ist.3 Tatsächlich dürfte eine solche Beschränkung im Leben der Einzelnen wie der Völker sehr selten gelingen. Die Überschreitung der Schwelle, die uns von physischer Gewalt, Verletzung und Tötung abhält, scheint vielmehr eine Eigendynamik freizusetzen, die alles, wenn auch nicht von jedem, möglich macht. Kein Krieg ohne Kriegsverbrechen ist eine Regel, auf die man sich verlassen kann. Freilich sollte man die Unterschiede nicht verwischen, die zwischen einer systematischen Organisation von Kriegsverbrechen und deren spontanem und ungeordnetem Vollzug bestehen.
Nicht jeder, dem dazu Gelegenheit sich bietet, verhält sich destruktiv oder sadistisch. Diese Ansicht, die im Gefolge der berühmten Experimente von Milgram und Zimbardo vertreten wurde, ist empirisch falsch. Immerhin ist so viel richtig, dass destruktive Gewalt auch dann ausgeübt werden kann, wenn sie keinem inneren Antrieb entspringt. Es gibt Gewaltverbrechen, die aus Gruppendruck und Konformismus begangen werden.4
Die Zahl der Menschen, die eine Befriedigung aus destruktivem Verhalten gewinnen, scheint eher gering zu sein.5 Übrigens muss eine sadistische Befriedigung nicht unbedingt der physischen Gewalttat entspringen. Es gibt auch andere Formen der Demütigung und Grausamkeit, die symbolisch vermittelt sind. Solche Formen sollten nicht mit dem Gewaltbegriff bezeichnet werden, indem man etwa von psychischer Gewalt spricht, was keineswegs bedeutet, dass sie weniger schlimm oder verurteilenswert sein müssen. Nach meiner Ansicht sollte der Gewaltbegriff auf die physische Gewalt beschränkt bleiben, damit der Begriff trennscharf bleibt. Als übergreifender Terminus bietet sich der Begriff der Aggression an – in der allgemeinen Bedeutung einer Aktion, die ihr Objekt schädigen soll.
Im Begriff der Aggression hat Erich Fromm eine Differenzierung vorgenommen, die mir sinnvoll und fruchtbar zu sein scheint. Er stellt einen in der Sozialisation erworbenen, im Charakter verankerten Trieb zur Destruktion der angeborenen, biologisch programmierten Tendenz gegenüber, sich und seine Nachkommen zu verteidigen.6 Die destruktive Aggression »dient keinem Zweck« und ist mit Lustgefühlen verbunden.7 Sie hat Fromm zufolge zwei Formen: die des Sadismus, bei dem die Befriedigung aus der Beherrschung eines Anderen folgt – eine Herrschaft, die sich vor allem in der Fähigkeit erweist, Schmerzen zuzufügen – und die Form der Nekrophilie, die tötet und zerstückelt und ganz allgemein, über den ursprünglichen Bereich sexueller Leichenschändung hinaus, von Fromm als das Hingezogensein zum Toten und Verwesenden definiert wird.
Der defensiven Aggression, die Fromm von der destruktiven unterschieden hat, bietet sich beim Menschen ein außerordentlich weites Feld der Betätigung. Wir verteidigen uns nicht nur, wenn wir bedroht sind, sondern wir wappnen uns auch gegen Bedrohungen, die wir voraussehen oder vorauszusehen meinen. Menschen reagieren nicht nur auf wirkliche, sondern auch auf fiktive Bedrohungen. Sie verteidigen nicht nur Leib und Leben, sondern auch ihr Eigentum. Sie reagieren auf die Verletzung kultureller Werte: eine Karikatur, eine brennende Fahne, ein Wort können Reaktionen höchster Aggressivität hervorrufen. Die Verletzbarkeit ist symbolischer Natur und sie hat offenbar viel zu tun mit dem Grad an Verletzbarkeit bei demjenigen, der angegriffen wird. Weil der Bereich der Anlässe zu defensiver Aggression so groß ist, kann sie auch so leicht manipuliert werden. Es gehört zu den alten, stets aufs Neue bewährten Herrschaftstechniken, in der Bevölkerung ein Gefühl der Bedrohung zu wecken: Das Kaiserreich war eingekreist von neidischen Feinden; die Nazis mussten die Sowjetunion überfallen, weil sie sonst überfallen worden wären; Vietnam musste den Kommunisten entrissen werden, weil sonst alle Staaten Südostasien wie Dominosteine gefallen wären; Milošević tanzte uns auf der Nase herum, die Demütigung war unerträglich; Putin will die Sowjetunion wiederherstellen – dafür gibt es zwar keine Anhaltspunkte, aber er ist undurchsichtig, er versteht nur die Sprache der Gewalt.
Hinter all diesen Parolen stehen handfeste Interessen ökonomischer und strategischer Art. Dass sie immer rational sind, wird man nicht behaupten können; oft sind sie mit einer Überschätzung der eigenen Möglichkeiten verbunden. Wichtig ist nur festzuhalten, dass die eigentlichen, den Konflikt bestimmenden Ziele mit den Vorwänden, die der Stimmungsmache dienen, meist wenig zu tun haben. Der ausersehene Feind ist immer beides: unerträglich frech und bedrohlich und zugleich schwach und leicht zu überwältigen, wenn man nur ordentlich auf den Tisch haut und entschlossen genug auftritt.
III
Nun können wir die oben aufgeworfene Frage nach der Übertragbarkeit des Modells der Überwindung des Kriegszustands von der Ebene der Individuen auf die der Staaten erneut aufgreifen. Lässt sich ein Rechtszustand der Staaten in ähnlicher Weise denken wie ein Rechtszustand der Individuen in einem Staat, der nach demokratisch beschlossenen Gesetzen und unter Achtung der Menschenrechte regiert wird? Von Hugo Grotius (De iure belli et pacis, 1625) bis zu Kant haben die führenden Sozialphilosophen Europas versucht, die Verrechtlichung des Gemeinwesens mit der Verrechtlichung der Staatenwelt zu verbinden. Kants Schrift Zumewigen Frieden von 1795 ist der Abschluss und der Gipfelpunkt dieser Entwicklung.8 Noch in den aktuellen Debatten über das Völkerrecht ist die Kant’sche Schrift ein wichtiger Bezugspunkt.9
Kant beantwortet die Frage, ob die Verrechtlichung der internationalen Beziehungen nach dem Muster des Gesellschaftsvertrags vollzogen werden könne, mit einem klaren Nein. Man müsste einen Weltstaat anstreben, der exekutive Befugnisse haben würde. Eine solche Weltrepublik aber würde den Keim des Despotismus in sich tragen und die Verschiedenheit der Völker, ihrer Sprachen und ihrer Geschichte missachten. Er würde zudem die Voraussetzung des Völkerrechts, die Pluralität souveräner Rechtssubjekte, zerstören. Was immer anstelle der Weltrepublik zu erstreben sei, es dürfe weder befugt sein, Strafkriege zu führen noch sich gewaltsam in die inneren Angelegenheiten der Staaten einzumischen.10
Nach Kant sollten wir als Rechtsverhältnis der Staaten ein foedus gentium, einen Völkerbund anstreben. Er gebraucht also genau den Namen, dem sich die nach dem Ersten Weltkrieg gegründete Vorläuferorganisation der heutigen UNO gegeben hatte. Das angemessene Ziel der Friedenspolitik ist für Kant ein Bündnis (foedus) von Staaten, die sich gegenseitig Gewaltverzicht erklären, alle Gebietsforderungen aneinander fallen lassen und ihre stehenden Heere abbauen, um schließlich ganz auf sie zu verzichten. Dem gewitzten Bürger des 21. Jahrhunderts muten solche Vorschläge so naiv an, dass man sich fragen muss, was Kant für ihre Realisierbarkeit ins Feld zu führen hat.
Die wichtigste Überlegung betrifft die Verfassung der Staaten, die einen Völkerbund vereinbaren können. Sie muss, so Kant, republikanisch sein. Damit meint er nicht eine Staatsform ohne König, sondern eine klare Trennung der Exekutive oder Regierung von der Legislative.11 In dieser uns etwas verwirrenden Terminologie könnte also die Staatsform monarchisch sein, wenn nur die Regierungsart republikanisch ist. Die Bezeichnung ›demokratisch‹ lehnt Kant ab, weil er sie mit der Vorstellung einer direkten Demokratie verknüpft, die Legislative und Exekutive miteinander vermischt. Beide Gewalten müssen Kant zufolge repräsentativ verfasst sein. Was die Gesetzgebung betrifft, so schweigt sich Kant über ihr Verfahren aus. Wichtig ist für ihn, dass sie dem Maßstab des (fiktiven) Gesellschaftsvertrags entspricht: Jeder muss einem Gesetz seine Zustimmung geben können, das Gesetz muss seiner Form nach allgemein sein. Dieses Erfordernis wird bei Kant auch so ausgedrückt, dass die grundlegenden Menschenrechte der Freiheit und der Gleichheit vor dem Gesetz respektiert werden müssen.12
In einer solchen Verfassung könnte es keinen Krieg geben, ohne dass die Staatsbürger über ihre Repräsentanten ihre Zustimmung gegeben hätten. Das freilich wäre sehr schwierig, denn alle könnten sich ausrechnen, dass sie selbst die Opfer eines Krieges wären, sei es als Kämpfer, sei es als Zivilisten. Die Geschichte der mehr als 200 Jahre, die uns von Kant trennen, hat uns eines Besseren belehrt. Auch demokratisch gewählte Parlamente zögern nicht, Mittel zu bewilligen und ihre Zustimmung zu Kriegen zu geben, besonders wenn sie weitab in den ehemaligen Kolonien geführt werden sollen. Freilich ist diese Erfahrung nicht Kant anzulasten, der in der Frühzeit der heutigen Weltordnung noch optimistisch sein durfte.
Bemerkenswert an Kants Argumentation ist nicht zuletzt die Berufung auf das Interesse. Im Kant’schen Sinn ist Interesse ein Naturbegriff; es ist immer eigennützig. Aus den individuellen Interessen entstehe ein Antagonismus, ein Gegensatz, der die Menschen zwingt, in einen Rechtszustand zu treten, in dem allgemeine Gesetze gelten. Das ist die ›List der Vernunft‹ bei Kant, noch bevor Hegel diesen einprägsamen Ausdruck geschaffen hat. Obwohl sie einander feindlich gesonnen sind, schränken sich die Individuen freiwillig ein, weil noch der Stärkste fürchten muss, von der Macht der Schwachen überwältigt zu werden. Selbst ein Volk von Teufeln, so Kant, könne die Aufgabe lösen, ein Gemeinwesen zu gründen, in dem das Gesetz herrscht und niemand sonst.
Erneut stellt sich die Frage, ob dieser Gedanke auf das Verhältnis der Staaten übertragbar ist. Kann der Völkerbund im Sinne eines dauerhaften Friedensschlusses aus dem Antagonismus der Staaten entstehen? In gewisser Weise ja, denn die Kosten der Kriegführung – sowohl nach Seite seiner Finanzierung als auch nach Seite der Verwüstungen, die sie mit sich bringen kann – steigen mit dem Antagonismus der Staaten an und widerstreiten dem Interesse der Völker. Darüber hinaus, und das ist Kants eigentliches Argument, ist die Geldmacht ihrer Natur nach friedlich. Es gibt nicht nur den antagonistischen, sondern auch den wechselseitigen Eigennutz. »Es ist der Handelsgeist«, so Kant, »der mit dem Kriege nicht zusammen bestehen kann«13.
Mir scheint, dass die Geschichte auch diese Hoffnung Kants widerlegt hat. Wir sollten uns daran erinnern, dass schon vor Kants Zeit die Völker dreier Kontinente im Handelsinteresse der europäischen Staaten bekriegt worden sind. Oft sind Handelsinteressen selbst antagonistisch und befeuern die Feindseligkeit zwischen Staaten. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg war die wirtschaftliche Verflechtung so weit fortgeschritten, dass er nach der Logik des Kant’schen Arguments nie hätte in Gang kommen dürfen.14 Richtig scheint eher die Überlegung, dass die Kosten eines Krieges eine abschreckende Wirkung gewonnen haben, zumindest was die Konflikte zwischen den Atommächten betrifft. Die Aussicht der gegenseitigen Auslöschung hat uns wahrscheinlich jahrzehntelang vor dem großen Krieg bewahrt, aber wir wissen auch, wie riskant diese Art von Abschreckung gewesen ist und wieder sein kann. Fehler und Missverständnisse werden mit der Verkürzung möglicher Reaktionszeiten auf nukleare Angriffe wahrscheinlicher und könnten leicht die letzten sein.
Nun muss auch bezüglich dieser These Kants, wonach Interessen auf einen stabilen Frieden drängen, die Kritik relativiert werden. Kant hat seinem Argument von vornherein eine beschränkte Reichweite zugesprochen. Es gilt nur unter der Bedingung, dass der ewige Friede aus moralischen Gründen ernsthaft und nicht nur vorgeblich angestrebt wird. Dann können die Hinweise darauf, dass die Interessen der Akteure selbst die Schaffung eines stabilen Rechtszustands begünstigen, zur Ermutigung dienen. Interessen sind also willkommen, wo sie dem moralisch begründeten Ziel dienen können. Sie sind freilich dann verdächtig, wenn sie sich unter einem Nebel moralischer Dämonisierung des Feindes verstecken und Moral selbst instrumentalisieren.