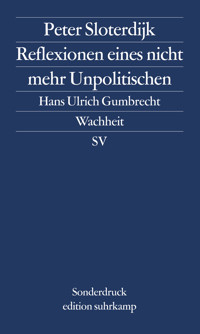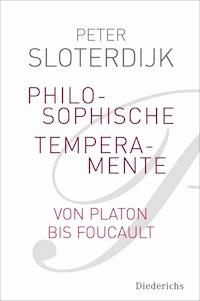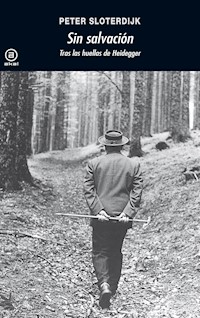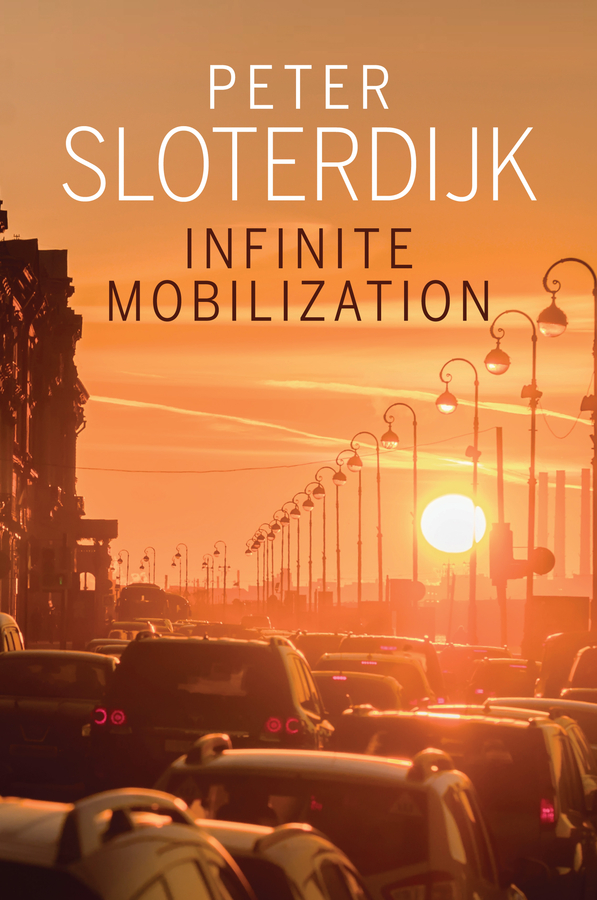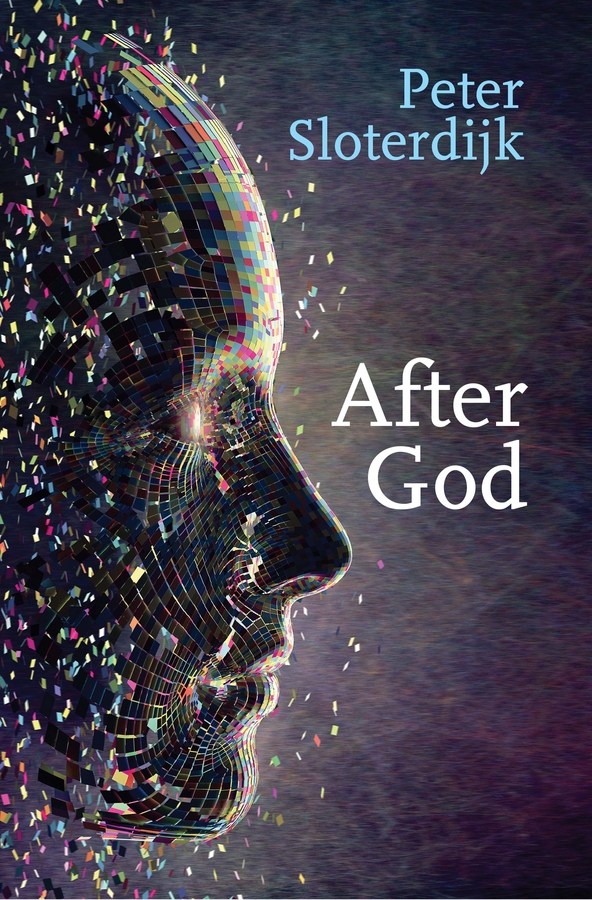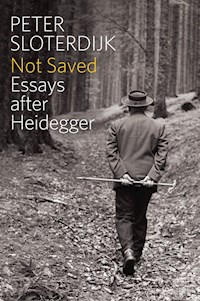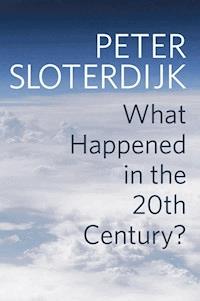17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Am Anfang war der Zorn. Im ersten Satz von Homers Ilias ist von ihm die Rede, und Peter Sloterdijk beschreibt ihn in seinem Bestseller als zentrale Triebkraft von Entwicklung und Veränderung. Dabei wurde der ungestüme Impuls schon während der Antike in geregelte Bahnen gelenkt. Judentum und Christentum, aber auch die Totalitarismen des 20. Jahrhunderts lassen sich als Ökonomisierungen beschreiben, als große Ideologien, die den Zorn sammeln und organisieren. Sloterdijks erhellende Analyse, mit der er einmal mehr Fragen der Gegenwart in ihre lange Geschichte einbettet, behandelt auch das aktuelle Phänomen des Islamismus – der Wiederkehr des Zorns als ungelenktes Ressentiment.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Peter Sloterdijk, geboren 1947, ist Professor für Ästhetik und Philosophie an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und deren Rektor.
Zuletzt erschienen von ihm: Scheintod im Denken (eu 28, 2010), Die nehmende Hand und die gebende Seite (2010), Streß und Freiheit (2011) und Zeilen und Tage. 1.Teil: Spuren ins Posthumien (2012).
Peter Sloterdijk
Zorn und Zeit
Politisch-psychologischer Versuch
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2006
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-73705-7
www.suhrkamp.de
INHALT
Einleitung
Europas erstes Wort
Die thymotische Welt: Stolz und Krieg
Jenseits der Erotik
Theorie der Stolz-Ensembles
Griechische Prämissen moderner Kämpfe – Die Lehre vom thymós
Nietzsches Augenblick
Vollendeter Kapitalismus: Eine Ökonomie der Generosität
Die post-kommunistische Situation
1 Zorngeschäfte im allgemeinen
Erzählte Rache
Der Aggressor als Geber
Zorn und Zeit: Die einfache Explosion
Projektform des Zorns: Rache
Bankform des Zorns: Revolution
Die ungeheure Macht des Negativen
2 Der zornige Gott: Der Weg zur Erfindung der metaphysischen Rachebank
Präludium: Die Rache Gottes an der säkularen Welt
Der Zornkönig
Die Unterbrechung der Rache
Ursprüngliche Akkumulation des Zorns
Genealogie des Militantismus
Die autoaggressive Zornmasse
Hyperbolischer Zorn: Jüdische und christliche Apokalyptik
Gefäße des Zorns, höllische Depots: Zur Metaphysik der Endlagerung
Warum die Suche nach Gründen für den Zorn Gottes in die Irre geht – Christliche Trugschlüsse
Lob des Purgatoriums
3 Die thymotische RevolutionVon der kommunistischen Weltbank des Zorns
Wenn eine Revolution nicht genügt
Gespenstische Aufheiterungen
Das Epochenprojekt: Den Thymos der Erniedrigten erregen
Theorielose Empörung oder: Der Augenblick der Anarchie
Klassenbewußtsein – Die Thymotisierung des Proletariats
Zum Auftauchen des nicht-monetären Bankwesens
Komintern: Die Weltbank des Zorns und die faschistischen Volksbanken
Zornbeschaffung durch Kriegsanleihen
Der Maoismus: Zur Psychopolitik des reinen Furors
Die Botschaft von Monte Christo
4 Zornzerstreuung in der Ära der Mitte
After Theory
Die Erotisierung Albaniens oder: Die Abenteuer der post-kommunistischen Seele
Realer Kapitalismus: Kollapsverzögerung in gierdynamischen Systemen
Zerstreute Dissidenz – Die misanthropische Internationale
Das Welttheater der Drohungen
Die dritte Sammlung: Kann der politische Islam eine neue Weltbank der Dissidenz einrichten?
Konklusion: Jenseits des Ressentiments
EINLEITUNG
Europas erstes Wort
Am Anfang des ersten Satzes der europäischen Überlieferung, im Eingangsvers der Ilias, taucht das Wort »Zorn« auf, fatal und feierlich wie ein Appell, der keinen Widerspruch duldet. Wie es sich für ein wohlgeformtes Satzobjekt gehört, steht dieses Nomen im Akkusativ. »Den Zorn besinge, Göttin, des Achilles, des Peleussohns …« Daß es an erster Stelle erscheint, bringt hohes Pathos hörbar zum Ausdruck. Welche Art Beziehung zum Zorn wird in dem magischen Auftakt des Heldenlieds den Hörern vorgeschlagen? Den Zorn, mit dem im alten Westen alles anfing – auf welche Weise will der Rezitator ihn zur Sprache bringen? Wird er ihn als eine Gewalt schildern, die friedliche Menschen in grauenhafte Geschehnisse verstrickt? Diesen unheimlichsten und menschlichsten der Affekte, soll man ihn dementsprechend dämpfen, zügeln, unterdrücken? Geht man ihm eilig aus dem Weg, sooft er sich bei anderen ankündigt und bei einem selber regt? Soll man ihn jederzeit der neutralisierten, der besseren Einsicht opfern?
Das sind, wie man sofort bemerkt, zeitgenössische Fragen, die weit vom Gegenstand wegführen – wenn dieser der Zorn des Achilles heißt. Die alte Welt hatte sich zum Zorn ihre eigenen Wege gebahnt, die nicht mehr die der Modernen sein können. Wo diese an den Therapeuten appellieren oder die Nummer der Polizei wählen, wandten die Wissenden von früher sich an die Überwelt. Um das erste Wort Europas zum Klingen zu bringen, wird von Homer die Göttin angerufen, entsprechend einem alten Rhapsodenbrauch und der Einsicht folgend, daß, wer Unbescheidenes vorhat, am besten sehr bescheiden anfängt. Nicht ich, Homer, kann das Gelingen meines Gesangs gewährleisten. Singen bedeutet von jeher den Mund auftun, damit höhere Kräfte sich kundgeben können. Erlangt mein Vortrag Erfolg und Autorität, werden die Musen dafür verantwortlich gewesen sein, und jenseits der Musen, wer weiß, der Gott, die Göttin selbst. Verhallt der Gesang ungehört, waren die höheren Mächte an ihm nicht interessiert. Im Fall Homers fiel das Gottesurteil deutlich aus. Am Anfang war das Wort »Zorn«, und das Wort war erfolgreich.
Menin aiede, thea, Peleiadeo Achileos
Oulomenen, he myri Achaiois alge eteke …
Den Zorn singe, Göttin, des Peleussohns Achilles,
den unheilbringenden Zorn, der tausend Leid den Achäern
Schuf und viele stattliche Seelen zum Hades hinabstieß …
Unmißverständlich wird in den Anrufungsversen der Ilias vorgeschrieben, auf welche Weise die Griechen, Mustervolk okzidentaler Zivilisierung, dem Einbruch des Zorns in das Leben der Sterblichen begegnen sollen – mit dem Staunen, das einer Erscheinung angemessen ist. Der erste Appell unserer Kulturüberlieferung – ist aber dieses »unser« noch gültig? – spricht die Bitte aus, die Überwelt möge den Gesang vom Zorn eines einzigartigen Kämpfers unterstützen. Bemerkenswert dabei ist, daß der Sänger keinerlei Beschönigung im Sinn hat. Von den ersten Zeilen an kehrt er die unheilstiftende Kraft des heroischen Zorns hervor: Wo er sich manifestiert, fallen die Schläge nach allen Seiten. Die Griechen selbst haben darunter sogar mehr zu leiden als die Trojaner. Schon ganz zu Beginn des Kriegsgeschehens wendet sich der Zorn des Achilles gegen die Seinen, um sich erst kurz vor der Entscheidungsschlacht wieder in die griechische Front einzureihen. Der Ton der ersten Verse gibt das Programm vor: Die Seelen der besiegten Helden – hier stattlich genannt, im allgemeinen eher als schattenhafte Phantome vorgestellt – fahren in den Hades hinab, ihre leblosen Körper, Homer sagt: »sie selbst«, werden von Vögeln und Hunden unter offenem Himmel gefressen.
Mit euphorischem Gleichmaß gleitet die Stimme des Sängers über den Horizont des Daseins, aus dem es dergleichen zu berichten gibt. Grieche sein und diese Stimme hören bedeutet während des klassischen Zeitalters dasselbe. Wo man sie vernimmt, wird eines unmittelbar verständlich: Krieg und Frieden sind Namen für Phasen eines Lebenszusammenhangs, in dem die Vollbeschäftigung des Todes nie in Frage steht. Daß der Tod dem Helden früh begegnet, auch dies gehört zu den Botschaften des Heldenlieds. Wenn das Wort »Gewaltverherrlichung« je einen Sinn hatte – für diesen Introitus zur ältesten Urkunde der europäischen Kultur wäre es am Platz. Doch würde es nahezu das Gegenteil dessen bezeichnen, worauf es in seinem heutigen, unvermeidlich mißbilligenden Gebrauch abzielt. Den Zorn besingen heißt ihn denkwürdig machen, was aber denkwürdig ist, steht dem Eindrucksvollen und dauerhaft Hochzuschätzenden nahe, ja geradezu dem Guten. Diese Wertungen sind den Denk- und Empfindungsweisen der Modernen so stark entgegengesetzt, daß man wohl zugeben muß: Ein unverfälschter Zugang zum Eigensinn des homerischen Zornverständnisses wird uns in letzter Instanz versperrt bleiben.
Nur indirekte Annäherungen helfen weiter. Wir verstehen immerhin, es handelt sich nicht um den heiligen Zorn, von dem die biblischen Quellen sprechen. Nicht um die Empörung des Propheten angesichts widergöttlicher Greuel, nicht um den Zorn des Moses, der die Tafeln zerbricht, während sich das Volk mit dem Kalb vergnügt, nicht um den schmachtenden Haß des Psalmisten, der den Tag nicht erwarten kann, an dem der Gerechte seine Füße baden wird im Blut der Frevler.1 Auch hat der Zorn des Achilles wenig gemeinsam mit dem Zorn Jahwes, des frühen, noch ziemlich unsublimen Gewitter- und Wüstengottes, der als »schnaubender Gott« vor dem Exodusvolk her zieht und dessen Verfolger in Unwettern und Fluten vernichtet.2 Doch ebensowenig sind die profanen menschlichen Zornattacken gemeint, die den späteren Sophisten und philosophischen Morallehrern vor Augen stehen, wenn sie das Ideal der Selbstbeherrschung predigen.
Die Wahrheit ist, Homer bewegt sich in einer von einem glücklichen Bellizismus ohne Grenzen erfüllten Welt. Wie düster die Horizonte dieses Universums aus Kämpfen und Toden auch sein mögen, der Grundton der Darstellung ist bestimmt durch den Stolz, Zeuge solcher Schauspiele und Schicksale sein zu dürfen. Ihre leuchtende Sichtbarkeit versöhnt mit der Härte der Tatsachen – das ist es, was Nietzsche mit dem Kunstwort »apollinisch« bezeichnet hatte. Kein moderner Mensch kann sich in eine Zeit zurückversetzen, in der die Begriffe Krieg und Glück eine sinnvolle Konstellation bilden; für die ersten Hörer Homers sind sie ein unzertrennliches Paar. Das Band zwischen ihnen wird durch den Heldenkult alten Stils gestiftet, der den Modernen nur noch in den Anführungszeichen der historischen Bildung gegenwärtig ist.
Für die Alten war der Heroismus keine feinsinnige Attitüde, sondern die vitalste aller möglichen Stellungnahmen zu den Tatsachen des Lebens. In ihren Augen hätte eine Welt ohne Heldenerscheinungen das Nichts bedeutet – den Zustand, in dem die Menschen der Monarchie der Natur ohne Gegenwehr preisgegeben wären. Die physis bewirkt alles, der Mensch kann nichts, so hätte das Prinzip eines heldenlosen Universums gelautet. Der Heros hingegen liefert den Beweis, daß auch von menschlicher Seite her Taten und Werke möglich sind, sofern göttliche Begünstigungen sie zulassen – und allein als Tatentäter und Werkevollbringer werden die frühen Heroen gefeiert. Ihre Taten zeugen für das Wertvollste, was die Sterblichen, damals wie später, erfahren können: daß eine Lichtung aus Nicht-Ohnmacht und Nicht-Gleichgültigkeit in das Dickicht der naturwüchsigen Gegebenheiten geschlagen worden ist. In Berichten von Taten leuchtet die erste gute Nachricht auf: Unter der Sonne ereignet sich mehr als das Gleichgültige und Immergleiche. Indem wirkliche Taten vollbracht wurden, beantworten die Berichte von ihnen die Frage: Warum tun Menschen überhaupt etwas und nicht eher nichts? Sie tun es, damit die Welt durch Neues und Rühmenswertes erweitert werde. Da es Vertreter des Menschengeschlechts waren, obschon sehr außerordentliche, die das Neue vollbrachten, öffnet sich für die übrigen ein Zugang zu Stolz und Staunen, wenn sie von den Taten und Leiden der Heroen hören.
Das Neue darf allerdings nicht als Nachricht vom Tage auftreten. Es muß, um legitim zu sein, als Prototypisches, Ältestes, ewig Wiederkehrendes sich tarnen und sich auf die lange vorherbedachte Zustimmung der Götter berufen. Gibt Neues sich als vorzeitliches Geschehen aus, entsteht der Mythos. Das Epos ist dessen beweglichere, breitere und festlichere Form, geeignet für den Vortrag auf Burgen, Dorfplätzen und vor frühem städtischem Publikum.3
Die Forderung nach dem Helden ist Voraussetzung für alles, was nun folgt. Nur weil der schreckenerregende Zorn für die kriegerische Heldenerscheinung unverzichtbar ist, darf sich der Rhapsode an die Göttin wenden, um sie für vierundzwanzig Gesänge zu engagieren. Wäre der Zorn, den die Göttin zu besingen helfen soll, nicht selber von höherer Natur, würde schon der Gedanke, sie anzurufen, Blasphemie bedeuten. Allein weil es einen Zorn gibt, der von oben verliehen wird, ist es legitim, die Götter in die heftigen Affären der Menschen zu involvieren. Wer unter solchen Prämissen den Zorn besingt, feiert eine Kraft, die die Menschen aus der vegetativen Benommenheit befreit und unter einen hohen schaulustigen Himmel stellt. Die Erdenbewohner schöpfen Luft, seit sie sich vorstellen können, die Götter seien Zuschauer, die sich an der irdischen Komödie delektieren.
Das Verständnis dieser für uns ferngerückten Verhältnisse dürfte durch den Hinweis erleichtert werden, daß nach der Auffassung der Alten der Held und sein Sänger in einem authentisch religiösen Sinn miteinander korrespondieren. Religiosität ist die Zustimmung von Menschen zu ihrer Medialität. Mediale Talente gehen bekanntlich verschiedene Wege, doch können diese sich an wichtigen Knotenpunkten schneiden. Der »Medien«pluralismus ist folglich ein Sachverhalt, der bis in frühe Zustände der Kultur zurückreicht. Jedoch, die Medien sind zu dieser Zeit nicht die technischen Apparate, sondern die Menschen selbst mitsamt ihren organischen und geistigen Potentialen. Wie der Rhapsode das Mundstück einer singenden Kraft sein möchte, so fühlt sich der Held als Arm des Zorns, der die denkwürdigen Taten vollbringt. Der Kehlkopf des einen und der Arm des anderen bilden miteinander einen hybriden Körper. Mehr als dem Kämpfer selber gehört dessen Schwertarm dem Gott, der auf dem Umweg über Sekundärursachen in menschliche Verhältnisse einwirkt; und er gehört natürlich seinem Sänger, dem der Held, samt seinen Waffen, den unsterblichen Ruhm verdanken wird. So bildet die Verknüpfung Gott – Held – Rhapsode den ersten effektiven Medienverbund. Die tausend Jahre, die im mittelmeerischen Raum auf Homer folgen, handeln immer wieder von Achilles und seiner Verwendbarkeit für die kriegerischen Musen.
Man braucht sich nicht lange bei der Feststellung aufzuhalten, wonach in heutiger Zeit kein Mensch mehr authentisch so zu denken in der Lage ist – ausgenommen vielleicht einige Bewohner des esoterischen Hochlands, wo die Wiederverzauberung der Welt größere Fortschritte gemacht hat. Ansonsten haben wir nicht nur aufgehört, wie die Alten zu urteilen und zu empfinden, wir verachten sie insgeheim dafür, daß sie die »Kinder ihrer Zeit« blieben, gefangen in einem Heroismus, den wir bloß als archaisch und ungehörig begreifen können. Was dürfte man Homer aus heutiger Sicht und den Gepflogenheiten der Ebene gemäß entgegenhalten? Soll man ihm vorwerfen, er verletzte die Menschenwürde, indem er Individuen allzu direkt als Medien befehlender höherer Wesen auffaßte? Er mißachtete die Integrität der Opfer, indem er die Mächte feierte, die ihnen Schaden zufügten? Er neutralisierte die willkürliche Gewalt und machte aus Kampfergebnissen unmittelbare Gottesurteile? Oder müßte der Vorwurf abgemildert werden zu der Feststellung, er sei eine Beute der Ungeduld geworden? Er habe nicht bis zur Bergpredigt warten können und Senecas De ira nicht gelesen, das Brevier der stoischen Affektkontrolle, das für die christliche und humanistische Ethik eine Vorlage bildete?
In Homers Horizont gibt es für Einwände dieser Art selbstverständlich keinen Angriffspunkt. Das Lied von der heroischen Energie eines Kriegers, mit dem das Epos der Alten beginnt, erhebt den Zorn in den Rang der Substanz, aus der die Welt gefertigt ist – falls wir zugeben, daß »Welt« hier den Kreis von Gestalten und Szenen des althellenischen krieger-adligen Lebens im ersten Jahrtausend vor der christlichen Zeitrechnung bezeichnet. Man möchte glauben, eine solche Sicht sei spätestens seit der Aufklärung hinfällig geworden. Doch dieses vom Vorrang des Kampfes geprägte Bild der Dinge zur Gänze zurückzuweisen dürfte dem gebildeten Realisten der Gegenwart weniger leichtfallen, als das kurante pazifistische Gefühl glauben möchte. Auch die Modernen haben die Aufgabe, den Krieg zu denken, nie völlig vernachlässigt, ja, dieser Auftrag wurde über lange Zeit mit dem männlichen Pol der Bildung assoziiert.4 An seinem Maß wurden bereits die Schüler der Antike geeicht, als die Oberschichten Roms, zusammen mit den übrigen griechischen Kulturmodellen, auch den epischen Bellizismus ihrer Lehrmeister importierten, ohne darüber im geringsten ihren bodenständigen Militarismus zu vergessen. Und so lernte es die Jugend Europas seit der Renaissance von neuem, Generation für Generation, nachdem die Vorbildlichkeit der Griechen für das Schulwesen der entstehenden Nationalstaaten wieder mit weitreichenden Folgen heraufbeschworen worden war. Sollte man es für möglich halten, daß auch die sogenannten Weltkriege des 20. Jahrhunderts unter anderem Wiederholungen des Trojanischen Krieges bedeuteten – organisiert von Generalstäben, deren führende Köpfe, auf jeder Seite der feindlichen Linien, sich jeweils als die vortrefflichsten Achaier verstanden, ja geradezu die Nachfahren des zürnenden Achilles und Träger einer athletisch-vaterländischen Berufung zu Sieg und Ruhm bei der Nachwelt?5 Der unsterbliche Held stirbt unzählige Male. Hat nicht noch Karl Marx der Gräfin Hatzfeld im September 1864 nach dem Duell-Tod des Arbeiterführers Lassalle mit den Worten kondoliert, dieser sei »jung gestorben, im Triumph, als Achilles«?6
Die Frage, ob Homer schon, wie etwas später Heraklit, und sehr viel später noch immer Hegel, glaubte, der Krieg sei der Vater aller Dinge, mag hier unentschieden bleiben. Auch ob er, der Patriarch der Kriegsgeschichte und der Griechischlehrer zahlloser Generationen, einen Begriff von »Geschichte« oder »Zivilisation« besaß, ist ungewiß, eher unwahrscheinlich. Sicher ist nur, daß das Universum der Ilias ganz aus den Taten und Leiden des Zorns (menis) gewoben ist – so wie die etwas jüngere Odyssee die Taten und Leiden der List (metis) dekliniert. Für die archaische Ontologie ist die Welt die Summe der in ihr zu führenden Kämpfe. Der epische Zorn erscheint seinem Sänger als eine Primärenergie, die von sich her aufquillt, unableitbar wie der Sturm und das Sonnenlicht. Sie ist Aktionskraft in quintessentieller Gestalt. Weil sie wie eine erste Substanz das Prädikat »aus sich« beanspruchen kann, geht sie all ihren lokalen Provokationen voraus. Der Held und seine menis bilden für Homer ein unzertrennliches Gespann, so daß sich angesichts dieser prästabilisierten Union jede Herleitung des Zorns aus äußeren Anlässen erübrigt. Achilles ist zornerfüllt, so wie der Nordpol eisig, der Olymp umwölkt und der Mont Ventoux windumtost ist.
Das schließt nicht aus, daß die Anlässe dem Zorn die Bühne bereiten – doch beschränkt sich ihre Rolle buchstäblich darauf, ihn »hervor«zurufen, ohne sein Wesen zu verändern. Als die Kraft, welche die strittige Welt im Innersten zusammenhält, bewahrt er die Einheit der Substanz in der Vielheit der Eruptionen. Er existiert vor allen seinen Manifestationen und überlebt wie unverändert seine intensivsten Verausgabungen. Wenn Achilles grollend in seinem Zelt hockt, gekränkt, nahezu gelähmt, seinen eigenen Leuten gram, weil ihm der Heerführer Agamemnon die schöne Sklavin Briseïs, dieses symbolisch hochbedeutsame »Ehrengeschenk«, abspenstig gemacht hatte, so tut das seiner glänzend-zürnenden Natur keinen Abbruch. Die Fähigkeit, an einer Zurücksetzung zu leiden, zeichnet den großen Kämpfer aus; die Verlierertugend des »Loslassenkönnens« hat er noch nicht nötig. Ihm genügt es, zu wissen, daß er im Recht ist und Agamemnon ihm etwas schuldet. Diese Schuld liegt nach altgriechischen Begriffen objektiv vor, da die Ehre des großen Kämpfers ihrerseits objektiver oder sachhafter Natur ist. Wenn der nur dem Rang nach Erste dem der Kraft nach Ersten eine Auszeichnung entzieht, ist die Ehrverletzung auf höchstem Niveau real gegeben. Die Groll-Episode zeigt die Kraft des Achilles im brütenden Stillstand – auch Helden kennen Zeiten der Unentschiedenheit und des Wütens nach innen. Doch ein ausreichend heftiger Anstoß genügt, um den Motor seiner menis wieder in Gang zu setzen. Ist dieser Anstoß geliefert, sind die Folgen schauerlich-faszinierend genug, um eines »Städtezerstörers« mit einem Kampfrekord von dreiundzwanzig vernichteten Siedlungen7 würdig zu sein.
Der junge Favorit des Achilles, Patroklos, der auf dem Kampfplatz übermütig die Rüstung des Freundes getragen hatte, war von dem Vorkämpfer der Trojaner, Hektor, erschlagen worden. Kaum hat die Nachricht von diesem unheilkündenden Vorfall im griechischen Lager die Runde gemacht, verläßt Achilles sein Zelt. Sein Zorn hat sich wieder mit ihm vereinigt und diktiert von da an ohne Schwankung die Richtung des Handelns. Der Heros verlangt eine neue Rüstung – das Jenseits selbst beeilt sich, die Forderung zu erfüllen. Der Zorn, der in den Helden einströmt, ist nicht einmal auf dessen Körper beschränkt, er setzt ein verzweigtes Geflecht von Aktionen in beiden Welten in Gang. Mit stürmischer Angriffslust übernimmt die menis die Vermittlung zwischen den Unsterblichen und den Sterblichen; sie treibt Hephaistos, den Schmiedegott, an, bei der Herstellung der neuen Waffen sein Bestes zu geben; sie verleiht Thetis, der Mutter des Helden, Flügel, um schnelle Botengänge zwischen der unterirdischen Schmiede und dem Lager der Griechen zu verrichten. Im innersten Zirkel ihrer Wirksamkeit jedoch richtet die menis den Kämpfer erneut an seinem schicksalhaften letzten Gegner aus – sie schwört ihn auf die reale Gegenwart des Kampfes ein. Sie führt ihn auf dem Schlachtfeld an die von der Vorsehung bestimmte Stelle, wo sie ihr höchstes Auflodern, ihr äußerstes Maß an erfüllender Freisetzung finden wird. Vor den Mauern Trojas setzt ihre Vollendung das Zeichen. Dort tut sie das Nötige, um jeden Zeugen an die Konvergenz von Explosion und Wahrheit zu erinnern.8 Nur der Umstand, daß zuletzt nicht der Zorn des Achilles, sondern die List des Odysseus die belagerte Stadt besiegt, läßt erkennen: Auch in der fatalen Ebene vor Troja mußte es schon einen zweiten Weg zum Erfolg geben. Sah Homer für den bloßen Zorn also keine Zukunft?
Eine solche Folgerung wäre übereilt, denn der Homer der Ilias unterläßt nichts, um die Würde des Zorns auszubreiten. Er stellt im kritischen Moment heraus, wie explosiv die Zornkraft des Achilles aufflammte. Von einem Augenblick zum nächsten stellt ihre Gegenwart sich ein. Gerade ihre Plötzlichkeit ist unentbehrlich, um ihren höheren Ursprung zu beglaubigen. Es gehört zur Tugend des frühgriechischen Helden, bereit zu sein, zum Gefäß für die jäh einströmende Energie zu werden. Noch befinden wir uns in einer Welt, deren spirituelle Verfassung offen mediumistisch geprägt ist: Wie der Prophet ein Mittler für das heilige Protestwort ist, so wird der Krieger zum Werkzeug für die Kraft, die sich in ihm schlagartig sammelt, um in die Erscheinungswelt durchzubrechen.
Eine Säkularisierung der Affekte ist in dieser Ordnung der Dinge noch unbekannt. Säkularisierung meint die Durchführung des Programms, das in normal gebauten europäischen Sätzen steckt. Durch sie wird im Realen nachgeahmt, was der Satzbau vorgibt: Subjekte wirken auf Objekte ein und erlegen ihnen ihre Herrschaft auf. Unnötig, zu sagen, daß Homers Handlungswelt von solchen Verhältnissen weit entfernt bleibt. Nicht die Menschen haben ihre Leidenschaften, die Leidenschaften haben vielmehr ihre Menschen. Der Akkusativ ist noch unregierbar. Bei dieser Lage der Dinge läßt der Eine Gott naturgemäß auf sich warten. Der theoretische Monotheismus kann erst an die Macht kommen, wenn die Philosophen das Satzsubjekt im Ernst als Weltprinzip postulieren. Dann freilich sollen auch die Subjekte ihre Leidenschaften haben und sie als ihre Herren und Besitzer kontrollieren. Bis dahin herrscht der spontane Pluralismus, in dem Subjekte und Objekte ständig die Plätze tauschen.
Daher also: Den Zorn muß man im reifen Moment besingen, wenn er seinem Träger widerfährt – nichts anderes hat Homer im Sinn, wenn er die lange Belagerung von Troja und den kaum noch erhofften Sturz der Stadt ganz auf die mysteriöse Kampfkraft des Protagonisten bezieht, wegen dessen Grollen die Sache der Griechen zur Erfolglosigkeit verurteilt war. Er nutzt die Gunst der Stunde, in der die menis in ihren Träger einströmt. Die epische Erinnerung braucht dann nur dem Gang der Ereignisse zu folgen, der durch die Konjunkturen der Kräfte diktiert wird. Entscheidend ist, daß der Krieger selbst, sobald der erhabene Zorn sich regt, eine Art numinoser Gegenwart erlebt. Darum allein kann der heroische Zorn bei seinem begabtesten Werkzeug mehr bedeuten als einen profanen Koller. Im höheren Ton gesprochen: Durch die Aufwallung redet der Gott des Schlachtfelds zum Kämpfer. Man versteht sofort, warum in solchen Augenblicken von zweiten Stimmen wenig zu hören ist. Kräfte dieser Art sind, an ihren naiven Anfängen zumindest, monothematisch, da sie den ganzen Mann in Anspruch nehmen. Sie fordern die ungeteilte Bühne für den Ausdruck des einen Affekts.9 Beim reinen Zorn gibt es kein verknotetes Innenleben, keine psychische Hinterwelt und kein privates Geheimnis, durch das der Held menschlich verständlicher würde. Vielmehr gilt der Grundsatz, das Innere des Akteurs solle ganz manifest und öffentlich, ganz Tat und wenn möglich Gesang werden. Dem aufwallenden Zorn ist es eigentümlich, in seinem verschwenderischen Ausdruck restlos aufzugehen; wo die totale Expressivität den Ton angibt, ist von Zurückhaltung und Aufsparung keine Rede. Natürlich wird auch immer »um etwas« gekämpft, vor allem aber dient der Kampf der Offenbarung der kämpfenden Energie an sich – die Strategie, das Kriegsziel, die Beute kommen später.
Wo der Zorn aufflammt, ist der vollständige Krieger gegeben. Durch den Aufbruch des entflammten Helden in den Kampf verwirklicht sich eine Identität des Menschen mit seinen treibenden Kräften, von der die häuslichen Menschen in ihren besten Momenten träumen. Auch sie, sosehr sie ans Vertagen und Wartenmüssen gewohnt sind, haben die Erinnerung an die Momente des Lebens nicht ganz vergessen, in denen der Elan des Handelns aus den Umständen selbst zu fließen schien. Wir könnten dieses Einswerden mit dem puren Antrieb, eine Wendung Robert Musils aufnehmend, die Utopie des motivierten Lebens nennen.10
Für die seßhaften Leute freilich, die Bauern, die Handwerker, die Tagelöhner, die Schreiber, die frühen Beamten, wie für die späteren Therapeuten und Professoren geben die zögernden Tugenden die Richtung vor – wer auf der Tugendbank sitzt, kann gewöhnlich nicht wissen, wie seine nächste Aufgabe lautet. Er muß den Rat verschiedener Seiten hören und seine Entscheidungen aus einem Gemurmel herauslesen, in dem kein Tenor die Hauptstimme verkörpert. Für die Alltagsmenschen ist Evidenz im Augenblick unerreichbar; ihnen helfen bestenfalls die Krücken der Gewohnheit weiter. Was die Gewohnheit bietet, sind bodennahe Surrogate von Gewißheit. Die mögen stabil sein, doch die lebendige Gegenwart der Überzeugung gewähren sie nicht. Wer hingegen den Zorn hat, für den ist die blasse Zeit vorüber. Der Nebel steigt, die Konturen härten sich, nun führen klare Linien zum Objekt. Der glühende Angriff weiß, wohin er will. Der in Hochform Zürnende »fährt in die Welt wie die Kugel in die Schlacht«.11
Die thymotische Welt: Stolz und Krieg
Es ist der ingeniösen Homer-Lektüre des Altphilologen Bruno Snell zu verdanken, daß wir beim zeitgenössischen Neu-Studium der Ilias auf die eigentümlich vormoderne Struktur der epischen Psychologie und Handlungsführung aufmerksam geworden sind. In dem Leitessay seines noch immer anregenden Buches Die Entdeckung des Geistes, der vom Menschenbild Homers handelt, hat er einen eminenten Umstand herausgearbeitet: Den epischen Personen der ältesten Schriftepoche im Westen fehlen noch weitgehend die prägenden Merkmale der klassisch verstandenen Subjektivität, insbesondere die reflektierende Innerlichkeit, das intime Selbstgespräch und die vom Gewissen gelenkte Bemühung um Affektkontrolle.12 Snell entdeckt bei Homer das latente Konzept der Komposit- oder Behälterpersönlichkeit, die in manchen Hinsichten dem Bild des postmodernen Menschen mit chronischen »dissoziativen Störungen« ähnelt. Von ferne läßt der frühantike Heros tatsächlich an die »multiple Persönlichkeit« heutigen Typs denken. Bei ihm scheint noch kein inneres hegemonisches Prinzip, kein kohärentes »Ich«, gegeben zu sein, das für die Einheit und Selbsterfassung des psychischen Feldes aufkommt. Vielmehr erweist sich die »Person« als ein Treffpunkt von Affekten oder Partialenergien, die sich bei ihrem Gastgeber, dem erlebnis- und handlungsfähigen Individuum, wie Besucher von weit her einfinden, um ihn für ihre Anliegen zu verwenden.
Der Zorn des Helden darf demnach nicht als ein inhärentes Attribut seiner Persönlichkeitsstruktur verstanden werden. Der erfolgreiche Krieger ist mehr als nur ein übermäßig reizbarer und aggressiver Charakter. Auch hat es wenig Sinn, über homerische Figuren so zu reden, wie Schulpsychologen es über Problemschüler tun. Sie würden Achill sofort kunstgerecht als einen Delegierten überspannter elterlicher Ambitionen hinstellen13 – als wäre er der Vorläufer eines psychisch verkrüppelten Tenniswunderknaben, dessen Erzeuger-Trainer bei jedem Spiel in der ersten Reihe sitzen. Da wir uns hier noch ganz in einem von der Behälter-Psychologie dominierten Bereich bewegen, muß man auf die Grundregel dieses seelischen Universums achten: Der in Intervallen aufflammende Zorn stellt ein energetisches Supplement der heroischen Psyche dar, nicht deren persönliche Eigenschaft oder intimen Komplex. Das griechische Kennwort für das »Organ« in der Brust von Helden und Menschen, von dem die großen Aufwallungen ausgehen, lautet thymós – es bezeichnet den Regungsherd des stolzen Selbst, zugleich auch den rezeptiven »Sinn«, durch den die Appelle der Götter sich den Sterblichen kundgeben. Die supplementäre oder »hinzutretende« Eigenschaft der Aufwallungen im thymós erklärt im übrigen die für die Modernen so befremdliche Abwesenheit einer affektzügelnden Instanz beim homerischen Personal. Der Held ist sozusagen ein Prophet, dem die Aufgabe zufällt, die Botschaft seiner Kraft auf der Stelle wahr zu machen. Die Kraft des Helden begleitet diesen in der Art, wie ein Genius die ihm schutzbefohlene Person begleitet. Wird die Kraft aktuell, muß ihr Schützling mit ihr gehen.14
Obwohl der Akteur nicht der Herr und Besitzer seiner Affekte ist, wäre es verfehlt zu meinen, er sei nur ihr blindes oder willenloses Instrument. Die menis gehört zu der Gruppe der invasiven Energien, von denen die poetische wie die philosophische Psychologie der Hellenen lehrte, sie seien als Gnadengaben aus der Überwelt zu betrachten. Wie jeder von oben Begabte aufgefordert ist, das ihm anvertraute Geschenk sorgfältig zu verwalten, muß sich der Held als Hüter des Zorns in ein bewußtes Verhältnis zu diesem setzen. Heidegger, den man sich gut als nachdenklichen Touristen in der Ebene vor Troja denken kann, würde wohl sagen: Auch kämpfen heißt danken.
Nach der Umstellung der griechischen Psyche von heroisch-kriegerischen Tugenden auf stadtbürgerliche Vorzüge verschwindet der Zorn allmählich aus der Liste der Charismen. Es bleiben allein die geisthafteren Enthusiasmen zurück, wie Platons Phaidros sie in einer Übersicht über die wohltätigen Besessenheiten der Psyche aufzählt, vornehmlich die inspirierte Heilkunde, die Gabe der Weissagung und der von der Muse gewährte begeisternde Gesang. Platon führt darüber hinaus einen paradoxen neuartigen Enthusiasmus ein: die nüchterne mania der Ideenschau, auf die sich die von ihm begründete neue Wissenschaft der »Philosophie« stützen wird. Unter dem Einfluß dieser Disziplin entfernt sich die durch logische Übungen erhellte »manische« Psyche endgültig von ihren »menischen« Anfängen – die Austreibung des großen Zorns aus der Kultur hat begonnen.
Seither ist der Zorn unter Bürgern nur noch ein mit strengen Auflagen willkommener Gast; als Furor alten Stils paßt er überhaupt nicht mehr in die urbane Welt. Allein auf der Bühne des athenischen Dionysostheaters wird er noch hin und wieder in seiner altertümlich-wahnhaften Heftigkeit vorgeführt, wie im Aias des Sophokles oder in den Bakchen des Euripides, doch in der Regel bloß, um die Sterblichen an die furchtbare Freiheit der Götter zu erinnern, zugrunde zu richten, wen sie wollen. Die stoischen Philosophen, die sich in den folgenden Generationen an das zivile Publikum wenden, werden in bester Sophistenart die Behauptung vertreten, der Zorn sei letztlich »unnatürlich«, weil er dem vernunfthaften Wesen des Menschen widerspricht.15
Die Domestikation des Zorns erzeugt die antike Form einer neuen Männlichkeit. Tatsächlich können die für die Polis nützlichen Reste des Affekts in die bürgerliche Thymos-Pflege übernommen werden: Er überlebt als »Mannesmut« (andreia), ohne den es auch für Anhänger städtischer Lebensweisen keine Selbstbehauptung gibt. Ein zweites Leben darf er zudem als nützlicher und »gerechter Zorn« führen, und als solcher ist er für die Abwehr von Beleidigungen und unbilligen Zumutungen zuständig. Zusätzlich hilft er den Bürgern, für das Gute und Richtige (modern gesprochen für Interessen) lebhaft einzutreten. Ohne Beherztheit – so sollte man den Ausdruck thymós jetzt besser übersetzen – ist ein Stadtbürgertum bekanntlich undenkbar. (Gerade für Deutsche ist dieses Thema nicht ohne Reiz, denn sie bringen nach 1945 eine Sonderausgabe von Beherztheit heraus – die vielgelobte Zivilcourage, die Magerstufe des Muts für Verlierer, mit der man einer politisch zaghaften Bevölkerung die Freuden der Demokratie näherbringt.) Darüber hinaus hängt die Möglichkeit der Freundschaft zwischen erwachsenen Männern in der Stadt weiterhin von thymotischen Prämissen ab, denn als Freund unter Freunden, als Gleicher unter Gleichen, kann seine Rolle nur spielen, wer in den Mitbürgern das profilstarke Hervortreten von allgemein gewürdigten Tugenden schätzt.16 Man möchte nicht nur auf sich selber stolz sein können, sondern ebenso auf das alter ego, den Freund, der sich vor den Augen der Kommune auszeichnet. Das In-gutem-Ruf-Stehen der miteinander wetteifernden Männer stiftet das thymotische Fluidum eines selbstsicheren Gemeinwesens. Der thymós der Einzelnen erscheint nun als Teil einer Feldkraft, die dem gemeinsamen Willen zum Erfolg Form verleiht. In diesem Horizont entfaltet sich die erste philosophische Psychologie Europas als politische Thymotik.
Jenseits der Erotik
In unseren Tagen konkretisiert sich der Verdacht, die Psychoanalyse – die dem 20. Jahrhundert weithin als psychologisches Leitwissen diente – müsse die Natur ihres Gegenstands in einer wesentlichen Hinsicht verkannt haben. Aus sporadischen Einwänden gegen das psychoanalytische Lehrgebäude, die bis in die Frühzeit der Doktrin zurückreichen, ist heute eine theoretisch gesicherte Verweigerung der Gefolgschaft geworden. Deren Ausgangspunkt sind weniger die endlosen Querelen über die mangelnde »wissenschaftliche« Beweisbarkeit psychoanalytischer Thesen und Resultate (wie sie jüngst anläßlich des problematischen Livre noir de la psychanalyse wieder einmal für Aufsehen sorgten) als vielmehr die immer größer werdende Kluft zwischen den psychischen Phänomenen und den schulischen Begriffen – eine Malaise, die von den kreativen Autoren und Praktikern der psychoanalytischen Bewegung seit längerem offen diskutiert wird. Auch die chronischen Zweifel an ihrer spezifischen Wirksamkeit machen nicht den Kern des Widerspruchs aus.
Die Quelle des prinzipiellen Mißverständnisses, dem sich die Psychoanalyse verschrieben hatte, lag in ihrem naturalistisch verkleideten kryptophilosophischen Vorsatz, die conditio humana insgesamt von der Libidodynamik her, mithin von der Erotik, zu erklären. Dies hätte kein Verhängnis bedeuten müssen, wäre das legitime Interesse der Analytiker für den energiereichen Eros-Pol der Psyche mit einer ebenso lebhaften Zuwendung zum Pol der thymotischen Energien verbunden gewesen. Nie war sie jedoch dazu bereit, mit gleicher Ausführlichkeit und Grundsätzlichkeit von der Thymotik des Menschen beiderlei Geschlechts zu handeln: von seinem Stolz, seinem Mut, seiner Beherztheit, seinem Geltungsdrang, seinem Verlangen nach Gerechtigkeit, seinem Gefühl für Würde und Ehre, seiner Indignation und seinen kämpferisch-rächerischen Energien. Etwas herablassend überließ man Phänomene dieser Art den Anhängern Alfred Adlers und anderen vorgeblich schmalbrüstigen Interpreten der sogenannten Minderwertigkeitskomplexe. Allenfalls räumte man ein, daß Stolz und Ehrgeiz die Oberhand gewinnen können, wo sexuelle Wünsche sich nicht adäquat verwirklichen lassen. Dieses Umschalten der Psyche zu einem zweiten Programm nannte man mit dürrer Ironie Sublimation – Herstellung von Erhabenem für jene, die es nötig haben.
Von einer zweiten Grundkraft des psychischen Feldes wollte die klassische Psychoanalyse zumeist nichts wissen – daran konnten Zusatzkonstrukte wie der »Todestrieb« oder eine mythische Figur namens »Destrudo« alias Primäraggression nur wenig ändern. Auch die später hinzugefügte Ich-Psychologie war nur kompensatorisch sinnvoll, und es war verständlich, wenn sie den klassischen Freudianern, Partisanen des Unbewußten, stets ein Dorn im Auge bleiben sollte.
Ihrem erotodynamischen Ansatz entsprechend brachte die Psychoanalyse viel von dem Haß ans Licht, der die dunkle Kehrseite der Liebe bildet. Es gelang ihr zu zeigen, daß das Hassen ähnlichen Gesetzen unterliegt wie das Lieben und daß hier wie dort Projektion und Wiederholungszwang das Kommando führen. Sie blieb weitgehend stumm angesichts des Zorns, der aus dem Streben nach Erfolg, Ansehen, Selbstachtung und dessen Rückschlägen entspringt. Das sichtbarste Symptom der freiwilligen Unwissenheit, die aus dem analytischen Paradigma folgte, ist die Narzißmustheorie, jenes zweite Aufgebot der psychoanalytischen Doktrin, mit dem die Unstimmigkeiten des ödipalen Theorems beseitigt werden sollten. Bezeichnenderweise wendet die Narzißmus-These ihr Interesse zwar den menschlichen Selbstaffirmationen zu, möchte diese jedoch gegen alle Plausibilität in den Bannkreis eines zweiten erotischen Modells einschließen. Sie nimmt die vergebliche Mühe auf sich, die eigensinnige Fülle der thymotischen Phänomene von der Autoerotik und deren pathogenen Zersplitterungen abzuleiten. Zwar formuliert sie ein respektables Bildungsprogramm für die Psyche, das die Transformation der sogenannnten narzißtischen Zustände in reife Objektliebe zum Ziel hat. Es kam ihr nie in den Sinn, einen analogen Bildungsweg für die Hervorbringung des stolzen Erwachsenen, des Kämpfers und Ambitionsträgers, zu entwerfen. Das Wort »Stolz« ist für Psychoanalytiker meist nur ein inhaltsleerer Eintrag ins Lexikon des Neurotikers. Zu dem, was das Wort bezeichnet, haben sie aufgrund einer Verlernübung, die sich Ausbildung nennt, den Zugang praktisch verloren.
Narziß jedoch ist unfähig, Ödipus zu helfen. Die Wahl dieser mythischen Modellpersonen verrät mehr über den Wähler als über die Natur des Gegenstands. Wie sollte ein Jüngling mit grenzdebilen Zügen, der nicht zwischen sich und seinem Spiegelbild unterscheiden kann, die Schwächen eines Mannes kompensieren, der den eigenen Vater erst in dem Moment kennenlernt, in dem er ihn totschlägt, und dann aus Versehen mit der eigenen Mutter Nachkommen zeugt? Beide sind Liebende auf trüben Pfaden, beide verirren sich so sehr in erotischen Abhängigkeiten, daß nicht leicht zu entscheiden wäre, wer von ihnen als der Elendere gelten soll. Eine Galerie der Prototypen menschlicher Kläglichkeit ließe sich überzeugend mit Ödipus und Narziß beginnen. Man wird solche Figuren bedauern, nicht bewundern, und soll doch in ihren Schicksalen, wenn es nach den Lehren der Schule ginge, die mächtigsten Muster für die Lebensdramen aller anerkennen. Welche Tendenz diesen Beförderungen zugrunde liegt, ist unschwer zu durchschauen. Wer Menschen zu Patienten – das heißt zu Personen ohne Stolz – machen möchte, kann nichts Besseres tun, als Figuren wie diese zu Emblemen der conditio humana zu erhöhen. In Wahrheit hätte ihre Lektion in der Warnung liegen müssen, wie leicht die unberatene und vereinseitigte Liebe ihre Subjekte zum Narren hält. Nur wenn das Ziel darin besteht, den Menschen ob ovo als Hampelmann der Liebe zu portraitieren, wird man den elenden Anbeter des eigenen Bildes und den ebenso elenden Liebhaber seiner Mutter zu Mustern menschlichen Daseins erklären. Man darf im übrigen konstatieren, daß die Geschäftsgrundlagen der Psychoanalyse inzwischen durch die übermäßige Verbreitung ihrer erfolgreichsten Fiktionen unterhöhlt worden sind. Von ferne weiß die kühlere Jugend unserer Tage noch, was es mit Narziß und Ödipus auf sich hatte – an ihren Schicksalen nimmt sie dennoch eher gelangweilt Anteil. Sie sieht in ihnen keine Urbilder des Menschseins mehr, sondern bedauernswerte, im Grunde ziemlich belanglose Versager.
Wer sich für den Menschen als Träger von stolzen und selbstaffirmativen Regungen interessiert, sollte sich entscheiden, den Knoten der überforderten Erotik zu durchschlagen. Man muß dann wohl zu der Grundansicht der philosophischen Psychologie bei den Griechen zurückkehren, nach welcher sich die Seele nicht allein im Eros und seinen Intentionen auf das eine und viele äußert, vielmehr ebensosehr in den Regungen des Thymos. Während die Erotik Wege zu den »Objekten« zeigt, die uns fehlen und durch deren Besitz oder Nähe wir uns ergänzt fühlen, erschließt die Thymotik den Menschen die Bahnen, auf denen sie geltend machen, was sie haben, können, sind und sein wollen. Der Mensch ist der Überzeugung der ersten Psychologen zufolge durchaus zum Lieben geschaffen, und dies gleich zweifach: gemäß dem hohen und vereinigenden Eros, sofern die Seele von der Erinnerung an eine verlorene Vollkommenheit gezeichnet ist; und gemäß dem populären und zerstreuenden Eros, sofern sie ständig einer bunten Vielzahl von »Begierden« (besser von Appetit-Attraktion-Komplexen) unterliegt. Keinesfalls darf er sich ausschließlich den begehrenden Affekten ausliefern. Mit ebenso großem Nachdruck soll er über die Forderungen seines thymós wachen, wenn nötig sogar auf Kosten der erotischen Neigungen. Er ist herausgefordert, seine Würde zu wahren und sich Selbstachtung wie Achtung durch andere im Licht hoher Kriterien zu verdienen. Dies ist so und kann nicht anders sein, weil das Leben von jedem einzelnen verlangt, auf den äußeren Bühnen des Daseins hervorzutreten und seine Kräfte unter seinesgleichen zur Geltung zu bringen, zum eigenen wie zum gemeinsamen Vorteil.
Wer die zweite Bestimmung des Menschen zugunsten der ersten aufheben möchte, weicht der Notwendigkeit einer doppelten psychischen Bildung aus und verkehrt das Verhältnis der Energien im inneren Haushalt – zum Schaden des Hauswirts. Solche Umkehrungen beobachtete man in der Vergangenheit vor allem in den religiösen Orden und den demutstrunkenen Subkulturen, in denen schöne Seelen sich gegenseitig Friedensgrüße schicken. In diesen ätherischen Kreisen wurde das gesamte thymotische Feld durch den Vorwurf der superbia abgeriegelt, indessen man vorzog, in den Wonnen der Bescheidenheit zu schwelgen. Ehre, Ambition, Stolz, hohes Selbstgefühl – dies alles wurde hinter einer dichten Wand von moralischen Vorschriften und psychologischen »Erkenntnissen« verborgen, die allesamt darauf ausgingen, den sogenannten Egoismus in Acht und Bann zu tun. Das in den imperialen Kulturen und ihren Religionen schon früh statuierte Ressentiment gegen das Ich und seine Neigung, sich und das Seine zur Geltung zu bringen, statt in der Unterordnung glücklich zu werden, lenkte über nicht weniger als zwei Jahrtausende hin von der Einsicht ab, daß der vielgescholtene Egoismus in Wahrheit oft nur das Incognito der besten menschlichen Möglichkeiten darstellt. Erst Nietzsche hat in dieser Frage wieder für klare Verhältnisse gesorgt.
Bemerkenswerterweise erreicht der aktuelle Konsumismus dieselbe Ausschaltung des Stolzes zugunsten der Erotik ohne altruistische, holistische und sonstige vornehme Ausreden, indem er den Menschen ihr Interesse an Würde durch materielle Vergünstigungen abkauft. So kommt das anfangs völlig unglaubwürdige Konstrukt des homo oeconomicus beim postmodernen Verbraucher doch ans Ziel. Bloßer Konsument ist, wer keine anderen Begierden mehr kennt oder kennen soll als jene, die, um mit Platon zu sprechen, aus dem erotischen oder verlangenden »Teil der Seele« hervorgehen. Nicht umsonst ist die Instrumentalisierung der Nudität das Leitsymptom der Konsumkultur, sofern Nacktheit immer mit einem Anschlag aufs Begehren einhergeht. Immerhin sind die zum Verlangen aufgerufenen Klienten zumeist nicht ganz ohne Abwehrkräfte. Sie fangen den Dauerangriff auf die Würde ihrer Intelligenz entweder mit Dauerironie oder mit erlernter Gleichgültigkeit auf.
Die Kosten der einseitigen Erotisierung sind hoch. Tatsächlich macht die Abdunkelung des Thymotischen das menschliche Verhalten in sehr weiten Bereichen unverständlich – ein überraschendes Ergebnis, zieht man in Betracht, daß es nur durch psychologische Aufklärung zu erzielen war. Hat man sich dieser Verkennung verschrieben, begreift man die Menschen in Spannungs- und Kampfsituationen nicht mehr. Wie üblich vermutet dieses Nichtverstehen den Fehler überall, nur nicht bei der eigenen Optik. Kaum treten bei Individuen oder Gruppen »Symptome« wie Stolz, Empörung, Zorn, Ambition, hoher Selbstbehauptungswille und akute Kampfbereitschaft auf, nimmt der Parteigänger der thymós-vergessenen therapeutischen Kultur Zuflucht zu der Vorstellung, diese Leute müßten Opfer eines neurotischen Komplexes sein. Die Therapeuten stehen hiermit in der Tradition der christlichen Moralisten, die von der natürlichen Dämonie der Selbstliebe sprechen, sobald die thymotischen Energien sich offen zu erkennen geben. Haben die Europäer über den Stolz wie den Zorn nicht von den Tagen der Kirchenväter an zu hören bekommen, solche Regungen seien es, die den Verworfenen den Weg in den Abgrund wiesen? Tatsächlich führt seit Gregor I. der Stolz, alias superbia, die Liste der Kardinalsünden an. Fast zweihundert Jahre früher hatte Aurelius Augustinus ihn als die Matrix der Auflehnung gegen das Göttliche beschrieben. Für den Kirchenvater bedeutet die superbia eine Tathandlung des bewußten Nicht-so-wollens-wie-der-Herr-will (eine Regung, deren gehäuftes Vorkommen bei Mönchen und Staatsdienern begreiflich scheint). Wenn es vom Stolz heißt, er sei die Mutter aller Laster, drückt das die Überzeugung aus, der Mensch sei zum Gehorchen geschaffen – und jede Regung, die aus der Hierarchie herausführt, kann nur den Schritt ins Verderben bedeuten.17
Man hat in Europa bis zur Renaissance und zur Schaffung einer neuen Formation des städtischen und bürgerlichen Stolzes warten müssen, bevor die dominierende humilitas-Psychologie, die Bauern, Klerikern und Vasallen auf den Leib geschrieben war, durch ein neo-thymotisches Menschenbild zumindest partiell zurückgedrängt werden konnte. Unverkennbar kommt dem Aufstieg des Nationalstaats bei der Neugewichtung der Leistungsaffekte eine Schlüsselrolle zu. Es ist kein Zufall, daß dessen Vordenker, allen voran Machiavelli, Hobbes, Rousseau, Smith, Hamilton und Hegel, ihren Blick wieder auf den Menschen als Träger wertender Leidenschaften gerichtet haben, besonders Ruhmbegierde, Eitelkeit, amour-propre, Ehrgeiz und Verlangen nach Anerkennung. Keiner dieser Autoren hat die Gefahren verkannt, die solchen Affekten innewohnen; dennoch haben die meisten den Versuch gewagt, deren produktive Aspekte für das Zusammensein der Menschen hervorzukehren. Seit auch das Bürgertum sein Interesse an Eigenwert und Würde artikuliert, und mehr noch seit die unternehmerischen Menschen des bürgerlichen Zeitalters einen neo-aristokratischen Begriff von selbstverdientem Erfolg entwickeln,18 werden die traditionellen Demutsdressuren kompensiert durch eine offensive Nachfrage nach Gelegenheiten, die eigenen Kräfte, Künste und Vorzüge vor einem Publikum zur Schau zu stellen.
Unter dem Deckbegriff des Erhabenen erhält die Thymotik in der modernen Welt ihre zweite Chance. Kein Wunder, daß der gute Mensch der Gegenwart auch vor dem Erhabenen instinktsicher zurückweicht, als witterte er in ihm die alte Gefahr. Bedrohlicher noch bringt das moderne Lob der Leistung die thymotische Seite der Existenz zu neuer Aufstellung, und nicht ohne Sinn für die strategische Lage widersetzen sich die Partisanen des weinerlich-kommunikativen Eros laut klagend diesem vorgeblich menschenfeindlichen Prinzip.19
Die Aufgabe lautet also, eine Psychologie des Eigenwertbewußtseins und der Selbstbehauptungskräfte wiederzugewinnen, die den psychodynamischen Grundgegebenheiten eher gerecht wird. Das setzt die Korrektur des erotologisch halbierten Menschenbildes voraus, das die Horizonte des 19. und 20. Jahrhunderts umstellt. Zugleich wird eine empfindliche Distanzierung von tief eingeschliffenen Konditionierungen der westlichen Psyche notwendig, in ihren älteren religiösen Ausprägungen ebenso wie ihren jüngeren Metamorphosen.
Zunächst und vor allem ist Abstand zu gewinnen von der unverhüllten Bigotterie der christlichen Anthropologie, nach welcher der Mensch in seiner Eigenschaft als Sünder das hochmutkranke Tier abgibt, dem nur durch Glaubensdemut geholfen werden kann. Man soll sich nicht einbilden, eine hiervon Distanz schaffende Bewegung wäre leicht auszuführen oder gar schon vollzogen. Wenngleich die Phrase »Gott ist tot« jetzt schon von Journalisten geläufig in den Computer eingegeben wird, bestehen die theistischen Demutsdressuren im demokratischen Konsensualismus nahezu ungebrochen fort. Es ist, wie man sieht, ohne weiteres möglich, Gott sterben zu lassen und doch ein Volk von Quasi-Gottesfürchtigen zu behalten. Mögen die meisten Zeitgenossen von anti-autoritären Strömungen erfaßt sein und gelernt haben, eigene Geltungsbedürfnisse auszudrücken, so halten sie doch in psychologischer Sicht an einem Verhältnis semirebellischer Vasallität gegenüber dem versorgenden Herrn fest. Sie verlangen »Respekt« und wollen auf die Vorteile der Abhängigkeit nicht verzichten. Noch schwieriger dürfte es für viele sein, sich von der verhüllten Bigotterie der Psychoanalyse zu emanzipieren, nach deren Dogmatik auch der kraftvollste Mensch nicht mehr sein kann als der bewußte Dulder seiner liebeskranken Kondition, die Neurose heißt. Die Zukunft der Illusionen ist durch die große Koalition gesichert: Das Christentum wie die Psychoanalyse können ihren Anspruch, die letzten Horizonte des Wissens vom Menschen zu umschreiben, mit Aussicht auf Erfolg verteidigen, solange sie sich darauf verstehen, ein Monopol für die Definition der menschlichen Kondition durch den konstitutiven Mangel, vormals besser bekannt als Sünde, aufrechtzuerhalten. Wo der Mangel an der Macht ist, führt die »Ethik der Würdelosigkeit« das Wort.
Solange also die beiden klugen Bigotteriesysteme die Szene beherrschen, ist die Sicht auf die thymotische Dynamik menschlicher Existenz verstellt, in bezug auf Individuen nicht weniger als in bezug auf politische Gruppen. Folglich ist der Zugang zum Studium der Selbstbehauptungs- und Zorndynamik in psychischen und sozialen Systemen praktisch blockiert. Stets muß man dann mit den ungeeigneten Konzepten der Erotik auf die thymotischen Phänomene zugreifen. Unter der bigotten Blockade kommt die direkte Intention nie wirklich zur Sache, da man sich nur noch mit schrägen Zügen den Tatsachen nähern kann – immerhin sind diese, ihrer erotischen Fehlauffassung zum Trotz, nie ganz zu verdunkeln. Ist diese Verlegenheit beim Namen genannt, wird klar, daß ihr allein durch die Umstellung des grundbegrifflichen Apparats abzuhelfen ist.
Theorie der Stolz-Ensembles
An dem gründlich eingeübten Fehlansatz der psychologischen Anthropologie des Westens hatte bisher vor allem die politische Wissenschaft, besser ausgedrückt: die Kunst der psychopolitischen Steuerung von Gemeinwesen, zu leiden. Ihr fehlte ein ganzer Set an Axiomen und Begriffen, die der Natur ihres Gegenstands angemessen wären. Was aus der Sicht der Thymotik umweglos als primäre Gegebenheit anzusetzen ist, läßt sich nämlich auf dem Umweg über die verfügbaren erotodynamischen Begriffe entweder gar nicht oder nur gewunden darstellen. Wir nennen an dieser Stelle die sechs wichtigsten Grundsätze, die als Ausgangspunkte für eine Theorie thymotischer Einheiten dienen können:
– Politische Gruppen sind Ensembles, die endogen unter thymotischer Spannung stehen. – Politische Aktionen werden durch Spannungsgefälle zwischen Ambitionszentren in Gang gebracht.
– Politische Felder werden durch den spontanen Pluralismus selbstaffirmativer Kräfte geformt, deren Verhältnisse zueinander sich kraft interthymotischer Reibungen verändern.
– Politische Meinungen werden konditioniert und redigiert durch symbolische Operationen, die einen durchgehenden Bezug zu den thymotischen Regungen der Kollektive aufweisen.
– Rhetorik – als Kunstlehre der Affektlenkung in politischen Ensembles – ist angewandte Thymotik.
– Machtkämpfe im Innern politischer Körper sind immer auch Vorrangkämpfe zwischen thymotisch geladenen, umgangssprachlich: ehrgeizigen Individuen mitsamt ihren Gefolgschaften; die Kunst des Politischen schließt darum die Verfahren der Verliererabfindung ein.
Geht man von dem natürlichen Pluralismus thymotischer Kraftzentren aus, muß man ihre Beziehungen gemäß deren spezifischen Feldgesetzlichkeiten untersuchen. Wo reale Kraft-Kraft-Beziehungen gegeben sind, hilft der Rekurs auf die Selbstliebe der Akteure nicht weiter – oder doch nur in untergeordneten Aspekten. Statt dessen ist zunächst zu statuieren, daß politische Einheiten (konventionell als Völker und deren Untergruppen aufgefaßt) in systemischer Sicht metabolische Größen sind. Sie haben allein als produzierende und konsumierende, stressverarbeitende, mit Gegnern und anderen entropischen Faktoren kämpfende Entitäten Bestand. Bemerkenswerterweise haben christlich und psychoanalytisch geprägte Denker bis heute Mühe zuzugeben, daß Freiheit ein Begriff ist, der nur im Rahmen einer thymotischen Menschensicht Sinn ergibt. Ihnen sekundieren mit hohem Eifer die Ökonomen, die den Menschen als das konsumierende Tier ins Zentrum ihrer Appelle stellen – sie wollen dessen Freiheit nur bei der Wahl der Futternäpfe am Werk sehen.
Durch Stoffwechseltätigkeiten werden in einem vitalen System erhöhte Innenleistungen stabilisiert, auf der physischen wie der psychischen Ebene. Das Phänomen Warmblütigkeit ist hiervon die eindrucksvollste Verkörperung. Mit ihm vollzog sich, etwa zur »Halbzeit der Evolution«, die Emanzipation des Organismus von den Umgebungstemperaturen – der biologische Aufbruch in die Freibeweglichkeit. Von ihr hängt alles ab, was später in den unterschiedlichsten Sinnabschattungen Freiheit heißen wird. Biologisch betrachtet, bedeutet Freiheit das Vermögen, das gesamte Potential spontaner Bewegungen zu aktualisieren, die einem Organismus eigentümlich sind.
Die Lossagung des warmblütigen Organismus vom Primat des Milieus findet ihr mentales Gegenstück in den thymotischen Regungen der Einzelnen wie der Gruppen. Als moralischer Warmblüter ist der Mensch auf die Aufrechterhaltung eines gewissen internen Selbstachtungsniveaus angewiesen – auch dies setzt eine Tendenz zur Loslösung des »Organismus« vom Vorrang des Milieus in Gang. Wo sich die stolzen Regungen geltend machen, entsteht auf der psychischen Ebene ein Innen-Außen-Gefälle, in dem der Selbstpol naturgemäß den höheren Tonus aufweist. Wer die untechnischen Ausdrucksweisen bevorzugt, kann dieselbe Vorstellung durch die These wiedergeben, die Menschen besäßen einen angeborenen Sinn für Würde und Gerechtigkeit. Dieser Intuition hat jede politische Organisation gemeinsamen Lebens Rechnung zu tragen.
Zum Betrieb moralisch anspruchsvoller Systeme, alias Kulturen, gehört die Selbststimulierung der Akteure durch die Hebung thymotischer Ressourcen wie Stolz, Ehrgeiz, Geltungswille, Indignationsbereitschaft und Rechtsempfinden. Einheiten dieser Art bilden in ihrem Lebensvollzug lokalspezifische Eigenwerte aus, die bis zum Gebrauch universalistischer Dialekte führen können. Es läßt sich durch empirische Beobachtung schlüssig nachweisen, wie erfolgreiche Ensembles durch einen höheren inneren Tonus in Form gehalten werden – an dem im übrigen häufig der aggressive oder provozierende Stil des Umweltbezugs auffällt. Die Stabilisierung des Eigenwertbewußtseins in einer Gruppe obliegt einem Regelwerk, das die jüngere Kulturtheorie als das Decorum bezeichnet.20 In Siegerkulturen wird das Decorum verständlicherweise an den polemischen Werten geeicht, denen man die bisherigen Erfolge verdankt. Daher die enge Liaison zwischen Stolz und Sieg in allen aus erfolgreich geführten Kämpfen hervorgegangenen Gemeinwesen. Stolzdynamisch bewegte Gruppen haben es manchmal sogar nicht ungern, bei ihren Nachbarn und Rivalen unbeliebt zu sein, solange das ihrem Souveränitätsgefühl Auftrieb gibt.
Sobald die Stufe der anfänglichen Interignoranz zwischen mehreren metabolischen Kollektiven überschritten ist, das heißt, wenn die gegenseitige Nichtwahrnehmung ihre Unschuld verloren hat, geraten sie unvermeidlich unter Vergleichsdruck und Beziehungszwang. Dadurch wird eine Dimension erschlossen, die man im weiteren Sinn als die der Außenpolitik bezeichnen kann. Infolge ihres Füreinander-wirklich-Werdens fangen die Kollektive an, sich gegenseitig als koexistierende Größen zu begreifen. Durch Koexistenzbewußtsein werden die Fremden als chronische Stressoren wahrgenommen, und die Beziehungen zu ihnen müssen zu Institutionen ausgebaut werden – in der Regel unter der Form von Konfliktvorbereitungen oder der diplomatischen Bemühung um das Wohlwollen der anderen Seite. Von da an reflektieren die Gruppen ihr eigenes Wertverlangen in den manifesten Wahrnehmungen der anderen. Die Gifte der Nachbarschaft sickern in die aufeinander bezogenen Ensembles ein. Diese moralische Reflexion ineinander hat Hegel mit dem folgenreichen Begriff der Anerkennung bezeichnet. Er weist damit hellsichtig auf eine mächtige Quelle von Satisfaktionen oder Satisfaktionsphantasien hin. Daß er damit zugleich den Ursprung zahlloser Irritationen benannt hat, versteht sich aus der Natur der Sache. Auf dem Feld des Kampfs um Anerkennung wird der Mensch zu dem surrealen Tier, das für einen bunten Fetzen, eine Fahne, einen Kelch sein Leben riskiert.
Wir sehen im gegebenen Kontext, daß Anerkennung besser als eine Hauptachse interthymotischer Beziehungen neu beschrieben werden sollte. Was die zeitgenössische Sozialphilosophie mit wechselndem Erfolg unter dem Stichwort Intersubjektivität verhandelt hat, meint häufig nichts anderes als das Gegeneinanderwirken und Ineinanderspielen von thymotischen Spannungszentren. Wo der landläufige Intersubjektivismus die Transaktionen zwischen Akteuren in psychoanalytischen und somit letztlich erotodynamischen Begriffen darzustellen gewohnt ist, empfiehlt es sich künftig eher, zu einer thymotologischen Theorie des Aufeinanderwirkens mehrerer Ambitionsagenturen überzugehen. Ambitionen sind zwar durch erotische Abschattungen modifizierbar, für sich genommen gehen sie jedoch aus einem Regungsherd ganz eigenen Typs hervor und sind nur von diesem her zu durchleuchten.
Griechische Prämissen moderner Kämpfe –Die Lehre vom thymós
Zum besseren Verständnis solcher Phänomene empfiehlt sich, wie oben angedeutet, der Rückgang zu den weitsichtigen Formulierungen in der philosophischen Psychologie der Griechen. Es ist unter anderem den Studien des neoklassizistischen jüdischen Philosophen Leo Strauss und seiner (überwiegend zu Unrecht von den politischen Neokonservativen der USA vereinnahmten) Schule zu verdanken, wenn man die von den Großen unter den griechischen Denkern statuierte Bipolarität menschlicher Psychodynamik heute wieder genauer in den Blick fassen kann. Strauss hat vor allem dafür gesorgt, daß man neben Platon, dem Erotologen und Verfasser des Symposions, wieder auf Platon, den Psychologen der Selbstachtung, aufmerksam wurde.21
Dieser liefert im 4. Buch der Schrift über das Gemeinwesen, Politeia, die Umrisse zu einer thymós-Lehre von großem psychologischem Reichtum und weittragender politischer Bedeutsamkeit. Die herausragende Leistung des platonisch gedeuteten thymós besteht in seiner Fähigkeit, eine Person gegen sich selber aufzubringen. Diese Wendung gegen sich selbst kann geschehen, wenn die Person die Ansprüche nicht erfüllt, die befriedigt werden müßten, damit sie die Achtung vor sich selber nicht verliert. Platons Entdeckung liegt im Hinweis auf die moralische Bedeutung der heftigen Selbstmißbilligung. Diese manifestiert sich zweifach – zum einen in der Scham, als einer affektiven Totalstimmung, die das Subjekt bis ins Innerste durchdringt, zum anderen im zorngetönten Selbsttadel, der die Form einer inneren Rede an sich selbst annimmt. Die Selbstmißbilligung beweist dem Denker, daß der Mensch eine angeborene, wenngleich trübe Idee des Angemessenen, Gerechten und Lobenswerten besitzt, bei deren Verfehlung ein Teil der Seele, eben der thymós, Einspruch erhebt. Mit dieser Wendung zur Selbstablehnung beginnt das Abenteuer der Selbständigkeit. Erst wer sich selber tadeln kann, kann sich selber lenken.
Die sokratisch-platonische thymós-Konzeption bildet, wie oben angedeutet, einen Meilenstein auf dem Weg zur moralischen Domestikation des Zorns. Sie plaziert sich auf halber Strecke zwischen der halbgöttlichen Verehrung der homerischen menis und der stoischen Verwerfung aller zornhaften und heftigen Impulse. Dank Platons thymós--Lehre erlangen die zivil-streitbaren Regungen die Aufenthaltsgenehmigung in der Stadt der Philosophen. Da auch die vernunftregierte Polis Militär benötigt, das hier als Stand der »Wächter« figuriert, darf der zivilisierte thymós als Geist der Wehrhaftigkeit in ihren Mauern Quartier nehmen. Die Anerkennung der wehrhaften Tugenden als bildnerischer Kräfte im Gemeinwesen wird von Platon in immer neuen Wendungen beschworen. Noch in dem späten Dialog Politikós, der vom Handwerk des Staatsmanns handelt, betont das bekannte Webergleichnis die Notwendigkeit, das seelische Gewebe des »Staates« sowohl unter Einflechtung der besonnenen Gemütsart als auch der tapferen Gesinnung zu erstellen.
Auf der Linie platonischer Anstöße weiß auch Aristoteles über den Zorn einiges Vorteilhaftes zu sagen. Er stellt diesem Affekt ein überraschend günstiges Zeugnis aus, sofern er mit dem Mut alliiert ist und sich zur angemessenen Abwehr von Ungerechtigkeiten regt. Der legitime Zorn hat noch »ein Ohr für die Vernunft«,22 auch wenn er oft wie ein voreiliger Diener losstürmt, ohne seinen Auftrag zu Ende anzuhören. Zu einem Übel wird er nur, wenn er mit der Unenthaltsamkeit zusammen auftritt, so daß er, die Mitte verfehlend, ins Übermaß ausufert. »Der Zorn ist nötig, und nichts kann ohne ihn durchgesetzt werden, wenn nicht er die Seele erfüllt und den Mut entzündet. Man darf ihn freilich nicht zum Führer, sondern nur zum Mitstreiter nehmen.«23
Sofern der bürgerlich konditionierte Thymos der psychologische Sitz des von Hegel dargestellten Strebens nach Anerkennung ist,24 wird verständlich, warum ausbleibende Anerkennung durch relevante Andere Zorn erregt. Wer von einem bestimmten Gegenüber Anerkennung fordert, unterzieht dieses einem moralischen Test. Verweigert sich der Angesprochene dieser Prüfung, muß er sich mit dem Zorn des Herausforderers auseinandersetzen, da dieser sich mißachtet fühlt. Die Zornaufwallung geschieht zunächst, wenn mir die Anerkennung von Anderen vorenthalten wird (woraufhin extravertierter Zorn entsteht), aber sie regt sich auch, wenn ich mir selber im Licht meiner Wertideen die Anerkennung verweigere (so daß ich Ursache habe, gegen mich selber zu zürnen). Der Lehre der Stoa zufolge, die den Kampf um Anerkennung ganz nach innen verlegte, soll dem Weisen die interne Selbstbilligung genügen, zum einen weil der Einzelne ohnehin keine Macht über das Urteil der Anderen hat, zum anderen weil der Wissende danach streben wird, sich von allem frei zu halten, was nicht von ihm selber abhängt.
In der Regel jedoch verbindet sich die thymotische Regung mit dem Wunsch, das Selbstwertgefühl in der Resonanz der Anderen bestätigt zu sehen. Dies ist ein Verlangen, das man ohne weiteres als eine Anleitung zum Unglücklichsein mit dauerhafter Erfolgsgarantie auffassen dürfte, gäbe es nicht hier und da Beispiele für geglückte wechselseitige Anerkennung. Was die abgründige Vorstellung einer fundierenden Spiegelung angeht, hat Lacan hierzu vielleicht das Nötige gesagt, obschon seine Modelle, von der Sache her vermutlich zu Unrecht, die frühen infantilen Zustände ins Zentrum der Betrachtung rücken. In Wahrheit ist das Leben vor dem Spiegel eher eine Krankheit der Jugend. Doch auch unter Erwachsenen bedeutet das Streben nach Reflexion in der Anerkennung der Anderen oft nichts anderes als den Versuch, ein Irrlicht in Besitz zu nehmen – im philosophischen Jargon: sich im Substanzlosen zu substantialisieren. Im übrigen drückt Lacans Werk die Ambition aus, die von Kojève reformulierte Thymotik mit der psychoanalytischen Erotik zu amalgamieren. Den Kern seines Unternehmens bildet die freibeuterische Vermischung des Freudschen Wunsches mit dem Hegelschen Ringen um Anerkennung. Durch die Einführung des systemfremden Faktors sprengte Lacan das Freudsche Lehrgebäude auf, nicht ohne zu behaupten, es handle sich in Wahrheit um eine »Rückkehr zu Freud«. Ohne Zweifel deutete die Aufnahme eines thymotischen Elements in die psychoanalytische Grundlehre in die richtige Richtung. Die Konsequenz war fürs erste jedoch das verwirrende Heranwachsen einer Performance, die den Hybridbegriff désir