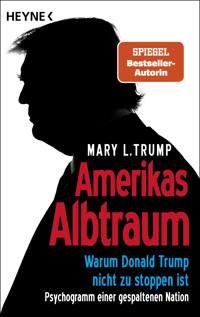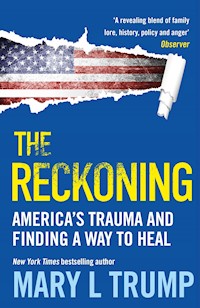9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Das wahre Gesicht von Donald Trump – intime Details aus der Familiengeschichte des US-Präsidenten
Mary L. Trump, Nichte des US-Präsidenten und promovierte klinische Psychologin, enthüllt die dunkle Seite der Familie Trump. Einen Großteil ihrer Kindheit verbrachte Mary im Hause ihrer Großeltern in New York, wo auch Donald und seine vier Geschwister aufwuchsen. Sie schildert, wie Donald Trump in einer Atmosphäre heranwuchs, die ihn für sein Leben zeichnete und ihn letztlich zu einer Bedrohung für das Wohlergehen und die Sicherheit der ganzen Welt machte.
Als einziges Familienmitglied ist Mary Trump dazu bereit, aus eigener Anschauung die Wahrheit über eine der mächtigsten Familien der Welt zu erzählen. Ihre Insiderperspektive in Verbindung mit ihrer fachlichen Ausbildung ermöglicht einen absolut einmaligen
Einblick in die Psyche des unberechenbarsten Mannes, der je an der Spitze einer Weltmacht stand.
»Anstößig, bissig und gut recherchiert – und zugleich doch eine fesselnde Erzählung.« —The Guardian
»Nach vielen, vielen Trump-Büchern ist dieses tatsächlich unentbehrlich.« — Vanity Fair
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 353
Ähnliche
Das wahre Gesicht von Donald Trump – intime Details aus der Familiengeschichte des US-Präsidenten
Mary L. Trump, Nichte des US-Präsidenten und promovierte klinische Psychologin, enthüllt die dunkle Seite der Familie Trump. Einen Großteil ihrer Kindheit verbrachte Mary im Hause ihrer Großeltern in New York, wo auch Donald und seine vier Geschwister aufwuchsen. Sie schildert, wie Donald Trump in einer Atmosphäre heranwuchs, die ihn für sein Leben zeichnete und ihn letztlich zu einer Bedrohung für das Wohlergehen und die Sicherheit der ganzen Welt machte.
Als einziges Familienmitglied ist Mary Trump dazu bereit, aus eigener Anschauung die Wahrheit über eine der mächtigsten Familien der Welt zu erzählen. Zahllose Experten, Laienpsychologen und Journalisten haben vergeblich versucht, Donald Trumps Psyche zu deuten. Mary Trumps Insiderperspektive und ihre fachliche Ausbildung ermöglichen ihr einen einzigartigen Einblick in die Psyche des unberechenbarsten Mannes, der je an der Spitze einer Weltmacht stand.
»Im Gegensatz zu allen anderen Trump-Büchern bietet dieses etwas Neues… Es hilft, ihn zu verstehen, und liefert die bislang prägnanteste Darstellung, warum er so ist, wie er ist.« — Politico
MARY L. TRUMP
ZU VIEL UND NIE GENUG
Wie meine Familie
den gefährlichsten Mann
der Welt erschuf
Aus dem Amerikanischen von
Christiane Bernhardt, Pieke Biermann,
Gisela Fichtl, Monika Köpfer und Eva Schestag
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel Too Much and Never Enough;How My Family Created the World’s Most Dangerous Man bei Simon & Schuster, New York.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
© 2020 by Compson Enterprises LLC
© der deutschsprachigen Ausgabe 2020 by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Kristian Wachinger
Umschlaggestaltung: Hauptmann und Kompanie, Zürich unter Verwendung eines
Fotos von: Archivio GBB/contrasto/laif/
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN: 978-3-641-27444-3V007
www.heyne.de
Für meine Tochter Avary
und
für meinen Vater
Ist eine Seele umnachtet,
so schleicht sich die Sünde in sie hinein.
Nicht derjenige ist der Schuldige,
der die Sünde begeht,
sondern der die Nacht geschaffen hat.
Victor Hugo, Die Elenden
Inhalt
Vorbemerkung
Prolog
Teil Eins
Grausamkeit ist entscheidend
Kapitel Eins The House
Kapitel Zwei Der Erstgeborene
Kapitel Drei Der große »Hier-bin-ich«
Kapitel Vier Am Abflug
Teil Zwei
Auf der falschen Seite des Lebens
Kapitel Fünf Am Boden
Kapitel SechsNullsummenspiel
Kapitel Sieben Parallelen
Kapitel Acht Fluchtgeschwindigkeit
Teil Drei
Schall und Rauch
Kapitel Neun Die Kunst des Freikaufs
Kapitel Zehn Die Nacht bricht nicht sofort herein
Kapitel Elf Die einzige Währung
Kapitel Zwölf Rechtsstreit
Teil Vier
Die schlechteste Investition aller Zeiten
Kapitel DreizehnDas Politische ist persönlich
Kapitel VierzehnStaatsdiener im öffentlichen Bau
Epilog Der zehnte Kreis
Dank
Register
Vorbemerkung
Vieles in diesem Buch entstammt meiner Erinnerung. Für Ereignisse, bei denen ich nicht zugegen war, habe ich mich auf Unterhaltungen und Interviews gestützt, großenteils mit Mitgliedern meiner Familie, Freunden der Familie, Nachbarn und Weggefährten. Einige Gespräche habe ich aus meiner Erinnerung und aus dem, was mir andere erzählt haben, rekonstruiert. Bei den Dialogen geht es mir nicht so sehr um wortgetreue Zitate, sondern darum, die Essenz der Unterhaltungen sichtbar zu machen. Ich stütze mich auch auf juristische Dokumente, Kontoauszüge, Steuererklärungen, private Aufzeichnungen, Familiendokumente, Briefe, E-Mails, Textnachrichten, Fotos und andere Quellen.
Für allgemeine Hintergrundinformationen habe ich auf die New York Times zurückgegriffen, insbesondere auf den investigativen Artikel von David Barstow, Susanne Craig und Russ Buettner, der am 2. Oktober 2018 veröffentlicht wurde; auf die Washington Post; die Vanity Fair; Politico; die Homepage des TWA-Museums und Norman Vincent Peales Buch Die Kraft positiven Denkens. Für die Informationen über den Steeplechase Park gilt mein Dank der Website des Coney Island History Project sowie einem Artikel von Dana Schulz, der am 14. Mai 2018 auf 6sqft.com erschienen ist. Für seine Erkenntnisse über den »episodischen Mann« danke ich Dan P. McAdams. Was die Familienhistorie und Informationen über die Trump’schen Familiengeschäfte und mutmaßlichen Verbrechen betrifft, bin ich den Berichten des verstorbenen Wayne Barrett, David Corn, Michael D’Antonio, David Cay Johnston, Tim O’Brien, Charles P. Pierce und Adam Serwer zu Dank verpflichtet. Danke auch an Gwenda Blair, Michael Kranish und Marc Fisher – mein Vater war allerdings zweiundvierzig, nicht dreiundvierzig, als er starb.
Prolog
Früher mochte ich meinen Namen. Als Kind in den 1970ern wurde ich im Segelcamp von allen Trump genannt. Es machte mich stolz, nicht weil der Name mit Macht und Immobilien verbunden war (damals war meine Familie außerhalb von Brooklyn und Queens unbekannt), sondern weil mir der Klang gefiel. Er passte zu mir, einer toughen Sechsjährigen, die sich vor nichts fürchtete.
In den 1980ern, als ich aufs College ging und mein Onkel Donald damit begonnen hatte, all seine Gebäude in Manhattan mit seinem Warenzeichen zu versehen, wurden meine Gefühle für meinen Namen komplizierter.
Dreißig Jahre später, am 4. April 2017, befand ich mich in dem ruhigen Waggon eines Amtrak-Zuges auf dem Weg nach Washington, D.C., zu einem Dinner im Kreis der Familie im Weißen Haus. Zehn Tage zuvor hatte ich eine E-Mail erhalten, in der ich zur Feier anlässlich des fünfundsiebzigsten und achtzigsten Geburtstags meiner Tanten Elizabeth und Maryanne eingeladen wurde. Im Januar war ihr kleiner Bruder Donald ins Oval Office eingezogen.
Als ich aus der Union Station mit ihrer Gewölbedecke und den schwarz-weißen Marmorböden trat, lief ich an einem Verkaufsstand mit Ansteckern vorbei, die meinen Namen rot durchgestrichen in einem roten Kreis zeigten: »DEPORT TRUMP«, »DUMP TRUMP«, »TRUMP IS A WITCH«. – »TRUMP AUSWEISEN«, »TRUMP LOSWERDEN« und »TRUMP IST EINE HEXE«. Ich setzte meine Sonnenbrille auf und legte einen Schritt zu.
Ich nahm ein Taxi zum Trump International Hotel, in dem meine Familie für eine Nacht gratis untergebracht war. Nachdem ich eingecheckt hatte, lief ich durch den Innenhof und blickte nach oben, zu der gläsernen Decke und dem blauen Himmel darüber. Die dreistöckigen Kristallkronleuchter, die am Mittelbalken einer bogenbrückenförmigen Stahlkonstruktion hingen, tauchten die Halle in ein sanftes Licht. Auf einer Seite waren Lehnsessel, Polsterbänke und Sofas – in Königsblau, Cyan- und Elfenbeinfarben – zu kleinen Sitzgruppen arrangiert; auf der anderen standen Tische und Stühle um eine große Bar, an der ich später mit meinem Bruder verabredet war. Ich hatte erwartet, das Hotel wäre vulgär und protzig. Weit gefehlt.
Auch mein Zimmer war geschmackvoll eingerichtet. Doch mein Name war überall, einfach alles war damit zugekleistert: TRUMP-Shampoo, TRUMP-Spülung, TRUMP-Pantoffeln, TRUMP-Duschhaube, TRUMP-Schuhputzmittel, TRUMP-Nähetui, TRUMP-Bademantel. Ich öffnete den Kühlschrank, nahm mir eine kleine Flasche von dem TRUMP-Weißwein und schüttete ihn in meinen Trump-Rachen, damit er durch meine Trump-Blutbahn direkt ins Lustzentrum meines Trump-Gehirns fließen konnte. Eine Stunde später traf ich meinen Bruder Frederick Crist Trump III., den ich seit unserer Kindheit Fritz nenne, und seine Ehefrau Lisa. Bald schon gesellten sich die anderen Mitglieder unserer Runde dazu: meine Tante Maryanne, die Älteste der fünf Kinder von Fred und Mary Trump, eine angesehene Bundesrichterin; mein Onkel Robert, das Nesthäkchen der Familie, der für kurze Zeit einer von Donalds Angestellten in Atlantic City war, bevor sie Anfang der 1990er im Streit auseinandergingen, und seine Partnerin; meine Tante Elizabeth, die Mittlere der Trump-Kinder, und ihr Ehemann Jim; mein Cousin David Desmond (Maryannes einziges Kind und der älteste Trump-Enkel) und seine Frau und ein paar der engsten Freunde meiner Tanten. Der Einzige der Trump-Geschwister, der bei der Feier fehlte, war mein Vater, Frederick Crist Trump Junior, der älteste Sohn, den alle Freddy genannt hatten. Er war bereits seit mehr als fünfunddreißig Jahren tot.
Als schließlich alle da waren, meldeten wir uns bei den Sicherheitsbeamten vom Weißen Haus an, die draußen warteten. Dann quetschten wir uns wie die Spieler aus der zweiten Reihe eines Lacrosse-Schulteams in die beiden Vans des Weißen Hauses. Ein paar der betagteren Gäste hatten Schwierigkeiten beim Einsteigen. Keiner fühlte sich sonderlich wohl, wie wir da eng aneinandergedrückt auf den Rückbänken saßen. Ich fragte mich, warum das Weiße Haus nicht wenigstens für meine Tanten eine Limousine geschickt hatte.
Als wir zehn Minuten später auf die Zufahrt zum South Lawn einbogen, kamen zwei Sicherheitsbeamte aus ihrer Wachhütte, um die Unterseite des Vans zu inspizieren. Erst dann durften wir das Eingangstor passieren. Wenige Augenblicke später hielten wir an einem kleinen, an den West Wing grenzenden Sicherheitsgebäude und stiegen aus. Während unsere Namen aufgerufen wurden, gingen wir einer nach dem anderen hinein, wir gaben unsere Telefone und Taschen ab und liefen durch einen Metalldetektor.
Als wir dann im Inneren des Weißen Hauses waren, wandelten wir zu zweit oder dritt durch lange Korridore, an Fenstern mit Blick auf die Gärten und Rasenflächen vorbei und entlang lebensgroßer Gemälde der ehemaligen First Ladies. Vor dem Porträt Hillary Clintons blieb ich stehen und hielt eine Minute lang inne. Wieder einmal ging mir die Frage durch den Kopf, wie es nur so weit hatte kommen können.
Ich hatte nie auch nur den geringsten Grund gehabt, mir vorzustellen, einmal das Weiße Haus zu betreten, und schon gar nicht unter diesen Umständen. Die ganze Sache fühlte sich surreal an. Ich sah mich um. Das Weiße Haus war elegant, erhaben und vornehm, und gleich sollte ich zum ersten Mal seit acht Jahren meinen Onkel treffen, den Mann, der hier wohnte.
Wir traten aus dem Halbdunkel des Flurbereichs in die Säulenhalle, die den Rosengarten umgibt, und standen vor dem Oval Office. Durch die Glastüren konnte ich sehen, dass noch eine Sitzung im Gange war. Vizepräsident Mike Pence stand ein wenig abseits, aber der Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, Senator Chuck Schumer sowie ein Dutzend andere Kongressabgeordnete und Mitarbeiter waren um Donald versammelt, der hinter dem Resolute Desk saß.
Die Szene erinnerte mich an eine Taktik meines Großvaters: Ob in seinem Büro in Brooklyn oder in seinem Haus in Queens: Bittsteller ließ er immer antanzen und blieb sitzen, wohingegen sie stehen mussten. Im Spätherbst 1985, ein Jahr nachdem ich mich von der Tufts University hatte beurlauben lassen, nahm ich vor ihm Platz und bat um Erlaubnis, mein Studium wieder aufnehmen zu dürfen. Er blickte auf und sagte: »Das ist doch albern. Warum denn? Geh doch einfach auf die Berufsschule und werde Empfangsdame.«
»Weil ich meinen Abschluss machen will.« Ich muss es mit einem Hauch von Unmut gesagt haben, denn mein Großvater zog die Augenbrauen zusammen und sah mich für einen Moment abschätzig an. Seine Mundwinkel verzogen sich zu einem höhnischen Grinsen, und er lachte. »Wie garstig«, war sein Kommentar.
Ein paar Minuten danach war die Sitzung zu Ende.
Das Oval Office war kleiner und zugleich weniger privat, als ich es mir vorgestellt hatte. Mein Cousin Eric und seine Frau Lara, die ich noch nicht kannte, standen an der Tür, und so sagte ich: »Hi, Eric. Ich bin’s, deine Cousine Mary.«
»Na klar, ich weiß, wer du bist«, erwiderte er.
»Na ja, es ist eine Weile her«, sagte ich, »ich glaube, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, warst du noch auf der Highschool.«
Er zuckte die Achseln und sagte: »Das stimmt wahrscheinlich.« Dann ging er mit Lara weg, ohne dass er uns miteinander bekannt gemacht hätte. Ich ließ meinen Blick durch den Raum wandern. Melania, Ivanka, Jared und Donny waren zwischenzeitlich eingetroffen und standen neben Donald, der sitzen blieb. Mike Pence schlich noch immer durch die andere Hälfte des Raums, auf seinem Gesicht ein eingefrorenes Lächeln, wie eine Aufsichtsperson, der man lieber aus dem Weg geht.
Ich starrte ihn an in der Hoffnung, dass ich Blickkontakt herstellen könnte, doch er sah kein einziges Mal in meine Richtung.
»Bitte alle mal herhören«, verkündete die Fotografin des Weißen Hauses, eine zierliche junge Frau im dunklen Hosenanzug, mit fröhlicher Stimme. »Stellen Sie sich bitte alle zusammen, damit ich ein paar Fotos von Ihnen machen kann, bevor wir nach oben gehen.« Sie wies uns an, uns um Donald herum zu postieren, der noch immer nicht vom Schreibtisch aufgestanden war.
Die Fotografin zückte die Kamera. »Eins, zwei, drei, lächeln.«
Nach dem Fotografieren erhob sich Donald und zeigte auf ein gerahmtes Schwarz-Weiß-Foto meines Großvaters, das auf einem Tisch hinter dem Schreibtisch aufgestellt war. »Maryanne, ist das nicht ein großartiges Bild von Dad?« Es handelte sich um das gleiche Foto, das auf dem Tischchen in der Bibliothek im Haus meiner Großeltern gestanden hatte. Darauf war mein Großvater noch ein junger Mann mit dunklen Haaren und Geheimratsecken, einem Schnauzbart und einem herrischen Gesichtsausdruck. Bis er dement wurde, habe ich kein einziges Mal erlebt, dass dieser Ausdruck ins Wanken geriet. Wir alle hatten ihn Tausende Male gesehen.
»Vielleicht solltest du auch ein Bild von Mom aufstellen«, schlug Maryanne vor.
»Das ist eine tolle Idee«, sagte Donald, als ob ihm das noch nie in den Sinn gekommen wäre. »Besorg mir doch jemand ein Bild von Mom.«
Wir verbrachten noch ein paar Minuten im Oval Office, wo wir abwechselnd hinter dem Resolute Desk Platz nahmen. Mein Bruder fotografierte mich dabei, und als ich mir das Bild später ansah, bemerkte ich, dass mein Großvater wie ein Geist über mir schwebte.
Der Historiker des Weißen Hauses stieß vor dem Oval Office zu uns, und wir begaben uns für eine Hausführung, die es vor dem Dinner geben sollte, in den Wohnbereich im zweiten Stock. Oben gingen wir in den Lincoln Bedroom. Ich sah mich rasch um und war erstaunt, einen halb gegessenen Apfel auf einem Nachttisch zu sehen. Während der Historiker uns Geschichten darüber erzählte, was sich in dem Raum über die Jahre alles zugetragen hatte, deutete Donald ab und zu vage auf Gegenstände und erklärte: »Dieser Ort hat, seit George Washington hier lebte, nie besser ausgesehen.« Der Historiker war zu höflich, darauf hinzuweisen, dass das Haus erst nach dem Tod von George Washington eröffnet worden war. Die Gruppe bewegte sich in Richtung des Treaty Room und des Executive Dining Room.
Donald stand in der Tür und begrüßte die Gäste beim Eintreten. Ich war eine der Letzten. Ich hatte ihn noch nicht begrüßt, und als er mich sah, zeigte er mit einem überraschten Gesichtsausdruck auf mich und sagte dann: »Ich habe ganz speziell darum gebeten, dass auch du eingeladen wirst.« So etwas sagte er oft, um anderen zu schmeicheln, und er hatte ein Talent, seinen Kommentar der jeweiligen Situation anzupassen, was umso beeindruckender war, da ich wusste, dass es nicht stimmte. Er kam auf mich zu, und dann, zum ersten Mal in meinem Leben, umarmte er mich.
Das Erste, was mir am Executive Dining Room auffiel, war seine Schönheit: das dunkle, hochglanzpolierte Holz, die exquisiten Gedecke und die kalligrafisch beschrifteten Tisch- und Speisekarten (Eisbergsalat und Kartoffelbrei, die Grundnahrungsmittel der Familie Trump, und dazu Wagyu-Filets). Das Zweite, was mir auffiel, nachdem ich Platz genommen hatte, war die Sitzordnung. In meiner Familie konnte man schon immer seinen Wert daran ablesen, wie man gesetzt wurde, aber das war in dem Fall kein Problem, denn alle, mit denen ich gerne zusammen war – mein Bruder, meine Schwägerin, Maryannes Stieftochter und ihr Ehemann – saßen in meiner Nähe.
Jeder der Kellner trug eine Flasche Rot- und eine Flasche Weißwein. Echten Wein, keinen TRUMP-Wein. Das kam unerwartet. Ich hatte noch nie erlebt, dass es bei einem Familienfest Alkohol gab. Im Haus meiner Großeltern wurden nur Cola und Fruchtsäfte ausgeschenkt.
Mitten während des Essens kam Jared hereinspaziert.
»Oh, schaut mal«, sagte Ivanka und klatschte in die Hände, »Jared ist von seiner Nahostreise zurück«, als hätten wir ihn nicht gerade eben noch im Oval Office gesehen. Er ging zu seiner Frau, gab ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wange und beugte sich dann zu Donald, der neben Ivanka saß. Für ein paar Minuten redeten die beiden leise miteinander. Und dann ging Jared wieder. Er würdigte keinen, nicht einmal meine Tanten, eines Blickes. Als er über die Schwelle trat, sprang Donny auf und stürzte hinter ihm her wie ein aufgeregtes Hündchen.
Als das Dessert aufgetragen wurde, erhob sich Robert, das Weinglas in der Hand, von seinem Platz. »Es ist eine solche Ehre, heute mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten hier zu sein«, sagte er. »Danke, Mr. President, dass Sie es uns ermöglichen, heute an diesem Ort die Geburtstage unserer Schwestern zu feiern.«
Ich dachte an den letzten Vatertag, den die Familie gemeinsam im Peter Luger Steak House in Brooklyn gefeiert hatte. Damals wie heute saßen Donald und Rob nebeneinander und ich genau ihnen gegenüber. Ohne irgendeine Erklärung hatte sich Donald damals zu Rob gedreht und gesagt: »Schau mal.« Er bleckte die Zähne und wies auf seinen Mund.
»Was ist?«, hatte Rob gefragt.
Donald hatte seine Lippen einfach noch weiter zurückgezogen und noch energischer in Richtung seines Mundes gestikuliert.
Rob wurde nervös. Ich hatte keine Ahnung, was sich da gerade abspielte, aber ich beobachtete das Ganze amüsiert, während ich an meiner Cola nippte.
»Schau doch!«, sagte Donald durch seine zusammengebissenen Zähne. »Wie findest du es?«
»Was meinst du?« Robs Verlegenheit war greifbar. Er hatte sich umgeblickt, um sicherzugehen, dass keiner ihn ansah, und flüsterte: »Hängt etwas zwischen meinen Zähnen?« Die Schüsseln mit Rahmspinat, die auf dem Tisch verteilt waren, legten dies nahe.
Donald hatte seinen Mund wieder entspannt und aufgehört, darauf zu zeigen. Sein geringschätziger Blick fasste die gesamte Geschichte ihrer Beziehung zusammen. »Ich habe mir die Zähne bleichen lassen. Was hältst du davon?«, fragte er trocken.
Nach Robs Kommentar bedachte Donald ihn mit dem gleichen verächtlichen Blick, den ich beinahe zwanzig Jahre zuvor im Lugers gesehen hatte. Dann machte er, seine Diät-Cola in der Hand, ein paar flüchtige Bemerkungen über die Geburtstage meiner Tanten und wandte sich in Richtung seiner Schwiegertochter. »Lara, dort«, sagte er. »Bevor sie mich beim Wahlkampf in Georgia mit einer großartigen Rede unterstützt hat, wusste ich noch nicht einmal, wer zum Teufel sie eigentlich ist.« Zu dem Zeitpunkt waren Lara und Eric beinahe acht Jahre zusammen, man kann also davon ausgehen, dass Donald sie zumindest bei ihrer Hochzeit getroffen hatte. Doch es klang, als hätte er nicht gewusst, wer sie war, bis sie bei einer Wahlkampfveranstaltung etwas Nettes über ihn gesagt hatte. Wie für Donald üblich, war die Story wichtiger als die Wahrheit, die leichtherzig geopfert wurde, vor allem, wenn eine Lüge die Geschichte besser klingen ließ.
Als Maryanne an der Reihe war, sagte sie: »Ich möchte euch dafür danken, dass ihr für unsere Geburtstagsfeier extra angereist seid. Wir haben es weit gebracht seit der Nacht, in der Freddy Donald eine Schüssel mit Kartoffelbrei an den Kopf geworfen hat, weil er so ein Rotzbengel war.« Alle, die die Kartoffelbrei-Anekdote kannten, lachten – alle, außer Donald, der mit fest verschränkten Armen und düsterer Miene zuhörte, so wie immer, wenn Maryanne den Vorfall erwähnte. Es ärgerte ihn, als wäre er noch immer der siebenjährige Junge. Ganz offensichtlich spürte er den Stachel dieser lang zurückliegenden Demütigung.
Plötzlich erhob sich mein Cousin Donny, der inzwischen von seiner Verfolgungsjagd auf Jared zurückgekehrt war, um ein paar Worte zu sagen. Statt auf das Wohl unserer Tanten anzustoßen, hielt er eine Art Wahlkampfrede. »Letzten November erkannte das amerikanische Volk etwas Außergewöhnliches und wählte einen Präsidenten, von dem es sich verstanden fühlte. Die Menschen sahen, was für eine großartige Familie das hier ist, und schlossen sich unseren Werten an.« Ich blickte zu meinem Bruder und verdrehte die Augen.
Ich winkte einem der Kellner zu. »Kann ich bitte noch etwas Wein haben?«
Er kam rasch mit zwei Flaschen zurück und fragte, ob ich lieber den Roten oder den Weißen wolle.
»Egal«, sagte ich.
Nach dem Dessert standen alle unverzüglich auf. Es waren nur zwei Stunden vergangen, seit wir das Oval Office betreten hatten, aber die Mahlzeit war vorüber, und es war Zeit, zu gehen. Insgesamt hatten wir etwa doppelt so viel Zeit im Weißen Haus verbracht wie je bei meinen Großeltern für Thanksgiving oder Weihnachten, aber dennoch weniger Zeit mit Donald als zwei Wochen später Kid Rock, Sarah Palin und Ted Nugent.
Jemand schlug vor, wir alle sollten uns einzeln mit Donald fotografieren lassen (nicht jedoch mit unseren Geburtstagskindern). Als ich an der Reihe war, lächelte Donald für die Kamera und gab grünes Licht, doch ich konnte die Erschöpfung hinter seinem Lächeln erkennen. Es schien, als würde es ihn zermürben, die fröhliche Fassade aufrechtzuerhalten.
»Lass dich nicht unterkriegen«, sagte ich zu ihm, während mein Bruder uns fotografierte. Kurz zuvor war sein erster nationaler Sicherheitsberater unehrenhaft entlassen worden, und es zeigten sich die ersten Risse in seiner Präsidentschaft.
Als Donald sein Kinn nach vorn reckte und die Zähne zusammenbiss, sah er für einen Moment aus wie der Geist meiner Großmutter. »Sie werden mich nicht rankriegen«, sagte er.
Als Donald am 16. Juni 2015 seine Präsidentschaftskandidatur bekannt gab, nahm ich das nicht ernst. Ich dachte auch nicht, dass er selbst es ernst nahm. Er war einfach nur auf die kostenlose Publicity für seine Marke aus. So etwas hatte er früher auch schon gemacht. Doch als seine Umfragewerte stiegen und er vom russischen Präsidenten Wladimir Putin möglicherweise die stillschweigende Zusage bekam, Russland würde alle Hebel in Bewegung setzen, dass sich die Wahl zu seinen Gunsten entschied, wuchs der Reiz am Gewinnen.
»Er ist ein Clown«, sagte Maryanne während einer unserer Verabredungen zum Lunch. »Das wird niemals passieren.«
Wir waren einer Meinung.
Wir redeten darüber, dass seine Kandidatur aufgrund seines Rufs als verblassender Reality-TV-Star und schiffbrüchiger Geschäftsmann zum Scheitern verurteilt wäre. »Nimmt ihm irgendjemand überhaupt diesen Mist ab, er sei ein Selfmademan? Hat er je etwas aus eigener Kraft erreicht?«, fragte ich.
»Nun«, sagte Maryanne trocken wie die Sahara, »er hat es fünfmal bis zum Bankrott gebracht.«
Als Donald das Gespräch auf die Opioidkrise lenkte, indem er die Suchtgeschichte meines alkoholabhängigen Vaters ins Feld führte, um sich als Kämpfer gegen die Drogensucht zu profilieren und einfühlsamer zu wirken, waren wir beide wütend.
»Er benutzt das Andenken an deinen Vater für politische Zwecke«, sagte Maryanne, »und das ist eine Sünde, vor allem, weil Freddy der Star der Familie hätte sein sollen.«
Wir dachten, der offenkundige Rassismus, der in Donalds Rede zur Bekanntgabe seiner Kandidatur zum Vorschein gekommen war, wäre ein K.-o.-Kriterium, doch wir wurden eines Besseren belehrt, als Jerry Falwell Jr. und andere weiße Evangelikale anfingen, ihn zu unterstützen. Maryanne, seit ihrer fünf Jahrzehnte zurückliegenden Konversion eine fromme Katholikin, war aufgebracht. »Was zum Teufel ist mit denen eigentlich los?«, sagte sie. »Donald ist nur ein einziges Mal zur Kirche gegangen, und zwar genau dann, als Kameras dort waren. Es ist unfassbar. Er hat keine Prinzipien. Überhaupt keine!«
Nichts von dem, was Donald während des Wahlkampfs sagte – von seiner Verunglimpfung von Außenministerin Hillary Clinton, die wohl qualifizierteste Präsidentschaftskandidatin in der Geschichte des Landes, als eine »garstige Frau« bis zu seinem Spott über Serge Kovaleski, einen Reporter der New York Times mit Körperbehinderung –, wich ab von meinen Erwartungen an ihn. Genau genommen erinnerte es mich an jedes Familienessen, bei dem Donald über all die Frauen geredet hatte, die er als eklige fette Schlampen ansah, oder die Männer, meist erfolgreicher und mächtiger, die er als Verlierer bezeichnete, worüber mein Großvater und Maryanne, Elizabeth und Robert alle beifällig lachten. Diese Art hemdsärmelige Entwürdigung anderer war Alltag am Esstisch der Trumps. Was mich aber überraschte, war, dass er damit durchkam.
Dann erhielt er die Nominierung. Was ihn meiner Meinung nach hätte disqualifizieren müssen, schien ihn für seine Fangemeinde nur noch attraktiver zu machen. Noch machte ich mir keine Sorgen – ich war überzeugt, dass er niemals gewählt werden würde –, doch allein der Gedanke, dass er eine Chance bekommen hatte, war beunruhigend.
Im Spätsommer 2016 dachte ich darüber nach, mich dazu zu äußern, warum ich Donald für absolut ungeeignet hielt. Zu diesem Zeitpunkt stand er gut da nach dem Parteitag der Republikaner und seinem Ruf nach »Anhängern für den 2. Zusatzartikel«, um Hillary Clinton zu stoppen, die angeblich den Waffenbesitz einschränken wollte. Selbst seine Verbalattacke gegen Khizr und Ghazala Khan, Gold-Star-Eltern, deren Sohn Humayun, ein ranghoher US-Offizier, im Irak gestorben war, schien keinerlei Bedeutung zu haben. Als eine Mehrheit befragter Republikaner ihn auch nach der Veröffentlichung des Access-Hollywood-Videos noch unterstützte, wusste ich, dass ich die richtige Entscheidung getroffen hatte.
Mich beschlich das Gefühl, dabei zuzusehen, wie meine Familiengeschichte und Donalds zentrale Rolle darin in großem Maßstab nachgespielt wurden. Während man an Donalds Rivalen im Rennen um die Präsidentschaft höhere Maßstäbe anlegte, wie das auch bei meinem Vater gewesen war, kam er nicht nur ungeschoren davon, sondern wurde für sein immer extremeres, unverantwortliches und abstoßendes Verhalten sogar belohnt. Das kann doch nicht noch mal passieren, dachte ich. Doch es passierte.
Den Medien entging, dass sich außer seinen Kindern, seinem Schwiegersohn und seiner derzeitigen Ehefrau nicht ein einziges Mitglied aus Donalds Familie während seines Wahlkampfes für ihn aussprach. Maryanne sagte zu mir, sie habe Glück, da sie als Bundesrichterin zur Unparteilichkeit verpflichtet sei. Als seine Schwester und aufgrund ihrer beruflichen Reputation war sie im ganzen Land vielleicht die einzige Person, die, hätte sie sich über Donalds vollkommene Untauglichkeit für das Amt geäußert, etwas hätte ausrichten können. Aber sie hatte ihre eigenen Geheimnisse, und ich war nicht sonderlich überrascht, als sie mir nach der Wahl erzählte, sie habe aus »familiärer Loyalität« ihre Stimme ihrem Bruder gegeben.
In der Familie Trump aufzuwachsen, vor allem als Freddys Kind, brachte gewisse Herausforderungen mit sich. In mancher Hinsicht war ich vom Glück extrem begünstigt. Ich besuchte exzellente Privatschulen und war die meiste Zeit meines Lebens durch eine erstklassige Krankenversicherung abgesichert. Doch es gab da auch ein Gefühl des Mangels, das außer Donald uns alle betraf. Nachdem mein Großvater 1999 verstarb, erfuhr ich, dass die Nachkommen meines Vaters aus dem Testament gestrichen worden waren, als hätte Fred Trumps ältester Sohn nie existiert, und es folgte ein Rechtsstreit. Letzten Endes kam ich zu dem Schluss, dass ich, sobald ich mich öffentlich über meinen Onkel äußerte, als frustrierte, enterbte Nichte hingestellt würde, die abkassieren oder sich rächen wollte.
Um zu verstehen, was Donald – und uns alle – an diesen Punkt gebracht hat, müssen wir bei meinem Großvater und dessen Bedürfnis nach Anerkennung anfangen; ein Bedürfnis, das ihn dazu trieb, Donalds tollkühne Übertreibungen und sein unbegründetes Selbstvertrauen zu befeuern, hinter denen sich Donalds krankhafte Schwächen und Unsicherheiten versteckten.
Als Donald heranwuchs, musste er sich selbst zujubeln. Zum einen, weil er seinen Vater davon überzeugen musste, ein besserer und selbstsicherer Sohn zu sein als Freddy; zum anderen, weil Fred es von ihm verlangte und schließlich auch, weil er anfing, an seinen eigenen Schwindel zu glauben, auch wenn er auf einer tieferen Bewusstseinsebene paradoxerweise den Verdacht gehabt haben mag, dass sonst niemand darauf hereinfiel. Zur Zeit seiner Wahl begegnete Donald jedem Zweifel an seiner Überlegenheit mit Zorn; seine Ängste und Schwachstellen hatte er so erfolgreich verdrängt, dass er nicht einmal mehr anerkennen musste, dass es sie gab. Und das würde er auch nie.
In den 1970ern, nachdem mein Großvater Donald bereits jahrelang den anderen vorgezogen und ihn nach vorn gepusht hatte, übernahmen die New Yorker Medien den Stab und fingen damit an, den unbegründeten Hype um Donalds Person zu verbreiten. In den 1980ern stiegen die Banken mit ein, indem sie seine Unternehmungen finanzierten. Ihre Bereitschaft (und später die Notwendigkeit), seine immer haltloseren Erfolgsbehauptungen zu protegieren, hing an der Hoffnung, ihre Verluste wieder hereinzuholen.
Nach einem Jahrzehnt, in dem Donald ins Schwimmen gekommen war, von Insolvenzen nach unten gezogen wurde und sein Gesicht für das Scheitern einer ganzen Reihe von Produkten von Steaks bis Wodka stand, gab ihm der Fernsehproduzent Mark Burnett dennoch eine weitere Chance. The Apprentice machte sich Donalds Image des dreisten, Selfmade-Dealmakers zunutze, ein Mythos, der bereits fünf Jahrzehnte zuvor von meinem Großvater in die Welt gesetzt worden war und der trotz der erdrückenden Beweislage, die ihn widerlegte, erstaunlicherweise fast unbeschadet bis ins neue Jahrtausend überdauert hatte. Als Donald im Jahr 2015 sein Rennen um die Kandidatur der Republikaner bekannt gab, war ein erheblicher Anteil der amerikanischen Bevölkerung bereits darauf vorbereitet, diesen Mythos zu glauben.
Bis zum heutigen Tag werden die Unwahrheiten, Falschdarstellungen und Lügenmärchen, die meinen Onkel in Summe ausmachen, von der Partei der Republikaner und den Evangelikalen verbreitet. Menschen, die es besser wissen müssten wie der Parteiführer des Senats Mitch McConnell; treue Gefolgsleute wie der Fraktionsvorsitzende Kevin McCarthy, Außenminister Mike Pompeo und Justizminister William Barr und unzählige andere haben sich, unwissentlich oder auch wider besseres Wissen, an ihrer Weiterverbreitung mitschuldig gemacht.
Keines der Trump-Geschwister ging unbeschadet aus der Soziopathie meines Großvaters und den sowohl physischen als auch psychischen Erkrankungen meiner Großmutter hervor, aber mein Onkel Donald und mein Vater Freddy hatten mehr darunter zu leiden als die anderen. Wenn wir ein Gesamtbild von Donald und seinen psychopathologischen Symptomen erhalten und sein dysfunktionales Verhalten verstehen wollen, erfordert das eine eingehende Betrachtung der Familiengeschichte.
Im Lauf der vergangenen drei Jahre habe ich zugesehen, wie zahlreiche Experten, Laienpsychologen und Journalisten bei dem Versuch, Donalds oft seltsames und sinnloses Benehmen zu erklären, mit Begriffen wie »maligner Narzissmus« und »narzisstische Persönlichkeit« das Thema verfehlten. Ich habe kein Problem damit, Donald als Narzissten zu bezeichnen – alle neun Merkmale, wie sie im Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) dargelegt sind, treffen auf ihn zu – aber diese Rubrizierung allein reicht nicht.
Ich habe am Derner Institute of Advanced Psychological Studies in klinischer Psychologie promoviert. Während ich für meine Dissertation forschte, arbeitete ich zugleich in der Aufnahmestation des Manhattan Psychiatric Centers, einer staatlichen Einrichtung, wo wir schwer kranke und stark gefährdete Patienten diagnostizierten, begutachteten und behandelten. Zusätzlich zu meiner Lehrtätigkeit in Psychologie für höhere Semester, die Kurse über Trauma, Psychopathologie und Entwicklungspsychologie beinhaltete, bot ich den Patienten einer auf Suchterkrankungen spezialisierten städtischen Klinik als Juniorprofessorin auch Therapiestunden und psychologische Diagnostik an.
Diese Erfahrungen zeigten mir immer wieder, dass Diagnostik nicht im luftleeren Raum stattfindet. Hat Donald möglicherweise andere Symptome, von denen wir nichts wissen? Liegen weitere Krankheiten vor, die ebenso aussagekräftig oder sogar aussagekräftiger sind? Vielleicht. Man könnte argumentieren, dass er auch die Kriterien für eine Antisoziale Persönlichkeitsstörung erfüllt, die in ihrer massivsten Ausprägung allgemein als Psychopathie bekannt ist, sich aber auch auf chronische Kriminalität, Arroganz und die Missachtung der Rechte anderer bezieht. Liegt eine Begleiterkrankung vor? Wahrscheinlich. Donald erfüllt auch einige der Kriterien, die eine Abhängige Persönlichkeitsstörung auszeichnen, wozu die Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen oder Verantwortung zu übernehmen, zählt, ebenso wie die Angst vor dem Alleinsein und übermäßige Bemühungen, die Unterstützung anderer zu gewinnen. Gibt es weitere Faktoren, die berücksichtigt werden sollten? Absolut. Möglicherweise hat er eine seit langer Zeit unbemerkte Lernschwäche, die seine Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten, bereits seit Jahrzehnten beeinträchtigt. Er soll außerdem bis zu zwölf Diät-Colas am Tag trinken und sehr wenig schlafen. Leidet er an einer durch Drogen (in diesem Fall durch Koffein) hervorgerufenen Schlafstörung? Seine Ernährung ist miserabel, und er macht keinen Sport, was zu seinen sonstigen möglichen Gesundheitsstörungen beitragen oder diese sogar verschlimmern könnte.
Fakt ist, dass Donalds Pathologien so komplex sind und sein Verhalten oft so unerklärbar, dass es für eine genaue und umfassende Diagnose einer ganzen Batterie an psychologischen und neuropsychologischen Tests bedürfte, auf die er sich niemals einlassen würde. Derzeit ist es unmöglich, seine Alltagstauglichkeit zu überprüfen, da er im West Wing fest institutionalisiert ist. Die meiste Zeit seines Erwachsenenlebens hat Donald in goldenen Käfigen zugebracht, sodass man nicht sagen kann, ob er auf sich gestellt in der realen Welt gedeihen, ja, ob er überhaupt überleben würde.
Am Ende der Geburtstagsfeier meiner Tanten im Jahr 2017, als wir auf unsere Fotos warteten, konnte ich sehen, dass Donald bereits unter einer Art Stress stand, die er noch nie zuvor gekannt hatte. Da der Druck auf ihn im Laufe der letzten drei Jahre stetig zugenommen hatte, vertiefte sich die Kluft zwischen der Kompetenz, die die Voraussetzung ist, um ein Land zu führen, und seiner Inkompetenz, wodurch sein Größenwahn stärker denn je zum Vorschein kam.
Viele von uns, aber beileibe nicht alle, wurden bisher von seinen Pathologien durch eine stabile Wirtschaft und das Ausbleiben ernsthafter Krisen verschont. Aber die außer Kontrolle geratene Corona-Pandemie, eine drohende Wirtschaftskrise, die Gräben zwischen den politischen Fronten, die dank Donalds Vorliebe zu spalten tiefer werden, und die niederschmetternde Unsicherheit über die Zukunft des Landes haben sich zu einer katastrophalen Großwetterlage zusammengebraut, der niemand schlechter gewachsen ist als mein Onkel. Sich dem zu stellen, würde Mut erfordern, Charakterstärke, Respekt vor Experten, das Selbstbewusstsein, Verantwortung zu übernehmen und den Kurs zu korrigieren, nachdem man seine Fehler eingestanden hat. Sein Talent, ungünstige Situationen durch Lügen, Verwirrung und Verschleierung zu meistern, hat inmitten der Tragödien, mit denen wir gegenwärtig konfrontiert sind, seine Wirkung verloren und ihn bis zur Ohnmacht geschwächt. Sein ungeheuerliches, womöglich vorsätzliches Fehlverhalten in der aktuellen Katastrophe hat zu einem Ausmaß an Gegenwind und kritischen Fragen geführt, wie er es noch nie zuvor erlebt hat. All das führt jedoch dazu, dass seine Aggressivität, sein Bedürfnis nach kleinlichen Racheakten zugenommen haben, was sich darin äußert, dass er in Bundesstaaten, deren Gouverneure ihm nicht tief genug in den Arsch kriechen, lebenswichtige Finanzmittel, Schutzkleidung und Beatmungsgeräte zurückhält, für die wir alle mit unseren Steuergeldern bezahlt haben.
In dem 1994 erschienenen Film, der auf Mary Wollstonecraft Shelleys Roman basiert, sagt Frankenstein: »Ich weiß, dass ich um des Mitgefühls eines einzigen Lebewesens willen, Frieden mit allen anderen schließen würde. Ich habe Liebe in mir, von der du keine Vorstellung hast, und Furcht, wie sie deinesgleichen nicht fassen würde. Wenn mir das eine nicht erfüllt werden kann, dann werde ich mich dem anderen hingeben …«
Unter Bezugnahme auf genanntes Zitat schrieb Charles P. Pierce im Esquire, »[Donald] quält sich nicht mit Zweifeln über das, was er um sich herum erschafft. Er ist stolz auf sein Monster. Er kostet dessen Zorn und Zerstörungswut aus, wohingegen er sich dessen Liebe nicht vorstellen kann, er glaubt von ganzem Herzen an dessen Wut. Er ist ein Frankenstein ohne Bewusstsein.«
Diese Aussage hätte Donalds Vater Fred sogar noch treffender beschrieben, mit einem wichtigen Unterschied: Freds Monster – das einzige Kind, das ihm etwas bedeutete – wurde letztendlich genau wegen der Art von Freds Bevorzugung nicht liebenswert. Am Ende gab es für Donald keinerlei Liebe, nur seinen schmerzhaften Hunger danach. Der ungehemmt wuchernde Zorn sollte alles andere überschatten.
Als Donalds langjährige Vorzimmerdame Rhona Graff mir und meiner Tochter eine Einladung zukommen ließ, Donalds Wahlparty in New York beizuwohnen, sagte ich ab. Ich hätte meine Freude über einen Sieg von Clinton nicht verbergen können und wollte nicht unhöflich sein. Am nächsten Morgen um fünf Uhr, nur wenige Stunden nachdem das Ergebnis verkündet worden war, wanderte ich durchs Haus, genauso traumatisiert wie viele, nur war es für mich persönlicher: Es fühlte sich so an, als hätten 62 979 636 Wähler entschieden, das Land in eine Makroversion unserer unheilbar dysfunktionalen Familie zu verwandeln.
Binnen eines Monats nach der Wahl konsumierte ich wie besessen die Nachrichten und checkte meinen Twitter-Account. Ich war nervös und konnte mich auf nichts anderes konzentrieren. Obwohl mich nichts von dem, was Donald tat, überraschte, überwältigte mich die schiere Geschwindigkeit und das Ausmaß, in dem er nun das Land mit seinen schlimmsten Impulsen malträtierte: von der Lüge über die Größe der Menschenmenge bei seiner Amtseinführung und seinem Jammern darüber, wie gemein er behandelt würde, über die Maßnahmen, den Umweltschutz zurückzufahren, und seinen Angriff auf den Affordable Care Act, um Millionen von Menschen eine erschwingliche Krankenversicherung zu entziehen, bis hin zur Verordnung seines rassistischen Einreiseverbots gegen Muslime. Kleinigkeiten – wie Donalds Gesicht zu sehen oder meinen Namen zu hören, was beides Dutzende Male am Tag geschah – versetzten mich zurück in die Zeit, als mein Vater unter der Grausamkeit und der Geringschätzung meines Großvaters verkümmerte und starb. Ich hatte ihn verloren, als er gerade zweiundvierzig und ich selbst sechzehn war. Wie unter einer Lupe wurde der Schrecken, der Donalds grausamem Handeln innewohnte, vergrößert, da alles, was er tat, nun offizielle US-Politik war, die sich auf Millionen Menschen auswirkte.
Die Atmosphäre der Spaltung, die mein Großvater in der Familie Trump erzeugte, ist das Wasser, in dem Donald schon immer geschwommen ist, und Menschen zu entzweien kommt ihm noch immer zugute, auch wenn es zulasten aller anderen geht. Es zermürbt das Land, wie es schon meinen Vater zermürbte; es verändert uns, während Donald davon völlig unberührt bleibt. Es schwächt unsere Fähigkeit, gütig zu sein oder an Vergebung zu glauben, Konzepte, die für ihn nie von Bedeutung waren. Seine Regierung und seine Partei haben sich seiner Politik der Kränkung und des Anspruchsdenkens untergeordnet. Schlimmer noch, Donald, der nichts von Geschichte, Verfassungsgrundsätzen, Geopolitik, Diplomatie (oder ehrlich gesagt sonst irgendetwas) versteht, hat alle Allianzen und alle Sozialprogramme des Landes einzig aus der Perspektive des Geldes bewertet, ganz so, wie sein Vater es ihm beigebracht hat. Die Verluste und Profite des Regierens werden in rein finanziellen Begriffen betrachtet, als wären die Staatskassen sein privates Sparschwein. Für ihn ist jeder Dollar, der ausgegeben wurde, sein Verlust, jeder gesparte Dollar sein Zugewinn. Inmitten eines obszön anmutenden Reichtums sollte dieser eine Mensch alle Schalthebel der Macht betätigen und jede sich ihm bietende Möglichkeit nutzen, um sich und unter Vorbehalt auch seinen engsten Angehörigen, seinen Spezis und seinen Speichelleckern einen Vorteil zu verschaffen; für alle anderen sollte nie genug da sein – das entspricht genau dem, wie mein Großvater seine Familie führte.
Es erscheint ungewöhnlich angesichts all der Aufmerksamkeit und Berichterstattung in den Medien, dass Donald innerhalb der letzten fünfzig Jahre so selten kritisch hinterfragt wurde. Obwohl seine Charakterschwächen und sein abnormes Verhalten kommentiert wurden und man sich darüber lustig machte, gab es nur äußerst wenige Versuche, zu verstehen, warum er zu dem wurde, der er heute ist, und auch wie er es schaffte, trotz offenkundiger Unzulänglichkeiten immer weiter nach oben zu gelangen.
Auf gewisse Weise war Donald immer von einer Institution geschützt, abgeschirmt von seiner Begrenztheit oder seinem Bedürfnis, es auf eigene Faust zu etwas in der Welt zu bringen. Ehrliche Arbeit wurde von ihm nie gefordert, und wie dramatisch er auch versagte, wurde er auf fast unvorstellbare Weise belohnt. Auch im Weißen Haus wird er weiterhin vor seinem Versagen geschützt. Seine treuen Claqueure applaudieren jeder seiner Verkündungen und decken seine potenziell kriminelle Fahrlässigkeit dadurch, dass sie sie bis zu dem Punkt normalisieren, an dem wir gegenüber seinen immer häufigeren Überschreitungen beinahe empfindungslos geworden sind. Allerdings steht heute sehr viel mehr auf dem Spiel als je zuvor; es geht buchstäblich um Leben und Tod. Anders als in anderen Phasen seines Lebens können Donalds Fehlschläge heute weder versteckt noch ignoriert werden, da sie uns alle bedrohen.
Auch wenn meine Tanten und Onkel das anders sehen werden, schreibe ich dieses Buch nicht, um abzukassieren oder mich zu rächen. Wäre dies meine Intention gewesen, hätte ich bereits vor Jahren ein Buch über unsere Familie geschrieben, als nicht absehbar war, dass Donald seinen Ruf als laufend insolventer Geschäftsmann und irrelevanter Reality-TV-Show-Moderator für einen Aufstieg ins Weiße Haus nutzen würde; als es weniger gefährlich gewesen wäre, weil mein Onkel nicht in einer Position war, von wo aus er Whistleblower und Kritiker bedrohen oder in Gefahr bringen kann. Die Ereignisse der letzten drei Jahre haben mich jedoch zum Handeln gezwungen, und ich kann nun nicht mehr schweigen. Wenn dieses Buch erscheint, werden Hunderttausende Amerikaner ihr Leben auf dem Altar von Donalds Hybris und mutwilliger Ignoranz geopfert haben. Wenn ihm eine zweite Amtszeit gewährt wird, bedeutet das das Ende der amerikanischen Demokratie.
Niemand weiß besser als seine Familie, wie Donald zu dem Mann wurde, der er heute ist. Bedauerlicherweise schweigen beinahe alle von ihnen aus Loyalität oder Angst. Mich hindert keins von beidem. Zusätzlich zu meiner Darstellung aus erster Hand, als Tochter meines Vaters und einzige Nichte meines Onkels, habe ich die Perspektive einer erfahrenen klinischen Psychologin. Zu viel und nie genug ist die Geschichte der mächtigsten und sichtbarsten Familie der Welt. Und ich bin die Einzige der Trumps, die dazu bereit ist, sie zu erzählen.
Ich hoffe, dieses Buch wird der Praxis ein Ende setzen, die auf Donalds »Strategien« oder »Agenden« verweist, als würde er gemäß irgendeinem Ordnungsprinzip handeln. Das tut er nicht. Donalds Ego war und ist eine verletzliche und unscharfe Grenze zwischen ihm und der realen Welt, die er dank des Geldes und der Macht seines Vaters niemals selbst verhandeln musste. Donald brauchte stets nur das Märchen weiterzuführen, mit dem bereits mein Großvater angefangen hatte. Das Märchen, dass er stark, schlau und überhaupt außergewöhnlich ist. Es würde ihn zu sehr ängstigen, der Wahrheit ins Auge zu blicken: dass er nichts von alldem ist.
Nach dem Vorbild meines Großvaters und unter Mittäterschaft, durch das Schweigen und die Tatenlosigkeit seiner Geschwister zerstörte Donald meinen Vater. Ich kann nicht zulassen, dass er auch mein Land zerstört.
TEIL EINS
GRAUSAMKEIT
IST ENTSCHEIDEND
KAPITEL EINS
The House
»Daddy, Mom blutet!«
Sie wohnten jetzt fast ein Jahr in der Villa, die einfach nur »The House« hieß, aber noch immer fühlte es sich fremd an, erst recht nachts. Maryanne war zwölf und nicht die Stabilste, als sie ihre Mutter in einem der Badezimmer im Obergeschoss fand – nicht im Hauptbadezimmer, sondern im Bad ganz hinten im Flur, das sie sich mit ihrer Schwester teilte. Die Mutter lag bewusstlos am Boden, überall war Blut. Normalerweise hätte Maryanne nicht gewagt, ihren Vater zu stören, aber jetzt war sie so entsetzt, dass sie von einem Ende des Hauses zum anderen in sein Schlafzimmer rannte und ihn weckte.
Fred stand auf, lief los und fand seine Frau. Sie war nicht ansprechbar. Er lief zurück, mit Maryanne im Schlepptau, um zu telefonieren. Sein Schlafzimmer hatte einen Nebenapparat.
Fred war inzwischen ein mächtiger Mann, er hatte einen direkten Draht zum Jamaica Hospital und wurde sofort mit jemandem verbunden, der einen Notarztwagen schicken und dafür sorgen konnte, dass die besten Ärzte bereitstanden, wenn Mary in der Notaufnahme eintraf. Fred beschrieb am Telefon, so gut er konnte, ihren Zustand. »Menstruation«, schnappte Maryanne auf, ein fremdes, aus dem Mund ihres Vaters merkwürdig klingendes Wort.
Mary wurde sofort notoperiert. Die Ärzte hatten schwere Komplikationen festgestellt, die nach der Geburt von Robert eingetreten und neun Monate lang nicht diagnostiziert worden waren, und entfernten ihr die Gebärmutter. Der Eingriff führte erst zu einer Unterleibsinfektion, dann zu weiteren Komplikationen.
Eines Tages saß Fred am Tischchen in der Bibliothek, von dem aus er zu telefonieren pflegte, sprach kurz mit einem von Marys Ärzten und rief dann Maryanne zu sich.
»Sie sagen, deine Mutter wird die Nacht nicht überleben.«
Bevor er zu seiner Frau ins Krankenhaus fuhr, trug er seiner Tochter auf: »Geh morgen zur Schule. Ich sage dir Bescheid, wenn sich etwas ändert.«
Maryanne wusste genau, was er meinte: Ich sage dir Bescheid, wenn deine Mutter stirbt.