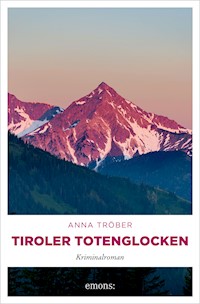Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein fesselnder Kriminalfall vor beeindruckender schneebedeckter Bergkulisse. Ein Tiroler Großunternehmer erstickt unter der Kunstschneedecke seiner eigenen Beschneiungsanlage auf der österreichischen Seite der Zugspitze. Was zunächst wie ein Unfall aussieht, lässt Bezirksanwalt Clemens Hugo keine Ruhe: Er hält es für Mord. Gemeinsam mit der resoluten Journalistin Kerstin Schlegele begibt er sich auf Spurensuche. Dabei stoßen sie auf offene Feindschaften, unaussprechliche Geheimnisse und einen verfluchten Schatz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Geboren 1989 in Füssen, aufgewachsen im Tiroler Außerfern, studierte Anna Tröber Rechtswissenschaften an den Universitäten Wien und Oslo mit Schwerpunkt Strafrecht. Sie war in einer renommierten Wiener Rechtsanwaltskanzlei und am Straflandesgericht Innsbruck tätig. Anna Tröber feierte 2022 ihr Debüt mit »Tiroler Totenglocken«, erschienen bei Emons.
Dieses Buch ist ein Roman. Teile der Handlung sind inspiriert von dem Reuttener Wirtschaftspionier Dr. Hermann Stern. Die beteiligten Figuren und deren Handlungen sind jedoch frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2024 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/Marian.Mertez/Alamy/Alamy Stock Photos
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Christiane Geldmacher, Textsyndikat Bremberg
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-226-0
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Für G.
»A jede Schraubn werd zum ›Wunder der Technik‹, a jede Odlgrubn zur ›Heilquelle‹, aber dass aner sei Leben hergebn hat, des Blut werd ausradiert.«»Der blut nur, aber leicht kennt sie mal aner verbluten.«
Ödön von Horváth, »Die Bergbahn«
1
Blickt man heute am Fuße der Zugspitze nach oben, tut man dies nicht annähernd so ehrfürchtig wie einhundert Jahre zuvor. Diese Höhe ist erschlossen. Eine Höhe, die nur einem gehörte, nämlich dem Zugspitzgeist. Einem zaubermächtigen Vogel, der keine Eindringlinge in sein Reich duldete und sich auf jeden stürzte, der es in die Nähe des Gipfels wagte. Der Legende nach bewachte er das Springkraut, mit dessen Hilfe man einen Schatz aus dem Herzen des Berges heben konnte. Die Höhe und der Vogel haben seither aber ihren Schrecken verloren. Vor gut einem Jahrhundert wurde der Zugspitzgeist an die Kette gelegt. Besser gesagt an die Leine. Eine achtundvierzig Millimeter dicke Leine. Das Tragseil der Tiroler Zugspitzbahn. Bruchlast hundertsechsundsiebzig Tonnen, gespannt über Fundamente voller Schweiß, Stahl und Geschichte.
Sechzig PS waren erforderlich, um den ersten Passagier das geborstene Gestein und zerklüftete Felswände überwinden zu lassen, ohne selbst einmal nach Luft zu ringen. Wenn es nicht die Höhe allein war, die ihm den Atem raubte. Auf einer Strecke von 3.362 Metern glitt man bei der ersten Fahrt über die vorangegangenen monatelangen Mühen am Boden hinweg. Sechs stählerne Stützen standen den Fahrgästen Spalier. Hundertsechsundvierzig Tonnen Eisen, das unter Hunger und Gefahr in den Berg getrieben werden musste. Sechzehn Minuten für die Passagiere. Vier Jahre für die Arbeiter draußen bei Wind und Wetter.
Diesen geschundenen Händen ist es zu verdanken, dass der Berg sich dieses fünfunddreißig Tonnen schwere Seil hatte umhängen lassen, das aus der Entfernung gerade einmal so aussah wie ein vom Wind getragenes Rosshaar. So hängt es da, für einen weiteren Wimpernschlag der Geschichte.
Das Erreichen des Gipfels darf bis heute nicht täuschen über den Blutzoll, den Männer und Frauen bei Lawinen und Sprengungen, zwischen Hacken und Schaufeln, Visionen und Ehrgeiz bezahlten, damit der Schatten des vergangenen Krieges kürzer wurde. Es gilt nicht mehr nur ehrfurchtsvoll den Berg hinaufzublicken, vielmehr muss andächtig die schwindelerregende Tiefe bestaunt werden, die von jenen geschaffen wurde, die hoch hinauswollten.
Bereits vor hundert Jahren hangelte sich die kleine Fahrgastkabine beinahe lautlos die 1.576 Meter gen Himmel. Nur ein pferdegleiches Schnauben erfasste die Kabine beim Passieren der Stützen. Deren Fenster erlaubten atemberaubende Ausblicke auf die zerschmetterte Silhouette der nördlichen Kalkalpen. Gesplittert und geschliffen durch Kräfte, die älter waren als die Erde selbst.
Im Winter schwebte man schwerelos wie Schneeflocken im Wind. Und im Sommer bekam man einen Eindruck davon, wie es war, die Fracht des kräftigen Bergwindes zu sein. So manch einem Alpinisten war die Leichtigkeit dieser Bergbezwingung ein Dorn im Auge gewesen. Letztlich brachte die Seilbahn jedermann sanft und sicher auf fast dreitausend Meter. Zu dieser Zeit waren diese Gefilde nur den Verwegensten vorbehalten gewesen. Aber auch bis heute fehlt es dem Berg nicht an Abenteurern und dank der Seilbahn auch nicht an anderen wohlgesonnenen Besuchern.
Für die einen mag die Seilbahn ein kaltes Konstrukt aus Stahl und Stein gewesen sein, eine überflüssige Spielerei. Für die anderen ein Hoffnungsschimmer in dieser österreichischen Stunde Morgendämmerung. Erbaut mit der Hoffnung letzter Kraft, damit das Licht des 20. Jahrhunderts den Horizont des Wettersteins genauso überschreiten konnte, wie es die Kabinen der Seilbahn andeuteten.
Die Seilbahn brachte Touristen und Skandale. Gewinn und Schulden. Sie ging verloren und kehrte zurück. Sie wurde bombardiert und wieder aufgebaut. Sie wurde Opfer von Flammen und entzündete Leidenschaft. Kostete Leben und Geld.
Sie war die erste Seilbahn Tirols.
2
März 1924, am Fuß der Zugspitze
In einer Frühlingsnacht hätte es nicht so kalt sein dürfen. Aber so waren sie, die Nächte im Frühling. Seit jeher etwas trügerisch. Viel zu kalt für das Versprechen, das ein warmer Tag zu geben vermag. Der Wind peitschte um die Häuser und stimmte unheilvolle Gesänge im Gebälk der alten Häuser an. Stecknadelgroße Eiskristalle stoben durch die Luft und schlugen an die Scheiben der Gaststube. Sie lenkten den Knaben immer wieder von seinem Kartenblatt ab. Ständig glaubte er, das Pferd des Hausherrn zu vernehmen. Aber die Straßen blieben weiterhin Hufschläge schuldig. Der körnige Schnee sammelte sich in den Ecken der Fenster und glänzte im Licht der Lampen. Der Knabe wurde ermahnt. Er musste eine Karte legen. Es war kein Spiel für einen Knaben und auch nicht der Ort für ihn, aber man hatte einen vierten Spieler gebraucht. Lieber hätte sich der Knabe längs auf die hölzerne Bank gelegt. Vom Boden stieg die Kälte auf, und seine kalten Schienbeine bohrten sich in seine Knie. Dabei heizte der Kachelofen aggressiv, aber machtlos gegen einen ausgekühlten Raum an. Seine Nase juckte von der staubigen heißen Luft. Eigentlich hätte er froh sein müssen, den Abend nicht in ihrem Haus zu verbringen. Im Wirtshaus der Gamslechners gab es immerhin einen Ofen und etwas Warmes für ihn zu essen. Hier saß der Vater und bekam von der feschen Gamslechnerin die einzige Wärme, die er sich noch leisten konnte, und trank sie mit dem Durst eines Kranken.
Der Vater hatte aus den Kampfgräben und Höhlen in den Dolomiten nicht nur Narben und Alpträume mitgebracht. Bei seiner Heimkehr hatte er niemand Geringeres als den Tod im Gepäck. Als er angekommen war, fiel er in den Schnee vor dem Haus. Er war so heiß gewesen, dass der Schnee um ihn herum in Sekundenschnelle geschmolzen war. Erst hatte man es für die Schwindsucht gehalten. Doch so schnell wie dann auch die Mutter krank geworden war, hatte es keine Schwindsucht sein können. Eine Grippe, hatte ihm der Pfarrer gesagt.
Seither begleitete er den Vater ins Wirtshaus, lernte, wie man Karten spielt und über die Zukunft zu reden, als wäre sie eine noch schlechtere Vergangenheit. Der Knabe hielt immer wieder Ausschau nach der Magd. Manchmal flickte sie ihm seine abgewetzte Kleidung, neuerdings war das Loch an seiner Hose so groß geworden, dass man fast den ganzen mageren Unterschenkel sehen konnte. Doch das Fräulein hatte sich an diesem Abend noch nicht sehen lassen. Er vermutete, dass die Gamslechnerin sie zu Strafdiensten verdonnert hatte, weil sie vergessen hatte, das Feuer im Ofen am Brennen zu halten.
Er legte willkürlich eine Karte ab. Das Spiel hatte erst begonnen. Noch verfolgte er keine Strategie. Der Mann zu seiner Linken kratzte sich am narbigen, kurz geschorenen Kopf und legte eine Karte, die die des Jungen an Wertigkeit überstieg. Letztlich nahm der Knecht der Gamslechners, der als Nächster an der Reihe war, einen Zug von seiner Pfeife, holte die drei Karten über den Tisch zu sich, warf den Herzober darauf und legte die Laubsau für die nächste Runde heraus. Auch er hörte immer wieder in die Stille, ob er nicht das Pferd seines Herrn vernehmen konnte.
»Der Herr ist lang aus heut«, sagte er.
»Der Sturm«, antwortete der Vater.
Die Gamslechnerin betrat die Stube. Wie immer trug sie ein schönes, sauberes Kleid, und ihre Haare waren tadellos frisiert. Sie schenkte dem Vater ein. Immer schenkte sie dem Vater ein, obwohl alle wussten, dass er nicht aufhören würde zu trinken. Die Leute im Dorf verabscheuten sie dafür. Und hätten die Leute im Dorf gewusst, dass der Vater der Gamslechnerin keine Zeche dafür bezahlen musste, hätten sie sie wohl noch mehr gehasst. Aber der Gamslechnerin war das einerlei. So konnte sie sicherstellen, dass der Knabe von dem bisschen, was der Vater als Kriegsheimkehrer erhielt, auch wirklich etwas in den Magen bekam. Als von Gott und Mutter verlassen erachtete sie das Kind. Überhaupt glaubte sie nicht, dass Gott mit auch nur einem dieser Männer je im gleichen Raum war.
Ferdl, zur Linken des Knaben, war einmal einer von zwei gewesen. Rösser hatten sie über die Grenze nach Bayern geschmuggelt. Dabei waren sie in abschüssigem Gelände in einen Steinschlag geraten. Der Zwillingsbruder von Ferdl war sofort tot gewesen, zwei der Pferde nach Stunden verendet. So schnell war der Bruder tot gewesen, dass Ferdl schien, der liebe Gott wäre einem von ihnen einfach überdrüssig geworden. Dann war auch Ferdl ein Stein auf den Kopf gefallen, und er sollte nie mehr in klaren Worten sprechen können.
Ferdl war an der Reihe.
»H-h-hafer, Hafer!«, sagte er und hob drei Finger über den Tisch.
»Jetz’ hat der Depp was!«, stöhnte der Knecht.
»Soll er kommen!«, rief der Knabe aufgeregt.
Ferdl legte den Schellkönig. Der Vater nahm einen Schluck aus seinem Krug und rülpste zufrieden. Der Knabe und der Knecht hatten das Spiel verloren. Dem Knecht machte es weniger aus als seinem Mitspieler.
»Weißt, Bub, der Ferdl weiß nicht mehr, wie man redt, aber immer, wie man sticht«, tröstete er ihn und paffte von seiner Pfeife. »Oha. Und ein Schneider war es auch noch.«
Das bedeutete, sie hatten in dieser Runde kein einziges Spiel gegen den Vater und Ferdl gewonnen. Der Knabe kritzelte missmutig zwei dicke Kugeln auf das Zeitungspapier.
Ferdl blickte in die Runde, um sich zu vergewissern, dass alle ein neues Spiel wollten. Der Vater nickte. Der Knecht aber schüttelte den Kopf. Noch immer toste draußen der Sturm. Der Knecht war besorgt. Weniger um den Hausherrn, aber ehe dessen Ross nicht versorgt war, konnte er nicht zu Bett gehen.
»Vater, erzähl vom Bayernkönig!«, verlangte der Junge.
»Ein langer Laggl war’s. Gern hat er’s gehabt bei uns. Vor allem da am Fernsteinsee. Am Ufer ist er gesessn, den lieben langen Tag. Und auf die Ruine im See hat er ein Schloss drauf bauen wollen. Stell dir vor, Bua, ein richtiges Schloss. Ein König musst sein«, schilderte der Vater mit glasigen Augen. An kaum etwas aus seiner Kindheit erinnerte er sich so gut wie an die vielen Besuche König Ludwigs II. in der Gegend.
»Ein Schinder war’s, der Ludwig«, sagte der Knecht. »Jedes Ross hat der zamgritten.« Er wusste, wovon er sprach. Auf Rösser verstand sich der Knecht. Bis die Eisenbahn den Fuhrwerksverkehr über den Fernpass obsolet gemacht hatte, hatte der Alte jede noch so unbedeutende Mähre gekannt, die jemals über den Fern angespannt worden war.
Von Gamslechner war noch immer nichts zu hören. Jetzt blickte auch die Gamslechnerin mit sorgenvoller Miene aus dem Fenster. Das Schneegestöber hatte sich verstärkt. Die Flocken waren zahlreicher geworden.
»Wo ist er denn?«, wollte der Vater wissen.
»Sitzung beim Bürgermeister«, antwortete die Gamslechnerin, »heute hätt sollen die Konzession kommen vom Ministerium.«
»F-f-frisch?«, fragte Ferdl.
»Für die Seilbahn«, beantwortete der Vater die Frage von Ferdl. »Das hätt dem Ludwig gefallen. So ein Zeug!«
Der Knecht sah es wie der Vater, aber er hatte stets gut daran getan, nur seine Meinung zu Pferden abzugeben. Der Knabe konnte sich nichts unter einer Seilbahn vorstellen und Ferdl niemand davon erzählen.
»Eine Arbeit bringt’s. Und die Fremden soll’s anziehen«, erklärte die Gamslechnerin.
Alles, was Arbeit brachte, war gut, wusste der Knabe. Er verstand nicht, warum der Vater nicht begeistert war. Vielleicht wegen den Fremden. »Walsche!«, schrie er oft des Nächtens, aber auch »Der Feind! Der Feind!« oder »Lawine!«. Sogar im Sommer. Der Knabe fragte sich, wovon Ferdl träumte.
»Jetzt aber«, meinte die Gamslechnerin, als sie aus dem Fenster sah. Sie nickte dem Knecht zu. Der erhob sich und hüllte sich in den vom Ofen gewärmten Schal, ehe er die Stube verließ.
Durch das Stubenfenster sah man den Nebel aus den Nüstern des schwarzen Pferdes steigen. So nah war Gamslechner an das Haus herangeritten. Der Knabe stellte sich auf die Bank, um aus dem Fenster zu schauen. Er winkte Wilhelm Gamslechner zu. Für den Knaben war Gamslechner etwas, das einem König am nächsten kam. Er hatte Untergebene, ein Haus mit vielen Zimmern und mehr Rösser, als er zählen konnte. Man erinnerte sich, wer seine Eltern und Großeltern waren. Postmeister sei sein Vater gewesen. Achtunddreißig Rösser habe der gehabt. Kaiser hingegen mochte der Knabe nicht. Die führten Krieg und starben oder liefen davon, wenn es verloren war. Könige waren wie der Ludwig. Die machten die Welt schöner.
Der Knecht nahm das müde Pferd entgegen und verschwand mit ihm im Stall. Gamslechner kam direkt in die Gaststube, um sich am Ofen zu wärmen. Sein Schnauzbart war voller Eis und Schnee. Seine Frau langte nach dem schneebedeckten Hut. Kalte, rußige Luft strömte aus der Unterseite. Die weißen Flocken an der Krempe drangen mehr und mehr in den Stoff ein.
»Wir bauen sie«, sagte Gamslechner heiser, »die erste Seilbahn.«
3
Heute
Lähn. Wie das schon klang. Dead End Lane. Clemens Hugos persönliches Sackgassenerlebnis. Mit einer ausladenden Plastikbox stand er neben seinem Auto, auf das er eine Zeit lang würde verzichten müssen. Die Beamten hatten ihm angeboten, ihn mitzunehmen. Doch die Hemmschwelle für einen Bezirksanwalt, hinten in ein Polizeiauto einzusteigen, lag denkbar hoch. Also stand er jetzt neben der Bundesstraße und ließ sich mit dem Schneematsch der vorbeifahrenden Fahrzeuge anspritzen. Graue Tropfen salzgeschmolzenen Schnees sammelten sich schon auf dem Deckel der Box. Immerhin der einzige Deckel, den Hugo noch hatte.
Die anderen Fahrzeuge fuhren alle gerade einmal sechzig Kilometer pro Stunde. Manch ein Fahrer sah aus dem Fenster, und Hugo vermeinte Hohn in seinem Gesicht zu erkennen. Oder Verwirrung. Was stand da auch jemand mit einer Plastikbox im Schneematsch, fragten ihre Blicke, während sie nervös die Tachonadel im Auge behielten. Dabei hätten die anderen sich das streberische Einhalten des Sechzigers sparen können. Die beiden Polizisten waren gleich weggefahren, nachdem sie seinen Führerschein einbehalten hatten. Der hatte ihnen wohl gereicht. Für den jungen Polizeibeamten war es ein klarer Fall von »Auf Sie hab ich den ganzen Tag gewartet!« gewesen.
Und Hugo: »Deswegen bin ich so schnell gefahren, wie ich konnte.«
Beschämt starrte Hugo auf die immer größer werdende Pfütze Salzwasser auf der Box. Es reichte nicht, dass es schweinekalt war an diesem Morgen. Nein, er musste auch noch richtig schön mit Straßendreck bespritzt werden. Das Leben war ein ständiger Kampf, und dieses Mal hatte er ihn in jedweder Hinsicht verloren.
Der Verkehr nahm immer mehr zu. Hugo hingegen wusste immer weniger, was er tun sollte. Er betrachtete die vielen Autos mit Skiern auf den Dächern, deren Ziel klar die nächste Liftkassaschlange war, wo überteuerte Liftkarten verkauft wurden, damit man sich von einem Lift zum überteuerten Germknödel auf einer Hütte schleppen lassen konnte.
In einer Radiosendung war unlängst die Rede vom »Germknödel-Index« gewesen. Dabei handelte es sich um eine Vergleichsmethode für die Preisniveaus von Skigebieten. Hugo wusste, dass er sich hier in der Zugspitzarena in einer eher höher indexierten Gegend befand. Aber in seiner Situation hätte er jeden Preis für einen Germknödel bezahlt. Ihm wurde für einen Moment ganz warm, als er daran denken musste, wie sich der heiße Dampf von der Powidl aus der Mitte des Germknödels nach oben schlängelte, wenn man ihn zum ersten Mal anstach. Rundherum ein See aus Vanille und süßem Mohn. All diese Aromen stiegen einem gleichzeitig in die Nase, wenn man sich über einen Teller beugte. Traurigerweise war das Einzige, das Hugo aktuell ins Gesicht stieg, der Geruch eines schlecht katalysierten Diesels. Es kam vor, dass er sich in Situationen wie diesen ärgerte, dass er nicht mehr rauchte.
Aus dem Augenwinkel nahm er wahr, wie ein großer gelb-grauer Bus auf seiner Seite zu blinken begann. Dabei befand er sich an keiner Haltestelle. Hugo stapfte ein paar Meter durch den glasigen Salzmatsch zur Seite. Der Bus hielt auf der Fahrbahn. Hinter ihm begannen sich sofort die Fahrzeuge zu stauen. Der Busfahrer musterte Hugo eindringlich, als würde er ihn bei einem Verbrechen ertappen. Dann begann er zu winken. Irgendwie wütend. Als hätte Hugo den Bus bestellt und würde jetzt nicht einsteigen wollen. Hugo, der keine wirklichen Optionen an dieser Stelle hatte, kam der Aufforderung nach. Mit einem hydraulischen »Pffft« ging die Tür auf.
»Gepäck unten!«, raunte der Fahrer aus dem Ausschnitt seines blauen Busfahrerpullunders heraus. Hugo schaute nach beiden Seiten. Wo unten? Als wäre Hugo der unfähigste Mensch der Welt, klappte der Busfahrer mit bösem Blick seine Kabinentür auf und hatte urplötzlich eine frisch angezündete Zigarette im Mund. Hinter dem Bus begannen die ersten Autos zu hupen. Der Busfahrer trat die letzte Stufe in den Schneematsch herunter und nahm gemächlich zwei Züge seiner Zigarette, bevor er mit faltigen Fingern das Gepäckfach auf der Seite des Busses öffnete.
»Gepäck da unten«, sagte er, als würde Hugo kein Deutsch verstehen. Aus Sicht des Busfahrers war das offensichtlich eine Möglichkeit.
Hugo schob die Plastikbox hinein. Man konnte Schuhe, ein paar Pullover und ein Starthilfekabel erkennen. Er hatte das Notwendigste aus dem Auto mitnehmen müssen und dazu die Autobox als Koffer zweckentfremdet. Immerhin hatte er daran gedacht, den Wagenheber herauszunehmen. Hugo fragte sich, ob dem Fahrer klar war, dass die Box bei der ersten Kurve auf der Ladefläche herumrutschen würde. Der hingegen machte ohne weitere Anstalten die Klappe zu und nahm noch einen letzten Zug von der Zigarette.
Die Fahrzeuge hinter seinem Bus ließen ihn kalt. Auch wenn der Stau vermutlich schon zurück zum Fernsteinsee reichte.
Beide stiegen ein. Der Bus war voller Skifahrer, die Hugo erst jetzt wahrnahm. Über die Sitze ragte mal höher, mal niedriger jeweils ein Helm in einer anderen Knallfarbe. Als würden hier Dummies zu Verkehrssicherheitstests angeliefert.
»Ehrwald Bahnhof?«, vergewisserte sich der Busfahrer, als er sein Fahrscheingerät zu füttern begann. Noch immer stand der Bus und mit ihm der gesamte Verkehr in Richtung der Fernpassbundesstraße. »Du willst doch sicher zurück nach Innsbruck.«
»Woher weißt denn das?«, fragte Hugo erstaunt.
»Du hast mich vorher überholt. Dunkelblauer Oktavia, Innsbrucker Kennzeichen. Gleich nach der Spitzkehre. Ich hab gewusst, dass wir uns hier wiedersehen«, antwortete er trocken und tippte auf die Anzeige, wo der Preis für das Ticket aufleuchtete. Hugo gab ihm einen Zehn-Euro-Schein. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis der Busfahrer das Wechselgeld parat hatte. »Jeder weiß doch, dass sie in Lähn stehen.«
»Wann geht es denn weiter?«, hörte Hugo einen deutschen Touristen mit grünem Helm und angelaufenen Brillengläsern fragen.
Der Busfahrer drehte sich mit strenger Miene um und zeigte auf die Plakette »Während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen!«.
Grüner Helm war still.
»Ein Junger gewesen, ha?«, wandte sich der Busfahrer wieder an Hugo, der in der freien ersten Reihe Platz genommen hatte. Hugo sah beschämt zu Grüner Helm. Doch der würdigte ihn durch den Nebel hinter seinen Gläsern keines Blickes. »Ob’s ein junger Beamter war?«
»Ja, ziemlich jung«, antwortete Hugo.
»So sind s’ halt, die Jungen. Die müssen knallhart sein. Die kennen nur die Regeln. Für Nachlässigkeit braucht’s Erfahrung«, sinnierte der Busfahrer und setzte das Gefährt endlich in Gang. Erfahrung hatte der wohl ziemlich viel, dachte Hugo.
Die Busfahrt ging entlang verschneiter Felder nach kurzer Zeit in ein illustres Dorf hinein, das verheißungsvoll noch mit Weihnachtslichterketten beleuchtet war. Ehrwald. Obwohl es noch früh am Vormittag war, tummelten sich schon zahlreiche Urlauber mit Skistöcken auf den Straßen. Der Busfahrer hielt aber nicht für sie an. Er fuhr Hugo direkt zum Bahnhof. Dort ließ er ihn aussteigen und lud weitere behelmte Dummies ein.
»Gepäck nicht vergessen!«, erinnerte er ihn an die Box und daran, dass er in Garmisch auf die Mittenwaldbahn nach Innsbruck umsteigen müsse. Hugo nahm seine Box und winkte dem Bus schwach hinterher.
Der Bahnsteig war schneebedeckt, und Hugo war sich sicher, noch nie zuvor an so einem sauberen Bahnhof gestanden zu haben. Alles strahlte weiß. Sogar die dunkelgrünen Streukästen waren von einer dicken Schicht Schnee überzogen. An den Seiten der eisernen Steher wucherte das Eis im Nordwind wie ein parasitärer Pilz an einem Laubbaum. Von den Bahntrassen waren nur zwei glänzende Schienen zu sehen. Die vorangegangenen Zugmaschinen hatten sie immer wieder freigepustet und den Schnee zu beiden Seiten der Schienenstränge aufgeworfen.
Hugo stellte ernüchtert fest, dass er den letzten Zug gerade verpasst hatte. Nach Studium des Fahrplanes wurde ihm klar, dass er auf den nächsten fast zwei Stunden warten musste. Er stellte die Box neben sich auf eine Wartebank.
Während er so dasaß und auf das Vergehen von zwei Stunden wartete, wurde ihm wieder bewusst, dass er nicht nach Hause konnte. Sie war bestimmt noch da. Deswegen war er ja weggefahren. Er hatte es für eine gute Idee gehalten, sich einmal das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf anzusehen. Das hatte er schon ewig geplant. Daraus wurde jetzt auch nichts. Genauso wenig wie aus ihm und Sarah.
Was sollte er also tun? Hierbleiben? Während sich die Sonne langsam im Tal ausbreitete und der Hochnebel sich verzogen hatte, konnte Hugo sich für diesen Gedanken sogar erwärmen. Er hatte weitere zwei Wochen frei. Tatsächlich könnte er hier Urlaub machen. Tausende anderer machten das auch. Mit klammen Fingern zog er sein Handy aus der Jackentasche. Neun Prozent Akku. Er öffnete eine Buchungsseite und suchte nach Einzelzimmern in der Gegend. Maximal eineinhalb Kilometer Radius. Er hatte kein Auto. Cookies annehmen. Acht Prozent Akku. 400 m vom Skilift. Zentrum. Nur noch ein Zimmer frei. Sieben Prozent Akku. Okay, das musste er nehmen. Anreise/Abreise 28. Dezember bis 12. Jänner. Sechs Prozent Akku. Kein Storno möglich.Bestätigen, bestätigen. Nach Verarbeitung der Zahlungsdaten drei Prozent Akku. Wir wünschen einen schönen Aufenthalt im *****Hotel Gamslechner Hof.
Zum Orientieren reichte der Ladestand des Akkus nicht mehr aus. Da hatte »Zentrum« gestanden, und er hatte ein Bild gesehen. Ein opulenter Bau wie der des Hotels Gamslechner Hof wäre wohl kaum zu übersehen, dachte er und suchte nach dem Kirchturm. Der stand immer im Ortszentrum. Gamslechner. Der Name kam ihm bekannt vor, aber er wusste ihn gerade nicht einzuordnen. Gamslechner. Gamslechner. Gamslechner. Nein, es wollte ihm nicht einfallen. Er steckte das Handy ein und machte sich auf den Weg, eineinhalb Kilometer ins Ortszentrum. Die Hände fielen ihm vom Tragen seiner Plastikbox vor Kälte fast ab. Sarah hatte auf der Box bestanden, damit der Kofferraum aufgeräumt aussehe. Seither fiel das Ding bei jeder Kurve gegen die jeweils andere Seite des Kofferraums. Soll sie ihm noch einmal vorwerfen, er liebe sie nicht.
Das Hotel Gamslechner Hof konnte man tatsächlich von Weitem ausmachen. Ein riesiges Gebäude voller Prunk aus der Frühzeit der Sommerfrische. Gut und gerne fünf Stockwerke zur Straßenseite hoch und mit kunstvoll verziertem Giebel, romantischen Erkern und geräumigen Balkonen neben einem hell verglasten Neubau. Hinter dem Hauptgebäude konnte man in der kalten Luft den beheizten Außenpool dampfen sehen.
Hugo betrat die Lobby. Noch nie zuvor war er in einem so noblen Hotel abgestiegen. Beinahe eingeschüchtert trat er an die Rezeptionistin heran, die seine Buchung bearbeitete. Sie musste das Burgfräulein hier sein. Ebenmäßige Haut, große blaue Augen und die Haltung einer Ballerina. Das aufwendige Dirndl tat sein Übriges dazu, um alle ihre Vorzüge zu unterstreichen. Gleich nachdem er seinen Namen genannt hatte, begann sie mit dem für Rezeptionsangestellte üblichen Sermon, der so schnell war, dass man die Inhalte gar nicht erfassen konnte. In einem freundlichen Singsang erklärte sie ihm, mit welchem Lift er in den wievielten Stock musste und um welche Uhrzeiten Mahlzeiten angeboten wurden. Hugo konnte sich nichts davon merken. Er würde es in der Hotelinfo nachschauen müssen.
»Und dort hinten ist die Hotelbar, bitte seien Sie auf einen Welcome-Drink eingeladen.« Letzteres hatte er unzweifelhaft richtig verstanden. Er nahm ihr die Schlüsselkarte aus der Hand und wollte sich schon umdrehen, als sie noch ergänzte: »Wir bringen selbstverständlich Ihr Gepäck aufs Zimmer, wenn Sie gestatten!«
Dann kam ein rot uniformierter Hotelangestellter und stellte die Plastikbox, ohne die Miene zu verziehen, auf seinen Transportschlitten. Das Letzte, was man davon sah, war das rote Ende des Starthilfekabels, als sich die Lifttüren schlossen.
4
1925, am Fuß der Zugspitze
Ferdl rannte. Aus der Entfernung hörte er die Detonationen vom Berg. Eine Sprengladung nach der anderen ging hinter ihm hoch. Der Donner hallte von einer Talseite auf die andere. Jeder Knall war begleitet von einem Hagel aus Gestein, der polternd zu Boden fiel und sich mit dem übrigen Gestein knirschend vermengte. Sie hatten ihn längst gesehen. Er musste schnellstens zurück ins Dorf. Wenn sie ihn erwischten, gäbe es kein Pardon für ihn. Für Ferdl galten keine Ausreden. Wie hätte er sich auch rausreden können?
Das dürre Geäst knackte unter jedem seiner weiten Schritte. Tief hängende Äste schlugen ihm ins Gesicht. Seine Augen tränten. Er befand sich in einem lichten Waldstück am Weg von der Baustelle ins Dorf. Das verdorrte Moos wurde stückchenweise von seinen Schuhen aufgewirbelt und hinterließ Löcher im Waldboden. Das machte es ihnen noch leichter, ihm zu folgen. Sie waren ihm ohnehin schon dicht auf den Fersen. Er konnte bereits ihren schweren Atem vernehmen, und er spürte den Zorn ihrer Blicke im Rücken. Kein Pardon. Das hatten sie versichert. Mit keinem. Er konnte nur hoffen, dass ihre Hacken und Schaufeln sie langsam machten und am Weg durch den Wald behinderten. Ein weiterer schwerer Donner erschreckte Ferdl so sehr, dass er das Gleichgewicht verlor und auf den weichen Waldboden stürzte. Als er sich aufgerappelt hatte, sah er sie. Sie hatten ihre Gerätschaften zurückgelassen. Das hieß, sie wollten ihn mit bloßen Händen umbringen. Immer näher kamen sie, immer näher.
»Da ist er, der Depp! Gleich haben wir dich, Elender!«, rief dem Giebler Schorsch sein bulliger Kettenhund.
Schorsch Giebler machte sich seine Hände nicht schmutzig. Für die Drecksarbeit hatte er Armin. Der verfügte über den Nacken eines Stiers und die Boshaftigkeit einer Wespe. Und rennen konnte der auch noch, wie Ferdl jetzt unglücklicherweise feststellen musste. Drei oder vier waren es wohl mit Armin, die hinter ihm her waren. Wenn der einen in die Finger bekam, dann tat es weh. Richtig weh. Ein Tischlergeselle aus Nassereith hatte Armin vor ein paar Monaten herausgefordert, und obwohl dieser Geselle ein ordentliches Mannsbild gewesen war, hatte Armin kurzen Prozess mit ihm gemacht. Nach dem ersten Faustschlag hatte der Geselle sich nicht einmal mehr wehren können. Die restlichen zehn Hiebe waren Armin reines Vergnügen gewesen. Mit einem Grinsen hatte er breitbeinig über ihm gestanden und einfach immer wieder mit der Faust auf ihn eingeschlagen. Es war, als ob er gar nicht wusste, dass er einen umbringen könnte. Und irgendwann, da würde er sicher auch einen umbringen. Wahrscheinlich auf Geheiß von Giebler.
Durch die Bäume konnte Ferdl schon die ersten Städel des Ortes ausmachen. Sie vermochten ihm keinen Schutz zu bieten, aber sie bedeuteten, dass er nicht mehr weit vom Dorf entfernt war.
»Jetzt bleib doch stehen, du Depp! A bissle reden wollen wir!« Nur der Hohn von Armin kam noch schneller voran als er und seine Freunde.
»Hahaha!«, lachten sie schallend. »Reden! Mit dem da! Hahaha!«
Ferdl kümmerte niemanden, das wussten alle. »Der Depp. Um den ist es nicht schad.«
Nur August hatte sich seiner angenommen, als er auf der Straße gestanden hatte. Sein eigener Vater hatte Ferdl nach dem Tod seines Bruders nicht mehr im Haus haben wollen. Er hatte ihm allein die Schuld an der unseligen Idee mit dem Pferdeschmuggel gegeben, und Ferdl schuldete ihm jetzt nicht nur einen Sohn, sondern auch einen zweiten, denn übrig von seinen zwei Söhnen war nur mehr ein Depp. August hatte Erbarmen gehabt mit ihm, nahm ihn mit zur Gamslechner-Wirtschaft, wo er ihn zu seinem Partner beim Watten gemacht und Gamslechner ihm eine Arbeitsstelle bei der Seilbahn verschafft hatte. Eine, wo man nicht reden hatte müssen. Nur hacken und wegtragen. Auch August hatte eine Arbeit bekommen, dann saß er nicht den ganzen Tag bei der Gamslechnerin, und der Knabe hatte in die Schule gehen können, dass ein Seilbahningenieur aus ihm wird. Aber August war nicht mehr. Und das nicht einmal wegen einem wie Schorsch Giebler. Der Feind hatte August genommen. Seinen langen Arm hatte er über die Dolomiten herauf ausgestreckt und August Jahre nach Ende des Krieges erledigt.
Ferdl rannte immer schneller. Armin durfte ihn nicht erwischen. Was würde dann nur aus dem Knaben von August werden? Dann hätte der gar niemanden mehr. Nein. Ferdl musste heute wohlbehalten nach Hause kommen und ihm die Schwielen vom Tagwerk zeigen. So wie jeden Abend, wenn er sich nicht auf den höheren Baustellen am Berg verdingte und in einer der Baracken knapp unterhalb des Gipfels wohnte. Die Arbeiten am Gipfel waren besonders hart und gefährlich. Die Kälte und die ständige Gefahr abzustürzen. Der Steinschlag. Die Lawinen. Das karge Essen. Keiner schätzte es besonders, unter diesen Bedingungen zu arbeiten. Aber die Arbeit war Ferdl wichtig, deswegen ließ er sich überall bereitwillig einteilen für den einen Schilling Stundenlohn. Und wäre die Arbeit Ferdl heute nicht auch so wichtig gewesen, dann hätte er nicht Armin am Hals gehabt.
Vielen erging es so wie Ferdl. Sie waren angewiesen auf die Arbeit an der Seilbahn und auf jeden Groschen, den sie dort verdienen konnten. Daher erwischte es sie auch mit voller Wucht, als es hieß, die Bahn sei fast fertig und mehr als die Hälfte der Arbeiter könne gehen. Das betraf überwiegend fremde Arbeiter, wie Schorsch Giebler aus dem Schwabenland. Die aus den umliegenden Ortschaften hingegen sollten weiter beschäftigt werden. Das nahmen Schorsch und andere als Anlass, um unter den Arbeitern Zwietracht zu säen. Als es dann noch zu Unstimmigkeiten bei den angekündigten Lohnerhöhungen der Arbeiter gekommen war, hatte Schorsch einen Streik angezettelt. Gleichzeitig wurden Arbeitswillige angefeindet und in Aussicht gestellt, kein Pardon walten zu lassen, wenn sie einen an der Baustelle antrafen. Bei den aufgebrachten Streikteilnehmern handelte es sich um weit mehr Leute als das Dutzend Gendarmen, das geschickt worden war, um für Ordnung und den Schutz der Anlagen zu sorgen. Einheimische Streikbrecher waren den Streikenden ein besonderer Dorn im Auge. Und was Ferdl anging, auf den hatten sie es sowieso längst abgesehen, weil der Depp doch der Günstling von Gamslechner selbst war, und kaum einer war in ihren Augen ein größerer Repräsentant der herrschenden Klasse als er. Darum verbreiteten sie auch das Gerücht, Gamslechner sei für die Lohnkürzungen verantwortlich, weil er mit dem Ersparten ein Hotel auf dem Gipfel bauen wollte. Aber diese Arbeit sollte nicht den fremden Arbeitern zugutekommen, nur den einheimischen. Mit der Erklärung, dass es aber die Leiharbeitsfirma war, die die Lohnmisere zu verantworten hatte, da sie als Basis der versprochenen fünfzehnprozentigen Lohnerhöhung niedrigere Sätze heranziehen wollte und das im Grunde einer Lohnkürzung gleichkam, wollte sich die Menge um Schorsch nicht zufriedengeben. Nicht einmal der Bürgermeister, den sie als einen der ihren ansahen, vermochte es, sie zu beschwichtigen. Zu groß war ihr Zorn geworden, als die Seilbahn ein Leben um das andere gefordert hatte. Zu kalt war es auf den ausgesetzten Felsvorsprüngen des Wettersteins. Zu hungrig waren sie in den eisigen Nächten schlafen gegangen. Für sie trug allein Gamslechner die Schuld an ihrer Situation, und da der für sie unerreichbar war, würden sie es am Ferdl auslassen.
An ausgedünnten Stellen des Waldes lag vereinzelt noch Schnee. Es waren dürftige Flecken, als hätte man saure Milch ausgegossen, und nur die weiße Schlacke war an manchen Stellen nicht in den Boden eingesickert. Ferdl spürte seinen Körper nicht. Längst hätten ihm die Knie schmerzen müssen oder die Oberschenkel brennen. Nur das Blut pulsierte durch seinen Schädel und rauschte in seinen Ohren. Ferdl konnte nicht sagen, ob es nicht vielleicht doch der Talwind war, der um ihn eingesetzt hatte. Ein kühler Wind, der die Ortschaften im Tal daran erinnerte, dass in diesen Gefilden die Berge das Wetter machten. Wetterstein.
Und da, mitten in einer Böe, traf es ihn ins Schulterblatt. Es brachte seine Schritte aus dem Takt. Er strauchelte, ging in die Knie, und er spürte die Nässe des Bodens den Stoff seiner Hose durchdringen. Einer von ihnen hatte einen Stein geworfen. Und getroffen.
Ferdl schloss die Augen, er wollte beten: »Sch…sch…schtisch… Doppel. Oh.«
Für ihn war es ein aufrichtiges Gebet voller huldvoller Worte.
Für Armin, der den Stein in den Händen hielt, eine einzige Aufforderung.
5
Heute
Der folgende Morgen war für Hugo kein Grund gewesen, das Bett zu verlassen, auch wenn er schon seit Tagesanbruch wach lag. Traktoren und Gemeinde-Unimogs taten draußen ihre Pflicht auf den frisch verschneiten Straßen. Hugo hörte, wie Traktorschaufeln über den Asphalt geschoben und ausgekippt wurden. Immer wieder fuhren sie vor und zurück, nahmen Schnee auf und entluden ihn auf größer werdenden Haufen. Dabei schepperten ihre Schneeketten, und geräuschvoll presste sich das Profil ihrer überdimensionierten Reifen in den trockenen Neuschnee. Ganz leicht wurde ihr oranges Signallicht von der Zimmerdecke aufgefangen. Es musste viel geschneit haben.
Nach einigen Minuten entfernten sich die Fahrzeuge, um andernorts Schneeberge aufzutürmen. Manch einer hätte sich vielleicht durch die lauten Motoren gestört gefühlt. Nicht so Hugo. Es gab einiges, womit er sich an diesem Morgen vertraut machen musste. Die Stille, die das entschwindende Brummen gemeinsam mit Schneebergen zurückgelassen hatte, gehörte ebenso dazu wie das unbekannte Rauschen der Leitungen im Haus. Das Schlimmste war aber, dass er es nicht gewohnt war, allein aufzuwachen. Jemand anderem beim morgendlichen Herumwälzen zuzusehen hatte etwas Meditatives. Er konnte dabei genüsslich wegdämmern. Morgens einsam im Bett zu liegen erzeugte bei Hugo Hektik. Da signalisierte einem niemand, dass man sich an keinem anderen Ort aufhalten musste. Dass man genau da, wo man war, richtig war. Nein, wenn man allein aufwachte, dann musste man seinen Platz erst finden. Dann brauchte man eine Idee oder zumindest eine Vorstellung davon, was die ersten Schritte eines Tages waren. Und genau über diese Schritte wollte Hugo sich nicht klar werden müssen.
Also verharrte er, solange er konnte, am Rücken liegend in dem viel zu warmen Bett mit der Hirschbettwäsche. Wäre es nach ihm gegangen, hätte man das Zimmer »Hirschzimmer« nennen müssen. Überall waren abstrahierte springende, äsende oder kämpfende Hirsche abgebildet. Auf der Bettwäsche, der Tischdecke, den Bezügen des Fauteuils. Nur auf den Vorhängen nicht. Die waren chalethüttenrot-weiß kariert.
Lediglich fürs Notwendigste stand er ein paarmal auf. Er dachte daran, den »Bitte nicht stören«-Aufhänger an der Türschnalle anzubringen. Dabei hatte er schon von Weitem das Klappern nicht geschlossener Schnallen von Skischuhen vernommen. Diese Geräusche schwollen gegen neun Uhr stark an, um dann wieder völlig abzuklingen.
Er warf einen Blick aus dem Fenster. Vor ihm türmte sich das Wettersteinmassiv auf, dessen höchster Gipfel die Zugspitze war. 2.962 Meter und damit der höchste Berg Deutschlands. Die Grenze zwischen Österreich und Deutschland verlief gerade über den Westgipfel des Berges. Hugo fiel ein, dass er mal gehört hatte, dass der österreichische Kaiser Franz Josef den Ostgipfel der Zugspitze an Deutschland verschenkt haben soll. War ja nicht einmal ein Dreitausender, dachte sich Hugo. Aber es war nur eine Legende. In Tirol war einem Deutschen noch nie etwas geschenkt worden. Für Hugo sah der Berg klobig aus, wie er so isoliert in der Landschaft stand. Er erinnerte ihn stark an den großen Backenzahn eines Hundes. Über den bewaldeten Fuß des Berges, der sich wie Zahnfleisch um dessen Saum schmiegte, stachen steile Felswände empor. Die Gratlinie war gespickt mit zahlreichen Gipfeln, die aus Hugos Perspektive höher aussahen als der eigentliche Zugspitzgipfel. Wenn er dem Kartenmaterial, das im Flur ausgehängt war, Glauben schenken konnte, dann war das Wettersteinmassiv Teil der Nördlichen Kalkalpen. Im Westen und Norden vom Loisachtal, im Osten von der Isar und im Süden von der Leutasch und dem Gaistal begrenzt. Von Ehrwald aus führte die Tiroler Zugspitzbahn direkt auf den Gipfel der Zugspitze. Auch von deutscher Seite gab es eine Seilbahn und sogar eine Zahnradbahn. Die einzige Qual an einer Zugspitzbesteigung lag heutzutage dann wohl in der Wahl des Fortbewegungsmittels.
Sarah hätte es gefallen, auf den Gipfel hinaufzugondeln. Ski fahren. Fünf-Sterne-Hotel. Den Tag verschlafen. Schon komisch, dass er dies alles jetzt ohne sie machte. Eigentlich hatte er nie wieder etwas ohne sie machen wollen, seitdem sie in die Wohnung gegenüber eingezogen war.
Hugo verbrachte die Stunden abwechselnd mit Nickerchen, Fernsehen und Chips aus der Minibar. Am Nachmittag aber gewann der Hunger, und er ließ sich in der Hotelbar einen Toast zubereiten. Aber auch dort ganzjährige Deko-Hirschbrunft. Und nicht nur die. An den Wänden hingen ringsherum echte Geweihe, sodass Hugo das Gefühl bekam, in das Mexican-Stand-off einer Rotwildauseinandersetzung geraten zu sein.
Hugo hatte sich an ein abgeschiedenes Nischentischchen gesetzt. Hinter ihm hingen Schwarz-Weiß-Bilder, die die Geschichte einer Flugzeuglandung auf der Zugspitze im Jahr 1922 erzählten. Damals hatte es noch keine Seilbahnen auf den Gipfel gegeben. Daneben war ein Zeitungsbericht angebracht, wonach sich der auf der Zugspitze dienstversehende Meteorologe von den Piloten hatte frisches Fleisch und Senf mitbringen lassen. Es gab aber noch weitere Zeitungsberichte, wie den, der vom Brand des Kammhotels an der Zugspitze im Jahr 1962 berichtete, oder den von dem verheerenden Lawinenunglück am Zugspitzplatt nur wenige Jahre danach. Nun war es aber vier, und Hugo wandte sich von den historischen Bildern ab, um sich dem zu widmen, weswegen er gekommen war. Er fragte den Barmann, ob es möglich sei, das Programm auf dem Fernseher zu wechseln, und bestellte ein weiteres Bier, als die Vorberichterstattung zum Skisprungwettkampf begann.
Es dauerte nicht lange, bis die bislang fast leere Hotelbar sich zu füllen begann. Die Leute kamen jetzt zum Après-Ski und erzeugten ein undurchdringliches Stimmengewirr, sodass Hugo von den Kommentatoren nicht mehr viel hören konnte. Es reichte ihm aber aus, wenn er die Namen lesen und sehen konnte, wie nah die Athleten der grünen Linie entgegensprangen.
»Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie mir sagen, ob der Oberstdorfer schon gesprungen ist?«, wurde Hugo plötzlich gefragt. Hugo sah auf und erwiderte den freundlichen Blick eines Sportfans.
»Nein, Sie kommen gerade recht! Setzen Sie sich doch zu mir!«, bot Hugo an. »Ich bin der Clemens!« Er biss sich auf die Zunge. Es hatte nicht an ihm gelegen, das Du-Wort anzubieten. Das universale tirolerische Du-Wort galt nicht für Deutsche. Da war schließlich jeder mit jedem per Sie.
»Gern, danke! Ich heiß Kerstin. Kerstin Schlegele. Was trinkst du da, Clemens? Hausbier?«, fragte Kerstin und machte Anstalten, an die Bar zu gehen.
Hugo nickte dankbar. Auch dafür, dass sie seinen Etiketten-Fauxpas entweder nicht bemerken wollte oder taktvoll überspielte. Sie kam mit zwei vollen Gläsern wieder zurück. Dabei hatte sie den Bildschirm nicht aus den Augen gelassen. Ein polnischer Sportler hatte gerade einen ausgezeichneten Sprung hingelegt.
Der Österreicher und die Deutsche sahen wenig amüsiert zu, wie ein Norweger das Auftaktspringen in Oberstdorf gewann. Hugo hatte zum Trost eine weitere Runde holen müssen. Kerstin war fast direkt von der Piste in die Bar gekommen. Sie hatte zwar keine Skikleidung mehr an, aber am Farbunterschied in ihrem Gesicht konnte man das erkennen. Ihre Wangen waren noch immer gerötet. Das Haar leicht zerzaust und ihre Bewegungen von der Kälte leicht steif. So wie Hugos Finger noch von der Kiste vom Vortag.
»Du bist gar nicht zum Skifahren hier?«, wollte Kerstin wissen.
»Sieht man das? Ich war eigentlich auf dem Weg nach Oberstdorf«, antwortete er und deutete mit dem Kinn auf den Fernseher, um zu untermauern, dass er sich den Wettkampf hatte aus nächster Nähe ansehen wollen. »Dann ist mir vor Ehrwald das Auto eingegangen, und ich hab mich kurzerhand für Urlaub entschieden«, log Hugo. Er fand, diese Lüge ließ ihn lässig ungebunden wirken.
»Ich komm selber aus Oberstdorf. Für das Event muss ich nicht dahoim sein. Sind mir zu viel Leute. Hier in Ehrwald bin ich ja eigentlich auch nicht zum Skifahren, sondern beruflich. Ich arbeite für die Allgäuer Allgemeine und recherchiere für einen Artikel über die Fernpassmaut.«
»Davon hab ich gehört. Ich müsst dann vierzehn Euro über den Fernpass zahlen.« Zusätzlich zu der horrenden Strafe und den übrigen Kosten, die ihn erwarteten, wenn er seinen Führerschein zurückhaben wollte, fiel ihm ein. Er nahm schnell einen Schluck von seinem Bier, um den bitteren Geschmack zu vertreiben.
»Ja, jedes Mal vierzehn Euro. Zusätzlich zu eurer Autobahnvignette. Da wird’s teuer, wenn unsereins mal an den Gardasee will.«
Obwohl Kerstin ungefähr in Hugos Alter war, ließ sie diese Knausrigkeit richtig alt wirken. Sarah war kein bisschen geizig gewesen. Sie hatte Hugo immer gescholten, wenn er zu wenig Trinkgeld geben wollte.
»Aber die Vignette zahlen wir ja auch«, beschwichtigte Hugo.
»Noi, das ist nicht das Gleiche. Wir sind ja so gut wie einheimisch hier. Da sollt’s neben den Außerfernern auch eine Ausnahme fürs Allgäu geben. Dafür möchte sich die Lokalpolitik bei uns einsetzen.«
Hugo konnte sein amüsiertes Schmunzeln gut zurückhalten.
»Da kommt mir ein Rechercheaufenthalt hier im Hotel Gamslechner Hof aber extra umfangreich vor«, antwortete Hugo. Dafür besaß sie immerhin das nötige Kleingeld. Er hatte wieder Glück, dass sie diese flapsige Frage geflissentlich überging.
»Weißt, ich hab der Redaktion eine umfassende Reportage zum Fernpass vorgeschlagen. Das war mal die Verkehrsverbindung von Venedig nach Augsburg. Du würdest dich wundern, wer alles hier hat durchmüssen auf seinen Reisen. Goethe zum Beispiel.«
Hugo staunte nicht schlecht. Manch einer hielt das Außerfern tatsächlich für das Ende der Welt. Aber der Goethe war hier gewesen. Schau, schau.
»Die Verbindung vom Inntal hier herauf ist historisch so wichtig, dass sogar drei verschiedene Straßen über den Fernpass führen. Eine ist keine geringere als die Via Claudia Augusta – eine Römerstraße, die fast kerzengrade über den Pass geht. Eine andere Straße stammt aus der Zeit eurer großen Landesfürsten, als man Fernstraßen noch als verlängerten Arm der Macht betrachtet hat und nicht als lautes, stinkendes Ärgernis.«
»Früher Macht der Landesfürsten, heute Ohnmacht der Tiroler Politik«, fügte Hugo süffisant hinzu.
»Die Leute haben profitiert von den Handelswaren und den Reisenden. Die Gamslechners hier, die sind reich geworden mit der Postkutsche über den Fernpass. Und damit haben s’ vor hundert Jahren auch am Bau der Zugspitzbahn mitfinanziert!« Kerstin war sichtlich stolz auf die Ergebnisse ihrer Recherche.
»Und heute sind’s aber die absoluten Transitgegner«, warf Hugo ein, bei dem der Groschen gefallen war, woher er den Namen Gamslechner kannte: »Gerade diese Postkutschen-Gamslechners sorgen beim Thema Transit innerhalb ihrer eigenen Touristikervereinigung immer wieder für Unmut.«
»Touristikervereinigung? Du meinst diesen Steinbockgipfel?«, vergewisserte sie sich.
»Ja, so nennen sie sich. Sämtliche einflussreichen Tiroler Seilbahner und Hoteliers sitzen dadrin und bestimmen maßgeblich die Geschicke der Tiroler Tourismuspolitik.«
»Österreichische Politik wird mir schnell zu unübersichtlich. Aber diese Familie tut sich da schon besonders hervor. Normalerweise ist es halt bei Zusammenschlüssen wie diesem Steinbockgipfel so, dass niemand aus der Reihe tanzen darf, weil man sonst bei den Aufträgen durch die Finger schaut. Die Gamslechners lassen sich davon anscheinend nicht sonderlich beeindrucken. Ein bisschen leicht reden haben sie schon, wenn man bedenkt, dass deren Gäste auch über Garmisch anreisen können und die Fernpassbundesstraße nicht unbedingt brauchen. Darum können die es sich auch leisten, gegen diese Maut zu sein. Derweil sind sie ja gar nicht gegen die Bemautung selber. Nur dagegen, dass man mit den Einnahmen dann den geplanten Fernpasstunnel verwirklicht, weil das nur noch mehr Verkehr anziehen würde«, erzählte Kerstin.
»Mit Straßenausbau ist es halt, wie wenn man einen Kanal gräbt und bei Regen glaubt, das Wasser fließt außenrum«, antwortete Hugo. Er selbst war Leidtragender des Transits. Von seinen Eltern hatte er ein schmuckes Häuschen an den Hängen des Inntales geerbt, das er dann gemeinsam mit Sarah bezogen hatte, und seit sie dort lebten, verursachte ihm das Dauergebrumme des Schwerverkehrs auf der tieferliegenden Inntalautobahn einen dicken Kopf.
»Lass allat gong, s’ hot’s allat dong«, lachte jetzt Kerstin. »Hat meine Oma immer gesagt. Man soll alles so lassen, wie es ist.«
»Auf die Großmama!«, prostete Hugo ihr zu.
»Broschd!«, allgäuerte Kerstin.
Und in diesem Moment dachte Hugo darüber nach, dass Sarah nie etwas für Skispringen übriggehabt hatte. Oder Innenpolitik.
Hugo und Kerstin setzten ihre Unterhaltung den ganzen Abend hindurch fort. Sie unterhielten sich über alles, was ihnen einfiel, und plauderten frei von der Leber. Hugo war in seinem Element. Plaudern. Hier eine Anekdote, da ein Reisebericht. Man hörte ihm einfach gern zu und ließ sich selbst auch wieder etwas erzählen. Kerstins Geschichten waren ebenso sympathisch wie sie selbst. Sie kam viel herum, und im Gegensatz zu Hugo genoss sie es, beruflich unterwegs zu sein.
Als sich in der Hotelbar die Reihen dann gegen Mitternacht lichteten, fand sich ein kleines Grüppchen um Hugo und Kerstin zusammen, die den Tag nicht aufgeben wollten. Zu den beiden gesellten sich die deutschen Urlauber Ulrich und seine Lebensgefährtin Theresa – ein Pärchen in den besten Jahren – sowie der Familienvater Emanuel, der sich von der Trennungsszene seines jüngsten Kindes beim Absetzen im Skikurs noch nicht erholt hatte.
Sie hatten Kerstin und Hugo zunächst für ein Paar gehalten. »Es steht mir leider nicht zu, mich mit dieser Blume zu zieren!«, stellte Hugo klar, wobei Kerstin angesichts der schmalzigen Wortwahl leicht errötete.
Es könnte aber auch am Alkohol gelegen haben. Ulrich und Theresa starteten die Konversation mit einem Lob auf die Gegend und wie angetan sie von den spitzen Berggipfeln, dem Skiwetter und dem täglich aufgefrischten Schnee waren. Hugos Patriotenherz klopfte daher zwei Schläge höher, und er ließ eine Runde springen. Die Deutschen ließen sich gern auf den von ihm bestellten Enzian einladen, der in Gegenwart des Barmannes dann in den Himmel gelobt wurde, in Wirklichkeit aber trocken die Kehle hinunterbrannte.
»Das Einzige, was uns hier negativ auffällt«, begann Theresa mit der Sprache herauszurücken, »ist, dass man überall fürs Parken bezahlen muss, obwohl man ja ohnehin einen Skipass besitzt.«
»Warum benutzt ihr nicht den Shuttle? Wir nehmen immer nur den Shuttle. Kinder mit Skischuhen brauch ich in der Nähe meines Autos genauso wenig wie diese Kühe, die auf dem Weg ins Tannheimer Tal auf der Straße stehen«, fragte Emanuel.
Ulrich fiel fast das Bierglas aus der Hand: »Ja, die kennen wir auch. Eine Katastrophe ist das. Und der ganze Dreck, den die auf der Straße liegen lassen. Dabei sucht man im Tannheimer Tal völlig vergebens nach einer Waschstraße. Da fragt man sich schon, was sich diese Tiroler denken.«
Das brachte Kerstin leicht in Verlegenheit. »Das ist kein Tiroler Vieh. Das kommt aus dem Allgäu. Da gibt’s Weiderechte für die Pfrontner, die so alt sind, dass eigentlich keiner mehr weiß, woher das stammt.«
»Dafür haben die Tiroler den Bayrischen Löwen erschossen!«, warf Theresa mit gespielter Empörung ein.
Hugo wusste nichts damit anzufangen. Er erinnerte sich nur an JJ