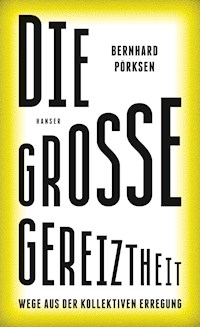Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum hören wir nicht zu? Ein Plädoyer, sich der Welt zu öffnen, von Bernhard Pörksen, der bereits in seinem Buch „Die große Gereiztheit“ Wege für positive gesellschaftlichen Debatten aufgezeichnet hat
Zuhören, Gehörtwerden, den Dialog auf Augenhöhe führen – das sind Schlagworte unserer Zeit, Leerformeln der politischen Rhetorik. Aber was heißt es, wirklich zuzuhören, die eigenen Überzeugungen in Frage zu stellen, sich der Weltsicht des anderen auszusetzen? Warum hört man so lange nicht auf die Opfer sexuellen Missbrauchs, warum nicht auf die Warnungen vor dem Klimawandel? Bernhard Pörksen zeigt, welche Mechanismen das Zuhören verhindern – ob im privaten Umgang oder in der Öffentlichkeit. Und er präsentiert Ansätze und Methoden, die eine neue Offenheit, tieferes Verstehen und empathisches Zuhören ermöglichen. Wie erreicht man, so lautet die Schlüsselfrage, diejenigen, die man nicht mehr erreicht?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Über das Buch
Zuhören, Gehörtwerden, den Dialog auf Augenhöhe führen — das sind Schlagworte unserer Zeit, Leerformeln der politischen Rhetorik. Aber was heißt es, wirklich zuzuhören, die eigenen Überzeugungen in Frage zu stellen, sich der Weltsicht des anderen auszusetzen? Warum hört man so lange nicht auf die Opfer sexuellen Missbrauchs, warum nicht auf die Warnungen vor dem Klimawandel? Bernhard Pörksen zeigt, welche Mechanismen das Zuhören verhindern — ob im privaten Umgang oder in der Öffentlichkeit. Und er präsentiert Ansätze und Methoden, die eine neue Offenheit, tieferes Verstehen und empathisches Zuhören ermöglichen. Wie erreicht man, so lautet die Schlüsselfrage, diejenigen, die man nicht mehr erreicht?
Bernhard Pörksen
Zuhören
Die Kunst, sich der Welt zu öffnen
Hanser
Für Julia
Vorbemerkung
Manchmal ist es überlebenswichtig, dem Clown zuzuhören. Das ist der Grundgedanke dieses Buches. Der Clown ist eine Figur aus einer Geschichte des dänischen Philosophen Søren Kierkegaard, eine Figur, die wir intuitiv sofort einsortieren in unbedingter Erwartung von Witzen, Nonsens, Klamauk. Søren Kierkegaards Geschichte geht so: Eines Tages brennt das Zirkuszelt, das die umherreisenden Zirkusleute am Rande des Dorfes inmitten von staubigen, ausgetrockneten Feldern aufgebaut haben. Aber der Brand lässt sich nicht löschen. Und so wird der Clown auf den Marktplatz des Dorfes geschickt, um Hilfe zu holen, schon in voller Montur, grell geschminkt und mit lustigen Latschen. Er warnt die Dorfbewohner, dass die Felder rund um das Zirkuszelt gleich brennen werden und sich dann alles in ein Flammenmeer verwandelt. Alle sollten, so ruft er, so schnell wie möglich zum Zirkuszelt kommen, bei den Löscharbeiten helfen. Die Dorfbewohner finden diese Performance einfach nur wahnsinnig komisch. Applaus, Applaus. Je mehr der Clown heult und bettelt, je intensiver er zetert und tobt, desto größer das Gelächter, desto lauter das Gejohle. Was für ein raffinierter Werbetrick! Und dann kommt es, das Feuer.
Vorurteile, Vorannahmen und nur schwer erschütterbare Überzeugungen bestimmen, was Menschen hören können. Es ist die Gefahr des sofortigen Bescheidwissens und des vorschnellen Urteils, die dieses Buch in immer neuen Anläufen in drei Kapiteln umkreist. Zu Beginn skizziere ich die Konturen einer Philosophie des Zuhörens, diskutiere grundsätzliche Fragen und schildere eigene Motive und Erfahrungen. Es folgen detaillierte Beobachtungen, Illustrationen einer Praxis des Zuhörens, Versuche der Wahrnehmungserweiterung durch maximale Präzision, die Sichtbarmachung von Kontexten. Das Buch endet in der Gegenwart unserer Diskurse und einer Auseinandersetzung mit der Politik des Zuhörens. Der Kontext ist die Botschaft, so wird hier erneut deutlich. Ohne Kontext kann sich kein wirkliches Zuhören entwickeln, kein angemessenes Verstehen. Ohne Kontext, ohne die Betrachtung im Konkreten, ohne die Analyse einer je besonderen Situation können wir nicht zu einem gerechten Urteil gelangen und keine adäquate Position entdecken. Søren Kierkegaards Clown tritt auf den folgenden Seiten nicht mehr auf, bleibt aber auf hintergründige Weise präsent. Denn ihm zu glauben heißt, die üblichen Wahrnehmungskonventionen zu sprengen, sich von Klischees und vorschnellen Urteilen zu lösen und zu einem Zuhörer der Zukunft zu werden, der sich selbst im entscheidenden Moment vergisst.1
I
Philosophie des Zuhörens
Die Macht der Tiefengeschichten
Dieses Buch geht auf ein Erlebnis zurück, das mich, obwohl es schon Jahre zurückliegt, noch immer umtreibt und irritiert. Ich selbst habe in einem entscheidenden Moment meines Lebens nicht wirklich zugehört, war taub, aber doch nicht so taub, dass ich taub für meine eigene Taubheit wurde. Aber lange kannte ich die Gründe für das anfängliche Hinhören und das spätere Weghören nicht. Und doch: Ist es nicht merkwürdig, peinlich und falsch, erst einmal vom eigenen Ich und den eigenen Erfahrungen zu sprechen, zumal wenn es um das Zuhören geht, also um die Zuwendung zum anderen? Nun, da ich dies notiere, noch einmal, ein allerletztes Mal, neu ansetze, stehen hinter mir drei Koffer voll mit Büchern. Gleich bringe ich sie zurück in die Bibliothek. Gleich können sie weg und auf Nimmerwiedersehen zurück in irgendein Regal. Ich habe Hilfe gesucht bei diesen Büchern, Werken aus der Philosophie, der Literatur und Psychologie. Aber sie haben mir nicht geholfen, allenfalls ein bisschen. Ich habe, im Versuch zu begreifen, endlos ein diffuses Zentrum umkreist, das ich lange nicht wirklich verstand und bestenfalls halbherzig kennenlernen wollte. Irgendwann habe ich mich drei Tage lang mit einem Freund in einem Zimmer in Hamburg eingeschlossen und erst einmal herumtheoretisiert und mit meinem Bücherwissen geprahlt, Studien und Statistiken aufgefahren, die vom Zuhören handeln, das klassische akademische Angebertum. Und irgendwann, weil der Freund so ausdauernd schwieg, so lange zuhörte, aber manchmal auch so hart und zupackend nachfragte, habe ich angefangen, von mir selbst zu sprechen, von meinem eigenen Erleben, von Scham und Schuldgefühlen, von Versäumnis und Versagen. »Fahr nach Hause und schreib alles auf«, sagte er zum Abschied erschöpft. »Du musst persönlich werden.«
Das Jahr 2007. Ein Tag im Herbst. Besuch bei den Eltern in der Wiehre, einem Stadtteil in Freiburg. Ein kurzer, flüchtiger Blick auf die Kirschholzkommode im Wohnzimmer, auf der immer die neuesten Bücher stehen, die gerade gekauft oder von irgendwem geschenkt worden waren. Und auf dieser Kommode findet sich ein Buch, das Hartmut von Hentig geschrieben hat, einst der Star der Reformpädagogik, ein Bekannter meiner Familie, der manchmal auf eine Stippvisite vorbeikam. Sein Buch heißt Mein Leben — bedacht und bejaht.1 Die Elite der alten Bundesrepublik marschiert hier noch einmal auf, Gräfin Dönhoff und Golo Mann, Richard von Weizsäcker, Walter Jens und Georg Picht. Und er, der Gründer der Bielefelder Laborschule, kannte sie alle, korrespondierte mit allen, wurde von allen hofiert und geladen, um Rat gefragt und umschmeichelt, so scheint es, wenn man die biografischen Exkurse liest, die er voller Selbstgenuss ausbreitet.
Nur eine Figur wirkt in dieser Parade der Prominenz seltsam blass, so denke ich, blätternd und lesend, an diesem Nachmittag. Und es ist nicht irgendeine Figur, nicht irgendein Freund oder ein beliebiger, aber natürlich berühmter Universitätsbewohner, mit dessen Namen man sich schmücken kann. Es ist vielmehr ein Mann, der als Freund und Lebensgefährte vorgestellt wird, der in diesem Buch eine zentrale Rolle spielt, aber doch eigentümlich diffus und schwer fassbar erscheint. Seinen Namen habe ich noch nie gehört. Er heißt Gerold Becker, auch er ein anerkannter Pädagoge, so scheint es. Adrian Koerfer, einst Schüler der Odenwaldschule, die Becker lange leitete, wird ihn später »einen der schlimmsten Serienvergewaltiger in der Geschichte der Bundesrepublik« nennen2, einen Pädokriminellen, der manche seiner Schüler hundertfach missbrauchte, ihnen schon morgens beim Wecken an der Odenwaldschule in den Schritt griff oder den Finger in die Poritze schob, um ihnen den Anus zu massieren. Natürlich war bei Hartmut von Hentig nichts von solchen Vorwürfen zu erfahren; der schreckliche Verdacht fand, obwohl damals schon Jahre öffentlich bekannt, mit keinem Wort Erwähnung. Man bekam stattdessen eine hübsche Griechenland-Segelstory mit einem schwierigen Kind zu lesen, die wesentlich vom pädagogischen Genie des Gefährten handelte, von seinem ungeheuren Talent im Umgang mit Jugendlichen, gerade mit jenen, die sich nicht anpassen konnten oder wollten und in der Konsequenz überall rausflogen. Und man erfuhr auf den letzten Seiten des Buches dann noch, dass Gerold mitunter ein bisschen zu viel trank, beim Treppensteigen ins Schnaufen kam, lange an seinem Computer saß, Spiegel und Zeit studierte und oft, trotz seiner Kurzatmigkeit, den Gang zum Postbriefkasten erledigte, auch wenn Hentig das Treppensteigen deutlich leichter fiel.
Warum wurde ich stutzig? War es die literarisierte Glätte der Schilderungen, ihre so eigentümlich überanstrengt wirkende Harmlosigkeit, die Stilisierung des Lebensgefährten zu einem Meister der Pädagogik? Kann man mitunter, ob man will oder nicht, auch das lautstark Beschwiegene und das Ungesagte hören? Vielleicht. Jedenfalls setzte ich mich aus einer Intuition heraus an den Rechner, um das Bild Gerold Beckers zu vervollständigen, das mir seltsam unvollständig schien. Im Netz stieß ich dann auf einen digitalen Zwilling, einen Avatar, der doch ganz andere Züge trug. Auch er hieß Gerold Becker. Auch er war der Lebensgefährte Hentigs. Aber dieser Becker hatte so gar nichts zu tun mit dem grundsympathischen, feinfühligen Menschenkenner aus dem Buch, dessen Fehler allenfalls darin bestand, dass er zum Abend ein paar Gläschen Mariacron zu viel trank. Denn hier erschien er, in manchen Artikeln, als Missbrauchstäter, der sich an Kindern verging. Ich las, was öffentlich zugänglich war. Und hörte zunächst einmal hin, hörte wirklich zu, verstand intuitiv, dass an den Vorwürfen etwas dran sein könnte, gerade weil sie mit keinem Satz Eingang in die Hochglanz-Biografie gefunden hatten und in der seltsam artifiziellen Prosa dieses Erinnerungswerkes nicht auftauchten. Mich verstörte, so würde ich in der Rückschau sagen, der Gegensatz von imponierender Vorderbühnen-Rhetorik (die sich im Buch entfaltete) und verbrecherischer Hinterbühnen-Existenz (die ihre Spuren im Netz hinterließ). Denn diese Kontrasterfahrung kannte ich aus eigenem Erleben. Das Muster war mir im Prinzip vertraut — hier die Schönsprecherei, die wunderbare Rede des Pädagogen, dort die Realität, von der kaum etwas in Richtung der Vorderbühne durchdringt. Nur manchmal lassen sich, wenn man ganz genau hinsieht und hinhört, Signale des Protests erahnen, chiffrierte Botschaften der Betroffenen, die aber auf der Vorderbühne in der Regel nicht wirklich erkannt werden, weil schlicht nicht vorstellbar scheint, was sonst noch so läuft und geschieht, wenn die Tür zu ist und ein Lehrer und die ihm anvertrauten Jugendlichen miteinander allein sind.
Der Klassenlehrer, den ich selbst an der Freien Waldorfschule hatte, war kein Missbrauchstäter, der sexualisierte Gewalt verübte. Er war ein Sadist, ein Menschenfänger und Machtspieler, charismatisch und gutaussehend, verehrt und umschwärmt, stets das passende Rudolf-Steiner-Zitat auf den Lippen und in der Beschämung des Gegenübers geübt, falls doch mal irgendwer kritisch nachfragen sollte.3 Er ließ ein Mädchen, das sich zu ihrem Unglück eine weiße Hose angezogen und ihre Tage hatte, nicht auf die Toilette, obwohl sie darum bat, bis die Hose dann durchgeblutet war und man Blutflecken sah, sich das Blut auf dem kleinen Stuhl ausbreitete, auf dem sie saß, und in das Holz einsickerte. Er verspottete sie vor der Klasse mit einer solchen Perfidie, dass andere Mädchen Angst bekamen und sich fragten, was wohl passieren würde, wenn sie selbst ihre Regel bekämen und womöglich solchen Ad-hoc-Attacken ausgesetzt sein würden. Er verspottete meinen Freund Leon, mit dem ich gelegentlich Musik machte, weil seine Eltern, wie er behauptete, zu den Proleten gehörten, arm und dreckig. Sie seien Abschaum, so suggerierte er, wieder und wieder. Und schon die Tatsache, dass mein Freund billige, nährstoffarme Weißbrötchen aß und kein Vollkornbrot, wurde auf seltsame Weise zu einem Zeichen von Schmutz und Nichtzugehörigkeit stilisiert, zu einem Stigma, das uns, den anderen, den vermeintlich Besseren, signalisierte, dass irgendetwas mit ihm grundsätzlich nicht stimmte. Leon, der nie mehr zu einem der Klassentreffen kam, musste sich manchmal vor aller Augen an dem Waschbecken im Schulraum waschen, bis auch unter den Fingernägeln nichts Schwarzes mehr zu sehen war. Niklas, dessen Vater überraschend verstarb, wurde zur Strafe vor die Tür eskortiert, weil er mit einem Mal nicht mehr richtig funktionierte und manchmal einfach nicht mehr aufhören konnte zu weinen. Hannah, die ihr Patschuli-Parfüm so liebte, holte er nach vorne. Wir sollten sie alle sehen, sie ganz in Ruhe anschauen. Sollten sie wie eine Nutte betrachten, das war die Wahrnehmungsübung, um die es ging und der wir uns bereitwillig und ohne ein Grummeln oder Protest unterzogen, ängstlich und fragend, was wohl gleich passieren würde und wen von uns es als Nächsten treffen könnte. Das Patschuli-Parfüm werde aus den Hoden von Ochsen gewonnen, so dozierte unser Lehrer. Und seht her, dieses junge Mädchen, das sich so aufreizend schminkt, schmiert sich die Essenzen des Ochsen-Hodens ins Gesicht! Eklig, oder? Manchmal malte unser Lehrer mit Kreide einen eng gezogenen Kreis auf den Fußboden im hinteren Teil des Klassenraums. Dort musste man sich dann hineinbegeben; dort saß man dann fest, fixiert in einem von ihm erschaffenen Gefängnis aus Kreidekreisen, die er mit hochrotem Kopf gezeichnet hatte. Und immer wieder ließ er Hannah endlos hinter der Klasse stehen, bis sie eines Tages erschöpft auf den Boden krachte und sich eine Gehirnerschütterung zuzog. Das Getöse ihres stürzenden Körpers haben manche von uns noch heute im Ohr.
Oft tauchte ebenjener Lehrer im Unterricht einer jungen Kollegin auf, die er umwarb, und sorgte hier für Ruhe, indem er ganz still hinten im Klassenraum wartete und lauerte. Wenn jemand störte, auf dem Stuhl hin und her wippte, dann schlich er sich von hinten heran, riss den Übeltäter an seinen Nackenhaaren empor, rupfte und riss an den kleinen Härchen, um wehzutun. Mir galten solche Überfälle von hinten häufiger, sodass ich ihn eines Tages anlockte, mit dem Stuhl scheinbar unkonzentriert hin und her wippte und quietschend gautschte, er sich heranschlich und mich emporriss, ich jedoch in gespieltem Erschrecken derart wild und unkontrolliert mit den Armen herumfuchtelte, dass seine Brille über den Fußboden des Klassenraumes schlitterte.
Ein kleiner, primitiver Racheakt, zugegeben. Und eine verdruckste Gegenwehr im Angesicht erlebter Schikane. Denn über solche Dinge sprechen konnte ich nicht. Ich war ein verquerer, isoliert dahintreibender Jugendlicher, unfähig, irgendwie mitzuhalten. Und schien so schlecht in der Schule, dass eine Koalition unterschiedlicher Lehrer eines Tages, als die Entscheidung anstand, verhindern wollte, dass ich zum Abitur zugelassen werde, und mir einer dieser Lehrer dies wie nebenbei auf dem Gang im Schulgebäude mitteilte, Begründung: mangelnde Intelligenz, schlechte Leistungen, absolute Aussichtslosigkeit in Fächern wie Mathematik und Deutsch. Er warnte mich davor, es auch nur zu versuchen, ich säße dann, sollte ich, wie zu erwarten sei, scheitern und durchfallen, »auf der Straße«. Das Abitur machte ich dann doch, aber den Kampf gegen den Klassenlehrer habe ich, wie alle anderen auch, nach Strich und Faden verloren. Denn natürlich war er stärker. Und er wusste nur zu gut, wie er einem unheimlich werden und in das Unbewusste eines Menschen hineinkriechen konnte. Ich zum Beispiel liebte das Angeln und war oft den Nachmittag über allein an dem Bach unterwegs, der durch das Schulgelände hindurchfloss, und fing hier Forellen. Er fand die Angelei widerlich. Und animierte andere zum Spott über mich, den Tierquäler. Wenn ich ihm zufällig in den Gängen der Schule begegnete, dann zog er mich manchmal zu sich heran, bis sein Mund ganz nah war an meinem Ohr, und flüsterte: »Tote Fische!« Und ließ mich dann wieder ziehen, taumelnd und wie unter Schock, starr vor Schreck.
War das auf Ängstigung und Einschüchterung zielende Gewalt? Aber gewiss. Und doch sind diese kleinen, miesen Quälereien, die ich selbst erlebte, in keiner Weise mit dem vergleichbar, was manche Schülerinnen und Schüler der Odenwaldschule erdulden mussten. Klipp und klar: Ich will hier keine Sekunde lang so tun, als gäbe es auch nur im Ansatz eine Parallelität der Leidensgeschichten. Das wäre lächerlich und einfach falsch. Die Schülerinnen und Schüler an der Odenwaldschule haben versuchten Seelenmord erlebt, genau das ist der Wesenszug sexualisierter Gewalt. Sie haben dann im Ringen um das Gehörtwerden und im Bemühen um Gerechtigkeit erfahren, dass es eine zweite Schuld gibt, nämlich die zunächst verweigerte, in immer neuen Anläufen blockierte Aufarbeitung des Geschehens. Hier geht es also um eine gänzlich andere Dimension der Misshandlung, der Gewalt und der gezielten Ignoranz. Ich erzähle von meinen eigenen Erfahrungen aus einem anderen Grund. Ich halte sie für analytisch aufschlussreich, um das Zuhören und Überhören besser zu verstehen. Denn zum einen fällt auf, dass dieser Lehrer, geschützt von einer alles vernebelnden Idealisierung der Schule und der frömmelnd-beseelten Vorderbühnen-Rhetorik, mit seinen sadistischen Spielchen stets durchkam; dass er unantastbar schien und mit seinem Waldorf-Reformpädagogik-Sprech viele verzauberte, gefeiert für seine Art, mit Menschen umzugehen, frei von Häme, frei von Hinterlist, stets offen und zugewandt. So hieß es zumindest eines Tages in einem vom Bund der Freien Waldorfschulen verbreiteten Nachruf über ihn, den großen Lehrer, den Freund der Kinder und den Mann der Kunst, der die Schönheit des Lichts in Italien und den Reichtum der Farben so liebte. Zum anderen, auch das scheint mir bedeutsam, wurde in diesen seltsamen Attacken auf einen Schüler, der sich für die Schule nicht sonderlich interessierte und vor allem Bachforellen fangen wollte, im Inneren etwas geformt, das die Soziologin Arlie Hochschild mit einem treffenden Wort eine Tiefengeschichte nennt. Eine Tiefengeschichte ist eine emotional eingefärbte Matrix aus Erfahrung und Erkenntnis, es ist ein subjektives Prisma aus Hoffnung und Sehnsucht, Verbitterung und Scham, die jeder Mensch mit sich herumträgt und die darüber entscheidet, was wir für real und für möglich halten und was wir uns vorstellen können und was nicht.4 Diese Geschichte handelt in meinem Fall von einer Erfahrung der Ohnmacht im Angesicht einer vermeintlichen Meisterfigur der Pädagogik, die absolute Macht besitzt. Sie handelt von dem Kontrast von Vorder- und Hinterbühne und den Wirkungen von Charisma vor dem Horizont von schönen, aber doch artifiziell wirkenden Reden und offensiv praktizierter Heuchelei. Jeder Mensch trägt seine eigene Tiefengeschichte mit sich herum. Sie wird durch die je besondere Lebenssituation, durch persönliche Erlebnisse und durch kollektive Umstände geformt. Sie macht ihn durchlässig und offen oder verschließt ihm die Ohren, lässt ihn in Abwehr, Angst und Leugnung erstarren oder in einen epistemischen Zwitterzustand hineindriften, den man als wissende Ignoranz bezeichnen könnte und der eine erahnte, zunächst nur diffus gespürte Wahrheit umkreist, die man partout nicht wahrhaben und eigentlich am liebsten wieder wegdrücken will, aber der man doch nicht dauerhaft ausweichen kann.5
Wir hören, was wir fühlen, so lautet eine zentrale These dieses Buches. Und wir fühlen, was wir selbst erlebt und erfahren haben, weil es unsere eigene, mal ganz persönliche, mal mit anderen geteilte Tiefengeschichte ist, die uns sensibel werden lässt.6 Wirklich hören heißt also auch: etwas in veränderter Form erneut hören. Erkennen bedeutet bis zu einem gewissen Grad immer auch: wiedererkennen, sich in dem, was ein anderer berichtet, spiegeln. Damit ist keineswegs gemeint, dass jedes neue Erleben in Wahrheit nur ein Wiedererleben darstellt und man nur das begreifen kann, wofür man bereits vorhandene Einordnungsinstrumente und Sensorien besitzt. Das wäre eine haltlose Übertreibung, denn das hieße auch: Man könnte nichts Neues wahrnehmen, was nicht auf bereits Wahrgenommenes verweist. Gemeint ist vielmehr: Das Selbsterlebte macht feinfühliger. Das Fremde wird uns zugänglicher, weil es Eigenes berührt. Die individuelle Erfahrung und die persönliche Tiefengeschichte — so kategorial anders sie auch bei genauerer Betrachtung sein mögen — schaffen einen Resonanzraum für das, was andere erzählen.
Erneut am eigenen Beispiel: Ich kann nicht sagen, dass mir beim Blättern in Hentigs Erinnerungen die Bilder meiner eigenen Schulzeit wieder zu Bewusstsein kamen. Aber ich bin inzwischen davon überzeugt, dass sich meine weiteren Reaktionen — erst Hinhören, dann Weghören, dann doch wieder Hinhören — nur durch meine eigenen Vorerfahrungen erklären lassen. Jedenfalls behielt ich, kaum dass ich im Netz über Gerold Becker recherchiert hatte, mein neu erworbenes Wissen nicht für mich. Und zog ein paar Monate umher und erzählte jedem, der es hören oder eben auch erkennbar überhaupt nicht hören wollte, was ich im Netz gefunden hatte: Gerold Becker, der Lebensgefährte von Hartmut von Hentig, ist womöglich ein Päderast! Die Reaktionen waren, vorsichtig formuliert, erstaunlich. Ein ehemals ziemlich einflussreicher Schul- und Wissenschaftsfunktionär erklärte mir, er habe von den Vorwürfen gewusst und geprüft, ob es der Reputation schaden könnte, wenn man den Mann als Berater in die eigene Schul- und Wissenschaftsbehörde holen würde, was dann tatsächlich geschah, wohl weil man den möglichen Skandal für beherrschbar hielt. Eine Psychologin, eine freundliche ältere Dame, die in einer Hamburger Villa lebte, fragte mich, ob ich denn nicht wisse, dass Pädophile sehr sensible Menschen seien, voller Einfühlungsvermögen und eben gerade aufgrund ihrer hoch entwickelten Empathiefähigkeit in der Lage, auch schwierigen, offiziell längst aufgegebenen Kindern zu helfen. Bei meinen mäandernden Recherchen traf ich auf einen Publizisten, der viel über Hartmut von Hentig und seine Schulideen geschrieben hatte. Er tat die Vorwürfe — Becker missbraucht jugendliche Schüler — als »Rache nach einer unglücklichen Liebesgeschichte« ab, wie er mir schrieb, dies vermutlich deshalb, weil er Hentig seit Jahrzehnten verehrte und in ihm eine intellektuelle Vaterfigur sah, die er nicht verlieren wollte. Als ich ihn viele Jahre darauf noch einmal auf all dies ansprach, gestand er mir, dass er Becker geschrieben hatte, als die Vorwürfe das erste Mal aufflackerten, um ihn zu fragen, wie man ihn da raushauen und ihm helfen könne.
Symptomatisch scheint mir, dass es mir auch heute noch schwerfällt, die eigentümlichen Wendungen all dieser Gespräche zu rekonstruieren. Denn es waren nicht einfach nur plumpe Rechtfertigungen, die mir da angeboten wurden. Es gab auch keine leicht fixierbare Realität und kein festes Repertoire von Tatsachenbehauptungen, auf das man sich hätte beziehen können. Es war etwas Drittes, nämlich der Versuch, in einer prinzipiell nebulös wirkenden Welt irgendwie Warn- oder Stoppsignale zu platzieren, Tabus zu errichten, dies jedoch auf eine maximal indirekte, schwer entzifferbare Weise, die im Ergebnis das weitere Nachfragen blockierte, ohne Drama und Drohung. Man hätte auch explizit sagen können: »Hör auf, Pörksen, das führt zu nichts und ist eklig.« Genau das sagte man jedoch nicht, zumindest nicht so deutlich. Aber tatsächlich bin ich dieser unausgesprochenen Aufforderung gefolgt. Ich habe nicht weitergefragt und herumgestochert, die gerade erst beginnende Recherchearbeit vorschnell beerdigt. Ich habe die bizarren Rechtfertigungsversuche, die mir begegnet waren, nicht ausreichend überprüft, auch nicht wirklich verstanden und mich in der Konsequenz nicht weiter mit Hartmut von Hentig und Gerold Becker befasst, bis im Jahre 2010 der Skandal erneut und dieses Mal mit einer gewaltigen, endgültig nicht mehr kontrollierbaren Wucht detonierte.
Jetzt war es da, das gesellschaftliche Momentum, das einer jahrzehntelangen Vertuschung ein Ende setzte. Aber warum eigentlich? Woher kam mit einem Mal die investigative Energie der Journalistinnen und Journalisten, die von einem Tag auf den anderen in der Odenwaldschule auftauchten und die doch auch schon früher dem Verdacht hätten nachgehen können, nachdem bereits 1999 der junge Reporter Jörg Schindler (Frankfurter Rundschau) die wesentlichen Fakten publiziert hatte? Aus welchen Gründen gab es sie mit einem Mal, die kollektive Zuhörbereitschaft? Und wie entstehen solche Kipppunkte der Wahrnehmung? Wann beginnt das Zuhören? Wieso wird plötzlich hingehört? Wann hört das Weghören auf? Und wem soll, wem darf man überhaupt zuhören? Und wem auf keinen Fall? Auch von solchen Fragen und der Suche nach Ursachen und Wirkungsmustern im Zusammenspiel von individuellen Tiefengeschichten, kollektivpsychologischer Dynamik und medialen Rahmenbedingungen handelt dieses Buch. Im Zuhören, Weghören und Nicht-Hören realisiert sich die Freiheit des Menschen. Und gleichzeitig wird der dringende Wunsch nach Verdrängung, nach Ignoranz und bloß bequemen Illusionen greifbar. Denn viel zu häufig existieren wir im Kokon unserer Vorurteile und im Fertig-System der reflexhaft geäußerten Meinungen, bestätigungssüchtig und darauf fixiert, zu hören, was wir hören wollen, unfähig, den anderen in seiner Andersartigkeit tatsächlich zu erkennen. Aber manchmal gelingt die Wahrnehmungsöffnung dann eben doch. Nur: Warum? Und: Wie?
Ich-Ohr und Du-Ohr
Es lohnt sich, der Frage nachzugehen, auf welche Weise ich und die anderen, deren Reaktionen ich hier schildere, zugehört haben. Was lässt sich daraus lernen? Zwei Befunde. Es braucht, erstens, um das Zuhören zu begreifen, ein mikrosoziologisches Studium von Ereignissen und Tiefengeschichten, von Ängsten und Atmosphären, die sich, wenn überhaupt, in der Regel nur mit Mühe und viel Zeit entziffern und rekonstruieren lassen. Man muss überdies versuchen zu hören, was allenfalls flüsternd und zögernd zur Sprache kommt, muss dem Raunen und Murmeln hinterherspüren, das plötzliche Schweigen dechiffrieren, darf sich also nicht nur von den lauten, spektakulären, mit Macht vorgetragenen Standpunkten faszinieren lassen.7 Zuhören, verstanden als eine »Metapher für Offenheit«, für »innere Gastfreundschaft« und die »Bejahung des Anderen«8, für die versuchte Akzeptanz und Beheimatung des Irritierenden und Fremdartigen, ist, zweitens, ein deutlich zu allgemeines, allzu umfassendes Wort für sehr unterschiedliche Formen und Varianten der Weltzuwendung.9 Das zeigt schon mein eigener Fall. Ich habe erst hingehört, aufmerksam geworden durch das Schlüssel- und Kontrasterleben von hagiografischer Buch-Prosa und Netz-Wirklichkeit, geprägt von den eigenen Kindheits- und Schulerfahrungen, der persönlichen Tiefengeschichte. Ich habe dann, als ich auf die Fraktion der Relativierer und Beschwichtiger stieß, nur noch sehr selektiv aufgenommen, was mir da erzählt wurde: Einerseits habe ich weggehört, genauer gesagt, ich habe es vermieden und versäumt, das Unausgesprochene, Beschwiegene zu hören, das zwischen oder unter den Worten lag. Aber andererseits habe ich die unterschwelligen, die entscheidenden Appelle exakt registriert, die sich zu der Ansage verdichten lassen, dass es kein Missbrauchsproblem gebe und dass ich das Thema doch bitte einfach fallen lassen solle. Erst als die Geschichte zum Skandal eskalierte, begriff ich das Gesagte wirklich und verstand das Geschehen in einem anderen Aggregatzustand der Klarheit und Eindeutigkeit.
In einem Kontinuum mit gleitenden Übergängen werden hier zwei Extremformen des Zuhörens manifest. Am Beispiel dieser Geschichte wird offenbar, dass es ein Ich-Ohr egozentrischer Aufmerksamkeit und ein Du-Ohr der nichtegozentrischen Aufmerksamkeit gibt.10 Mit dem Ich-Ohr hören wir entlang unserer persönlichen Urteile und Vorurteile zu. Hier ist die Matrix unserer persönlichen Weltwahrnehmung bestimmend. Hier fragen wir nach dem Grad der Übereinstimmung mit unseren eigenen Auffassungen und Interessen, die als Filter funktionieren — und die das Persönliche und für uns Unerwünschte fernhalten, ausblenden, wegretuschieren. Hier dominieren unsere eigenen Fragen und Interessen, unsere Sorgen und Ängste. Hier regiert die Agenda des Ich — und nicht die des Du beziehungsweise des Gegenübers. Der andere dringt nicht durch, wird nicht wirklich kenntlich. Im Ich-Ohr-Zuhören befangen, will ein Wissenschaftsfunktionär vor allem in Erfahrung bringen, ob ihm beziehungsweise der eigenen Schulbehörde das Engagement von Gerold Becker als Berater schaden könnte. Leitprinzip ist also nicht das Schicksal der Betroffenen oder ein authentisches Wahrheits- oder Aufklärungsinteresse, sondern die eigene Agenda im Verbund mit einem institutionellen Narzissmus, der primär daran interessiert scheint, das Image der eigenen Organisation vor Schaden und Schande zu bewahren. Dementsprechend wird gehandelt, geschwiegen, vielleicht aber auch gar nicht erst reagiert, abgewartet, taktiert oder zum Gegenangriff geblasen. Womöglich, aber das ist schwer oder gar nicht zu entscheiden, weil es eine Kenntnis der innerpsychischen Bezirke eines Menschen voraussetzt, hat ebenjener Wissenschaftsfunktionär sehr wohl verstanden, was das Gesagte in der Konsequenz bedeuten könnte und dass nun ein anderes Zuhören und ein neues Handeln nötig wären, aber sich bewusst oder halbbewusst dafür entschieden, dies alles nicht an sich heranzulassen. Jedenfalls wurde über Jahre hinweg (die Geschehnisse um die Odenwaldschule und Gerold Becker waren ja lange bekannt) auf diese Weise zugehört, das Gesagte wurde relativiert, ignoriert und, wie noch zu zeigen sein wird, gezielt vertuscht und mit hoher rhetorischer und strategischer Raffinesse vernebelt. Man kann also, darauf kommt es mir hier an, scheinbar interessiert und zugewandt zuhören — und hört doch eigentlich nur sich selbst, gefangen im System der eigenen Urteile und Vorurteile, das die Berührung mit der Welt des anderen und einer fremden Wirklichkeit blockiert. Der kategorische Imperativ dieser Art des Zuhörens ließe sich folgendermaßen formulieren: Erkenne das Andere nach Maßgabe eigener Interessen, geprägt von eigenen Wünschen, Sehnsüchten, Ängsten und einer persönlich-privaten Agenda.
Das andere Extrem ist die nichtegozentrische Aufmerksamkeit, das Zuhören mit dem Du-Ohr. Hier versucht man in die Welt des anderen einzutauchen, sich ihr wirklich zu nähern und für ihre Andersartigkeit zu öffnen. Hier verlieren eigene Filter zumindest ein Stück weit an Wirkung; der verzerrende Einfluss der persönlichen Perspektive, die man selbst in den Prozess des Zuhörens einbringt, schwindet. Man fragt sich beim Du-Ohr-Zuhören und auf dem Weg zur Anerkennung von Andersartigkeit: In welcher Welt ist das, was der andere sagt, plausibel, sinnvoll, wahr? In welche Wirklichkeit passt es hinein? Der Imperativ dieser Form von Welt- und Wirklichkeitszuwendung könnte folgendermaßen lauten: Erkenne das Andere als Anderes — in seiner Fremdheit, seiner Schönheit, seinem Schrecken. Es ist das entschiedene Bemühen, über die eigene Perspektive hinauszugelangen, das diese Form des Zuhörens auszeichnet. Das Ringen um die Bestätigung bereits vorgefasster Auffassungen wird schwächer, nimmt ab, die eigene Agenda tritt zumindest in den Hintergrund.
Allerdings wird es nun ein wenig kompliziert. Denn man kann idealtypisch zwei unterschiedliche, im Kern gegensätzliche Pfade des Du-Ohr-Zuhörens voneinander unterscheiden. Pfad Nummer 1 mündet im Extremfall in eine liebende Akzeptanz, die die Legitimität der gerade noch fremd und unverständlich erscheinenden Weltsicht und Perspektive anerkennt, vielleicht sogar versucht, ihr gemäß zu handeln. Ausgangspunkt für diesen Weg des Wahrnehmens und Erkennens bildet beispielsweise der Wunsch, einen geliebten Menschen noch tiefer als bisher zu verstehen, vielleicht weil er sich in einer Form geäußert oder plötzlich in einer Weise gehandelt hat, die uns befremdlich oder gar erschreckend schien. Hier geht es um einen Weg vom Verstehen zum Verständnis bis hin zum Einverständnis, frei nach dem Motto: Ich habe dich, deine Schmerzen und deine Wünsche und Sehnsüchte gehört und verstanden. Ich begreife, was dir wichtig ist. Und tue dies alles nicht unter Zwang, sondern aus freiem Willen und aus eigener Einsicht.11 Pfad Nummer 2 des Du-Ohr-Zuhörens wird von andersartigen Ausgangsmotiven und Erkenntnis-Ergebnissen geprägt.12 Hier will man zwar auch verstehen, aber entwickelt kein sympathisierendes, auf Akzeptanz zielendes Verständnis oder gar Einverständnis, das auf Perspektivübernahme oder gar die Beglaubigung der Weltsicht des anderen durch veränderte Verhaltensweisen hinausläuft. So kann es sein, dass uns ein Mensch gerade in seiner Fremdheit so berührt, fasziniert, vielleicht auch verstört, dass wir ihm unsere ganze Aufmerksamkeit schenken und versuchen, in seine Wahrnehmungs-, Denk-, Gefühlswelten einzutauchen, aber ihn dann doch entschieden verdammen, ihn also im Akt des Urteilens wieder auf Distanz bringen. Man denke hier etwa an die Psychiaterin, die einem Gefängnisinsassen intensiv zuhört, um herauszufinden, in welchem Geflecht aus Motiven, Affekten und Prägungen er agiert hat. Man halte sich das Beispiel eines Soziologen vor Augen, der Tiefeninterviews mit Hooligans führt, um den gewalttätigen Fanatismus zu verstehen, der sie befeuert. Man denke an eine Historikerin, die die Biografie eines Politikers schreibt und sich in Selbstzeugnisse versenkt — ein »lesendes Zuhören« —, um den Triebkräften des Handelns auf die Spur zu kommen, aber eben ohne Sehnsucht nach Horizontverschmelzung. Vorstellbar ist schließlich, dass ein Profiler eine Mordserie in all ihren grausigen Details studiert, um die Vorgehensweise des Täters zu begreifen, die nächsten Taten vorauszusagen, um ihn dann festnehmen zu lassen. Er will verstehen, was diesen Menschen antreibt; er aktiviert seine »prophetische Fantasie«, analysiert die Motive des Täters, verurteilt sie jedoch entschieden und zielt letztlich darauf, ihn zu bekämpfen.
Trotz der Unterschiedlichkeit der hier skizzierten Wege und Herangehensweisen ist den beiden Varianten des Du-Ohr-Zuhörens doch gemein, dass der Zuhörende — zumindest vorübergehend, wenn auch aus unterschiedlichen Motiven und mit radikal unterschiedlichen Zielsetzungen — darum ringt, die Perspektive seines Gegenübers zu übernehmen beziehungsweise sich in ihn hineinzuversetzen, den anderen in seiner Andersartigkeit überhaupt erst einmal zu erkennen (und vielleicht auch anzuerkennen oder eben zu verurteilen). Er oder sie will »sich aussetzen und das eigene System überschreiten«, wie die Sozialwissenschaftlerin und Musikerin Christina Thürmer-Rohr schreibt, nicht in Zynismus, Gleichgültigkeit oder Distanz zum Gegenüber verharren.13 Man kann jedoch fragen, bis zu welchem Grad es überhaupt gelingen kann, in dieser tieferen Art und Weise zuzuhören, sich also von den eigenen Wünschen, Interessen und Filtern und dem, was manchmal das Ego genannt wird, zu lösen.14 Ist es überhaupt möglich, in dieser drastischen und dramatischen Weise empathisch zu werden und die Welt, wie es dann heißt, mit den Augen des anderen zu sehen? Das lässt sich am Ende nicht entscheiden, auch wenn die Euphoriker der Empathie auf der Möglichkeit der Horizontverschmelzung bestehen. Ja, die totale Perspektivübernahme könne gelingen, so beispielsweise der humanistische Psychologe Carl Rogers; man könne das Erleben des anderen in einer Weise nachempfinden, als ob es das eigene wäre.15 Man müsse einfach nur, so meinen auch andere Autoren, das eigene Ego transzendieren, sich »selbst vergessen«16, auf Bewertungen verzichten, einen »Akt der Hingabe« für den anderen erbringen17 und sich letztlich als Person aus dem Prozess der Wahrnehmung herauskürzen, darum gehe es.
Nun denn. Hier wird in bewusster Distanz zu so viel erkenntnistheoretischer Naivität eine weniger idealistisch-euphorische These ausgeführt. Sie besagt zum einen, dass man natürlich und auch in unbedingtem Streben nach Empathie an eigene Wahrnehmungs-, Denk- und Fühlweisen gebunden bleibt, aber dass man — je vielfältiger und komplexer diese Wahrnehmungs-, Denk- und Fühlweisen entwickelt sind — sich der Wirklichkeit des anderen zumindest anzunähern vermag. Sie besagt zum anderen, dass im Akt des Zuhörens unvermeidlich eigene Interessen, verschiedenartige Tiefengeschichten, innere und äußere Widerstände unterschiedlichster Art im Spiel sind, die eine praktisch und pragmatisch interessierte Philosophie des Zuhörens analysieren sollte. Und das bedeutet im Ergebnis und in der Konsequenz, dass die Simulation von Distanz und Objektivität falsch und unsinnig wäre, man also mit den klassischen Konventionen des akademischen Sprechens und Schreibens brechen muss, die geprägt sind durch das Ich-Tabu (bloß keine Ich-Form!), das Erzähl-Tabu (bloß keine Storys!) und das Metaphern-Tabu (bloß keine individuellen, kreativ schillernden Sprachbilder!).18 Denn sie laufen allesamt darauf hinaus, den Erkennenden vom Prozess des Erkennens zu trennen, das Persönliche, aber doch womöglich Entscheidende sprachlich auszublenden — ganz so, als sei man selbst ein Neutrum ohne eigene Empfindlichkeiten, Sehnsüchte, Träume, Narben und Wunden.
Diese Tabus, Konventionen und Darstellungsregeln der klassischen akademischen Prosa befördern eine Vorstellung, die die Publizistin Kübra Gümüşay die »Illusion des Einwegspiegels der Wissenschaft« nennt: Man tut so, »als stünde man geschützt hinter einer verspiegelten Scheibe in sicherer Distanz«, um von dort aus mit »einem entfremdeten Blick die Welt und ihre multiplen Krisen zu erforschen — abstrakt, interessant!«19. Eine einigermaßen seltsame Position, eine illusionäre Idee, naiv und irreführend. Denn niemand denkt, wie ich versuche zu zeigen, über das Gelingen oder Misslingen von Kommunikation, den Dialog oder eben das Zuhören nach, ohne eine eigene Agenda, ein individuelles Interesse, eine persönliche Tiefengeschichte. Das, was hier großspurig eine Philosophie des Zuhörens genannt wird und was doch nicht viel mehr ist als eine Kultur der Nachdenklichkeit20, verlangt daher die Offenlegung der eigenen Vorannahmen und Motive, und zwar gewiss nicht im Sinne eines unscharfen psychologisierenden Daherredens, das in narzisstischer Verzückung den Krümmungswinkel des eigenen Bauchnabels analysiert. Das kann nicht das Ziel sein. Nötig ist vielmehr ein Bemühen um Offenheit und Verständigung, ein Ringen um ein befreites und befreiendes Sprechen, das seine eigene Subjektivität nicht verbirgt, persönliche Erfahrungen und Erlebnisse nicht verleugnet. Denn es existiert, wie der Medienwissenschaftler Jay Rosen zu sagen pflegt, keine »Position aus dem Niemandsland«, es gibt keine epistemologische Schweiz, keinen Ort vollständiger erkenntnistheoretischer Neutralität. Dies anzuerkennen heißt: auch von sich zu sprechen, sich berührbar zu zeigen, verbunden mit der Welt, die man beschreibt.
Die Entscheidung unentscheidbarer Fragen
In der gegenwärtigen Situation, vor dem Horizont ineinander verschlungener Krisen, einer allgemeinen Polarisierungsfurcht und der neuen Macht von Populisten und Ideologen, gewinnt eine Frage an Brisanz, die eine Philosophie des Zuhörens umtreiben muss. Sie lautet: Wem überhaupt zuhören? Nur »den Richtigen« oder auch »den »Falschen«? Gilt es beispielsweise vor dem Hintergrund der Wahlerfolge populistischer Parteien, Rechtsextremen Gehör zu schenken? Tut man dies (Pfad 1 des Du-Ohr-Zuhörens), um sie zu verstehen, weil man zumindest ein partielles Einverständnis für möglich hält? Oder geschieht dies (Pfad 2 des Du-Ohr-Zuhörens), um die Gesinnung der Parteigänger unvoreingenommen zu begreifen, um sie gut begründet und kenntnisreich zu verurteilen und maximal effektiv zu bekämpfen? Was ist das Ziel: das verständnisinnige, von Sympathie geprägte Verstehen oder die klare Verurteilung? Oder ist die Zuhör-Avance nur ein kommunikativer Trick zur Konfliktvermeidung, um versprengte und möglicherweise verirrte Protestierende wieder einzufangen, sie zu besänftigen, um ihnen dann — eben nur scheinbar an ihren Motiven interessiert — klarzumachen, wo sie falschliegen? Noch einmal: Wem muss man unter allen Umständen, wem darf man auf keinen Fall Gehör schenken, zumal öffentlich?
Die Suche nach einer Antwort verlangt die Klärungs- und Sortierarbeit. Zu unterscheiden sind drei Ebenen der Analyse und Betrachtung. Auf all diesen Ebenen werden Fragen zum Thema, die im weitesten Sinne von der Ethik und Moral des Zuhörens handeln — und von den Entscheidungen, die es konkret und praktisch in unterschiedlichen Situationen und Konstellationen zu treffen gilt. Auf der ersten Ebene geht es um Fragen, die strategischer Natur sind. Wer einem anderen zuhört, signalisiert, zumindest solange er nicht unterbricht und offen widerspricht oder auf andere Weise sein Missfallen kundtut, dass die Position, die da ausgebreitet wird, sinnvoll ist, prinzipiell akzeptabel, potenziell erkenntnisträchtig und in irgendeiner Weise interessant. Einem Menschen zuzuhören bedeutet, den Standpunkt des anderen, zumindest dem äußeren Anschein nach, ernst zu nehmen, auf die Präsentation von Gegenargumenten zu verzichten — eben bis zum Moment einer klärenden Intervention, die diese implizite Würdigung und diffuse Sympathiekundgabe mehr oder minder deutlich widerruft und mögliche Differenzen offenlegt. Erschwert wird die Einschätzung, wie das eigene Zuhören wirkt, auch dadurch, dass sich diese so stille, eigentlich so unauffällige Form der Kommunikation im öffentlichen Raum als offene oder verdeckte Parteinahme deuten lässt — und mal zu Recht, mal zu Unrecht in dieser Weise interpretiert und attackiert wird. Oft wird bereits »der zaghafte Versuch des Verstehens als Einverständnis und Sympathiekundgabe oder doch mindestens als eine unnötige mediale Aufwertung skandalisiert«.21 Und manchmal ist man selbst einfach nicht klar und geklärt genug. Hört zu intensiv beziehungsweise auf die falsche Weise zu. Und dringt nicht zur notwendigen Verurteilung durch.
Erneut ein Beispiel aus eigenem Erleben, das mir immer noch nachgeht. Anfang der 1990er-Jahre (in einer Zeit also, als es in Rostock-Lichtenhagen zu rassistischen Pogromen kam) verdiente ich neben dem Studium Geld als Journalist. Von einem linksliberalen Stadtmagazin bekam ich den Auftrag, ein Porträt über den in Hamburg lebenden Neonazi Christian Worch zu schreiben, an dessen Fersen ich mich heftete. Ich las seine Schriften, ging zu Aufmärschen, besuchte ihn in seiner Wohnung, diskutierte nach erlittener Lektüre mit ihm über einen Romanentwurf aus seiner Feder, den er mir kopiert hatte. Einmal fuhr ich nach Halle, um Worch bei einer Demonstration zu beobachten. In einem besetzten Haus am Stadtrand traf ich junge Leute, Desperados und Obdachlose, die sich im Machtvakuum der Nachwendezeit und der allgemeinen Regellosigkeit mit Waffen aus den Beständen der abziehenden sowjetischen Armee versorgt hatten. Einer von ihnen trug, deutlich sichtbar, eine Pistole am Gürtel. Auf dem Marktplatz hielt der britische Holocaustleugner David Irving eine Rede, umjubelt von ein paar Hundert Neonazis, von denen manche Sieg heil! brüllten, alles unter den Augen der Polizei. Ich lief aufgebracht durch die Straßen, weil ich spürte, wie sich die ganze Stadt an diesem Tag in eine rechtsfreie Zone verwandelte und in die Gewalt einer faschistischen Bande geriet, der niemand wirklich entgegentrat.
Eine Szene ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Nicht weit vom Marktplatz stieß ich in einer Seitenstraße auf einen Punk, der sich verlaufen hatte. Er wollte zu einer Gegendemonstration und kannte sich in der Stadt genauso wenig aus wie ich. Nun war er mit seiner Irokesenfrisur und den gefärbten Haaren aus Versehen im Nazi-Territorium gelandet. Und er litt, ebenso für jeden erkennbar, an den Folgen einer Contergan-Schädigung, hatte fehlgebildete, verkürzte Arme und Hände, die aus seinem T-Shirt herausschauten. Wir beide hatten einfach nur noch Angst. Das Einzige, was mir einfiel, war, ihm zu sagen, dass er unbedingt hier wegmüsse; hier sei keine Gegendemonstration, hier seien überall Nazis, die ihn zusammenschlagen würden. Aber ich wusste den Weg nicht. Und er wusste den Weg auch nicht. Wir schauten uns an — ein unendlich trauriger Moment der Hilfslosigkeit. Dann flitzte er weiter und meinte, er müsse vermutlich einfach an das andere Ende der Stadt. Was kann man tun, das war die eigentliche Frage, die unsere Begegnung bestimmte, wie findet man den richtigen Umgang mit ideologisierten, totalitären Wirklichkeiten? Wie sieht er aus, der richtige Weg? Demonstrieren, auf die Straße gehen? Erst einmal zuhören, beobachten, möglichst genau hinschauen, aufklären? Aber mit welchem Ziel? Das Porträt über Christian Worch, das ich nach Wochen quälender Arbeit zusammenstümperte, blieb glücklicherweise ungedruckt. Denn ich hatte zugehört, um zu verstehen, aber hätte im Prozess der Verarbeitung und auf dem Weg zur Veröffentlichung entschiedener auf die Entlarvung und Verurteilung zielen müssen. Es fehlte mir an innerer Klarheit, professioneller Distanz, notwendiger Härte.
Damit gerät die zweite Ebene der notwendigen Klärungsarbeit in den Blick. Sie ist kommunikationspraktischer Natur und handelt von der Frage, wie man im Konkreten und in der je besonderen Situation22 entscheidungsfähig wird, auf welche Weise man zuhört und welche Haltung man wählt. Natürlich wird all dies beeinflusst von der eigenen Rolle im Verbund mit den persönlichen Zielen, Motiven, Tiefengeschichten. Das heißt: Die Frage, wem man wann zuhören sollte, ob einem Menschen oder einer gesellschaftlichen Gruppe zu viel oder zu wenig und auf die richtige und angemessene Art und Weise zugehört wird, lässt sich nicht grundsätzlich für alle Situationen beantworten; das wäre naives Rezeptdenken oder versuchte Bevormundung, paternalistische Besserwisserei. Vielmehr geht es um das persönlich und situativ adäquat Erscheinende, um das gerade jetzt und in diesem Moment Stimmige, das vielleicht nur hier und nur heute für ein spezielles Individuum passt. Die Orientierung an einem potenziell immer umstrittenen Ideal der Stimmigkeit, die Orientierung an einer Idee von individuell-persönlicher und situativer Passung (und nicht mehr an einem vermeintlich zeitlos gültigen, verallgemeinerbaren Rezept oder Prinzip) ist natürlich auch ein Prinzip, aber eben ein Meta-Prinzip, das die Selbst- und Situationsklärung verlangt. Es handelt sich um eine gedankliche Rahmenbildung, um die Suche nach Lösungen voranzutreiben, die zur jeweiligen Person und Situation passen. Meine Einschätzung des Kontextes ist gefordert, meine Entscheidung, ob ich dem anderen Gehör schenke und ob dies sinnvoll, nützlich und angebracht erscheint, wird verlangt. Es gilt, in einem möglichst hellen Bewusstsein für die Nuance und die Situation, die eigene Rolle und das eigene Wollen entscheidungsfähig zu werden; es gilt, die Philosophie des Zuhörens als eine Heuristik anzulegen, sie als eine Kunst des Herausfindens auf dem Weg zu einer stimmigen Haltung zu begreifen — ohne vorfabrizierte Kommunikationsschablonen, ohne eine feste, exakt ausbuchstabierte Rezeptologie, ohne eine vermeintlich ewig gültige, von der Person und der Situation unabhängige Lösung, die eine Eindeutigkeit und Klarheit suggeriert, die es nicht geben kann. Das zentrale Credo bei der Suche nach einer Antwort auf die Frage, wem man zuhören soll und wem nicht, lautet daher im Sinne dieses Neuen Situationismus der Kommunikationstheorie, den ich hier vorschlage (irgendeinen Ismus braucht man ja): Es kommt darauf an.23 Aber wer entscheidet, worauf es ankommt, wer definiert die Logik der Situation?
Damit erreichen wir auf dem Weg zu möglichst bewusst getroffenen Entscheidungen die dritte Ebene der Analyse und Betrachtung. Hier geht es um Fragen, die verantwortungsethischer Natur sind und die von dem Problem handeln, wie man — jenseits der konkreten Selbst- und Situationsklärung — die eigene Haltung und die Entscheidung für die eigene Haltung begründet. Ob man eine beliebige Zahl durch 2 zu teilen vermag — das ist sofort entscheidbar. Es sind die Gesetze der Mathematik, die diese Frage entscheidbar machen. Wenn man darüber nachdenkt, ob man in einem Kaufhaus einen Lippenstift einfach einstecken und sich dann an der Kasse vorbeischleichen darf, dann ist die Antwort klar: Dem stehen Gesetze entgegen, die das Klauen verbieten. Wenn man sich mit dem Problem plagt, ob der Satz »Ich habe fertig!« grammatikalisch korrekt ist, dann lässt sich sofort feststellen, dass dies nicht der Fall ist. Das Besondere: Diese und viele andere Fragen des täglichen Lebens sind, um eine Formulierung des Kybernetikers Heinz von Foerster aufzugreifen, entscheidbare Fragen. Ihre Entscheidbarkeit wird durch die Spielregeln eines Realitätsbereichs (des Realitätsbereichs der Mathematik, der Gesetze, der Grammatikbücher) festgelegt. Und wir kommen, wenn wir nach diesen Regeln spielen und sie für uns akzeptieren, zu einer eindeutigen Antwort, die richtig sein kann — oder eben falsch. »Entscheidbare Fragen sind«, so Heinz von Foerster, »durch den gesetzten Rahmen in einem gewissen Sinne bereits entschieden; man kann lediglich gemäß der vorgegebenen Spielregel die Antwort finden.«24
Aber: Darf man Populisten Gehör schenken, Querdenker und Corona-Leugner zum Gespräch bitten? Muss man dies vielleicht sogar? Gilt es, entschieden für die eigene Wahrheit zu streiten oder behutsam für eine Pluralisierung der Wahrnehmungsformen zu werben? Wie sehen die Konsequenzen aus? Dies sind unentscheidbare Fragen, die jeder für sich entscheiden muss, passend zur eigenen Position und zur je besonderen Situation, verdammt zur Freiheit und Verantwortung.25 Es gibt keinen Automatismus im Prozess der Entscheidungsfindung und kein allgemein akzeptiertes Regelbuch des Sozialen, das Zuhörregeln für alle Fälle bereithält. Heinz von Foersters Pointe: Nur unentscheidbare Fragen können wir entscheiden. Der Akt der Entscheidung einer unentscheidbaren Frage enthält das Votum für eine spezielle Haltung, die einem selbst sinnvoll erscheint; man hört beispielsweise in der Ich-Ohr-Variante oder in der Du-Ohr-Variante weiter zu oder wechselt in den Konfrontationsmodus, sucht Distanz, verurteilt mit Schärfe und so weiter. All dies zeigt die Individualität des Menschen, seine Freiheit in einer prinzipiell offenen Situation.
Heinz von Foerster, selbst in der NS-Zeit als sogenannter Vierteljude in Gefahr und zeit seines Lebens auf eine im Innersten erschütterte Weise darum bemüht, ein Vokabular der ethisch-moralischen Ermutigung zu entwickeln und ein Denken ohne festes Geländer zu befördern, verfolgt mit diesem eigentümlich frei schwebenden Entwurf einer Ethik der Ethikermöglichung ein spezielles Ziel.26 Er will die zentrale Vorbedingung und Prämisse ethisch-moralischen Handelns offenlegen, nämlich die Annahme, dass der Einzelne Entscheidungsfreiheit besitzt, die er in eigener Verantwortung wahrnehmen kann und muss. Wenn man eine unentscheidbare Frage entscheidet, dann wird die eigene Verantwortung deutlich, man kann die eigene Entscheidung nicht an irgendeine übergeordnete Instanz — ein heiliges Buch mit fertig ausgearbeiteten Regeln, die Ansagen eines Philosophenkönigs oder einer Philosophenkönigin, eine vermeintlich objektiv beziehungsweise letztgültig erfasste Realität oder irgendein »anderes geräumiges und vages Reservoir unverseuchter Wahrheit«27 et cetera — delegieren; man kann sie nicht abwälzen und suggerieren, die eigenen Präferenzen hätten nicht sehr direkt etwas mit der eigenen Person und den eigenen Urteilen zu tun. Noch einmal: Die Entscheidung, wem man bis zu welchem Moment in welcher Weise zuhören soll, kann sich, folgt man diesem Argumentationsgang, nur in einer einzigen Art und Weise legitimieren, nämlich durch die selbstverantwortlich getroffene Auswahl einer speziellen Möglichkeit des kommunikativen Handelns bei gleichzeitig postulierter Wahlfreiheit. Das eigene Vorgehen wird auf diese Weise begründbar, aber natürlich nicht letztinstanzlich beweisbar.28 Das bedeutet in der Konsequenz zweierlei. Zum einen gilt es anzuerkennen, dass man für die Entscheidung einer prinzipiell unentscheidbaren Frage die Verantwortung trägt, die einem niemand abnehmen kann. Wirkliches Zuhören, das nicht nur eine Simulation von Zuwendung darstellt, ist nur in Freiheit denkbar. Man kann Menschen zum Schweigen bringen, das ist möglich. Aber man kann sie nicht zum Zuhören zwingen. »Man kann uns zwingen, ruhig zu sein, den Mund zu halten, man kann uns unter Druck setzen«, so der Philosoph und Theologe Francesc Torralba. »Wer aber glaubt, dass wir dann zuhören, der irrt. Nur derjenige hört zu, der es wirklich will. Das Zuhören ist eine der wenigen freien Handlungen, die ein Mensch ausüben kann.«29 Zum anderen gibt es, wenn man für sich entscheidungsfähig werden will, die Pflicht zur zögernden, geduldigen Betrachtung, zu einer sich vorsichtig vorantastenden Annäherung — bis man zu einer gut begründbaren, stimmig erscheinenden Schlussfolgerung gelangt ist, die sich nicht auf Ad-hoc-Einfälle und vorschnelle Deutungen verlässt. Das Ausmaß investierter Zeit und die Bereitschaft zur Betrachtung von Situation und Kontext sind also entscheidende Gütekriterien für die Qualität des Urteils.
Jenseits von Alarmismus und Idealismus
Was bedeuten solche Überlegungen für das Ethos der Darstellung, die eben nicht einfach nur Darstellung ist, sondern auch ein Erkenntnisprogramm sein könnte, eine eigene Schule der Wahrnehmung in Form von komplexen, möglichst vielschichtigen Beschreibungen? Die Antwort, die ich mit diesem Buch versuche, lautet: Es gilt, sich der Erfahrung des Zuhörens und des Ringens um das Gehörtwerden in konkreten Situationen zuzuwenden, diese Situationen in allen Nuancen und Details zu studieren. Das bedeutet auch, dass man sich zwei Denkformen bewusst und mit Entschiedenheit verweigert, die in aktuellen Analysen des Kommunikationsgeschehens außerordentlich mächtig sind. Sie sollen hier Diskursalarmismus und Diskursidealismus genannt werden. Gemeinsam ist beiden Denkformen, obwohl sie konträre, gegensätzliche Positionen markieren, die Distanz zum Konkreten — zugunsten der allgemeinen Idee und der pauschalen These, die entweder den Untergang (Alarmismus) oder die Vision perfekter Zuhör-Welten (Idealismus) beschwört. Beide verfehlen in der Pauschalität ihres Urteils und in ihrer Orientierung am Prinzipiellen das Wirkliche; sie blockieren die Auseinandersetzung mit einer feinkörnigen, widersprüchlich schillernden Realität mit ihren je eigenen Möglichkeiten und besonderen Hindernissen.
Diskursalarmisten sind sich in einem sehr sicher, nämlich, dass die gesellschaftliche Kommunikation vor dem Kollaps stehe und die Öffentlichkeit »in Trümmern« liege (Eva Menasse). Nun haben, so heißt es, die Bullshitter, die PR-Spezialisten, die Populisten und die Trolle übernommen. Respekt und Rationalität versinken in einem postfaktischen Spektakel, regiert von Erregungsstichflammen, Verdummung, sinnloser, niemals endender Wut, die nur noch Erschöpfung erzeugt und keine Erkenntnis mehr ermöglicht. Was einmal Dialog war und Polis zu sein schien, »wird bald nicht einmal mehr eine Erinnerung gewesen sein«30, das scheint den Alarmistinnen und Alarmisten im Feld der Diskursdiagnostik gewiss, die wahlweise die Digitalisierung, den Neoliberalismus oder raffinierte, schwer erkennbare Techniken der Macht beschwören, um die Ursachen der zerstörerischen Prozesse zu benennen. Die Fähigkeit zum Zuhören ist in dieser Düster-Welt erloschen, auch das scheint sicher. »In Zukunft wird es womöglich einen Beruf geben, der Zuhörer heißt«, prophezeit etwa der im apokalyptischen Denken geschulte Philosoph Byung-Chul Han, ein Meister der alarmistischen Thesenproduktion. »Gegen Bezahlung schenkt er dem Anderen Gehör. Man geht zum Zuhörer, weil es sonst kaum jemand mehr gibt, der dem Anderen zuhört.«31
Protagonistinnen und Protagonisten des Diskursidealismus definieren hingegen optimale Sprech- und Dialogsituationen, formulieren immer weitere Kriterien einer idealen Kommunikation, präsentieren immer neue Rezepte und Regeln — auf dem Weg zur Umsetzung der formschönen Idee des Zuhör-Optimums, die sie für sich erkannt haben. Es ist ein Idealismus der Doktrin und nicht des Prozesses, den sie propagieren.32 Dies ist eine wichtige Unterscheidung, weil doch Ideale nicht grundsätzlich kritikwürdig sind, sie vielmehr in der Reibung mit der Erfahrungswirklichkeit und als orientierendes Hintergrundbild Kräfte des Denkens und Handelns freisetzen können. Wo liegt die entscheidende Differenz? Der Idealismus des Prozesses will in enger Bindung an Person und Situation eine Kunst des Herausfindens begründen, die dazu inspiriert, eigene, individuelle Möglichkeiten des Zuhörens ausfindig zu machen, Wachstumschancen zu entdecken, das kommunikative Repertoire zu erweitern. Diese Variante des Idealismus setzt auf Entwicklung und Entfaltung, orientiert sich immer auch an eigenen Erfahrungen und inneren Bildern und nicht an den Denkergebnissen anderer, die bereits feststehen und die sich wie ein Kriterienkatalog abarbeiten lassen. Bei einer solchen Herangehensweise verkündet man keine Rezepte, sondern präsentiert — hin und wieder, ohne universalen, vermeintlich ewig gültigen Lösungsanspruch — Prinzipien, die eine grobe Orientierung geben können und auf die Weitung der Perspektive zielen, aber in jedem Fall die persönliche Selbstbearbeitung und die situationsbezogene Adaption brauchen, die ein Einzelner dann für sich leisten muss. Der Idealismus der Doktrin weiß im Gegensatz zu einer solchen Haltung immer schon (und zwar unabhängig von Kontext und Person), was richtig ist und was falsch und wie man optimal zuhören, reagieren und sprechen sollte. Man kennt die Techniken, weiß den korrekten Weg zu beschreiben, kann die Methode ausbuchstabieren, sie in Regeln für alle Fälle übersetzen. Eben auf dieser Grundlage diagnostiziert man dann Erfolge oder Defizite, Fehler und Versagen — und driftet in eine Form der geistigen Gefangenschaft, die eine reduktionistische, eigentümlich starre Wirklichkeitszuwendung bedingt und für die reiche, vielschichtige Komplexität des Zuhörens taub macht. Entscheidend ist, dass der Idealismus der Doktrin mit feststehenden, unverhandelbaren Schemata der Einordnung und vermeintlich allgemein gültigen Methoden an die fluide Erfahrungswelt des Zuhörens herantritt, ohne situatives Gespür oder gar systemische Weisheit. Man weiß, dass man weiß — und vermisst die Wirklichkeit und das konkrete Kommunikationsgeschehen im Korsett des idealisierten Entwurfs, folgt einer Regel und einem Rezept, das zur Entwertung unterschiedlicher individueller Erfahrungen führt. Denn das Ideal und das vermeintlich situationsunabhängig gültige Zuhör-Rezept wirken wie ein Filter, verengen die Wahrnehmung.33
Im Kontrast zu dieser Haltung wird in diesem Buch eine Denkweise jenseits von Diskursalarmismus und Diskursidealismus erprobt, die der Sozialpsychologe Kurt Lewin action research genannt hätte.34