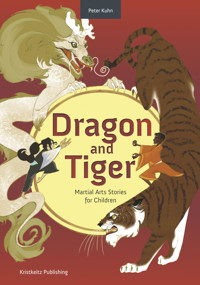16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wer bin ich und warum bin ich so? Rund 500.000 adoptierte Menschen in Deutschland erleben die kaum nachfühlbare Last ungewisser Herkunft. Der vorliegende Band macht auf ebenso behutsame wie eindringliche Weise mit Betroffenen und ihren Schicksalen bekannt. Ihr Suchen über Jahre und Jahrzehnte hinweg, ihre Geschichten, ihr Leiden an und in der Ungewissheit legen offen und zeichnen nach, wie tief die Frage nach der Herkunft uns alle prägt und bewegt. Gelingt die Suche nach den biologischen Eltern, kommt es zur langersehnten Begegnung, dann lebt dieser Moment nicht allein aus dem Kennenlernen der Langgesuchten. Der Moment lebt vor allem als maßgeblicher Schritt auf dem Weg der Begegnung mit dem eigenen Ich. Wie kaum eine andere Untersuchung zuvor verbindet der vorliegende Band die Präzision wissenschaftlicher Analyse mit der Kunst behutsamer Gesprächsführung und tief reichender Problemkenntnis. Der Autor ist selbst ein Betroffener. Er stellt dies nie heraus, doch erklärt sich so die innere Kraft des Werkes. Ein Buch voller Spannung, reich an bewegenden Momenten. Ein Buch voller Erkenntnis, ein Buch über Menschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Dieses Buch richtet sich an alle, denen die Suche Adoptierter nach ihrer leiblichen Familie ein Anliegen ist. Das gilt für Betroffene und interessierte Menschen, aber auch für Fachkräfte. Es fasst die Ergebnisse einer Studie aus den Jahren 2007 bis 2012 zusammen und bereitet sie übersichtlich auf. Es bildet Lebensgeschichten Adoptierter ab, führt umfangreich aktuelle und historische Daten zur Adoption auf und stellt die rechtliche Lage dar. Schließlich werden die Ergebnisse der Forschung zusammengefasst und schlaglichtartig Ausblicke skizziert.
Wem an einer tiefer führenden Erkundung gelegen ist, dem sei der Band „Adoptierte auf der Suche nach ihrer genealogischen Verwurzelung“ (Kühn, ibidem-Verlag 2014) empfohlen. Dort werden zusätzlich umfassend die theoretischen Grundlagen und die Forschungsmethodik beschrieben und die Ergebnisse auf die vorgestellten lebensgeschichtlichen Interviews bezogen sowie in den fachlichen Diskurs gestellt.
An dieser Stelle danke ich den Interviewpartnerinnen und -partner, die mir vertrauensvoll ihre Lebensgeschichte öffneten, ihre ganz persönliche Sicht auf den Prozess der Adoption offenbarten. Dank auch an alle, die mich in anderer Weise beim Entwickeln des Buches unterstützten. Genannt seien Steffi Baldow, Ingo Bochmann, Dieter Boström, Franziska Hofmann, Juliane Kühn, Steffi Kühn, Manuela Lorenz, Prof. Dr. Wolfgang Melzer, Petra Sprenger, Thorsten Stechow, Jörg Wagner und Christine Winkler-Dudczig. Besonderer Dank gilt Prof. Henri Deparade (www.deparade-art.de), der mir wieder eines seiner großartigen Bilder für die Covergestaltung zur Verfügung stellte, sowie Prof. Dr. Harald Wagner, der mich fortwährend Mut machend und wegweisend begleitete.
Peter G. Kühn
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Worum geht es?
Biografische Aneignung der Adoptionsgeschichte
1. Fakten, Zahlen und Gesetze
1.1 Geschichte und Intention der Adoption
1.1.1 Historischer Blick auf die Adoption
1.1.2 Entwicklung in Deutschland
1.1.3 Adoption in der DDR
Exkurs: Zwangsadoptionen
1.1.4 Zwischenresümee
1.2 Adoptionsformen: inkognito, halboffen, offen
1.3 Adoptionsgeheimnis, Familienroman und Interaktionstabu
1.4 Das Adoptionsviereck
1.4.1 Die Adoptionsvermittlungsstelle
1.4.2 Die Adoptiveltern
1.4.3 Abgebende Mütter
1.4.4 Das adoptierte Kind
1.4.5 Die Beziehungen zwischen den Eckpunkten des Adoptionsvierecks
1.5 Machtstrukturen im Adoptionsviereck
1.5.1 Macht
1.5.2 Macht und Adoption
1.6 Statistische Zahlen zur Adoption
1.6.1 Bundesrepublik Deutschland 1950-1990
1.6.2 DDR 1950-1990
1.6.3 Vergleich Geburtenrate und der Adoptionszahlen der BRD und DDR
1.6.4 Weitere Entwicklung der Adoptionszahlen in Deutschland
Exkurs: Die „Pille“ und legalisierter Schwangerschaftsabbruch als Ursachen für rückläufige Adoptionszahlen?
1.6.5 Gewandelter gesellschaftlicher Blick auf Ehe, Familie und Adoption
1.6.6 Das Verhältnis von aktuell vermittelten Adoptionen und Herkunftssuchen in Deutschland
1.7 Rechtlicher Rahmen für die biografische Aneignung
1.7.1 Völkerrecht und bundesdeutsches Recht
1.7.2 DDR-Adoptionsrecht
1.7.3 Zwischenresümee
2. Bindung, Identität und der Zeigarnik-Effekt
2.1 Frühtraumatisierung und Bindungsabbrüche bei Adoptivkindern
2.2 Identitätsentwicklung
2.3 Unbeendete Sinn- und Handlungskonzeptionen: Der Zeigarnik-Effekt
3. Einblicke: Geschichten aus dem Leben
3.1 Andrea
3.2 Beate
3.3 Christian
3.4 Daniela
3.5 Elisabeth
3.6 Friederike
3.7 Gudrun
3.8 Hannelore
3.9 Ines
3.10 Jörg
4. Erkenntnisse
4.1 Die Ausgangssituation der Adoptierten
4.2 Das erste Treffen
4.3 Typische Verläufe biografischer Aneignung der Adoptionsgeschichte
4.3.1 Biografische Aneignung als Teil der Emanzipationsarbeit und des Übergangs zum Erwachsenenleben
4.3.2 Herkunftssuche in der zweiten Lebenshälfte
4.3.3 Zusammentreffen mit den leiblichen Eltern als Interventionsmaßnahme der Adoptiveltern im Kinder- und Jugendalter der Adoptierten
4.3.4 Die Suche nach Kontakten innerhalb der eigenen Generation
5. Ergebnisse
5.1 Motive, Erwartungen, Ziele und Barrieren der biografischen An- eignung der Adoptionsgeschichte
5.1.1 Intrinsische Motive für die biografische Aneignung der Adoptionsgeschichte
5.1.2 Extrinsische Motive für die biografische Aneignung der Adoptionsgeschichte
5.1.3 Intrinsische Barrieren der biografischen Aneignung der Adoptionsgeschichte
5.1.4 Extrinsische Barrieren für die biografische Aneignung der Adoptionsgeschichte
5.1.5 Spannungsverhältnis zwischen intrinsischen und extrinsischen Motiven und Barrieren
5.1.6 Lebensgeschichtliche Übergänge und zyklischer Verlauf
Exkurs: Herkunftssuchen von Kindern
5.2 Voraussetzungen, Prozess und Ergebnisse der biografischen Aneignung der Adoptionsgeschichte
5.2.1 Selbstdefinition als Adoptierte
5.2.2 Hybride Identität
5.2.3 Selbstzuschreibungen und Identitätskonstruktionen
5.2.4 Entmystifizierung der Herkunftsfamilie
5.2.5 Die leibliche Mutter
5.2.6 Die Entwicklung des weiteren Verhältnisses nach dem ersten Kontakt
5.2.7 Geschwistersuche
5.2.8 Die Qualität der Beziehungen in der Adoptivfamilie
5.2.9 Tabuisierungsstrategien in der Adoptivfamilie
5.2.10 Einbeziehung der Adoptiveltern in den Prozess der Herkunftssuche
5.2.11 Die Rolle der Adoptionsvermittlungsstellen
Ausblicke
Literaturverzeichnis
Anlagen
Einwohner und Adoptionen BRD 1970-1990
Einwohner und Adoptionen DDR 1970-1989
Einleitung
Woher komme ich? Wer sind meine Wurzeln? Diese Fragen treiben Menschen um. Sie wollen mehr als nur eine Ahnung ihrer Herkunft gewinnen. Sie suchen nach Wurzeln für Talente, nach Quellen von Charaktereigenschaften, nach Ursachen ihrer Neigungen und Interessen. Häufig werden Kirchenbücher gewälzt, Standesämter befragt. Viele reisen an Orte, die eine besondere Rolle in der familiären Vergangenheit spielen. Computerprogramme zur Erstellung eigener Stammbäume haben Hochkonjunktur; Internet-Suchmaschinen liefern Anhaltspunkte. Seit Urzeiten definieren sich Menschen über Generationsfolgen. Exemplarisch stehen dafür Familienamen wie Hansson (Sohn des Hans) aus dem skandinavischen Bereich und der Zusatz „ben“ oder „ibn“ im Hebräischen bzw. Arabischen (jeweils: Sohn des...).1
Es ist anscheinend die leibliche Familie, um die sich alles dreht. „In der leiblichen Familie aufzuwachsen ist in unserer Kultur selbstverständlich. Ein Kind ist Teil seiner Verwandtschaft, letztes Glied von Generationen. Durch seine Familie weiß es, wer es ist, bekommt es seine Besonderheit, seinen Namen, seine Identität“ (Krappel 1999, 62). Tyrell (1988, 147) spricht davon, dass „mit Ehe und (notwendig hinzutretend) Filiation exklusiv und vollständig die beiden Rekrutierungsprinzipien benannt sind, die – unter Ehemann/Vater, Ehefrau/Mutter und Kind – die familiale Zusammengehörigkeit unabweisbar herstellen.“ Was aber, wenn die leibliche Familie fehlt? Was bleibt jenen unter uns, die früh schon adoptiert worden sind und ihre genealogischen Wurzeln nicht kennen? Adoptierte haben keine Herkunft außerhalb ihrer Adoptivfamilie. Tatsächlich liegen dort ihre sozialen Wurzeln. Die biologische Herkunft jedoch ist abgerissen. Für die meisten Menschen gehören biologische und soziale Elternschaft zusammen. Bei Adoptierten wird beides schon am Beginn des Lebensweges getrennt. Sicher ist das ansatzweise auch in Pflegefamilien oder so genannten „Patchworkfamilien“ der Fall. Bei einer Adoption2 sind jedoch die Verbindungen zu den leiblichen Eltern in besonders drastischer Weise gekappt. Fragen und Schwierigkeiten von Bindung oder Identität, die auch in anderen Konstellationen auftreten können, werden bei der Inkognito-Adoption am schärfsten auf den Punkt gebracht. So kann die Forschung an der verhältnismäßig kleinen Untersuchungsgruppe der Adoptierten Ergebnisse zutage bringen, welche auch für viele andere Bevölkerungsgruppen relevant sind. Die gewonnenen Erkenntnisse können auf weitere Familienarrangements übertragen und bei der sozialen Arbeit angewandt werden.
Adoption ist eine seit alters her bekannte Methode zur Nachwuchsgenerierung. Die Trennung von sozialer und biologischer Elternschaft beschäftigte sowohl die archaischen Mythen (z.B. Ödipus und Mose), als auch immer wieder die Literatur. In den letzten Jahrzehnten dringt das Thema der Suche Adoptierter nach ihrer Herkunft auch in Deutschland immer wieder durch Berichte, Talkshows und Filme in die mediale Öffentlichkeit. Diesem Phänomen widmet sich die vorliegende Arbeit. „Unklar ist, wie viele Adoptierte Informationen über die leiblichen Eltern wünschen bzw. mit diesen zusammentreffen wollen. Für die Bundesrepublik Deutschland liegen keinerlei Zahlen vor. Befragungen älterer Adoptivkinder erbrachten unterschiedliche Angaben über den Anteil derjenigen, die eine Suche beabsichtigen: Die ermittelten Prozentsätze reichen von 45 Prozent über mehr als ein Drittel bis 20 Prozent“ (Textor 1988, 456). Es ist anzunehmen, dass mit einer zunehmenden öffentlichen Thematisierung der Suche Adoptierter in den letzten 25 Jahren der Prozentsatz inzwischen erheblich höher liegt. Genaue Zahlen sind jedoch immer noch nicht verfügbar.
Der Verfasser selbst wurde als Kleinkind von seinen Eltern adoptiert und hat vor über fünfzehn Jahren die leiblichen Eltern zum ersten Mal getroffen. Als Insider hat er einen ganz besonderen Blick auf die Thematik. Das zeigt sich schon im schnellen Zugang zu Betroffenen, im raschen Herstellen eines Vertrauensverhältnisses. Dies kann besonders für die narrativen Interviews gewinnbringend sein. Gewiss birgt eine solche Position auch Risiken, wie zum Beispiel die Gefahr, dass das eigene Erleben die Forschungsergebnisse beeinflussen könnte und Zitate der Interviewpartner durch die eigene Geschichte hindurch interpretiert oder mit dieser ins Verhältnis gesetzt werden. Diese Risiken sind dem Verfasser bewusst und er stellte in allen Arbeitsphasen sicher, sie weitgehend fernzuhalten. Das fiel umso leichter, da die eigene biografische Spannung dank mehrerer Kontakte und Begegnungen mit den leiblichen Eltern vor Jahren schon gelöst wurde. Methodisch dienten die Auswertung zentraler Interviewpassagen in einer Forschergruppe und die konsequente Reflexion der eigenen Position im Untersuchungsprozess dieser Sicherstellung. „Die Wissenschaftlichkeit der Soziologie hängt […] davon ab, dass die Forscherin und der Forscher ihre eigene Beteiligung an der sozialen Welt, ihre Einbindung, Interessen, Wertungen, Sichtweisen, Emotionen erkennen und von ihrem wissenschaftlichen Standpunkt abtrennen“ (Krais/Gebauer 2010, 12f). Wenn dies gelingt, bietet sich dem Forscher, der zugleich Insider ist, ein besonderer Blickwinkel auf das sensible Forschungsfeld, so dass die hieraus erwachsenen Chancen weitaus gewichtiger betrachtet werden können, als mögliche Risiken. Die hier vorliegende Studie soll deshalb in besonderer Weise eine wissenschaftlich reflektierte Sicht des Phänomens der Herkunftssuche Adoptierter bieten. Insiderwissen war Ausgangspunkt für die Themenwahl und formt einen besonderen Blick auf die Problematik. Denn wissenschaftliche Beiträge, die den Prozess der Adoption und zum Teil auch die Herkunftssuche Adoptierter von außen betrachten, gibt es selbst im deutschen Sprachraum schon einige.3 Diesen Studien sollen die hier erarbeiteten Ergebnisse zur Seite gestellt werden und so einen multiperspektivischen Blick ermöglichen. Dabei wird die thematische Involviertheit des Forschers gesehen, bei der Auswertung berücksichtigt und als Chance genutzt.
Worum geht es?
Adoptivkinder werden nach den aktuellen Adoptionsgesetzen vollständig in das Familiensystem der Adoptivfamilie integriert. Alle Verwandtschaftsverhältnisse, auch die Großfamilie, gehören dazu. Dies ist vom Gesetzgeber gewollt und dient dem Wohl des Kindes, das auf diese Weise in normalen Familienverhältnissen aufwachsen kann. Dennoch bleibt immer auch die andere Seite bestehen. Der unklare Beginn der eigenen Lebensgeschichte, die ursprüngliche Zugehörigkeit zu einer anderen Familie bzw. die Beschäftigung damit können dazu führen, dass sich Adoptierte auf den Weg machen, ihre genealogische Abstammung zu rekonstruieren und dabei Kontakt zur leiblichen Familie suchen.
Wie sehen die Lebensgeschichten, Bindungsrepräsentationen und Identitätskonstruktionen der Adoptierten, die auf die Suche gehen, aus? Welchen Einfluss hat der (geglückte oder missglückte) Kontakt mit der Herkunftsfamilie auf das Selbstbild der Betroffenen? Welchen individuellen Nutzen oder welche Befriedigung streben sie mit der Kontaktsuche an? Werden diese Erwartungen erfüllt? Welche typischen Situationen und Konstellationen führen zu der Entscheidung, die Suche nach der Herkunft tatsächlich in Angriff zu nehmen? Wie wirkt sich die (erfolgreiche oder erfolglose) Suche nach den leiblichen Eltern auf den sozialen Kontext der Betroffenen aus?
Die konkrete Fragestellung der diesem Band zugrundeliegenden Studie war: Was motiviert Adoptierte für die Suche nach ihrer Herkunftsfamilie und aus welchen lebensgeschichtlichen Zusammenhängen heraus beginnen sie mit dieser Suche? Wie verarbeiten und bewerten sie die sich daraus ergebenden Prozesse bezüglich ihrer Identität und ihres familiären Zugehörigkeitsgefühls(vgl. Kühn 2014)? Zielgruppe sind dabei Adoptierte, die mindestens mit einem leiblichen Elternteil nach der Suche Kontakt haben oder hatten. Interessant wäre es auch, Lebensgeschichten suchender und nicht-suchender Adoptierter miteinander ins Verhältnis zu setzen. Das würde jedoch den Rahmen sprengen. Ebenfalls nicht betrachtet wird, wenn die Herkunftssuche zu keinem Kontakt mit den leiblichen Eltern geführt hat, die Suche als das Ziel nicht erreicht hat. Der Schwerpunkt der Fragestellung liegt bei den Adoptierten selbst. Die Blickwinkel der abgebenden Mütter und der Adoptiveltern sowie die Rolle der vermittelnden Stellen werden ergänzend in die Studie einfließen.
In der vorliegenden Arbeit, die sich ausschließlich auf Deutschland bezieht, geht es nicht um Auslandsadoptionen (mit weiteren, kulturellen Schwierigkeiten der Begegnung mit der leiblichen Familie), sondern der Fokus liegt auf Inkognitoadoptionen innerhalb der Bundesrepublik bzw. der DDR. Stiefkindadoptionen4 und Verwandtenadoptionen waren und sind ebenfalls ein wichtiger Teil der Adoptionsvermittlungsarbeit. Das Kind wird auf diese Art nahe an seiner Herkunftsfamilie untergebracht und aufgenommen. Dadurch wird jedoch der Blick in Hinsicht auf unsere formulierte Forschungsfrage getrübt, so dass dieser Teil der Adoptierten hier ebenfalls nicht untersucht wird und spezielle Probleme und Fragen aus diesem Bereich nicht im Fokus stehen. Die Ergebnisse können jedoch sowohl in Richtung der Auslandsadoptionen, als auch bezüglich der Stiefkind- und Verwandtenadoption ausgewertet und durch Folgestudien erweitert werden.
Biografische Aneignung der Adoptionsgeschichte
Für die Suche Adoptierter nach ihrer leiblichen Familie, Herkunft oder Vergangenheit gibt es keinen einheitlichen Begriff, der das Phänomen treffend beschreibt. Ebenso gibt es keine im gesellschaftlichen Bewusstsein verankerte oder akzeptierte Verhaltensform für die Begegnung Adoptierter mit den leiblichen Eltern. Jede einzelne Herkunftssuche muss dafür eine eigene, stimmige Form „erfinden“, was ein unverkrampftes Umgehen in einer emotional auch so schon hoch aufgeladenen Situation zusätzlich erheblich erschwert. Was nicht verbal zu benennen ist, lässt sich umso schwerer in praktische Handlung transformieren und zur Realität formen.5 Auch Adoptierte selbst können nur schwer beschreiben, was sie eigentlich suchen. Es scheint sich um eine Form der Bemächtigung der eigenen Geschichte und Klärung für die Narration des eigenen Lebens zu handeln.
Ein Zitat aus einem Interview mit einer Adoptionsvermittlerin beschreibt die Intention der herkunftssuchenden Adoptierten recht gut: „Es sind die Suchenden, es sind die Leute die, hm - nach ihrer Vergangenheit, nach ihren Wurzeln nach ihren - ach, was-weiß-ich-alles forschen. Nach dem schwarzen Loch, zum Aufhellen, um Licht ins Dunkel zu bringen“ (Kühn 2006, 74)? Es geht vor allem darum, Unklares zu verstehen, aufzuarbeiten und in den Kontext der eigenen Lebenserzählung integrieren zu können. Identität entsteht durch Erzählung der eigenen Lebensgeschichte. Diese Lebensgeschichte braucht einen Anfang, der Kohärenz der eigenen Biografie ermöglicht.
In diesem Sinne ist die Suche Adoptierter nach ihrer genealogischen Verwurzelung als ein identitätsstiftender Vorgang zu betrachten, der in verschiedenen Lebensphasen der Adoptierten eine verstärkte Relevanz bekommen kann. Vor einigen Jahren wurde vom Verfasser der Begriff Biografische Aneignungder Adoptionsgeschichte als Beschreibung dieses Prozesses eingeführt (vgl. Kühn 2006/2010). Diese Bezeichnung hat sich bewährt. Biografie ist im Unterschied zum Lebenslauf eine persönliche, subjektive Sichtweise auf das Leben. Deshalb ist das Wort biografisch angemessen. „Als konstruktiver Akt der Lebensbeschreibung verweist die ‚Biografie‘ auf die notwendig gewordene Selbstreflexivität in einer Situation pluraler Lebensoptionen. Sie enthält den Versuch, dem individuellen Leben im Spannungsfeld von Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Bestimmungen Sinn, Bedeutung und Ordnung zu verleihen“ (Deinet/Sturzenhecker 2005, 234). Biografie beinhaltet individuelle Erlebnisse und Erfahrungen, persönliche Deutungsmuster und Relevanzstrukturen und unterscheidet sich somit vom Begriff des Lebenslaufes, wo vor allem die Ereignisse in zeitlicher Abfolge aneinandergereiht werden. Das Erzählen der Lebensgeschichte ist Teil der Identitätsarbeit. Durch das Einordnen und Bewerten, aber auch durch das Weglassen oder Umdeuten vergangener Ereignisse wird Kohärenz und Kontinuität erreicht. Damit ist Biografie die Darstellung subjektiver Realität, die zwar mit den objektiven Ereignissen korrespondiert, jedoch nicht mit diesen gleichzusetzen ist. Biografie hat stets eine „Gegenwartsperspektive, d.h. [es hängt davon ab], mit welchen Interessen, Bedürfnissen und mit welcher biografischen Gesamtsicht sich [die Person] der Vergangenheit zuwendet, in welcher aktuellen Lebenssituation sie sich augenblicklich befindet und mit welchem Grad der Aufmerksamkeit sie sich erinnert. [Dementsprechend] konstituiert [sich] ihre Zuwendung zur Vergangenheit“ (Rosenthal 1995, 93). Biografie entwickelt sich nicht linear, sondern wird von den Individuen immer wieder re-interpretiert und gedeutet und ist damit individuell konstruiert. Eine biografische Erzählung spiegelt die aktuelle Selbstwahrnehmung und -interpretation im Zusammenhang mit der Gegenwart, der Vergangenheit und der antizipierten Zukunft wider.
Aneignung ist ein allgemein verständliches Wort, zu dem auch Nicht-Fachleute Zugang haben. Aneignung ist hier nicht im materiellen Sinne (etwa von Beschlagnahmung) gemeint, deshalb auch das Zusammenspiel mit dem Wort Biografie. Ein Teil der persönlichen Geschichte, Herkunft wird sich zu eigen gemacht und damit dem Machtbereich anderer Interpretationen entrissen. Aneignung ist ein Prozess internalisierender Bedeutungserfassung bzw. Bedeutungsgebung durch das Individuum. Nach Leontjew (1977) ist Aneignung vor allem eine Tätigkeit, das heißt, eine aktive Auseinandersetzung mit einer Gegebenheit (z.B. Gegenstand, Werkzeug, Musikstück, Gesellschafttheorie)6 in praktischer oder kognitiver Form. „Ein Mensch, der sein Bedürfnis nach Kenntnissen befriedigt und dabei einen gegebenen Begriff zu seinem Begriff macht, das heißt, dessen Bedeutung beherrschen lernt, vollzieht dabei [diesen] Prozess. […]Die geistige, die psychische Entwicklung einzelner Menschen ist demnach das Produkt eines besonderen Prozesses - der Aneignung“ (Leontjew 1977, 282; Hervorhebung im Original). Dabei produzieren und reproduzieren die Individuen die kulturellen Bedeutungen der Objekte oder Fähigkeiten. Aneignung vollzieht sich dialogisch, durch Auseinandersetzung mit anderen Individuen, z.B. beim Erlernen einer Sprache. „Der Aneignungsprozess erfüllt die wichtigste Notwendigkeit und verkörpert das wichtigste ontogenetische Entwicklungsprinzip des Menschen: Er reproduziert die historisch gebildeten Eigenschaften und Fähigkeiten der menschlichen Art in den Eigenschaften und Fähigkeiten des Individuums“ (Leontjew 1977, 286). Deinet (2009, 36) versteht „Aneignungsprozesse als schöpferische Leistung, als Eigentätigkeit, [die durch] die realen Anforderungs- und Möglichkeitsstrukturen bestimmt und gerichtet [werden].“ Aneignung geht über das kognitive Kopieren von Wissen hinaus und meint vielmehr eine persönliche Bemächtigung, die individuellen Be-Deutung eines Gegenstandes, eines Ortes, einer Geschichte usw.
Dieser Prozess vollzieht sich auch bei der Suche Adoptierter nach ihrer leiblichen Familie. Adoptierte haben durch die biografische Aneignung ihrer Adoptionsgeschichte die Möglichkeit, sich der Anfangsgeschichte ihres Lebens zu bemächtigen, sie zumindest zu kennen, zu verstehen und nachzuvollziehen. Sehr häufig empfinden Adoptierte, dass Entscheidungen über sie hinweg von den anderen drei Seiten des Adoptionsvierecks getroffen wurden. Dies beginnt bei der Trennung von der leiblichen Mutter, dem Verweigern von Informationen durch die Adoptiveltern bis hin zu unvollständiger Akteneinsicht im Jugendamt bei der Herkunftssuche oder einer Ablehnung von Kontakt durch die leibliche Mutter im Verlauf der Herkunftssuche. Durch aktives Suchen ergreifen sie die Möglichkeit, sich ihre eigene Geschichte zu Eigen zu machen. Der Startpunkt des Lebens soll aus dem Nebel der Ahnungen und Fremdinterpretatinonen (z.B. durch Erzählung anderer) herausgehoben und einer persönlichen Ansicht und Deutung zugeführt werden. Es geht darum, die eigene Geschichte selbst interpretieren, verstehen und erzählen zu können. Ein Puzzleteil des eigenen Lebens, das bisher nicht erkennbar war, bekommt Form, Farbe und Gestalt, so dass es in die Gesamtheit des Selbstkonzeptes integriert werden kann. Die Biografie ist Eigentum des Individuums. Aneignung ist in diesem Zusammenhang zu verstehen im Sinne von: Erkenntnis, Verständnis, Sinngebung sowie Integration sozialer und geschichtlicher Zusammenhänge. Brüche und Abläufe im Welt- und Selbstbild gehören ebenfalls hinein, im Sinne einer Vereinigung gegensätzlicher Pole zu einer Gesamtsicht. Ziel ist die selbstbestimmte Gestaltung der individuellen Identitätskonstruktion, die Gewinnung eines konstant und kontinuierlich empfundenen Selbstbildes. Das Fragezeichen der eigenen Herkunft wird in bewusste Lebensgeschichte verwandelt.
1 Vorab ein Wort zum sprachlichen Genderaspekt in dieser Studie: Alle geschlechtsspezifischen Formen schließen das jeweils andere Geschlecht mit ein (außer, wenn es sich um konkrete Personen handelt). Es wird entweder in der femininen oder in der maskulinen Form geschrieben, umd eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten. Der Verfasser hofft, ein ungefähr ausgeglichenes Verhältnis getroffen zu haben.
2 Besonders im Fall einer Inkognitioadoption, bei der jegliche Informationen über die leiblichen Eltern geheim gehalten werden.
3 Z.B. Napp-Peters 1978, Sorosky/Baran/Pannor 1982, Textor 1988/1989/1990/1990a, Hoffmann-Riem 1989, Geller 1992, Bott 1995 Swientek 2001
4 Das heißt: Ein Ehepartner adoptiert ein Kind, das der andere Ehepartner bereits vor der Eheschließung hatte.
5 Vgl. die Einführung des „Neusprech“ als verordnete Sprache in George Orwells apokalyptischen Roman „1984“: Was nicht sagbar ist (z.B. das Wort „Aufstand“), existiert in der Vorstellungswelt der Individuen nicht und kann so kaum zur Realität werden
6 Leontjew bezieht seinen Aneignungsbegriff auf die Auseinandersetzung mit „Produkten menschlicher Tätigkeit“ (Leontjew 1977, 282). Nachdem Menschen kulturell oder produktiv etwas geschaffen haben, machen es sich andere Menschen, nachfolgende Generationen durch aktive Auseinandersetzung zu eigen.
1. Fakten, Zahlen und Gesetze
In diesem Kapitel werden die relevanten geschichtlichen, strukturellen und rechtlichen Fragen, die mit der biografischen Aneignung individueller Adoptionsgeschichten in Verbindung stehen, beleuchtet. Dabei dient das Adoptionsviereck als Arbeitsmodell. Daneben wird ausführlich auf die Adoptionsstatistiken der Jahre 1950-1990 in beiden deutschen Staaten, sowie im wiedervereinigten Deutschland bis zum Jahr 2013 eingegangen. Ein Exkurs über politisch motivierte Zwangsadoptionen in der DDR ist in das Kapitel eingebunden.
1.1 Geschichte und Intention der Adoption
Adoption heißt übertragen „hinzuwünschen“ und war schon im Altertum bekannt. Die ursprüngliche Intention war, bei Kinderlosigkeit einen Erben zu gewinnen. „Geht man auf die Ursprünge der Adoption zurück, so zeigt sich, dass beherrschendes Motiv lange Zeit die Sicherung der Familiennachfolge in Fällen der Kinderlosigkeit war, wobei die vermögensrechtliche Seite oft eine bedeutende Rolle spielte. Sehr häufig handelte es sich deshalb auch um die Adoptionen von Volljährigen“ (Paulitz 2006, 7). In der späteren bürgerlichen Gesellschaft mit dem (immer noch vorherrschenden) Ideal der Kleinfamilie wurde Adoption volkstümlich als Möglichkeit für ungewollt kinderlose Paare gesehen, doch zu einem Kind zu kommen. Hier spielte auch der patriarchale Gedanke vom „Kind als Besitz“ eine Rolle.
Bekannte geschichtlich-mythische Beispiele für Adoptionen sind der Ödipus-Mythos und die biblische Geschichte der Aussetzung des hebräischen Kindes Moses, das von der Pharaonentochter aufgezogen und adoptiert wird. Bei dieser Geschichte ist zu beobachten, dass Moses zu seinem ursprünglichen Volk zurückkehrt und sich mit diesem identifiziert, es dann schließlich in die Freiheit von der Unterdrückung durch die Ägypter führt. Bei deren Hauptrepräsentanten war er jedoch aufgewachsen. Auch Mose hatte also eine eigene Geschichte der Herkunftssuche nach seinen ursprünglichen Wurzeln.
1.1.1 Historischer Blick auf die Adoption
An dieser Stelle kann nur ein kurzer Überblick geboten werden.1 Adoption ist ein schon seit Jahrtausenden bekanntes und genutztes Mittel der Sicherung des Familienverbandes. Im Altertum wurde adoptiert, um Blutsverwandtschaft bei eigener Unfruchtbarkeit zu ersetzen und so den Fortbestand der eigenen Sippe und des Stammes zu sichern. So sind auch alte babylonische Regelungen einzuordnen, die eine unveränderliche Verbindung mit den Annehmenden sichern sollte: „Vor viertausend Jahren wurde dem Adoptierten, der es wagte, öffentlich zu sagen, dass er nicht das Kind seiner Eltern sei, die Zunge herausgeschnitten. Wenn er gar nach seinen leiblichen Eltern suchte, dann wurde er zur Strafe geblendet“ (Sorosky/Baran/Pannor 1982, 25). Das Inkognito und dessen Wahrung durch ein Nichtreden- und Nichtsehendürfen wurden auf drastische und brutale Weise durchgesetzt. Auch in anderen Kulturräumen, wie in China und Indien, sind Adoptionsbräuche nachzuweisen (vgl. Sorosky/Baran/Pannor 1982, 27). Die Adoption hat sich als Möglichkeit der Familiengründung bzw. der Erbengewinnung in verschiedenen Kulturen weltweit und zu allen Zeiten etabliert.
Im deutschen Sprachraum wurde Adoption mit dem römischen Recht eingeführt. Aus dieser Zeit sind erste Gesetze zur Adoption bekannt. „Bereits das Römische Recht kannte die Adoption. Vor Justinian (527-565 n. Chr.) war sie eine sogenannte ‚adoptio plena‘, das heißt, eine Adoption, die mit allen Folgen einer Kindschaft ausgestattet war (insbesondere mit der ‚patria potestas‘). Seit Justinian erzeugte die ‚datio in adoptionem‘ nur noch ein Kindeserbrecht gegen den Adoptivvater, dagegen kein Kindesverhältnis mehr. Dies war die sogenannte ‚adoptio minus (quam) plena‘“ (Oberloskamp 1993, 14). Auch hier ging es vor allem um Gewinnung von Erben und Fortbestand der eigenen Familie. Adoption wurde im Römischen Reich nicht verschwiegen oder als beschämend angesehen. Auch wurde nicht erwartet, dass der Adoptierte die Verbindungen zu seiner bisherigen Familie abbrach. Wie ein Ehevertrag war die Adoption ein Weg, familiäre und politische Allianzen zu stärken. Bekanntestes Beispiel einer Adoption damals ist wohl die Adoption des Augustus Octavian durch Julius Cäsar, der ihn so zum Kaiser machte. Es folgten später die sogenannten Adoptivkaiser. „Die Bezeichnung erklärt sich aus der Art der Nachfolgeregelung: Nach dem Vorbild von Augustus und Galba versuchten die Adoptivkaiser, durch möglichst frühzeitige Adoption und dadurch gewährleistete Vorbereitung des jeweiligen Nachfolgers der bestgeeigneten Persönlichkeit die Herrschaft zu sichern“ (Meyers Lexikon 1992, Bd. 1, 82). Adoption war im Römischen Kaiserreich ein flexibles Mittel, die eigene Nachfolge besser abzusichern, als es natürliche Nachfolge tat, wenn z.B. der leibliche Nachwuchs als nicht tauglich genug für die hohe Verantwortung erachtet wurde. Es ist davon auszugehen, dass diese Praxis sich nicht auf die Kaiser beschränkte, sondern in den Oberschichten des Römischen Reiches generell praktiziert wurde. Meist wurden Erwachsene adoptiert. Wenn es Kinder waren, so standen dennoch die Erhaltung des eigenen Stammbaumes und die Nachfolge im Mittelpunkt. Ein heutiges Verständnis vom Wohl oder den Bedürfnissen des Kindes war nicht im Spiel.
1.1.2 Entwicklung in Deutschland
„Über das Gemeine Recht, also über das seit dem Ende des Mittelalters in Deutschland rezipierte römische und mit kanonischen und germanischen Elementen vermischter Recht, fand die Adoption als ‚adoptio minus plena‘ Eingang in alle großen europäischen Gesetzeswerke“ (Oberloskamp 14). Der Blick nach Deutschland zeigt, dass es hier ebenfalls eine lange Geschichte der Aufnahme fremder Kinder in die eigene Familie gab. Manche klingen nahezu modern: „Eine frühe Maßnahme im Sinne des Kindes war die im germanischen Kulturkreis vorzufindende ‚Ankindung’, die dazu diente, den unehelich Geborenen die Rechte ehelicher Kinder zu garantieren“ (Krappel 1999, 10; vgl. Napp-Peters 1978, 7).Im mittelalterlichen Deutschland hatte die Adoption eine geringere Bedeutung, wurde jedoch im Ständestaat des 18. Und 19. Jahrhunderts beispielsweise zur Erhaltung von Adelstiteln, wichtig.2 Auch hier zeigt sich wieder der primär materiell-strategische Zweck von Adoptionen in dieser Zeit.
Bis ins späte 19. Jahrhundert und noch darüber hinaus waren in Europa uneheliche Kinder der allgemeinen Diskreditierung ausgesetzt, sie waren „Bastarde“,3 die im vorherrschenden engen christlich-ethischen Weltbild kaum einen Platz fanden. Die bürgerliche Kleinfamilie wurde mit der Urbanisierung allmählich die Richtschnur der angestrebten und anerkannten Lebensform und löste so die bäuerliche Großfamilie ab, die in den Jahrhunderten davor das primäre Familienmodell darstellte. Uneheliche Kinder passten dort nicht hinein. Alleinerziehende Mütter hatten kaum eine Chance auf ein vernünftiges, materiell abgesichertes Leben. So wurden viele Kinder in dieser Zeit ausgesetzt oder fortgegeben. Ähnliches passierte auch mit Kindern, die aus armen Familien stammten und von den Eltern nicht ernährt und aufgezogen werden konnten. Solche Kinder wurden gelegentlich bis in das 20. Jahrhundert hinein auch in Europa als billige Arbeitskräfte in andere Familien aufgenommen. „Das System des ‚Verdingens‘, [bedeutet], die Annahme diente der Beschaffung von Arbeitskraft und verpflichtete das Kind, die ihm gewährte Nahrung, Unterkunft und Kleidung etc. abzuverdienen“ (Napp-Peters 1978, 23). Fjodor Dostojewski beschreibt am Rande seines Romans „Die Brüder Karamasow“ einen solchen Fall, der die Selbstverständlichkeit dieser Handlungsweise illustriert: „Dieser war unehelich geboren, die Eltern hatten ihn als sechsjähriges Kind irgendwelchen Hirten in den Schweizer Bergen geschenkt, die Hirten zogen ihn auf, um ihn zur Arbeit zu verwenden. Er wuchs bei ihnen heran wie ein kleines wildes Tier, die Hirten gaben ihm keinerlei Unterricht, im Gegenteil, als Siebenjähriger musste er auf ihr Geheiß schon die Herde hüten, musste hinaus in die Nässe und Kälte, und sie kleideten ihn schlecht und nährten ihn kaum. Versteht sich, keiner von ihnen machte sich Gedanken darüber, dass sie so handelten, keiner empfand Gewissensbisse, im Gegenteil, sie glaubten sich ganz im Recht, weil [er] ihnen wie eine Sache geschenkt worden war, sie hielten es nicht einmal für notwendig, ihn zu ernähren“ (Dostojewski 1981, 383). Auch wenn dieses Beispiel der Literatur entstammt, so zeigt es recht deutlich die allgemeine Einstellung zu unehelichen, fortgegebenen Kindern.
Im besseren Fall fanden sich solche Kinder in Waisenhäusern wieder, die vor allem von christlichen und wohltätigen Frauen und Männern gegründet wurden. Von da aus wurden sie etwa seit Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts von verschiedenen Organisationen zur Adoption vermittelt. „Die Ortsgruppen des Caritasverbandes, des katholischen Fürsorgevereins für Mädchen, Frauen und Kinder, das Seraphische Liebeswerk und einige evangelische Organisationen […] lernten durch ihre Fürsorgetätigkeit viele verlassene Kinder kennen und fanden unter denen, die ihre Arbeit unterstützten, auch Ehepaare, die bereit waren, diese Kinder in ihre Familie aufzunehmen“ (Napp-Peters 1978, 27). Um die Kinder vor Diskreditierung zu schützen, wurde das strikte Inkognito propagiert. „1928 erhob das Reichsgericht die Inkognitoadoption zum Standardmodell“ (Breitinger 2011, 79). Die Kinder sollten ggf. gar nicht wissen, dass sie adoptiert seien. Der Kontakt zu den leiblichen Eltern war nicht erwünscht und normalerweise auch nicht möglich. So wurde den „Bastarden“ ein relativ normales Leben in einer Familie, die sich aus erbrechtlichen, altruistischen oder anderen Gründen (noch) ein Kind wünschte, ermöglicht. Auch die Adoptiveltern konnten durch das Inkognito die Abweichung von der Norm der bürgerlichen Kleinfamilie, die aus verheirateten Eltern und leiblichen Kindern bestand, möglicherweise verbergen oder vergessen machen. „Gegen diese gesellschaftliche Norm verstießen nun die Ehefrau, die ihrer angeblich natürlichen Bestimmung nicht nachkam, weil sie keine Kinder gebären konnte und die ledige Frau, die zwar Kinder in die Welt setzte, aber sie nicht aufzog. Beiden Frauen drohte die gesellschaftliche Ächtung, beide rettete die Adoption. Sie übertünchte mit ihrer Geheimniskrämerei die Schande der Kinderlosigkeit und das Stigma der unehelichen Geburt“ (Breitinger 2011, 81).
In Deutschland blieb über die Jahrhunderte das Hauptziel einer Adoption, meist wohlhabenden, kinderlosen Ehepaaren den Wunsch nach einem Kind zu erfüllen und sie zur Weiterführung ihres Familienstammbaumes zu befähigen, „das Andenken an ihren Namen und ihre Familie fortzupflanzen“ (§§ 1741-1772 BGB, alte Fassung, zitiert in Jungmann 1987, 3). Die Grundidee des Römischen Rechtes lebte fort. Die Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) im Jahr 1900 brachte eine einheitliche rechtliche Regelung der „Annahme an Kindes statt“ für alle deutschen Länder. Vorher galten unterschiedliche landesrechtliche Gesetze. „Mit der Übernahme in das Bürgerliche Gesetzbuch wurde der Adoption zusätzlich zu der Interessen- auch eine Schutzfunktion zugewiesen“ (Napp-Peters 1978, 35). Auch wenn das Hauptziel einer Adoption weiterhin im familialen und weniger im fürsorgerischen Bereich zu sehen war, sind doch bereits im BGB und bei der weiteren Entwicklung im ersten Drittel des zwanzigsten Jahrhunderts Bestrebungen zu verzeichnen, Adoption mehr mit Blick auf die Fürsorge des Kindes zu gestalten. Dennoch blieb das Adoptionsrecht weitgehend unverändert. In der Zeit des Nationalsozialismus vorgenommen Änderungen dienten vor allem der Durchsetzung der Rassenpolitik.
Im BGBwar ursprünglich das Mindestalter für Adoptiveltern bei 50 Jahren festgelegt. Eine Eltern-Kind-Beziehung konnte durch den großen Altersunterschied bei einer Adoption Minderjähriger so kaum entstehen. Die Adoption Volljähriger zur Beschaffung eines Erben und zur eigenen Sicherung im Alter war nach wie vor durchaus normal. Erst Anfang der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde dieses Mindestalter auf 35 Jahre gesenkt, die Annahme Minderjähriger wurde zur Regel (vgl. §§ 1744 Satz 3, 1745 c BGB alte Fassung). Die Einwilligung der leiblichen Mutter zur Adoption konnte erst gegeben werden, wenn der Säugling mindestens drei Monate alt war. Diese Einwilligung konnte allerdings in Ausnahmefällen gerichtlich ersetzt werden. 1973 wurde das Mindestalter für Adoptiveltern auf 25 Jahre gesenkt. Bei einer Adoption blieben dennoch Verwandtschaftsverhältnisse zur Ursprungsfamilie bestehen und zur Verwandtschaft der Adoptiveltern entstand kein Rechtsverhältnis. „Das bis 1976 geltende bundesdeutsche Adoptionsgesetz sah keine Volladoption vor. Der Adoptionsvertrag […] konnte sogar in begründeten Fällen wieder aufgehoben werden. Das adoptierte Kind war zwar mit seinen Adoptiveltern, nicht aber mit deren Verwandten verwandt, sondern blieb der Familie der leiblichen Eltern verwandtschaftlich verbunden. Es erhielt nicht automatisch die Staatsangehörigkeit der Adoptiveltern und konnte durch einen Vertrag vom Erbrecht ausgeschlossen werden“ (Ahlemeier 1982, 202). Adoption unterlag dem Vertragsrecht, das Vormundschaftsgericht musste allerdings bei Minderjährigkeit zustimmen.
Inzwischen hat sich der Blickwinkel auf Adoption grundlegend geändert. „Zunächst war die Adoption als Vertrag ausgestaltet, der vor einem Notar zu schließen war. Erst die große Reform des Adoptionsrechts von 1977 brachte hier eine grundlegende Änderung. Eine vertragliche Gestaltung, die eigentlich voraussetzt, dass gleichwertige Partner eine Übereinkunft schließen, schien für die Minderjährigenadoption nicht mehr geeignet. Man änderte die rechtliche Konstruktion, und nunmehr wurde die Adoption durch einen Beschluss des Vormundschaftsgerichts ausgesprochen (§ 1752 BGB). Weiter wurde normiert, dass Adoption nur zulässig ist, wenn sie dem Wohl des Kindes dient und zu erwarten ist, dass zwischen dem Annehmenden und dem Kind ein Eltern-Kind-Verhältnis entsteht“ (Paulitz 2006, 8). Adoption wurde zunehmend als Maßnahme der Kinder- und Jugendhilfe interpretiert, wie es sich auch später mit Einführung des KJHG und im Adoptionsvermittlungsgesetz niederschlug. Das adoptierte Kind wird nun vollständig rechtlich aus der Herkunftsfamilie gelöst und in die Adoptivfamilie integriert. Die Änderung der Formulierung ‚Annahme an Kindes statt’ zu ‚Annahme als Kind’ im Gesetzestext spiegelt die Intention der vollständigen Verwurzelung in der Adoptivfamilie wider. Es werden – das ist der Paradigmenwechsel – nicht mehr Kinder für kinderlose Eltern gesucht, sondern Kindern, die nicht in ihrer Ursprungsfamilie aufwachsen können, werden Eltern vermittelt. Gesucht werden also Eltern für das Kind – nicht umgekehrt. Das Kindeswohl steht im Mittelpunkt. Rechtlich sind adoptierte Kinder leiblichen Kindern absolut gleichgestellt, eine Adoption ist prinzipiell unwiderrufbar. „An Stelle der bisherigen Teiladoption mit schwachen Wirkungen trat die Volladoption, d.h., das Kind wird wie ein eheliches Kind der annehmenden Eheleute oder des Annehmenden voll in deren Familienverband eingegliedert (§1754 BGB) und ganz aus seinem ursprünglichen Familienverband herausgelöst“ (Napp-Peters 1978, 42). Mit der großen Reform des Adoptionsrechtes fällt die alte Vertragsform des Adoptionsaktes weg. Adoption ist nun Akt gerichtlichen, staatlichen Handelns. Die Inkognitoadoption – also das Verheimlichen und Verschweigen der biologischen Herkunft gegenüber dem Kind – wird zur rechtlichen Norm. Diese Form wurde allerdings auch vorher schon bei Minderjährigenadoptionen regelmäßig angewandt und scheint historisch durchaus gut begründet, wie oben dargestellt wurde.
Seit 2004 ist es durch das Lebenspartnerschaftsgesetz auch gleichgeschlechtlichen Lebenspartnern möglich, im Sinne einer Stiefkindadoption das leibliche Kind des Partners zu adoptieren. Das Gesetz zur Sukzessivadoption seit Mai 2014 in Kraft. Gemeinsame Adoption fremder Kinder ist momentan noch nicht vorgesehen. Allerdings kann sich ein Partner allein für eine Adoption bewerben. Aktuelle Gesetzesinitiativen bemühen sich darum, auch bei der Adoption gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften der Ehe gleichzustellen und eine gemeinsame Adoption eines Kindes durch beide Partner zu ermöglichen.
1.1.3 Adoption in der DDR
Nach 1945 wurde in der sowjetischen Besatzungszone relativ schnell eine „Verordnung zur Erleichterung der Annahme an Kindes statt [erlassen], um Kriegswaisen und von ihren Familien getrennten Kindern die ungestörte Entwicklung und die Geborgenheit in der Gemeinschaft einer erzieherisch geeigneten Familie zu sichern“ (Grandke 1976, 271f). Das 1965 verfasste Familiengesetzbuch bringt ein Adoptionsrecht mit sich, das in vielen Punkten mit dem heutigen vergleichbar ist und moderner war, als das bis in die 70er Jahre in der Bundesrepublik geltende Recht. Warnecke (2009) vergleicht die bundesdeutsche Rechtsnorm des aktuellen BGB mit dem Adoptionsrecht der DDR. „Betrachtet man die in beiden Rechtsnormen vorgesehenen Voraussetzungen für eine Adoption, so ist festzuhalten, dass mit Ausnahme des §79 Abs. 2 Alt. 2 FGB4 im Wesentlichen strukturelle Ähnlichkeiten bestehen und gleiche Ansätze verfolgt wurden“ (Warnecke 2009, 157). Auch auf anderen Gebieten des Familienrechtes, z.B. bei der Gleichstellung von Mann und Frau, der Stellung unehelicher Kinder oder beim Scheidungsrecht war die Gesetzgebung des FGB der DDR durchaus liberaler und aus heutiger Sicht „moderner“, als die Gesetzgebung der alten Bundesrepublik. Es wurden bei der Eignungsprüfung potenzieller Pflege- oder Adoptiveltern in den achtziger Jahren zum Teil Maßstäbe angelegt, die mit heutigen Ansichten des SGB VIII zum Thema Kindeswohl durchaus korrespondieren. So wurde eine Unterbringung in einer fremden Familie nur angedacht, wenn dies für die Entwicklung des Kindes förderlich war, die Eltern nicht „egozentrische“ Motive verfolgen und nötigenfalls (v.a. bei älteren Pflegekindern) Verbindungen zu leiblichen Verwandten aufrechterhalten werden können. Die individuellen Eigenschaften und Besonderheiten des Kindes sollten in der neuen Familie mindestens ebenso gefördert und entwickelt werden können, wie unter den Bedingungen des Heimes. Die Familie musste kommunikations- und beratungsfähig sein und sich den Möglichkeiten und Besonderheiten des Kindes anpassen können (vgl. Bundesarchiv, DR/2 Nr. 13750).5 „Das, was in den vorgenannten familienrechtlichen Gebieten in der Bundesrepublik zum Zeitpunkt ihrer Änderung als Fortschritt angesehen worden ist, war in der DDR bereits gesetzlich verankert“ (Warnecke 2009, 162). Sie hebt jedoch ebenfalls heraus, dass speziell in Bezug auf das Adoptionsrecht „die einzelnen Voraussetzungen des [aktuellen] BGB jedoch insbesondere unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsprinzips weitaus detaillierter gestaltet sind“ (Warnecke 2009, 157).
Adoption war in der DDR Teil des „sozialistischen Erziehungskonzeptes“. Nach §42 (1) FGB ist „die Erziehung der Kinder eine bedeutende staatsbürgerliche Aufgabe der Eltern.“ Im selben Paragrafen wird ausgeführt, was damit konkret gemeint ist. Neben dem Ziel der Erziehung „zu geistig und moralisch hochstehenden und körperlich gesunden Persönlichkeiten“ wird festgestellt: „Durch verantwortungsbewusste Erfüllung ihrer Erziehungspflichten, durch eigenes Vorbild und durch übereinstimmende Haltung gegenüber den Kindern erziehen die Eltern ihre Kinder zur sozialistischen Einstellung zum Lernen und zur Arbeit, zur Achtung vor den arbeitenden Menschen, zur Einhaltung der Regeln des sozialistischen Zusammenlebens, zur Solidarität, zum sozialistischen Patriotismus und Internationalismus“ (§42, Abs. 2 FGB). Das bedeutet für den Adoptionsprozess, dass „in der DDR auch für notwendig befunden wurde, dass der Annehmende als ‚erzieherisch wertvoll‘ eingestuft werden könne, er dem anzunehmenden gegenüber als ‚guter Staatsbürger‘ in Erscheinung treten werde, eine systemkonforme politisch-moralische Grundhaltung aufweise und vollständig in die sozialistische Gesellschaft integriert sei“ (Warnecke 2009, 150). Wichtige Voraussetzung für das Zustandekommen einer Adoption in der DDR war unter anderem, dass die Betriebe, in denen die Annehmenden arbeiteten, eine Stellungnahme bezüglich der Eignung und der Adoptionsbewerber im Hinblick auf deren moralischer und politischer Eignung abgeben mussten.
Nach § 68 des Familiengesetzbuches (FGB) der DDR traf die Entscheidung über eine Adoption der Staat und nicht ein unabhängiges Gericht. „Zuständig für die Entscheidung über den Antrag des Annehmenden auf Annahme an Kindes statt ist der Jugendhilfeausschuss des Rates des Kreises“ (BI-Universallexikon 1988, Bd.1, 89). Im damaligen Lehrbuch zum Familienrecht wurde das so begründet: „Die gesellschaftliche Wertschätzung und die von Konsequenz geprägte familienrechtliche Ausgestaltung, die die Annahme an Kindes statt unter sozialistischen Verhältnissen erfährt, wird unter anderem auch dadurch deutlich, dass sie unter Wegfall ihres früheren Vertragscharakters Gegenstand eines staatlichen Entscheidungsaktes ist“ (Grandke 1976, 273). Der Jugendhilfe wurde damit eine staatstragende Rolle zugewiesen, die deutlich von unserem heutigen Verständnis von Institutionen wie dem Jugendhilfeausschuss oder der Verwaltung des Jugendamtes abweicht. Die Jugendhilfe in der DDR hatte nach § 70 (1) FGB als einzige Institution Klagebefugnis, wenn es um die Ersetzung der Einwilligung abgebender Eltern zur Adoption ging. Der Paragraf besagt, dass gerichtlich ersetzt werden kann, wenn „sich aus dem bisherigen Verhalten eines Elternteils ergibt, dass ihm das Kind und seine Entwicklung gleichgültig sind.“ Die Klage der Organe der Jugendhilfe musste zwar von einem Gericht bestätigt werden. „Jedoch wurde die Jugendhilfe dazu aufgefordert, die Adoption von elternlosen und familiengelösten Minderjährigen zu forcieren und auch die durch § 70 Abs. 1 FGB eingeräumten Möglichkeiten aktiv zu nutzen, um auf diese Weise möglichst vielen Kindern die Chance zu geben, in einer Familie aufwachsen zu können“ (Warnecke 2009, 121). Es ist ein deutlich offensiveres staatliches Handeln in Bezug auf Familie und Kindeserziehung zu beobachten, als das in der bundesdeutschen Rechtslage jemals denkbar gewesen wäre. Dies ist durch den in der DDR grundsätzlichen Vorrang des Kollektiven gegenüber dem Individuellen erklärbar. Mit diesem Vorgehen ist die Adoption deutlich vom Bereich der Privatverträge abgegrenzt, wie es in der Bundesrepublik bis in die 70er Jahre hinein üblich war. Adoption war, wie generell die Familie, keine reine Privatsache, sondern immer auch von gesellschaftlichen und staatlichen Interessen geleitet. Auch wenn die Entscheidung über die Ersetzung der Einwilligung zur Adoption letztlich ein Gericht fällen musste, waren die „Organe der Jugendhilfe“ in fast allen Bereichen, die die Adoption betrafen, Themensetzer und Entscheidungsträger. In der DDR wurden bspw. in den Jahren 1968 und 1969 zwischen 10 und 15% der Adoptionen ohne Einwilligung der Eltern vollzogen. Davon ca. ¾ nach § 70 (2) FGB6 und ¼ nach § 70 (1) FGB (vgl. Bundesarchiv DR/2 Nr. 13754).7 Der Vater eines unehelichen Kindes musste nach § 69 FGB nur einwilligen, wenn er das Erziehungsrecht übertragen bekommen hatte. Dies war eher selten der Fall.
Dazu kommt, dass nach § 249 des Strafgesetzbuches der DDR „asoziales Verhalten“ – was zum Beispiel durch ein fehlendes Arbeitsverhältnis begründet wurde – ein Grund war, Müttern das Erziehungsrecht für ihre Kinder zu entziehen und diese dann anders unterzubringen. Auch eine Ersetzung der Einwilligung der Eltern „auf Klage des Organs der Jugendhilfe“ und damit die zwangsweise Freigabe zur Adoption waren möglich. Das kann prinzipiell auch nach heutigem Adoptionsrecht, gemäß § 1748 BGB (Ersetzung der Einwilligung eines Elternteils) unter bestimmten Umständen geschehen. Dennoch geraten wir an dieser Stelle in den Bereich der potenziellen Zwangsadoptionen. Auf dieses Thema wird im folgenden Exkurs eingegangen.
Trotz dieser Einschränkungen kann davon ausgegangen werden, dass für die überwiegende Anzahl von ausgesprochenen Adoptionen im jeweiligen rechtlichen und gesellschaftlichen Kontext in der DDR gilt, dass das Wohl des Kindes wichtigste Zielrichtung war. Dabei ist jedoch festzuhalten, dass die damalige Interpretation des Kindeswohls nicht in allen Punkten mit der aktuellen Definition übereinstimmt. Bei der Bewertung des Adoptionswesens in der DDR sind einerseits der gesetzliche Rahmen und die allgemein verordnete Zielrichtung der Erziehung in der DDR zu sehen. In diesem Kontext wurden auch alle Fragen um Adoptionen behandelt. Auf der anderen Seite stehen der fürsorgerische Anspruch, der ebenfalls gesetzlich verankert war, sowie das situationskonkrete Handeln der einzelnen Adoptionsvermittlerinnen. Die meisten Adoptionen, die in der DDR ausgesprochen wurden, halten auch heutigen Kriterien weitgehend stand. Dies gilt genauso, wenn man die parallele Entwicklung des Adoptionswesens in der damaligen Bundesrepublik betrachtet. Dennoch gab es auch eine andere Seite, die keinesfalls verschwiegen werden darf: Zwangsadoptionen.
Exkurs: Zwangsadoptionen
Durch die oben beschriebene Einordnung der Adoptionsgesetzgebung in das Globalziel, die Menschen zu „sozialistischen Persönlichkeiten“ zu erziehen, ist die Trennung zwischen normaler Adoptionsfreigabe und staatlichem Willkürhandeln nicht immer scharf zu ziehen. Durch die Ersetzung der Einwilligung zur Adoption durch die leiblichen Eltern wurde, wie auch im aktuellen Recht, ein Instrument zur Machtausübung gegen den Willen der Eltern gesetzlich novelliert. Offizielles Ziel einer solchen Intervention war sicherlich stets das Wohl des Kindes. Allerdings, wie oben bereits angedeutet, ist dies nicht mit heutigem Verständnis des Kindeswohls nach dem KJHG bzw. BGB in allen Belangen gleichzusetzen, da die gesamtgesellschaftliche sozialistisch-kollektive Ausrichtung wenig Platz für alternative, nonkonforme Lebensweisen bot und das Wohl des Kindes stets auch unter politisch-gesellschaftlicher Prämisse bewertet wurde. So stellte Heinz Funke, Sektorenleiter des Ministeriums für Volksbildung der DDR, während des 20. Plenums des Obersten Gerichtes der DDR Ende der 60er Jahre fest, „dass das Kindeswohl nur vom Klassenstandpunkt aus betrachtet werden könne und es dann als gewahrt gelte, wenn die Entwicklung des Kindes zum sozialistischen Staatsbürger gesichert sei“ (Warnecke 2009, 86).
Die Frage nach politisch motivierten Zwangsadoptionen wurde erstmals in einer breiten Öffentlichkeit diskutiert, als der „Spiegel“ 1975 mehrere Artikel zu diesem Thema veröffentlichte.8 „Der Zentralen Erfassungsstelle der Länderjustizverwaltungen in Salzgitter zur Erfassung von Gewalttaten in der DDR sind bisher 13 Zwangsadoptionen von Kindern ‚republikflüchtiger‘ Eltern in der DDR bekannt geworden. Wie der Leiter der Behörde, Oberstaatsanwalt Tetemeyer, gestern auf Anfrage mitteilte, sind die Informationen darüber inoffiziell gesammelt worden, weil es eine Rechtsvorschrift zur Registrierung dieser Fälle nicht gibt“ (TAGESSPIEGEL, 13.03.1976; gefunden in BStU MfS ZAIG 9845, 92). Die Berliner Morgenpost berichtet am 16.01.1976 von fünf Fällen, die der Bundesregierung bekannt seien (BStU MfS ZAIG 9845, 123). Die „Gesellschaft für Menschenrechte“ Frankfurt/Main dokumentierte 1977 die Fälle von vier Familien in ausführlicher Form. 1991, nach der politischen Wende und der deutschen Wiedervereinigung wurden im Rathaus Berlin Mitte Akten gefunden, die auf mögliche Zwangsadoptionen in der DDR schließen ließen (vgl. Warnecke 2009, 1ff, Janitzki 2009, 89ff). Daraufhin wurde eine Clearing-Stelle gegründet, die sich mit diesem Thema befasste. Diese Stelle definierte den Begriff „Zwangsadoption“ folgendermaßen. „Als zwangsadoptiert betrachtet die Clearing-Stelle jene Kinder, die ihren Eltern wegen politischer Delikte wie ‚Republikflucht‘, ‚Staatshetze‘ oder ‚Staatsverleumdung‘ weggenommen wurden, ohne dass in der Vergangenheit ein gegen das Wohl des Kindes gerichtetes Versagen der Eltern nachweisbar war“ (zitiert in: Warnecke 2009, 175f).9 Eine Zwangsadoption nach dieser Definition liegt vor, wenn in politischer Gesinnung oder staatsfeindlichen Handlungen die alleinigen oder überwiegend ausschlaggebenden Gründe für einen Entzug des Erziehungsrechtes zu sehen sind. Die Clearingstelle bewertete insgesamt 7 Fälle von Adoptionen als Zwangsadoptionen (vgl. Warnecke 2009, 177, Fußnote 870; Janitzki 2009, 90). „In etwa 20-25 Fällen erklärte die Clearing-Stelle gegenüber den leiblichen Eltern, dass auch nach bundesdeutscher Rechtsprechung die Herausnahme der Kinder wegen gravierender Versorgungsmängel und Kindeswohlgefährdung berechtigt gewesen wäre“ (Janitzki 2009, 90). Warnecke (2009) findet insgesamt 6 eindeutig zuzuordnende Fälle. Auch wenn die Zahl zunächst gering erscheint, zeigen sie doch unglaubliche Momente staatlichen Willkürhandelns, die nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Warneckes Schlussresümee ist diesbezüglich eindeutig und muss wohl nicht weiter kommentiert werden: „In der DDR hat es Fälle politisch motivierter Kindesentziehungen gegeben. […] Ein System muss sich auch daran messen lassen, was in ihm möglich ist. Die Durchführung von Zwangsadoptionen war in der DDR möglich“ (Warnecke 2009, 351ff).
Nach § 249 des Strafgesetzbuches der DDR war „asoziales Verhalten“ – was zum Beispiel durch ein fehlendes Arbeitsverhältnis begründet wurde – ein Grund, Müttern das Erziehungsrecht für ihre Kinder nach §§ 50/51 FGB der DDR10 zu entziehen und diese dann anders unterzubringen. Dieser Paragraf war recht dehnbar, wurde allerdings von der Clearing-Stelle nicht als politisches Delikt in die Definition aufgenommen. „Diese Aussparung ist insofern erstaunlich, als gerade auch der Straftatbestand der ‚Asozialität‘ ein Delikt politischer Natur sein kann, geht es doch um die strafrechtliche Sanktionierung gesellschaftlich nonkonformen Verhaltens“ (Warnecke 2009, 340). Es können politische Motive für den Erziehungsrechtsentzug nicht ausgeschlossen werden bzw. erscheinen stellenweise sogar wahrscheinlich.11 Die Ersetzung der Einwilligung der Eltern nach § 70 FGB „auf Klage des Organs der Jugendhilfe“ und damit die zwangsweise Freigabe zur Adoption war in der DDR möglich und wurde etwa doppelt so oft ausgesprochen, wie in der alten Bundesrepublik (9% DDR, ca. 4,6% alte BRD, vgl. Janitzki 2009, 90). Dieser Paragraf wurde auch angewendet, wenn Eltern ohne ihre Kinder in die Bundesrepublik geflohen sind. „Der elterliche Aufenthalt galt u.a. dann als nicht ermittelbar, wenn Eltern die DDR verlassen hatten, ohne die polizeilichen Meldevorschriften zu beachten und trotz Nachforschungen nicht ausfindig gemacht werden konnten“ (Warnecke 2009, 123). Politische Willkür konnte sich mit fürsorgerischem Handeln vermischen bzw. dieses bestimmen.
Exemplarisch sei auf einen Fall von politsch motivierter Zwangsadoption kurz eingegangen:12 Frau F, eine 30-jährige studierte Naturwissenschaftlerin, versuchte 1974 mit ihrem damals 3-jährigen Kind in einem umgebauten Fluchtfahrzeug die DDR Richtung BRD zu verlassen. Ihrem Sohn verabreichte sie durch Injektion vorher ein Schlafmittel, um einer Entdeckung des Fluchtversuches vorzubeugen. Als Chemikerin wusste sie über die Zusammensetzung des Schlafmittels Bescheid, dennoch wurde ihr dieser Fakt später als schuldhafte Gefährdung der Gesundheit ihres Kindes unterstellt, was sie vehement zurückwies. An der innerdeutschen Grenze wird der Fluchtversuch entdeckt und Frau F schließlich zu einer Haftstrafe von 4 ½ Jahren verurteilt. Gleichzeitig wird ein Verfahren zum Entzug des Erziehungsrechtes angeschoben. In der Begründung dazu ist zu lesen: „Der Versuch des illegalen Verbringens des Kindes an sich sei schon ausreichend, eine schuldhafte Erziehungspflichtverletzung festzustellen“ (BStU MfS ZKG 7759, 26). Der Leiter des Referates Jugendhilfe beantragt, Frau F das Erziehungsrecht zu entziehen. „Die Klage ist auf § 51 Abs. 1 Familiengesetzbuch gestützt. Danach kann bei schwerer schuldhafter Verletzung der elterlichen Pflichten […] als äußerste Maßnahme das Erziehungsrecht entzogen werden, wenn die Entwicklung des Kindes gefährdet ist“ (BStU MfS ZKG 7759, 28). Als zusätzliche Begründungen wurden neben dem „ungesetzlichen Grenzübertritt“ die Verabreichung des Schlafmittels sowie das einkalkulierte Risiko, bei Misslingen des Fluchtversuches eine Gefängnisstrafe zu bekommen, angeführt. In der Urteilsbegründung heißt es dazu: „Wenngleich gemäß § 51 FGB und Richtlinie Nr. 25 des Obersten Gerichts davon sprechen, dass oft Maßnahmen der Organe der Jugendhilfe nach § 50 FGB einer solchen Sanktion vorangegangen sind und diese zu keiner Veränderung im Verhalten des Elternteils zu ihren Erziehungs- und Betreuungspflichten geführt haben, so schließt dies doch andererseits nicht aus, ‚dass bei besonders schwerwiegenden Versäumnissen, die auch in einer einmaligen Handlung gesehen werden können, ohne vorherige Maßnahme nach § 50 FGB der Entzug ausgesprochen werden kann‘. Der von der Verklagten mehrfach versuchte schwere ungesetzliche Grenzübertritt ist somit als schwerwiegende Pflichtverletzung im obengenannten Sinne zu würdigen. Die Verklagte selbst gibt zu, dass sie mit Zwischenfällen an der Staatsgrenze und mit einer Freiheitsstrafe von ein bis zwei Jahren rechnen musste. Sie hatte auch dabei die Vorstellung, dass das Kind mit ihr gemeinsam diese Freiheitsstrafe verbüßen würde. Ihre Risikobereitschaft zur Entwicklungsgefährdung des Jungen ist also zu bejahen, und tatsächlich hat die Verhaltensweise der Mutter zu einer Gefährdungssituation für das Kind geführt. […] Die Voraussetzungen für den Entzug des elterlichen Erziehungsrechtes entsprechend § 51 Absatz 1 FGB waren somit als erfüllt zu betrachten. Mit dieser Maßnahme wird zum Ausdruck gebracht, dass die sozialistische Gesellschaft das Vertrauen zum Erziehungsberechtigten, er werde für seine eigenen Kinder verantwortungsbewusst sorgen, verloren hat“ (BStU MfS ZKG 7759, 29.31).
Frau F wurde in Untersuchungshaft und während des Gefängnisaufenthaltes kein Kontakt zu ihrem Kind gewährt. Es wurde eine systematische Entfremdung zwischen Mutter und Kind forciert. Sie wehrte sich jedoch mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die drohende dauerhafte Trennung. In einem Schreiben an das Referat Jugendhilfe im Januar 1975 brachte sie zum Ausdruck: „Ich bin niemals damit einverstanden, dass mir auf Grund dieser einmaligen Handlungsweise für immer mein Kind genommen werden soll. Ich möchte weiterhin als Mutter meines Kindes auch das Erziehungsrecht für dieses besitzen. Ich bitte herzlich, von Ihrem Vorhaben Abstand zu nehmen. Sie würden mir damit viel Leid ersparen“ (zitiert in Warnecke 2009, 265). Trotz Frau F‘s monatelangen intensiven Widerstandes, auch vom Gefängnis aus, verliert sie das Erziehungsrecht ein Jahr nach ihrer Verhaftung. Als sie Berufung gegen das Urteil einlegt, wird auch diese zurückgewiesen. Die Aufnahme ihres Kindes bei einer von ihr benannten Person wurde ebenfalls abgelehnt. Das Kind sollte in eine fremde Familie zur Adoption gegeben werden. „Das zuständige Referat Jugendhilfe richtete bereits im Juli 1975 – und damit noch vor Abschluss des Berufungsverfahrens über den Erziehungsrechtsentzug – an die Arbeitgeber der als potentielle Adoptiveltern ausersehenen kinderlosen Eheleute ein jeweils gleichlautendes Schreiben mit der Bitte um eine […] umfassende Beurteilung über die politische und moralische Grundhaltung.‘“ (Warnecke 2009, 271) Der potentielle Adoptivvater ist Zirkelleiter im Parteilehrjahr der SED, Mitglied der Kampfgruppe und auch sonst scheinen in dieser Hinsicht die notwendigen Voraussetzungen erfüllt zu sein. Die Adoption wird schließlich gegen den Willen der Mutter, Frau F, im Jahr 1976 vollzogen. Ein letzter Hinweis findet sich in einem Informationsschreiben des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR (MfS) vom 01. Juli 1977: „Nachdem die F für eine Übersiedlung nach der BRD vorgesehen war und sich bereits in Karl-Marx-Stadt befand [Von dort aus wurden Auslieferungen und Freikäufe durchgeführt. d.V.], wurde diese am gleichen Tag aus unbekannten Gründen in die Strafvollzugseinrichtung zurückgebracht“ (BStU MfS ZKG 7759, 49). Im Februar 1978 berichtete „DIE WELT“13 von dieser Zwangsadoption. Erst 1988 wird Frau F nach einer zweiten Haftstrafe in die Bundesrepublik freigekauft. In dieser Zeit schreibt sie einem Journalisten: „Jetzt könnte ich leben, aber ich stehe gebrochen da“ (zitiert in: Noll 1991). 1989 kann sie nach 15 Jahren erstmals ihren Sohn wieder treffen (vgl. Griese 1991). Ihr Leben ist durch politisch motiviertes staatliches Handeln im Zusammenhang mit dem Zwangsadoptionsverfahren nachhaltig negativ beeinflusst worden.
In den Akten sind mehrere vergleichbare Fälle zu finden, die ebenfalls als überwiegend politisch motiviertes Handeln der Institutionen der Jugendhilfe (oder einzelner Akteure in diesen) im Zuge von Adoptionsvermittlung hinweisen. Dennoch muss wohl jeder Einzelfall nach politischen Motivationen (sei es, dass „staatstreue“ potenzielle Adoptiveltern ein Kind bekommen sollten, oder dass durch den Kindesentzug eine als staatsfeindlich gesinnt eingestufte Mutter/Familie getroffen werden sollte) untersucht werden. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß, sondern viele Graustufen zwischen jugendfürsorgerlich angemessenem Handeln und politisch motivierten Kindeswegnahmen sind erkennbar. Ja, es gab politisch motivierte Zwangsadoptionen in der DDR und jeder einzelne Fall ist moralisch, juristisch und politisch als himmelschreiendes Unrecht einzustufen. Im weiteren Sinne, besonders in Verbindung § 249 StGB der DDR („Asoziales Verhalten“)14 sind deutlich mehr Fälle anzunehmen, als die von der Clearing-Stelle bestätigten. Dennoch kann nicht davon ausgegangen werden, dass dies auf einen übergroßen Anteil der in der DDR abgeschlossenen Adoptionen zutrifft. „Die Fallanalyse hat ergeben, dass kein durchgängiges bzw. überwiegend praktiziertes formell- und materiellrechtliches Verfahrensmuster von Behörden und Gerichten erkennbar ist. Daraus und aus dem Nichtvorhandensein einer allgemeinverbindlichen Weisung des Ministeriums für Volksbildung ist zu schließen, dass die Durchführung von Zwangsadoptionen kein üblicherweise, über vierzig Jahre lang angewandtes Instrumentarium war, um nonkonformistisch denkende Bürger der DDR zu sanktionieren“ (Warnecke 2009, 341). Die bekannten Fälle von Zwangsadoptionen fanden in den späten 70er Jahren statt. Möglicherweise hat die Berichterstattung in bundesdeutschen Nachrichtenmagazinen ihren Teil dazu beigetragen, dass politisch motivierte Zwangsadoptionen nicht in größeren Zahlen auftraten. Nach momentanem Erkenntnisstand ist eine Teilmenge im unteren einstelligen Prozentbereich aller DDR-Adoptionen anzunehmen. Der übergroße Anteil der vollzogenen Adoptionen in der DDR geschah jedoch unter der Prämisse, für – aus welchen Gründen auch immer – elternlos gewordene Kinder geeignete Eltern zu finden. Dabei wurde die konkrete Definition der Eignung durch die vorherrschenden kulturellen und gesellschaftlichen Gegebenheiten bestimmt.
1.1.4 Zwischenresümee
Adoption ist heute in Deutschland eine anerkannte Form der Familiengründung. Sie ist in der Regel Minderjährigenadoption. Die Entwicklung geht vom strikten Inkognito hin zu einer immer weiteren Öffnung. Die Interessen des Kindes stehen im Mittelpunkt, nicht das Interesse einer kinderlosen Familie, den eigenen Stammbaum weiterzuführen. Rechtlich gibt es keine Unterschiede zwischen leiblichen und adoptierten Kindern mehr. Ursprünglich waren die Intentionen für eine Adoption andere: Es ging darum, die eigene Familie nicht aussterben zu lassen bzw. einen Nachfolger und Erben zu finden. Diese Idee hatte ihre Ursprünge bereits im Altertum und im Römischen Reich. Sie wirkte bis in die Entstehung und Formulierung des BGB im Jahr 1900 hinein. Bei der Forschung müssen die verschiedenen gesetzlichen Rahmenbedingungen bei Vollzug der Adoption mit bedacht werden. Adoption im heutigen Sinne ist prinzipiell rechtlich erst mit der großen Reform des Adoptionsrechtes 1977 geregelt und strukturiert. Allerdings nahm diese Regelung die damals herrschende Praxis und Meinung auf, so dass der Paradigmenwechsel sich fließend vollzog.
In der DDR wurde nach dem Krieg ein Adoptionsrecht eingeführt, das in manchen Punkten an die bundesdeutschen Rechtsnormen nach 1977 erinnert, jedoch stets staatliche Interessen mit berücksichtigte. Auch wenn es unbestreitbar Fälle von politisch motivierten Zwangsadoptionen in der DDR gab und viele Adoptionsentscheidungen, die in Zusammenhang mit § 249 des DDR Strafgesetzbuches gefällt wurden aus heutiger Sicht zu hinterfragen sind, war die Adoptionspraxis grundsätzlich auf das Wohl des Kindes ausgerichtet.
Die in der vorliegenden Arbeit interessierenden Fragen nach der biografischen Aneignung von Adoptionsgeschichten werden durch die jeweiligen rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Adoption zwar beeinflusst, die grundsätzliche Ausrichtung der Suchbewegung und die Fragen nach der Vergangenheit und der Identität jedoch nur peripher dadurch berührt. Zentraler sind die Fragen nach familiärer Entwicklung sowie die gesellschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Herkunftssuche. So soll die kurze Betrachtung der geschichtlichen Entwicklung des Adoptionswesens an dieser Stelle ausreichen und der Blick auf die verschiedenen Formen der Adoption gerichtet werden.
1.2 Adoptionsformen: inkognito, halboffen, offen
Als gesetzliche Vorgabe gilt in Deutschland die Form der Inkognitoadoption. Halboffene und offene Formen beruhen auf Absprachen und Vereinbarungen zwischen abgebenden und annehmenden Eltern und sind stets nur im beiderseitigen Einverständnis möglich. So können, jeweils in dem Maße, wie das beide Seiten wünschen, Informationen weitergegeben werden oder Begegnungen stattfinden. Schnittpunkt ist, zumindest bei Inkognito- bzw. halboffener Adoption, die zuständige Adoptionsvermittlungsstelle.
Inkognitoadoption
Die Inkognitoadoption ist der Rahmen, den das Gesetz vorgibt, um die Adoptivfamilie vor ungewolltem Kontakt einer anderen Seite zu schützen. Inkognito heißt, wörtlich übersetzt: Verheimlichung. Damit ist auch schon das Problemfeld, um das es hier geht, mit einem einzigen Wort umrissen. „Da bei Inkognito-Adoptionen die leiblichen Eltern keine Rolle mehr spielen, nachdem sie ihr Kind zur Adoption freigegeben haben, werden oft nur wenig Informationen über sie in den Akten festgehalten oder an die Adoptiveltern weitergegeben“ (Textor 1990a, 10).
Ursprünglich war das Wohl des Kindes bei der Durchsetzung des strikten Inkognitos handlungsleitend. So z.B. in England in der viktorianischen Zeit, als viele uneheliche Kinder in Heimen untergebracht wurden. „Der Makel der Unehelichkeit war aber so stark, dass man keine achtbaren Familien fand, die bereit waren, ein solches Kind aufzunehmen und wie ein eigenes zu behandeln. Um ihnen im Leben eine faire Chance zu geben, musste man diesen Kindern einen neuen Namen, eine neue Identität geben. Es musste für jedermann ganz unmöglich sein, das Geringste herauszubekommen über die Herkunft des Kindes vor der Adoption. Es war ein kühner, ideenreicher Gedanke, und es hat tatsächlich viele Kinder von dem Odium der Schande befreit“ (Toynbee 1989, 23f). Diese Argumentation ist jedoch in der heutigen Zeit nicht mehr stichhaltig, da Unehelichkeit in der westeuropäischeren Gesellschaft kein Makel mehr ist.
„Inkognito-Adoption bedeutet nur, dass die Abgebenden den Namen der Annehmenden nicht kennen – aber nicht umgekehrt“ (Oberloskamp, 22) In der Praxis sieht es aber so aus, dass in der Regel keine Seite die andere kennt und die Adoptiveltern theoretisch ihrem Kind nicht sagen müssen, dass es adoptiert ist. Dies ist allerdings eigentlich nur theoretisch möglich, da auf der Abstammungsurkunde des Kindes die biologischen Eltern eingetragen sind (soweit bekannt). Auf der Geburtsurkunde dagegen stehen die Adoptiveltern als Eltern. Mit Wegfall der Abstammungsurkunde im Jahr 2009 ist dieser Weg allerdings schwieriger zu beschreiten. Immer noch können Adoptierte beim Einwohnermeldeamt einen vollständigen Auszug ihres Geburtsregistereintrages erhalten. Jedoch ist dafür notwendig, um den Status als Adoptierter zu wissen – sonst fehlt ja der Anlass für eine Nachfrage. Im Fall von Babyklappen oder anonymer Geburt ist das Inkognito absolut. Ein Nachvollziehen der Abstammung ist nicht möglich, was für die Betroffenen zu großen psychischen Problemen führen kann.15
In den deutschen Adoptionsvermittlungsstellen wird den Eltern heute in der Regel geraten, frühzeitig mit ihrem Kind offen über den Fakt der Adoption zu sprechen. Die Erfahrung zeigt, dass häufig „sich die Kinder in jüngeren Jahren relativ uninteressiert zeigen“, (Huber-Nienhaus 2003, 143). Jedoch können sie so von Anfang die Adoption in ihre Ich-Identität integrieren und ein gesundes Selbstbewusstsein bezüglich ihres Status als Adoptivkind entwickeln.
Halboffene Adoption
Bei einer halboffenen Adoption gibt es die Möglichkeiten, dass die abgebenden und annehmenden Eltern miteinander direkten Kontakt haben oder auch nicht. Bei der Form mit Kontakt lernen die Eltern sich wenigsten einmal direkt kennen und es gibt für die abgebenden Eltern regelmäßig Informationen über die Entwicklung des Kindes (normalerweise 1-2 Mal jährlich). Es werden aber keine Namen oder Adressen/Telefonnummern ausgetauscht. Bei einer halboffenen Adoption ohne Kontakt werden die Informationen über das Amt weitergegeben, ohne dass die Eltern sich persönlich kennen lernen. Die abgebende Mutter hat bei der halboffenen Form eine Wahlmöglichkeit bezüglich der Annehmenden im Hinblick auf Familienform (Ehepaar, Alleinerziehend, Geschwister) und Umfeld, in dem das Kind aufwachsen soll. Wenn es irgend möglich ist, sollen ihre Wünsche bei der Vermittlung berücksichtigt werden. Aktuelle Beobachtungen der Arbeit von Adoptionsvermittlungsstellen zeigen, dass inzwischen dieses Wahlrecht der abgebenden Mutter auch bei Inkognitoadoptionen angewandt wird.
Festgehalten werden muss, dass es weder auf die halboffene noch auf die offene Adoption einen Rechtsanspruch gibt. Sie sind immer nur im beiderseitigen Einverständnis auf der Basis von privatem gegenseitigem Vertrauensbonus möglich.
Offene Adoption
Hier gibt es, wie der Name schon sagt, noch erheblich mehr Offenheit miteinander. Die Eltern kennen sich meist schon im Vorfeld, teilweise auch mit Namen und Adresse. Dies kann sogar so weit gehen, dass die Adoptiveltern bei der Geburt des Kindes dabei sind. Auch hier haben beide Seiten Entscheidungsmöglichkeiten, wie weit sie gehen wollen und wo sie Grenzen ziehen wollen. Die Offenheit geschieht ausschließlich aufgrund persönlicher Entscheidungen mit- und füreinander und wird oft von der Adoptionsvermittlungsstelle fachlich begleitet, soweit das von den Beteiligten gewünscht wird. Aber generell gilt: „Herkunfts- und Adoptiveltern vereinbaren selbst, wie sie ihre Kontakte gestalten und pflegen“ (Bott 2005, 2).