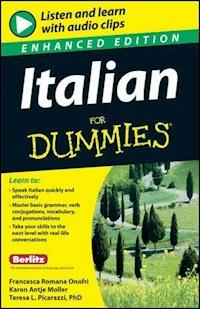Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: StudienVerlag
- Kategorie: Bildung
- Serie: Erfahrungsorientierte Bildungsforschung
- Sprache: Deutsch
Diese Studie über Zuschreibungserfahrungen offenbart, wie Schülerinnen und Schülern aus unterschiedlichen Gründen Eigenschaften zugeschrieben werden. Sie zeigt nicht nur den schulischen Umgang mit ihnen, sondern auch die Art der Aufmerksamkeit, die sie dadurch in der Schule bekommen. Als Diskriminierungserfahrungen äußern sich Zuschreibungen mündlich, gestisch oder mimisch bzw. artikulieren ihre Wirkmacht im (pädagogischen) Handeln. Am Beispiel von Vignetten, narrativ verdichteten Erzählungen eines prägnanten Erfahrungsmomentes aus dem Schulkontext, werden in diesem Buch schulische Erscheinungsformen von Zuschreibungserfahrungen illustriert und in ihrer Wirkmächtigkeit als Herausforderung für das Lehren in Schule und Universität bestimmt. In der multiperspektivischen Untersuchung der Wirkmacht schulischer Zuschreibungserfahrungen will dieses Buch eine andere, zuschreibungssensitive Aufmerksamkeit schulen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 624
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erfahrungsorientierte BildungsforschungBand 4
Im Bildungsbereich werden täglich vielfältige Aktivitäten initiiert, Prozesse in Gang gesetzt und Aufgaben bearbeitet. Wenig ist darüber bekannt, wie sie vollzogen werden. Die Reihe erschließt einen in den Bildungswissenschaften vernachlässigten Bereich, indem sie den Erfahrungen nachspürt, die sich in Bildung und Erziehung zeigen. Die einzelnen Bände machen die Erfahrungsmomente pädagogischen Handelns versteh- und erfahrbar. Über dichte Beschreibungen (z. B. Vignetten, Anekdoten) werden Erfahrungsdimensionen erschlossen, welche zum Überdenken der eigenen pädagogischen Erfahrungen beitragen können.
Herausgegeben von Evi Agostini, Markus Ammann, Siegfried Baur, Michael Schratz und Johanna F. Schwarz
Johanna F. Schwarz
Zuschreibung als wirkmächtigesPhänomen in der Schule
© 2018 by Studienverlag Ges.m.b.H., Erlerstraße 10, A-6020 Innsbruck
E-Mail: [email protected]
Internet: www.studienverlag.at
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-7065-5966-9
Buchgestaltung nach Entwürfen von himmel. Studio für Design und Kommunikation, Inns-bruck/Scheffau – www.himmel.co.at
Satz: Konrad Schartner
Umschlag: himmel. Studio für Design und Kommunikation, Innsbruck/Scheffau - www.himmel.co.at
Umschlagabbildungen: rechts und links: Autorin, Mitte: pixabay
Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.studienverlag.at
Inhalt
Vorwort
Einleitende Bemerkungen
Der Forschungskontext und die Findung der Frage
Zuschreibung – ein schillerndes Phänomen
Zuschreibung als Differenzierungsprozess
Zuschreibung als Ungleichheit und Ungerechtigkeit
Zuschreibung als Adressierungs-, Anerkennungs- und Aufmerksamkeitsgeschehen
Zuschreibung als Einschätzung, Diagnose, Wertung und Beurteilung
Zuschreibung als Sich-ein-Bild-Machen
Zuschreibung als Unterlassung
Zuschreibung als Unterstellung, Labeling und Etikettierung
Zuschreibung als Diffamierung, Diskreditierung und Stigmatisierung
Sozialwissenschaftliche Perspektiven auf das Phänomen der Zuschreibung
Erziehungswissenschaftliche Perspektiven auf Zuschreibung
Literarische Perspektiven auf Zuschreibung
Zuschreibung als Erfahrung
Zeitliche, räumliche, relationale und leibliche Dimensionen
Phänomenologische Perspektiven auf Zuschreibung
Zuschreibungserfahrungen konkret: Vignette 61
Zwischenstand
Flüchtig wie der Wind. Von der Schwierigkeit, Zuschreibungserfahrungen empirisch zu erfassen: phänomenologische Orientierung und Methodologie der Innsbrucker Vignettenforschung
Phänomenologische Orientierung des Forschungszugangs
Phänomenologie und Pädagogik
Phänomenologie und Vignettenforschung
Die Innsbrucker Vignettenforschung
Vignetten als Klangkörper des Lernens
Zwischenstand
Die Wirkmacht von Zuschreibungen in der pädagogischen Interaktion: leibliche Gesten und Gebärden und sie begleitende Gefühlsdispositionen
Vorbemerkungen
(Feindselige) Gefühle: Eine theoretische Annäherung
Leibliche Gesten und Gebärden: Eine theoretische Annäherung
Gesten oder Praktiken? Eine phänomenologisch-praxeologische Verhältnisbestimmung
Grüßen und Beginnen als Gesten schulischer Praxis
(Auf-)Zeigen als Geste schulischer Praxis
Reden und Schweigen als Gesten schulischer Praxis
(Zu-)Hören und (Ge-)Horchen als Gesten schulischer Praxis
(Über-)Prüfen und (Ab-)Fragen als Gesten schulischer Praxis
(Be-)Enden und (Ab-)Schließen als Gesten schulischer Praxis
Zwischenstand
Zuschreibungen als Herausforderungen für das Bildungssystem
Die Wirkmacht schulischer Zuschreibungserfahrungen bei Differenzierungsprozessen
Die Wirkmacht der Unterlassung bei schulischen Zuschreibungserfahrungen
Status und Zeit als wirkmächtige Faktoren bei schulischen Zuschreibungserfahrungen
Herausforderungen für die Schule
Herausforderungen für die LehrerInnenbildung
Danksagung
Literatur
Webseiten und Internetquellen
Legende (Abkürzungen)
Wenn es auf etwas eine einfache Antwort gibt,dann war die Frage falsch gestellt.Harold Pinter
Ich komme langsam, dir ein Werk zu bringen,Und zaudre noch, es dir zu überreichen.Ich weiß zu wohl, noch bleibt es unvollendet,Wenn es auch gleich geendigt scheinen möchte.Allein, war ich besorgt, es unvollkommenDir hinzugebenUnd wie der Mensch nur sagen kann: Hier bin ich!Daß Freunde seiner schonend sich erfreuen:So kann ich auch nur sagen: Nimm es hin!J. W. v. Goethe, Torquato Tasso
Vorwort
“The best interest of the child”
(Art. 3, 1 der UN-Kinderrechtskonvention, 20. November 1989) Lernen zwischen Zu-Schreibung und An-Erkennung
Etymologisch ist das Wort „lernen“ mit „lehren“ und „List“ verwandt und gehört zur Wortgruppe von „leisten“, das ursprünglich „einer Spur nachgehen, nachspüren“ bedeutet. Das Wort „Lernen“ geht auf die gotische Bezeichnung für „ich weiß“ (lais) und das indogermanische Wort für „gehen“ (lis) zurück (Wasserzieher, 1974, 273). Im Gotischen heißt „lais“ genau übersetzt „ich habe nachgespürt“ und „laists“ steht für „Spur“. Die Herkunft des Wortes deutet darauf hin, dass Lernen ein Prozess ist, bei dem man einen Weg zurücklegt und dabei zu Wissen gelangt.“ (Mielke, 2001, S. 11)
Lernen bedeutet demnach sowohl Spuren aufnehmen, als auch neue Spuren legen. Dieses Fortschreiten, Zurückschreiten, Weiterschreiten ist lernseitig wie lehrseitig ein delikater Prozess, der sehr störanfällig ist. Zuschreibungen, Labelings, vor allem wenn sie negativer Art sind, können diese Lernspuren bei Schülerinnen und Schülern rasch verschütten und zu Entmutigung, Misserfolgen und einem Exklusionsempfinden führen. Dies ist das zentrale Thema dieses Buches von Johanna F. Schwarz.
Zuschreibungen sind immer Eingrenzungen, Begrenzungen oder Ausgrenzungen. Sie klassifizieren, ordnen ein und ordnen zu. Sie inkludieren einige und exkludieren andere: Schüler/innen, Mitarbeiter/innen, Kolleginnen/Kollegen usw. Sie ermutigen oder entmutigen, meist nicht absichtlich, sehr wohl aber unterbewusst oder unbewusst.
Diese psychischen Prozesse sind seit langem bekannt und werden Pygmalioneffekte, Rosenthal-Effekte oder einfach Erwartungseffekte genannt. Der Pygmalioneffekt geht auf den Künstler Pygmalion von Zypern zurück, der eine elfenbeinfarbene weibliche Figur schafft, in die er sich immer stärker verliebt. Die Göttin Venus erhört schließlich sein Flehen und die Statue verwandelt sich in einen lebendigen Körper. Der Erwartungseffekt bringt Früchte, in diesem Falle positive. Aus der Verbindung geht ein Kind mit dem Namen Paphos hervor, nach dem die spätere Stadt in Zypern benannt wird, unweit des Felsens im Meer, bei dem Aphrodite aus dem Meer stieg. (Ovid, Publius Naso Ovidius (2–8 n. Chr.) 1986, Vers 243).
Beim Pygmalion von Ovid erscheint die Zuschreibung als positive Erwartung im Sinne eines Self-Fulfilling Prophecy-Prozesses, der aber ebenso als negative Zuschreibung oder Vorhersage eintreten kann. Die Sozialpsychologen Robert Rosenthal und Leonore Jacobson haben bereits 1966 diesen Prozess nachgewiesen. Im Rahmen eines Experimentes, bei dem eine Gruppe von Grundschulkindern zufällig ausgewählt worden war, teilten sie den Lehrpersonen mit, dass sich diese Kinder im Laufe des Schuljahres hervorragend entwickeln würden. Ein Jahr später schnitten diese zufällig ausgewählten Kinder bei einem Intelligenztest tatsächlich besser ab als zu Beginn des Experimentes (vgl. Rosenthal und Jacobson 1968). Zuschreibungen mit negativen Folgen treten auch häufig bei benachteiligten oder stigmatisierten Gruppen auf, wie z. B. bei Migranten und Migrantinnen, ethnischen Minderheiten oder sozial schwächeren Gruppen. Hier wirken sich die angenommenen oder zugeschriebenen negativen Leistungsentwicklungen tatsächlich negativ aus und fügen Kindern und Jugendlichen enorme Entwicklungsschäden zu, die sich in ihren Leib einschreiben und sich vor allem auf das Selbstbild auswirken, auf Handlungsmotivationen und die Fähigkeit, Initiativen zu ergreifen.
Zuschreibungen und positive wie negative Erwartungshaltungen sind keine Ausnahmephänomene. Sie kommen häufig vor und scheinen de facto oft unvermeidbar zu sein, es sei denn, dass es an der Schule, in der Institution, im Betrieb supervisionierte Strukturen der gemeinsamen Reflexion gibt. Es ist besorgniserregend, aber den Tatsachen entsprechend, wenn Johanna F. Schwarz im ersten Teil dieser Arbeit schreibt: „Der Doppelcharakter von Zuschreibungen als etwas Alltäglichem und Unvermeidlichem sowie als etwas, das kritischer Reflexion bedarf, um nicht in eine beengende oder versteinernde (vgl. Meyer-Drawe 2010b, S. 806) Fehlform abzugleiten, ist Wesenselement der Ambivalenz dieses schillernden Phänomens. Die pädagogisch herausfordernde Frage lautet, wie verhindern wir, dass die unvermeidlich entstehenden Bilder, die wir uns von Schülerinnen und Schülern machen, im Sinne von Max Frisch1 zu erstarrten Menschenbildern werden, die Andere zu unseren Erzeugnissen oder gar Opfern degradieren. Dieses ambivalente Spannungsverhältnis, das manche Lehrperson als Dilemma erfahren mag, ist nicht aufzulösen, sondern pädagogisch möglichst taktvoll und respektvoll zu beantworten. Dies darf nach Mecheril (vgl. 2010a) allerdings keine Forderung sein, die sich an die individuelle Lehrperson allein richtet, sondern muss zur institutionellen (Reflexions-)Aufgabe werden.“ (vgl. in der vorliegenden Arbeit) Zuschreibungen sind die Folge der Einnahme eines bestimmten Standortes, den eben nur ich einnehme. Merleau-Ponty (1973) verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass es notwendig sei „innerhalb meiner Erkenntnis (zu) unterscheiden zwischen der Zone der individuellen Perspektiven und der der intersubjektiven Bedeutungen.“ (Ebd., S. 249)
Aber was führt dazu, sich ein nicht hinterfragtes Bild über einen Schüler/eine Schülerin zu machen? Was führt, im Falle von Zuschreibungen, zur unreflektierten Einnahme eines bestimmten Standortes einem Schüler/einer Schülerin gegenüber, zur Entscheidung, eine Haltung einzunehmen, die eine positive oder negative Entwicklung prognostiziert? Dies kann nichts mit Wahrnehmung zu tun haben, wie Merleau-Ponty (1966) betont. „Wahrnehmen ist nicht das Erleben einer Mannigfaltigkeit von Impressionen, die zu ihrer Ergänzung geeignete Erinnerungen nach sich ziehen, sondern die Erfahrung des Entspringens eines immanenten Sinnes aus einer Konstellation von Gegebenheiten, ohne den überhaupt ein Verweis auf Erinnerungen nicht möglich wäre. Sich erinnern heißt nicht, das Bild einer an sich vorhandenen Vergangenheit aufs Neue in den Blick des Bewusstseins bringen, sondern sich in den Horizont der Vergangenheit versenken und Schritt für Schritt die in ihm sich verknüpfenden Perspektiven entfalten, bis die Erfahrungen, die sie enthält, gleichsam neuerlich an ihrem zeitlichen Ort erlebt sind. Wahrnehmung ist nicht Erinnerung.“ (Ebd., S. 42) Daher muss Labeling etwas mit Empfindungen zu tun haben, die weder Wahrnehmungen noch Erfahrungen sind. Die „einzige mit dem Empfindungsbegriff vereinbare Philosophie ist der Nominalismus, d. h. die Reduktion alles Sinnes auf den Widersinn verworrener Ähnlichkeiten oder den Un-sinn der Assoziation von Kontiguitäten.“ (Ebd., S. 34f.) Diese assoziierten Kontiguitäten, diese zufällig mit Erwartungshaltungen zusammengefallenen Empfindungen sind es, die bewirken, dass es zu einem Trugschluss kommt, der Erkenntnis vortäuscht, wo Erkenntnis nicht ist. „Alle Erkenntnis erscheint so als eine Art systematischer Substitution, ein System von Substitutionen, worin Impressionen auf Impressionen verweisen, ohne daß je die Verweisung selbst sich begründet zeigte, und worin bestimmte Worte die Erwartung bestimmter Empfindungen wecken, so wie der Abend die Erwartung der Nacht.“ (Ebd., S. 34) Man könnte auch zu Recht pointiert den Text der Acquatinta-Radierung von Francisco de Goya (um 1797–1799) in Erinnerung rufen: „El sueno de la razón produce monstruos“.
Es darf daher nicht verwundern, wenn John Locke schon 1689 in seinen Briefen über Toleranz schreibt: „Wenn aber eine von diesen Kirchengemeinden das Recht und die Macht hat, gegen die andere zu wüten, so frage ich: welche von beiden und mit was für einem Recht? Man wird ohne Zweifel antworten, dass solches der orthodoxen gegen die ketzerische zukomme. Allein das heißt mit großen und scheinbaren Worten nichts sagen. Eine jede Kirche ist sich selbst orthodox, anderen irrgläubig oder ketzerisch, denn sie glaubt, was sie für wahr hält, und was nicht damit übereinkommt, verwirft sie als Irrtum.“ (Locke 1689, 45f.)
Das ist, nun wieder etwas eingeengt, die vor allem schulische, aber durchaus auch lebensweltliche Spannweite der Forschungsarbeit von Johanna F. Schwarz. Es geht dabei um „Bilder“ in den Köpfen der Lehrerinnen und Lehrer, und zwar „Bilder“, die schon da sind, aber auch „Bilder“, die sich zuerst verborgen halten und sich nun zeigen, um sich sofort wieder zu verbergen, da sonst ihr Konstruktionscharakter deutlich werden könnte. „Bilder sind (wirk-)mächtig, nicht weil sie als ,Machthaber‘ (Meyer-Drawe 2010b, S. 808), sondern als ,Sinngeber‘ (ebd.) fungieren. Bilder ,verleihen Sinn in bestimmten Kontexten, in denen sich Macht geltend macht‘ (ebd.) und dieses Machtverhältnis entsteht zwischen den Bildern und denen, die sie anblicken. Bilder haben, so Meyer-Drawe, ihre eigenen imaginären Überschüsse nicht im Griff (ebd.) und nehmen Gestalt an dadurch, dass sie ,jemandem etwas zeigen oder verbergen‘ (ebd.).“ (vgl. in der vorliegenden Arbeit)
Ein großer Fehler ist es und eine große Gefahr besteht darin, statt Individuen in Schulklassen Schüler/innentypen zu sehen, gleichsam wie Bilder oder noch präziser „Wesenheiten“ (vgl. Merleau-Ponty 1973). „Es kann sein, daß ich eine Wesenheit anzuschauen glaube, wenn ich in Wahrheit ein Etwas anschaue, das gar keine Wesenheit, sondern ein bloß in der Sprache wurzelnder Begriff, ein Vorurteil, eine Kenntnis ist, deren Kohärenz mit der Gebräuchlichkeit zusammenhängt. Das beste Mittel gegen diese Gefahr besteht in der folgenden Annahme: Wenn die Tatsachenerkenntnis zur Erfassung eines Wesens unzureichend ist, mit anderen Worten, wenn ich darüber hinaus jeweils ,idealisierende Fiktionen‘ konstruieren muß, dann bin ich des Vorzugs meiner Wesensschau gegenüber einem Vorurteil, einem in der Sprache wurzelnden Begriff erst dann gewiss, wenn die Wesensschau die Vorstellung aller in einem gegebenen Zeitpunkt vorhandenen Tatsachen ermöglicht. In diesem Falle gelten die Tatsachen als Prüfstein der Wesenheit. In den Tatsachen findet man keinerlei Wesen, doch soll das Wesen die uns bekannten Tatsachen (in einer Konfrontation von Wesen und Tatsache) erhellen. Ohne diese Konfrontation ist das Wesen unter Umständen kein Wesen, sondern ein Vorurteil.“ (Ebd., S. 167)
Diese gefährliche „Wesensschau“, bzw. hier das „Bild des Anderen“, offenbart sich im Text von Terkessidis (2015) in der scheinbar „unschuldigen“ Frage des Bürgermeisters, der dem kleinen Mehmet, der den Wettbewerb „Sicher durch den Straßenverkehr“ gewonnen hatte, bei der Prämierung die übliche Frage der Herkunft stellte. Die Frage sollte sich allerdings als „Geandertwerden“ (Kaletsch und Rech 2015, S. 85) offenbaren, da sie das Bild, das der kleine Junge bisher von sich hatte, verdeckte und verbarg. Mehmet wurde in Deutschland geboren und hatte bisher immer geglaubt, dass er kein Ausländer sei. Als Gewinner des Wettbewerbes wurde er zu einer öffentlichen Prämierung „beim Bürgermeister geladen und war dort das einzige Kind mit Migrationshintergrund. Als der Bürgermeister fragte, woher er denn komme, nannte er den Namen des Dorfes in der Nähe von Bielefeld, in dem er mit seinen Eltern wohnte, worauf der gesamte Saal in Lachen ausbrach. Die Anwesenden hatten erwartet, der Junge würde sich als ,Ausländer‘ identifizieren und sagen: ,Ich komme aus der Türkei.‘ Für Mehmet barg dieses Erlebnis eine initiale Erkenntnis – die Erkenntnis nämlich, dass er anders ist, dass er von woanders herkommt und dass er nicht dazu gehört. Zuvor hatte Mehmet, der ja in Deutschland geboren wurde, fest geglaubt, er gehöre dazu – zu den anderen Kindern, zu seinem Dorf und letztlich auch zu Deutschland. Diese Selbstverständlichkeit war danach dahin. Seitdem ist er – kaum hatte jemand seine schwarzen Haare bemerkt oder seinen Namen gehört – immer wieder gefragt worden, wo er denn herkomme. Und immer wurde so lange gebohrt, bis seine ,Fremdheit‘ zum Vorschein kam. Es geht hier um Erlebnisse, die zunächst nicht groß und gravierend erscheinen, die aber mit erheblicher Penetranz wiederkehren, manchmal täglich, manchmal in längeren Abständen, und die gerade in ihrer Alltäglichkeit sehr deutlich einen Unterschied markieren und dauerhaft eine Grenze etablieren zwischen ,uns‘ und ,ihnen‘.“ (Terkessidis 2015, S. 80)
Meyer-Drawe weiß um die Bedeutung und das „Stigma“ (Goffman 2001) der Namensgebung. „Am Beispiel der Namensgebung wird für Meyer Drawe (2001) die ,Zerfallmöglichkeit interpersonaler Verbundenheit durch Depersonalisierung des Anderen deutlich‘ (ebd., S. 130f.).“ (Schwarz in Druck) Dies betrifft nicht nur „Spitznamen“, sondern auch „fremdländische“ Namen, die wie bei Mehmet eindeutig als nicht „einheimische“ Namen identifiziert werden, wahrscheinlich solange wie der Bürgermeister in Berlin nicht so ähnlich wie der Major von London, nämlich Sadiq (Sadiq Kahn) heißt. Eine Studie der Universität Oldenburg (vgl. Kaiser 2010) hat gezeigt, dass Grundschullehrer/innen Kinder bereits auf Grund ihrer Vornamen diskriminieren.
Zuschreibungen als positive Marker können fehlleiten, angenommene Stärken können sich in der späteren Entwicklung des Kindes, des Jugendlichen als falsch erweisen und zu Verirrungen führen. Sie sind jedoch weit weniger gefährlich als „Zuschreibungen als Diffamierungen, Diskreditierungen und Stigmatisierungen“ (Schwarz 2018, S. 39) und man sollte hinzufügen als „geanderte“ Verortung in der Gruppe der weniger Leistungsfähigen durch die „bildungsferne“ soziale Schicht oder den „Makel“ einer Migrationsgeschichte. Und das gravierende Problem dabei besteht darin, dass sich der Schüler/die Schülerin gerade in seiner/ihrer Leiblichkeit als minderwertig, hässlich, faul, weniger intelligent und weniger leistungsfähig erfährt (Meyer-Drawe 2001, S. 285). Dies meint Merleau-Ponty (1966), wenn er festhält: „Doch mein Leib steht nicht vor mir, sondern ich bin in meinem Leib, oder vielmehr ich bin mein Leib. (…) Wenn im Falle der Wahrnehmung des eigenen Leibes überhaupt von Interpretation noch gesprochen werden kann, so müssen wir sagen, er interpretiere sich selbst.“ (Ebd., S. 180)
Hinsichtlich der Zuschreibungen sollte nochmals mit Merleau-Ponty (2004) Folgendes beachtet werden: „Jede Wahrnehmung ist unbeständig und nur wahrscheinlich, wenn man so will, ist sie nur eine Meinung …“(ebd., S. 64). Es gilt aber auch: „Jede Wahrnehmung enthält die Möglichkeit, durch eine andere ersetzt zu werden, und damit auch die Möglichkeit einer Art von Widerruf der Dinge [...]“ (ebd., S. 64). Dies wird noch deutlicher in folgendem Zitat: „Merleau-Ponty folgt Husserl und den Gestaltpsychologen auch darin, dass uns diese Sinneserfahrungen nur selten in <roher>, unbearbeiteter Form erreichen. Phänomene sind immer schon durch Vorannahmen, Bedeutungen und Erwartungen geprägt, wenn wir sie wahrnehmen – sei es durch frühere Erfahrungen, sei es durch den Kontext, in dem sie uns begegnen“ (ebd., S. 261 f.).
Bilder, die wir uns von anderen machen, die wir konstruieren, entspringen zwar unserer Subjektivität, sie erscheinen uns als real, sie entbehren allerdings der „Objektivität“, die durch die Intersubjektivität erreicht werden kann. Daher ist es notwendig, dass Lehrende aufmerksam sind, dass sie in Kontakt mit anderen Lehrenden treten, die einen anderen subjektiven Blick auf Schüler/innen haben, damit diese subjektiven Wahrnehmungen stärker in den Fokus einer pädagogischen „Aufmerksamkeit“ treten und die Möglichkeit eines Widerrufes von Meinungen oder Vorurteilen entstehen kann. Denn: „Aufmerksam zu sein heißt achtsam zu sein, was eben nicht aufpassen meint. Wenn ich aufpasse, ahne ich zumindest, womit ich zu rechnen habe. Aufmerksam zu sein bedeutet, den Möglichkeitsspielraum offen zu halten, damit anderes auch in dem auffallen kann, was nicht von mir (dem Lehrenden, A. d. A.) eingeräumt wurde.“ (Meyer-Drawe 2013a, S. 55) Dieses „Einräumen“, dieser Begriff, den Meyer Drawe (ebd.) hier verwendet, verweist auf Zuschreibungen, da etwas einräumen ja bedeutet, hier dem Schüler/der Schülerin keine weiteren Entfaltungsmöglichkeiten zuzusprechen, ja zu geben, denn gerade die Enge des Raumes verhindert dies dem Wortsinn nach. „Einräumen“ oder „eingeräumt werden“ bedeutet außerdem zu einer Klassifikation, zu einem Schema zu gehören, verweist auf einen Raum, der nur vordergründig als inkludierend gesehen werden kann, in Wirklichkeit aber der Raum der Exklusion ist. Es mag hart klingen, was Greese (2011) schreibt, aber es entspricht dem, was Foucault grundsätzlich unter der Institution „Schule als Disziplinaranstalt“ (Kupfer 2011) meint: „Schule als Struktur ist der originär eigene Beitrag zur Gefährdung der ihr anvertrauten Schülerinnen und Schüler. So wie Schule heute aufgestellt ist, verstärkt sie die benachteiligenden sozialen Prägungen des Herkunftsmilieus. Das ist durch internationale Bildungsvergleichsstudien hinreichend belegt. Schule stärkt die Starken und schwächt die Schwachen. Unser vielgliedriges Schulsystem befördert Aussonderung und Abschiebetendenzen. Sitzenbleiben und verhaltens-determinierende Kopfnoten beeinträchtigen das Selbstwertgefühl der betroffenen Kinder und senken ihre Motivation, ihre Freude am Lernen. Mäßige Zeugnisse, Abschlüsse an niedrigrangigen Schulformen vernichten Zukunftschancen von Kindern. Behinderte Kinder an Förderschulen bleiben auch nach der Schule auf biografischen Sondergeleisen. Wer kein Geld für individuelle Ergänzungsförderung und Nachhilfe hat, wird abgehängt.“ (Ebd., S. 80 f.)
Es gibt aber auch ein anderes Paradigma, das an Raum gewinnt, das Paradigma der Schule als Ort des Lebens und Lernens. „Schule als Ort des Lebens und Lernens gilt als Metapher für einen Wandel in Stil, Ablauf und Organisation des Schulalltags. Schule determiniert einen langen Lebensabschnitt junger Menschen. Das begründet eine hohe Verantwortung für das Kindeswohl.“ (Ebd., S. 81) Dies ist auch der Kernpunkt der UN-Kinderrechtskonvention von 1989: „The best interest of the child“.
Siegfried Baur
1 Frisch, Max (1961): Andorra: Stück in zwölf Bildern. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Einleitende Bemerkungen
Es gibt viele Fragen im schulischen Kontext, die im Sinne Harold Pinters komplexe, differenzierte, ambivalente oder irritierende Antworten nach sich ziehen, schließlich ist pädagogisches Handeln per definitionem2 etwas Kontingentes, Komplexes, von Aporien, Spannungsfeldern und unauflösbaren Dilemmata durchzogen, die meist unumgehbar sind, mit denen aber umgegangen werden muss. Die Frage danach, wie und auf welche Weise Zuschreibungserfahrungen in der Schule ihre Wirkmacht entfalten, ist eine solch uneindeutige und komplexe Frage, der sich die vorliegende Arbeit verschrieben hat. Wie lässt sich die Wirkung von Zuschreibungserfahrungen in der Schule empirisch angemessen erfassen, wenn Erfahrungen von Anderen keine originären Erfahrungen sind (vgl. Husserl 1985) und sich dem unmittelbaren empirischen Zugriff entziehen? Der Umstand, dass Zuschreibungen nichts Schriftliches sind, das retrospektiv analysiert werden könnte, sondern sich meist mündlich, mimisch, gestisch, tonal, stimmlich oder im Handeln artikulieren, stellt eine zusätzliche Schwierigkeit in der empirischen Erfassung dar. Wie erfahren Schülerinnen und Schüler3 daher Schule, was widerfährt ihnen an diesem institutionellen Ort und wie antworten sie auf sich dort stellende Aufgaben (vgl. Girmes 2004). Das sind nicht nur die zentralen Fragen des Forschungsvorhabens, dessen Datensatz4 die vorliegende Arbeit nützt, sondern auch jene der Arbeit selbst.
Empirisch wird die Wirkmacht schulischer Zuschreibungserfahrungen mittels Vignetten der Innsbrucker Vignettenforschung (IVF) entfaltet. Bei Vignetten handelt es sich um erfahrungsträchtige, verdichtete Erzählungen aus dem Schulalltag, die als „Klangkörper des Lernens“ (Schratz et al. 2012, S. 31) fungieren. Im Kapitel Flüchtig wie der Wind. Von der Schwierigkeit,
Zuschreibungserfahrungen empirisch zu erfassen: phänomenologische Orientierung und Methodologie der Innsbrucker Vignettenforschung werden der forschungsmethodologische Zugang sowie die phänomenologisch und lernseits5 orientierten Grundlagen vorgestellt, auf die sich dieser Forschungszugang bezieht. Theoretisch wird das Thema aus einer Vielzahl von Perspektiven beleuchtet, die im Kapitel Zuschreibung – ein schillerndes Phänomen vorgestellt, im Kapitel Zuschreibungen als Herausforderungen für das Bildungssystem erneut aufgegriffen und auf die gewonnenen Einsichten der Vignettenlektüren bezogen werden. Die phänomenologisch- und lernseits orientierten Grundlagen der Innsbrucker Vignettenforschung sind zentral für die vorliegende Arbeit, gründen sie doch auf einer Art von Aufmerksamkeit, die der Flüchtigkeit von Zuschreibungserfahrungen gerecht zu werden versucht und Blickrichtungen und Blicktiefen erlaubt, die andere Zugänge eher versperren als eröffnen. Die phänomenologische Aufmerksamkeit, die von der grundsätzlichen Gerichtetheit unserer Aufmerksamkeit ausgeht, in der wir stets etwas als etwas sehen, wahrnehmen, erfahren, analysieren, erinnern oder sagen und tun, zeichnet sich durch das Folgende aus:
Weil es uns unmöglich ist, an einen festen Grund hinter den Erscheinungen zu gelangen, nehmen wir immer etwas als etwas wahr, das dieses nicht bloß an sich oder bloß für uns ist, sondern seinen Sinn in einer eigentümlichen Zwischensphäre gewinnt. Dieser Zwischensphäre gilt die besondere phänomenologische Aufmerksamkeit. (Meyer-Drawe 1993)
Auch im Hinblick auf schulische Zuschreibungserfahrungen gibt es eine solch eigentümliche Zwischensphäre. Wir schreiben jemandem etwas zu. Allein durch die linguistische Grundstruktur dieser sprachlichen Wendung entsteht eine Triade, die von den Zuschreibenden zu den Adressaten reicht und die Richtung des Weges bestimmt, die das Zugeschriebene nimmt. Inwiefern in Dimensionen dazwischen alles ungefiltert zu den Adressaten wandert, oder was auf dem Weg dorthin verloren geht, dazu kommt oder neu entsteht, ist empirisch schwer aufzuweisen. Dies gilt auch für Erfahrungen an sich, vor allem dann, wenn es sich wie im Falle des Forschungsprojektes, dessen Datensatz diese Arbeit verwendet, um die Erfahrungen Anderer handelt, hier konkret um jene von zehnjährigen Schülerinnen und Schülern aus einem Reformprojekt an österreichischen Mittelschulen.6 Husserl zufolge reichen wir nie an die Erfahrungen Anderer heran, sie sind uns lediglich zugänglich in den leiblichen Äußerungen, die sich uns, vor allem in der Miterfahrung,7 zeigen.
Im Folgenden wird der Forschungskontext exemplarisch an den Schulen S und T vorgestellt, das Forschungsinteresse persönlich begründet und Zuschreiben als ein schillerndes, als ein vielfältiges und vielschichtiges Phänomen eingeführt. Hier kommt auch die Faszination darüber zum Ausdruck, dass sich im Hinblick auf schulische Zuschreibungserfahrungen Ambivalenzen, Irritierendes, Abweichendes, Opakes und Differentes zeigen, die nicht auf einen Nenner zu bringen sind, sondern einer sorgfältigen Ausdifferenzierung bedürfen. Dies benennt auch das Kernanliegen dieser Arbeit, worauf im Folgenden empirisch wie theoretisch möglichst differenziert eingegangen wird.
Sebastian (Schule S) sowie Türkan und Tülay (Schule T) – hier handelt es sich um anonymisierte Forschungsidentitäten – werden beispielhaft als jene Zehnjährigen vorgestellt, welche die wesentlichen Forschungspartner dieses phänomenologisch- und lernseits orientierten Forschungsvorhabens sind.
1. Der Forschungskontext und die Findung der Frage
1.1 Sebastian
Die erste Begegnung mit Sebastian, einem meiner beiden Forschungskinder, ereignete sich im ersten Forschungsaufenthalt im Feld. Nach der Ankunft in der nebelverhangenen kleinen Gemeinde der Gang zur Schule, die, eingerahmt von Dorfmuseum, Tante-Emma-Laden, Kirche und Widum, während der Forschungsbesuche in pädagogischer wie architektonischer Hinsicht eine substantielle Renovierung erfuhr. Die lokale Position ist symptomatisch für die Schule: Im Dorfzentrum zu sein bedeutet für den Schulleiter, dass sich die Lehrpersonen als verortet im Dorfleben begreifen und sich auch in dieses einbringen. Im Zuge der Renovierung, beispielsweise, wird die Bibliothek umgestaltet zur Gemeindebibliothek, in der ältere Menschen als Vorlesende für die Jugendlichen fungieren.
Es folgen erste Kontakte mit der Schulleitung, Kolleginnen und Kollegen, das schwarze Brett, das mein Kommen ankündigt. Mathematik, die erste Stunde, in die mich die Kollegin mitnimmt, und in der die folgende Vignette von der ersten Begegnung mit Sebastian erzählt.
Sebastian ist damit beschäftigt, den mathematischen Inhalt einer Karteikarte ins Heft zu übertragen. „Was machst du da?“ – „Des ini schrieba“8 – „Hilft dir das beim Mathematiklernen?“ – „Nö!“, kommt es wie aus der Pistole geschossen von ihm zurück. „Was würde dir helfen?“ – „Ein Taschenrechner!“
Langjährig als Lehrerin, als LehrerInnenbildnerin und Didaktikerin sozialisiert, bin ich sofort begeistert vom Ansatz, der hier gelebt wird. Dass sich Mathematiklehrpersonen der Mühe unterziehen, den gesamten Stoff der Sekundarstufe I auf Karteikarten zu übertragen, damit die Schülerinnen und Schüler diesen in Formen des selbstorganisierten offenen Lernens selbstbestimmt und selbstorganisiert bearbeiten können, finde ich beachtlich (vgl. Peschel 2012; Meyer-Drawe 2012b). Dass die ganze Schule pädagogisch in Teameinheiten umgebaut wurde, in denen die beiden Jahrgangsklassen in enger Abstimmung zwischen den Klassenvorständen und ihren Teams geführt werden, ebenfalls. Kennzeichnende didaktische Prinzipien sind die durchgängige Fokussierung auf soziale und offene Lernformen, selbstständiges, selbstorganisiertes Arbeiten, Projektunterricht, Freiarbeit sowie vielfältige Methoden zur Aneignung und Präsentation von Wissen. Der nachfolgende architektonische Umbau unterstützt diese Ansätze durch ein offenes, helles und buntes Raumkonzept, Lerninseln, Begegnungsräume, schnell veränderbare Arbeits- und Lernbereiche und eine vielfältige Ausstattung mit Material und (digitalen) Geräten. Im Sinne der engen Einbindung an das Gemeinwesen übernehmen weitgehend lokale und regionale Handwerksbetriebe die Fertigung der Möbel, ein Prozess, in den auch Lehrpersonen und SchülerInnengruppen eingebunden sind, die gemeinsam mit den Handwerkern entwerfen, planen und herstellen und in dem auch erste Ausbildungsverhältnisse entstehen.
Sebastians Wunsch nach einem Taschenrechner erschüttert meine Begeisterung, sobald ich im Versuch der Urteilsenthaltung im Husserl’schen Sinne (Epoché)9 und lernseits blickend (vgl. Schratz 2009) die Perspektive der Lehrperson aufgebe und die (Lern-)Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler miterfahre.10 Erste Zweifel tauchen auf und Fragen, unangenehm und grundsätzlich: Was, wenn der ganze Aufwand, den die Lehrpersonen betreiben, um den Lernenden andere, neue, anregende und differenzierende Aufgabenpaletten zu bieten, diese in ihrem Lernen viel weniger unterstützen als angenommen, ja vielleicht sogar behindern? Zumindest, so die gewonnenen Einsichten während der Forschungsaufenthalte, stellt sich das für beinahe jedes Kind immer anders dar, ist also nie für alle gültig, was eine pädagogisch-didaktische Binsenweisheit sein mag. Im Folgenden sei kurz auf ein zentrales Ergebnis des Folgeprojektes eingegangen, das sich vor allem der Frage nach besonders erinnerungswürdigen Ereignissen ihrer Mittelschuljahre gewidmet hat (Ammann et al. 2017). Nach vier Jahren wurden an denselben Schulen, in denselben Klassenzimmern, dieselben Schülerinnen und Schüler erneut an mehreren Erhebungszeitpunkten miterfahrend durch ihren Schulalltag begleitet; anders als erwartet erwähnten wenige besonders eindrückliche pädagogischdidaktisch Inszenierungen, sondern erzählten vorwiegend von Projektwochen, Skikursen, oder Auslandsreisen.
Sebastian, begeisterungsfähig für alle Sachinhalte der Biologie, entpuppt sich im Laufe der forschenden Begleitung als kleiner Naturwissenschaftler und Zahlenkünstler; vielleicht versteht er die Aufgabe, die er in der Vignette zu bewältigen hat, eher als Schreib-, denn als Rechenaufgabe und betrachtet den Weg über die Karteikarte im Vergleich zum Taschenrechner, der das Ergebnis schneller brächte, möglicherweise als unnötigen Umweg. Auch die anwesende Kollegin äußert schon bei diesem ersten Aufenthalt in den begleitenden Gesprächen11 Zweifel an diesem Konzept: Früher, so ihre Aussage, wäre sie näher dran gewesen an den Lernenden und hätte im direkten Kontakt die Lernenden eher einladen können, ihre Gedankengänge als mathematische Expertin nachzuvollziehen (vgl. Schirlbauer 2008).
„Der isch an Oagner,12ein Minimalist.“ – Diese von einer anderen Lehrperson in meiner Anwesenheit geäußerte explizite Zuschreibung irritierte, stimmte mich nachdenklich in der miterfahrenden Forschungshaltung und legte den Grundstein für das damit einsetzende Interesse an der Beschäftigung mit dem Phänomen Zuschreibung. Wie wirkt eine solche Zuschreibung, wenn Sebastian sie gar nicht hört, wie entfaltet sie Wirkmacht, wie schreibt sie sich ein in seinen Leib, wie wird sie empirisch erfassbar? Sebastian ist eine auffallende Erscheinung. Er ist von kleiner, fast mädchenhafter physischer Statur, er wirkt schüchtern und zurückhaltend, wenn nicht zurückgezogen und zeigt auffallende körperliche Ticks, welche die meisten Lehrkräfte im Team herausfordern: Ein Zucken im Gesicht und ein kaum wahrnehmbares Aufzeigen mit dem Zeigefinger am Kinn seines Gesichtes, wenn er sich doch einmal zu Wort meldet. Umso erstaunlicher erscheinen seine feste Stimme und die Klarheit seiner Aussagen schon im ersten, die Lektüre der ersten (Roh-)Vignette begleitenden Gespräch.13
1.2 Türkan (und Tülay)
Die zweite Schule liegt im Einzugsbereich eines kleinstädtischen Gewerbe- und Wohngebietes und ist neben einer zweiten die weniger angesehene Mittelschule, weil, so der Schulleiter im Gespräch, der Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Zuwanderungshintergrund an seiner Schule unvergleichlich höher sei. Noch bevor ich mich bei ihm vorstelle, ereignet sich etwas, das zu einer der wenigen Schulleitungsvignetten im Datenbestand geführt hat. Schon in den ersten Minuten meiner Anwesenheit im Feld, diesem unbekannten Terrain, (Breidenstein 2010; Heinzel et al. 2010; Breidenstein 2012) zeigte sich Schule in einer Fülle an Erfahrungen und als ein komplexes Erfahrungsfeld, die deren präzise und umfassende empirische Erfassung mehr als fragwürdig erscheinen lässt. Als Fremde in dieses Feld eintretende Personen sind Orientierungshilfen wie respektvolle Annäherung gefragt und die Bereitschaft, in einen geteilten pädagogischen Raum einzutreten (Schwarz 2015b; Stieve 2008; Busch und Därmann 2007). Die Wirkmacht von Interventionen, die Forschende als schulfremde Personen darstellen, zeichnet pädagogische oder erziehungswissenschaftliche Forschung in besonderem Maße aus. Türkan, die von den Lehrpersonen gewählte Türkin im Vergleich zur einheimischen Tanja,14 lerne ich im Klassenzimmer kennen, in dem sie mit ihrer Schwester15 zusammen dem Unterricht beiwohnt. Von Anfang an sind ihre Zugänglichkeit und Anhänglichkeit auffallend, die sich u. a. in häufigen Umarmungen und Bitten um möglichst große räumliche Nähe während der miterfahrenden Begleitung äußern. Vielleicht ist dies Ausdruck dafür, wie sehr sie die Aufmerksamkeit genießt, die ihr durch diese Auswahl zuteil wird. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass sie die wohlwollende, an ihren (Lern-)Erfahrungen interessierte Miterfahrung spürt, die einen deutlichen Gegensatz bildet zum relativ rauen Umgangston, den die Lehrpersonen mit den Lernenden insgesamt pflegen. Dass die gesamte Klasse bei meiner Verabschiedung spontan applaudiert, ist möglicherweise auch darin begründet.
Sie ist bemüht! – Sie ist frech, laut, ungehörig! – Das sind Eigenschaften, die Türkan (Satz 1) und Tülay (Satz 2), Türkans Freundin und häufige Nachbarin, trotz der wechselnden Sitzarrangements und in Vignetten immer wieder mit präsent, zugeschrieben werden. Tanja, das zweite, von den Lehrpersonen an der Schule T ausgewählte Forschungskind,16 gilt als intelligent, fleißig und einem intellektuellen Elternhaus entstammend. Fast durchgängig wird Türkan – und möglicherweise auch den vielen andern Kindern mit Zuwanderungshintergrund in der Klasse – das Nicht-Verstehen der deutschen Sprache zugeschrieben. In nahezu allen Fächern wird dies als eine Art Generalentschuldigung verwendet, als wäre Sprachvermögen ein unabänderliches Schicksal, dem die mehrjährige Schulzeit an einer österreichischen, deutschsprachigen Bildungsinstitution nichts entgegenzusetzen hätte.
Hier zeichnet sich eine die Laufbahn der Lernenden prägende Wirkmächtigkeit schulischer Zuschreibungen ab, wenn den Schülerinnen und Schülern etwas zugeschrieben wird, das in die Verantwortung von Lehrpersonen gehört. Balinovic fragt im Verweis auf Bialystock & Gogolin, wie es möglich sei, dass einerseits viele aktuelle Publikationen auf den Mehrwert zweisprachiger Erziehung hinweisen und andererseits, „Sprache als Aufhänger der schlechten Bildungserfolge von Kindern mit Migrationshintergrund dient“ (vgl. 2011, S. 9). Sie weist außerdem darauf hin, dass die „Konstruktion Kinder mit Migrationshintergrund“ wirkmächtig ist und reproduziert wird über mehrere Generationen und diesen dadurch „ein niedrigerer Platz in der gesellschaftlichen ,Ordnung‘ bzw. Hierarchie zugewiesen“ (ebd.) wird.
Im Leitbild der Schule T ist von Gemeinschaft erleben und Unterricht in angenehmer und lernförderlicher Umgebung die Rede. Eine der Fragen im Gesprächsleitfaden17 zielt auf Standards ab, die an der Schule bestehen, hinsichtlich dessen, was eine gute SchülerIn, was eine gute Lehrperson ist. Der Schulleiter beantwortet diese Fragen damit, dass die Lehrpersonen jedes einzelne Kind wahrnehmen und versuchen sollten, ihm bestmöglich Genüge zu tun. Pro Jahrgang werden jeweils zwei kleine Klassen geführt, in denen die Lehrpersonen, ähnlich wie in Schule S, im Team und verstärkt mit Formen des offenen und selbstorgansierten Lernens arbeiten. Beim ersten Forschungsbesuch ist die Lerngruppe um Türkan und Tülay gerade aus den Gemeinschaftstagen zurück, einer Art Landschulwoche mit dem Ziel der Eingewöhnung in die neue Schule bzw. des gegenseitigen Kennenlernens. „Es war wie im Gefängnis!“ – Dieser Satz fällt mehrmals, von unterschiedlichen Kindern geäußert und bezieht sich sowohl auf die Unterbringung wie den Ablauf dieser Tage. Das irritiert und macht mich nachdenklich, lässt mich aufhorchen und macht mich sprachlos.18
Türkan antwortet im Gespräch mit der Forschenden auf die Frage Wozu Schule? – „Da gibt es Lehrpersonen, die mir helfen!“ Diese Antwort wirft ein anderes Licht auf die in beiden Schulen zu beobachtende Begeisterung für selbstorganisiertes Lernen. Sie verweist darauf, dass Türkan die Lehrpersonen als professionelles Gegenüber für ihr Lernen braucht, deren Gedankengängen als Expertinnen und Experten sie folgen kann (vgl. Schrittesser 2009a; Schirlbauer 2008), und die überfordert zu sein scheint mit der Aufgabe, sich Inhalte und Methoden selbstständig und selbsttätig anzueignen. Solche und ähnliche Schwierigkeiten mit offenen, selbstorganisierten pädagogischen Settings zeigen sich nicht nur in verschiedenen Vignetten, sondern dies wird auch durchaus kritisch in der Literatur beschrieben (vgl. Rabenstein und Reh 2009; Schratz und Westfall-Greiter 2010; Reh et al. 2011; Meyer-Drawe 2012b).19
1.3 Gliederung der Arbeit
Vignetten, in denen Sebastian und Türkan (Tülay) zu den Protagonisten werden, erfahren in der vorliegenden Arbeit eine differenzierte Darstellung; zusätzlich kommen fast alle 75 Vignetten aus der Textsammlung (Schratz et al. 2012, S. 57–89) in Kapitel vier, dem Herzstück der Arbeit, zum Einsatz. In Kapitel zwei wird Zuschreibung als schillerndes Phänomen vorgestellt: Das Verb schillern hat einen Bedeutungswandel von schielen zu in verschiedenen Farben spielen vollzogen, vom verwandten flimmern hin zu changieren als einer Eigenart gewebter Seide (vgl. DWB, Bd. 15, Sp. 148–149). Kapitel Zuschreibung – ein schillerndes Phänomen versteht sich als ein Impromptu, das verschiedenste (theoretische) Ansätze, Zugänge, Facetten und Dimensionen des Phänomens beleuchtet und vorstellt. Kapitel Flüchtig wie der Wind. Von der Schwierigkeit,
Zuschreibungserfahrungen empirisch zu erfassen: phänomenologische Orientierung und Methodologie der Innsbrucker Vignettenforschung führt ein in die phänomenologische und lernseitige Orientierung (vgl. Schratz 2009) und miterfahrende Forschungshaltung der Innsbrucker Vignettenforschung als dem forschungsmethodologischen Versuch, der Flüchtigkeit und prinzipiellen Unzugänglichkeit von schulischen Zuschreibungserfahrungen empirisch zu begegnen. In Kapitel Die Wirkmacht von Zuschreibungen in der pädagogischen Interaktion: leibliche Gesten und Gebärden und sie begleitende Gefühlsdispositionen konkretisiert sich die Wirkmacht schulischer Zuschreibungserfahrungen in den Vignettenlektüren, die anhand prägender leiblicher Gesten und Gebärden schulischer Praxis und damit einhergehender Gefühlsdispositionen charakteristische Sequenzen einer schulischen Unterrichtsstunde illustrieren. In Kapitel Zuschreibungen als Herausforderungen für das Bildungssystem werden hinsichtlich der Wirkmacht schulischer Zuschreibungserfahrungen zentrale Herausforderungen für das Bildungssystem benannt und entsprechende Implikationen für die Schule und die LehrerInnenbildung formuliert. Die abschließenden Bemerkungen greifen die Intentionen der Einleitung noch einmal auf und weisen auf Forschungsdesiderata hin.
2Kursives markiert in der gesamten Arbeit inhaltliche Hervorhebungen der Autorin bzw. Verweise auf Vignettentexte, die, in Abgrenzung zu wörtlichen Zitaten aus anderen Quellen, nicht unter Anführungszeichen gesetzt werden.
3 Die Arbeit vermeidet im Bemühen um eine geschlechtergerechte Sprache ein generisches Maskulinum, es findet sich allerdings keine einheitliche Vorgangsweise. Abhängig von Situation und Kontext werden explizit weibliche und männliche Formen (Schülerinnen und Schüler), geschlechtsneutrale Bezeichnungen (Lernende, Lehrende, Forschende) oder Paar-Varianten verwendet. Verweise aus älteren Texten bzw. alles direkt Zitierte bleibt unverändert, genauso wie Bezeichnungen, die sich explizit auf ein bestimmtes Geschlecht, eine/n bestimmte/n Schüler/in, eine bestimmte Lehrperson beziehen. Eine besondere Strategie zur Wahrung der Gendergerechtigkeit ist das Vermeiden von Abkürzungen beim Literaturverzeichnis, sodass weibliche und männliche Autorenschaft deutlich sichtbar wird.
4 Der Datensatz stammt von den beiden Forschungsprojekten Personale Bildungsprozesse in heterogenen Gruppen I und II, die vom FWF, dem Österreichischen Fonds zur Förderung wissenschaftlicher Forschung, gefördert wurden (P-22230-G-17 & P-225373-G-16). Vgl. www.vignettenforschung.at (2016-03-21).
5 Schratz 2009; Schratz et al. 2011b; Schwarz 2012a; Schwarz et al. 2013; Vgl. Christof und Schwarz 2013
6 Vgl. www.neuemittelschule.at (2016-04-20).
7 Damit ist die besondere Forschungshaltung der Innsbrucker Vignettenforschung bezeichnet, die in Kapitel 3 eine detaillierte Darstellung erfährt vgl. auch Schwarz und Schratz 2014a; Schratz et al. in Druck.
8 Österr. für „Ich übertrage das ins Heft!“ Diese Vignette ist, anders als die in Kapitel 4 verwendeten vgl. Schratz et al. 2012, noch unveröffentlicht.
9 Das griechische Wort (Epoché) bedeutet nach Husserl, sich „hinsichtlich des Lehrgehaltes aller vorgegebenen Philosophie vollkommen des Urteils [zu] enthalten und alle […] Nachweisungen im Rahmen dieser Enthaltung zu vollziehen“ Husserl 2009, S. 39. Solche Urteilsenthaltung meint einerseits, sich der eigenen (Vor-)Erfahrungen, (Vor-)Annahmen und (Vor-)Urteile bewusst zu werden und sie, temporär zumindest, zu suspendieren, um neue, frische Blicke auf das Gewohnte und Bekannte zu ermöglichen.
10 Dies ist die Forschungshaltung der Innsbrucker Vignettenforschung, die das empirische Datenmaterial und den forschungsmethodologischen Zugang für die vorliegende Arbeit liefert; eine ausführlichere Darstellung dazu Vgl. Beekman 1987; Stieve 2010a, 2010b.
11 Vgl. 1SL2 (s. Legende der Abkürzungen); neben Vignetten sind Gespräche mit Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen, SchulleiterInnen und Erziehungsberechtigten, Fokusgruppen, Fotoevaluation und die Analyse schulischer Leistungsdokumente Teil des multiperspektivischen Instrumentariums. In der (Weiter-)Entwicklung der Innsbrucker Vignettenforschung im Rahmen der vom FWF, vom Forschungsfonds der Wissenschaften in Österreich, geförderten Forschungsprojekte (P-22230-G-17 & P-225373-G-16), liegt der Fokus vor allem auf Vignetten bzw. Anekdoten.
12 Österr. für „Das ist ein ganz spezieller (Schüler)!“
13 Sebastian spricht vor allem über Zeitdruck und Stress als die größte Veränderung gegenüber der Grundschule im ersten Lernjahr in der Neuen Mittelschule. Das österreichische Reformprojekt für eine gemeinsame Schule der 10–14-Jährigen war Anlass für das geförderte Forschungsprojekt. Manchen Vignetten kann sogar fraktale Wirkung zugesprochen werden, wenn das Phänomen des Zeitdrucks beispielsweise in der Gesamtstruktur der Schule beobachtet werden konnte, von den Lehrpersonen über die Schülerinnen und Schüler bis zur Schulleitung.
14 Um den Forschenden den Eintritt in das Forschungsfeld zu erleichtern, wurden top-down über die Schulbehörde forschungswillige Schulen angesprochen, und die KlassenlehrerInnen gebeten, jeweils zwei Kinder auszusuchen, die eine Differenz repräsentierten. Die Anregung, Schülerinnen und Schüler nach Differenzen hinsichtlich von Gender, Verhalten, Leistung oder Herkunft auszuwählen, griffen viele Lehrpersonen bereitwillig auf, erhofften sie sich doch dadurch pädagogische Anregungen oder Hilfestellungen aufgrund der durch das Reformprojekt sehr viel stärker einsetzenden Differenzierungsherausforderungen.
15 In begleitenden Gesprächen mit Lehrpersonen und Erziehungsberechtigten stellt sich dieser Umstand überraschend unterschiedlich dar. Die Klassenlehrerin vermutet, eine der Schwestern habe eine Klasse wiederholt und deshalb seien sie nun zusammen, aber um Zwillinge handle es sich jedenfalls nicht. Es zeigte sich allerdings bald, dass sie nicht genau Bescheid wusste und sich offensichtlich auch nicht entsprechend informiert hatte. Der Vater erklärt den Umstand, dass beide Mädchen, obwohl unterschiedlichen Alters, in der gleichen Klasse sitzen, aus der eigenen schulischen Erfahrung heraus. In ähnlicher Weise hätten seine Eltern ihn mit seinem Bruder zusammen eingeschult, in der Hoffnung, dass das, was der eine überhörte beim anderen fruchtete. In Bezug auf Türkan und Elif sei dies allerdings eine Hoffnung, so schließt er schmunzelnd, die sich leider nicht erfülle (vgl. Gespräche T1L2; T1EvS1).
16 Vgl. Fußnote 13.
17 Vgl. Anhang.
18 Als Forschende entstand dadurch ein besonderes Dilemma für mich: Sollte ich in der Forscherrolle bleiben und das in der Verschwiegenheit der Forschungssituation mir Anvertraute geheimhalten oder intervenieren und, beispielsweise, den Schulleiter informieren? In diesem Fall fiel die Entscheidung, mit einem nicht geringen Unbehagen, für das Stillschweigen. Dieses Dilemma zog sich allerdings durch den gesamten Forschungsaufenthalt: Theo, ein als äußerst schwierig attribuierter Schüler an der Schule, kommentierte die sogenannte Gemeinschaftsstunde – so etwas wie Soziales Lernen – als Gemeinheitsstunde. Diese Dilemmata bleiben, sie sind unangenehm aber nicht auflösbar. Im Zweifel ist aus (forschungs-)ethischen Gründen jedenfalls die Intimität der Forschungssubjekte zu wahren.
19 Zu einer ausführlicheren und kritischeren Darstellung der Herausforderungen, welche die Wirkmacht von Zuschreibungen für die Schule im Allgemeinen und offene, selbstorganisierte pädagogische Inszenierungen im Besonderen darstellt, vgl. das Schlusskapitel der Arbeit.
Zuschreibung – ein schillerndes Phänomen
In gewissem Grad sind wir wirklich das Wesen, das die andern in uns hineinsehen, Freunde wie Feinde. Und umgekehrt! auch wir sind die Verfasser der andern; wir sind auf eine heimliche und unentrinnbare Weise verantwortlich für das Gesicht, das sie uns zeigen, verantwortlich nicht für ihre Anlage, aber für die Ausschöpfung dieser Anlage. [...] Wir halten uns für den Spiegel und ahnen nur selten, wie sehr der andere seinerseits eben der Spiegel unseres erstarrten Menschenbildes ist, unser Erzeugnis, unser Opfer. (Frisch 1976, S. 29)
Das Zitat von Max Frisch artikuliert unsere Verstrickung mit den Anderen und der Welt, ein Befund, der für das Phänomen Zuschreibung von zentraler Bedeutung ist. Das Bild, dass wir teilweise zu jenem Wesen werden, das die Anderen in uns hineinsehen, artikuliert eine fundamentale Wesensstruktur von Zuschreibungserfahrungen. Die Eigenschaften und Charakteristika, die wir uns wechselseitig zuschreiben, prägen offensichtlich nachhaltig. Es ist die Rede von der Verantwortung der Zuschreibenden vor allem für die Ausschöpfung des Potentials, das die Adressaten zur Verfügung haben, und das durch Zuschreibungen geschmälert werden kann. Das Bild des Spiegels, im Rahmen dessen die Anderen als die Opfer und Erzeugnisse unserer erstarrten Menschenbilder erscheinen, weist bereits auf die weitreichende Wirkmacht von Zuschreibungserfahrungen hin. Im Extremfall führen Zuschreibungen zu Fixierungen, Erstarrungen, zu stereotypen Bildern, zu Stigmatisierung und Ausgrenzung. Dass dies auf eine heimliche und unentrinnbare Weise geschieht, weist auf Ambivalenzen, auf schwer Durchschaubares und Komplexes hin und macht die Zuschreibung zu einem schillernden Phänomen.
Je nachdem, welches Licht auf einen schillernden Gegenstand geworfen wird bzw. aus welcher Perspektive er betrachtet wird, changiert, schwankt und flimmert er in unterschiedlichen Farben und Facetten (vgl. DWB, Bd. 15, Sp. 148–149).20 Synonyme wie verschwimmend, ambivalent oder schwer durchschaubar verstärken dies. Das Phänomen Zuschreibung stellt sich als ähnlich vielschichtig, schillernd und schwer durchschaubar dar und erscheint in jeweils anderem Lichte, je nachdem aus welcher Perspektive es betrachtet wird. Das ist nicht nur ein Teil des Reizes, der die Beschäftigung mit diesem Phänomen lohnt, sondern es deutet auch auf eine komplexe Gemengelage hin, die im Sinne Harold Pinters die wissenschaftliche Beschäftigung mit diesem Gegenstand zu einer sehr herausfordernden macht.
Wie Zuschreibungen wirken und sich in den Leib einschreiben können, wenn die AdressatInnen sie gar nicht hören, weil sie, beispielsweise, ausschließlich im Beisein der Forschenden, geäußert werden, zieht sich als eine zentrale Frage durch die vorliegende Arbeit. Wie lässt sich empirisch fassen, was unsichtbar, unhörbar und im Verborgenen wirkt? Wie lassen sich Zuschreibungserfahrungen so beschreiben, dass sie sich als Geschehen in Klangfarben, Tonlagen, Nuancen und Facetten zeigen und „verkörpern [können], ohne sogleich auf die eingefahrenen Bahnen von Logos, Organon, Regel oder Konsens zu geraten“ (Waldenfels 1994, S. 17). Waldenfels’ Bild des Registers oder des Verzeichnisses, in das man Ergebnisse von Untersuchungen einträgt, ist angemessen, die Verfahrensweise zu beschreiben, die diese Arbeit verfolgt. Es wird zusammengetragen, was sich zu Zuschreibungen aus sehr unterschiedlichen Zugängen und Perspektiven sagen lässt, ohne dass alle gleichermaßen erschöpfend behandelt werden könnten, oder zu einer konzisen Synthese führten. Die Ambivalenz, Opazität und bedingte Undurchdringlichkeit des Phänomens bringt es mit sich, dass endgültige Antworten sowie eindeutige Befunde in einem solchen Register fehlen. Zuschreibungserfahrungen werden in ihrer Wirkmacht zuallererst beschrieben, ohne sie vorschnell zu kategorisieren oder zu operationalisieren (vgl. auch Kapitel drei und vier) (vgl. Lippitz 2003; Brinkmann 2010a).
Schülerinnen und Schülern werden aus unterschiedlichen Gründen Eigenschaften zugeschrieben. Dadurch werden sie als bestimmte Lernende anerkannt, als andere nicht. Dies markiert nicht nur den schulischen Umgang mit ihnen, sondern auch die Art der Aufmerksamkeit, die sie dort bekommen. Es stellt sich die Frage, ob Lernenden, die als schlecht attribuiert sind, noch komplexe Aufgabenangebote gemacht werden, oder ob bei solchen, die als brillant etikettiert sind, noch überprüft wird, was es mit dieser Exzellenz auf sich hat. Zuschreibungserfahrungen sind häufig Diskriminierungserfahrungen in der Schule und haben Widerfahrnischarakter. Wir können uns davor nicht schützen, sondern sind ihnen ausgesetzt, sodass wir durchleiden (müssen), was uns hier widerfährt. Die Anderen, die uns Eigenschaften zuschreiben, sind unserem Einfluss- und Wirkungsbereich entzogen. Wir können weder den Zeitpunkt bestimmen, an dem Zuschreibungen erfolgen, noch können wir deren Schwere oder Leichtigkeit bestimmen. Oft hören wir Zuschreibungen nicht, weil sie nicht in unserer Anwesenheit geäußert werden, sondern spüren oder vermuten lediglich ihre Wirkung.
Während Zuschreiben den Akt des Zuschreibens meint, betont das Nomen Zuschreibung den Vollzug zuschreibenden Denkens, Redens oder Handelns. Im Synonym attribuieren schwingt ein Tribut mit, der zu leisten ist, während unterstellen andeutet, dass es sich um etwas Negatives handelt. Allerdings entfalten auch positive Zuschreibungen ihre ganz spezifische Wirkmacht (vgl. etwa Abschnitt 4.5.9. in dieser Arbeit). Der Begriff des Schreibens im Verb zuschreiben ist irreführend, weil es sich hier um nichts Schriftliches handelt. Die festen Bilder, mit denen Zuschreibungen operieren und gegen die Lernende im Grunde machtlos sind, äußern sich vorwiegend mündlich, gestisch oder mimisch bzw. artikulieren ihre Wirkmacht im Handeln (vgl. Meyer-Drawe und Schwarz 2015). Die Vignettenlektüren in Kapitel vier geben reichlich Zeugnis davon, dass sie sich in ihrer Wirkung in den Leib einschreiben, dass sie gelegentlich ins Fleisch schneiden und Narben bilden, wie diese Arbeit auch im Rückgriff auf literarische Stimmen zu zeigen versucht. Literarische Stimmen sind besonders dort erhellend, wo sich Erfahrung dem direkten Forschungszugriff entzieht und Dimensionen der Phänomene berührt, die empirisch schwer fassbar sind (vgl. Merleau-Ponty 1966, 2003, 2004).
Wir sind nicht neutral in der (Schul-)Welt, sondern nehmen immer etwas als etwas wahr (Husserl 1985; Waldenfels 1992, 2000; Meyer-Drawe 2010c). In einer Gruppe von Kindern in der Schule nehmen wir diese als Aufgeweckte, Langsame, Freche, Unscheinbare, Mutige, Brave, Intelligente oder Schwache wahr. In Zuschreibungen machen sich Lehrpersonen ein Bild, ordnen und strukturieren das Erfahrene. Dies gibt Halt und Orientierung, aber typisiert und kategorisiert auch. Typisierte und global bewertende Bilder oder erstarrte Bilder aufgrund wiederholter Zuschreibungen führen leicht zu Stigmatisierung und Diskreditierung, zu sozialer Ausgrenzung und gesellschaftlicher Benachteiligung (vgl. u. a. Brusten und Hurrelmann 1976; Brusten 1975b; Goffman 1975, 1973; Rabenstein und Reh 2009; Arens und Mecheril 2010; Mecheril et al. 2011; Brusten 1975a).
Eine zentrale Herangehensweise an die theoretische Beschäftigung mit diesem schillernden Phänomen sind phänomenologische Zugänge zu Erfahrung. Phänomenologie gilt als die Philosophie der Erfahrung und verlangt nach einer bestimmten Aufmerksamkeit wie einer besonderen Schule des Sehens und Wahrnehmens. Die besondere phänomenologische Aufmerksamkeit (vgl. u. a. Herrlitz und Rittelmeyer 1993) spart Ambivalentes, Opakes oder Irritierendes nicht aus, sondern, ganz im Gegenteil, wendet sie sich Bruchlinien (vgl. Waldenfels 2002b), Zwischensphären und Graubereichen in besonderer Weise zu, auch im Wissen um die Begrenztheit der Möglichkeiten, die Vielschichtigkeit von Erfahrungsdimensionen restlos aufklären zu können. Das als „signifikative Differenz“ bezeichnete und beschriebene Konzept phänomenologischer Wahrnehmung nach Edmund Husserl betont, dass das, was sich zeigt, über sich hinausweist und immer mehr bedeutet als gegeben ist bzw. als gesagt, geklärt oder erschlossen werden könnte. „Was uns erscheint, d. h. was ein Phänomen für uns ist, ist dann nur in der Art und Weise zu beschreiben, wie es uns erscheint (nicht aber, wie es wirklich ist und an sich ist)“ (Waldenfels 1992, S. 32). Zuschreibungserfahrungen in der Schule zeigen sich uns also nicht, wie sie wirklich und an sich sind, sondern vor allem so, wie sie in der gerichteten Aufmerksamkeit der Vignettenschreibenden erscheinen. Aus unseren Sätzen über die Welt werden „eingeklammerte Urteil[e]“ (Bedorf 2011, S. 84). Die Formen, in denen sich schulische Zuschreibungserfahrungen in den Vignetten artikulieren, d. h. in denen sie den Vignettenschreibenden in ihrer Miterfahrung21 erscheinen, werden in Kapitel 4 hinsichtlich ihrer Wirkmacht und bezogen auf prägende leibliche Gesten und Gebärden und begleitende Gefühlsdispositionen in maßgeblichen Unterrichtssequenzen gelesen.
1. Zuschreibung als Differenzierungsprozess
Für die Entstehung von Zuschreibungen sind Differenzierungsprozesse entscheidend. Die Zuschreibung Paul ist fleißig resultiert aus einem Vergleich mit einem faulen und weniger aktiven Lernenden. Der schulische Umgang mit Differenz ist häufig geprägt von einem binären Vorgehen und oft gekennzeichnet durch wertende Attribute. Differenz und Differenzierung sind etwas scheinbar Normales im schulischen Kontext. Wir differenzieren Schülerinnen und Schüler nach Geschlecht, Leistung, Verhalten und – seit kurzem – sehr viel stärker nach (ethnischer, sozialer und kultureller) Herkunft.22 Gerade in den (äußerlich) differenzierenden Schulsystemen im deutschen Sprachraum wird von einer Homogenität ausgegangen, die es so nie gibt. Selbst vorselektierte Gymnasiumsklassen oder ein Leistungskurs sind heterogen. Die äußere Differenzierung der Schülerinnen und Schüler nach Leistungs- und Begabungsniveaus geht davon aus, dass es sich bei dieser Zuweisung um homogene Gruppen handelt.
Nach Hagedorn geht es bei Fragen von Homogenität und Heterogenität im Wesentlichen um die Auseinandersetzung mit Einheit und Differenz (vgl. 2013). Dahinter steht die Frage nach Unterschieden wie nach Gemeinsamkeiten, die eine Person im Vergleich mit anderen in Bezug auf bestimmte Kriterien, die im Fokus der Betrachtung stehen, besitzt. Heterogenität beschreibt ein „Problemfeld, das sich mit askriptiven Merkmalen (Geschlecht, kulturelle oder soziale Herkunft etc.) auseinandersetzt, die für die Bildungsprozesse von Heranwachsenden von Bedeutung sind“ (2013, S. 405). Aufgrund solcher askriptiver Merkmale findet Selektion im Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt statt, wodurch „systematisch Ungleichheiten in Bezug auf gesellschaftliche Teilhabe (re-)produziert werden“ (ebd.) können.
Gerade Schule, so Hagedorn, sei „strukturlogisch auf Universalisierung, Homogenisierung und Separierung codiert“ (2013, S. 410) und es sei daher wenig verwunderlich, dass etwa die Grau- und Zwischenbereiche zwischen gut und schlecht, fleißig und faul, intelligent und dumm, brav und schlimm, usw. bevorzugt ausgespart und vermieden werden. Die Grau- und Zwischenbereiche bringen in ihrer diffusen Vielfalt Schwierigkeiten herein, bei denen erprobte (methodisch-didaktische) Mechanismen nicht greifen. In der vorliegenden Arbeit interessieren gerade solche Grau- und Zwischenbereiche, das Unsichtbare, das Verborgene und das Opake im schulischen Tun. Vignetten als erfahrungsträchtige, verdichtete Erzählungen aus dem Schulalltag, als „Klangkörper des Lernens“ (Schratz et al. 2012, S.31) werden genutzt, um leibliche und pathische Dimensionen von Zuschreibungserfahrungen zu konkretisieren, zu illustrieren und, ohne Zwischensphären und Graubereiche auszusparen, in möglichst vielen Facetten auszudifferenzieren.
Die Erfahrung von Differenz ist etwas Grundmenschliches, etwas Unvermeidliches und grundsätzlich Positives, das uns immer wieder herausfordert, Differentes zu akzeptieren.23 Differenzen werden in Beziehungen häufig von Macht und Dominanz konstituiert (vgl. Ploesser und Mecheril 2012; Mecheril und Plößer 2009). Die zahlreichen Arbeiten der Migrations- und Gender Studies, beispielsweise, weisen nach, dass „Konsumenten sozialer Arbeit“24 nicht nur „,different‘, but also ,differently different‘ […]“ sind (2012, S. 795; Arens und Mecheril 2010). Daher votieren Ploesser & Mecheril für die Einführung des Konzeptes der Otherness, der Veranderung durch Andere, das auf besondere Weise aufmerksam macht für Ausgrenzungs- oder Benachteiligungsmechanismen im Umgang mit (schulischer) Differenz. Im Wesentlichen werden in aktuellen Diskursen vor allem drei Zugänge zum Umgang mit Differenz thematisiert: einmal die Vernachlässigung bzw. die Ignoranz von Andersheit, zweitens die Anerkennung der Anderen und drittens, die Dekonstruktion der Differenz zwischen Anderen und Nicht-Anderen. Immer geht es dabei um Machtfragen und Herrschaftsverhältnisse, immer braucht es reflexive Zugänge zum Umgang mit Differenz, vor allem in der Schule.
Im pädagogischen Bereich, so Ploesser & Mecheril (vgl. 2012), lässt sich nach einer Phase der Vernachlässigung von Differenzen eine erhöhte Bereitschaft und Sensitivität beobachten, mit schulischen Unterschieden umzugehen. Befürworter von Ansätzen, des sogenannten „colour-blind“ Ansatzes (ebd., S. 797) etwa, welche die Gleichheit und Gleichbehandlung aller anstreben, ignorieren Differenzen eher, als dass sie diese kritisch reflektierend bearbeiten. Solche Ansätze laufen Gefahr, Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten zu vergrößern, wenn die Machtstrukturen, die in Differenzkategorien eingeschrieben sind, weder auf struktureller noch institutioneller Ebene reflektiert werden. Das Anderssein der Anderen wird in der Vernachlässigung von Differenzen häufig als Defizit und Devianz erlebt, ein Umstand, der sich immer auch in den Vignetten zeigen lässt. Dabei müssen strukturelle und institutionelle Bedingungen entsprechend kritisch mitreflektiert werden, ohne sichtbar werdende leibliche und pathische Erfahrungsdimensionen allein auf der individuellen Ebene von Lehrpersonen und Lernenden zu belassen.
Die seit den 1980er Jahren (vgl. Honneth 1992; Balzer 2014; Prengel 2013) einsetzende Bewegung der Anerkennung von Differenz ist einerseits begrüßenswert, weil sie Differenz weder leugnet noch vernachlässigt, andererseits entsteht gerade dadurch die Gefahr, dass Differenzen überhaupt erst hergestellt werden. Dies geschieht nicht nur durch Lehrpersonen im pädagogischen Feld, sondern vollzieht sich auch in Bildungsinstitutionen und kann ohne kritische Reflexion zu Bildungsbenachteiligung führen (vgl. Deppe 2013); auch Forschende sind vor dieser Gefahrenlage nicht gefeit, wie im Folgenden ein konkretes Beispiel im Forschungszugang der Innsbrucker Vignettenforschung illustriert.
Türkan und Tülay sind zwei Schülerinnen mit Migrationshintergrund, die als Forschungssubjekte immer wieder zu handelnden Personen in Vignetten wurden (vgl. u. a. 4.3.2.; 4.4.7). Im Rahmen des Forschungsprojektes sind Türkan und Tülay jene Namen, die sich die Mädchen für ihre Forschungsidentität wählten. Diese Namen weisen sie als Migrantinnen aus, als Nicht-Einheimische, obwohl sie in Österreich geboren sind, die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen und die Türkei nur als Urlaubsland kennen, wie Türkans Vater im Gespräch25 betont. Die Forschenden können im Schreiben der Vignetten an der Produktion von Differenz beteiligt sein (vgl. u. a. Mecheril und Rose 2012; Mecheril et al. 2013), indem sie Forschungssubjekte aufgrund einer binären Sichtweise und Namenssetzung zu Migranten in Abgrenzung von Einheimischen machen.26 Hier zeigt sich ein unauflösbares Dilemma im Umgang mit Differenz in der Schule: Die Anerkennung von Differenz im Gegensatz zum Gleichheitsprinzip läuft einerseits Gefahr, Differenzen überhaupt erst zu erzeugen, andererseits ermöglicht erst ihre Thematisierung eine kritisch reflexive Auseinandersetzung.
Dekonstruktive Perspektiven auf den Umgang mit Differenz widmen sich vor allem der Analyse (bildungs-)politischer Macht- und Herrschaftsbezüge in Zugängen, die einen affirmativen Umgang mit Differenz befürworten. Sie beschäftigen sich mit der Kritik an unhinterfragter und unreflektierter Anerkennung von Differenz. Eine Frage, die Ploesser & Mecheril als zentral für solche Zugänge formulieren, heißt: Angesichts dessen, was wir tun, was für eine Realität entsteht und was ist die Wirkung solcher Praxis? (2012, S. 798)27 Dies fragt unmittelbar und auch nach der Wirkmacht schulischer Zuschreibungspraktiken und ist damit relevant für das Grundanliegen der vorliegenden Arbeit. Soziale Differenzen sind „überaus wirkmächtig“ (2009, S. 198) und bleiben als reale und fühlbare Erfahrungen von Ungerechtigkeit und Diskriminierung bestehen. Dekonstruktive Ansätze laufen Gefahr, Unterscheidungsschemata zu übergehen und durch „Veruneindeutigung und Vervielfältigung“ (ebd.) die Benennung und damit die produktive Bearbeitung solcher Erfahrungen zu erschweren.
Judith Butler (vgl. 1998, 2012) zufolge sind vor allem binäre Muster problematisch, nach dem Differenzierungsprozesse erfolgen, ein strikter Entweder-Oder-Zugang28, unabhängig von rekognitiven oder dekonstruktiven Ansätzen im Umgang mit Differenz. Dies gilt gleichermaßen für die Wirkmacht von Zuschreibungen, die genau nach diesen Mustern fungieren und Grau- und Zwischenbereiche ausblenden. Dekonstruktive Theorien über Differenz verstehen diese weniger als einen objektivierbaren Tatbestand denn als einen dynamischen Prozess, in dem Adressierung eine wichtige Rolle spielt. Im Verweis auf Hall werden wir nach Ploesser & Mecheril (vgl. 2012) dadurch zu Anderen, zu Schwarzen, Türken, Frauen oder sonstigen Abweichenden, dass wir als Andere, als Schwarze, Türken, Frauen oder als abweichend von geltenden Normen angesprochen werden. Im schulischen Umgang mit Zuschreibungen verhält es sich ähnlich: Schülerinnen und Schüler, die als Freche, Schwache, Starke, Fleißige, Faule u.a. adressiert werden, werden demnach als Freche, Schwache, Starke, Fleißige oder Faule konstituiert. Das Zuschreibungsgeschehen ist also nicht nur ein Differenzierungs-, sondern auch ein Adressierungs- und damit Anerkennungsgeschehen (vgl. auch Abschnitt 2.3.).
Der didaktische Ort, an dem Differenzierung erfolgt, ist nach Mecheril ein Ort, „der im Schnittfeld gesellschaftlicher, institutioneller, interaktiver und kultureller Praktiken, etwa Attribuierungspraktiken, entsteht“ (2010a, S. 23). Schratz & West-fall-Greiter argumentieren, dass zunächst eine vielleicht nicht vorhandene Differenz, „über die didaktischen Maßnahmen, etwa gestützt auf diagnostische Urteile, […] – z. B. ,leistungsstark‘ und ,leistungsschwach‘ in den fachlichen Leistungen“ (2010, S. 24) der Lernenden, erst erzeugt wird. Dabei, so Mecherils Kritik, bleibt Kontextuelles
[…] weitestgehend unthematisiert. Dieser Mangel an Kontextualisierung korrespondiert mit dem implizit universalistischen, kontextunspezifischen Vorgehen vieler Ansätze: Es interessiert nicht so sehr, wie in einem bestimmten sozialen Raum vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen, institutionellen und kulturellen Vorgaben [...] ,Differenz‘ erzeugt wird, sondern vielmehr ist das [...] Differenzprodukt von Interesse, das abgelöst von den kontextspezifischen Bedingungen seiner Produktion als je schon existierender Unterschied und nicht als Praxis der Unterscheidung betrachtet wird. (Mecheril 2010a, S. 23)
Für Mecheril & Plößer hat Differenz mit Unsicherheit, Opazität, Ambivalenz, Ungewissheit, Nicht-Wissen und Unbestimmtheit zu tun (vgl. 2009). Sie warnen davor, die gerade am Ort Schule in Differenzverhältnisse eingelagerten Macht- und Herrschaftsverhältnisse zu übersehen. Differenzierungsprozesse, so Schratz & Westfall-Greiter (2010), produzieren Differenz in Klassenräumen und basieren auf Zuschreibungen. Verschiedenste Lernstilkonzepte erfreuen sich derzeit großer Beliebtheit (vgl. u. a. Prashnig 2008); so hilfreich sie auf den ersten Blick scheinen mögen, so durchdrungen sind sie von Etikettierungen und Zuschreibungen, die in der pädagogischen Umsetzung sehr problematisch sein können. Tomlinson warnt davor, solche vermeintlich hilfreichen Etiketten wie ,visuell‘ oder ,kinästhetisch‘, überzubewerten: „It may be helpful for the teacher to be aware of a student’s particular learning style, but telling a student he is a ,visual type‘ may or may not be useful for his development“ (2006, zit. in Schratz und Westfall-Greiter 2010, S.24).
Ein differenzsensibler Unterricht, so Schratz & Westfall-Greiter (2010), erfordert einen anderen Blick auf Lernende, aber zugleich „müssen sich pädagogische Institutionen und pädagogisch Handelnde fragen, inwiefern sie selber am ,doing difference‘ beteiligt sind, welche Zuschreibungen sie vornehmen, wie sie in ihrer täglichen und notwendig anerkennenden Arbeit durch Anreden, Zuordnungen, Diagnosen, räumliche Settings etc. Differenz und damit Ungleichheit produzieren. Weil ,doing difference‘ immer auch ,doing inequality‘‘29 (ebd. S. 25) bedeuten kann, gelte es zu überprüfen, welche Ressourcen den Subjekten vor allem jenen in randständigen Positionen zur Verfügung stünden, und „wie die Pädagogik für deren Zugänglichmachung oder deren Aufwertung eintreten“ (Mecheril und Plößer 2009, S. 201) könne.
Zuschreibungserfahrungen sind eng an Differenzierungsprozesse geknüpft, in die häufig Macht- und Herrschaftsstrukturen eingelagert sind und daher eine ganz spezifische Wirkmacht entfalten. Zuschreibungserfahrungen sind häufig Diskriminierungserfahrungen und tragen den Stachel der Ungerechtigkeit und Benachteiligung in sich; dieser Perspektive soll im Folgenden in detaillierterer Weise Rechnung getragen werden.
2. Zuschreibung als Ungleichheit und Ungerechtigkeit
Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass Zuschreibungen zu sozialer Selektion und (Bildungs-)Ungerechtigkeit führen können, wenn ihre Wirkmächtigkeit nicht individuell, institutionell und strukturell reflektiert wird (Arens und Mecheril 2010; Dirim und Mecheril 2009, 2011; Mecheril 1994b, 2010a; Mecheril und Melter 2012; Mecheril und Plößer 2009; Erler 2011). Dies bedeutet, dass schulische Zuschreibungserfahrungen (auch) Erfahrungen von Ungerechtigkeit sind, was sich in verschiedenen Vignetten immer wieder artikuliert (vgl. u. a. Abschnitt 4.2.1; 4.2.5; oder 4.2.3). Judith Shklar unterscheidet zwischen Unglück und Ungerechtigkeit und votiert dafür, sich nicht nur mit der Gerechtigkeit, sondern vor allem auch mit der Ungerechtigkeit zu beschäftigen. Dies wird ihrer Einschätzung nach sowohl in der Philosophie als auch in anderen Disziplinen vernachlässigt (vgl. Shklar 1992). Für Shklar ist Ungerechtigkeit mehr und anderes als fehlende Gerechtigkeit. Sie spricht sich dafür aus, „jene Erfahrungen, die wir ungerecht nennen, als unabhängige, eigenständige Phänomene [zu] denken,“ denn obwohl es sich dabei um wahrlich „gewöhnliche Erfahrungen“ handle, nähmen sie unsere Aufmerksamkeit ungewöhnlich stark in Anspruch: „[...] aller Wahrscheinlichkeit nach haben die meisten von uns häufiger gesagt, >>dies ist unfair<< oder >>dies ist ungerecht<< als >>dies ist gerecht<<“ (1992, S. 32). Das Erleben von Ungerechtigkeit, so Shklar, „hinterläßt einen tiefen Riß in unserem Denken“ (ebd.). Balinovic (2011) stellt im Verweis auf Erler fest, dass Bildungschancen in Österreich in hohem Maße vererbt werden. Dies sei einerseits der kurzen Pflichtschuldauer geschuldet, der frühen Selektion mit 10 Jahren,30 den unverhältnismäßig langen Ausbildungszeiten und einer wenig wertschätzenden Suche nach jungen Talenten, vor allem aus sozial benachteiligten (Zuwanderungs-)Hintergründen.31 Die Schlechterstellung Migrationsanderer ist von der empirischen Bildungsforschung wiederholt festgestellt worden (vgl. Dirim und Mecheril 2009, 2011). Dabei sind im Besonderen verschiedene „gesellschaftliche Ungleichheitspraxen und Unterscheidungsmechanismen“ am Werk, die durch soziale Interaktion, vor allem auch in der Schule, „Anknüpfung sowie Bekräftigung“ (Balinovic 2011, S. 3) finden. Ungleichheit, so Balinovic, setzt auf „aktive Mechanismen der Unterscheidung“ (ebd.), die immer inkludierend oder exkludierend sind. Als aktive Praxen produzieren sie „Asymmetrien“ (ebd.), bewerten diese in den bereits erwähnten binären Mustern und laufen Gefahr, auszugrenzen und zu benachteiligen, vor allem dann, wenn sie Unterscheidungen zwischen Personen oder Gruppen betreffen.32 Begriffe wie Ungleichheit, Disparität und Benachteiligung basieren auf Vergleichen, deren Ergebnis Differenzen sind. Erst durch die Feststellung von Gleichem werden „Abweichungen“ (ebd., S. 8) definiert. Ungleichheit und Disparität haben mit der Unterscheidung von gleich und gleich(er) zu tun, während der Begriff „Benachteiligung“ (ebd.) eine unterschiedliche Behandlung von Personen markiert, die den „Zugang zu begehrten Ressourcen ermöglichen bzw. verhindern“ (ebd.) und synonym gesetzt werden kann zu Diskriminierung als zugespitzter Benachteiligung (vgl. Balinovic 2011). Vor allem die „systematische und institutionelle Diskriminierung [wird] als systematische Diskriminierung entlang von Ungleichheit“ (ebd.) verstanden.
Rieger-Ladich beobachtet einen neuen Trend in sozialwissenschaftlichen Studien, in welchen das besondere Augenmerk auf das Erleben von Ungerechtigkeit gelegt wird (vgl. Rieger-Ladich 2014b; vgl. 2014b). Damit geht weniger ein sozialer Tatbestand als eine Urteilszuschreibung einher. Je nachdem, ob Erlittenes als Unglück oder als Ungerechtigkeit gewertet wird, reagieren Menschen anders. Im Verweis auf Shklar hält Rieger-Ladich fest, dass es sich dabei stets um ein Attributionsgeschehen handelt, darum nämlich, was wir dem jeweiligen Umstand zurechnen. Shklar zufolge verbirgt sich in jeder Äußerung, die etwas als ungerecht markiert, ein Urteil. Die vorliegende Arbeit will diesen Ansatz weiterverfolgen und den besonderen Fokus auf das Erleben von Zuschreibungen legen, in dem die Wirkmächtigkeit schulischer Zuschreibungserfahrungen im Zentrum der Aufmerksamkeit steht: Schulische Zuschreibungserfahrungen sind immer wieder auch Erfahrungen33 von Ungerechtigkeit und Ungleichheit (vgl. u. a. Abschnitte 4.2.3.; 4.2.5. oder 4.7.5.). Wie sich das Erleben von Ungerechtigkeit oder Ungleichheit in den Vignetten der Vignettenschreibenden artikuliert, die schulische Lernerfahrungen von Zehnjährigen an österreichischen Mitteschulen miterfahren, wird in Kapitel vier, im Herzstück der Arbeit, weiter expliziert.
3. Zuschreibung als Adressierungs-, Anerkennungs- und Aufmerksamkeitsgeschehen
Zuschreibungen prägen sowohl Anerkennungs-, wie auch Aufmerksamkeitserfahrungen in der Schule und beruhen, wie bereits bemerkt, auf Adressierungspraktiken. Schülerinnen und Schülern werden aus unterschiedlichen Gründen verschiedene Eigenschaften zugeschrieben, die meist eine binäre