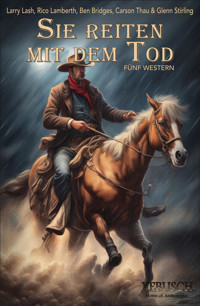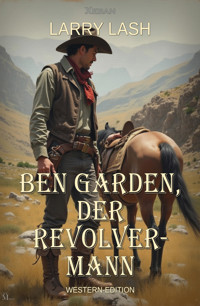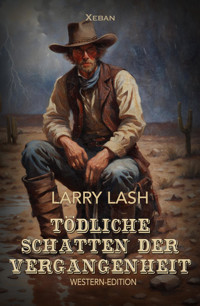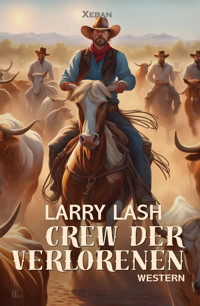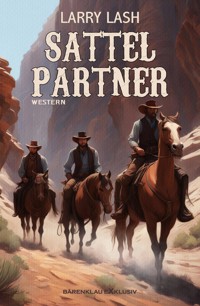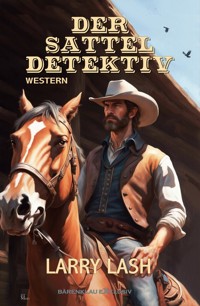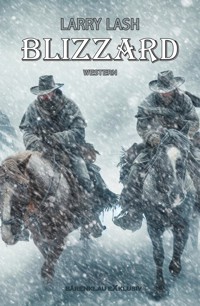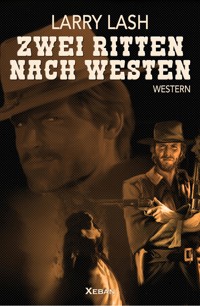
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: XEBAN-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
p>»Irgendwann ist für jeden von uns der Trail zu Ende. Niemand kennt den Zeitpunkt, und das ist gut so. Vielleicht war der Tote ein guter, vielleicht ein schlechter Mann. Wir wissen es nicht. Nur eins steht fest: Das hier war ein Mord!«
Bob Wharton und Sid Fanning schließen sich zusammen und reiten gemeinsam nach Westen, die Richtung, aus der der Mörder gekommen zu sein scheint. Sie sollen recht behalten. Nur ist der nun Gejagte nicht ihr einziger Gegner auf dem Weg zur vermeintlichen Gerechtigkeit, einem Weg, der gespickt ist mit Hass, Gier, Neid – und Tod …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Larry Lash
Zwei ritten nach Westen
Western-Edition
Impressum
Neuausgabe
Copyright © by Authors
© Copyright dieser Lizenzausgabe by XEBAN-Verlag.
Verlag: Xeban-Verlag: Kerstin Peschel, Am Wald 67, 14656 Brieselang; [email protected]
Lizenzgeber: Edition Bärenklau / Jörg Martin Munsonius
www.editionbaerenklau.de
Cover: © Copyright by Steve Mayer, nach Motiven, 2024
Korrektorat: Claudia Müller
Alle Rechte vorbehalten!
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt beim XEBAN-Verlag. Hiermit untersagen wir ausdrücklich die Nutzung unserer Texte nach §44b Urheberrechtsgesetz Absatz 2 Satz 1 und behalten uns dieses Recht selbst vor. 13.07.2023
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Zwei ritten nach Westen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Der Autor Larry Lash
Eine kleine Auswahl der Western-Romane des Autors Larry Lash
Das Buch
»Irgendwann ist für jeden von uns der Trail zu Ende. Niemand kennt den Zeitpunkt, und das ist gut so. Vielleicht war der Tote ein guter, vielleicht ein schlechter Mann. Wir wissen es nicht. Nur eins steht fest: Das hier war ein Mord!«
Bob Wharton und Sid Fanning schließen sich zusammen und reiten gemeinsam nach Westen, die Richtung, aus der der Mörder gekommen zu sein scheint. Sie sollen recht behalten. Nur ist der nun Gejagte nicht ihr einziger Gegner auf dem Weg zur vermeintlichen Gerechtigkeit, einem Weg, der gespickt ist mit Hass, Gier, Neid – und Tod …
***
Zwei ritten nach Westen
Western von Larry Lash
1. Kapitel
»Heben Sie die Hände, Stranger!«
Sid Fanning erstarrte. Kalt rann es ihm über den Rücken. Niemand wusste besser als Sid Fanning, in was für einer verfänglichen Situation er sich befand. Niemand konnte die Stimme eines Mannes besser beurteilen als er.
Er hatte bisher durch diese Fähigkeit manchen Vorteil für sich verbuchen können. Jetzt allerdings sah es nicht danach aus, als sollte es ihm noch einmal gelingen. Eine tiefe Bitterkeit überfiel ihn. Er wusste, dass er hätte vorsichtiger sein müssen.
Sid Fannings dunkle, fast schwarze Augen waren auf den Toten gerichtet, vor dem er gerade kniete. Einige Habseligkeiten hatte er ihm bereits abgenommen, aber er hatte nichts gefunden, was ihn identifiziert hätte. Das würde dem Mann in seinem Rücken gleichgültig sein, für den sich der Eindruck der Leichenfledderei geradezu aufdrängte. Sid Fanning wusste das nur zu gut.
By gosh, es war immer das Gleiche. Jeder Mann konnte ohne Verschulden in eine Situation geraten, die scheinbar gegen ihn sprach.
»Sie haben sicherlich nicht viel gefunden, Stranger?«, sagte der Mann mit einem so spöttisch kalten Ton, dass der heiße Zorn in Sid aufstieg. »Sie hätten sich nicht einen Satteltramp vornehmen sollen. Aber Sie sind wohl so schlecht dran, dass Sie sogar arme Schweine abknallen?«
Das war eine höllische Anklage, die deutlich zeigte, dass Sid die Situation richtig eingeschätzt hatte. Man hielt ihn für einen Wegelagerer und Strauchdieb, für einen hinterhältigen Killer.
»Der Mann ist bereits seit Stunden tot«, sagte Sid Fanning und zwang seine Stimme zur Ruhe. »Er liegt schon lange hier, und die Geier haben ihn so zugerichtet, dass sein Gesicht kaum zu erkennen ist. Ich konnte die Raubvögel vertreiben, aber es gelang mir nicht, diesen Toten zu identifizieren. Ich habe ihn weder ermordet noch war ich dabei, ihn auszurauben. Das ist die reine Wahrheit!« Sid hielt seine Hände in die Höhe.
Der Mann hinter ihm befahl: »Aufstehen!«
Sid befolgte den Befehl. Er würde aufatmen, wenn sich der Fremde den Toten ansehen würde und dann Sids Darstellung anerkennen musste. Doch war die Gefahr damit gebannt? Sid hatte wenig Hoffnung. In dieser Gegend hier, nahe der mexikanischen Grenze, misstraute einer dem anderen. Zu viel übles Gelichter trieb sich herum. Nein, hier vertraute man niemandem.
Aus der Mulde hörte Sid Pferdeschnauben. Sein magerer brauner Wallach meldete sich. Warum hatte das Tier nicht früher warnend geschnaubt?
»Zur Seite treten!«, forderte der Mann.
Sid kam auch diesem Befehl nach. Dabei schossen ihm eine Menge Gedanken durch den Kopf. Verzweifelt suchte er nach einem Ausweg, um sich aus der brenzligen Situation herauszuwinden. So sehr er sich auch anstrengte, er fand keine Lösung und kam schließlich zu der Überzeugung, dass es sinnlos sein würde, etwas zu unternehmen. Der andere hatte alle Trümpfe in der Hand und würde keinen Augenblick zögern, auf Sid zu feuern.
Sid Fanning war nicht lebensmüde, er wollte nicht tot hier im heißen Sand liegen. Man sah ihm seine fünfunddreißig Jahre an, und die Spuren eines harten Lebens waren nicht mehr aus seinem Gesicht zu wuschen. Das Schicksal hatte ihm nichts geschenkt. Schon früh hatte er auf eigenen Beinen stehen und sich allein behaupten müssen. Er dachte nicht gern an die Vergangenheit zurück.
»Nun?«, fragte Sid, als er einige Minuten schweigend dagestanden hatte.
»Sie scheinen mir die Wahrheit gesagt zu haben«, antwortete der Mann im Hintergrund. »Was glauben Sie wohl, wer der Mann war, vor dem Sie gekniet haben?«
»Ich habe keine Ahnung.«
»Er war ein Vertreter des Gesetzes. An der Stelle, an der der Stern saß, sieht man die Nadelstiche. Der Stern ist allerdings fort. Der Tote hat den Stern aus irgendeinem Grunde abgelegt. Jemand hat aus dem Hinterhalt geschossen und den Mann in den Kopf getroffen. Er muss auf der Stelle tot gewesen sein. Die Spur seines durchgehenden Pferdes zeigt an, dass der Mord schon vor Stunden geschehen sein muss. Die Ränder der Hufspur sind eingefallen. Deshalb glaube ich Ihren Worten und nehme an, dass Sie nicht der Mörder dieses Mannes sind. Ein Mörder bleibt nicht stundenlang bei seinem Opfer. Nehmen Sie die Hände herunter und drehen Sie sich zu mir um, Stranger!«
Sid Fanning war erleichtert. Er drehte sich um und sah sein Gegenüber scharf an. Im gleichen Augenblick wusste er, dass er einen Langreiter vor sich hatte, einen Mann, der wie er selbst schon viele Meilen geritten war. Der Wüstenstaub auf der Kleidung verriet es.
Der Fremde war etwa so groß wie Sid. Er hatte blondes Haar, das ihm bis zu den Schultern reichte. Die hellblauen Augen strahlten ein kristallenes Feuer aus. Seine Kleidung bestand aus der Ledertracht eines Waldläufers, die mit Fransen verziert war. Dazu trug er eine bunte Weste, die nicht zu der übrigen Kleidung passte. Interessanter jedoch war die Art, wie er den Colt trug. Der Fremde musste ein Revolvermann sein. Der 45er Colt steckte nicht in einem Holster, sondern in einer Lederschlinge. Das Erstaunliche war, dass der Revolver nicht in der Hand des Mannes lag, wie Sid angenommen hatte.
In dem breitflächigen Gesicht des Fremden zeigte sich etwas, was ihn Sid sympathisch machte.
»Wie soll es weitergehen?«, fragte Sid.
Der andere grinste, zuckte die Schultern und erwiderte: »Ich will Sie nicht aufhalten, Freund. Sie können reiten, wohin Sie wollen. Sie können aber auch bleiben und mir helfen, diesen Mann unter die Erde zu bringen. Für was entscheiden Sie sich?«
»Ich bleibe natürlich. Der Tote ist übel zugerichtet. Ich wäre ein Schuft, wenn ich davonreiten würde.«
Die Blicke der beiden Männer kreuzten sich. Der Fremde nickte.
»All right«, sagte er, »ich habe es mir gedacht.«
Nach diesen Worten wandte er sich ab und verschwand hinter einer Bodenwelle. Es dauerte nicht lange, als aufklingender Hufschlag seine Rückkehr verriet.
Sid Fanning holte sein Pferd aus der Mulde. Der Braune war mehr die Karikatur eines Pferdes. Im Fell des Tieres schienen die Motten gewütet und große Stellen kahlgefressen zu haben. Die Rippen zeichneten sich so deutlich ab, dass man einen Stetson an ihnen hätte aufhängen können. Das Aussehen des Pferdes aber täuschte; niemand wusste das besser als Sid. Sein Brauner konnte, wenn es sein musste, sich von Disteln und Kakteen ernähren. Er war ein richtiges Wüstenpferd, nicht sehr schnell auf kurzen Strecken, doch ausdauernd, wenn es über längere Distanz ging.
Sid dachte daran, dass der Fremde beim Anblick seines Braunen sicherlich lachen würde, doch er täuschte sich.
Der blonde Fremde tauchte mit einem Rappen auf, dessen Anblick das Herz eines Pferdekenners schneller schlagen ließ. Nicht alle Tage bekam man ein so prächtiges Tier zu sehen. Der Rappe war nicht sehr groß, aber die Proportionen waren herrlich abgestimmt. Unter dem glänzenden Fell erkannte man deutlich die unter der Haut liegenden Muskeln.
»Der nächste Bandit, bestimmt aber die nächste Bande, wird versuchen, Ihnen das Pferd abzunehmen«, sagte Sid.
»Das hat man schon versucht«, erwiderte der Blonde leichthin. »Noch vor drei Tagen. Danach musste ich mit diesem kleinen Spaten Gräber schaufeln. Blacky hat mir gegen die Bande geholfen. Einen der Kerle warf er ab und beförderte ihn mit den Hufen ins Jenseits.«
Nach diesen Worten betrachtete er Sids unscheinbaren braunen Wallach und nickte dann anerkennend.
»Ein gutes Pferd«, sagte er. »Mit so einem Pferd kann man es im Notfall schaffen. Man kann sich darauf verlassen.«
Sid zeigte sein Erstaunen nicht, doch er wusste jetzt, dass der Fremde ein Pferdekenner war. Der Mann ließ sich nicht vom äußeren Schein täuschen.
»Es ist ein ausgesprochenes Wüstenpferd«, fuhr der Fremde fort. »Woher haben Sie es?«
»Von Cochise, dem Häuptling der Chiricahua Apachen«, antwortete Sid.
Die Augen des Fremden weiteten sich. Er schwang sich aus dem Sattel und winkte Sid dann zu der Stelle, die er als Grabplatz ausgesucht hatte. Der Platz lag vor einem Kakteenfeld.
»Hier ist etwas Schatten«, sagte der Fremde und blickte zur Sonne, die mit unbarmherziger Glut auf die Erde brannte.
Der Wind kam aus Süden. Er wehte Fahnen von Sand hoch, die ihnen in die Gesichter peitschten.
»In vier Stunden bekommen wir einen Sandsturm«, stellte der Fremde fest und begann mit dem Ausheben des Grabes. »Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich mich vorstelle. Ich heiße Wharton, Bob Wharton.«
»Ich bin Sid Fanning und stamme aus Texas, aus dem Panhandle.«
»Ihre gedehnte Sprechweise verriet es bereits«, erwiderte Bob Wharton. »Ich komme aus Montana, doch ich habe das Land seit zwanzig Jahren nicht mehr gesehen. Ich habe bei der Eisenbahn gearbeitet, bei der Pacific Union. Nach dem Krieg wurde ich heimatlos. Zu der Zeit scheinen Sie Cowboy gewesen zu sein, nach den Lassonarben an Ihren Händen zu urteilen.«
»Das ist schon Jahre her«, sagte Sid, der sich immer mehr zu dem Fremden hingezogen fühlte. »Damals hatten die Apachen das Land meines Vaters noch nicht verwüstet. Als er starb und die Ranch niedergebrannt war, versuchte ich ihn zu rächen. Dabei drang ich ins Chiricahua-Lager ein, doch dann war ich am Ende. Man stellte mich, doch ich bekam eine Chance. Ich musste gegen einen Krieger kämpfen, den Cochise aussuchte. Ich hatte Glück, ich erhielt meine Freiheit wieder und den Braunen dazu.«
Sie beerdigten den Toten.
»Möge er seinen Frieden finden«, sagte Bob Wharton. »Irgendwann ist für jeden von uns der Trail zu Ende. Niemand kennt den Zeitpunkt, und das ist gut so. Vielleicht war der Tote ein guter, vielleicht ein schlechter Mann. Wir wissen es nicht. Nur eins steht fest: Das hier war ein Mord!«
Sid Fanning nickte.
Das Grab war schnell zugeschaufelt. Ein kleiner Hügel wölbte sich auf. Die beiden Männer sahen auf das Grab, in dem ein Unbekannter ruhte. Keiner von ihnen wusste, woher er kam und wer ihn vermissen würde. Es bedrückte sie aber beide, dass ein Mann so enden musste, hinterrücks erschossen und liegengelassen wie ein Tier.
»Gehen wir«, sagte Bob Wharton. »Suchen wir uns eine Stelle, die uns einigen Schutz vor dem Sandsturm gewährt. Wir müssen die Vulkanfelsen erreichen. Von dort ist es nicht mehr weit zu den Ansiedlungen. Reiten wir nach Westen!«
»Ich reite seit Wochen nach Westen«, erwiderte Sid.
»Es ist auch seit Wochen die Richtung, in der ich reite«, erklärte Wharton. »Sie sagen mir nichts Neues, denn seit Tagen bewege ich mich auf Ihrer Fährte und beobachtete Ihre Lagerfeuer in den einsamen Camps. Bevor wir reiten, schauen wir uns aber den Hinterhalt einmal gründlich an. Vielleicht entdecken wir an der Stelle etwas, von der aus der Mörder schoss.«
Sid war einverstanden. Es war leicht, den Platz zwischen den Kakteen zu finden. Einige leere Patronenhülsen lagen herum. Es war Winchestermunition. Die Spuren von Mokassins waren an dieser Stelle deutlich zu erkennen.
»Indianer?«, fragte Sid.
»Nein«, erwiderte Bob. »Indianer haben die Fußspitzen nach innen gerichtet, diese hier zeigen nach außen. Ein Weißer trug indianische Fußbekleidung. Es gibt viele Weiße, die dieses leichte Schuhwerk bevorzugen. Die Fährte ist kein echter Hinweis. – Haben Sie etwas Besonderes entdeckt?«, fragte er, als Sid sich plötzlich bückte und etwas vom Boden aufhob. Gemeinsam betrachteten sie den Gegenstand, den Sid in der Hand hielt.
»Es ist eine silberne Zigarrenspitze«, stellte Bob Wharton fest. »Wer sich die leisten kann, hat Geld, eine Menge Geld sogar. Ich glaube, die Fährte wird heiß.«
Die beiden Männer schwangen sich in die Sättel und ritten an. Der heiße Wind blies jetzt stärker. Die Hitze setzte ihnen mächtig zu. Sie mieden die dornenstarrenden Kakteenfelder. Die Hufe der Pferde wirbelten den gelbroten Staub der Wüste auf. Der feine Sand war überall, er drang in Mund, Augen und Ohren, setzte sich in der Kleidung und im Fell der Pferde fest.
Die beiden Männer durchritten einen Arroyo und sahen dann die Vulkanberge vor sich. Die Lavahügel leuchteten rot, blau und schwarz und bildeten einen seltsamen Farbenkontrast vor dem stahlblauen Himmel.
Hoch in den Lüften zogen Geier ihre Kreise. Ihr Gekreisch war deutlich zu hören.
Der Ritt ging durch ein Tal, in dem es windstill zu sein schien. Man hörte nur das Quietschen des Sattelleders und das Mahlen der Pferdehufe im Sand. Schwer lastete die Stille auf den beiden Männern, doch beide waren diese unheimliche Ruhe gewöhnt. Sie sprachen kein Wort. Mit jeder Meile, die sie zusammen ritten, schienen sie miteinander vertrauter zu werden. Sie ritten auf einer Fährte, auf der des Mörders und seines Opfers. Längst hatten sie entdeckt, dass der Mörder das Pferd des Toten eingefangen und mitgenommen hatte. Die Spur führte nach Westen. Sie war nur undeutlich zu erkennen. Der vom Wind aufgewirbelte Sand würde sie bald ganz auslöschen, noch bevor der Sandsturm einsetzte.
Keinen Moment zu früh erreichten sie die Vulkanhügel. Kaum hatten sie sich und ihre Pferde auf den Sturm vorbereitet, als er auch schon mit einem seltsamen Laut losbrach, der bis ins Mark drang. Eine Wolke aus rotgelbem Staub richtete sich wie eine Wand auf und wurde größer und größer.
»Halten wir die Ohren steif, Partner«, sagte Sid. »Hoffentlich begräbt uns der Sand nicht lebendig.«
Bob Wharton grinste nur. Er sagte kein Wort, doch auf seinem Gesicht lag eine feste Zuversicht.
2. Kapitel
Gegen Abend war der Sandsturm vorüber. Sie hatten ihn gut überstanden und konnten den Ritt fortsetzen. Bei Einbruch der Dunkelheit ließ die Hitze merklich nach. Das Reiten war jetzt weitaus angenehmer als in der Glut des Tages.
Schon bald tauchten Hügelausläufer auf. Spärlicher Pflanzenwuchs zeigte sich. Die beiden Reiter sahen sich um. Sie wussten, dass sie die Durststrecke durch die Wüste jetzt hinter sich hatten und ins Rinderland kamen. Weit im Hintergrund hoben sich die Gebirgsketten der Sangre de Christo Range Mountains ab. Ihre Rücken wuchsen in den Nachthimmel hinein. Die kühle, trockene Luft trug leichten Harzgeruch mit sich. Sicherlich waren Wälder in der Nähe, die schattige Kühle verbreiteten.
Noch bevor es Mitternacht wurde, erreichten die beiden Reiter das Rinderland. Ein Stacheldrahtzaun hielt sie auf. Verwundert stoppten sie ihre Pferde.
Sid Fanning beugte sich im Sattel vor. Die Augenlider verengten sich zu schmalen Schlitzen. Von seinen Lippen kam ein leiser Pfiff. Seine Augen wanderten den Zaun entlang, der nicht nur den Weg versperrte, sondern endlos zu sein schien.
Bob Wharton, sein jüngerer Begleiter, strich sich mit einer schnellen Handbewegung sein Haar aus dem Gesicht. Er zuckte die Schultern.
»Zäune bereiten immer Kummer«, sagte er leise wie zu sich selbst. »Wer Zäune aufstellt, fordert ihn geradezu heraus. Stacheldraht und Absperrungen sind ein Zeichen für Fehden. Manch einer wird sein Leben dabei lassen. Aber was geht uns das an. Reiten wir weiter!«
Bob Wharton setzte seinen Rappen wieder in Bewegung, und Sid Fanning folgte ihm.
Ihr Weg führte jetzt am Stacheldrahtzaun entlang. Das war beiden Männern sichtlich unangenehm. Sie waren es nicht gewohnt, dass ein abgegrenztes und eingezäuntes Gebiet sie am freien Reiten hinderte. Mit einem Schlag hatten beide ihren Gleichmut verloren. In gewissen Abständen entdeckten sie am Zaun entlang Tauchgruben, die mit Wasser gefüllt waren und nach Desinfektionsmitteln rochen. Am Rande einer Tauchgrube hielten sie an.
»Verstehst du das, Freund?«, fragte Sid Fanning seinen Begleiter.
Bob Wharton lachte leise in sich hinein. Die beiden Männer waren sich während des Rittes nähergekommen und hatten das steife »Sie« abgelegt.
»Ein Mann, der wie du aus dem Süden kommt, kennt so etwas nicht«, sagte Bob erklärend. »Eure texanischen Rinder sind in der Regel gegen die Zecke immun. Zeckenbehaftete Rinder sind für Leute aus deiner Gegend kaum beachtenswert. Ihr findet nichts dabei, denn daran sterben eure Rinder nicht. Das trifft sowohl für Texasrinder als auch für Rinder aus dem Chiricahua-Land zu, es kommen noch die mexikanischen Rinder hinzu. Bei Tieren der wertvolleren Fleischrassen ist das anders. Bei ihnen kann die Zecke ganze Herden vernichten. Dieser Zaun hier ist nichts weiter als ein Schutzzaun, um zeckenverseuchte Rinderherden fernzuhalten. An seiner Länge ist zu erkennen, dass er nicht von einem Rancher allein errichtet wurde. Das bestätigen auch die vielen Tauchgruben längs des Zaunes. Sicherlich werden wir bald auf bewachte Einlässe stoßen.«
Schon nach kurzem Ritt wurde den beiden Männern ein scharfes »Halt!« zugerufen. Gewehrläufe schoben sich über einen Muldenrand hinter dem Stacheldrahtzaun. Eine heisere Stimme forderte sie auf, näher heranzureiten. Sie folgten der Aufforderung und ritten ins helle Mondlicht hinein.
»Sie sind es nicht, Dan«, sagte jemand. »Das sind keine Reiter von Kid Slover.«
»Sag das nicht, Johnny. Slover kann neue Kerle angeworben haben. Er wird noch einmal versuchen wollen, durch den Zaun zu brechen.«
»Zum Teufel, Sheriff Murky hat sich auf Slovers Fährte gesetzt, und ich glaube, dass Slover es nicht noch einmal wagen wird, hierherzukommen.«
»Das werden wir später sehen, vielleicht erst nach Monaten, wenn er seine Treibherde nach Montana geschafft hat und wieder zurückkommt. Jedenfalls ist es Sheriff Murky gelungen, Slover vom Zaun abzudrängen. – Kommt näher!«, wurden Sid Fanning und Bob Wharton aufgefordert. »Wohin geht die Reise?«
Die beiden Männer blieben in ihrer Deckung. Bob wunderte sich, dass sie ihnen nicht befohlen hatten, die Hände zu heben. Bestimmt waren die Männer in der Mulde keine Greenhorns und hatten an den mit Wüstenstaub bedeckten Reitern und Pferden erkannt, dass sie nicht zu Slovers Mannschaft gehören konnten. Slover war mit seiner Herde aus nördlicher Richtung gekommen und nicht aus der Wüste. Slover und seine Leute hatten keinen Wüstenstaub in der Kleidung gehabt.
Bob Wharton hob sich in den Steigbügeln und gab Auskunft nach dem Ziel ihrer Reise.
»Wir reiten überallhin, wo es etwas zu sehen gibt, und halten uns von Orten fern, wo es nach Verdruss riecht. Mein Partner und ich sehnen uns nach Ruhe. Wir suchen eine Gegend, die still und friedlich ist.«
Leises Lachen ertönte. Der Mann, der Johnny hieß, sagte: »Dann müsst ihr sehr weit reiten, Gents, für meine Begriffe bis ans Ende der Welt. Wenn ihr aber einen Job haben wollt, den könnt ihr hierzulande finden.«
Die beiden Partner sahen sich an. Jeder schien die Gedanken des anderen lesen zu können. Trotz des kurzen Beisammenseins verstanden sie sich ausgezeichnet. Man hätte meinen können, dass sie schon seit Jahren Bügel an Bügel ritten.
»Lasst hören«, forderte Sid den Sprecher auf, der sich mit seinem Begleiter aus der Deckung der Mulden erhob und jetzt sichtbar wurde.
Die beiden Männer waren nicht mehr jung. Beide waren grauhaarig und mochten ihre sechzig Jahre auf dem Buckel haben. Man sah ihnen an, dass sie schon von Jugend an als Cowboys gearbeitet hatten und sich in ihrem Fach auskannten. Die Mündungen ihrer Waffen zeigten nach unten.
»Für zwei Männer, die aus der Wüste kommen und ihre Eisen so tief geschnallt tragen, hat Sheriff Murky sicherlich einen Job«, sagte Johnny, der größere der beiden Männer. »Ich für meinen Teil hätte nichts dagegen, wenn die Wachpostenmannschaft durch euch abgelöst würde. Ich trete gern aus diesem Geschäft aus. Ich schätze, dass du nicht anders denkst, Dan?