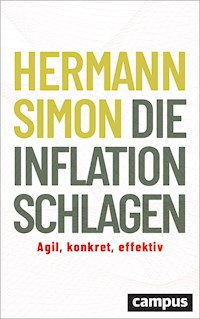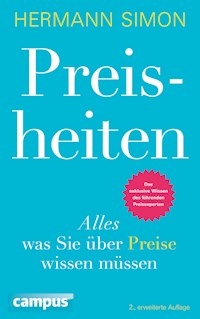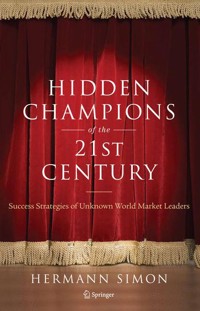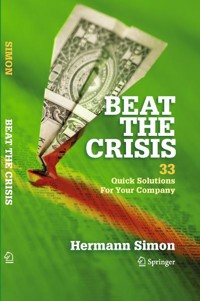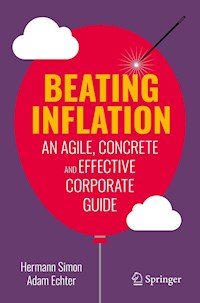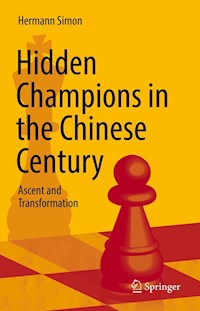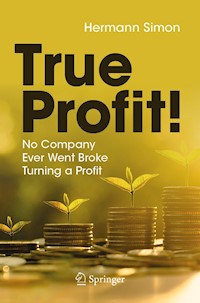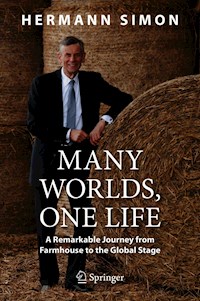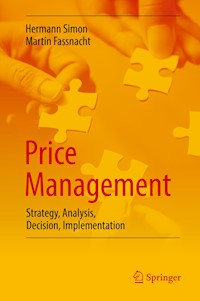Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Vom Bauernhof zum Global Business Hermann Simon, geboren 1947, weltweit gefragter Managementdenker, Entdecker der "Hidden Champions", erfolgreicher Unternehmer und Pricing-Experte, entdeckte sein Interesse an Preisen schon als Kind: in der elterlichen Landwirtschaft und auf dem Schweinemarkt. Seine Lebensgeschichte beginnt auf einem deutschen Bauernhof - und führt ihn in die Topliga des internationalen Managements. In seiner Autobiografie erzählt Hermann Simon diesen außergewöhnlichen Weg vom Eifelkind zum Global Player, und wie es ihm gelang, innerhalb weniger Jahrzehnte mit seiner Firma Simon-Kucher & Partners zum Weltmarktführer für Preisberatung mit 37 Büros in 24 Ländern zu werden und ganz nebenbei die Bahncard zu erfinden. Eine persönliche Lebensgeschichte und der beeindruckende Erfolgsbericht eines Wanderers zwischen den Welten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HERMANN SIMON
ZWEI WELTEN, EIN LEBEN
Vom Eifelkind zum Global Player
Campus Verlag
Frankfurt/New York
Über das Buch
Hermann Simon, geboren 1947, international gefragter Managementvordenker, erfolgreicher Unternehmer und Pricing-Spezialist, entdeckte sein Interesse an Preisen schon als Kind: in der elterlichen Landwirtschaft und auf dem Schweinemarkt. Seine Lebensgeschichte beginnt typisch auf einem deutschen Bauerndorf - und mündet sehr ungewöhnlich in eine große Wirtschaftskarriere.
Als Entdecker der »Hidden Champions«, der unbekannten Weltmarktführer, hat er in wenigen Jahrzehnten selbst die international erfolgreichste deutsche Beratung aufgebaut: Simon-Kucher & Partners mit Sitz in Bonn ist heute der Weltmarktführer für Preismanagement – vertreten an 36 Standorten in Europa, den USA, Asien, Südamerika, Kanada, Australien … Und nebenbei hat die Firma Anfang der 1990er-Jahre auch die Bahncard erfunden.
Hermann Simon, der Wanderer zwischen den Welten, erzählt in seiner Autobiografie lebensnah von seinem Weg in die Topliga des Managements. Eine persönliche Lebensund eine beeindruckende Erfolgsgeschichte.
Vita
Hermann Simon, Jahrgang 1947, zählt als erster und einziger Deutscher zu den »Thinkers50«, den 50 führenden Managementdenkern der Welt. Im deutschsprachigen Raum gilt er, der Entdecker des »Hidden Champions«-Konzepts, als der einflussreichste lebende Managementvordenker.
Hermann Simon war Professor für Marketing an den Universitäten Bielefeld und Mainz, bevor er – nach Stationen in Harvard und Stanford, an MIT und INSEAD, der Keiō University in Tokio und der London Business School – 1985 Simon-Kucher & Partners gründete. Heute ist das Beratungsunternehmen, dessen CEO er bis 2009 war, der Weltmarktführer für Preismanagement.
Simon ist international gefragter Vortragsredner sowie Autor zahlreicher Bücher, die in 26 Sprachen übersetzt wurden. Bei Campus erschienen unter anderem »Hidden Champions – Aufbruch nach Globalia« (2012, 3. Auflage) und »Preisheiten« (2015, 2. Auflage).
INHALT
VORWORT
1. WURZELN
Aus Raum und Zeit
Durch Jahrhunderte
Westen, Warschau und Rückkehr
Europa: Schicksal und Patria Nostra
Eifel
Das Band der Sprache
2. DIE WELT, IN DER ICH AUFWUCHS
Gruß aus dem Mittelalter
Aus der »Heimat Erde«
Acht Jahrgänge, eine Klasse
Entscheidung am Morgen
Gymnasium
Grenzen sprengen
3. JAHRE DES DONNERS
Der geplatzte Traum
Luftwaffe
Tödliche Kerze
Die Banalität der Bombe
Absturz
Über den Wolken – später
4. VOM ERNST DES LEBENS
Studienjahre sind keine Herrenjahre
Assistentenzeit
Forschung
Venia Legendi
5. ZAUNGAST DER POLITIK
Politik im Blut
Sturm auf die Donauhalle
Gegen die Notstandsgesetze
Bundestagswahl 1969
Politischer Student
Heimspiel
Kampf gegen Windräder
Stiftungen
Kleine Wahlhilfe
6. HINAUS IN DIE WELT
Goin’ to Massachusetts – ans MIT
Fontainebleau
Japanische Episode
Ans Ende der Welt – Papua-Neuguinea
Das große Schweineschlachten
Der entlegenste Ort
Die »Kinder« von Papua
Die Missionare
Zwei Jahreswechsel an einem Tag
If you’re going to San Francisco
Comin’ back to Massachusetts – nach Harvard
Südafrika
Business-School-Netzwerke
7. UNIVERSITÄT UND WASSERSCHLOSS
Seh’n wir uns nicht in dieser Welt …
Schlossherr
Schloss Gracht und seine Netzwerke
Zu Gast bei Johannes Gutenberg
Deutsche Marketingwissenschaft international
Autorenschaft
Aufsichtsrat
Verlockende Angebote
8. DER PREISE SPIEL
Preisheiten
Der Schweinepreis
Der Preis als Wegbegleiter
Pretium
Am Anfang der Preis
Preismacht
Vormarsch der Preise
Mein Weg zum Preis im Überblick
9. HIDDEN CHAMPIONS
Einheit von Person und Aufgabe
Fokussierte Zielstrebigkeit
Furchtlosigkeit
Vitalität und Ausdauer
Inspiration von anderen
Internationale Ausgaben der Hidden-Champions-Bücher
10. AUF ADLERS FLÜGELN
Mühsam nährt sich das Eichhörnchen
Preisrat
Vision und Führung
Internationalisierung
Geistkapital versus Finanzkapital
Jenseits der Kommandobrücke
Auf fremden Feldern
Traveling Poet
11. BEGEGNUNGEN
Peter Drucker
Herman the German
Ted Levitt
Joseph Kardinal Höffner
Philip Kotler
Marvin Bower
Hans Riegel
Tomohiro Nakada
Yang Shuren
Miky Lee
12. STERNSTUNDEN
Von der Unfähigkeit zu prognostizieren
Wiederkehr jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger
Erscheinung eines Ahnen
Überfahrt nach Afrika
Nine Eleven
Moskauer Nächte
Ruhigstellung
Wenn die Erde bebt
Im Jahre Vierzigtausend
13. SCHULE DES LEBENS
Rückendeckung wertschätzen
Sich heute nicht sorgen
Gesundheit leben
Bodenständig bleiben
Keep it simple stupid: das KISS-Prinzip
Ambivalent führen
Zeit rationieren
Juristen meiden
Kleine Weisheiten
EPILOG
ANMERKUNGEN
1. Wurzeln
2. Die Welt, in der ich aufwuchs
3. Jahre des Donners
4. Vom Ernst des Lebens
5. Zaungast der Politik
6. Hinaus in die Welt
7. Universität und Wasserschloss
8. Der Preise Spiel
9. Hidden Champion
10. Auf Adlers Flügeln
11. Begegnungen
12. Sternstunden
13. Schule des Lebens
Epilog
REGISTER
VORWORT
Die gefühlte Mitte des Lebens soll einer amerikanischen Publikation zufolge bei 18 Jahren liegen. Das heißt, grob gerechnet kommen dem Menschen die ersten zwei Jahrzehnte subjektiv genauso lange vor wie der Rest seines Lebens. Für mich persönlich kann ich diese Hypothese tendenziell bestätigen. Bis kurz vor meinem 20. Geburtstag lebte ich in einem kleinen Dorf in der Eifel. Das war meine erste Welt, in der die Zeit sehr langsam verging. In den folgenden 50 Jahren änderte sich mein Leben radikal. Es spielte sich in der großen, weiten Welt ab, die ich später »Globalia« nannte. In dieser meiner zweiten Welt verflog die Zeit immer schneller, sodass ich den Eindruck habe, in meiner ersten und in meiner zweiten Welt etwa gleich lange gelebt zu haben.
»Zwei Welten, ein Leben« soll diese Spannung zum Ausdruck bringen. Meine Entwicklung vom Eifelkind zum Global Player war mir nicht in die Wiege gelegt. Es lag ihr auch kein Plan zugrunde. Vielmehr entstand sie Schritt für Schritt. Glück und Zufälle spielten eine große Rolle. Immer wieder gab es Weggabelungen, an denen sich mir eine Chance bot. Meistens habe ich zugegriffen, wobei die Ermunterung meiner Frau Cäcilia oft eine entscheidende Rolle spielte. »Natürlich machst du das«, lautete ihr Urteil, und dann geschah es so. Auch meine Kinder Jeannine und Patrick spielten mit, wenn wir sie durch die Welt schleppten oder der Vater ständig auf Achse war. Ich danke allen dreien für ihren unschätzbaren Beitrag zu dem, was ich werden durfte.
In den frühen Jahrzehnten meiner beruflichen Karriere orientierte ich mich primär an der westlichen Welt, vor allem an Amerika sowie an europäischen Business-Schools. Aber schon in den achtziger Jahren zeitigte ein Aufenthalt in Japan prägende Wirkungen. Später wurden asiatische Länder, insbesondere China, Korea und Japan, für mich zunehmend interessant und wichtig. Asien entwickelte sich zu einer späten Liebe.
Trotz meiner Rolle als Global Player bin ich meiner Eifelheimat eng verbunden geblieben. Ich glaube sagen zu können, dass ich meine Wurzeln nicht verloren und meine Bodenständigkeit behalten habe. Wann immer ich der globalen Industriegesellschaft entfliehen will, kehre ich zurück in mein Heimatdorf, lebe in unserem alten Bauernhaus und werde wieder zum Eifelkind. Die Polarität von Eifelkind und Global Player schien auch zu meinem 70. Geburtstag im Februar 2017 durch. Meine Familie bereitete mir zwei Überraschungen, die mich emotional sehr berührten. Die erste war für das Eifelkind, nämlich ein Auftritt von drei Gesangvereinen aus meiner Heimat mit 70 Sängern. Die zweite sprach den Global Player an. Es waren 25 Videobotschaften von Weggefährten aus zwölf Ländern. Global Player und Eifelkind sind für mich nicht unvereinbar, sondern die zwei Seiten meines Lebens.
Hermann Simon, im Sommer 2018
1. WURZELN
Aus Raum und Zeit
Wer hat sich nicht schon die Frage gestellt: »Woher komme ich?« Die Antwort auf diese Frage hat eine räumliche und eine zeitliche Dimension. Ich komme aus einem bestimmten Raum und einer bestimmten Zeit. Das Bauernhaus, in dem ich das Licht der Welt erblickte, liegt fern der großen Zentren im früheren »Sibirien Preußens«, weit draußen in der Eifel. Diese herbe Landschaft hat mich geprägt und markante Spuren in mir hinterlassen. Bis heute erkennen Kundige diese Herkunft an meiner Sprache. Oft frage ich Menschen, denen ich zum ersten Mal begegne, woher sie stammen und wo sie aufgewachsen sind. In einem Interview antwortete der ehemalige Finanzminister Theo Waigel auf die Frage »Wie gelang es Helmut Kohl, Staatsgäste für sich einzunehmen?« wie folgt: »Das war eine Kunst. Er fragte: Wo kommst du her, was haben deine Eltern gemacht, wie ist dein Leben verlaufen?«.1 Die Frage der räumlichen Wurzeln eines Menschen interessiert mich, weil ich selbst räumlich verwurzelt bin. Wenn ich mich für einige Stunden oder Tage aus der globalen Industriegesellschaft ausklinken will, kehre ich an den Ort meiner Kindheit zurück.
Komme ich auch aus der Zeit? Mein Eintritt in die Welt ereignete sich an einem Montag, dem 10. Februar 1947, um 2 Uhr. Den Status eines Sonntagskindes verpasste ich um zwei Stunden. Wie jedes Lebewesen bin ich Glied einer unendlichen Kette von Vorfahren. Jeden von uns gibt es nur, weil diese Kette niemals abgerissen ist. Dieser Gedanke ist natürlich nicht neu. Schon Seneca sagte: »Beruft man sich auf die Vergangenheit, so gibt es niemanden, der nicht aus einer Zeit stammte, vor der es überhaupt nichts gibt. Vom ersten Ursprung der Welt bis in unsere Zeit erstreckt sich unsere Ahnenreihe.« Der Historiker Michael Wolffson widmet das Buch zur Geschichte seiner Familie den »Ahnen – sie prägen uns mehr, als wir ahnen«.2 Sebastian Kleinschmidt schreibt in der FAZ, inspiriert von einem Gedicht von Ulrich Schacht: »Woher wir kommen, das ist mehr als eine historische oder genealogische Frage. Sie hat etwas Philosophisches. Und da man nicht weiß, was man letztlich darauf antworten soll, spürt man das Irritierende daran. Etwas Rätselhaftes, zutiefst Unbestimmtes ist in das Fundament unserer Existenz gegossen.«3 Unsere Gene transportieren die geronnenen Entwicklungen und Erfahrungen der endlos zurückreichenden Ahnenreihe. Wir kommen aus der Tiefe der Zeit. Erziehung und Umfeld schaffen auf dieser Grundlage Prägungen, die uns lebenslang begleiten.
Menschen in anderen Kulturen glauben an umfassendere Verbindungen in die Vergangenheit. Auf einer Indienreise las ich in einem Buch über Reinkarnation, dass die Seelen von Verstorbenen aus dem Wartezustand zwischen zwei Leben bevorzugt in die nächstgeborenen Kinder der eigenen Familie zurückkehren. Die Seelen zögen es vor, in der Familie zu bleiben. Die Reinkarnationslehre erklärt Ängste im jetzigen Leben aus Erfahrungen früherer Leben. Wer Angst vor Wasser hat, sei in einem früheren Leben ertrunken. Ich habe Angst vor Wasser, vor allem vor tiefem Wasser. Ich kann nicht gut schwimmen. Doch ist die Zahl derer, die ertrunken sind, nicht viel geringer als die Zahl derer, die Angst vor tiefem Wasser haben?4 Die Theorie von der Rückkehr der Seelen in die eigene Familie brachte mich auf einen seltsamen Gedanken. Der Letzte aus unserer Familie, der vor meiner Geburt die Welt verlassen hatte, war in der Tat ertrunken. Und zwar im Schwarzen Meer. Nachdem er Jahre lebensbedrohlicher Gefahren in Russland überstanden hatte, schien er endlich gerettet. Er war in Sewastopol an Bord eines Schiffes gegangen, das die deutschen Soldaten in Sicherheit bringen sollte. Doch dann wurde das Schiff von russischen Granaten getroffen und sank. Das geschah im Mai 1944. Erst acht Jahre später erfuhren wir von diesem tragischen Ende. Im Jahre 1952 erreichte uns die Nachricht vom Suchdienst des Roten Kreuzes, dass ein Kamerad meinen Onkel Jakob Simon beim Besteigen des Schiffes, das anschließend versenkt wurde, gesehen hatte. Jakob Simon wurde für tot erklärt, und es wurde seiner in einer Trauerfeier in der Eifel gedacht. Er war der letzte Familienangehörige, der vor meiner Geburt starb.
Doch es kam noch mehr heraus. Später erinnerte sich Cäcilia, meine Frau, mit der ich in Indien meine Gedanken zu Reinkarnation und Angst vor dem Wasser geteilt hatte, an ein fast 150 Jahre zurückliegendes Ereignis: »Dein Onkel Jakob ist nicht der einzige aus eurer Familie, der ertrank. Hast du vergessen, was deinem Urgroßvater in Paris widerfahren ist?« Mein Urgroßvater Andreas Nilles stammte aus Lothringen, das bis 1871 zu Frankreich gehörte. Er bekam eine Stelle als Briefträger in Paris und zog mit seiner Frau dorthin. Kurz nach der Geburt des ersten Sohnes Johannes am 18. November 1875 wurde er überfallen und in die Seine geworfen, wo er ertrank. Seine Witwe zog zu ihrer Familie nach Lothringen zurück, das seit dem Krieg von 1870/71 wieder zu Deutschland gehörte.
Zwei Familienangehörige, die ertranken, und ich, der Nachfahre, der Angst vor tiefem Wasser hat. Ist das Zufall? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht sagen, dass ich an Reinkarnation glaube. Aber ich kenne viele Asiaten, die davon überzeugt sind. Und welche Gründe soll es geben, diese Lehre für weniger plausibel zu halten als den christlichen Glauben an ein Leben nach dem Tod?
Später las ich ein weiteres Buch über das Leben danach und die Reinkarnation, The Tibetan Book of the Dead, bearbeitet von Robert Thurman.5 Es fiel mir bei einem Besuch der Bibliothek meines langjährigen Freundes Professor Pil Hwa Yoo in Seoul, der Hauptstadt Südkoreas, ins Auge. Pil Yoo ist Betriebswirt mit einem MBA der Northwestern University und einem Doktorgrad der Harvard Business School. Doch seine wahre Liebe gilt der Philosophie. Er spricht sechs Sprachen und hat alle bedeutenden Philosophen im Original gelesen. Robert Thurman bin ich nur einmal begegnet, aber diese Begegnung hat Eindruck hinterlassen.
Es geschah in der Alpine University, dem Weiterbildungszentrum von McKinsey in Kitzbühel. Ich kam um etwa 20 Uhr dort an, hatte noch nichts gegessen und ging ins Restaurant. Dort saß einsam ein Gast, der wie ich spät eingetroffen war. Da ich ihn flüchtig kannte, fragte ich, ob ich mich zu ihm setzen dürfe. Er hieß mich willkommen, wir aßen gemeinsam und kamen ins Gespräch. Nach etwa einer Stunde, es dürfte kurz nach 21 Uhr gewesen sein, betrat ein weiterer Besucher das Gastzimmer und gesellte sich zu uns. Da er Amerikaner war, wechselten wir ins Englische. Meine beiden Tischgenossen entdeckten schnell Gemeinsamkeiten, und es entspann sich eine Diskussion, die bis nach Mitternacht währte. Ich war dabei mehr Zaungast als aktiver Diskutant. Nur ab und zu stellte ich eine Frage. Die beiden waren Reinhold Messner und Robert Thurman. Nach einem Unfall, bei dem er ein Auge verlor, ging Robert Thurman Anfang der sechziger Jahre nach Tibet und wurde der erste buddhistische Mönch mit westlichen Wurzeln. Während dieser Zeit studierte er zusammen mit dem Dalai Lama, mit dem er bis heute eng befreundet ist. Nach Amerika zurückgekehrt gab er sein Mönchtum auf und wurde Professor für buddhistische Studien an der Columbia University in New York. Zusammen mit dem Schauspieler Richard Gere gründete er das Tibet House in New York. Die bekannte Schauspielerin Uma Thurman ist seine Tochter.
Mit Reinhold Messner, der eng mit Tibet und dem Himalaya verbunden ist, und Robert Thurman trafen zwei verwandte Seelen aufeinander. Und so lauschte ich ihrer Diskussion über Reinkarnation und buddhistische Lehre. Das von Thurman bearbeitete und herausgegebene Tibetan Book of the Dead vermittelt detaillierte Vorstellungen darüber, wie die Übergänge von früheren zu neuen Leben aussehen. Komme ich also aus der Tiefe der Zeit? Ich weiß es heute genauso wenig wie vor 20 Jahren. Doch seltsam sind manche Dinge schon. Warum habe ich Angst vor dem Wasser? Selbst hatte ich nie bewusste Angsterlebnisse, die mit Wasser zu tun haben. Und warum erschien mir mein Onkel Jakob, den ich nie gesehen habe, in ungewohnter Klarheit im Traum?
Durch Jahrhunderte
Unsere Vorstellung vom Raum ist konkreter als unsere Vorstellung von der Zeit. »Was ist die Zeit?«, rätselte schon Augustinus von Hippo und fand als Antwort nur: »Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es, aber soll ich sie einem Fragenden erklären, weiß ich es nicht.« Albert Einstein war pragmatischer und definierte einfach: »Zeit ist, was die Uhr anzeigt.« Heinrich Heine mahnte Mitte des 19. Jahrhunderts, dass die »Elemente von Raum und Zeit schwankend geworden sind. Durch die Eisenbahn wird der Raum getötet, und es bleibt uns nur noch die Zeit.« Henri Bergson zufolge begreifen wir nur den Raum, nicht jedoch die Zeit. Den Raum beschreiben wir als kurz, lang, weit, hoch oder ähnlich. Genauso die Zeit: Wir sprechen von der Kürze des Lebens, von langen Zeiträumen, von weit zurückliegenden Ereignissen oder sagen »es ist höchste Zeit«. In unserer Sprache werden Raum und Zeit mit den gleichen Adjektiven belegt. Der Mathematiker Kurt Gödel sagte: »The world is a space, not a time.«6 Der amerikanische Philosoph Ralph Waldo Emerson versteht Raum und Zeit als eine Art Einheit, wenn er sagt: »Das Gefühl des Seins ist nicht unterschieden von Raum und Zeit und strömt offenbar aus derselben Quelle, aus der Leben und Dasein quillt.«7 Am pointiertesten aber hat Karl Valentin den Zusammenhang von Raum und Zeit auf einen Nenner gebracht: »Ich weiß nicht mehr genau, war das gestern, oder war’s im vierten Stock?« Jedenfalls verwundert es nicht, dass sich mir der Raum, aus dem ich stamme, wesentlich konkreter darstellt als die Zeit, der ich entwachsen bin.
Meinen Weg habe ich gleichermaßen in räumlicher wie zeitlicher Dimension hinter mich gebracht. In früheren Jahrhunderten hat ein Bauer in seinem Leben vielleicht 10 000 Kilometer zurückgelegt. Er ging aufs Feld, gelegentlich in die Stadt, um Besorgungen zu machen oder seine Erzeugnisse auf dem Markt feilzubieten. Einmal im Jahr unternahm er eine Pilgerfahrt zu einem weiter entfernten Wallfahrtsort. Die Distanzen, die er zurücklegte, waren kurz. Nur wenn er in den Krieg zog oder ungewöhnliche Pilgerfahrten unternahm, überwand er größere Entfernungen. In der Summe des Lebens kamen so wenige Tausend Kilometer zusammen. Selbst der Soldat Johann Peter Forens aus meiner Heimat, der mit Napoleon durch ganz Europa zog und in vielen Kriegen kämpfte, soll in seinem Leben »nur« 14 000 Kilometer zurückgelegt haben. Die 72. Division, die ursprünglich in Trier stationiert war, und im Zweiten Weltkrieg an allen Fronten kämpfte, überwand 4 000 Kilometer zu Fuß.8
Heute reisen wir je nach Verkehrsmittel 30 bis 150 Mal schneller als unsere Vorfahren. Zu Fuß schafft man rund 5 Kilometer pro Stunde, ein Auto fährt in dieser Zeitspanne 100 Kilometer, ein Hochgeschwindigkeitszug 300 Kilometer und ein modernes Düsenflugzeug überwindet in derselben Zeit 900 Kilometer. Die Entfernung zwischen Frankfurt am Main und dem Wallfahrtsort Santiago de Compostela beträgt 2 045 Kilometer. Wer als Pilger 30 Kilometer pro Tag schafft, braucht ohne Ruhetage für diese Strecke 68 Tage. Die Flugzeit beträgt zweieinhalb Stunden. Das ist 1/652 der 68 Tage des Fußpilgers. In wenigen Tagen legen wir Distanzen zurück, für die früher ein Leben benötigt wurde. Heute fliege ich zu einem Vortrag nach Beijing, bin in zwei Tagen wieder in Frankfurt und habe 15 578 Kilometer überwunden. Oder ich reise in etwa 20 Stunden nach Sydney, das sind in einer Richtung 16 501 Kilometer. Meine schnellste Reise um die Welt absolvierte ich in sieben Tagen (Frankfurt – New York – San Francisco – Seoul – Frankfurt), in der Summe 27 922 Kilometer. Die in meinem Leben zurückgelegten Distanzen summieren sich auf mehrere Millionen Kilometer. Das hätte in früheren Zeiten für viele Generationen, ja für Jahrhunderte ausgereicht. Mein Weg hat mich in Kilometern oder Meilen gemessen – metaphorisch gesprochen – durch viele Jahrhunderte geführt. Einen ähnlichen Gedanken bringt der polnische Schriftsteller Andrzej Stasiuk, der als wichtigster polnischer Gegenwartsautor der jüngeren Generation gilt, zum Ausdruck: »Wer viel reist, der lebt mehrere Leben.«9
Von der räumlichen zur zeitlichen Dimension meines Weges: In dem kleinen Eifeldorf, in das ich hineingeboren wurde, war die Welt nicht viel anders als im Mittelalter. Und wenn ich den Zustand von damals mit heute vergleiche, dann hat sich in den Jahrzehnten, die ich erleben durfte, mehr geändert als früher in Jahrhunderten. Mein bisheriger Weg führte mich also nicht nur in Kilometern durch Jahrhunderte. Auch das Ausmaß des Wandels hätte bei herkömmlichen Änderungsgeschwindigkeiten für viele Jahrhunderte ausgereicht. Mein Gefühl ist, dass sich die Welt zwischen 1947 im Eifeldorf und dem 21. Jahrhundert in Globalia weitaus stärker geändert hat als beispielsweise die Welt zwischen 1650 und 1850 und vermutlich auch stärker als zwischen 1850 und 1950. Man kann selbstverständlich nicht ausschließen, dass jede Generation, die nach dem Ende des Mittelalters lebte, ihre eigene Ära als die Zeit der größten Änderungen empfand.
In Kapitel 2 gehe ich näher auf diesen Wandel ein und versuche eine objektivere Messung. Die Aussage, dass ich in Raum und Zeit durch Jahrhunderte »gereist« bin, erscheint nicht vermessen. Dabei handelt es sich nicht um eine persönliche Errungenschaft meinerseits, vielmehr haben manche Angehörige meiner Generation weit größere metaphorische Distanzen überwunden. Ein Beispiel ist Mohed Altrad, der als Beduinenjunge in der syrischen Wüste geboren wurde und sein genaues Geburtsdatum nicht kennt. Insofern weiß er nicht, wie alt er ist. In Frankreich wurde er zum Milliardär und in die Ehrenlegion aufgenommen. Er sagt: »Ich wuchs ähnlich auf wie Abraham, der ein Beduine war und nur die Wüste kannte. Wenn mich die Leute fragen, wie alt ich bin, so antworte ich ›3 000 Jahre‹.«10 Er drückt damit aus, dass er in seinem Leben eine Entwicklung durchlaufen hat, für die die Geschichte Jahrtausende brauchte.
Westen, Warschau und Rückkehr
Die Frage nach der Herkunft führt zwangsläufig zu den Eltern. Meine Mutter Therese Nilles wurde 1911 im saarländischen Hemmersdorf nahe der Grenze zu Lothringen, das damals zum Deutschen Reich gehörte, geboren. Mein Vater Adolf Simon erblickte 1913 in dem kleinen Dorf Hasborn in der Eifel das Licht der Welt. Beide Eltern sind also Kinder des deutschen Westens. Wie lernten sie sich kennen? Ein Aufeinandertreffen unter normalen Umständen wäre angesichts der Entfernung der beiden Dörfer von 130 Kilometern sehr unwahrscheinlich gewesen. Geheiratet wurde fast nur innerhalb des Dorfes oder zwischen umliegenden Dörfern. Dass ein Ehepartner von weit her in ein Eifeldorf kam, war äußerst selten. Wie so oft erwies sich der Zweite Weltkrieg als der große Würfelspieler und Beeinflusser von Lebenswegen. Meine Mutter hatte beim Roten Kreuz eine Ausbildung als Hilfsschwester absolviert. Zu Beginn des Krieges wurde sie eingezogen. Ihre erste Station war das Hotel Schulz in Unkel am Rhein, ein schönes, klassizistisches Haus, direkt am Rhein gelegen. Dieses Hotel wurde 1939 in Vorbereitung auf den Frankreichfeldzug zum Lazarett umfunktioniert. Nach Zwischenstationen in Metz – die Sanitätsversorgung rückte mit dem Angriff auf Frankreich nach Westen vor – und Wiesbaden erfolgte 1941 ihre Versetzung nach Warschau, wo sie drei Jahre blieb. Dorthin verschlug es auch den Sanitätsgefreiten Adolf Simon. Sie arbeiteten im selben Lazarett am damaligen Rotkreuzplatz in Warschau. So lernten sich die Kinder des Westens, Therese Nilles und Adolf Simon, weit im Osten, mehr als 1 200 Kilometer von ihrer Heimat entfernt, kennen. Irgendwann muss es zwischen den beiden gefunkt haben. Ohne dieses Zusammentreffen gäbe es mich nicht.
Im Mai 1944 heirateten sie in Hemmersdorf/Saar. Einen Tag nach der Hochzeit reiste Adolf Simon in Richtung Atlantikküste ab. In St. Nazaire erwartete ihn sein nächster Einsatz. Nur wenige Wochen später, am 6. Juni 1944, landeten die Alliierten in der Normandie und der Rückzug von der Westfront begann. Therese, jetzt mit dem Familiennamen Simon, kehrte nicht mehr nach Warschau zurück, sondern meldete sich bei der zuständigen Rotkreuz-Schwesternschaft in Darmstadt. Bereits im Juli 1944 stießen die sowjetischen Truppen bis kurz vor Warschau vor. Sie stoppten dann jedoch, da Stalin kein Interesse hatte, den polnischen Volksaufstand in Warschau zu unterstützen. Er überließ die brutale Niederschlagung des Aufstandes den Deutschen.11 In Warschau habe ich nie die Stelle besucht, an der meine Eltern seinerzeit tätig waren. Das deutsch-polnische Verhältnis steht bis heute unter dem Schatten der Geschichte. Ich habe polnische Freunde und kenne viele Polen. Von meinem ältesten polnischen Freund, dessen Familie und er selbst schwer unter den Nazis gelitten haben, weiß ich, dass er Deutsch versteht und spricht. Doch wir haben in mehr als 30 Jahren nie ein Wort in Deutsch gewechselt. In jüngerer Zeit schicke ich ihm gelegentlich deutsche Zeitungsartikel, die er auch liest. Viele Menschen aus jener Zeit sind nicht über die ihnen zugefügten Leiden hinweggekommen.
Mit der bedingungslosen Kapitulation der Deutschen am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg. Mein Vater befand sich in französischer Gefangenschaft. Meine Mutter kehrte in ihr saarländisches Dorf zurück. Da der öffentliche Verkehr zusammengebrochen war, fuhr meine Mutter mit dem Fahrrad vom Saarland in die Eifel. Eine abenteuerliche Fahrt, denn überall herrschte Chaos. Städte, Straßen und Brücken lagen in Trümmern. Unterwegs wurde sie von französischen und amerikanischen Soldaten kontrolliert. Zum ersten Mal in ihrem Leben sah sie dunkelhäutige Menschen. Mutter erzählte, welcher Schrecken in sie fuhr, als ein amerikanischer Soldat dunkler Hautfarbe über ihr Haar strich. Doch sie kam sicher in der Eifel an. Zum ersten Mal erlebte meine Mutter das kleine Dorf und das Bauernhaus, in dem sie den Rest ihres Lebens verbringen sollte. Ob sie sich das so vorgestellt hatte, als sie sich in Warschau in den Eifler Bauernsohn Adolf Simon verliebte? Der Kontrast zwischen der agrarischen, rückständigen Eifel und dem vergleichsweise modernen, industriell geprägten Saarland war damals eklatant.
Die Familie meiner Mutter hatte ihre eigene, bewegte Geschichte hinter sich. Vor dem Angriff auf Frankreich und kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde das Gebiet ihres Heimatdorfes zur Roten Zone erklärt. »Rote Zone« bedeutete, dass alle Einwohner von Basel im Süden bis Aachen im Norden ihre Dörfer mit Mann und Maus verlassen mussten. Mit ihrem Vieh wurden sie nach Thüringen umgesiedelt. Die Familie, die eine kleine Landwirtschaft, ein Lebensmittelgeschäft und eine Stellmacherei betrieb, zog mit ihrem gesamten Haushalt und ihren Tieren nach Thüringen. Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg mit dem Beschuss der Westerplatte bei Danzig durch deutsche Kriegsschiffe (»Ab 5.45 Uhr wird zurückgeschossen«).
Im Mai 1940 griff die deutsche Wehrmacht auch unsere westlichen Nachbarn, Frankreich, die Niederlande, Belgien und Luxemburg an. Nachdem die deutschen Truppen die Rote Zone im Westen durchquert und in nur 19 Tagen bis Paris vorgedrungen waren, durften die Saarländer in ihre Heimat zurückkehren. Der Tross zog von Thüringen heimwärts. Doch zu Hause warteten böse Überraschungen. Das Haus einer Schwägerin war verschwunden. Es stand an einer engen Kurve den deutschen Panzern im Wege und wurde von der Wehrmacht einfach platt gemacht. Die Familie stand vor dem Nichts.
Genau 50 Jahre später besuchte ich mit meiner Mutter und ihrer Schwester, meiner Patentante, das romantische Städtchen Unkel am Rhein, wo Mutter den Kriegsbeginn erlebt hatte. In Vorbereitung des Krieges war das bekannte Rheinhotel Schulz zusammen mit einem angrenzenden kirchlichen Erholungsheim in ein Lazarett umgewandelt worden. Wie bereits erwähnt, war meine Mutter im Jahr 1939 als Krankenschwester dorthin versetzt worden. Das Hotel betreten wir durch einen steinernen Torbogen, der innen liegende Hof strahlt Ruhe und Geborgenheit aus. Direkt am Rhein gelegen geht der Blick von der Terrasse ungehindert zum Drachenfels und zum Rolandsbogen, ein wunderschönes Panorama. Dies scheint genau die Perspektive zu sein, die viele Maler des 19. Jahrhunderts für ihre romantischen Bilder des Drachenfels’ und der davor liegenden Insel Nonnewerth genutzt haben.
Der jungen Dame am Empfang erzählen wir von den Geschehnissen im September 1939. Sie ist interessiert und weiß für ihr Alter erstaunlich gut Bescheid. Noch besser kennt sich die Kellnerin, die uns den Kaffee serviert, aus. Schon älter und in Unkel aufgewachsen, erklärt sie uns, dass der Hotelbesitzer von damals noch lebe und 88 Jahre alt sei. Mutter erinnert sich an ihn.
Ein seltsames Schiff, das an diesem Tag den Rhein flussabwärts fährt, berührt uns. Auf dem zur Bühne umfunktionierten Deck spielt eine Kapelle Musik und Lieder aus der Zeit des Kriegsbeginns. Einzelne Soldaten in militärischen Uniformen verschiedener Epochen stehen auf dem Schiff, als hielten sie Wache. Kalt läuft es mir den Rücken herunter, die Erinnerung scheint sich zu materialisieren. Doch das Schiff ist Schauplatz einer Theateraufführung, die in Verdun, in Bitburg, auf dem Rhein und in Bonn spielt. Bertolt Brecht hatte seine Ballade vom toten Soldaten ursprünglich mit Blick auf den Ersten Weltkrieg geschrieben, die modernen Veranstalter haben den Stoff um einen Weltkrieg nach hinten verschoben. In Brechts Ballade wird ein im Ersten Weltkrieg in Verdun gefallener und dort in kaiserlicher Uniform beerdigter Soldat ausgegraben, um wieder in einen Krieg, diesmal den Zweiten Weltkrieg, entsandt zu werden. Er fällt erneut und findet seine nächste Ruhestätte – jetzt in Wehrmachtsuniform – auf dem Soldatenfriedhof in Bitburg, der durch den umstrittenen Besuch des amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan und von Bundeskanzler Helmut Kohl am 8. Mai 1985 zu weltweiter Bekanntheit gelangt war. Wieder lässt man dem Soldaten keine Ruhe, gräbt ihn aus, verpasst ihm nun eine Bundeswehruniform, um ihn in einen neuen Krieg zu schicken. Sein letztes Wegstück bis Bonn legt er auf besagtem Schiff zurück. In Bonn, am Alten Zoll, hoch über dem Rhein, findet der Soldat in der umstrittenen Ballade seine endgültige Ruhestätte.
Diese Darbietung hielt ich für einen beachtenswerten Kunstgriff, der Räume und Zeiten in einer denkwürdigen Weise in Beziehung setzte. Eine interessante Begleiterscheinung des Geschehens war, dass sich seinerzeit sowohl der Bonner Oberbürgermeister als auch der Bitburger Bürgermeister gegen das Theaterprojekt gesträubt hatten. Warum eigentlich? Beide Bürgermeister verloren auch prompt vor den Gerichten, vor die sie gezogen waren. Und so saß ich – genau 50 Jahre später, am 1. September 1989 – mit meiner Mutter und meiner Patentante auf der Terrasse des Hotels Schulz und konnte erleben, wie in dieser Theaterinszenierung Zeit und Raum zusammenflossen. Hätte etwas verschiedener sein können als die Welt am Rhein im September 1939 und im September 1989? Wieder stieg in mir der Gedanke auf, dass zwischen diesen Daten nicht 50 Jahre, sondern Jahrhunderte lagen.
Europa: Schicksal und Patria Nostra
Die Schicksale meiner Familie spiegeln die Irrungen und Wirrungen Europas im 19. und 20. Jahrhundert wider. Mein Urgroßvater arbeitete und starb in Paris. Mein Großvater wurde dort geboren. Die saarländische Familie lebte abwechselnd unter der Herrschaft Frankreichs, Deutschlands und zeitweise des Völkerbundes.12 Meine Mutter wartete als Kind im Dom von Metz, bis ihre Mutter die Einkäufe erledigt hatte. Der Großvater väterlicherseits fing sich im Ersten Weltkrieg in Bessarabien eine Malaria ein.13 In St. Gabriel bei Wien studierte mein Onkel Johannes Nilles Theologie und wurde 1935 zum Priester geweiht. Anschließend ging er für 53 Jahre als Missionar ins ferne Papua-Neuguinea. Meine Eltern verschlug es im Zweiten Weltkrieg nach Polen. In Warschau, wo sie im selben Lazarett arbeiteten, lernten sie sich kennen. Zwei Onkel kämpften in Russland, einer von ihnen überlebte den Krieg nicht. Mein Vater wurde 1944 nach St. Nazaire am Atlantik versetzt. Ein Bruder von Mutter und ein angeheirateter Onkel dienten unter Rommel in Nordafrika. Sie trafen später in der amerikanischen Gefangenschaft auf einer Farm im Bundesstaat Kentucky aufeinander. Sicherlich hat diese mit unserem Kontinent und den Nachbarländern so eng verwobene Familiengeschichte einen wesentlichen Anteil daran, dass ich ein überzeugter Europäer geworden bin. Ich teile nicht die etwas skeptische Einstellung des französischen Philosophen Bruno Latour, der sagt: »Europa, das ist, was ich nur zögerlich das europäische Vaterland nenne.«14 Europa ist unser »Patria Nostra« – oder wir haben kein Vaterland.
Exemplarisch für schwere Zeiten stehen auch die zahlreichen Schicksalsschläge, die meine Vorfahren getroffen haben. Vier von acht Kindern meines Urgroßvaters väterlicherseits starben bei der Geburt oder in jungem Alter, ebenso ein Zwillingsbruder meines Vaters. Ein Onkel kam 1940 als Zwanzigjähriger bei einem Eisenbahnunglück ums Leben. Vier Jahre später ertrank sein Bruder – wie berichtet – im Schwarzen Meer. Mein Eifeler Großvater stürzte mit 75 Jahren von der Scheune und erlag seinen Verletzungen. Auch in der Familie meiner Mutter schlug das Schicksal vielfach zu. Nicht nur ertrank mein Urgroßvater in der Seine: drei Geschwister der Mutter überlebten ihre frühe Kindheit nicht. Derartige Katastrophen in Folge gab es in vielen Familien. Kindersterblichkeit, Kriege und Unfälle forderten einen hohen Tribut. Ist es Zufall oder Vorsehung, dass gerade die Ahnenkette, der ich selbst entstammte, nicht abriss?
Eifel
Nach Rückkehr meines Vaters aus der Gefangenschaft im September 1945 ging meine Mutter in die Eifel, für immer. Sie zog in ein Bauernhaus, in dem drei alte Menschen lebten – meine Großeltern Johann und Margarete Simon und eine unverheiratete Großtante. Alle drei waren damals um die siebzig. Meine Großeltern hatten sieben Kinder, von denen nach dem Krieg noch fünf lebten. Alle hatten das Haus verlassen und standen insofern für die Fortführung der kleinen Landwirtschaft nicht zur Verfügung. Obwohl in meiner Gegenwart nie darüber gesprochen wurde, müssen sich meine Großeltern große Sorgen über ihr Alter und die Betriebsnachfolge gemacht haben. So blieb meinem Vater, der vor dem Krieg als Milchkontrolleur im Hunsrück gearbeitet hatte, keine Wahl, als in sein Elternhaus zurückzukehren und Bauer zu werden. Obwohl er in den dreißiger Jahren zwei Semester die Landwirtschaftsschule in Wittlich besucht hatte, wurde er Zeit seines Lebens kein begeisterter Landwirt. Aber seine Generation hatte nach dem Krieg wenige Optionen. Herkunft, Familientradition und ökonomische Zwänge erlaubten es nicht, eigene Wege zu gehen. Die Pflicht, die Eltern nicht allein zu lassen und im Alter für sie zu sorgen, stand der Verwirklichung alternativer Lebenspläne im Wege.
Jedenfalls brachte mein Vater, immerhin schon 32 Jahre alt, aus dem Krieg eine Frau mit. Das dürfte für meine Großeltern ein Lichtblick gewesen sein. Für die Familie und das Dorf war die neue Frau allerdings sehr ungewöhnlich. Sie kam von weither, sprach einen anderen Dialekt und hatte mit ihren Jahren in Warschau und an anderen Plätzen eine gewisse Welterfahrung. Die Frauen aus der Nachbarschaft kannten nur ihr Dorf. Manche hatten auch einige Jahre als Mägde in anderen Dörfern oder in Bürgerhaushalten der Städtchen Wittlich und Manderscheid gedient. Doch Mutter bereute den Umzug in das kleine Eifeldorf Hasborn nie. Obwohl das nahe gelegen hätte, sprach sie mit den Leuten des Dorfes kein Hochdeutsch, sondern ihren saarländischen Dialekt, den die Eifeler gerade noch verstehen. Denn beide Dialekte gehören zur sogenannten moselfränkischen Sprachgruppe. Moselfränkisch war einst das offizielle Idiom des mächtigen Erzstiftes Trier, eines Staates, dessen Bischof zu den sieben Kurfürsten des deutschen Reiches gehörte. Die Kurfürsten wählten den Kaiser.
Moselfränkisch ist der einzige Dialekt, der bis heute in der Europäischen Union eine offizielle Staatssprache ist, nämlich in der luxemburgischen Variante. Eifler, Luxemburger und Saarländer (dort gibt es allerdings eine Sprachgrenze) können sich in ihren Dialekten verständigen. Welch seltsame Vorteile das zeitigen kann, verdeutlicht die folgende Geschichte. Der spätere Staatsminister im Auswärtigen Amt, Alois Mertes, stammte aus Gerolstein in der Eifel und beherrschte den Eifler Dialekt perfekt. Während der Hochzeit des Kalten Krieges diente er als Diplomat in Moskau. Jeder Diplomat wusste, dass der russische Geheimdienst KGB Gespräche mithörte. In seiner Kommunikation mit dem luxemburgischen Botschafter benutzte Mertes deshalb den moselfränkischen Dialekt. Den KGB soll das zur Verzweiflung gebracht haben, da man keinen Agenten hatte, der dieses Idiom beherrschte. Es ist eben von Vorteil, viele Sprachen zu sprechen.
Das Band der Sprache
Ich wuchs quasi zweisprachig auf. Meine Mutter sprach mit mir in ihrem saarländischen Dialekt, dieser ist also im engeren Sinne meine »Muttersprache«. Mein Vater und das Dorf kommunizierten mit mir in Eifler Platt. Nur diesen Dialekt gebrauchte ich aktiv, auch in der Kommunikation mit meiner Mutter. Dabei war mir als Kind nicht bewusst, dass meine Mutter ein anderes Idiom benutzte als mein Vater. Diese Zweisprachigkeit war einfach normal, die Welt, in die ich hineinwuchs. Vermutlich ist es bei Kindern, deren Eltern in zwei wirklich verschiedenen Sprachen mit ihnen kommunizieren, ähnlich. Diese Kinder dürften die Zweisprachigkeit als das Normalste auf der Welt empfinden.
Das Eifler Platt beherrsche ich bis heute und gebrauche es stets, wenn ich in meiner Heimat bin. Es macht einen wichtigen Teil der Geborgenheit aus, die ich dort empfinde. Allerdings nimmt die Zahl derjenigen, die diese Sprache beherrschen, kontinuierlich ab. Denn nur wenige Kinder und Jugendliche erlernen heute noch das Platt von ihren Eltern. Diese ziehen es vor, mit ihnen Hochdeutsch zu sprechen, um sie besser auf die Welt draußen vorzubereiten. Zwar gibt es seit einigen Jahren eine gewisse Rückbesinnung. Aber ob diese über die Kreise hinausgeht, die Lesungen und Erzählabende in Platt veranstalten, bleibt zweifelhaft. Da ein Dialekt nur mündlich überliefert werden kann, sieht es um das Überleben der Sprache meiner Kindheit nicht rosig aus. Ich selbst werde sie jedoch nicht vergessen und bis zu meinem Lebensende gebrauchen. Sie ist ein Stück von mir.
Der Dialekt enthält zahlreiche Worte, die es im Hochdeutschen nicht gibt oder die dort verschwunden sind. Ein Beispiel ist das Wort für Spreu, wie in »Spreu und Weizen«. Es heißt in Eifler Platt »Koff«, das englische Wort dafür ist »chaff«. Bei einem Abendessen diskutierten wir solche Eigenarten der Dialekte mit Professor Josef Isensee, dem bekannten Bonner Staatsrechtler und Staatsphilosophen. Er stammt von einem niedersächsischen Bauernhof. Von ihm erfuhr ich, dass Spreu auch in seinem niederdeutschen Dialekt »Koff« oder »Kaff« heißt. Ähnliches erlebte ich mit dem Wort »Kump«, das in der Eifel Trog bedeutet. Mein Geschäftspartner Dr. Georg Tacke, in Ostwestfalen aufgewachsen, bestätigte, dass es im dortigen Platt dasselbe Wort gibt. Solche Worte haben offensichtlich ihren Ursprung im Germanischen und strahlen von dort ins Englische und Niederdeutsche aus. Eine Erklärung, warum sie auch in der Eifel vorkommen, könnte darin liegen, dass Karl der Große während seiner Kriege gegen die Sachsen vermutlich eine größere Zahl derselben in die Eifel zwangsumgesiedelt hat.15
Auch grammatikalisch hat das Eifler Platt merkwürdige Besonderheiten. Im Hochdeutschen unterscheidet man beim Zahlwort »ein« die männliche, weibliche und sächliche Form: ein Mann, eine Frau, ein Pferd. Beim Zahlwort zwei gibt es in der hochdeutschen Sprache hingegen nur eine Form. Im Platt hingegen existieren drei Formen. Es heißt zwien Männa, zwu Frauen, zwei Pärda. Seltsam!
Der gemeinsam gesprochene Dialekt spielte für die Identität der Dorfgemeinschaft eine gewichtige Rolle. Wenn man Platt sprach, gehörte man dazu. Hingegen gab es zwischen Platt und Hochdeutsch Sprechenden eine Art unsichtbare »Mauer«. Damit will ich nicht ausdrücken, dass diese »Mauer« Animosität oder gar Feindseligkeit widerspiegelte. Zwischen Platt Sprechenden entsteht jedoch spontan eine größere Nähe. Distanz wird abgebaut. Das ist bis heute so. »Jede Provinz liebt ihren Dialekt, denn er ist doch eigentlich das Element, in welchem die Seele ihren Atem schöpft« – so formulierte Goethe es in seiner Autobiografie Dichtung und Wahrheit.
Gemeinsame Sprache erzeugt Gefühle des Vertrauens und Geborgenseins. Bei internationalen Managementseminaren und ähnlichen Veranstaltungen werden die Teilnehmer bunt gemischt, arbeiten in multinationalen Gruppen zusammen, diskutieren und präsentieren. Die Sprache ist dabei in aller Regel Englisch, für die meisten Teilnehmer eine Fremdsprache. Interessant ist die Beobachtung, die ich Hunderte von Malen während der Pausen machte. Schlagartig bilden sich Gruppen gleicher Sprache, beim Mittagessen sitzen die Franzosen, die Japaner, die Italiener zusammen. Der Zweck solcher Events, dass sich die Menschen über nationale und sprachliche Grenzen hinweg kennen lernen, wird durch diese Flucht in die eigene Sprachwelt ad absurdum geführt, zumindest behindert. An einem Abend in einem Brauhaus in der Kölner Altstadt, an dem einige Hundert unserer Mitarbeiter teilnahmen, ging ich von Tisch zu Tisch, um die Kollegen zu begrüßen. An einem großen runden Tisch saßen nur Pariser. Auf meinen Einwand, das sei doch nicht der Sinn unseres länderübergreifenden »World Meetings«, vielmehr sollten sie sich mit den Kollegen aus anderen Ländern und Büros mischen, erhielt ich die Antwort: »In Paris haben wir nie Zeit, uns mal in Ruhe zusammenzusetzen. Wir finden es ganz toll, dass wir hier an einem Tisch sitzen können.« Die Franzosen sind nie auf den Mund gefallen. Und obwohl unsere Pariser Mitarbeiter alle gut Englisch sprechen, fühlen sie sich in ihrer Muttersprache offensichtlich wohler. Entsprechend schätzen sie es, wenn man mit ihnen en français kommuniziert.
Persönlich habe ich häufig erfahren, wie mich meine Sprache verriet und Bande schuf, die sich über die Zeit erhielten. Das beginnt mit dem Erkennen der gemeinsamen Herkunft. Immer wieder begegneten mir Personen, die wie ich selbst aus der Eifel oder dem nahegelegenen Moseltal stammten. Nicht selten wurde ich bei Vorträgen, Diskussionen oder Beratungsprojekten an meiner Sprache erkannt, oder ich erkannte die Eifelherkunft in der Sprache des anderen. Dazu sagt Michael Naumann, Kulturstaatsminister unter Bundeskanzler Gerhard Schröder: »Dialekte können wie Ausweispapiere wirken, die manche Menschen auch wider Willen ein Leben lang bei sich tragen.«16 Ich erinnere mich an einen Besuch bei der Firma Bosch Rexroth in Lohr im Spessart. Ich kam zur Mittagszeit an, der Vorstand lud mich zum Mittagessen ein, das Gespräch begann. Plötzlich sagte ein Vorstandsmitglied: »Herr Simon, Sie sprechen genauso wie unser Dr. Hieronimus.« »Wer ist Dr. Hieronimus?«, fragte ich und schob nach: »Und woher stammt er?« Dr. Albert Hieronimus, damals Vorstandsmitglied von Rexroth, dann Chef von Bosch in Indien und in seinem letzten Amt Vorstandsvorsitzender der Bosch Rexroth AG, des Weltmarktführers für Hydraulik, antwortete: »Aus einem kleinen Dorf in der Eifel, das Sie mit Sicherheit nicht kennen.« Doch ich wollte wissen, wie das Dorf hieß. »Immerath im Vulkaneifelkreis Daun«, lautete die Antwort. Da brauchte ich nur noch zu ergänzen, dass mein Urgroßvater aus Immerath stammte und den Namen Simon in mein Heimatdorf brachte. Über die Jahre gab es viele Begegnungen dieser Art mit »Kindern der Eifel«. Ist es Zufall, dass sich meine Pfade so häufig mit den Wegen anderer Eifeler kreuzten? Oder liegt es an der Sprache, dass wir uns erkannten?
Aus diesen Begegnungen entstand die Idee, die Erfolge, Karrieren und Erlebnisse dieser Persönlichkeiten zurückzutragen in die Heimat. Denn fast alle hatten ihre Heimatdörfer und -städte in jungen Jahren verlassen. Zu Hause wussten nur die wenigsten Menschen, was aus ihnen geworden war und welche ungewöhnlichen Laufbahnen sie zurückgelegt hatten. So startete ich im Jahr 2007 mit der regionalen Eifelzeitung unter dem Titel »Kinder der Eifel – erfolgreich in der Welt« eine Serie. Jede Woche erschien ein Portrait, und später veröffentlichten wir diese Serie unter gleichem Titel als Buch.17 Serie und Buch fanden große Beachtung. Die Eifler waren stolz auf ihre Kinder, die draußen in der Welt ihren Weg gemacht haben.
Es gab eine weitere Situation, in der die Sprache eine zusammenführende, aber auch eine separierende Funktion hatte. Ab 1958 besuchte ich das Cusanus-Gymnasium in der nahe gelegenen Kreisstadt Wittlich. Viele Schüler kamen aus den Dörfern und viele von ihnen beherrschten nur ihren Dialekt. Hochdeutsch war für sie eine Art Fremdsprache. Hingegen sprachen die Schüler, die in der Stadt aufgewachsen waren, in der Regel Hochdeutsch, wenn auch mit starker regionaler Färbung. Sie waren Kinder von Beamten, Ärzten, Rechtsanwälten oder Geschäftsleuten. Die Sprachteilung hielt sich praktisch über die ganze Schulzeit, und darüber hinaus. Die Dorfkinder sprachen untereinander weiterhin Platt, in der Kommunikation mit und zwischen Stadtkindern wurde in Hochdeutsch parliert. Und bis heute ist das im Wesentlichen so geblieben. Wenn ich jemanden treffe, mit dem ich früher per Platt verkehrte, falle ich automatisch in unser altes gemeinsames Idiom zurück. Es fällt mir schwer, mit einer solchen Person Hochdeutsch zu reden. Und dem oder der anderen scheint es genauso zu gehen. Beim Münchner Oktoberfest saßen wir in einer fröhlichen Runde im Käfer-Zelt. Von den rund 15 Personen war einer, Dr. Michael Thiel, der Sohn meines Volksschullehrers Jakob Thiel, ein »Stammesbruder« aus Kindheitstagen. Für uns beide war klar, dass wir Eifler Platt sprachen. Es wäre nicht anders gegangen.
2. DIE WELT, IN DER ICH AUFWUCHS
Gruß aus dem Mittelalter
Ein etwas älterer Zeitgenosse aus meiner Heimat schrieb, dass seine »Kindheit und Jugend einer Lebenswelt angehörten, die aus heutiger Sicht geradezu mittelalterlich anmutet, aber vor kaum einem halben Jahrhundert noch wirklich war. Gleichsam über Nacht erfolgte dann ein Umbruch, wie man sich ihn radikaler kaum vorstellen kann.«1 Der Verfasser, der Professor der Pädagogik Johannes Nosbüsch (1929–2011), stammte aus dem Eifelkreis Bitburg. Diese Aussage beschreibt auch meine Kindheit treffend. Es ist keineswegs übertrieben, die Bauernwirtschaft in der Eifel unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg als »mittelalterlich« zu bezeichnen. Seit dem 19. Jahrhundert hatte es Fortschritte gegeben, gleichwohl dominierten nach wie vor Handarbeit, Selbstversorgung und traditionelle Gewohnheiten. Wohl Hunderte von Autoren haben ihre Kindheit auf dem Bauernhof beschrieben. In solchen Biografien erkenne ich vielfach meine eigene Geschichte wieder. Und Wiederholungen ähnlicher Inhalte will ich meinen Leserinnen und Lesern ersparen. Ich beschränke mich deshalb auf wenige markante Gegebenheiten, an die ich mich selbst noch erinnere.
Von wenigen Ausnahmen wie Lehrer, Postbeamter und Polizist abgesehen, lebten alle Familien unseres Dorfes von der Landwirtschaft. Es handelte sich dabei um Kleinbetriebe mit einer durchschnittlichen Größe von acht Hektar. Der größte Landwirt bewirtschaftete elf Hektar. Nahezu alle Arbeiten wurden per Hand erledigt. Im Hinblick auf den Einsatz von Landmaschinen lag die Eifel gegenüber fortschrittlicheren Gebieten wie Westfalen gut zwei Jahrzehnte zurück. Wir selbst hatten zwei Geräte, die ansatzweise die Bezeichnung »Maschine« verdienten, eine Mähmaschine und eine Sämaschine. Beide Maschinen wurden von einem Pferd gezogen. Die Mähmaschine hatte mein Großvater am 10. Januar 1940 für 341,50 Reichsmark erworben. Sie wurde zum Mähen sowohl von Gras als auch von Getreide eingesetzt und brachte einen enormen Fortschritt gegenüber dem Mähen mit der Sense. Das Heumachen, das Aufheben und Binden der Garben, blieb jedoch nach wie vor Handarbeit. Die Sämaschine hatte gegenüber dem Aussäen von Hand den Vorteil, dass die Körner gleichmäßiger über das Feld verteilt wurden. Die Arbeitswelt der Eifelbauern um 1950 war ansonsten kaum verschieden von derjenigen, die man 100 oder 200 Jahre früher dort vorfand.
Auch die Rolle der katholischen Kirche wies mittelalterliche Züge auf. Die mächtigste Figur im Dorfleben war der katholische Pfarrer. Dies spiegelte sich schon in seiner Bezeichnung wider, denn er wurde einfach »der Herr« genannt, nicht »der Herr Pfarrer«, sondern nur »der Herr«.2 Wenn wir ihm begegneten, knieten wir nieder und murmelten »Gelobt sei Jesus Christus«. Der »Herr« bestimmte, ob die Bauern in der Erntezeit an Sonntagen arbeiten durften. Dies war nur erlaubt, wenn er in der Sonntagsmesse »auftat«, und selbstverständlich hielten sich alle an diese Regel. Der Glaube an übernatürliche Mächte war weit verbreitet. So gab es im Dorf sogenannte »Hexer«, die man rief, um erkranktes Vieh zu heilen. Vor ihnen hatte man aber auch Angst, da sie einen Fluch aussprechen konnten. Tobte ein Gewitter, so entzündeten wir Kerzen und geweihte Zweige, um den Blitz vom Haus fernzuhalten.
Unsere Landwirtschaft war auf Selbstversorgung ausgerichtet. Außer Salz, Zucker und Gewürzen erzeugten wir nahezu alles selbst. Unser Brennholz holten wir aus dem Wald. Werkzeuge wie Rechen, Körbe, Stiele und so weiter fertigten die Bauern in Eigenarbeit. Und bis wenige Jahre vor meiner Zeit wurden sogar Wolle und Leinen selbst erzeugt. Wir besitzen noch zahlreiche Bett- und Tischtücher mit dem Engramm »JS« für Johann Simon, die meine Großmutter auf unserem Webstuhl gefertigt hatte.
Geld spielte in dieser Selbstversorgungswirtschaft keine große Rolle. Das wenige Geld, das wir brauchten, erlösten wir durch Verkäufe von Milch, Schweinen und Ferkeln. Geld war zwar immer knapp, aber wir fühlten uns dadurch nicht eingeschränkt oder gar arm. Wir hatten stets genug zu essen, gleichwohl war die Vielfalt der Speisen begrenzt. Eine Apfelsine oder eine Banane gab es nur zu Weihnachten. Selbst Süßigkeiten, Schokolade oder Limonade waren Seltenheiten, sodass wir danach gierten. Einmal kamen meine »verwöhnten« Kusinen aus dem Saarland in den Ferien, und es wurde eine ganze Kiste Limonade ins Haus geholt. Das war für mich eine Festwoche.
Das Leben war hart. Als Kinder mussten wir in der Landwirtschaft kräftig mithelfen. Meine Großmutter starb, als ich neun Jahre alt war. Ab diesem Zeitpunkt betrieben meine Eltern ihre Landwirtschaft allein und waren auf jede Hand angewiesen. Knechte oder Mägde konnten sich die kleinen Betriebe nicht leisten. Eine Arbeit, die ich regelrecht hasste, war das Vereinzeln von Rüben. Ursprünglich wurden die Rübensamen im Garten ausgesät und die kleinen Pflänzchen auf das Feld verpflanzt. Das war problematisch. Wenn in der Pflanzzeit Trockenheit herrschte, wuchsen die verpflanzten Setzlinge nicht an. Deshalb kam man auf die neue Methode, den Rübensamen direkt auf den Feldern auszubringen. Das führte jedoch zu vielen Trieben, die ausgerupft werden mussten. Diesen Vorgang nennt man Vereinzeln. Eine Rübe braucht etwa 30 Zentimeter Abstand, um voll auszuwachsen. Eine Erleichterung des Vereinzelns brachte der sogenannte Monogermsamen, bei dem nur ein Trieb aus einem Samenkorn entsprang. Dennoch musste vereinzelt werden, da die Samenkörner nicht so präzise platziert werden konnten. Die Arbeit des Vereinzelns zog sich über viele Tage hin, in denen man sich gebückt, hockend oder kniend entlang der Reihen vorarbeitete und unendliche Geduld aufbringen musste. Das Vereinzeln war die unbeliebteste Arbeit im ganzen Jahreslauf. Dabei spielte auch eine Rolle, dass man seine Leistung kaum sah. Man hatte ja nur Pflänzchen ausgerissen.
Etwas geselliger und damit abwechslungsreicher war das Ernten von Kartoffeln. Wenn das Roden erledigt war, lag ein Feld voller Kartoffeln vor uns, die alle per Hand aufgelesen werden mussten. Dazu reichten die wenigen Hände der Familie nicht aus. Deshalb heuerten wir zusätzlich ein oder zwei Frauen an, die selbst keine Landwirtschaft hatten. Sie wurden für ihre Arbeit in Kartoffeln oder in Geld entlohnt. Meistens brachten die aushelfenden Frauen ihre Kinder mit, sodass eine fröhliche Kinderschar zusammenkam. Wenn dann noch das Wetter mitspielte, konnte es nichts Schöneres geben. Zwar musste man selbst als Kind arbeiten, aber zwischendurch blieb Zeit zum Spielen. Zu trinken gab es selbstgemachten Himbeersaft, und das Marmeladenbrot beim Kaffeetrinken auf dem Feld war ein Genuss. Im späteren Verlauf des Nachmittags wurden Kartoffelfeuer entzündet und die frischen Kartoffeln geröstet. Gewöhnlich verkohlten die Kartoffeln im Feuer, oder wir versengten uns die Finger. Dennoch war es ein Vergnügen.
Gegen Abend kam mein Vater mit Pferd und Wagen, um die gefüllten Säcke aufzuladen. Diese Säcke waren unterschiedlich gekennzeichnet, denn je nach Feld und Kartoffelsorte wurden bis zu drei Arten unterschieden: Ess-, Schweine- und Pflanzkartoffeln. Die schönen, großen Erdäpfel wurden für den menschlichen Verzehr aussortiert. Kleine, hutzelige oder beschädigte wanderten in den Korb der Schweinekartoffeln. Und wenn die Sorte zum erneuten Pflanzen im kommenden Frühjahr verwendet werden sollte, dann kamen mittlere, wohlgeformte Knollen in einen gesonderten Korb. Diese drei Sorten wurden auch unterschiedlich gelagert. An guten Tagen kamen mehr als dreißig Säcke zusammen, sodass das Pferd es kaum schaffte, den schweren Wagen vom Feld zu ziehen. Gelegentlich musste das Pferd eines Nachbarn dazugespannt werden. Wenn der Wagen auf einem befestigten Weg fuhr, ging es leichter. Da es meistens schon dunkel war, wenn wir das Feld verließen und auf einer öffentlichen Straße in Richtung Dorf fuhren, musste der Wagen mit einer Petroleumlaterne beleuchtet werden. Diese Laternen bildeten ein ständiges Ärgernis. Entweder war das Petroleum aufgebraucht, der Docht verrottet, oder die Laterne funktionierte einfach nicht. Deshalb wurde die Heimfahrt im abendlichen Dunkel nicht selten zum Abenteuer. Es gab zwar nur wenige Autos und eigentlich nie Unfälle, aber die Befürchtung, dass der Polizist im Dunkeln auftauchen und das Fehlen der Laterne mit einer gebührenpflichtigen Verwarnung ahnden könnte, war stets vorhanden. Zu Hause angekommen, musste nicht nur das Vieh versorgt, sondern auch der Wagen entladen werden. Das geschah mit Hilfe einer Schütte, auf die die Kartoffeln gekippt wurden. Von dort rutschten sie durch kleine Luken direkt in den Keller. In guten Jahren stapelten sie sich bis an die Kellerdecke. Pflanzkartoffeln wurden in besonderen Abteilen im Keller oder in Mieten im Garten gelagert. Die Schweinekartoffeln kamen größtenteils auf einen Haufen hinter dem Haus.
Der Tages- und Jahreslauf der Landwirtschaft bestimmte mein Leben als Kind und Jugendlicher. Das änderte sich auch mit dem Wechsel aufs Gymnasium, zu dem ich mit dem Zug in die nahe Kreisstadt fuhr, nicht wesentlich. Wenn ich nachmittags gegen zwei Uhr zurückkam, schwang ich mich in der Erntezeit aufs Fahrrad und fuhr aufs Feld. Abends half ich beim Füttern des Viehs und erledigte anschließend meine Hausaufgaben. Unter normalen Umständen empfand ich dies nicht als ungewöhnlich oder hart. Ich hatte in der Schule keine Probleme, war gleichwohl kein besonders guter Schüler. Hart war für mich allerdings das Schuljahr 1959. Meine Mutter musste während der Erntezeit für mehrere Wochen ins Krankenhaus und danach für einen Monat in eine Kur. Mein Vater stand mit mir als Zwölfjährigem in dieser arbeitsintensiven Phase allein da. Meine jüngere Schwester hatten wir zu einer Tante nach St. Augustin entsandt. Ich arbeitete neben der Schule wie ein Erwachsener. Um die Arbeit besser zu bewältigen, schaffte mein Vater eine Melkmaschine an. So konnte ich morgens und abends die Kühe melken. Die Vakuumtechnik der Maschine faszinierte mich. Mein Vater stellte manchmal auf den Feldern bis nach Mitternacht Garben auf. Gelegentlich saßen wir ermattet beim Abendessen, und Vater spendierte uns zwei Flaschen Bier, für sich ein Helles und für mich ein Malzbier. Wir prosteten uns zu, und ich fühlte mich als Mann. Meine Schulnoten fielen in dieser harten Phase signifikant ab. Das wurmte mich. Im nächsten Schuljahr, als meine Mutter wieder gesundet war, legte ich zu und erhielt das beste Zeugnis meiner gesamten Schulzeit.
Die Angst, dass ein Elternteil ausfallen könne und damit die Fortführung des Betriebes äußerst schwierig würde, ließ mich nie mehr los. Ein kleiner Bauernbetrieb mit nur zwei Erwachsenen ist eine ökonomisch heikle Angelegenheit. Bei Gesundheitsproblemen gibt es keine Reserven. Obwohl ich keinerlei Anlass habe, über meine Lage zu klagen, verlässt mich das Gefühl wirtschaftlicher Unsicherheit nie. Ich glaube, dass dieses subkutane Gefühl hier seine Wurzeln hat. Eine weitere Quelle von Unsicherheit war die Abhängigkeit der Landwirtschaft von äußeren Faktoren wie Wetter oder Schädlingsbefall. Ich verhehle meine Abneigung gegen Geschäfte, die solch unbeeinflussbaren Wirkungsfaktoren ausgesetzt sind, nicht. Dabei lässt sich natürlich nicht leugnen, dass derartige Einflüsse unabdingbar zur Wirtschaft gehören. So erlebten wir bei Simon-Kucher in der Krise von 2009 einen Umsatzeinbruch von rund 10 Prozent. Auch in dieser Situation merkte ich, dass die Kindheits- und Jugenderfahrungen ein anhaltendes Gefühl wirtschaftlicher Unsicherheit in mir hinterlassen haben.
Als Kinder erfuhren wir einen seltsamen Widerspruch zwischen Zwang und Freiheit. Die Teile unseres Lebens, die geregelt waren und unter der Aufsicht von Erwachsenen standen, unterlagen strengem Zwang. Das galt für alles, was mit Kirche und Gebet zu tun hatte, aber genauso für die Schule oder das pünktliche Erscheinen zum Essen. Auch das Verhalten gegenüber Respektspersonen wie Pfarrer oder Lehrer war streng geregelt. Hingegen waren wir uns zu anderen Zeiten selbst überlassen und hatten völlige Freiheit. Den Eltern fehlte einfach die Zeit, uns ständig zu beaufsichtigen oder für unser »Entertainment« zu sorgen. Wir spielten fast immer draußen, strolchten durchs Dorf oder den angrenzenden Eichenhain. Wir konnten tun und lassen, was wir wollten. Kein Erwachsener passte auf oder intervenierte. Ich war der Älteste einer Gruppe von sechs Jungen aus der unmittelbaren Nachbarschaft. So fiel mir eine natürliche Führungsrolle zu. Diese Anführer- und Anstifterrolle wurde die erste und vermutlich beste Führungsschule meines Lebens. Als Anführer muss man sich etwas einfallen lassen, man muss motivieren, anstiften, einteilen, die Gruppe bei der Stange halten. Es handelt sich um Führungsaufgaben, die von denen, die ich Jahrzehnte später zu meistern hatte, nicht grundverschieden waren. War es Glück oder Zufall, dass ich in und mit einer solchen Jungengruppe aufwuchs? Und wäre aus mir derselbe geworden, wenn es in unserer Nachbarschaft nur Mädchen oder überhaupt keine Kinder gegeben hätte (so wie es heute dort der Fall ist)?
Wir waren als Kinder dem vollen Leben ausgesetzt, wohingegen moderne Kinder nur einen winzigen Ausschnitt der Welt erleben. Wenn jemand aus der Nachbarschaft starb, besuchten wir selbstverständlich die aufgebahrte Leiche. Genauso wurden wir zu einem neu geborenen Baby gelassen. Wir beobachteten, wie die Kühe ihre Kälber zur Welt brachten oder ein Wurf von Ferkeln den Leib der Sau verließ. Wir sahen zu, wie Schweine vom Schlachter geschossen und ihnen anschließend der Hals aufgeschlitzt wurde, aus dem das Blut spritzte. Man schickte uns auch nicht weg, wenn ein Huhn oder ein Hahn mit der Axt geköpft wurde, um anschließend in den Suppentopf zu wandern. Wir sahen tote Tiere aller Art, bevor sie von der Tierkörperverwertungsanstalt abgeholt wurden. Was bedeutet dieses dem vollen Leben Ausgesetztsein im Vergleich zum wohlbehüteten, geschützten Aufwachsen heutiger Kinder? Diese Frage lasse ich im Raum stehen, denn ich habe keine Antwort.
Eine weitere Facette unseres Lebens, deren Bedeutung ich erst später schätzen lernte, bildete die Dorfgemeinschaft. Diese hatte zwei Fundamente. Zum einen eine relative soziale Gleichheit. Es gab keine Familie, die wirklich reich war, am unteren Ende der Wohlfahrtsskala aber auch keine wirklich Armen. An Festen und Gemeinschaftsaktivitäten beteiligte sich das ganze Dorf. Auch die Landwirtschaft trug zum Gemeinschaftsgefühl bei. Die gleichen Früchte wurden auf den gleichen Feldern angebaut. So fanden sich alle Bauern mit ihren Familien zur Kartoffel- oder Getreideernte auf den entsprechenden Fluren. Für uns Kinder war das ein Paradies, denn wir konnten in großen Gruppen auf den Feldern spielen. Doch auch die Erwachsenen nahmen sich Zeit zu einem Plausch mit den Feldnachbarn. Abends zogen die vollbeladenen Wagen in einer Kolonne ins Dorf zurück. Jeder kannte jeden. Die Kehrseite war die ausgeprägte soziale Kontrolle. Nichts blieb unentdeckt oder lange geheim. Wer die Grenzen sozialer Normen überschritt, musste mit Ächtung rechnen. Als Kind nahm ich solche Beschränkungen nicht wahr, aber als Jugendlicher empfand ich sie als zunehmend beengend.
Die so beschriebene »mittelalterliche« Welt überdauerte mein erstes Lebensjahrzehnt ohne große Veränderungen. In dieser Zeit besaß niemand in unserem Dorf ein Auto, ein Badezimmer oder einen Fernseher. Im Grunde hatte sich seit Jahrhunderten wenig geändert. Im Jahr 1726 wurde von Thurn und Taxis die Postkutschenlinie Trier-Koblenz eingerichtet, die in unserem Dorf einen Haltepunkt hatte. Das bedeutete erstmalig einen Anschluss an die »große« Welt. Rund 150 Jahre später, im Jahr 1879, kam die Eisenbahn in unsere Gegend. Ab 1912 gab es eine öffentliche Wasserversorgung und ab 1918 Elektrizität. So blieb es im Wesentlichen bis 1947, als ich auf die Welt kam, und bis in die Mitte der fünfziger Jahre änderte sich wenig. Doch dann brach der Wandel mit umso größerer Kraft los. Das erste Auto und der erste Traktor erschienen. Wie die Abbildung zeigt, kamen Jahr für Jahr bahnbrechende Innovationen hinzu. Die Jahreszahlen in der Abbildung gelten für unsere Familie. Sie waren von Familie zu Familie etwas verschieden, wir dürften ungefähr im Durchschnitt gelegen haben.
So gab es in der Zeit von 1955 bis 1975 mehr technische Innovationen als in den 200 Jahren zuvor. Und in diesen beiden Jahrzehnten nach 1955 löste sich die Welt meiner Kindheit völlig auf. Heute gibt es im Dorf keinen einzigen Landwirt mehr. Auch die Handwerker, die Geschäfte, die Bräuche, die Rolle der Kirche sind dem radikalen Wandel anheimgefallen. Am stärksten vermisse ich die Dorfgemeinschaft meiner Kindheit. Viel würde ich dafür geben, noch einmal ins »Mittelalter« zurückkehren und bei der Ernte einen Tag mit der ganzen Dorfgemeinschaft verbringen zu dürfen.
Aus der »Heimat Erde«
Eine fundamentale Änderung, die kaum jemandem bewusst ist, betrifft unseren Körper und die Moleküle, aus denen er zusammengesetzt ist. Auf die Frage »Woraus bin ich gemacht?« gibt es für die Zeit meiner Kindheit eine eindeutige Antwort: »Aus der Erde meines Heimatdorfes.« In der Zeit bis zur Geburt und in der Stillzeit erhält man seine Moleküle auf natürliche Weise von der Mutter. Danach werden die Zellen des Körpers aus den Stoffen aufgebaut, die man durch die Nahrung zu sich nimmt. Und unsere Nahrung stammte nahezu ausschließlich aus der Erde meiner Heimat. Von wenigen Ausnahmen wie Zucker, Salz und Gewürzen abgesehen, war alles, was wir aßen, selbst erzeugt. Das galt für das Gemüse aus unserem Garten genauso wie für das Getreide, aus dem wir unser Brot buken. Und auch das Fleisch, die Milch, die Eier, die wir konsumierten, stammten von unseren eigenen Tieren, die sich ihrerseits von den Erträgen unserer Felder und Wiesen ernährten. Wir waren damals also tatsächlich aus der Erde unserer Heimat gemacht. Das Wasser und die Luft gehörten dazu.
Und woraus sind wir heute gemacht? Wir wissen es nicht. Zumindest lässt sich diese Frage nicht präzise beantworten. »Aus der Erde der ganzen Welt«, dürfte der Wahrheit ziemlich nahe kommen. Einmal versuchte ich in einem Obstladen die Herkunftsländer der Waren zu zählen. Äpfel aus Chile, Kiwis aus Neuseeland, Orangen aus Spanien, Trauben aus Südafrika, Mangos aus Ägypten, Feigen aus Marokko, Pilze aus Polen, Tomaten aus Holland … Und so ging es endlos weiter. Woher kommt die Margarine, die wir essen? Vermutlich wird sie aus Palmöl, das in Malaysia oder Indonesien gewonnen wird, hergestellt. Und wo haben die Kühe geweidet oder wo sind die Fische geschwommen, deren Fleisch wir verzehren? Wir wissen es meist nicht.
Die Selbstversorgung erforderte zahlreiche Fähigkeiten, die heute verloren gegangen sind. Wir mussten nicht nur die vielfältigen Pflanzen und Tiere züchten, sondern auch entsprechende Fähigkeiten zur Verarbeitung und Konservierung beherrschen. Wir wussten, wie sich Fleisch durch Räuchern, Einlegen in Salzlake oder Einkochen haltbar machen lässt. Die Verarbeitung von Früchten und Gemüsen erforderte spezielle Kochkünste. Obst wurde getrocknet, Kohl zu Sauerkraut verarbeitet, Pflaumen wurden sauer eingelegt, Möhren in Sand gelagert. Tausend kleine Tricks und Fertigkeiten waren notwendig, um ohne Einkauf über den langen Winter zu kommen. Trotz all dieser Mühen blieb die Küche recht eintönig. Heute steht uns eine ungleich größere Auswahl von Nahrungsmitteln zur Verfügung.
Die Tatsache, dass unsere Moleküle heute aus aller Herren Länder, nicht mehr nur aus einem Dorf oder einer kleinen Region stammen, ist vielleicht einer der markantesten, aber kaum bedachten Unterschiede zwischen der Welt meiner Kindheit und unserer Welt von heute. Welche Relevanz dieser Unterschied besitzt, vermag ich nicht zu sagen. Hat es Konsequenzen, dass wir uns nicht mehr nur aus der Erde unserer Heimat, sondern auch aus der Erde der ganzen Welt ernähren? Es wird ja empfohlen, den Honig aus der Region, in der man wohnt, zu verzehren. Beeinflusst die globale Herkunft der Nahrungsmittel unser Immunsystem? Ich weiß es nicht. Aber sich allein des Unterschieds in der molekularen Zusammensetzung unseres Körpers bewusst zu werden, lohnt der Gedanken Mühe. Und diese Veränderung beschreibt ihrerseits meinen Weg durch die Zeit. Mein Körper reflektiert in seiner materiellen Struktur den Weg von dem Eifelkind, das nur sein Dorf kannte und aus dessen Erde gemacht war, zu dem Global Player, der überall zu Hause ist und dessen Moleküle aus aller Herren Länder stammen.
Acht Jahrgänge, eine Klasse
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: