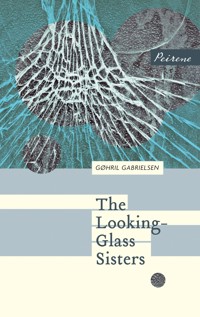19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Die Schwedin Edith Södergran sollte später eine berühmte Dichterin werden. Als junges Mädchen lebt sie mit ihrer Mutter Helena Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts in Sankt Petersburg. Helena wünscht sich eine Gefährtin für die Tochter, hat Sorge, dass sie sich einsam fühlen könnte. Also adoptiert sie ein weiteres Mädchen. Doch das löst eine Kette von Ereignissen aus, die das Leben der Familie für immer verändern wird. Mehr als einhundert Jahre später erforscht eine Mutter in Norwegen die Geschichte der Södergrans, um zu verstehen, was mit ihrer eigenen kleinen Familie – und vor allem mit ihrer Tochter Lu – gerade geschieht.
Zwischen Nord und Nacht erzählt von zwei Müttern, die eines gemeinsam haben: Ihre Töchter unbedingt vor den Gefahren dieser Welt schützen zu wollen. Es ist ein Buch über Mütter und Töchter, über enge, fast symbiotische Beziehungen und den manchmal schmerzhaften Konsequenzen des Instinkts, alles für sein Kind tun zu wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 267
Ähnliche
Cover
Titel
Gøhril Gabrielsen
Zwischen Nord und Nacht
Roman
Aus dem Norwegischen von Hanna Granz
Insel Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel Mellom nord og natt bei Aschehoug, Oslo.
eBook Insel Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2022.
© der deutschsprachigen AusgabeInsel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2022© Gøhril GabrielsenFirst published by H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS, Oslo 2021Published in agreement with Oslo Literary Agency
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Umschlagfoto: KuS/plainpicture, Hamburg
eISBN 978-3-458-77509-6
www.suhrkamp.de
Motto
Ich ging zu allen, aber kam zu niemand.
Friedrich Nietzsche
Nun wollen wir dir das Geheimnis deines Lebens sagen: der Schlüssel zu allen Geheimnissen liegt im Gras am Himbeerhügel.
Edith Södergran, Die Bäume meiner Kindheit
Zwischen Nord und Nacht
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Motto
Prolog
1.
2.
1.
Ich
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Helena
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2.
Ich
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Helena
1.
2.
3.
4.
5.
Ich
1.
2.
3.
4.
Helena
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3.
Ich
1.
2.
3.
Helena
1.
2.
3.
4.
5.
Helena
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4.
Ich
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Helena
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ich
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5.
Helena, knapp zwei Wochen später
1.
2.
3.
4.
5.
Helena, dreiunddreißig Jahre später
1.
6.
Ich, zwei Jahre später
Ich sehne mich nach dem Land, das nicht ist, denn alles, was ist, bin ich müde zu begehren.
Der Mond erzählt mir in silbernen Runen vom Land, das nicht ist.
Vom Land, in dem all unsere Wünsche wunderbar in Erfüllung gehen, vom Land, in dem unsere Ketten fallen,
vom Land, in dem wir unsere zermaterte Stirn im Mondtau kühlen.
Mein Leben war ein heißer Wahn.
Doch eins habe ich gefunden und wirklich gewonnen – den Weg in das Land, das nicht ist.
Im Land, das nicht ist, geht mein Geliebter mit funkelnder Krone.
Wer ist mein Geliebter? Die Nacht ist finster und die Sterne zittern Antwort.
Wer ist mein Geliebter? Wie lautet sein Name?
Die Himmel wölben sich höher und höher, und ein Menschenkind ertrinkt in endlosen Nebeln und weiß keine Antwort.
Doch ein Menschenkind ist nichts als Gewissheit,
und es streckt seine Arme höher als alle Himmel.
Und es kommt eine Antwort: Ich bin der, den du liebst und immer lieben wirst.
NACHWORT
1.
2.
Literaturverzeichnis
Gedichtnachweise
Informationen zum Buch
Prolog
1.
Ich lebe allein und abgeschieden, und aus Mangel an Gesellschaft stehe ich oft am Küchenfenster und schaue nach draußen. Ich betrachte die Stämme der Kiefern und Fichten, die Zweige der Ebereschen und Wacholderbeerensträucher, und ich betrachte den Waldboden zwischen den Bäumen.
Im Sommer, im klaren, hochstehenden Licht, schaue ich in ein Dickicht aus grünen Beerenhügeln, sprießendem Heidekraut und weißen Moosansammlungen. Im Winter sehe ich die Sonne in unsteten Strahlen durch die Zweige dringen, und bei Vollmond werfen die Stämme lange Schatten auf den Schnee, der im Mondlicht bläulich schimmert.
Nichts da draußen steht still, auch wenn es für einen rastlosen Blick so erscheinen mag. Bin ich aufmerksam genug, kann ich sehen, wie der Wind mit seinen unsichtbaren Händen durch die Baumkronen fährt und sacht an den Zweigen rüttelt, und wenn ich hinausschaue und gerade einmal nichts passiert, etwa nach der Schneeschmelze im Frühling oder bis zum ersten Frost im Herbst, dann weiß ich doch, dass die Baumstämme in Bewegung sind. Sie wachsen, selbst wenn sie es so langsam tun, dass ich es nicht sehen kann. Sie wachsen, wie im Unterholz neue Triebe wachsen, wie das Moos wächst, Halme und Gräser. Und so wie ich hoffentlich an den Erfahrungen wachse, die ich mache, auch wenn ich das am Fenster stehend nicht spüren kann.
Hin und wieder kommt es vor, dass die Bäume neue Formen annehmen, vor allem nach starkem Regen. Die Zweige, die schwer von den Stämmen herabhängen, kratzen über das Unterholz mit seinem Fell aus schütteren Nadeln, und von den Wurzeln bis zur Mitte des Stammes ist die Rinde dunkel vor Feuchtigkeit, es ist, als stünden die Bäume wie Obdachlose da, verfroren und pitschnass. Sie wollen rein, denke ich dann manchmal. Sie wollen reinkommen und mir erzählen, wie es ist, sich so verloren zu fühlen. Sie wollen rein und unter Balken und Lattenwerk sein, die einst ihresgleichen waren.
Wenn die Sonne ihren niedrigsten Stand erreicht, etwa bei Sonnenuntergang im Frühling und Herbst, erscheinen im rötlichen, gedämpften Licht manchmal Motive auf der Rinde. Meist sehe ich darin Tiergesichter, märchenhaft und verzerrt, aber ich habe auch schon Muster gesehen, die an menschliche Züge erinnerten.
Und dann, eines Nachmittags erkenne ich überraschend klar und deutlich Tors Gesicht. Ich hatte eine Weile vergessen, wie er aussah, aber mit einem Mal sehe ich ihn genau so ins Sonnenlicht blinzeln, wie er es immer getan hat, abwartend, in sich gekehrt, die Brauen zu einer Spitze über der Nasenwurzel zusammengezogen. Ich trete zurück, verlasse das Fenster, plötzlich nervös, werde wieder an ihn und die unglücklichen Ereignisse vor knapp zwei Jahren erinnert. Aber es nützt nichts. Ich habe ihn gesehen, und damit ist alles, was meiner Tochter und dadurch auch mir geschehen ist, erneut zum Leben erwacht. Die Ereignisse sind in meinem Bewusstsein anscheinend noch immer nicht verblichen, vergessen oder vergangen, sondern ebenso präsent wie der Baum da draußen. Und obwohl ich versuche, mir ganz andere Formen und Gesichtszüge vorzustellen, ist es tatsächlich auch in den darauffolgenden Tagen immer noch Tor, den ich in der Maserung des Stamms erkenne, jedes Mal, wenn ich aus dem Fenster schaue.
Etwas in mir beharrt darauf, sich an ihn zu erinnern, und möglicherweise werde ich das auch für immer tun, sein Gesicht in jeder erdenklichen Oberfläche erkennen, solange ich mich weigere, mich mit dem, was geschehen ist, auseinanderzusetzen. Wenn er verschwinden soll, müssen die Ereignisse ans Licht. Und wenn die Ereignisse ans Licht sollen, muss die Leerstelle in der Geschichte geschlossen werden, und zwar durch sorgfältiges Verknüpfen und Zusammennähen aller einzelnen Fäden und Fetzen, bis der Riss, den die Trauer in mir verursacht hat, repariert ist.
2.
Edith Södergran schrieb über den Baum: Es wuchs einst ein Baum im Walde – so schön und so mächtig – ich hatte es gesehen … Über den Nebeln der Tiefe erhob er sich zu den Zinnen der Erde in einsamem Glanz.
Und sie schrieb über Schuld und Reue: Wir werden Buße tun in den einsamen Wäldern. / Wir werden einzelne Lichter anzünden über der Heide. / Wir werden uns erheben – einer nach dem anderen.
Seit ich als Sechzehnjährige eine Fernsehdokumentation über Edith Södergrans Leben in Raivola auf der Karelischen Halbinsel gesehen habe, wende ich mich ihren Gedichten zu, wenn ich eine Antwort suche oder etwas im Leben nicht verstehe. Das Thema der Doku, die Geschichte und wie sie erzählt wurde, berührten mich damals sehr: Eine junge Frau, an Tuberkulose erkrankt, schreibt Gedichte, um dann, im Alter von nur dreißig Jahren, allein und mittellos zu sterben. Über der Handlung schwebte eine finnlandschwedische Erzählstimme, die Södergrans Gedichte in einem harten und abgehackten Tonfall rezitierte, in einer eintönigen, psalmenhaften Melodie – die für mich, auf dem Teppich vor dem Bildschirm kauernd, wie ein Gesang in einer uralten Sprache klang. Stimmungen und Bilder trieben von einem Ort auf mich zu, von dem ich bisher nicht gewusst hatte, dass es ihn gab, und als am Ende der Sendung ein Gedicht erklang, das die junge Frau kurz vor ihrem Tod geschrieben hatte, wurde mir schwindlig, denn aus den Worten der Mond erzählt mir in silbernen Runen / vom Land, das nicht ist, begriff ich plötzlich, dass der Boden, auf dem ich saß, und das Zimmer, das mich umgab, eine unsichtbare und ganz andere Wirklichkeit verbargen, einen Ort, an dem die Vernunft nicht gilt und an dem sie all demjenigen, was unaufhörlich im Werden begriffen ist, nachgibt. Eine Welt, in der sich die Seele manifestiert und Gedichte entstehen können.
An diesem Ort will ich suchen, um die Leerstelle in meiner Geschichte zu füllen. In diesem Fließen können die Erinnerungen frei nach oben strömen, intuitiv und ungefiltert, bis die Vernunft oder das Verdrängen die Oberhand gewinnen. Doch das reicht noch nicht aus. Ich will Edith Södergran und ihre Mutter, Helena, sowie ihre Geschichte miteinbeziehen. Denn so viel weiß ich nach einem Leben mit Södergrans Gedichten und Werken: In dieser kleinen Familie geschah etwas, vielleicht ganz ähnlich dem, was mir und meiner Tochter widerfahren ist. Ein Ereignis, dem ich nun auf den Grund gehen will, um dadurch mich und das, was ich getan habe, zu verstehen und um mich anschließend erheben und die Ereignisse vor mir hertragen zu können, wie ein einzelnes Licht über der Heide.
Möglich, dass die erwachsene Edith Södergran mich einen Schmarotzer genannt hätte, einen Leichenwurm, eine Person, die sich von den Geschichten einer Toten ernährt. Wenn ich ihr jedoch weiter hineinfolge in das Gedicht über den Baum im Wald, wird man sich den Versen nach an den Baum erinnern, auch wenn er vom Blitz getroffen und zu Boden geschmettert wird, er wird weiterleben, solange das Gedicht über ihn existiert. Und darin finde ich eine Art Vergebung.
1.
Ich
1.
Am Johannisabend 1995, als meine Tochter vier Monate alt war, ging ich in den Garten unseres Reihenhauses. Ich war von der romantischen Idee erfüllt, die geheimnisvollen Kräfte dieses Abends zu nutzen und einen symbolischen Akt, ein kleines Ritual zu begehen, um Einfluss auf die Zukunft meiner Tochter zu nehmen, meine Wünsche für sie zu konkretisieren. Der Garten war klein und verwildert und von struppigen alten Ziersträuchern umgeben, auf der Wiese fand ich jedoch Weißklee und Gänseblümchen, neben den Grundmauern ein Stiefmütterchen, und von den Sträuchern riss ich einen halb aufgeblühten Rhododendron ab. Natürlich hätte ich eigentlich in die Felder gehen und dort einen Strauß pflücken müssen – altem Aberglauben zufolge liegt die Kraft in frischgepflückten Wiesenblumen –, doch da mich vor allem das Symbolische an diesem Brauch interessierte, dachte ich, dass diese vier Stängel schon ihren Zweck erfüllen würden. Ich ging ins Haus und die Treppe zum Schlafzimmer hinauf, wo meine Tochter in der Wiege lag und schlief, und legte die Gartenblumen unter ihr Kopfkissen, während ich meine Wünsche flüsterte, den wichtigsten zuerst. Mögest du glücklich werden, flüsterte ich und schob das Gänseblümchen unter ihr Kissen. Mögest du gesund bleiben und dich stets einer guten Konstitution erfreuen, mit diesen Worten ließ ich den Weißklee folgen. Mögest du talentiert und klug werden, sagte ich und legte das Stiefmütterchen an seinen Platz. Und zuletzt, während ich behutsam den Rhododendron hinterherschob: Mögest du schön werden.
Das waren meine Wünsche für ihre Zukunft, zugleich hatten sie einen egoistischen Hintergrund, waren es doch Wünsche, die Einfluss auf mich und mein Leben haben würden. Denn auch so konnte man es sehen: Ihr Glück würde meine Freiheit bedeuten, ihre Gesundheit meine Unabhängigkeit. Ihre Klugheit würde meine Integrität sichern, und ihre Schönheit alles andere kompensieren, falls die vorherigen Wünsche nur zum Teil in Erfüllung gingen. Ich spürte es bereits, als sie als Neugeborene an meiner Brust lag: Eine so heftige und starke Verbindung, dass der Gedanke an Trennung sich da schon als zwingende Notwendigkeit darstellte.
Als man mir unmittelbar nach der Geburt meine Tochter auf den Bauch legte, stellte ich erleichtert fest, dass alles so war, wie es sein sollte, sowohl was die Proportionen als auch was ihre Gesichtszüge anging, dass sie, die Neugeborene, ein gesundes Kind war. Aber wie sah sie eigentlich aus? Was war das Besondere an ihr, das ich so sehnlich zu erkennen wünschte? Ein paar Stunden später, als sie mir frisch gewaschen und steif wieder in die Arme gelegt wurde, untersuchte ich, wie wohl die meisten frischgebackenen Mütter, jeden Zentimeter ihres Körpers, ich starrte, schnupperte, sog sie ein, musterte Stirn und Ohren und Hals, ich öffnete ihren Mund, sah mir Gaumen und Zunge an, und nicht zuletzt untersuchte ich ihre Augen, deren Tiefe, die Gegenwärtigkeit ihres Blicks. Ich schob die Zipfel der Decke auseinander, streckte jedes ihrer Glieder, streichelte jeden Finger und Zeh, dennoch blieb sie unscharf und vage, unmöglich für mich zu erfassen und zu verstehen, im Gegensatz zu den anderen Neugeborenen um uns herum, die ich problemlos als kleine Individuen wahrnahm. Ich spürte, wie mein Blick verschwamm, ich sah sie und gleichzeitig auch nicht. Da war eine Schicht aus Unwirklichkeit zwischen uns, als ob die nötige Distanz, der objektive Blick fehlten. Ich schloss die Augen, konzentrierte mich, versuchte noch einmal, sie zu fassen, sie in mich aufzunehmen, wurde aber von einem seltsamen Prickeln verwirrt, das sich von meiner Wirbelsäule um die Brust bis in meine Arme ausbreitete. Was ich fühlte, war nichts Ausgesprochenes, nichts Bewusstes, aber ich glaube, ich empfand meine Tochter als eine Art neuen Körperteil, ein körperliches Anhängsel, unauflöslich mit mir verbunden und unmöglich von meinem eigenen Leben zu trennen. In diesem Gefühl von Schwere und Starre bekam ich keine Luft mehr und klingelte nach der Kinderpflegerin. Sie hörte sich aufmerksam an, was ich ihr zu sagen versuchte.
Es war eine schwere Geburt, ich gebe dir etwas, damit du schlafen kannst, danach wird es sich schon anders anfühlen, sagte sie und nahm mir das Kind aus den Armen.
Und dennoch. In all den Jahren kam es immer wieder vor, dass ich mich gefragt habe: Sehe ich sie jetzt – oder sehe ich immer noch uns beide? Als wäre es unmöglich, meine Tochter als Person zu begreifen, sie als etwas vollkommen Eigenständiges, von mir Getrenntes wahrzunehmen.
2.
Seitdem habe ich kontinuierlich an meiner Befreiung gearbeitet. Vorsichtig, ruckelnd und zupfend habe ich versucht, mich von diesem Anhängsel loszureißen, ja, diesen neuen Körperteil zu amputieren. Mir der Schritte bewusst, die geeignet waren, uns voneinander zu scheiden, sie von mir, mich von ihr, Maßnahmen, die die Verbindung und die Verantwortung lockern und meine Tochter nach und nach unabhängig und selbstständig machen würden. Ich habe den Weg freigeräumt, Hindernisse entfernt und ihr die Möglichkeiten aufgezeigt, das ist alles, den Rest musste sie selber schaffen.
Als sie drei war, sagte ich: Hier sind Pullover und Hose, jetzt kannst du dich alleine anziehen. Als sie in die zweite Klasse kam: Von jetzt an kannst du dir dein Pausenbrot selbst schmieren. Als sie in die siebte ging: Es ist dein Leben, du kannst dich nicht immer auf mich verlassen. Und als sie mit der Gesamtschule fertig war: Erwarte kein Glück, du musst es dir schon selbst erarbeiten. Das mag gnadenlos und hart klingen. Gleichzeitig war mir bewusst, dass Selbstständigkeit und Unabhängigkeit durch sanfte Anleitung innerhalb eines sicheren und liebevollen Rahmens entstehen.
Als meine Tochter klein war, kam ich nach der Arbeit immer sofort nach Hause, ich hielt mich an Absprachen, ich sang und las ihr vor, ich gab ihr einen Gutenachtkuss. Ich trank in ihrer Gegenwart nicht übermäßig, und sie wachte nie im Chaos oder mit fremden Männern im Haus auf. Es gab feste Zeiten für Frühstück, Mittagessen und Abendbrot. Ich ermutigte sie, ich sagte: Das schaffst du, wenn sie fiel und sich Ellbogen und Knie blutig schlug, das schaffst du, wenn sie nachts aufwachte und nicht alleine weiterschlafen wollte, und ich wiederholte meine Ermutigung, wenn sie blass und müde über ihren Hausaufgaben saß: Das schaffst du. Ich versicherte sie meiner Liebe und sagte häufig: Ich hab dich lieb. Und wenn sie nach ihrem Vater fragte, warum sie ihn so selten sähe, log ich und sagte, sie sei sein allergrößter Schatz, seine Arbeit erlaube jedoch nicht, dass sie mehr Zeit miteinander verbrächten. Nur um sie froh zu machen.
Ich habe zielstrebig und konkret an ihrer Unabhängigkeit gearbeitet. Meine Tochter war wie Lehm in meinen Händen, unsicher und instabil in den ersten Umdrehungen, aber je fester ich sie hielt, desto sicherer und stabiler würde sie werden, um dann eines Tages als sie selbst dazustehen, fertig und bereit für das Leben, für das sie sich entschied.
Das war der Plan. Das war der lange Weg zurück zu mir selbst, und damit auch zu ihrer Zukunft.
3.
Mein Bedürfnis nach Trennung hatte seine Gründe. Die Symbiose – dieser fließende Zustand mit seinen unscharfen Grenzen, der bedeutete, dass mein Leben untrennbar mit ihrem verbunden war, dass ich einatmete, was sie ausatmete, genauso wie alles, was sie absorbierte, an mich weiterging, oder dass alles Glück und Unglück, das der einen zufiel oder geschah, im nächsten Augenblick der anderen gehörten; das und noch vieles mehr flößten mir die quälende Furcht ein, nicht zu genügen. Ein überwältigendes Gefühl von Hilflosigkeit, weil die Verantwortung mir größer vorkam, als ich tragen konnte. Ein Geschwisterchen zum Beispiel, das sie sich lange gewünscht hatte, wäre zu viel gewesen. Meine Fürsorge reichte nicht für drei, ich hatte gerade genug für zwei, genug für sie und genug für mich selbst. Ihr Vater war natürlich auch ab und zu da, aber er war nie mit uns beiden zusammen. Es gab entweder sie und ihn – oder sie und mich. Und meistens, ja, eigentlich immer, waren es sie und ich. Großeltern, Tanten und Onkel gab es auch, aber da sie ein ganzes Stück entfernt wohnten, bestand kein regelmäßiger Kontakt. Es gab sie und mich, Tag für Tag, jahrein, jahraus. Wir zwei bildeten unsere kleine Familie.
Das Gefühl der Unzulänglichkeit manifestierte sich bei mir zum ersten Mal, als ich elf oder zwölf war. Aus irgendwelchen Gründen hatte sich in meinem Zimmer ein großes Durcheinander angesammelt, ein Chaos aus Büchern, Tassen und Gläsern und nicht zuletzt Klamotten, die überall auf dem Boden verstreut lagen, und in dem Versuch, endlich Ordnung zu schaffen, stopfte ich alles, was aus Stoff war, in den Kleiderschrank, inklusive eines alten Federbetts, das noch von der Übernachtung einer Freundin herumlag. Meine Katze hatte zu dem Zeitpunkt zwei Junge, und als die Mutter gegen Abend zu maunzen und zu klagen begann, stellte ich fest, dass eins der Jungen verschwunden war, ein graugesprenkelter Knirps mit dickem, flauschigem Fell. Ich durchsuchte das ganze Haus und schließlich auch mein Zimmer, wo die Schranktür nur angelehnt war, einfach, weil sie sich nicht schließen ließ gegen den Druck all der Dinge, die ich hineingestopft hatte. Als ich die Tür nun öffnete und mit den Händen umherzutasten begann, merkte ich sofort, dass etwas nicht stimmte. Es war dieser Geruch, eine Ausdünstung von etwas Warmem, Verschwitztem, das, wie ich kurz darauf feststellte, vom Keuchen und verzweifelten Strampeln des Katzenjungen herrühren musste. Ich fand es tief drinnen in der Decke, eingewickelt in das zerknautschte Inlett, schlaff und mit völlig durchnässtem Fell. Es hatte sich in meine Unordnung hineingewühlt, aber keinen Weg aus dem Chaos herausgefunden, meine Schlampigkeit, meine Dummheit waren schuld daran, dass es so kläglich gestorben war. Es war unerträglich. Ich weinte und trauerte, gleichzeitig wurde das Zimmer für mich zu vermintem Terrain, unmöglich hineinzugehen oder sich darin aufzuhalten. Ich schloss die Tür ab, ließ das Zimmer mehrere Wochen zugesperrt und schlief stattdessen bei meiner Schwester. Ich ertrug das Wissen nicht, was meine Unordnung angerichtet hatte, vermochte aber auch nicht, mich zusammenzureißen und aufzuräumen, es war besser, so zu tun, als wäre nichts geschehen und als würde das Chaos gar nicht existieren.
Ich fühlte mich nie wieder wohl in diesem Zimmer, trotz der Wiederherstellung von Ordnung und Sauberkeit. Jeder Winkel, jede Wand des kleinen Vierecks stand als Zeuge da und erinnerte mich täglich daran, wozu meine Unzulänglichkeit führen konnte.
Und tatsächlich, im Jahr darauf manifestierte sich das Gefühl erneut, ebenso eindringlich wie berechtigt, eine Unzulänglichkeit, die in der Konsequenz letztlich in Ohnmacht überging:
Ein Paar aus der Nachbarschaft hatte mich zum Babysitten engagiert, wir hatten vereinbart, dass ich bis kurz nach Mitternacht auf die zweijährige Tochter aufpassen sollte, während die Eltern ein paar Kilometer entfernt zu einem Weihnachtsbuffet ins Restaurant gingen. Kurz zusammengefasst, wachte das kleine Mädchen gegen zwölf Uhr auf, und als ich in ihr Zimmer kam, um sie zu trösten, richtete sie sich in ihrem Gitterbett auf und begann wie am Spieß zu brüllen. Ich versuchte sie herauszunehmen, um ihr die Windel zu wechseln, aber sie strampelte und schrie und wand sich aus meinem Griff, und als ich ihr Milch geben wollte, schob sie die Flasche weg; sobald ich ihr zu nahe kam, kippte ihre Stimme ins Falsett. Damals gab es noch keine Handys, ich versuchte die Eltern zu kontaktierten, indem ich mehrmals im Restaurant anrief. Da aber niemand abnahm und das Tuten sinnlos verhallte, kam es mir vor, als wüchse das Heulen im Hintergrund zu einem stoßweisen Alarm an, immer ohrenbetäubender und gellender. Panik machte sich in mir breit, ich wusste einfach nicht, was ich tun, wie ich das Kind wieder beruhigen sollte. Irgendetwas brauchte es, irgendetwas wollte es haben, aber ich begriff nicht, was, und konnte es ihm nicht geben, ich war hilflos, und das merkte das Kind, was dazu führte, dass es immer weiter schrie, als wäre es in größter Not.
Die Wut und die Verzweiflung des kleinen Mädchens raubten mir alle Kräfte. In meinem Kopf tauchten Bilder von so wütenden Kindern auf, dass es fast schon an Bosheit grenzte, aber auch von Kindern, die aus dem Fenster oder von Dächern fallen gelassen wurden, kleinen Körpern, die aufplatzten, und von spritzendem Blut. Und wenn ich auch Angst vor dem kleinen Mädchen und den ihr innewohnenden Kräften hatte, so fürchtete ich doch am allermeisten mich selbst, meine Panik vermischt mit einem Gefühl von etwas Weichem und Blassem, wozu ich in meiner Ohnmacht möglicherweise imstande wäre. Am besten mache ich die Zimmertür zu, dachte ich, lasse das Kind in seinem Gitterbett schreien und gehe nach Hause. Und das tat ich. Ich verließ das weinende Mädchen, ganz allein und auf sich selbst zurückgeworfen, und verteidigte diese Flucht vor mir selbst so gut ich konnte. Sie würde bald von ihren Eltern getröstet werden, ich hatte wirklich alles versucht, und es hatte nicht genügt. Es hat nicht genügt, entschuldigte ich mich vor mir selbst im Davoneilen immer wieder, erlöst von der Aufgabe und froh, entkommen zu sein, doch das schlechte Gewissen verfolgte mich, holte mich ein und überwältigte mich, flüsterte mir zu, ich wäre böse und tauge zu nichts, ein Kleinkind allein zu lassen sei unverzeihlich.
Meine dunklen Seiten waren an die Oberfläche getreten, eine Kälte aus einer unbekannten Tiefe, und das entsetzte mich, als hätte ich an einem heißen Sommertag plötzlich Frost aus meinem Mund dringen sehen.
Als das Gefühl ein paar Jahre später zum dritten Mal auftrat, verfestigte sich die Unzulänglichkeit als grundlegender Zug meines Charakters. Es passierte nach einem Zwischenfall im Internat, in dem ich damals wohnte, genauer gesagt in der Waschküche, die alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam nutzten. Die Waschmaschinen waren oft besetzt, und statt zu warten, bis ich an der Reihe war, kam es vor, dass ich die schmutzige Wäsche in einer Wanne einweichen ließ, die ich auf einer Bank unter dem Waschbecken abstellte. Einmal ließ ich ein paar Pullover und Socken zu lange im Wasser liegen. Es bildete sich eine schleimige Brühe, eine Mischung aus Waschmittel und Schmutz, und nachdem mehrere Tage, ja, Wochen vergangen waren, eine Art Schwamm, der zu einer Scholle zusammenwuchs und auf der Wasseroberfläche trieb. Wieder schaffte ich es nicht, mich zusammenzureißen und zu tun, was nötig war, ich ließ Wasser und Kleidungsstücke einfach verrotten, obwohl die anderen zu reden anfingen und sich über den Gestank beschwerten. Wie kann man nur so faul und schlampig sein, sagten sie zueinander, wem gehört bloß dieser Dreck. Mehrere Mitbewohner gerieten in Verdacht, und besonders ein Junge, ein Typ mit fettigen Haaren und schwarzen Rändern unter den Fingernägeln. Die Mädchen schüttelten sich vor Verachtung, und obwohl ich hörte, wie hinter seinem Rücken getuschelt wurde, und sah, wie sie ihn ausgrenzten, unternahm ich nichts. Und eines Tages war die Wanne mit meiner Schmutzwäsche fort.
Danach erlebte ich immer wieder ähnliche Situationen. Es war ein Beweis meiner Schlamperei, eines Schlendrians, ja, aber auch Ausdruck einer Schwäche, die ich nicht richtig erklären kann. Eins jedenfalls war sicher: Auf mich war kein Verlass. Man musste damit rechnen, dass ich versagte. Ich ließ selbst die Allerschwächsten, die Verletzlichen und Hilflosen im Stich. Niemand durfte in Abhängigkeit von mir geraten, am wenigsten ein Kind. Sollte es dennoch geschehen, musste ich die Schwäche eindämmen und in den Griff bekommen, und zwar, indem ich Zuflucht in ihrem Gegenteil suchte, im Glauben an Kontrolle und Autorität. Oder, wie ich seit ein paar Jahren manchmal denke: Die Schwäche kann nur behoben werden, indem man sich zu ihr in all ihrer Grausamkeit bekennt.
4.
Als meine Tochter ein Baby war, wurde jedes einzelne ihrer Kleidungsstücke gebügelt, hübsch ordentlich zusammengelegt und gestapelt, die Bettwäsche wurde häufig gewechselt, ich wusch und schrubbte den Kinderwagen, das Bett und ihr Spielzeug, bis ich von einer Ordnung umgeben war, die bestätigte, dass ich als Mutter taugte und die Dinge im Griff hatte. Ich wechselte meiner Tochter die Windel, sobald sie roch, ich achtete auf Erbrochenes, Flecken und Grind, ich duschte und badete sie morgens und abends. Ich war permanent in Bereitschaft, für den Fall, dass jemand zu Besuch kam, für den Fall einer Kontrolle, für den Fall eines Gerüchts, für den Fall langanhaltenden Weinens, für den Fall, dass Gott-weiß-was nicht den Anforderungen entsprach. Natürlich war das etwas, womit ich spielte, dieser Gedanke an unangekündigten Besuch, aber er war getrieben von Selbstbeherrschung und hatte seine klare Funktion. Denn was, wenn ich alles aufgeben würde? Das Kind. Wenn ich die Tür schloss und den Dingen ihren Lauf ließ?
Zu Hause, wo nur sie und ich uns zueinander verhielten, waren wir jeweils das Maß für den Zustand der anderen, täglich wurde mir bestätigt, dass ich als Mutter genügte, aber auch als Mitmensch. Wenn sie aufwachte, lächelte meine Tochter und streckte die Arme nach mir aus, sie lachte hingebungsvoll, herzlich und frei, einfach so und ohne konkreten Anlass. Es überwältigte mich. Woher kam diese Freude? War ich der Auslöser, war ich diejenige, die sie ermöglichte?
Ich ging förmlich auf in ihrem Geruch, in den weichen Falten um ihre Glieder, und wenn ich mit meinem Blick ihrem folgte, rückte mir die Welt noch ein wenig näher. Trennung und Loslösung wurden eher zu einer Idee, einer Behauptung, denn mit den Augen meiner Tochter sah ich Vögel zu Vögeln werden und Blumen zu Blumen, und gemeinsam mit ihr hörte ich plötzlich den Wind und das Rascheln der Laubbäume. Wir waren der Mittelpunkt der wundervollen Ereignisse des Lebens, und wenn sich der Sonnenschein über den Himmel ergoss, war es, als umschlösse das Lichtmeer uns allein.
Hin und wieder wachte sie auch weinend auf, ein untröstliches Schreien, das sich nicht beruhigen ließ, ihr Blick war dann fern und sie heulte ohne Unterlass, als würde sie immer noch schlafen und träumen. Dann wiegte und schaukelte ich sie, ich sang und flüsterte, ich nahm sie hoch und trug sie herum, und eines Abends, als gar nichts half, ging ich ins Bad und stellte mich mit ihr vor den Spiegel, in der Hoffnung, sie würde aufhören, wenn sie sich ihrer selbst bewusst würde. Aber als ich mich selbst sah, mein eigenes Spiegelbild und dessen Augen, vermochte ich kaum, mich in meinem eigenen Blick zu verankern oder meine Existenz klar und deutlich von ihrer zu trennen. Denn auf dieselbe Weise, wie ich von ihr entfernt war, war ich auch von mir selbst entfernt, jedem Schrei, den sie ausstieß, vollkommen ausgeliefert, eins mit der Verzweiflung, der Ohnmacht und ihrer wortlosen Wut – als wäre ich ein Kind und keine Erwachsene, als wäre ich sie und nicht ihre Mutter, als hätte mich ein Wille, der viel stärker war als meiner, gefressen und verschlungen und verzehrt – und plötzlich dachte ich: Jetzt tue ich es, jetzt werfe ich sie aus dem Fenster. Ein Zittern lief durch meine Hände, ich sah vor mir, wie sie fiel und hörte den Aufprall, mit dem sie auf den Boden traf, der Gedanke war ganz kalt und klar. Aber ich tat es nicht, ich blieb stehen, hielt sie fest, trotz meiner Unzulänglichkeit und meines schwachen Charakters. Es hing mir nach, als sie wieder in Schlaf fiel, ein Gefühl von Austilgung und Verschmelzung, wie in einem Wir und Uns aufzugehen, und gleichzeitig, dass ich die Kraft hatte, uns beide zu ertragen.
5.
Es dauerte grenzwertig lange, bis sie einen Namen bekam. Ich fand keinen, der zu ihr passte; es sollte ein Name sein, der ihr Gemüt und ihr Gesicht in einer bestimmten Klangfolge zusammenfasste, eine exakte Mischung aus Konsonanten und Vokalen, die sie von mir unterschied und sie als Person sichtbar machte. Alle Namen, die mir einfielen, waren wie Schubladen ohne Inhalt, Rahmen ohne Bild, ich fand keinen, der ihr zwischen den Menschen, die ich kannte, einen Platz zugewiesen hätte, Menschen, die den Namen, den sie bekommen hatten, ausfüllten. Als das Einwohnermeldeamt nach fünf Monaten die zweite Mahnung schickte – eine Mahnung, von der ich fürchtete, dass sie etwas Größeres auslösen könnte, eine Kontrolle, eine Überprüfung meiner Tauglichkeit als Mutter –, begann ich mich umzuhören, welche Namen Bekannten von mir gefielen, was eine Nachbarin schön oder eine Freundin passend fand, und verwirrt und ängstlich wie ich war, wählte ich schließlich willkürlich einen aus, einen Namen, den jemand, zu dem ich damals aufsah, vorschlug und von dem ich deshalb glaubte, er wäre richtig. So kam es, dass sie einen Namen bekam, den sehr viele Mädchen ihres Alters tragen, einen Namen ohne Charakter, der ihr nach all den Jahren immer noch keinen eigenen Platz beschert hat, einen Namen, der an ihr hängt wie eine falsche Flagge oder ein merkwürdiger Ton.
Für mich ist sie Lu, denn das verbinde ich mit Nähe, und so habe ich selbst sie seit ihrer Geburt genannt.
6.
Erst später, als Lu mit anderen Kindern zusammenkam, bemerkte ich, dass sie anders war. Ich verglich sie mit Gleichaltrigen, Älteren und Jüngeren, Jungen wie Mädchen und stellte fest, dass sie sich von ihnen unterschied. Erst im Kindergarten und auf dem Spielplatz, dann in der Schule und bei Freizeitaktivitäten. Ich stellte fest, dass ihr Pony zu dünn und zu lang war und ihre Pullover an den Ärmeln zu kurz, ich stellte fest, dass ihre Kleidung verwaschen und aus der Form geraten und die Farben ausgeblichen waren. Ich stellte fest, dass es unpassend war, zu Geburtstagsfeiern in T-Shirt und Jogginghose zu erscheinen, und dass Cherrox-Stiefel bei Eiseskälte nicht taugten. Es war meine Unzulänglichkeit, die hier sichtbar wurde, aber mein Kind, an dem sie sich offenbarte. Sie trug sie wie ein Mal und legte sie bloß, stellte sie zur Schau, und egal, wie sehr es eigentlich auf mich zurückfiel, war es, als ob meine Unzulänglichkeit wüchse und sich in Form physischer Mängel an ihr manifestierte. Wuchsen ihre Zähne nicht unregelmäßig? Standen ihre Ohren nicht allzu sehr ab? Und ihre Arme und Beine, wirkte es nicht ungelenk, wie sie damit herumwirbelte?