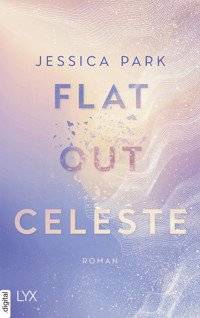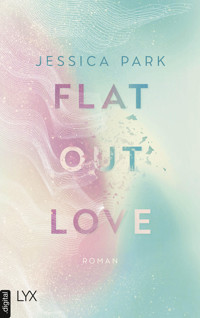9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Manchmal passiert das Unerwartete. Manchmal bringt dich jemand dazu, deine eigenen Regeln zu brechen.
Nachdem sie als Kind von Pflegefamilie zu Pflegefamilie gereicht wurde, glaubt Allison nicht mehr daran, dass irgendetwas im Leben von Dauer ist. Sie verbringt ihre Zeit am College zurückgezogen und meidet den Kontakt zu anderen. Das ändert sich, als sie zufällig Teil eines sozialen Experiments wird: 180 Sekunden soll sie Augenkontakt mit einem Fremden halten. Doch weder sie noch Esben, der Social-Media-Star, der ihr gegenübersitzt, rechnen damit, dass dies ihr Leben für immer verändert ...
"Eines dieser Bücher, die Besitz von deinem Herz ergreifen und es nie wieder loslassen. Ihr werdet euch in Allison und Esben verlieben." THE BOOKISH SISTERS
Der große Self-Publishing-Erfolg aus den USA - endlich auf Deutsch!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Die Autorin
Romane bei LYX
Impressum
JESSICA PARK
180 Seconds
UND MEINE WELT IST DEINE
Roman
Ins Deutsche übertragen von Hannah Brosch
Zu diesem Buch
180 Sekunden können dein ganzes Leben verändern …
Nachdem sie als Kind von Pflegefamilie zu Pflegefamilie gereicht wurde, glaubt Allison nicht mehr daran, dass irgendetwas im Leben von Dauer ist. Sie verbringt ihre Zeit am College zurückgezogen und meidet den Kontakt zu anderen. Das ändert sich, als sie zufällig Teil eines sozialen Experiments wird: 180 Sekunden soll sie Augenkontakt mit einem Fremden halten. Doch weder sie noch Esben, der Social-Media-Star, der ihr gegenübersitzt, rechnen damit, dass dies ihr Leben für immer verändert …
Dieses Buch ist Danielle Allman gewidmet. Weil sie tapfer ist, so tapfer, so durch und durch tapfer.
1
Vögelchen
Das dritte Collegejahr fängt an, was bedeutet, dass es nur noch zwei Jahre dauert, bis ich frei bin. Jeden Tag werde ich daran erinnert, wie sehr ich mich von meinen Kommilitonen unterscheide, und mir ist permanent bewusst, dass ich nicht in der Lage bin, gesellig, glücklich und unbeschwert zu sein. Es ist nicht immer leicht, mich hier für mich zu halten, doch ich tue mein Bestes.
Simon muss zwanzig Minuten lang um den Campus von Andrews College herumfahren, um einen Parkplatz zu finden. Am Ankunftstag herrscht hier immer völliges Chaos. Studenten strömen aus Autos, vollbepackt mit Kisten und Taschen, die ganze Straße ist in Zweierreihen zugeparkt, und überall stehen Eltern, mit Tränen in den Augen, im Weg. Die Fahrt von Boston nach Nord-Maine hat fast fünf Stunden gedauert, und dieser Tag Anfang September fühlt sich eher nach August an als nach Herbstanfang. So ist das in New England. Wegen der mangelhaften Klimaanlage bin ich verschwitzt, doch beim Aussteigen versuche ich, mir mit meinem T-Shirt unauffällig Luft zuzuwedeln, während ich mich an dem leichten Wind erfreue.
»Das mit der Klimaanlage tut mir leid«, meint Simon entschuldigend. »Dieses Auto ist alt, aber es erfüllt seinen Zweck.« Von der Fahrertür aus schaut er mich über das Auto hinweg an und lächelt versonnen, während er die Motorhaube tätschelt und dabei trotz der Hitze fit aussieht. »Sie ist zu einem schlechten Zeitpunkt ausgefallen, ich weiß. Lass es uns als eine Art Wellness-Entgiftung betrachten, so was ist doch gerade angesagt. Volvo würde das bestimmt prima finden.«
Ich lächle und nicke. »Klar. Das dritte Jahr sollte mit irgendeiner Art von Reinigung beginnen.«
»Nicht wahr? Ehe du dich wieder voll ins Studentenleben stürzt und deinen Organismus verseuchst. Partys, Mensaessen …« Er macht eine Handbewegung, und ich weiß, er hofft, dass ich den Witz aufgreife.
Simon gibt sich große Mühe mit mir, und ich lasse ihn regelmäßig hängen. Ich bin mir dessen bewusst, aber zu mehr bin ich einfach nicht in der Lage. Es liegt nicht an ihm, sondern an mir. Er ist ein ausgesprochen netter Mann. Wahrscheinlich zu nett. Zu freigiebig und verständnisvoll.
Außerdem, rufe ich mir in Erinnerung, ist Simon mein Vater. Es ist peinlich, wie oft ich mir das in Erinnerung rufen muss, schließlich habe ich die Adoptionsunterlagen gesehen. Herrgott noch mal, ich war dabei, als sie unterzeichnet wurden und ich offiziell – und für immer – all die Pflegefamilien hinter mir ließ, mit immerhin sechzehneinhalb Jahren.
Ich erhasche einen Blick auf mein Spiegelbild in der Autoscheibe. Mein langes dunkles Haar ist zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden, dessen Gewicht sich auf meinem Rücken bleischwer anfühlt. Mein dichter Pony klebt mir vor lauter Schweiß an der Stirn, und meine Wangen sind gerötet.
Das ist jedoch keine Reaktion auf die Hitze. Das ist aufsteigende Angst.
Ich brauche Wasser.
Ich muss heute nicht nur eine neue Mitbewohnerin kennenlernen, sondern mich auch noch von Simon trennen. Um ihm eine peinliche Verabschiedung zu ersparen, nehme ich mir vor, mich zusammenzureißen und meine Rolle gut zu machen. Ich bin einfach nicht allzu gut darin, jemandes Tochter zu sein, aber ich will es versuchen. Obwohl er mir so viel bedeutet, fällt es mir immer noch schwer, ihm das zu zeigen.
Ich setze ein Lächeln auf und gehe um das Auto herum an den Kofferraum. »Denkst du, wir schaffen das in einer Tour?«, frage ich. »Wenn ja, lade ich dich zum Mittagessen ein.«
»Bei deinem scheußlichen Studentenwerk? Das ist kein wirklicher Anreiz.« Simon nimmt eine Kiste aus dem Kofferraum. Er versucht es zu verbergen, doch ich sehe, wie er grinst. »Ich trage deine Schuhe einzeln rein, wenn mich das davor bewahrt.«
»Tatsächlich dachte ich eher an ein arabisches Lokal nicht weit von hier.« Der Koffer, den ich heraushole, wiegt nicht viel. Ich bin Minimalistin, daher reise ich mit leichtem Gepäck.
Simon strafft sich, neigt den Kopf und zieht eine Augenbraue hoch, wobei er seine Freude nicht länger verbirgt. »Arabisch? Mit Schawarma? Und Hummus?«
Ich nicke. »Und Baba Ghanoush.«
Er verlagert die Kiste, sodass sie an seiner Hüfte ruht und er eine Hand frei hat. Er hebt die Stimme: »Nimm, was du kannst, und beeil dich! Nimm nur das mit, was du brauchst! Und jetzt nichts wie los!« Er zerrt eine kleine Reisetasche aus dem Auto und sprintet zum Gehsteig, während er mir über die Schulter zuruft: »Komm schon, Allison! Nicht trödeln!«
Ich lache, nehme die einzige andere Tasche, die ich besitze, hinten aus dem Auto und knalle dann den Kofferraum zu. Simon will mich nur ärgern, denn tatsächlich ist sein Auto bereits leer. Mein Adoptivvater versucht herunterzuspielen, dass ich nicht in der Lage bin, irgendwo richtig Wurzeln zu schlagen, weil ich mir selbst nur einen Bruchteil der Dinge zugestehe, mit denen andere Studenten ihre kleinen Wohnheimzimmer vollstopfen. Das erinnert mich wieder daran, wie lieb und verständnisvoll er ist, was meine Schwächen angeht. Während die meisten Studenten Stunden brauchen, um ihre Autos auszuladen und ihre Kisten aus den Lagerräumen auf dem Unigelände zu holen, haben wir das Auto innerhalb von fünf Sekunden leer.
Ich muss mich sputen, um Simon einzuholen – der ist so weit vorausgerannt, dass ich mich über meine Unfähigkeit, mit ihm mitzuhalten, ärgere –, und schleife dabei meinen Koffer die Treppe hoch und auch ein Stück über den Rasen, als ich eine Abkürzung zwischen den Wohnheimen hindurch nehme, um zu meinem zu gelangen. Außer Atem erreiche ich Kirk Hall, wo Simon auf der Umzugskiste hockt und völlig entspannt wirkt.
»Also ehrlich, Simon? Woher … woher wusstest du überhaupt, wo du hinmusst?«
»Ich habe mir letzte Woche den Lageplan des Unigeländes angeschaut. Und gestern irgendwie auch. Und dann noch mal heute Morgen, ehe wir los sind.« Simon schafft es auf wundersame Weise, so cool und attraktiv wie immer auszusehen, ohne eine Spur von Schweiß auf seinem roten Leinenhemd. Seine Frisur, die ihm stets modisch in die Stirn fällt, sitzt perfekt. Seine Fähigkeit, scheinbar ohne jegliche Mühe so ausgeglichen zu wirken, selbst in schwierigen Situationen, ist bewundernswert. Er wendet mir seine Pilotensonnenbrille zu. »Ich war erst ein paarmal hier oben, und ich kann doch nicht wie ein ahnungsloser Angehöriger aussehen, der darauf angewiesen ist, dass sein Kind ihm den Weg zeigt. Ich will aussehen, als wüsste ich, was ich tue.«
Ich fühle mich schlecht, weil ich ihn in den letzten zwei Jahren nicht öfter hierher eingeladen habe. Vielleicht wird es dieses Jahr ja anders. Vielleicht schaffe ich es dieses Jahr, ihn an mich heranzulassen. Das wäre schön.
Mein Herzschlag normalisiert sich allmählich, aber ich schwitze schon wieder. »Also bist du lieber wie ein Irrer über den Campus gehetzt?«
Er grinst. »Ja. Komm, schauen wir uns dein Zimmer an.«
Bei der Wohnungslotterie letztes Frühjahr hatte ich gehofft, ich würde Glück haben und eines der heiß begehrten Einzelzimmer ergattern, doch wie zu erwarten zog ich die Arschkarte. Ich hatte stundenlang angestanden, um mir auf einem schlecht gezeichneten Lageplan mein Zimmer auszusuchen, nur um festzustellen, dass alle Einzelzimmer bereits belegt waren. Unglaublich, dass man sich die Zimmer nicht online aussuchen konnte. Ich habe das vorsintflutliche System verflucht, während ich die letzten freien Zimmer durchging. Der zuständige Student fragte mich mehrmals, ob ich nicht eine Freundin wüsste, mit der ich mir das Zimmer teilen könnte, und ich habe ihn fünfmal abgeblockt, bis ich quasi schreien musste: »Nein, okay? Nein, ich habe niemandem, mit dem ich mir das Zimmer teilen kann. Deshalb will ich ja ein Einzelzimmer!«
Möglicherweise habe ich eine ziemliche Szene hingelegt, aber ich war zu sehr in Panik, als dass es mir etwas ausgemacht hätte. Schließlich entschied ich mich für eine halbe Zweiersuite, die mir wenigstens ein eigenes Schlafzimmer bot, zusammen mit einem Gemeinschaftsraum. Ich würde durch diesen kleinen Wohnbereich, den wir uns teilen würden, rein- und rausgehen müssen, aber ansonsten könnte ich wohl einigermaßen für mich bleiben. In positiv gestimmten Momenten wagte ein Teil von mir zu hoffen, dass diese mysteriöse Mitbewohnerin und ich uns vielleicht verstehen würden. Wunder gibt es schließlich immer wieder. Trotzdem habe ich jetzt Angst davor, sie zu treffen.
Es dauert nur ein paar Minuten, mich beim Wohnheim anzumelden und meinen Schlüssel zu bekommen. Dann betrete ich mit beträchtlichem Bangen meine Bleibe, die sich im Souterrain befindet.
Simon lacht, als ich hörbar aufatme. »Bist du erleichtert, dass sie noch nicht da ist?«
Ich ziehe meinen Koffer in eines der leeren Schlafzimmer und lasse mich dann auf das steinharte, scheußliche orange Sofa im Wohnbereich fallen. Simon holt sich einen Schreibtischstuhl aus meinem Zimmer und rollt ihn zu mir, ehe er sich darauf niederlässt. »Warum machst du dir solche Sorgen?«
Ich verschränke die Arme und schaue mich im Raum um, betrachte die Betonwände. »Ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Wahrscheinlich ist sie supernett. Bestimmt werden wir Seelenverwandte, und sie macht mir Zöpfe, und wir veranstalten leicht bekleidete Kissenschlachten und haben eine innige lesbische Liebesaffäre.« Ich kneife die Augen zusammen, als ich ein Spinnennetz entdecke. Bestimmt gibt es hier Spinneneier, und gleich schlüpft die Brut und verteilt sich im Zimmer.
»Allison?« Simon wartet, bis ich ihn anschaue. »Das geht nicht. Du kannst nicht lesbisch werden.«
»Warum nicht?«
»Weil es dann heißen wird, dass dein schwuler Adoptivvater dich auf magische Weise homosexuell gemacht hat, und alle werden viel Aufhebens darum machen, und wir müssen uns ätzende Theorien über Vererbung versus Erziehung anhören.«
»Stimmt.« Ich warte darauf, dass es Spinneneier regnet. »Dann gehe ich eben davon aus, dass sie einfach ein echt netter, normaler Mensch ist, mit dem ich keine sexuelle Beziehung anfangen will.«
»Schon besser«, räumt er ein. »Sie ist bestimmt nett. Eine gute geisteswissenschaftliche Uni wie diese hier zieht auch gute Studenten an. Die Leute hier sind anständig.« Er versucht mich zu beruhigen, aber es funktioniert nicht.
»Absolut«, sage ich. Ich streiche über den verschlissen aussehenden orangen Sofabezug, der Noppen hat und eindeutig aus Beton besteht. »Simon?«
»Ja, Allison?«
Ich seufze und hole ein paarmal Luft, während ich mit den scheußlichen Sofatroddeln spiele. »Wahrscheinlich hat sie Hörner.«
Er zuckt mit den Schultern. »Das halte ich für unwahrscheinlich.« Simon hält inne. »Obwohl …«
»Obwohl was?«, frage ich erschrocken.
Es folgt ein langes Schweigen, das mich nervös macht. Schließlich sagt er ganz langsam: »Es könnte sein, dass sie ein Horn hat.«
Ich wende ruckartig den Kopf und starre ihn an.
Simon klatscht in die Hände und versucht, mir ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. »Wie ein Einhorn! Oh Gott! Vielleicht ist deine Mitbewohnerin ja ein Einhorn!«
»Oder ein Nashorn«, bemerke ich. »Ein abscheuliches Killernashorn.«
»Das kann auch sein«, gibt er zu.
Ich seufze. »Die gute Nachricht: Sollte ich jemals einen Rückenkratzer brauchen, habe ich dieses borstige Sofa.« Ich lasse mich wieder gegen den groben Stoff fallen und strecke abwehrend die Hände aus, ehe er protestieren kann. »Ich weiß. Ich bin ein Ausbund an Optimismus.«
»Das ist für mich nichts Neues.« Der Blick seiner blauen Augen begegnet meinem. Seine Haut ist gebräunt und wettergegerbt, weil er den Sommer über an der Küste von Massachusetts segeln war, sein braunes Haar ist von der Sonne gebleicht, wo es noch nicht ergraut ist. Ich hätte ihn öfter auf diesen Reisen begleiten sollen. Nächsten Sommer, vielleicht nächsten Sommer …
»Ich finde, ein Rückenkratzer ist ein nicht zu unterschätzender Luxus, den das Andrews College dir da zur Verfügung stellt«, sagt er. »Also genieß es.«
Während ich mich in dem unwirtlichen Zimmer umschaue, fasse ich einen Entschluss: Ich werde dieser unbekannten Mitbewohnerin eine Chance geben. Ich werde mir einen Ruck geben und offen und freundlich sein. Vielleicht passen wir ja richtig gut zusammen. Diese Unibeziehung braucht keine wunderbare Freundschaft zu werden, die habe ich nämlich schon mit Steffi, meiner einzigen wahren Freundin, und in meinem Herzen ist kein Platz für mehr. Aber eine gute, funktionierende Beziehung zu einer Mitbewohnerin? Das könnte tatsächlich ganz nett sein.
Na ja, ganz nett ist vielleicht zu viel des Guten. Ich würde eher sagen erträglich.
Es klopft laut an der Tür, und sie öffnet sich, als ein großer Kerl mit Zottelbart und mehreren Perlenketten um den Hals hereinlinst. »Jo, bist du Allison?«
Ich nicke.
»Hey!«, sagt er strahlend. »Schön, dich kennenzulernen! Ich bin Brian, der Wohnheimsprecher. Hör zu, meine Liebe, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du in Kirk Hall bist. Das wird ein super Jahr!« Er reckt die Faust, und ich versuche, nicht zurückzuzucken. »Okay, Schwester, eine Sache. Deine Mitbewohnerin. Es gibt da ein kleines Problem mit ihr.«
»Wie meinst du das?«, frage ich.
»Na ja, also, sie kommt diese Jahr quasi nicht an die Uni. Hat irgendwas mit einer Antarktis-Reise und einem Seeleoparden zu tun.« Er verzieht das Gesicht. »Klingt für mich wenig attraktiv, aber sie wird sich ein paar Monate in einem Labor verkriechen und diese Tiere studieren, ehe sie aufbricht, um sie in der freien Natur zu erleben.«
Simon runzelt die Stirn. »Seeleoparden?«
»Ja, Alter.« Der Junge mit den Halsketten hält sich die Nase zu. »Die stinken garantiert. Du haust dieses Jahr dann wohl allein, Schnecke.« Plötzlich hellt sich seine Miene auf. »Aber hey! Heute Abend steigt eine geile Willkommensparty hier im Wohnheim! Im Aufenthaltsraum im dritten Stock! Da sehen wir uns!« Er zeigt auf mich und verschwindet dann, wobei er die Tür hinter sich zuschlägt.
Während Simon enttäuscht aussieht, weil ich keine Mitbewohnerin haben werde, hat sich meine Laune schlagartig gebessert. Ich bin eine Schnecke, die dieses Jahr alleine haust! »Komm, wir holen uns Baklava«, sage ich mit zu großer Begeisterung.
»Allison …«
»Was? Oh.« Ich zwinge mich dazu, einen betrübten Eindruck zu machen, und versuche, mir nicht anmerken zu lassen, dass diese Wendung mir tatsächlich einen gewissen Trost beschert. »Ich meine, es wäre bestimmt schön gewesen, mit jemandem zusammenzuwohnen, aber es ist schon okay. Dieses Mädchen wird sicher ein großartiges Jahr erleben. Das ist doch gut für sie, oder? Wusstest du, dass Seeleoparden eine Robbenart sind? ›Robbe‹ klingt irgendwie netter.«
Simon schlägt die Hände zusammen. »Nein, wusste ich nicht.« Er scheint nach den richtigen Worten zu suchen. »Schau, ich weiß, dass du keine Menschen magst, aber das bedeutet nicht, dass du dich freuen solltest, wenn …«
»Wenn jemand lieber ein Jahr lang erst in einem Labor und dann in der eisigen Tundra leben und ein böses und gruseliges Tier studieren will, anstatt mit mir zusammenzuwohnen?«
Er sieht traurig aus. »Ja. Es ist ja nicht so, als hätte sie dich gekannt und … zurückgewiesen. Sie folgt nur irgendeinem Traum, den sie hat oder so.«
Wir sitzen schweigend da, und irgendwann tut mein Hintern von dem kratzigen Sofa so weh, dass ich aufstehe und zu dem Raum hinübergehe, der das Schlafzimmer meiner Mitbewohnerin hätte sein sollen. Ich lehne mich mit dem Kopf an den Türrahmen und schaue zu Boden. »Es tut mir leid, dass ich keine Menschen mag. Es tut mir leid, dass ich so offensichtlich erleichtert wirke, dass ich alleine wohnen werde.«
»Ist schon okay«, antwortet er sanft. »Ich verstehe das.«
»Und es tut mir leid, dass ich so ein Pessimist bin.«
»Das verstehe ich auch.«
»Und es tut mir leid …« Ich finde keine Worte mehr. »Es tut mir einfach leid. Ich glaube, du hast einen Fehler gemacht. Mit mir.« Es ist das erste Mal, dass ich das ausspreche, was ich schon seit Jahren denke. Ich bin mir nicht sicher, warum es gerade jetzt rauskommt, aber ich bin mir im Allgemeinen nicht vieler Dinge sicher.
Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie Simon aufsteht und sich mir zuwendet. Leise, aber mit sehr fester Stimme sagt er: »Nein. Ich habe ganz sicher keinen Fehler mit dir gemacht.«
Weil er mich gut genug kennt, geht er nicht auf mich zu und erwartet keine Umarmung oder irgendeine andere emotionale oder körperliche Reaktion. Es muss Simon hoch angerechnet werden, dass er meine Grenzen respektiert. Er weiß, dass es mir nicht liegt, eine Beziehung aufzubauen.
Menschen sind nicht mein Fall.
Vertrauen ist nicht mein Ding.
»Außerdem weiß ich ganz sicher«, fährt er fort, »dass du mir ein Mittagessen schuldest.«
Also gehen wir zu dem kleinen arabischen Lokal, das einen Block vom Unigelände entfernt ist, und bestellen haufenweise Essen. Ich verbringe ziemlich viel Zeit damit, mich vollzustopfen, und eher wenig Zeit mit Reden, aber Simon schafft es, dass unser Schweigen sich nicht so peinlich anfühlt, wie es müsste.
»Ich frage mich, wie sie so ist«, murmle ich zwischen zwei Bissen. Kurz stelle ich mir vor, wie es wäre, eine typische College-Erfahrung zu machen, mit allem was dazugehört. Mit einer supertollen Mitbewohnerin, wenn ich bloß für eine solche Erfahrung offen wäre. Zu meinen letzten beiden Mitbewohnerinnen habe ich – wer hätte das gedacht – keinerlei Beziehung aufgebaut. Ich weiß, dass das an mir lag. »Vielleicht ist sie echt cool. Vielleicht wären wir Freundinnen geworden.«
Simon räuspert sich. Ihm ist klar, dass ich dummes Zeug labere.
»Aber«, fahre ich sachlich fort, »offensichtlich sind Seeleoparden die Liebe ihres Lebens, und da ich die absolut furchteinflößend finde, habe ich den Verdacht, dass es mit der Freundschaft sowieso nicht geklappt hätte. Es ist besser so.«
Langsam bekomme ich Kopfweh. Ich kippe mein Getränk hinunter und konzentriere mich dann darauf, mein Glas immer wieder mit Mineralwasser aufzufüllen.
»Was weißt du überhaupt über diese Tiere?«, unterbricht Simon meinen obsessiven Wasserkonsum. »Ich habe so gut wie noch nie von ihnen gehört.«
Ich brauche nur ein paar Sekunden, um auf meinem Handy ein Foto aufzurufen, und ich halte ihm das Display hin. »Sieh mal diese Zähne. Dieses Tier hat kleine Speere als Zähne.«
Simons Blick besagt, dass er sich geschlagen gibt. »Okay. Du hast recht. Das ist ein widerliches Tier. Sie hätte vielleicht nicht die beste Mitbewohnerin abgegeben.«
Zutiefst zufrieden lehne ich mich zurück, während meine Kopfschmerzen abklingen.
2
Wir bekommen einen
Um neun Uhr abends liege ich im Bett, glätte die frischen Laken und sorge dafür, dass die perfekte Falte, die auf meiner Brust ruht, ihre Form behält. Ein kleiner Tischventilator erzeugt genug Wind, dass ich in dieser warmen Nacht nicht ersticke. Das Geräusch der Studenten, die auf den Putz hauen und ihre Rückkehr auf den Campus feiern, sorgt dafür, dass sich mir der Magen verkrampft, deshalb lasse ich das kleine Fenster geschlossen. Das Surren des Ventilators übertönt die betrunkenen Partygänger zwar nur unzulänglich, aber immerhin ein bisschen.
Ein plötzliches Hämmern an meiner Tür lässt mich aufschrecken, und ich brauche einen Moment, um meine Panik zu unterdrücken, ehe ich zögernd aufmache.
»Allison! Wie war dein Sommer? Kommst du zur Wohnheimparty oben?« Ein zierliches Mädchen mit einem Plastikbecher in der Hand steht vor mir. Ihr blondiertes Haar steht in abenteuerlichen Formen von ihrem Kopf ab und landet dann direkt auf ihren Schultern. Ich kenne sie von ein paar Seminaren, die ich letztes Jahr hatte. Becky? Bella? Brooke? Irgendein Name mit B. Sie stutzt, als sie sieht, dass ich ein Tanktop und eine Schlafanzughose trage. »Oh. Wohl eher nicht«, sagt sie.
Ich öffne den Mund zu einem Lächeln. »Hey! Freut mich, dich zu sehen. Mein Gott! Du siehst echt toll aus! So schön gebräunt!« Ich schaffe es, so übertrieben begeistert zu klingen, dass ich selbst ganz überrascht von meiner Quietschstimme bin. »Ich bin echt fertig von den ganzen Partys zum Sommerende.« Ich setze eine vielsagende Miene auf und versuche den Eindruck zu erwecken, dass ich in den letzten paar Wochen so viele wilde und skandalöse Sachen unternommen habe, dass ich mich unter keinen Umständen zu einem weiteren gesellschaftlichen Ereignis aufraffen kann. Dann tue ich so, als müsste ich gähnen.
Das Mädchen mit dem B-Namen hebt verständnisvoll den Becher und nickt so energisch, dass eine ihrer Haarsträhnen in die Flüssigkeit eintaucht. »Alles klar. Na, dann ruh dich gut aus. Beim nächsten Mal, okay?«
Die Vorstellung, dass ich noch zwei weitere Jahre hier verbringen und soziale Kontakte abwenden muss, ist beängstigend. Wenn ich mir eine Tarnkappe überwerfen und damit zur Uni gehen könnte, würde ich es tun.
»Na klar …« Ich mache den fatalen Fehler, zu stocken, sodass sie merkt, dass ich mich beim besten Willen nicht an ihren Namen erinnern kann.
»Carmen«, sagt sie mit einem Anflug von Gereiztheit. »Carmen. Ich habe letztes Jahr neben dir gewohnt, und wir saßen zusammen in Literatur und in britischer Geschichte.«
»Ich weiß, wie du heißt, du Nuss!« Ich zermartere mir das Hirn nach etwas, das ich noch sagen könnte. Auch wenn ich nicht auf Partys gehen will, möchte ich wirklich nicht ihre Gefühle verletzen. In solchen Augenblicken wünsche ich mir so sehr, ich wäre weniger unbeholfen und linkisch. In einem mühevollen Versuch, freundlich zu sein, platzt es aus mir heraus: »Ich habe … ich habe nur gerade deine coolen Ohrringe bemerkt. Sie sind echt was Besonderes.«
Sie fasst sich ans Ohr. »Es sind schlichte Kreolen.«
»Ähm, ich meinte nicht wirklich besonders. Ich meinte … sie haben … die perfekte Größe. Nicht zu groß, nicht zu klein, verstehst du?«
Carmen betrachtet mich skeptisch. »Schätze schon.«
»Sie sind wirklich hübsch. Ich wollte mir auch solche holen.«
»Meine Mom hat sie mir besorgt. Wenn du magst, frage ich sie, wo sie sie herhat.«
Ich lächle. »Das ist echt cool von dir. Danke!« Mir wird klar, dass ich zu aufgekratzt wirke, deshalb schraube ich ein bisschen runter und täusche erneut ein Gähnen vor. »Sorry jedenfalls, dass ich heute Abend so langweilig bin. Aber trink für mich ein Bier mit, okay?«
»Na klar! Ich fange direkt damit an!« Sie nimmt einen großen Schluck aus ihrem Becher und verschwindet den Flur hinunter, ehe sie sich nach ein paar Schritten noch mal zu mir umdreht. »Es war schön, dich zu sehen, Allison.«
»Fand ich auch, Carmen!«
Ich schließe die Tür ab und mache das Licht aus. Die Tür zum zweiten Schlafzimmer steht offen, und ich starre darauf. Soll ich die Tür offen lassen oder zumachen? Ich kann mich nicht entscheiden. Wenn sie zu ist, wird es so wirken, als wäre dort drin jemand. Jemand, der schläft, lernt, Sex hat, Privatsphäre will … Als hätte ich dort vielleicht eine Freundin, jemanden, zu dem ich tatsächlich eine Beziehung habe. Irgendetwas. Wenn die Tür offen steht, werde ich daran erinnert, dass niemand drinnen ist.
Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich tun soll. Mehrere Minuten verstreichen.
Plötzlich taumle ich nach vorn, packe den Türgriff und knalle die Tür zu. Dieses Zimmer gibt es nicht. Ich eile davon und schließe schnell meine eigene Tür. Ich kann gar nicht schnell genug in mein Bett kommen. Fieberhaft ziehe ich mir in einem Anfall von Wahnsinn die Decke bis hoch zum Kinn. Warum bloß ist Carmen zu meinem Zimmer gekommen? Es gibt einfach keine Erklärung dafür. Meine Zehen zucken wie verrückt, und ich schlage die Füße aneinander, um sie zu beruhigen.
Ich fächle mir mit der Decke Luft zu, ehe ich den Stoff wieder glattstreiche, wobei ich darauf achte, dass die Falte oben nicht verrutscht. Simon bestand darauf, mir neue Bettwäsche zu besorgen, obwohl ich bereits welche hatte, und bevor wir losfuhren, hat er sie für mich gewaschen und sogar gebügelt. Er sah furchtbar enttäuscht aus, als ich versucht habe, die neue Bettwäsche abzulehnen. »Du kannst nicht nur ein einziges Paar Bettbezüge haben! Bitte. Mir zuliebe. Nimm nur dieses eine Jahr zwei Paar mit«, bat er mich. »Ihre Fadenzahl ist einfach gigantisch.« Also habe ich mich bei ihm bedankt und das Geschenk mit der hohen Fadenzahl angenommen. Die schwere Baumwolle fühlt sich weniger vertraut an als die günstigen, kratzigen Bezüge, in denen ich als Kind geschlafen habe, deshalb fühle ich mich ein wenig unbehaglich und spiele mit dem Gedanken, die alte Bettwäsche aus dem Kleiderschrank zu holen und das Bett neu zu beziehen. Doch um Simon glücklich zu machen, belasse ich es dabei. Er versucht seit Jahren, meinem Leben eine neue Normalität zu verleihen. Ich wünschte, ich könnte es zulassen, aber meine Geschichte besteht aus zu vielen Flicken, als dass er sie wieder ganz machen könnte.
Ich habe aufgehört, auf Beständigkeit zu hoffen, als ich zehn war. Mein Optimismus hat ganz schön lange angehalten, wenn man mich fragt, aber als ich zehn wurde, war es offenkundig, dass mich keiner adoptieren würde. Niemand würde ein schüchternes, uninteressantes, scheues Kind haben wollen, das schon lange kein süßes Baby mehr war.
Ich schließe die Augen und streiche immer wieder über die Bettwäsche, um die Angst in den Griff zu bekommen, die mich jedes Mal überkommt, wenn ich über meine Vergangenheit nachdenke.
Ich erinnere mich an eine sehr nette Sozialarbeiterin, die mich bei einer Pflegefamilie abholte, als ich ungefähr acht war. Es war Neujahr, die Schneedecke wurde von Schneeregen durchlöchert, und sie zupfte vor lauter Nervosität bestimmt ein Dutzend Mal ihren rosa Wollschal zurecht. Sie hatte echt einen deprimierenden Job. Ich sehe immer noch die lächelnden Gesichter der Eltern und ihrer beiden leiblichen Kinder vor mir, als sie mich alle zum Abschied umarmten und mir hinterherwinkten, mir alles Gute wünschten und sich bedankten, dass ich bei ihnen gewesen war. Sie dankten mir, als wäre ich eine Austauschschülerin, die nur vorübergehend zu Gast gewesen wäre, um das Leben einer Oberschichtfamilie in Massachusetts kennenzulernen. Als hätten sie mich nur zum Spaß bei sich aufgenommen. Aber zumindest hatte ich in der Zeit gut gegessen, eine gute Schule besucht und sechs Monate lang Ballettunterricht gehabt. Ballettunterricht wog jedoch das gebrochene Herz nicht auf, das ich hatte, als man mir sagte, es sei Zeit zu gehen.
Meine Kindheit war eine ständige Abfolge neuer Schulen, neuer Zimmer, neuer Häuser, neuer Wohnviertel und neuer Familien. Ich denke darüber nach, wie viele Lehrer und Mitschüler ich kennengelernt habe, wie oft ich von vorne anfangen musste.
Und die Geburtstage. Entweder wurden sie übertrieben gefeiert oder komplett vergessen.
Mein Atem beschleunigt sich, und ich umklammere die Decke und versuche mir wieder zu vergegenwärtigen, dass ich inzwischen mehr habe, als ich je erwartet hätte. Ich sollte mich sicher fühlen. Es gibt jetzt Simon. Er hat versprochen, mich nicht zu verlassen. Er hat mich adoptiert. Herrgott noch mal, er hat die Papiere unterschrieben. Es ist gesetzlich verankert, dass er mich nicht mehr verlassen kann.
Also muss er mich behalten.
Mein Handy bewahrt mich davor, die Nerven zu verlieren.
Steffi. Sie ist der einzige Mensch, mit dem ich in solch einer Situation zu reden bereit bin.
Ich wische mir das Gesicht ab und huste gegen die Enge in meiner Kehle an. »Hey du!«
»Selber hey!«, ruft Steffi fröhlich. Sofort fühle ich mich getröstet.
Steffi war die einzige Ausnahme von der Regel, dass die Welt unbeständig und unzuverlässig ist. Seit dem Augenblick, als wir uns mit vierzehn Jahren kennengelernt haben, sind wir Überlebenspartner. Wir haben nur drei Monate lang bei derselben Pflegefamilie mit vier anderen Kindern gewohnt, aber das hat ausgereicht, um unsere Freundschaft zu besiegeln.
»Wie ist es in Kalifornien?«, frage ich.
»Irre sonnig und toll. So wie ich.« Steffi lässt ihr heiseres Lachen hören, und ich sehe förmlich vor mir, wie sie sich das lange blonde Haar über die Schulter wirft. »Los Angeles ist mein Schicksal, das weißt du. Und deines auch. Das wirst du erkennen, sobald du deinen Abschluss hast und deinen Hintern hierher bewegst.«
Ich lächle. »Das ist der Plan.« Durchs Telefon höre ich Musik lauter und leiser werden und das Geräusch von Kleiderbügeln, die eine Stange entlanggeschoben werden. »Gehst du aus?«
»Darauf kannst du wetten. Ich stell dich auf Lautsprecher, während ich mich anziehe, okay? Also, was gibt’s bei dir denn so? Hat Daddy dich gut abgeliefert?«
»Allerdings. Also … wir haben zusammen zu Mittag gegessen.«
»Ist Simon immer noch so scharf?«
»Oh Gott, Steffi! Sei nicht so eklig!« Dennoch muss ich lachen.
»Er ist schließlich nicht mein Daddy«, sagt sie, wobei sie ihre Stimme supersexy und leicht verrucht klingen lässt. »Wenn es nach mir ginge, könnte ich Mrs Simon Dennis sein. Dann wäre ich deine Mommy!«
»Halt die Klappe! Das ist krank. Außerdem ist er schwul«, rufe ich ihr in Erinnerung. »Du bist nicht gerade sein Typ. Gott sei Dank.«
»Das stimmt«, sagt sie und seufzt dramatisch. »Verdammt! Trägt er immer noch diese scharfe Pilotensonnenbrille? Sag jetzt nichts. Warum geht es in der Liebe so unfair zu?«
Ich verdrehe die Augen. »Du wirst es bestimmt überleben, nicht Simons Herz erobert zu haben.«
»Es ist in Ordnung. Ich habe vor, heute Abend meinen Kummer in Wodka zu ertränken und den geilsten Kerl abzuschleppen, den ich finden kann. Und du? Hast du an diesem schönen Abend auch schon einen Kommilitonen im Visier?«
Ich unterdrücke ein Schnauben. »Morgen gehen die Vorlesungen los. Ich … lasse … es langsam angehen.«
Aus irgendeinem Grund muss ich die Worte hervorpressen, und das genügt Steffi, um zu merken, dass etwas nicht stimmt.
»Was ist los, Allison?« Jetzt klingt sie sanft.
»Mir geht’s gut.«
»Hast du eine schlimme Nacht?«
Es bringt nichts, sie anzulügen. »Ja. Ein bisschen. Weiß nicht warum.«
Die Musik im Hintergrund verstummt. Ob ich es will oder nicht, ich habe jetzt ihre gesamte Aufmerksamkeit. »Sollen wir das noch mal durchgehen?«, fragt sie.
Ich kann nicht sprechen, aber sie kennt mich gut genug, um zu wissen, dass ich nicke.
Also fängt sie an und sagt mir, was ich längst weiß – oder wissen sollte, aber woran sie mich allzu oft erinnern muss. »Wir sind nicht Teil einer Statistik. Wir haben das System besiegt. Ja, all die Jahre hat uns niemand gewollt. Was soll’s. Davon haben wir uns nicht unterkriegen lassen. Wir sind allein, zurückgewiesen, nicht gewollt groß geworden. Aber sie können uns alle mal. Wir haben die Highschool abgeschlossen und gehen beide aufs College. Wir sitzen nicht im Gefängnis. Wir nehmen keine Drogen. Wir sind weder weggelaufen, noch haben wir auf der Straße gelebt und Gott weiß was getrieben. Wir sind nicht Teil einer Statistik«, betont sie noch mal. »Wir haben bei beschissenen Familien gelebt. Aber auch bei einigen tollen. Die Einzelheiten spielen keine Rolle. Hörst du? Sie spielen keine Rolle. Ich will nicht in der Vergangenheit leben. Und du auch nicht. Wir kehren nicht mehr dorthin zurück. Es ist vorbei. Wir sind keine gottverdammten Statistiken. Das werden wir nie sein. Wir sind die Ausnahme, und wir sind was Besonderes. Kapiert?«
Wieder nicke ich. »Richtig.« Ich war nur noch eine leere Hülle, als Steffi auftauchte und mich mit ihrer Energie zurück ins Leben holte. Jedenfalls zu einem gewissen Grad.
»So, was noch?«, fragt sie. »Was tun wir? Jeden einzelnen Tag?«
Ich drehe mich auf die Seite und strecke den Arm aus, um die kleine Schreibtischlampe auszumachen, die über mir leuchtet. »Wir konzentrieren uns auf die Zukunft und schauen nicht zurück.«
»Eine glorreiche Zukunft«, korrigiert sie mich. »Und warum wartet auf uns eine glorreiche Zukunft?«, fragt sie.
»Weil du uns zum Lernen getrieben hast. Weil du wusstest, dass Bildung für uns das Wichtigste war. Dass sie uns retten würde.«
Es ist keine Angeberei, wenn sie mich das sagen lässt, sie will lediglich, dass ich mir vor Augen führe, was wir beide vollbracht haben. Ihren eigenen Anteil daran sollte sie jedoch nicht unter den Scheffel stellen, denn Steffi hat die Hölle in Bewegung gesetzt, um nach jedem neuen Umzug meine Kontaktdaten zu bekommen. Sie hat unablässig dafür gesorgt, dass wir zusammenblieben, selbst als wir getrennt waren. Und Steffi ist der einzige Grund, warum ich mich in der Schule so reingehängt habe, da sie mir eingebläut hatte, wie wichtig das war, wenn man überleben wollte.
»Und du bist aufs College gekommen. Auf ein verdammt gutes sogar.«
»Und du hast ein Vollstipendium für die UCLA bekommen. Das schafft sonst niemand. Niemand«, betone ich, so als wolle ich mir selbst ins Gedächtnis rufen, was sie erreicht hat. Steffis harte Arbeit und grimmige Entschlossenheit haben sich tatsächlich bezahlt gemacht. Mehr noch als ich ist sie die Ausnahme von der Pflegekind-Regel.
»Wir haben es dahin gebracht, wo wir jetzt sind«, fährt sie fort, »weil wir unser Ziel nicht aus den Augen verloren haben.«
Ich blicke an die Zimmerdecke. »Und weil du dich um mich gekümmert hast.«
»Wir haben uns umeinander gekümmert.« Steffi hält inne. »Weißt du noch, was du für mich getan hast?«
»Ich will nicht darüber reden.«
Sie schweigt eine Weile. »Okay. Aber du hast dich auch um mich gekümmert.«
»Warum lässt du nicht zu, dass ich mich jetzt mehr um dich kümmere?«
»Weil ich eine harte Nuss bin.«
Ich muss einfach lachen. »Das bist du. Du sollst bloß wissen, dass ich für dich da bin. Dass ich alles für dich tun würde.«
»Natürlich würdest du das! Das weiß ich doch. Allison?«
»Ja?«
»Dein Schicksal hat ein gutes Ende genommen, okay? Du hast Simon bekommen. Auch wenn wir dachten, es wäre zu spät, auch wenn es sich angefühlt hat, als würde es keine Rolle mehr spielen, hast du jetzt einen Vater. Du hast einen Ort, den du dein Zuhause nennen kannst, wo du in den Ferien hingehen kannst. Dass er zu einem späten Zeitpunkt aufgetaucht ist, bedeutet nicht, dass er nicht wichtig ist. Du bist gegen alle Regeln der Wahrscheinlichkeit während der Highschoolzeit adoptiert worden.«
»Es ist nicht gerecht.« Ich ertrage es nicht, wenn Steffi das sagt, weil es in mir solche Schuldgefühle weckt. Ich halte mir eine Hand vor den Mund, um die Schluchzer zu unterdrücken, die sich ihren Weg nach draußen zu bahnen drohen, und brauche einen Augenblick, bis ich wieder sprechen kann, ohne dass man meine heftige Gefühlsregung hört. Ich warte, bis meine Stimme ausdruckslos ist. Sachlich. »Aber du bist nicht adoptiert worden.«
»Das brauchte ich auch nicht. Ich war krank, Allison. Niemand wollte ein Kind mit Krebs. Und dann, Jahre später, selbst als es mir besser ging, habe ich sie nicht gebraucht.« Sie bezieht sich auf Joan und Cal Kantor. Steffi ist etwa zur selben Zeit bei ihnen eingezogen wie ich bei Simon. Simon hat mich adoptiert, aber Joan und Cal haben das bei Steffi nicht getan, sondern stattdessen zugesehen, wie sie achtzehn wurde, und sie dann alleine losziehen lassen. Ohne Unterstützung, ohne Familie, ohne das Gefühl, eine sichere Zuflucht zu haben.
So abgehärtet und unabhängig Steffi auch war, sogar sie war erschüttert, als sie sie höflich darüber in Kenntnis setzten, dass ihre Zeit als Pflegeeltern vorüber sei. Ihr Highschool-Abschluss war keine glückliche Zeit.
Ich werde ihnen nie verzeihen.
Mir werden immer die Worte fehlen, wenn es um Joan und Cal geht. Was soll man auch dazu sagen, dass sie ein so wundervolles Mädchen einfach fallen gelassen haben? Ein Mädchen, das ihre Tochter hätte werden können.
Wie immer schaltet Steffi sich ein, um meine Pausen zu füllen. »Weißt du, Allison, ich war eben eine Versagerin. Ein Risiko. Und warum sollte ich mich bei einer netten Familie mit drei Hunden niederlassen wollen, wenn ich doch dich habe? Stimmt’s?«
»Stimmt.« Doch ich bin nicht überzeugt.
»Hey! Aufgepasst!«, sagt sie scharf. »Ich hab dich! Wie sage ich immer?«
Mir schwirrt der Kopf. »Ich weiß nicht …«
»Halt an dem einen Menschen in deinem Leben fest. Weißt du noch? Ich hab dich, und du hast mich. Und wenn man das Glück hat, in diesem gnadenlosen Leben zumindest einen – einen einzigen – Menschen zu finden, der dafür sorgt, dass alles einen Sinn hatte, den man liebt und dem man vertraut und für den man töten würde, dann hält man ihn besser verdammt fest, denn er ist möglicherweise alles, was man je bekommen wird. Und das haben wir getan«, sagt Steffi voller Überzeugung.
»Okay.«
»Es tut nur weh, bis es nicht mehr wehtut.«
»Okay.«
»Sag es.«
»Es tut nur weh, bis es nicht mehr wehtut.« Ich wiederhole ihre Worte, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich daran glaube. Ich bin nicht so stark wie Steffi, und meine Vergangenheit tut weiterhin weh. Auch wenn das Schlimmste wahrscheinlich vorbei ist, trage ich immer noch so viel Schmerz in mir. Ein steter, bleibender Schmerz, dem ich nicht gewachsen bin.
Vielleicht bin ich einfach zu kaputt.
»Steffi? Du bist keine Versagerin. Das warst du nie. Du bist perfekt. Eltern kommen damit nicht klar. Das ist alles.«
3
Motivation
In der ersten Woche des Semesters überkommt mich eine beunruhigende Erkenntnis: Im Hauptstudium ist es schwerer, Massenveranstaltungen zu finden. Ich bin ein großer Fan von Vorlesungssälen und Kursen, die Anonymität erleichtern. Sosehr ich Menschen auch meide, kommen bestimmte Menschenmengen mir ironischerweise zugute.
Am Freitagmorgen verbringe ich fünfunddreißig Minuten im Studienbüro und gehe die zur Auswahl stehenden Kurse im Hinblick darauf durch, wo ich die besten Chancen habe, in der Menge unterzugehen. Ich weigere mich, das Seminar »Hundert Worte für Schnee: Sprache und Natur« aus meinem Plan zu streichen, weil es dort darum geht, wie Sprache unsere Weltsicht beeinflusst, und das finde ich ungeheuer faszinierend. Außerdem scheint bei diesem Kurs eher Zuhören gefragt zu sein, ohne sich selbst groß einbringen zu müssen, und da bin ich immer voll dabei. Ich verzichte allerdings auf »Kultur in Zeiten des Neoliberalismus«, weil das in einem Konferenzraum in der Bibliothek stattfindet und ich unter keinen Umständen »die relative Autonomie der ökonomischen Sphäre« mit nur sechs anderen Studenten und einer Professorin diskutieren werde. Stattdessen wähle ich den sehr beliebten Kurs »Sozialpsychologie«. Mit diesen beiden Kursen und »Essen für Veränderung? Ernährung, Medien und Umwelt in der US-amerikanischen Konsumkultur« sowie »Wahrscheinlichkeit und mathematische Statistik« sollte ich einerseits vor zu viel Interaktion sicher sein und andererseits wirklich interessante Veranstaltungen haben, die mir Spaß machen – ein perfekt ausgewogenes Verhältnis.
Nun, da mein Stundenplan feststeht, verlaufen die nächsten paar Wochen reibungslos. Ich gewöhne mir eine angenehme Routine an, die aus Lernen, Bibliotheksbesuchen und Lesen während des Essens in der Mensa besteht. Wahrscheinlich vermittle ich den Eindruck eines stillen Nerds, aber das ist am Andrews College nicht allzu ungewöhnlich.
An einem Freitag Ende September bin ich überraschend guter Stimmung, während ich geschmeidig durch das überfüllte Studentenwerk auf den Hof hinausgehe. Ich habe heute nur noch meine Psychologie-Vorlesung, und das nahe Wochenende bedeutet, dass ich weniger unter Druck stehen werde, mit Leuten in Kontakt zu geraten. Das Café des Studentenwerks macht guten Eiskaffee, und auf dem Weg zu einer sonnigen Rasenfläche sauge ich fest an meinem Strohhalm. Unter einer großen Eiche finde ich ein Plätzchen. Bis mein Kurs anfängt, habe ich noch eine halbe Stunde, deshalb lehne ich mich gegen den knorrigen Stamm und hole ein Buch, das ich mir in der Bibliothek ausgeliehen habe, aus meinem Rucksack.
Wahrscheinlich bin ich inzwischen der einzige Mensch auf der Welt, der gedruckte Bücher lieber mag als E-Books. Ich habe es generell nicht so mit Technik. Klar schreibe ich Mails und benutze das Internet, um mich zu informieren und zu recherchieren, und ich habe auch ein Handy, aber das ist quasi alles. Steffi drängt mich schon seit Jahren, mir ein Profil bei Facebook und Twitter anzulegen, aber bei der bloßen Vorstellung überkommt mich ein Schaudern. Als jemand, der sich regelmäßig mit Promiklatsch versorgt, hat Steffi wenig Verständnis für meinen Wunsch, soziale Plattformen zu meiden. Zwar hat sie in Los Angeles keine sonderlich engen Freunde, doch sie ist in dem oberflächlichen Sozialleben der UCLA gut etabliert und ständig mit irgendwelchen Partybekanntschaften unterwegs.
Mein Eiskaffee ist genau die richtige Mischung aus stark und süß. Ich ziehe noch mal einen großen Schluck durch den Strohhalm, während ich unter dem Baum sitze, um die Zeit vor meinem Kurs totzuschlagen. Es hat ein bisschen abgekühlt, und das Wetter fühlt sich nun ein wenig mehr wie Herbst an. Als ich den Blick von meinem Buch hochhebe, sehe ich die Eichenblätter im schwachen Wind flattern, wobei ich Sonnenlicht und Schatten über mein Gesicht huschen lasse. Ich empfinde ein Gefühl von Frieden. Es ist so ruhig hier.
Ich betrachte meine Umgebung und bewundere einmal mehr den schönen alten Stein, aus dem die ursprünglichen Gebäude auf dem Campus bestehen. Andrews College sieht ganz und gar wie ein klassisches College aus, und selbst die neueren Gebäude wurden so gestaltet, dass sie zu den alten passen. Bäume und Büsche, gepflasterte Wege und verschnörkelte Laternenpfähle tragen alle zu dieser besonderen Atmosphäre bei. Von diesem herrlichen Tag beseelt beschließe ich, mehr Zeit hier draußen zu verbringen, ehe der harte Maine-Winter Einzug hält. Es ist wahrscheinlich nicht klug, mich so viel in meinem Zimmer zu verkriechen, und von meinem Platz unter diesem Baum aus kann ich zumindest zuschauen, wie die Welt vorüberzieht, selbst wenn ich nicht dazugehöre. Ich stelle fest, dass es jede Menge Geräusche um mich herum gibt, wenn ich meine Aufmerksamkeit darauf richte: Frisbee-Spieler, die sich gegenseitig Dinge zurufen, das Geplauder von Studenten, die dem Spazierweg in der Nähe folgen, Gitarrenklänge, die in meine Richtung wehen, von einem Musiker unter einem anderen Baum in der Nähe … ich bin verblüfft, wie viele Geräusche ich normalerweise ausblende. Na toll. Noch etwas, das wahrscheinlich nicht gerade für meine geistige Gesundheit spricht.
Ich beobachte den Gitarrenspieler. Er sieht gepflegt aus, mit kurzem, perfekt geschnittenem Haar und einem Karohemd, das in seinen Jeans steckt. Die Gitarre liegt in seinem Schoß, während er sie anschlägt und für ein Mädchen singt, das auf der Seite im Gras liegt und unverwandt zu ihm hochschaut. Der Junge kommt mir nicht wie ein typischer Gitarrenspieler vor. Er sieht aus wie ein BWL-Student, der sich eine Gitarre besorgt hat, um Mädchen anzulocken. Aber es scheint zu funktionieren, denn das Ziel seiner Begierde ist völlig in seinen Bann geschlagen.
Eigentlich ist es ein schöner Anblick, der sich mir bietet, doch ich spüre nur, wie meine gute Laune sich allmählich verflüchtigt. Einen kurzen Moment bin ich eifersüchtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir jemals ein Junge etwas vorsingen wird, geschweige denn mich so anschaut wie er sie. Dabei gibt es keinen Grund zur Eifersucht, denn vermutlich wird die Sache zwischen ihnen eh kein gutes Ende nehmen. So läuft das im Leben.
Sie haben keine Ahnung, wie naiv es ist, jemandem zu glauben, jemandem zu vertrauen.
Ich versuche, nicht zusammenzuzucken, als der Junge seine Gitarre beiseitelegt und zu dem Mädchen krabbelt. Er lacht, als er sie auf den Rücken dreht, ehe er seinen Mund auf ihren senkt. Mein Gott, ich bin wirklich eifersüchtig. Und traurig. Ich bin traurig, dass ich das niemals haben kann.
Ich knalle mein ungelesenes Buch in den Rucksack und ziehe den Reißverschluss zu. Ich stapfe hinüber zu einem Mülleimer, um meinen eisgekühlten Kaffee wegzuwerfen, der mir nun nicht mehr schmeckt. Ich schleudere ihn auf den Mülleimer zu, doch er prallt davon ab und fällt zu Boden, wobei er eine Sauerei aus Flüssigkeit und Eiswürfeln auf dem Weg anrichtet.
»Guter Wurf«, kommentiert ein Typ frech im Vorbeigehen.
»Vielen Dank auch«, rufe ich ihm hinterher.
Ich seufze genervt. Ich kann die Eiswürfel nicht einfach überall auf dem Weg liegen lassen, deshalb gehe ich in die Hocke und fange an, sie einzusammeln, wobei ich verhalten vor mich hin fluche, als mir mehr als einer aus der Hand flutscht.
»Verdammt rutschig, die kleinen Biester, nicht wahr?« Neben mir taucht ein Paar Beine auf, und ich werfe nur kurz einen Blick auf zerrissene Jeans und rote Chucks.
Ich sage nichts, während ich in meinem verzweifelten Versuch, die Schweinerei in Ordnung zu bringen, fortfahre. Ohne hochzuschauen, schaffe ich es, in meinem Rucksack ein paar Taschentücher zu finden und damit so gut ich kann die Flüssigkeit aufzuwischen.
Der Mensch neben mir beugt sich hinunter, und ich sehe zu, wie er geschickt jeden dämlichen Eiswürfel aufsammelt, der mir entglitten ist, und sie mir dann ruhig in die hohle Hand fallen lässt. Seine Unterarme sind gebräunt und muskulös, mit Lederriemen und schmalen geflochtenen Bändern um jedes Handgelenk. Wie Superhelden-Manschetten. Wahrscheinlich glaubt er, dass er damit Kugeln abwehren kann. Unwillkürlich wende ich ein klein wenig den Kopf und erhasche einen Blick auf einen Bizeps, der unter seinem weißen T-Shirt-Ärmel hervorblitzt. Schnell schaue ich wieder weg. Ich wünschte, dieser Typ hätte nicht angehalten.
Ich wünschte, ich hätte nicht augenblicklich schmutzige Gedanken.
Ich wünschte, er würde nicht nach Keksen und Liebe riechen.
Als er beim letzten Eiswürfel ankommt, schaffe ich es, den Becher erfolgreich und ohne Desaster in den Mülleimer zu werfen. »Danke fürs Helfen. Wahrscheinlich ist gleich eine Armee von Ameisen hier, um das Zuckerfest zu feiern«, murmle ich.
Und schon im nächsten Moment kippt der Kekse-und-Liebe-Junge Wasser aus einem Metallbehälter, um den Gehweg damit zu spülen. »Keine Sorge.«
Mir wird klar, dass ich diesen Menschen, der unnötig freundlich ist, nicht weiter ignorieren kann. Das fühlt sich wie eine Last an, und dafür schäme ich mich, aber ich setze ein Lächeln auf und schaue ihn an. Oder besser gesagt zu ihm hoch, da er gut fünfzehn Zentimeter größer ist als ich mit meinen eins dreiundsechzig.
Dieser Junge schaut mich an. Er schaut mich wirklich an. Ich wende ein wenig den Kopf, um Blickkontakt zu vermeiden, und auch wenn ich mich liebend gern komplett wegdrehen würde, umrahmt sein weiches dunkelbraunes Haar sein Gesicht auf eine Weise, die mich davon abhält. Seine Locken sind zu lang, die kürzeren ringeln sich um sein Gesicht, während andere ihm verwegen über die Ohren fallen und fast seine Schultern berühren. Ich habe den Verdacht, dass es schon ein paar Tage her ist, dass er sich rasiert hat, aber der Dreitagebart steht ihm, und ich muss meine ganze Willenskraft aufbringen, um mich nicht von seinen ungewöhnlichen bernsteinfarbenen Augen anziehen zu lassen, die mich durchdringend betrachten. Dieser Mensch bringt mich völlig aus der Fassung und sorgt dafür, dass ich neben mir stehe. Und dennoch … schaue ich ihn unverwandt an. Nur einen kurzen Moment. Ein paar Sekunden lang erlaube ich meinem Blick, seiner Gesichtsform zu folgen, seinen ausgeprägten Wangenknochen, seiner Kinnlinie, die in mir den Wunsch weckt, dass er sich rasiert, damit ich sie besser erkennen kann.
Das hier ist verrückt. Ich bin verrückt. Irgendeine völlig durchgeknallte Hormonwelle hat mich vorübergehend überflutet, und ich werde diesem Unsinn jetzt ein Ende setzen. Genau jetzt. Ehrenwort.
Schließlich wende ich den Blick ab und werfe ein nasses Taschentuch weg. »Danke noch mal. Ich muss in meinen Kurs.«
Ich spüre, dass er im Begriff ist, etwas zu sagen, deshalb schwenke ich ab und mische mich unter die Studenten, die auf die andere Seite des Campus zusteuern. Als wäre ich nicht schon genug neben der Spur, läuft Carmen an mir vorbei in die andere Richtung und winkt mir zu. Ich winke höflich zurück und sage nichts, dabei würde ich am allerliebsten schreien, was für ein Wrack ich bin, nachdem ich Kaffee verschüttet habe und ein unbekannter sexy Typ mir geholfen hat.
Meine Vorlesung in Sozialpsychologie findet in einem der größten Hörsäle auf dem Campus statt. Obwohl der Kurs ziemlich gut besucht ist, gibt es immer noch jede Menge freie Sitze, und ich nehme den Platz ein, der mein Stammplatz geworden ist, am Ende einer der mittleren Reihen. Sofort schlage ich meinen Ordner auf und tue so, als würde ich konzentriert meine Notizen der letzten Sitzung lesen. Die meisten Studenten machen sich auf ihrem Laptop Notizen, aber Steffi hat mir erzählt, sie hätte gelesen, dass man sich Sachen besser merken wann, wenn man sie aufschreibt. Ich stecke mir meine Ohrhörer ein und starte meine App mit dem weißen Rauschen, um mich zusätzlich vor Unterbrechungen zu bewahren, während sich der Raum langsam füllt.
Jemand tippt mir auf die Schulter, und ich zucke zusammen. Es ist nur ein Mädchen, das an mir vorbei will, um sich hinzusetzen. Ich nicke und erhebe mich, und da höre ich Stimmen, die das Geräusch in meinen Ohrhörern übertönen und mich aufblicken lassen. Der Junge, der mir mit den Eiswürfeln geholfen hat, betritt gerade den Saal. Mir rutscht das Herz in die Hose. Er steht oben auf der Treppe, die quer zu den Sitzreihen verläuft, umringt von Studenten, die alle lebhaft auf ihn einreden und – ganz eindeutig – gehörigen Wirbel um ihn machen.
Ohne nachzudenken, schalte ich meine App stumm und setze mich langsam wieder hin.
Der Junge lächelt, als ihm jemand zur Begrüßung auf den Rücken klopft, dann reckt er das Kinn, um das Klatschen zur Kenntnis zu nehmen, das von einer Reihe von Studenten kommt. Wer ist dieser Kerl?
Andere wiederum stimmen in einen Sprechchor ein: »Esben! Esben! Esben! Hashtag rock yourself! Hashtag rock yourself!«
Sein Name ist also Esben. Der Eiswürfelsammler heißt Esben. Hm. Na ja, egal.
Ich runzle die Stirn und versinke tiefer in meinem Sitz. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert, aber es wühlt mich ganz schön auf. Dieser Esben-Typ lacht und winkt angesichts all der Aufmerksamkeit ab. Ein Mädchen in der dritten Reihe ruft seinen Namen laut genug, dass man es über den anschwellenden Sprechchor hinweg hören kann, und winkt ihn zu einem freien Sitz neben sich. Er ist eindeutig irgendeine extrem beliebte Campus-Ikone.
Ich ignoriere ihn einfach. Was mir nicht besonders schwerfallen dürfte. Schließlich haben wir nichts gemeinsam.
Dennoch stelle ich fest, dass ich während der anderthalbstündigen Vorlesung seinen Hinterkopf anstarre, und ich muss mich anstrengen, um mit den Notizen hinterherzukommen. Gegen meinen Willen erweckt es meine Neugier, als der Prof den Begriff charismatischer Führung aufbringt und dann auf Esben deutet, was im ganzen Saal Gelächter und Applaus hervorruft. Als die Vorlesung zu Ende ist, klopft mein Herz wie wild, und ich springe quasi von meinem Sitz auf, sobald der Professor damit fertig ist, uns die Literatur für die nächste Sitzung zu nennen. Innerhalb von Sekunden bin ich am Ausgang und schiebe mich, um rauszukommen, durch die Flut von Studenten, die den Saal verlassen.
Mein Gott, ich brauche Luft. Ich brauche Luft.
Ich beschleunige meine Schritte, als ich mich von der Masse der Studenten trenne und schaffe es in Rekordzeit zurück in mein Zimmer. Ich lege meinen Rucksack auf das Sofa im Wohnbereich und schaue in den Spiegel, während ich mich langsam beruhige. Mein Pony ist noch immer ordentlich, mein langer Pferdeschwanz ist nicht verrutscht, und mein Mascara ist weder verschmiert noch hat es eklige, klebrige Klumpen in meinen Augenwinkeln hinterlassen. Ich atme ein und aus, ein und aus, bis ich mich langsam wieder im Griff habe.
Da bemerke ich einen nicht gerade unauffälligen Kaffeefleck auf meinem gelben Top.
So ein Mist.
Ich zittere, als ich mir das Oberteil über den Kopf reiße und zu meinem Kleiderschrank rase, um ein sauberes zu finden. Meine Reaktion auf einen einfachen Fleck ist extrem, das weiß ich, ich weiß aber auch, dass ich dafür meine Gründe habe.
Als ich elf war, habe ich bei einer Pflegemutter gelebt, die geradezu davon besessen war, dass ich mich nie schmutzig machen durfte. Schon der kleinste Fleck auf einem Schuh war eine Katastrophe. Also habe ich in dem Bemühen, weiße Turnschuhe nicht zu verdrecken, eine eigenartige Art zu gehen entwickelt, die eher wie Stampfen aussah. Ein sichtbarer Fleck auf einem Oberteil war demzufolge ein Grund zur Aufregung, weshalb ich mir angewöhnte, ständig vor allem auf der Hut zu sein, was ihre Bereitschaft, mich zu adoptieren negativ beeinflussen könnte. Diese Frau wies mich ständig auf jegliche Verunreinigung meiner Kleidung hin, auch wenn sie noch so unbedeutend sein mochte, und gab nicht eher Ruhe, bis ich mich umgezogen hatte. Ich kann mich einfach nicht von dem Gedanken befreien, dass sie mich wieder abgegeben hat, weil ich nicht in der Lage war, meine Kleider makellos sauber zu halten.
Deshalb durchwühle ich hektisch meinen Kleiderschrank auf der Suche nach dem makellosesten Top, das ich finden kann. Obwohl ich den Grund für mein panisches Verhalten kenne, hilft mir das nicht weiter. Meine überzogene Reaktion ist nur eine von zahlreichen Störungen, die ich im Lauf der Jahre perfektioniert habe.
Ich bin einfach ein hoffnungsloser Fall.
Ich bringe mein beschmutztes Oberteil ins Bad am Ende des Flurs. Als ich den Fleck unter den Wasserhahn halte, bleibt mein Blick an etwas Dunklem in der Nähe des Saums hängen, und ich stöhne auf. Na toll, und was ist das jetzt, bitte schön?
Meine Finger gleiten unter den Stoff, und ich fühle etwas aus Plastik. Ich bin verwirrt, deshalb drehe ich mein Oberteil um.
An der Seitennaht meines Oberteils ist ein Anstecker befestigt. Er ist hellblau mit weißem Aufdruck.
Nur wer die Vergangenheit loslässt, kann die Zukunft bewältigen.
Ungläubig starre ich darauf. Was hat dieser Anstecker in meinem T-Shirt zu suchen?
Nur wer die Vergangenheit loslässt, kann die Zukunft bewältigen.
Die Aussage ist Schwachsinn, weil manche von uns nie in der Lage sein werden, die Vergangenheit ruhen zu lassen, weil sie uns bis in die Gegenwart verfolgt.
Nur wer die Vergangenheit loslässt, kann die Zukunft bewältigen.
Der Satz schreit mich förmlich an. Unwillkürlich muss ich lächeln.
Wie seltsam. Ein Anstecker, der auf meinem Oberteil auftaucht. Ganz zufällig. Und doch irgendwie wunderbar. Es ist ein netter Gedanke, und wahrscheinlich sollte ich ihn mir zu Herzen nehmen.
Dieser Anstecker ist wahrscheinlich schlauer als ich.
4
Weißes Rauschen
Ich beschließe, am Wochenende komplett in den Rückzugsmodus zu schalten, wobei ich mein Zimmer nur verlassen will, um Pizzalieferungen zu bezahlen und unter die Dusche zu springen. Am Freitagabend ist es allerdings fast unmöglich, in den Schlaf zu finden, da der Lärm von Betrunkenen, die fröhlich grölend über die Flure streifen, mich daran hindert. Während ich mich hin und her wälze, beschließe ich, entweder auch eine von ihnen zu werden oder mir Ohrstöpsel zuzulegen.
Ich entscheide mich für Ohrstöpsel.
Aber immerhin klopft niemand an meiner Tür.
Ich schlafe unruhig und habe Albträume, in denen ich ein Auto fahre, das sich nicht steuern lässt, ohne Gepäck und ohne Ticket durch einen Flughafen irre und mein Abfluggate nicht finde oder vor einer endlosen Reihe verschlossener Türen stehe, für die ich keinen Schlüssel habe.
Als ich am Samstagmorgen um acht aufstehe, bin ich erschöpft, und ich kann den Tag unmöglich ohne Kaffee überstehen, weshalb meine Hoffnung, mich einigeln zu können, dahin ist. Das Schöne, an einem Wochenende früh aufzuwachen, ist die Stille, die über dem ganzen Unigelände liegt. Kaum jemand ist unterwegs, als ich mich zum Studentenwerk aufmache. Es ist frisch draußen, die Blätter verfärben sich allmählich, und ich freue mich darauf, dass es bald richtig Herbst wird. Der Campus von Andrews College ist immer schön, aber heute Morgen ist das Licht außergewöhnlich. Ich weiß die stille Verlassenheit zu schätzen, und meine Müdigkeit fühlt sich weniger qualvoll an.
Trotzdem brauche ich Kaffee.
So gern, wie ich die Stille mag, sollte ich wahrscheinlich darüber nachdenken, allein in die Pampa zu ziehen, sobald ich nächstes Jahr meinen Abschluss habe. Ich könnte von Internetbestellungen leben und müsste niemals das Haus verlassen. Die Vorstellung ist äußerst verlockend, aber ich habe Steffi versprochen, nach Los Angeles zu kommen. Das war immer unser Plan, allerdings weiß ich nicht, wie ich in einer so bevölkerungsreichen Stadt mit so vielen Menschen klarkomme. Natürlich werden wir zusammen sein, und sie wird mir helfen, mich zurechtzufinden. Steffi ist mein Fels in der Brandung. Sie wird nicht zulassen, dass ich mich verliere.
Im Studentenwerk ist es leer, sodass ich sofort bei dem mürrischen Studenten, der heute im Café arbeitet, meine Bestellung aufgeben kann. Er sieht schlecht gelaunt und noch müder aus als ich, und er zieht sich die Baseballkappe tiefer, ehe er mein Geld entgegennimmt und auf die Tasten an der Kasse einhämmert. Da, denke ich zufrieden, das ist jemand ganz nach meinem Geschmack. Nicht so wie dieser Esben. So unbeschwert, fröhlich und menschenfreundlich, dass es mir ein Rätsel ist. Ich weiß nicht, warum er mir in den Sinn kommt. Er spielt doch gar keine Rolle in meinem Leben. Ich würde den schlecht gelaunten Barista am liebsten dafür abklatschen, dass er sich in aller Öffentlichkeit so unleidlich zeigt.
Ich nehme meinen vierfachen Cappuccino und schaue auch in mein Postfach, wo ich eine Benachrichtigung finde.
Simon hat mir schon wieder ein Carepaket geschickt. Das ist jetzt das fünfte in diesem Jahr. Es ist nicht so, dass ich die Aufmerksamkeit nicht zu schätzen wüsste, aber ich weiß nicht, wie ich auf seine Großzügigkeit reagieren soll. Ich hole das Päckchen ab und klemme es mir unter den Arm, wobei mir auffällt, dass ich den Anblick der üblichen weißen Verpackung mit der Adresse in Simons Handschrift seltsam tröstlich finde.
Der Weg zurück zum Wohnheim gestaltet sich etwas mühselig, und ich muss das Päckchen auf dem Boden abstellen, während ich meinen Schlüssel aus der Tasche fische. Wie ich so vornübergebeugt dastehe, geht plötzlich die schwere Metalltür auf und knallt gegen meine rechte Schulter. Ich verliere das Gleichgewicht und falle hin, wobei ich nicht weiß, was mehr wehtut: der Aufprall auf dem harten Asphalt oder der Cappuccino, an dem ich mich verbrühe, als er sich über meine linke Hand ergießt.
Das händchenhaltende, kichernde Paar, das zur Tür herauskommt, schnappt jetzt nach Luft und entschuldigt sich wortreich. Der Geruch nach Alkohol und Sex eilt ihnen voraus, und mit einem knappen »Passt schon« hebe ich schnell mein Päckchen auf und haste hinein.
Ich komme wieder an meinem Zimmer an und betrachte verärgert meinen Kaffee, der jetzt halb leer ist und keinen Deckel mehr hat. Das sollte mich nicht weiter wundern, denn mittlerweile ist mir klar, dass ich keinen Kaffee trinken kann, ohne dass etwas gewaltig schiefläuft. Behutsam stelle ich den Becher auf dem kleinen Tisch ab, als enthalte er flüssiges Gold.
»Beweg dich nicht vom Fleck«, befehle ich ihm.