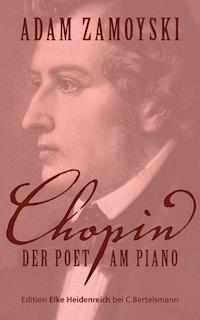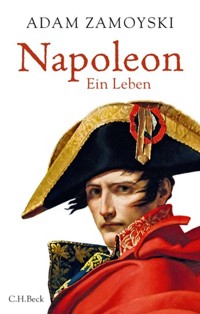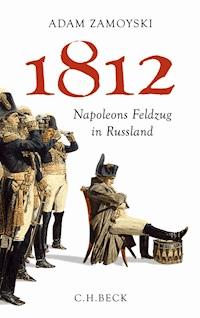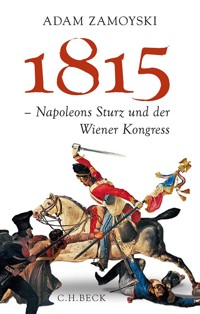
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Selten in der Geschichte gab es an einem Ort so viel Scharfsinn und Intrigen, so viel Gier, Bestechung, Spionage, Sex und Pracht wie auf dem Wiener Kongress. Während die mächtigsten Männer Europas neue Grenzlinien über die Karte des Kontinents ziehen und Entscheidungen von epochaler Tragweite treffen, wird auf dem großen Welttheater die menschliche Komödie aufgeführt. Doch dann kehrt Napoleon zurück… Nach dem grandiosen Bestseller „1812“ entfaltet Adam Zamoyski in „1815“ erneut ein fulminantes historisches Panorama. Mit seltener Erzählkunst führt er uns in das Zeitalter Napoleons, Metternichs und Talleyrands, als wäre es gestern gewesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Adam Zamoyski
1815 –
Napoleons Sturz und der Wiener Kongreß
Aus dem Englischenvon Ruth Keenund Erhard Stölting
C.H.Beck
Zum Buch
Selten in der Geschichte gab es an einem Ort so viel Scharfsinn und Intrigen, so viel Gier, Bestechung, Spionage, Sex und Pracht wie auf dem Wiener Kongress. Während die mächtigsten Männer Europas neue Grenzlinien über die Karte des Kontinents ziehen und Entscheidungen von epochaler Tragweite treffen, wird auf dem großen Welttheater die menschliche Komödie aufgeführt. Doch dann kehrt Napoleon zurück…
Nach dem grandiosen Bestseller „1812“ entfaltet Adam Zamoyski in „1815“ erneut ein fulminantes historisches Panorama. Mit seltener Erzählkunst führt er uns in das Zeitalter Napoleons, Metternichs und Talleyrands, als wäre es gestern gewesen.
„Ein exquisites Beispiel für erzählende Geschichte. “
Christopher Clark, Literary Review
Über den Autor
Adam Zamoyski, geboren 1949 in New York, wuchs in England auf und studierte Geschichte und Sprachen in Oxford. Seine adlige Familie floh 1939 nach der deutschen und sowjetischen Invasion aus Polen. Er lebt als freier Autor und Historiker in London. Sein Buch „1812“ und seine Biographie über Frédéric Chopin wurden in acht Sprachen übersetzt. Adam Zamoyski ist Fellow der Society of Antiquaries, der Royal Society of Arts und der Royal Society of Literature. Er ist mit der Malerin Emma Sergeant verheiratet.
Inhalt
Einleitung
1. Der aufgeschreckte Löwe
2. Der Retter Europas
3. Die Friedensstifter
4. Ein Krieg für den Frieden
5. Diskrete Verhandlungen
6. Farce in Prag
7. Das Spiel um Deutschland
8. Die ersten Walzertakte
9. Ein Stück vom Kuchen
10. Diplomatie des Schlachtfelds
11. Triumph in Paris
12. Frieden
13. Die Londoner Runde
14. Gerechte Vereinbarungen
15. Die Bühne wird gerichtet
16. Punkte auf der Tagesordnung
17. Noten und Bälle
18. Ferienzeiten für die Fürsten
19. Ein Friedensfest
20. Guerre de plume
21. Ein politisches Karussell
22. Diplomatische Explosionen
23. Kriegstanz
24. Krieg und Frieden
25. Der sächsische Handel
26. Unerledigte Punkte
27. Der Flug des Adlers
28. Die Hundert Tage
29. Der Weg nach Waterloo
30. Wellingtons Sieg
31. Die Bestrafung Frankreichs
32. Letzte Riten
33. Disharmonisches Konzert
34. Der Stillstand Europas
Anhang
Anmerkungen
Literatur
Bildnachweis
Personenregister
Einleitung
Die Neuordnung Europas auf dem Wiener Kongreß ist wahrscheinlich der folgenreichste Vorgang der modernen Geschichte. Nicht nur zeichnete der Kongreß die Landkarte völlig neu. Er entschied, welche Nationen über die nächsten hundert Jahre politisch existieren würden und welche nicht. Er verordnete dem ganzen Kontinent eine Ideologie, die sich aus den Interessen der vier Großmächte ableitete. Sein Versuch, die Vereinbarungen dieser Mächte in Stein zu meißeln, führte dazu, daß sich ihre expansionistischen Bestrebungen auf Afrika und Südasien richteten. Er veränderte die Gestaltung der internationalen Politik von Grund auf. Zu den Folgen des Kongresses gehört damit alles, was seit seinem Ende in Europa geschehen ist, auch der aggressive Nationalismus, der Bolschewismus, der Faschismus, die beiden Weltkriege und letztlich die Europäische Union.
Die Akteure dieses dramatischen Schauspiels mit all seinen vielen Schicksalswendungen zählen zu den faszinierendsten Gestalten der europäischen Geschichte. Im Zentrum des Geschehens stand Napoleon, der verzweifelt um seinen Thron kämpfte und doch mit jedem neuen Schritt seine Chancen untergrub und das Unheil offenbar hemmungslos auf sich zog. Auf der anderen Seite stand Zar Alexander von Rußland, der inzwischen überzeugt war, von Gott zur Erlösung der Welt berufen zu sein, ohne zu sehen, daß er in den Augen aller anderen eine Bedrohung dieser Welt darstellte. Der begnadete Strippenzieher Metternich übertraf sich selbst darin, schmeichelnd und beeinflussend die Ereignisse seiner eigenen Vision von einer sicheren Welt anzupassen. In seinem besessenen Bemühen, aus den Trümmern des napoleonischen Reiches für Frankreich – und für sich – zu retten, was zu retten war, knüpfte der listige Talleyrand immer wieder seine Netze. Der ungemein liebenswürdige Castlereagh, in jeder Hinsicht ein grundanständiger Mensch, mußte feststellen, daß er ebenso rücksichtslos Nationen zerlegte und Tauschgeschäfte mit Seelen trieb wie jeder andere Realpolitiker. Viele andere Charaktere nahmen zu gegebener Zeit ihre Plätze in diesem großen Karneval ein, einschließlich des Herzogs von Wellington, der sich als ebenso guter Staatsmann erwies wie als General. Und es gab ein faszinierendes Aufgebot von Frauen, die sich die Leidenschaften und enttäuschten Ambitionen der großen Männer Europas zunutze machten, was immer wieder Augenblicke großer Tragödien und kleiner Farcen schuf. Vom blutgetränkten Schlachtfeld und den armseligen Hütten am Wegesrand bis zu den vergoldeten Boudoirs und Ballsälen Wiens entsprach die Szenerie in allem der Erhabenheit und Erbärmlichkeit dieses Schauspiels. Die Geschichte hat bei den meisten Gebildeten allerdings ein Bild höfischer Eleganz und walzerseligen Leichtsinns hinterlassen.
Als ich im Katalog der British Library die Wörter «Wiener Kongreß» eingab, wurde mir eine Liste von Büchern angeboten über: den Ersten Internationalen Meteorologenkongreß, den Kongreß zu ökologischen Problemen von Lipiden, den Kongreß der Europäischen Vereinigung für Regionalwissenschaften, Literatur zu statistischen, sexuellen und philatelistischen Kongressen, zu Kongressen für angewandte Chemie, der Bibliophilen, für Dermatologie, für genealogische und heraldische Wissenschaften, Krampfadern, Exfoliativzytologie, Geburtsfehler, Hepatitis B, Elektroenzephalographie, Klinische Neurophysiologie und viele, viele andere, die alle während des vergangenen Jahrhunderts in Wien veranstaltet worden waren. Zwischen diesen verführerischen Titeln versteckten sich nicht mehr als ein halbes Dutzend, die sich auf die Ereignisse von 1814/15 bezogen.
Weitere Nachforschungen ergaben, daß die Literatur zu diesem Gegenstand tatsächlich schwer faßbar ist. Die umfangreichen und kompakten deutschen Untersuchungen, die überwiegend während des Prozesses der deutschen Einigung im 19. Jahrhundert und dann in der Zeit des Nationalsozialismus entstanden, spiegeln die speziellen Anforderungen der jeweiligen Epoche wider. Ein jüngerer französischer Beitrag, «Le Congrès de Vienne. L’Europe contre la France», enthält bereits im Titel eine Sichtweise, die charakteristisch für einen großen Teil der französischen Literatur zum Thema ist. Britische Studien zeichnen sich durch eine unglaubliche Überheblichkeit aus, die sich einer Unkenntnis der europäischen Bedingungen und der Überzeugung verdankt, daß Großbritannien keine Eigeninteressen verfolgte und seine Beteiligung daher unparteiisch und wohlwollend war. Wo immer sie auch geschrieben wurden, die meisten vorhandenen Bücher über den Kongreß sind ihrer Art nach oberflächlich, und die besten sind paradoxerweise jene, die sich redlicherweise nur auf die sozialen und auf die erotischen Aspekte des Ganzen beschränken. Kurzum, es gibt keine zufriedenstellende umfassende Untersuchung dieses Ereignisses, und folglich wissen die meisten Leute wenig darüber, außer daß auf diesem Kongreß viel getanzt wurde.
Die Gründe dafür wurden mir klar, als ich mich den Komplexitäten des Gegenstandes zuwandte. Es fängt damit an, daß der Wiener Kongreß in einem formellen Sinn niemals wirklich stattgefunden hat. Ähnlich wie «Jalta» für Verhandlungen und Abkommen zwischen 1943 und 1945 und sogar danach steht, umschreibt «Wiener Kongreß» pauschal einen Prozeß, der im Sommer 1812 begann und erst zehn Jahre später zu Ende ging. Wie so oft bei einem sich lange hinziehenden Prozeß sind es die scheinbar nebensächlichen Details, deren Lösung in frühen Phasen der Verhandlungen vertagt wurde, die dann aber in der entscheidenden Schlußphase die Verhandlungen beherrschen und verzerren. Es läßt sich daher unmöglich ein umfassender und verständlicher Bericht dieses Ereignisses schreiben, ohne eine sehr lange Zeitspanne in den Blick zu nehmen, und das verlangt viel Arbeit und erzwingt einen komplexeren Text, als ihn sich manch ein Historiker vornehmen möchte.
Ebenso wichtig ist es für jeden, der sich dieses Gegenstandes annehmen will, so viele europäische Sprachen wie möglich hinreichend zu kennen. Die Verhandlungen, die zwischen 1812 und 1815 geführt wurden, lassen sich mit einem Pokerspiel vergleichen, dessen Verlauf nur verständlich wird, wenn man sieht, welche Karten jeder Spieler auf der Hand hat und wie er sie ausspielt. Darüber hinaus ist etwas erforderlich, mit dem Historiker, die ihr Handwerk zu anderen Zeiten gelernt haben, besonders schwer umgehen können: eine Empathie mit den Wünschen und Ängsten jedes Mitspielers aufbringen zu können, weil sonst deren Entscheidungen und Reaktionen unverständlich bleiben. Der Grund dafür, daß es während des Wiener Kongresses mehrfach fast zum Krieg kam, war nicht die unprovozierte Aggressivität Preußens, nicht die Widerborstigkeit Rußlands oder die Doppelzüngigkeit Österreichs, er lag bei allen in der Furcht davor, von den anderen über den Tisch gezogen zu werden.
Als ich dieses Buch schrieb, beabsichtigte ich, die Verhandlungen, die zu dem Friedensabkommen führten, so vollständig wie möglich darzustellen, denn ich hoffte, daß die Abfolge der Ereignisse sich schließlich zu einer Erklärung dessen verdichten würde, wie dieses Ergebnis erreicht wurde. Ich habe mich bemüht, die Hoffnungen und die Befürchtungen jeder Seite so distanziert und zugleich so mitfühlend wie möglich zu schildern, wobei ich der festen Überzeugung war, daß es in diesem Spiel weder «gute» noch «böse» Akteure gab, sondern ausschließlich angstvolle.
Der Umfang der Untersuchung, den ich vorgesehen hatte, gestattete mir nicht, so ausführlich auf die Politik der bourbonischen Restaurationen einzugehen, wie ich es mir gewünscht hätte; das gleiche gilt für die verschlungenen Kräfteverhältnisse, in denen das italienische Problem einer Lösung zugeführt wurde, und erst recht für die Komplexitäten der deutschen Frage. Einer der wichtigsten, wenn nicht gar der wichtigste Gegenstand in dem, was wir als Wiener Kongreß bezeichnen, ist die territoriale und staatsrechtliche Neuordnung Deutschlands. Ich habe ihr sicherlich nicht so viel Raum gegeben, wie sie verdient hätte, und doch entschuldige ich mich hier dafür nicht. Es handelt sich bei ihr um einen so vielschichtigen und verwickelten Prozeß, daß nur ein erfahrener Spezialist für deutsche Geschichte ihn adäquat erfassen könnte, und dem dazu entstehenden Bericht könnte auch nur jemand folgen, der kaum weniger in diesem Thema versiert wäre. Für ein verständliches Gesamtbild der wesentlichen Aspekte des Kongresses ist es unvermeidlich, viele zusätzliche Zusammenhänge unberücksichtigt zu lassen, so faszinierend sie auch sein mögen.
Ich habe mich außerdem, im Sinne einer leichteren Lesbarkeit meiner Darstellung, auf die Hauptakteure konzentriert und es vermieden, viele ihrer zusätzlichen Mitarbeiter und Gegner zu erwähnen. Die Zahl derer, die sich an diesem großen Gerangel um Land, Macht und Einfluß beteiligten, war so groß, daß manch spannender Nebenschauplatz dieser Geschichte unerwähnt bleiben mußte.
Zwar sind gute Bücher über den Kongreß rar, es herrscht aber kein Mangel an publizierten Zeugnissen erster Hand, die ein Eintauchen in Archivmaterialien praktisch überflüssig machen. Nicht nur die Gesetzestexte und Verträge, auch die Memoranden, Verbalnoten, Proklamationen, Demarchen und andere Spuren der Verhandlungen liegen gedruckt vor, wie auch die Korrespondenz der Hauptakteure, ihre Tagebücher und Memoiren. Ebensolche Zeugnisse anderer Teilnehmer und Zuschauer sind publiziert worden, und etliche Berichte der österreichischen Geheimpolizei. Dennoch habe ich einige Archivquellen verwendet – zum guten Teil aus dem Wunsch heraus, die Arbeitsprozesse des Kongresses genauer zu durchdringen. Will man verstehen, wie eine Beziehung oder eine Verhandlung konkret verlief, läßt sich ein Originaldokument, das man in der Hand hält, durch nichts ersetzen. Als ich die Archive durchforstete, wurde mir klar, daß einige der gedruckten Primärquellen nicht so zuverlässig waren, wie man es sich gewünscht hätte, und daß die auf einer Sitzung getroffenen Entscheidungen nicht immer von allen Beteiligten in gleicher Weise notiert wurden. Für einige der entscheidenderen Momente der Verhandlungen griff ich daher auf Archivquellen zurück.
Was das leidige Problem der Toponyme betrifft, so ist es angesichts des weiten Gebiets, in dem die geschilderten Ereignisse spielen, schwer, Konsistenz zu erreichen. Ich habe daher eher die damals gängigen Bezeichungen verwendet und ihnen bei ihrer ersten Erwähnung im Text, falls erforderlich, ihren heutigen Namen in Klammern hinzugefügt. So habe ich mich beispielsweise an allgegenwärtige deutsche Bezeichnungen gehalten, wie etwa, wenn es um den Vertrag von Kalisch ging, obwohl die Stadt damals formal im Großherzogtum Warschau lag und daher als Kalisz bekannt war. Im Falle der Hauptstädte und größerer Städte habe ich jedoch die heute übliche Form verwendet.
Um der Lesbarkeit willen habe ich mehrere Quellen pro Absatz in einer einzigen Endnote gebündelt; sie werden im Anmerkungsverzeichnis in der Reihenfolge der erwähnten Fakten oder Zitate im Text aufgeführt.
Ich möchte Aleksandr Sapožnikov von der Handschriftenabteilung der Russischen Nationalbibliothek dafür danken, daß er mir bei der Einsicht in die Tagebücher von Michajlovskij-Danilevskij behilflich war, und Galina Babkova, die mir half, Kopien anderer Dokumente und Artikel in Rußland zu besorgen. In dankbarer Schuld stehe ich bei Ole Villumsen Krog, dem Direktor der Königlichen Silberkammer von Schloß Christiansborg in Kopenhagen, für seine Hilfe und Liebenswürdigkeit, mit denen er mir seine unschätzbare Arbeit zum Wiener Kongreß zugänglich machte, und bei meiner Rechercheurin in dänischen Dingen, Marie-Louise Møller Lange. Dank geht auch an Barbara Prout von der Bibliothèque Publique et Universitaire de Genève, die mir Kopien von dortigen Manuskripten zuschickte, und an Jennifer Irwin, die im Public Record Office Nordirlands recherchierte. Angelica von Hase war außerordentlich hilfreich beim Eindringen in die deutsche Literatur zum Kongreß und mit Übersetzungen einiger Quellen. Ich stehe in der Schuld von Barbara de Nicolay, die mich durch die Komplexitäten des Streits um das Herzogtum Bouillon geleitet hat. Dankbar bin ich auch Professor Isabel de Madariaga, Emmanuel de Waresquiel und Dr. Philip Mausel für ihren hilfreichen Rat, Shervie Price dafür, daß sie das Manuskript las, und Richard Foreman für seine überaus wertvolle Beratung zu den Kapitelüberschriften. Sehr zu danken habe ich Richard Johnson für die ermutigende Unterstützung und seine Nachsichtigkeit bei den Abgabeterminen. Robert Lacey war ein mustergültiger Lektor, der mich einmal mehr davor bewahrte, mich zum Narren zu machen. Der vielleicht bemerkenswerteste Beitrag kam von Sophie-Caroline de Margerie, die mir das Thema überhaupt vorschlug. Und auch dieses Mal hat meine Frau Emma mich daran gehindert, verrückt zu werden, und mir das Leben durch und durch lebenswert gemacht.
Adam Zamoyski
London, im Januar 2007
Hinweis der Übersetzer:
Wir haben, wo möglich, alle Zitate aus ihren Originalsprachen übersetzt. Lingua franca der Diplomatie und der europäischen Höfe war damals das Französische, hinzu kamen auch russische und andere Quellen. Die zuweilen altertümliche Diktion und Orthographie der deutschen Zitate entsprechen der Zeit ihres Entstehens bzw. ihrer Veröffentlichung. Für das Aufspüren der Originalzitate danken wir Jan Dreßler und Tino Jacobs sehr herzlich. Unser Dank geht auch an den Deutschen Übersetzerfonds, der diese Arbeit großzügig unterstützt hat.
1Der aufgeschreckte Löwe
Die Uhr des Tuilerien-Palastes hatte gerade zum letzten Viertel vor Mitternacht geschlagen, als eine schlammbespritzte, von vier ermüdeten Pferden im Galopp gezogene Kutsche von jener einfachen Art, die als chaise de poste bekannt war, auf den Paradeplatz vor dem Schloß einbog. In Unkenntnis der Hofetikette fuhr der Kutscher durch den dort befindlichen mittleren Bogen des Arc de Triomphe du Carrousel, der ausschließlich dem Kaiser vorbehalten war, noch bevor die schlaftrunkenen Wachen reagieren und sich ihm in den Weg stellen konnten. «Das ist ein gutes Vorzeichen!», rief einer der beiden Männer, die in der Kutsche saßen, ein molliger Mann in einem dicken, gefütterten Mantel, dessen Gesicht von einer Pelzmütze weitgehend verdeckt wurde.
Das Gefährt hielt am Haupteingang, unter der Uhr, und die Passagiere kletterten hinaus. Der erste und größere von beiden hatte seinen Militärmantel aufgeknöpft, so daß seine goldbesetzte Brust sichtbar wurde und die Wachen ihn und seinen Begleiter unbehelligt passieren ließen, da sie annahmen, es handele sich um hohe Offiziere, die eilige Depeschen brachten.
Die beiden Männer gingen rasch den Gewölbegang hinunter und klopften an dessen Ende an ein hohes Portal. Nach einer Weile erschien der Kastellan im Nachthemd mit einer Laterne. Der größere der beiden gab sich als Kaiserlicher Großstallmeister zu erkennen, aber es dauerte einige Zeit, bis der Kastellan und seine schlaftrunkene Frau, die sich zu ihm gesellt hatte, überzeugt waren, daß der Mann, der vor ihnen stand, tatsächlich General de Caulaincourt war. Er trug zwar die passende Uniform, aber mit seinen langen und zerzausten Haaren, dem wettergegerbten Gesicht und den etwa zwei Wochen alten Bartstoppeln glich er eher einem Räuber auf der Bühne als einem hohen Würdenträger des kaiserlichen Hofes.
Diese Zeichnung von Anne-Louis Girodet-Trioson, entstanden im März 1812, kurz bevor der Kaiser zu seinem Rußlandfeldzug aufbrach, zeigt einen alternden Napoleon, der sich lieber der Konsolidierung seiner Herrschaft gewidmet hätte, als wieder in den Krieg zu ziehen. Seine Friedenssehnsucht hatte sich zwölf Monate später noch verstärkt; auf seine Macht wollte er aber auf keinen Fall verzichten. Nicht jedoch er, sondern seine Feinde entschieden über die zukünftige Gestalt Europas.
Die Frau des Kastellans öffnete das Tor und sagte, die Kaiserin habe sich soeben zur Nacht zurückgezogen; derweil ging ihr Mann die diensthabenden Diener holen, die die Neuankömmlinge hineinbegleiten sollten. Die Frau wandte sich, noch gähnend und sich die Augen reibend, nun dem anderen Mann zu. Obwohl das flackernde Licht nur einen Teil seines Gesichts erleuchtete, meinte sie, zwischen dem hohen Kragen des Mantels und der in die Stirn gezogenen Pelzmütze den Kaiser zu erkennen. Aber das schien ihr unmöglich zu sein. Erst vor zwei Tagen hatten die Einwohner von Paris aus dem neunundzwanzigsten Bulletin de la Grande Armée zu ihrer Bestürzung erfahren, daß er sich mit seinem bedrängten Heer durch den russischen Schnee kämpfte.
Die beiden Männer wurden einen Säulengang hinabgeführt, der sich rechts zu den Gärten hin öffnete, und gingen nach links in die Gemächer der Kaiserin – gerade als ihre Kammerzofen, die sie beim Schlafengehen bedient hatten, aus ihrem Privatgemach traten. Beim Anblick des bärtigen Mannes in dem verdreckten Militärmantel schreckten die Damen ängstlich zurück, aber als er ihnen erklärte, er bringe Nachricht vom Kaiser, erkannten sie Caulaincourt, und eine kehrte zur Kaiserin zurück, um den Großstallmeister anzukündigen.
Als Napoleons Gesandter in Rußland von 1807 bis 1811 hatte General Armand de Caulaincourt alles in seiner Macht Stehende getan, um die beiden Imperien vor einem Konflikt zu bewahren und Napoleon dazu zu bringen, Frieden zu schließen, solange das möglich war. Zeichnung von Jacques-Louis David.
Voller Ungeduld drängte sich der kleinere der beiden Männer an seinem Begleiter vorbei auf die Tür des Gemachs zu. Sein Mantel hatte sich geöffnet, unter dem die Uniform eines Grenadiers der Alten Garde zum Vorschein kam, und als er jetzt zielstrebig den Raum durchquerte, bestand kein Zweifel mehr daran, daß dies Kaiser Napoleon war. «Gute Nacht, Caulaincourt!», sagte er und warf einen Blick zurück. «Sie haben auch Ihre Ruhe verdient.»[1]
Das war ziemlich untertrieben. Der General hatte seit über acht Wochen nicht mehr in einem Bett geschlafen und sich während der letzten beiden kaum einmal ausstrecken können; er hatte unter unsäglichen Bedingungen, oft unter Feuer, den weiten, mehr als 3000 Kilometer langen Weg von Moskau aus zurückgelegt. Zuvor hatte er an dem zermürbenden Vormarsch teilgenommen, in dessen Verlauf die beste Armee in Europa dezimiert worden war, und er hatte zuschauen müssen, wie sein geliebter jüngerer Bruder in der Schlacht von Borodino umkam. Er hatte Moskau brennen sehen. Er hatte die Entbehrungen und Greuel des katastrophalen Rückzugs miterlebt, dem über eine halbe Million französischer und verbündeter Soldaten zum Opfer gefallen waren.
Vielleicht war es für den neununddreißigjährigen General Armand de Caulaincourt, Herzog von Vicenza, einen fähigen Soldaten und Diplomaten, am schwersten zu ertragen gewesen, daß er mitansehen mußte, wie sich seine schlimmsten Prophezeiungen eine nach der anderen erfüllten. Zwischen 1807 und 1811 hatte er als Napoleons Botschafter in Rußland alles getan, was in seiner Macht stand, um einen Konflikt zwischen den beiden Großmächten abzuwenden. Mehrfach hatte er Napoleon beschworen, nicht gegen Rußland in den Krieg zu ziehen, und ihn gewarnt, daß man gegen diesen Gegner unmöglich gewinnen könne. Noch als sie quer durch Europa reisten, um beim Truppenaufmarsch gegen Rußland dabeizusein, hatte er ihn umzustimmen versucht. Nachdem der Feldzug begonnen hatte, versuchte er ein ums andere Mal, Napoleon zu einer Schadensbegrenzung zu überreden – Caulaincourts Loyalität zu seinem Kaiser war unerschütterlich, aber er scheute sich nie, seine Meinung offen zu sagen. Es war alles vergebens.
Während sich die Reste seiner Armee noch auf dem letzten Abschnitt ihres Rückzugs durchkämpften, hatte Napoleon am 5. Dezember 1812 beschlossen, seine Armee zu verlassen und nach Paris zurückzueilen. Das Kommando übertrug er seinem Schwager Joachim Murat, dem König von Neapel, unter der strikten Anweisung, die Grande Armée im litauischen Wilna (Vilnius) zu sammeln, das mit Vorräten und Verstärkungstruppen gut bestückt war, und es um jeden Preis zu halten.
Er war mit Caulaincourt in seinem Reise-Coupé aufgebrochen, dem zwei weitere Kutschen mit drei Generälen und einigen Dienern folgten. Sie wurden von einer Schwadron Gardejäger sowie einer der polnischen Chevaulegers der Alten Garde begleitet, vorübergehend auch von etwas neapolitanischer Kavallerie. Einmal wäre der Konvoi um ein Haar von marodierenden Kosaken abgefangen worden. Napoleon hatte zwei geladene Pistolen in sein Coupé legen lassen und für den Fall seiner Gefangennahme seine Begleiter angewiesen, ihn zu töten, sollte er dazu nicht mehr selber in der Lage sein.[2]
Caulaincourt wich nicht von seiner Seite, selbst dann nicht, als sie ihre Eskorte und Gefährten zurückließen, wobei sie von der Kutsche in einen behelfsmäßigen Schlitten, von diesem auf eine Kutsche und dann wieder auf einen Schlitten wechselten usw., und immer wieder die Achsen brachen und ein halbes Dutzend Fahrzeuge verschlissen wurde, während sie von Wilna über Warschau, Dresden, Leipzig, Weimar, Erfurt und Mainz schließlich bis nach Paris flohen, wo sie in den letzten Minuten des 18. Dezember eintrafen.
Aber bevor er daheim zu Bett gehen konnte, mußte Caulaincourt noch einer letzten Pflicht nachkommen. Er begab sich zum Haus des Erzkanzlers Jean-Jacques de Cambacérès, und nachdem er diesen mit der erstaunlichen Nachricht von der Rückkehr des Kaisers geweckt hatte, wies er ihn an, die nötigen Arrangements zu treffen, damit das ordnungsgemäße kaiserliche lever am nächsten Morgen stattfinden könne. Napoleon wünschte eine sofortige Wiederaufnahme der normalen Alltagsroutinen.
Auf seinen Feldzügen ließ Napoleon in regelmäßigen Abständen Bulletins de la Grande Armée veröffentlichen, um seine Untertanen über sein Tun auf dem laufenden zu halten und sich dabei in einem heldenhaften Licht zu präsentieren. Im neunundzwanzigsten Bulletin vom 16. Dezember hatten sie zum ersten Mal Nachrichten vorgefunden, die wenig glorreich waren. Sie lasen jetzt, daß er Moskau gezwungenermaßen hatte verlassen müssen und seine Armee infolge des Winters schreckliche Verluste erlitten hatte. Wer zwischen den Zeilen las, konnte auf eine ungeheure Katastrophe schließen. Aber das Bulletin endete mit den Worten: «Die Gesundheit Sr. Majestät war nie besser.» Damit bezweckte er, daß die Bürger Frankreichs zwei Tage, nachdem sie das Schlimmste erfahren hatten, wieder zuversichtlich sein könnten, im Wissen, daß ihr Kaiser wiedergekehrt und Herr der Lage sei.
Vor allem aus einem Grund hatte Napoleon seine Armee verlassen und war nach Paris zurückgekommen: Er wollte frische Truppen ausheben und im Frühjahr mit ihnen ausrücken, um seine Armee zu verstärken. Aber es gab auch andere Erwägungen. Zum einen war es ihm lieber, wenn er seine durchaus nicht zuverlässigen Verbündeten Österreich und Deutschland vor sich hatte, und nicht im Rücken. Als noch wichtiger und drängender empfand er es, seine Autorität im eigenen Land wieder zu stärken. Mehr als sieben Monate lang war er der Hauptstadt ferngeblieben und hatte während dieser Zeit die Staatsangelegenheiten von seinem Hauptquartier aus geführt. Das hatte erstaunlich gut funktioniert, und von der Außenpolitik bis hin zum Spielplan der Pariser Bühnen hatte er von dort aus weiterhin alles beaufsichtigt und befehligt.
Aber in der Nacht des 23. Oktober, um die Zeit, als er seinen Rückzug aus Moskau begann, hatte ein unbedeutender General namens Malet mit einer Handvoll anderer Offiziere versucht, die Macht in Paris zu ergreifen, mit der Behauptung, der Kaiser sei tot. Sie wären beinahe erfolgreich gewesen, und obgleich man Malet und seine Komplizen vor Gericht stellte und erschoß, bevor noch Napoleon von dem Putschversuch erfuhr, verstörte ihn die Sache zutiefst, als ihm davon berichtet wurde. Sie führte ihm vor Augen, auf welch unsicherem Fundament sein Thron stand, und das gab ihm zu denken.
Am Morgen des 19. Dezember feuerte die Kanone vor dem Invalidendom einen Salut, der den verblüfften Bürgern von Paris verkündete, daß ihr Kaiser wieder in der Hauptstadt weile. Sie waren noch immer fassungslos angesichts der Nachricht seines Scheiterns in Rußland; sie brannten darauf, Näheres zu erfahren, und hofften auf irgendeine Erklärung. Diese gespannte Erwartung beherrschte vor allem jene Beamten und Höflinge, die zum lever eilten. Aber sie wurden enttäuscht: Der Kaiser war einsilbig und abweisend und verschwand nach kurzer Zeit in seinem Arbeitszimmer, wohin er seine wichtigsten Minister bestellte.
Er war nicht in der Stimmung, Erklärungen abzugeben, sondern, im Gegenteil, welche einzufordern, und das bekamen die Vertreter der gesetzgebenden Institutionen und der Verwaltungen zu spüren, als sie ihm am nächsten Tag ihre Aufwartung machten. Um sie als schwach, feige und unfähig hinzustellen, brachte er die Verschwörung Malets zur Sprache. Besonders empfindlich hatte ihn getroffen, daß jene, die der von Malet in Umlauf gebrachten Nachricht von seinem Tod in Rußland aufgesessen waren, einen Regimewechsel erwogen, statt seinen Sohn, den König von Rom, zum Thronfolger auszurufen. «Unserer Väter Losungswort war: Le roi est mort, vive le roi!», hielt er ihnen vor, und fügte hinzu: «Diese wenigen Worte enthalten die Hauptvorteile der Monarchie.» Daß der Ruf am 23. Oktober nicht erschollen war, machte ihm bewußt, daß die Monarchie, die er geschaffen hatte, trotz aller äußerlichen Riten und Symbole auf tönernen Füßen stand. Nach wie vor war er nur ein General, der die Macht ergriffen hatte, ein parvenu ohne einen Herrschaftsanspruch, der auf mehr als seiner Fähigkeit beruhte, an ihm festzuhalten. Diesen Rückschlag empfand er als persönliche Kränkung, und die Unsicherheit, die er bei ihm auslöste, sollte sich stark auf sein Verhalten während der nächsten beiden Jahre auswirken. Sie machte ihn aggressiver und weniger zugänglich, und führte unaufhaltsam in seinen Untergang.[3]
Bevor er im Sommer 1812 zu seinem verhängnisvollen Feldzug gegen Rußland aufbrach, war Napoleon der unumstrittene Herrscher über Europa gewesen und mächtiger als irgendein römischer Kaiser. Das französische Kaiserreich und die von ihm unmittelbar abhängigen Gebiete umfaßten ganz Belgien, Holland und die Nordseeküste bis hinauf nach Hamburg, das Rheinland, die gesamte Schweiz, Piemont und Ligurien, die Toskana, den Kirchenstaat, Illyrien (das heutige Slowenien und Kroatien) und Katalonien und dazu auch das heutige Frankreich. Alle kleineren deutschen Staaten, darunter die Königreiche Sachsen, Bayern und Württemberg, waren im Rheinbund vereinigt, einem gänzlich abhängigen und unterworfenen Verbündeten Frankreichs; das waren auch das Großherzogtum Warschau, das Königreich Italien und die Königreiche Neapel und Spanien. Mehrere dieser Monarchien wurden von Geschwistern oder Verwandten Napoleons regiert oder waren mit ihm durch dynastische Eheschließungen verbunden. Dänemark und Rußland saßen in einer mehr oder weniger permanenten Allianz mit Frankreich fest, Österreich und Preußen waren ziemlich fragile Verbündete und in Kontinentaleuropa blieb nur Schweden außerhalb des napoleonischen Systems.
Viele haßten den Würgegriff Frankreichs, aber es gab auch andere, die ihn begrüßten oder zumindest akzeptierten. Der einzige Herausforderer Napoleons war Großbritannien; aber auch wenn es die Meere beherrschte, auf dem europäischen Festland hatte es nur in Spanien Fuß fassen können, wo die Armee des Generals Wellington neben regulären spanischen Truppen und Guerillaeinheiten operierte, die die Herrschaft von Napoleons Bruder Joseph bekämpften. Die Briten waren jedoch zugleich in einen schwierigen und kostspieligen Krieg mit den Vereinigten Staaten von Amerika verwickelt, was ihrem militärischen Potential Grenzen setzte.
Der verheerende Rußlandfeldzug hatte all das verändert, jedoch nicht so tiefgreifend, wie man vermuten könnte. Obwohl er nun mit Rußland Krieg führte und bei dem Versuch, es in die Knie zu zwingen, eine Armee verloren hatte, hatte sich Napoleons Position insgesamt nicht verändert. Sein System und seine Bündnisse waren nach wie vor intakt, und die Lage in Spanien hatte sich sogar verbessert, nachdem die Rückschläge des Sommers überwunden und die britischen und spanischen Truppen unter Wellington abgewehrt worden waren.
Die einzige Gefährdung für sein System hätte zum damaligen Zeitpunkt durch Deutschland gedroht, dessen viele Herrscher, angefangen mit Friedrich Wilhelm III. von Preußen, das Bündnis mit ihm zunehmend als lästig empfanden, und dessen Untertanen eine heftige Abneigung gegen ihre französischen Verbündeten hegten. Aber Preußen war durch Frankreich erheblich verkleinert und wirtschaftlich ausgeblutet worden, während die anderen Monarchen zu schwach waren und einander zu sehr mißtrauten, um eine ernsthafte Bedrohung darzustellen; und Österreich war nach seiner verheerenden Niederlage von 1809 nicht imstande, Krieg zu führen. Wer immer noch davon träumte, das französische Joch abzuschütteln, mußte die Überreste der Grande Armée in Polen und eine Kette von Festungen mit französischen Garnisonen überall in Deutschland mitbedenken.
Napoleons Selbstbewußtsein war durch die Ereignisse von 1812 nicht ernstlich erschüttert worden. Er hatte grobe politische und militärische Fehler begangen, und er hatte eine ausgezeichnete Armee verloren. Aber er wußte – ebenso wie es, trotz der russischen Propaganda, die meisten erfahrenen Feldherren Europas wußten –, daß er auf dem Schlachtfeld immer siegreich gewesen war. «Meine Verluste waren beträchtlich, aber dessen darf sich der Feind nicht rühmen», schrieb er in einem Brief an den König von Dänemark. Und er konnte jederzeit eine neue Armee aufstellen.[4]
Frankreich war nach wie vor der mächtigste Staat auf dem europäischen Kontinent. Rußland besaß keine vergleichbaren Reserven an Macht und Reichtum, und es hatte im Vorjahr stark unter den Verwüstungen des Krieges gelitten. Im nachhinein wissen wir, daß Napoleons Ruf und die Grundlagen seiner Macht unheilbar beschädigt waren, aber damals war allen klar, daß seine Position unangreifbar blieb, solange er einen kühlen Kopf behielt und seine Ressourcen konsolidierte. Und dies zu tun, schickte er sich nun an.
Auf seinem Rückweg nach Paris hatte er gerade lange genug in Warschau Halt gemacht, um die polnischen Minister zu versichern, er habe alles im Griff und werde im Frühjahr mit einer neuen Armee zurückkehren. Einige Tage später redete er beruhigend auf seinen Verbündeten, den König von Sachsen, ein und drängte ihn, weitere Truppen auszuheben. Ebenfalls in Dresden schrieb er seinem Schwiegervater, dem Kaiser von Österreich, er habe alles unter Kontrolle, und bat ihn, das Kontingent österreichischer Soldaten, die gemeinsam mit der Grande Armée kämpften, auf 60.000 zu verdoppeln. Zusätzlich bat er ihn, einen Botschafter nach Paris zu entsenden, damit sie leichter miteinander kommunizieren könnten.[5]
Nach seiner Rückkehr nach Paris machte er sich daran, seine Truppen wieder aufzubauen. Noch vor seiner Abreise hatte er Befehl zur Einberufung der Altersgruppe gegeben, die im Jahr 1814 an der Reihe gewesen wäre, was ihm 140.000 junge Männer beschert hatte, die bereits in den Sammelstellen gedrillt wurden. Zusätzlich standen ihm 100.000 Mann der Nationalgarde zur Verfügung, die er für die Landesverteidigung aufgestellt hatte, bevor er nach Rußland aufbrach. Angesichts der politischen Lage in Frankreich schuf er nun eine neue Streitmacht, die Gardes d’Honneur, die sich aus Sprößlingen von Adelsfamilien und solchen zusammensetzte, die seine Herrschaft ablehnten und die man mitten aus den royalistischsten Provinzen zusammengeholt hatte. Die Besserung der Lage in Spanien ermöglichte es ihm, vier Garderegimenter, die berittene Gendarmerie und einige polnische Kavallerieeinheiten von der Iberischen Halbinsel abzuziehen. Und er wies seine anderen Verbündeten in Deutschland an, zu seiner Unterstützung mehr Truppen auszuheben.
Nach seinen Berechnungen hatte er immer noch 150.000 Soldaten, die die Ostgrenze seines Imperiums absicherten, davon mindestens 60.000 Mann unter Murat in Wilna, 25.000 unter Macdonald im Norden, 30.000 österreichische Bündnissoldaten im Süden unter Schwarzenberg, Poniatowskis polnisches Korps und die Reste des sächsischen Kontingents unter Reynier, die Warschau schützten, sowie mehr als 25.000 Männer in Reservedepots oder Festungen von Danzig an der Ostsee bis hinunter nach Zamość. Er war daher zuversichtlich, daß er im Frühjahr mit etwa 350.000 Mann in Deutschland losmarschieren könne.[6]
Aber nicht einmal eine Woche nach seiner Rückkehr nach Paris erreichten ihn am Weihnachtsabend schlechte Nachrichten aus Litauen. Als die versprengten Reste der Grande Armée nach und nach in Wilna eintrafen, in dem sie einen rettenden Hafen wähnten, war die Durchhaltekraft der Soldaten einem großen Ruhebedürfnis gewichen. Murat hatte versäumt, eine angemessene Verteidigung auf die Beine zu stellen, so daß die vorrückenden russischen Truppen die Stadt mühelos überrennen konnten. Verwirrung und Panik hatten eine geordnete vakuierung selbst durch solche Einheiten verhindert, die noch kampffähig gewesen wären, und einige Tage später überquerten kaum mehr als 10.000 Mann den Njemen und verließen Rußland. Napoleon war durch diese Nachricht am Boden zerstört. Er bereute bitterlich, Murat das Kommando übertragen zu haben, und ihm grauste davor, wie dieses Ereignis gegen ihn propagandistisch ausgeschlachtet werden würde. Aber nach ein, zwei Tagen versicherte er Caulaincourt bereits, es sei ein unwesentlicher Rückschlag gewesen; er hatte es offenbar verwunden.[7]
Er würde sich dadurch bestimmt nicht von seinen Plänen abbringen lassen oder erlauben, daß sein Selbstvertrauen Schaden nähme. Der angeforderte Botschafter des Kaisers Franz von Österreich war in Paris eingetroffen. Es handelte sich um General Ferdinand Graf von Bubna und Littitz, einen hervorragenden Soldaten, den Napoleon gut kannte und mochte. Im Verlauf ihrer ersten Unterredung am Abend des 31. Dezember überbrachte Bubna das Angebot Österreichs, beim Aushandeln eines Friedens zwischen Frankreich und Rußland behilflich zu sein. Napoleon schlug es aus.
Sicherlich wünschte er Frieden, wahrscheinlich sehnlicher als alle seine Feinde. Er war jetzt dreiundvierzig Jahre alt. «Ich werde schwerfällig und zu beleibt, um nicht meine Ruhe zu lieben, um nicht das Hin und Her, die ständige Anspannung, die der Krieg verlangt, als große Strapaze zu empfinden», gestand er Caulaincourt. Er habe den Krieg von 1812 gegen Rußland nur deshalb geführt, um Zar Alexander zu zwingen, eine Blockade durchzuführen, von der er sich versprach, daß sie Großbritannien an den Verhandlungstisch bringen würde.[8]
Während ihrer langen Fahrt von Litauen nach Paris hatte sich der zur Untätigkeit verdammte Napoleon ausgiebig und hartnäckig seinen Gedanken hingegeben, wobei er gelegentlich seinen Reisebegleiter in die Wange kniff oder ihn am Ohr zog, wie es seine Art war. Zum Glück für die Nachwelt hörte Caulaincourt aufmerksam zu und hielt diese Ergüsse schriftlich fest, wann immer der Kaiser einnickte oder sie anhielten, um die Pferde zu wechseln. Napoleon beteuerte wieder und wieder, daß er sich nur nach Frieden und Stabilität für Europa sehnte und die anderen Mächte auf dem Kontinent mit Blindheit geschlagen seien, wenn sie nicht erkannten, daß ihr wahrer Feind Großbritannien war, mit seiner Monopolstellung als See- und Handelsmacht. Jeder Frieden, der Großbritannien nicht einbeziehe, sei wertlos. Aber Großbritannien sei nicht bereit, einen Frieden zu solchen Bedingungen zu erwägen, die für Frankreich annehmbar wären. Die Briten müßten zum Kompromiß gezwungen werden.
Drei Tage, nachdem er das österreichische Vermittlungsangebot ausgeschlagen hatte, besprach sich Napoleon mit seinen wichtigsten Beratern in auswärtigen Angelegenheiten. Dabei ging es hauptsächlich um die Frage, ob es besser sei, sich direkt um eine Einigung mit Rußland zu bemühen – über die Köpfe von Österreich und Preußen hinweg und möglicherweise zu deren Lasten –, oder auf Österreich als wichtigsten Verbündeten und möglichen Verhandlungsführer zu setzen. Erzkanzler Cambacérès, der ehemalige Außenminister Talleyrand und Caulaincourt rieten zur ersteren Vorgehensweise, der amtierende Außenminister Maret und die anderen zur zweiten. Wie stets bei derartigen Beratungen hörte Napoleon zu, ohne sich in der einen oder der anderen Richtung festzulegen. Für eine Entscheidung bliebe ihm noch reichlich Zeit, denn er hatte nicht vor, anders als aus einer Position der Stärke zu verhandeln. Sie wäre gegeben, wenn er an der Spitze einer frischen Armee wieder in Deutschland auftauchte, und bis dahin mußte er sich darauf konzentrieren, eine aufzustellen.[9]
Darin kam er gut voran. «Alles ist hier in Bewegung», schrieb er seinem Stabschef, Marschall Berthier, am 9. Januar 1813. «Es fehlt an nichts, weder an Soldaten, noch an Geld, noch an gutem Willen.» Das einzige, woran es mangele, gestand er, seien Offiziere und ein Grundstock an bewährten Soldaten, aber er war zuversichtlich, daß er diese unter den Resten der Grande Armée finden würde, da es im allgemeinen Offiziere und Unteroffiziere waren, die die Mehrzahl der Überlebenden ausmachten. Aber als er noch am selben Abend von einer Vorstellung im Théâtre Français zurückkehrte, erwarteten ihn unerfreuliche Neuigkeiten, in denen sich alarmierende Folgen abzeichneten.[10]
Preußen war in das Bündnis mit Frankreich gezwungen worden und hatte zur Invasion Rußlands ein Armeekorps beigesteuert. Aber in der Bevölkerung herrschten starke Ressentiments gegen Frankreich, besonders in den nördlichen und östlichen Teilen des Landes, und auch in der Armee waren sie stark. Am 30. Dezember 1812 trennte General Yorck von Wartenburg, Befehlshaber des preußischen Korps in der Grande Armée, dieses von den französischen Einheiten ab und unterschrieb seinen eigenen Bündnisvertrag mit Rußland. Nicht nur machte das den Franzosen unmöglich, ihre bisherige Verteidigungsstrategie aufrechtzuerhalten und zwang sie, sich zur Weichsel zurückzuziehen; es weckte auch Zweifel an der Loyalität Preußens.
Kurze Zeit nach Erhalt dieser Nachricht folgte die Versicherung, daß der preußische König, Friedrich Wilhelm III., diese Tat verurteilt und befohlen habe, Yorck seines Kommandos zu entheben. Napoleons Botschafter in Berlin, der Graf von Saint-Marsan, schickte beschwichtigende Berichte über Preußens Loyalität und meldete am 12. Januar, daß Friedrich Wilhelm mit dem Gedanken spiele, seinen Sohn, den Kronprinzen, mit einer Prinzessin der Familie Bonaparte zu vermählen, um das Bündnis zwischen den beiden Höfen zu festigen. Wenige Tage später traf Friedrich Wilhelms Sondergesandter, Fürst von Hatzfeldt, in Paris ein.[11]
Aus Wien erhielt Napoleon ähnlich ermutigende Berichte. Er zweifelte keine Sekunde daran, daß sein Schwiegervater, Kaiser Franz, ihm bis zuletzt beistehen würde: Napoleon war so vernarrt in seine Gattin Marie-Louise und seinen Sohn, den König von Rom, daß er Franz dieselben Gefühle für Tochter und Enkel unterstellte. Aber Franz folgte keiner eigenen politischen Linie. «Unsere Allianz mit Frankreich … ist so nothwendig, daß, wenn Sie dieselbe heute brechen, wir uns morgen bemühen werden, sie mit Ihnen durchaus auf dieselben Bedingungen wiederherzustellen», hatte der österreichische Außenminister Metternich zu Napoleons Gesandten in Wien, Graf Louis-Guillaume Otto, gesagt. Napoleon blieb dennoch auf der Hut und beschloß, Otto durch jemanden zu ersetzen, der einen frischen Blick auf die Lage in Wien werfen könnte. Für diese Aufgabe wählte er den Grafen Louis Marie de Narbonne-Lara.[12]
Während seine Rekruten in Uniformen gesteckt und ausgebildet wurden, widmete sich Napoleon den täglichen Amtsgeschäften und entspannte sich bei der Jagd in Fontainebleau. Er ergriff die Gelegenheit, Papst Pius VII. zu besuchen, der dort seit 1809, nachdem die Franzosen den Kirchenstaat besetzt hatten, als Gefangener lebte. Nach kurzen Verhandlungen unterzeichnete Napoleon mit ihm ein neues Konkordat. Dies war ratsam, da er mit seiner Behandlung des Papstes nicht nur die Katholiken Frankreichs, sondern auch solche, die in den Gebieten seiner süddeutschen und österreichischen Verbündeten lebten, unnötig gegen sich aufgebracht hatte. Die Bedingungen des Abkommens waren aber so demütigend, daß sich die Gemüter nicht beruhigten.
Am 14. Oktober nahm Napoleon an der Eröffnung der gesetzgebenden Versammlung teil und hielt eine Rede, in der er seinen leidenschaftlichen Wunsch nach Frieden ausdrückte. Er würde alles tun, ihn zu fördern; gleichzeitig betonte er, daß er nie einen Vertrag unterschreiben werde, der Frankreich entehre. Er malte ein beruhigendes Bild der internationalen Lage und behauptete, daß die Dynastie der Bonaparte in Spanien sicher sei und die Lage in Deutschland keinen Anlaß zu Befürchtungen gebe. «Ich bin mit dem Betragen aller meiner Alliirten vollkommen zufrieden. Ich werde keinen von ihnen im Stiche lassen, und die Integrität ihrer Staaten zu handhaben wissen. Die Russen werden nach ihrem abscheulichen Klima zurückkehren.»[13]
2Der Retter Europas
«Meine Herren, Sie haben nicht nur Rußland, Sie haben auch Europa gerettet», hatte Zar Alexander seinen Generälen am 12. Dezember 1812 in Wilna versichert, kurz nachdem die letzten französischen Nachzügler die Stadt verlassen hatten. Ob beide Behauptungen stimmten, ist zweifelhaft, aber das war unwichtig. Der sympathische und ritterliche Alexander galt mit seinen vierunddreißig Jahren vielen als die Verkörperung des monarchischen beau idéal. Daß er sich von Napoleon nicht einschüchtern ließ und sein Land entschlossen verteidigte, hatte überall Respekt geweckt. Mochte er auch fast völlig deutsch sein, die merkwürdige Mischung aus Exotik und Spiritualität, die in Europa nahezu allem, was hier als russisch galt, zugeschrieben wurde, verlieh ihm eine Aura von Kühnheit und Aufrichtigkeit. So wurde er zum Idol aller, die glaubten, Europa müsse gerettet werden.[1]
Aber wenn er auch den brennenden Wunsch hegte, sie nicht zu enttäuschen, er wußte nicht so recht, wie diese Rettung Europas bewerkstelligt werden sollte. Seine Absichten waren gewiß löblich. «Er wollte, daß alle Menschen einander brüderlich lieben und sich in ihren wechselseitigen Bedürfnissen beistünden, und daß ein freier Handel zum einigenden Band der Gesellschaft werde» – das gab eine junge Dame weiter, der er sich zu diesem kritischen Zeitpunkt anvertraute. Aber er war nicht hinreichend überzeugt und entschlossen. «Manchmal möchte ich meinen Kopf gegen die Wand schlagen», sagte er zu ihr, «und wenn ich meinen Stand auf ehrenhafte Weise wechseln könnte, würde ich es gerne tun, denn kein Stand ist schwieriger als der meine, und ich bin für den Thron in keiner Weise berufen.»[2]
Darin steckte viel Wahres. Obgleich Alexander von Natur aus freundlich und großzügig war, neigte er dazu, sich rasch auch verstimmen zu lassen. Er war zugleich charakterschwach und stur – leicht zu beeinflussen, aber schwer zu handhaben. Der fortschrittliche Geist, in dem er erzogen worden war, hatte sein Selbstvertrauen zerstört, insofern dieser seiner tragischen Bestimmung, absoluter Monarch der theokratischsten und tradionalistischsten Macht Europas zu werden, diametral widersprach. Das führte dazu, daß er sich auf geradezu klägliche Weise bemühte, anderen zu gefallen, und sich doch zugleich als entschlossene und starke Herrscherpersönlichkeit beweisen wollte.
Zar Alexander I. von Rußland, nach eigener Überzeugung von Gott dazu berufen, die Welt zu retten, wurde anfangs allseits als Befreier gefeiert. Aber schließlich galt er wegen seiner autoritären Haltung als Bedrohung des Friedens: zugleich spottete man über seine vielen Liebschaften. Porträt von Sir Thomas Lawrence, 1817.
«Er hätte von ganzem Herzen allen die Freiheit geschenkt, solange sie sich alle von ganzem Herzen seinem Willen untergeordnet hätten», wie es ein enger Freund ausdrückte. Alexander hatte sich den Ideen der Aufklärung verschrieben und wollte gern als Wohltäter der Menschheit gesehen werden, aber diese Neigung entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einer Art spirituellem Schicksalsglauben, der ihn von diesen Idealen weit abführen würde. «Mehr denn je», schrieb er im Januar 1813 seinem Freund Aleksandr Golizyn, als er über die Rettung Europas nachdachte, «füge ich mich dem Willen Gottes und unterwerfe mich blind Seinen Geboten.»[3]
Alexanders Freund und Berater in internationalen Angelegenheiten, der polnische Prinz Adam Czartoryski. Während der Russische Hof ihn als potentiellen Feind wahrnahm, sahen die anderen Mächte in ihm den gefährlichsten der russischen Unterhändler. Porträt von Józef Oleszkiewicz, ca. 1806.
Alexander hatte 1801, nach der Ermordung seines Vaters, Pauls I., in die er erheblich verwickelt gewesen war, im Alter von dreiundzwanzig Jahren den Thron bestiegen. Sofort hatte er ein «Geheimkomitee» gebildet, das aus engen und gleichgesinnten Freunden bestand und ihn bei der Planung grundlegender Reformen des russischen Staates unterstützen sollte. Mit der Außenpolitik betraute er Fürst Adam Czartoryski, der Alexanders utopische Phantasien in einem hochfliegenden Projekt eines zukünftigen «Systems» sammelte, das alle internationale Beziehungen regulieren würde.
Wie einige andere europäische Staatsmänner war auch Czartoryski davon überzeugt, daß die überkommenen diplomatischen Spielregeln, nach denen immer wieder Paritäten angestrebt wurden, die sich ihrerseits auf instabile und schwer faßbare Machtbalancen stützten, ebenso unsinnig wie moralisch inakzeptabel seien. Im Gegenzug schlug er ein übernationales Sicherheitssystem vor, das aus Bündnissen kleinerer Staaten bestünde, die sich nach sprachlicher oder kultureller Nähe zusammenfänden. Ihnen wären Eroberungswünsche fremd, und sie würden auch nicht über den für Kriege notwendigen Zusammenhalt verfügen – es sei denn zur Selbstverteidigung. Alexander war von dieser Vision sehr angetan, die einen tief verwurzelten russischen Wunsch zu rechtfertigen schien, die Herrschaft über alle von Slawen bewohnten Lande auszudehnen.[4]
Weder Alexander noch seine Berater sahen Rußlands Bestimmung in einer Expansion nach Europa – sie blickten nach Konstantinopel und nach Osten. Aber durch seinen kometenhaften Aufstieg zur Großmacht in den letzten hundert Jahren war Rußland jetzt gezwungen, Europa zu beachten, und sei es nur aus Gründen der Selbstverteidigung. Die Mächte, die es im Auge behalten mußte, waren vor allem Großbritannien, dessen Überlegenheit zur See und östliche Herrschaftsgebiete als unbezweifelbare Herausforderung galten; Frankreich, dessen traditionell enge Beziehungen zur osmanischen Türkei und dessen Interesse an Ägypten und weiter östlich gelegenen Gebieten Anlaß zu Unbehagen gaben, und, weniger gewichtig, Österreich, dessen Besitzungen auf dem Balkan zumindest lästig waren. In den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts war Rußland in einen Krieg mit Frankreich hineingeraten, aber in diesem Konflikt hatte das Zarenreich keine starken Interessen, sieht man von der aussichtslosen Hoffnung ab, einen Marinestützpunkt im westlichen Mittelmeer errichten zu können.
Alexanders Sicht auf Napoleon war zwiespältig. Er kam nicht umhin, seine Begabung und Energie zu bewundern, und er neidete dem Ersten Konsul seine Leistungen als tatkräftiger und erfolgreicher moderner Staatsmann, der viele Ideale der Aufklärung verwirklicht hatte. Aber Napoleons willkürliche Grausamkeit entrüstete ihn, und seine Abneigung gegen den französischen Emporkömmling schlug in kalte Abscheu um, als dieser sich im Dezember 1804 zum Kaiser der Franzosen krönen ließ.
Im Oktober desselben Jahres, als Großbritannien und andere Mächte einen Krieg gegen Frankreich erwogen, hatte Alexander den Grafen Nikolaj Nowosilzow mit einem von Czartoryski ausgearbeiteten Vorschlag nach London entsandt, der seine Vision einer neuen europäischen Ordnung auf der Basis liberaler Grundsätze und «den heiligen Rechten der Menschlichkeit» enthielt. Wie nicht anders zu erwarten war, blieb der britische Premierminister William Pitt skeptisch, aber in seiner Antwort erschien er sehr interessiert. Er lobte Alexanders «weise, würdige und großzügige Politik» und hob aus dem Koalitionsvorschlag gegen Frankreich dreierlei als wichtigste Ziele hervor: Frankreich sollte seine Eroberungen zurückgeben und sich auf seine vorherigen Grenzen zurückziehen; diese restituierten Gebiete wären so zu sichern, daß sie nie wieder einer französischen Aggression zum Opfer fallen könnten; und, was das Wichtigste war, es sei «bei der Wiederherstellung des Friedens eine allgemeine Vereinbarung und Garantie zum gegenseitigen Schutz und zur gegenseitigen Sicherheit der verschiedenen Mächte zu erzielen, sowie die Wiedereinführung eines allgemeinen Systems des öffentlichen Rechts in Europa.»[5]
Es blieb bei der Vision, denn die Koalition, die dieses neue Zeitalter einläuten sollte, wurde auf den Schlachtfeldern von Austerlitz, Jena und Friedland zerrieben. Czartoryski wurde 1806 von Alexander, wenn auch widerwillig, entlassen. Aufgrund seiner wortkargen und reservierten Art hatte er bei Hof wenig Freunde und zog wegen seines Einflusses auf den Zaren die Feindseligkeit und den Neid vieler auf sich. Zudem war er Pole. 1792 hatte er in Verteidigung seines Vaterlands gegen Rußland gekämpft und war als Geisel, die das Wohlverhalten seiner Familie garantieren sollte, nach Sankt Petersburg gelangt.
Das Königreich Polen war 1775 auf der Grundlage einer Reihe von Abkommen zwischen Rußland, Preußen und Österreich von der Landkarte gefegt worden. Den Löwenanteil des Landes hatte sich Alexanders Großmutter, Katharina die Große, angeeignet; sie war auch die treibende Kraft gewesen. Im Einklang mit den meisten Aufklärern verurteilte Alexander diese Aufteilung eines der ältesten Staaten Europas und empfand daran auch eine gewisse persönliche Mitschuld. Diese Gefühle wurden durch seine Freundschaft mit Czartoryski noch verstärkt, dem er geschworen hatte, Polen seine Freiheit zurückzugeben, wenn er Zar werde. Als es soweit war, war er damit konfrontiert, daß er unmöglich etwas tun konnte, was angeblich wesentlichen russischen Interessen widersprach. Niemals aber gab er seinen Traum auf, dieses Versprechen eines Tages einzulösen. Dieses polnische Dilemma ist ein typisches Beispiel für Alexanders inneren Konflikt zwischen seinen persönlichen Idealen und der russischen Staatsraison, die auf den verschiedensten Ebenen kollidierten.
Wie viele polnische Patrioten war sich Czartoryski darüber im klaren, daß sein Land kurzfristig die Unabhängigkeit nicht zurückgewinnen könne. Im besten Fall konnte er auf eine Wiedervereinigung der auseinandergerissenen Teile hoffen. Ihm schwebte ein mehr oder weniger autonomes Polen als Provinz, vielleicht sogar Königreich, innerhalb des russischen Reiches vor, und diesem Reich diente er rückhaltlos. Dennoch konnte er nie das Mißtrauen des Hofes und der russischen Gesellschaft insgesamt zerstreuen, die in ihm nur einen potentiellen Feind sahen. Seine Lage wurde nicht leichter dadurch, daß er der Liebhaber von Alexanders Gemahlin Elisabeth gewesen war, die ein Kind von ihm bekommen hatte. Er war eine Belastung und mußte gehen.
Czartoryskis Sturz veränderte die außenpolitischen Ansichten des Zaren nicht. Anders als die patriotischen russischen Gegenspieler des entlassenen Ministers gehofft hatten, hielt er auch daran fest, was sie als beklagenswerte Besessenheit mit Polen ansahen.
Aber seine Haltung gegenüber Großbritannien änderte sich. Czartoryski hielt die Briten zwar für unzuverlässig und selbstsüchtig, aber auch für unverzichtbar als Verbündete im Kampf gegen Frankreich. Alexander indes hatte seine Zweifel. Besonders verärgerte ihn Großbritanniens Beharren auf der absoluten und ausschließlichen Qualität seiner angeblichen «Rechte zur See», nämlich jedes Schiff nach Belieben durchsuchen und die Weltmeere überwachen zu dürfen. 1805 hatte Alexander Großbritannien als notwendigen Verbündeten akzeptiert, fühlte sich aber 1806/07 schmerzlich von ihm im Stich gelassen, als es versäumte, ein Expeditionskorps in die Ostsee zu entsenden, und er Napoleon allein gegenüberstand.
Angesichts der Notwendigkeit, mit Napoleon zu verhandeln, schloß Alexander nicht nur Frieden: Er bot dem Kaiser der Franzosen auch eine Partnerschaft derselben Art an, wie er sie Pitt drei Jahre zuvor vorgeschlagen hatte. Er bildete sich ein, er könne dank der so entstehenden Allianz, die im Verlauf ihrer Verhandlungen bei Tilsit im Sommer 1807 besiegelt wurde, sein Reich erneuern und durch die Eingliederung Konstantinopels und anderer Teile des Nahen Ostens erweitern, und zugleich gemeinsam mit Napoleon eine aufgeklärte und segensreiche Schirmherrschaft über den Kontinent ausüben, den sie beide beherrschten.
Das Debakel von Austerlitz im Dezember 1805, wo Alexander gehofft hatte, als Held zu glänzen und statt dessen vom Schlachtfeld fliehen mußte, während seine Armee sich auflöste, und, ein gutes Jahr darauf, seine endgültige Niederlage bei Friedland, waren persönliche Demütigungen gewesen. Sie hatten auch seine politische Position geschwächt. Zwar liebte ihn sein Volk noch immer, es gab aber viele, die ihn für schwach hielten und bei denen seine Reformtendenzen Befürchtungen weckten. Sie betrachteten Minister wie Czartoryski und den reformfreudigen Speranskij als Überträger französischer/freimaurerischer/polnischer/jüdischer Einflüsse, die die Reinheit Rußlands besudelten, und Alexander sah sich gezwungen, sie zu entlassen und auch Programme aufzugeben, die ihm am Herzen lagen. Er war einer sich zunehmend artikulierenden öffentlichen Meinung ausgesetzt, die er nicht ignorieren durfte. Als Zar Rußlands regierte er zwar theoretisch als Selbstherrscher mit grenzenloser Macht, die Mehrheit der gebildeten Russen konzentrierte sich aber in der Armee, der Verwaltung und am Hof in Sankt Petersburg und Moskau. Nur durch sie konnte der Staat funktionieren, und ohne ihre willige Mitarbeit war der Autokrat buchstäblich machtlos.[6]
Auch wenn sich das Bündnis mit Napoleon für Alexander zwischen 1807 und 1812 als vielfach unbequem und demütigend erwies, ermöglichte es ihm, in Finnland einzudringen, es zu annektieren und sich darüber hinaus noch zusätzlich einige Streifen polnischen Bodens zu sichern. Er hoffte, sich noch weitere Gebiete aneignen und auf den Balkan vordringen zu können. Aber all das reichte nicht aus. Rußlands Selbstachtung verlangte von ihm eine unnachgiebigere, wenn nicht gar provokative Haltung gegenüber Frankreich. Dies hatte unaufhaltsam zu Napoleons schlechtberatener Invasion geführt, und als die russische Armee in den letzten Tagen des Jahres 1812 den geschlagenen Überresten der Grande Armée nachsetzte und dabei Rußland selbst verließ, war auch den naivsten Gemütern klar, daß sich die russische Herrschaft weiter in westliche Richtung ausdehnen würde. Das Großherzogtum Warschau bot sich für eine Besetzung an; so hätte Alexander die Möglichkeit gehabt, seine Bringschuld gegenüber den Polen einzulösen und ihr Königreich wiederherzustellen.
Aber die Wiederherstellung eines unabhängigen polnischen Staates hätte den Weg Rußlands zu weiteren territorialen Zugewinnen im Westen versperrt. Schlimmer noch, Rußland hätte dann wahrscheinlich polnische Provinzen zurückgeben müssen, die es in der Vergangenheit annektiert hatte. Für Alexander kam daher ein polnisches Königreich nur innerhalb des russischen Reichs in Frage, und mit ihm selbst als König. Dies könnte, wie er hoffte, die Befürchtungen der russischen Öffentlichkeit dämpfen. Aber weil sich damit auch die Grenzen seines Reichs weit nach Westen hin verschöben, bedeutete dies auch, daß er bei der Neuordnung Deutschlands ein Wort mitzusprechen hätte.
Deutschland war von der Französischen Revolution und den darauffolgenden Eingriffen Napoleons stärker in Mitleidenschaft gezogen als jeder andere Teil Europas. 1789 hatten die deutschen Länder zum Heiligen Römischen Reich gehört, einem unübersichtlichen Flickwerk aus etwa dreihundert unabhängigen, souveränen Staaten und Tausenden von weltlichen und geistlichen Herrschaftsgebieten, deren politische Formen von der absolutistischen Alleinherrschaft über das geistliche Regiment der Kirche bis hin zu republikanischen Stadtverfassungen alles umfaßte.
Diese chaotische Vielfalt war 1792 im Zuge des französischen Ausgreifens ins Rheinland bereinigt worden, und zwischen 1801 und 1809 unterwarf Napoleon ganz Deutschland einer gründlichen Neuordnung. Sein Ziel war es, Österreich zu verkleinern und zu isolieren, Preußen, das er gern im französischen Lager halten wollte, zu vergrößern und eine Reihe von weiteren Staaten wie Bayern, Baden und Württemberg auszubauen, deren aufgewertete Herrscher dann zu treuen Verbündeten würden. Aufgrund des Reichsdeputationshauptschlusses von 1803 waren jene, die durch den Anschluß der linksrheinischen Gebiete an Frankreich ihre Territorien verloren hatten, im rechtsrheinischen Rest des Reiches zu entschädigen, wo nun Schritt für Schritt im Zuge der Mediatisierung bisher souveräne Herrschaftseinheiten anderen und größeren zugeordnet wurden. Was an souveränen Gebilden übrigblieb, wurde 1806 im Rheinbund zusammengefaßt, zu dessen Beschützer Napoleon sich erklärte. Er hatte diesem Staatenbund zwar die Form gegeben, aber seine Macht über ihn beruhte darauf, daß er die Mitgliedsstaaten gegeneinander ausspielte und sie in einem Zustand der Abhängigkeit hielt. Zudem war keiner von ihnen ganz Herr im eigenen Haus, da Napoleon eine Reihe von «mediatisierten» Grafen und Rittern («Standesherren») innerhalb ihrer Herrschaftsgebiete belassen hatte, die nicht ihren neuen Herren, sondern ihm, Napoleon, unterstanden.
Gewinner all dieser Veränderungen waren nicht nur die Kurfürsten von Bayern, Württemberg und Sachsen, die zu Königen wurden, oder die anderen Regenten, die eine Standeserhöhung erfuhren, sondern auch die Kaufleute, die von archaischen und einengenden Vorschriften befreit wurden, die Handwerker, die sich vom Zunftzwang erlösten, die Juden, die dank eines Emanzipationsedikts ihre Ghettos verlassen durften und preußische Staatsbürger wurden, und zahllose andere. Verlierer waren die vielen hundert Herzöge, Fürsten, Pfalzgrafen, Bischöfe, Markgrafen, Burggrafen, Landgrafen, Äbte, Äbtissinnen, Großmeister und Reichsritter, die Territorien und Vorrechte verloren, ebenso wie die Freien Reichsstädte, deren Unabhängigkeit im Verlauf der Umgestaltung beseitigt wurde.
Unter den deutschen Staaten hatte Preußen am meisten gewonnen. Als es 1795 mit den Franzosen gegen die anderen deutschen Staaten zusammenging, erwarb es wertvolle Gebiete im Rheinland, die es später gegen ausgedehntere in Mitteldeutschland eintauschte. Für die Unterstützung Napoleons gegen Österreich holte es sich 1805 Hannover. Aber im Jahr darauf wechselte Preußen die Seite, und nachdem Napoleon es 1806 bei Jena und Auerstedt vernichtend geschlagen hatte, erwog er, den preußischen Staat vollständig abzuschaffen.
Das Königreich Preußen hatte erst seit 1701 bestanden, als sich der Kurfürst von Brandenburg eigenmächtig den Titel «König in Preußen» zulegte. 1750, mit der Eroberung Schlesiens, war sein Gebiet um mehr als fünfzig Prozent angewachsen; bis 1805 hatte es seine Größe ein weiteres Mal verdoppeln können und war zu einer Großmacht aufgestiegen. Aber es war erstaunlich zerbrechlich. Friedrich II., sein bedeutendster Herrscher, pflegte zu sagen, zum Wappen Preußens tauge nicht der schwarze Adler, sondern ein Affe, da sich Preußen einzig darin auszeichne, die Großmächte nachzuäffen. Im Verhältnis zu seiner Bevölkerung hatte es sechsmal so viele Soldaten wie Österreich, und der größte Teil seiner Ressourcen wurde von dieser riesigen Armee verschlungen, dem einzigen Fundament seiner Macht.[7]
Schließlich schaffte Napoleon Preußen nicht ab; er nahm ihm nur die meisten seiner polnischen Provinzen, die es in den letzten Jahrzehnten erworben hatte, und schuf aus ihnen unter dem Namen Großherzogtum Warschau einen französischen Satellitenstaat. Dadurch verminderte er die preußische Bevölkerungszahl von fast neun auf weniger als fünf Millionen. Was von Preußen übrigblieb, mußte französische Truppen beherbergen, deren Verwaltungsbeamte Geld und Futter erpreßten und jede Gelegenheit wahrnahmen, die Preußen zu erniedrigen, während sie ihr Land ausplünderten. Angesichts der allgemein bekannten Verachtung des Kaisers für die Preußen blieb die Existenz des Staates fraglich. Die preußische Armee war auf kümmerliche 42.000 Soldaten verringert worden, von denen im Jahr 1812 fast 30.000 an Napoleons Rußlandfeldzug teilnehmen mußten.
Die Gegenreaktionen setzten ein, nachdem der Schock über die Niederlage von 1806 abgeklungen war. Die in großer Zahl entlassenen preußischen Offiziere ergaben sich gemeinsam mit den patriotischen Intellektuellen ihrer mürrischen Abneigung gegen alles Französische. Viele Offiziere traten in den Dienst der Armeen Österreichs oder Rußlands, während die Patrioten von einem nationalen Wiederaufstieg und von Rache träumten und sich dabei vom Beispiel der guerilleros in Spanien inspirieren ließen.
Dichter wie Ernst Moritz Arndt, Heinrich von Kleist und Theodor Körner förderten diese Stimmung mit patriotischen Versen und nationalistischen «Katechismen»; Philosophen und Journalisten stritten darum, welche Regierungsform Deutschland in einer idealen Welt annehmen sollte. Junge Männer schlossen sich im Tugendbund zusammen, um zu diskutieren und sich auf das Kommende vorzubereiten; andere folgten dem «Turnvater» Friedrich Jahn und stählten ihre Körper für den bevorstehenden Krieg.
Eine Reihe hoher Offiziere diente der Sache auf handfestere Art. Gerhard Johann von Scharnhorst, Gebhard Leberecht von Blücher, Hermann von Boyen und August Neidhardt von Gneisenau widmeten sich dem Auf- und Umbau der Armee und bemühten sich, der Bevölkerung militärische Tugenden nahezubringen. Andere, zum Beispiel Wilhelm von Humboldt, kümmerten sich um das Bildungssystem oder bemühten sich darum, den Staat überhaupt zu reformieren. Besonders wichtig unter ihnen war ein Staatsdiener namens Heinrich Friedrich Karl vom Stein, der wie viele der übrigen Reformer gar kein richtiger Preuße war.
Stein war in Cappenberg bei Lünen in Westfalen als Freiherr und Reichsritter des Heiligen Römischen Reichs geboren worden. Nichts in seiner Herkunft oder seinem Stand prädestinierte ihn zum deutschen Patrioten. Nach dem Jurastudium an der Universität Göttingen trat er in preußische Dienste, zunächst beim Bergwerks- und Hüttendepartement im Generaldirektorium, wo er sich einen Namen als tatkräftiger Verwaltungsfachmann machte, der Straßen baute und Kanäle anlegte.
Der strenge deutsche Patriot Heinrich Friedrich Karl Freiherr vom und zum Stein, der auf die vollkommene Vernichtung Napoleons drängte, und dessen Reformen in Preußen die Grundlage für die spätere Einigung Deutschlands schufen. Porträt von Johann Christoph Rincklake, ca. 1804.
Stein war ein Mann von strenger Moral und festen Grundsätzen, der alle Exzesse mißbilligte, seien sie politisch, wie im Fall der Französischen Revolution, oder moralisch, wie im Fall sexueller Freizügigkeit, die er bei anderen beklagte. Allerdings zeigte er sich im politischen Handeln etwas flexibler.
Obwohl ihn die hinterhältige Art zutiefst erschütterte, mit der Preußen im Basler Frieden von 1795 neue Gebiete am Rhein erwarb, widmete er sich eifrig ihrer Einverleibung in den preußischen Staat. Was er immer auch an moralischen Skrupeln gehabt haben mag, sie traten hinter seinen alles beherrschenden Willen zurück, Ordnung in das ererbte mittelalterliche Durcheinander zu bringen und Deutschland als Ganzes zu einem rationalen und funktionsfähigen Staat umzubilden. Wie viele andere Patrioten überall in Deutschland war er zu der Einsicht gelangt, daß das Land und seine Kultur nur dann vor den Eingriffen Frankreichs oder anderer Mächte bewahrt werden könne, wenn man einen geeinten deutschen Staat schuf, der stark genug wäre, äußere Einflüsse zu verhindern und militärischer Aggression zu widerstehen.
Der Philosoph Johann Gottlieb Fichte verkündete, daß die Nation zugleich als geistige und physische Einheit existiere, in der sich etwas Höherwertiges verkörpere als die Bindung an irgendeinen Staat oder König; und es gab viele, besonders an den Universitäten, die sich die Entstehung einer deutschen Republik wünschten. So sehr Patrioten wie Stein, Gneisenau und Humboldt auch mit solchen Ansichten sympathisieren mochten, ihnen war klar, daß ein vereintes Deutschland nicht aus dem Nichts erschaffen werden könne. Darum dienten sie dem einen deutschen Staat, dem sie zutrauten, die anderen nach und nach zu absorbieren und so zum selben Ziel zu gelangen – Preußen.
1804 wurde Stein auf eine Führungsposition nach Berlin berufen. Er war entsetzt von der Korruption und Ineffizienz, die er dort vorfand, und verzweifelte schier über die Mittelmäßigkeit des Monarchen, dem er diente. Heftig mißbilligte er Friedrich Wilhelms Ausrichtung auf Frankreich im Jahr 1805 und seinen daraus folgenden Erwerb Hannovers. Gemeinsam mit anderen überredete er den zaudernden Friedrich Wilhelm, zur Koalition gegen Napoleon überzutreten, und als dies zur Katastrophe von Jena und Auerstedt führte, wurde er, unter einem Schwall von Verwünschungen seitens des Königs, im Januar 1807 entlassen.
Um so ärgerlicher war es für den unglückseligen Friedrich Wilhelm, als Napoleon, der Preußen klein, ohnmächtig und abhängig gemacht hatte, den König wenige Monate später anwies, Stein zum Staatsminister zu ernennen. Der Kaiser hatte zwar gehört, daß Stein ein guter Verwaltungsfachmann, aber nicht, daß er deutscher Patriot sei. Stein ergriff die Gelegenheit, die ihm seine neue Stellung bot, um sofort Maßnahmen einzuleiten, die Preußen von einer feudalen Monarchie in einen modernen Staat umgestalteten. Das Oktoberedikt von 1807 hob die Leibeigenschaft und die Untertänigkeit der Bauern auf. Ihm folgten Reformen in der Gemeindeverfassung und in der Staatsverwaltung, später auch Militärreformen. Knapp ein Jahr später offenbarte ein von der französischen Polizei abgefangener Brief das ganze Ausmaß des Steinschen Franzosenhasses, woraufhin ihn Napoleon entlassen, seine Güter konfiszieren und ihn selbst als vogelfrei erklären ließ. Der von einem Tag auf den anderen mittellos gewordene Stein nahm Zuflucht in Prag, das damals zu Österreich gehörte.
1812 rief Zar Alexander Stein nach Rußland. Die beiden hatten sich 1805 in Berlin kennengelernt und waren einander aufgrund ihrer hohen Ideale – und sicherlich auch ihrer Selbstgefälligkeit – sympathisch gewesen. Als die Grande Armée in Rußland einmarschierte und Zweifel über die Kompetenz Alexanders und seiner Generäle aufkamen, durchlebte der Zar gelegentliche Anflüge von Selbstzweifeln und angespannter Gefühlslagen. In dieser Situation war ihm Stein, der unerschütterlich an ihn glaubte und in ihm den Vorkämpfer des allgemeinen antifranzösischen Kampfes sah, eine unschätzbare und tröstliche Stütze. Entsprechend wuchs sein Einfluß auf den Zaren.
Stein regte bei Alexander die Einrichtung eines deutschen Komitees an, das überall in Deutschland eine prorussische Stimmung verbreiten sollte. Er übernahm den Vorsitz des Komitees und nutzte es als Instrument für seine eigenen Ziele. Am 18. September 1812, wenige Tage, nachdem Napoleon bei Borodino vor Moskau den letzten russischen Widerstand zerschmettert hatte, legte Stein eine Denkschrift vor, in der er seinen Plan zur Gründung eines vereinten deutschen Staates skizzierte. Er war überzeugt, daß Rußland am Ende die Oberhand behalten werde, und setzte sich dafür ein, daß Rußland nach seinem Sieg über Frankreich den Krieg nach Deutschland hineintragen und Europa von seinem Joch befreien solle.