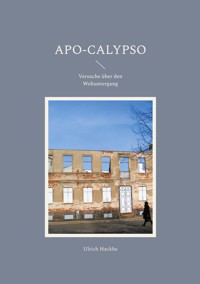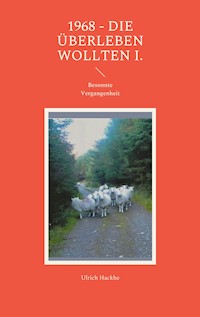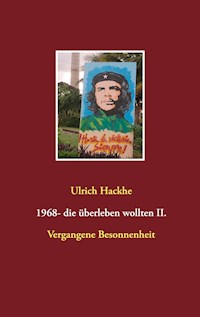
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte der Jahre 1968 bis zur Jahrtausendwende. Erwachsenwerden, ein sperriges Studium, ein holpriger Start in den Beruf, Projekte neuen Wohnens. Der Aufbruch von 1968 verleppert sich langsam am Strande einer neuen Bürgerlichkeit
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 697
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zu diesem Buch:
Der zweite Teil des Romans führt uns in die Zeit nach 1968. Arnald und seine Generation haben sich von den Zwängen der 50er und 60er Jahre frei gemacht. Das geistige Erbe des Nationalsozialismus scheint überwunden zu sein. Aber wird jetzt wirklich alles freier? Arnald und viele seiner Zeitgenossen aus dem ersten Band tauchen wieder auf. Aber wie haben sie sich, wie haben sich die Umstände gewandelt? Andere Begleiter Arnalds verschwinden im Dunkel der Geschichte. Und neue Protagonisten tauchen auf. Arnald lässt sich auf ein Studium der Rechtsgelehrsamkeit ein, mit mäßigem Erfolg. Das Verhältnis zu seinen Eltern wird immer schwieriger, weil sie ihren Sohn für einen Versager halten. Und haben sie etwa Recht, wenn sie meinen, dass Arnald ein Bummelant ist? Auch einige Frauengeschichten gehen ziemlich schief und enden in teils bizarren Katastrophen.
Am Ende des Romans geht Arnald dann auch noch in eine Kommune, aus der mit der Zeit eine stinknormale, bürgerliche Wohnungseigentümergemeinschaft wird. Der Geist der Rebellion hat sich wie eine Welle am Strand verlaufen. Die Revolution hat ihre Kinder verschlungen. Na, das ist vielleicht übertrieben! Aber die Kinder der Revolution sind erwachsen geworden, was auch nicht immer einfach ist.
Inhalt:
Teil III: Die Kiel-Krise
1968 – 1971
1.Im Reich der Sirenen
2. Bizarre Lebensformen im Reihenhaus
3. In geheimen Diensten
4. Der wahre Ernst des Lebens
Ab Mitte 1971 ..
5. Aus dem Tagebuch eines Taugenixen
6. Telemach macht weiter
7. Eine folgenschwere Reise
8. Im Reich der Simplegaden
1972
9. Je höher man steigt, desto tiefer fällt man
10. Der Untergang des Hauses Dagghe
11. Im Reich der Lotophagen
1973 .
12. Im Reich der Lästrigonen
13. Im Reich der Zyklopen
Teil IV. Die Berlin- Krise
1. Zwischen Scylla und Charybdis
1974
2.Som en edderkop som styrter sig i sine konsekvenser
3. Im Hades
4.In Spanien stand’s um unsere Sache schlecht
5. Vor dem Gesetz
1975
6. Im Reich des Äolus
7. Bei den Rindern des Sonnengottes
8. Die Faschismustheorie nach Umberto Eco
1978 – 2008
Teil V. Wir haben noch nicht genug gelitten
- Geschichte einer Kommune
-
1.
Vorgeschichte in Grønland
2.
Der Einzelne und sein Eigentum
3.
Viele gute Vorsätze
4.
Ein Kaufvertrag und (zu) viele Vollmachten
5.
Der dunkle Turm
6.
Die paar probleme
7.
Rauchende Colts
8.
Auf dem tickenden Vulcan
9.
Das Ende der Commune
10.
Is nix mehr as güstern no wör
11.
Die Welt des Glaubens
12.
Zu sensibel für die WEG
13.
Hasta la victoria siempre
14.
Abschlussschwanengesang
Gemeinhin wird behauptet, der Mensch sei ein geselliges Tier. Tatsächlich ist er ein Raubtier, was nicht nur ein kurzer Blick auf sein Gebiss beweist.(S.Å.Kierkegård)
(Alle im II. Buch handelnden oder auch nicht handelnden Personen, seien sie tot, mausetot, lebendig oder untot, sind frei erfunden. Eine Ähnlichkeit mit tatsächlich lebenden, toten oder untoten Personen wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt. Das gleiche gilt für die Orte der Handlung: Alles nur ausgedacht! Insbesondere die beiden Städte Kiel und Berlin.)
Teil III. Die Kiel-Krise
Spätsommer 1968
Wir befinden uns in einer anmutigen Gegend. Wo diese Gegend liegt, ist nicht ganz klar. Die Dämmerung setzt ein. Auf einem blumigen Rasen liegt eine ermüdete, unruhig schlafsuchende Gestalt: Arnald Dagghe. Die Geschehnisse des Jahres 1968, insbesondere das mit Ach und Krach bestandene Abitur haben ihn ermattet. Elfen umkreisen sein Haupt und versuchen, ihn in den Schlaf zu singen.
Unvoreingenommener Leser: Halt, das ist doch eine ganz andere Geschichte! Die von einem Sucher! Und Arnald sucht doch nach gar nichts, sondern ist froh, wenn man ihn nicht findet.
Arnald: Na, gut dann mag hier lieber eine Odyssee erzählt werden.
1969 – 1971
1. Im Reich der Sirenen
Im März 1969 feierte Arnald seinen 20.Geburtstag. Da war das Jahr 1968 auch schon vorbei, aber alles, was jetzt kommt, ist sozusagen der Nachhall dieses Schicksalsjahres. Kiesinger war zwar noch Kanzler. Aber viele alte Nazis hatten schon ihren Calabreser nehmen müssen und waren gegangen und auch des Edelnazikanzlers Tage waren schwer angezählt.
Arnald kann nicht sagen, dass vor 1968 in seinem Leben alles glatt gegangen war. Ganz und gar nicht! Aber kaum, dass er gedacht hatte, das Schlimmste sei mit dem Abitur überstanden, und er wisse jetzt, wo es lang geht, begann für ihn eine rechte Odyssee seines Daseins. Irrfahrer aller Länder vereinigt Euch!
Besonders undurchschaubar ist für Irrfahrer das Reich der Sirenen und Meerjungfrauen. Was diese Flossenwesen denn nun genau mit den Reisenden machen wollen, bleibt stets unklar. Auf jeden Fall versuchen sie, die Reisenden mit betörenden Gesängen und unhaltbaren Versprechungen anzulocken. Ob sie die Reisenden denn nun auffuttern oder sie nur auf die Klippen locken wollen, wo ihre Boote zerschellen und ihre Knochen dann in der flimmernden Salzluft unter der unbarmherzigen Sonne fremder, ferner Himmel bleichen, weiß man nicht so genau.
Zufällig traf Arnald vor einiger Zeit am Friedrichsorter Leuchtturm eine Seejungfrau. Sie hatte es sich während eines wirklich ungemütlichen Unwetters auf dem Sand gemütlich gemacht und kämmte ihre Locken.
Arnald: „Hallo Seejungfrau! Wie steht‘s, wie geht’s denn so?“
Seejungfrau: „Danke der gütigen Nachfrage. Aber ich bin ein wenig heiser. Immer im kalten Wasser schwimmen. Aber was soll man als Seejungfrau sonst schon groß machen. Jetzt kann ich auch nicht singen. Wegen der Probleme im Hals. Na wenn ich jetzt singen könnte, dann würde es dir aber an den Kragen gehen.“
Arnald: „In diesem Zusammenhang würde es mich mal interessieren, was ihr Seejungfrauen eigentlich mit euren Opfern macht. Reicht es euch, wenn sie am Ufer zerschellen oder futtert ihr sie auf. Oder macht ihr irgendwas mit perversem Sex mit ihnen. Man hört da ja so manches.“
Seejungfrau: „Betriebsgeheimnis!“
Es gibt natürlich auch nette Nixen wie die kleine Seejungfrau von Hans-Christian Andersen. Aber deren Schicksal ist natürlich wenig dazu angetan, als Vorbild zu dienen. Aus Liebe zugrunde gehen? Da kann man doch drauf verzichten!
Arnald hatte jetzt schon ein Semester freies Universitätsleben erleben dürfen. Ein erstes Semester Jura war vorbei. Zwar hatte Arnald noch keine Scheine gemacht und, wenn er ehrlich vor sich selbst war, auch noch gar nichts gelernt, jedenfalls nichts Rechtes. Aber alleine der Studentenstatus war schon etwas. Damals studierten noch nicht so viele Leute. Die Christian-Albrechts-Universität war die einzige Uni im Lande Schleswig-Holstein und hatte gerade einmal 6000 Studenten. Der Rektor der Universität sprach bei der Einführungsvorlesung für die Erstsemesterles aller Fakultäten mit ernsten Worten von den Herausforderungen der Massenuniversität. Da sei es für Lehrende und Lernende nicht immer ganz leicht, in der Masse nicht unterzugehen. Was der wohl zu den heutigen Hochschulen mit mehreren Zigtausend Studierenden sagen würde. Das wichtigste, um Student zu werden, war ein wenig Glück in der Schule und man sollte auch bei der Auswahl seiner Eltern vorsichtig vorgegangen sein. Nicht umsonst lautete eine Forderung linker Studenten: „Reiche Eltern für alle!“
Aber der elitäre Status des Gymnasialabiturienten war 1969 schon schwer in Gefahr. Neue Gymnasien wuchsen in allen Stadtteilen aus dem Boden wie die Pilze nach einem warmen Regen. Und über den zweiten Bildungsweg strömten jetzt auch noch Leute auf die Uni, die zuvor schon einen echten Beruf erlernt hatten. Denen hatten die Gymnasialabiturienten dann meist nichts oder nur sehr wenig entgegenzusetzen. Die waren nicht nur fleißiger und ehrgeiziger als die Pennäler vom klassischen Gymnasium. Die kannten sich auch schon im Leben aus. Und das Leben hatte sie Dinge gelehrt, von denen die Gymnasiasten nicht einmal etwas ahnten. Wer als Kind von seinen Studienräten klein gemacht und eingeschüchtert worden war, hatte keine guten Voraussetzungen für ein selbständiges Studium!
Aber auch wenn er im ersten Semester nicht viel mehr gelernt hatte, als gerade einmal hilflos im BGB zu blättern, so hatte Arnald sich doch wenigstens politisch heftig engagiert. Keine Demo ohne ihn. Das Zeitalter des Duckmäusertums war vorbei. Auch harte Demos mit Körpereinsatz gegen die Bullen gehörten dazu. Das hört sich jetzt dramatischer an, als es war. Steine flogen damals in Kiel nur selten, und wenn, dann nur kleine. Und auch nicht gegen Personen, sondern eher gegen Schilder oder Wände. Auch mal gegen eine Scheibe. Ehrlich gesagt wurde meistens nur gerangelt und eigentlich hat es sowohl den Demonstranten als auch den jungen Bullen eher Spaß gemacht, wenn man mit einander Nachlaufen spielte. Die Bereitschaftspolizisten aus Eutin waren ja auch meistens noch sehr jung und teilweise selbst von den Ideen der 68er angetan. Es gab da auch einen Arbeitskreis „Demokratische Polizisten“, bei dem die jungen Beamten verdächtig autoritäre Vorgesetzte als alte Nazis entlarven wollten. Und davon gab es in der Polizei auch weiß Gott genug.
Im Juni 1969 hatten die Studenten gegen einen Erlass des Kultusministers demonstriert, wobei jetzt egal ist, was er erlassen hatte. Kultusminister Hannemanns Erlasse waren alle bizarr und rückwärts gewandt. Hannemann war kein Nazi, seine geistige Heimat war das Kaiserreich, wahrscheinlich sogar das Erste, das Heilige Römische. So schlimm wird der Erlass wohl aber auch nicht gewesen sein, dass man sich so furchtbar darüber erregen musste. Aber es war ganz einfach nicht mehr das Zeitalter, in dem man gelassen bleiben wollte. Die Studentenschaft war daher auf das Höchste erregt und empört. Die Demonstranten zogen in drei mächtigen Marschsäulen mit tausenden von Teilnehmern zum Kultusministerium und riefen bedrohlich: „Kumi, wir kommen.“
Der reaktionäre Büttel des Systems wollte aber, obwohl eigentlich eher ein weich gespülter Scheißliberaler als ein reaktionärer Hardliner, die Studenten gar nicht hören oder sehen und schon gar nicht mit ihnen sprechen. „Ich meine es doch nur gut mit den jungen Leuten, aber sie müssen auch endlich mal lernen, widerspruchslos zu gehorchen“, war seine Maxime.
Das ganze Kultusministerium war an diesem warmen Sommertag mit Bandstacheldraht eingewickelt worden. Dummerweise war auch die einzige Getränkebude ebenfalls mit unüberwindlichen Barrikaden und Nato-Draht isoliert worden. Die jungen Vollzugsbeamten aus Eutin erkannten das Problem aber sofort. Die Demonstranten steckten ihnen Geld durch den Stacheldraht und die Polizisten brachten den Demonstranten die Getränke. Als es dann unerträglich heiß wurde, schaltete die Staatsmacht die Wasserwerfer auf leichte Berieselung ein, sodass man eine Dusche nehmen konnte. Viele Demonstranten legten die Oberbekleidung ab und legten sich in die Sonne. Einige legten auch die Unterbekleidung ab und badeten im etwas zweifelhaft dunklen Wasser an der Dampferanlegebrücke. Das Kultusministerium liegt nämlich direkt am Ufer der Förde. Man könnte also zusammenfassend sagen: Die Bürger und ihre Polizei haben sich gemeinsam einen netten Nachmittag an der Reventloubrücke gemacht.
Dazu der weinerliche, bigotte Kultusminister Hannemann1): „Ich konnte mein Büro bei Feierabend nicht verlassen. Meine Freiheit war bedroht. Die Demonstranten sind rot lackierte Nazis!“
Und der schneidige Ministerpräsident Helmut Lemke von Soltenizz, der schon vor 1933 und dann bis zum Zusammenbruch seines Systems ein fanatischer und nicht nur lackierter sondern ein richtig bis ins Mark tiefbrauner Nazi und besonders brutaler SA-Mann gewesen war, also ein ganz alter Kämpfer der NSDAP, geiferte: „Das sind alles bezahlte Ost-Agenten.“
Man konnte in jenen Jahren mit relativ einfachen und friedlichen Mitteln selbst topgefährlichen Alt-Nazis, denen ein Menschenleben sicherlich nicht allzu viel gegolten hatte, in Angst und Schrecken versetzen. Endlich zitterten auch mal die fiesen, alten, braunen Ratten, die den Jungen so lange so viel Angst eingejagt hatten. Viel mehr wollten die meisten aufmüpfigen Studenten meistens auch gar nicht, auch wenn immer wieder von Klassenkampf, struktureller Revolution, der Errichtung eines wissenschaftlich fundierten Sozialismusses und anderen sehr ernsthaften Dingen die Rede war.
Apropos: Wissenschaft! Dass er noch nichts Wissenschaftliches gelernt hatte, war nicht so schlimm und beunruhigte Arnald nicht übermäßig. Noch hatte er das Gefühl, dass das ganze volle Studium mit allen seinen Möglichkeiten einladend und wie ein offenes Buch vor ihm lag. Die riesengroße, alle Bereiche des menschlichen und - wenn man das Tierschutzgesetz mit einbezog - auch des tierischen Lebens - durchdringende Wissenschaft der Jurisprudenz mit ihren zahlreichen Verästelungen und Nebenfächern, die er alle erforschen wollte. Sachenrecht, Familienrecht, Altrömischen Pandektenrecht und was es da noch so alles gab. Und ein Fachidiot wollte er natürlich auch nicht sein: Sprachen lernen, die gesellschaftlichen und historischen Hintergründe durchleuchten in der Rechtssoziologie und der Rechtsphilosophie. Das war doch was! Arnald wünschte, recht gelehrt zu werden, wie es schon der Schüler bei Mephisto werden wollte. Dass Mephisto von der Rechtsgelehrsamkeit abrät, hätte natürlich schon zu denken geben müssen, denn der Universalgelehrte Goethe gab als Beruf immer „Jurist“ an und nicht Genie oder Universalgelehrter oder Dichterfürst. Der muss sich schon ausgekannt haben. Und wenn ein solches Jahrtausendgenie kein gutes Haar an Rechten und Gesetzen ließ, sie gar als ew’ge Krankheit bezeichnete, wäre das doch Warnung genug gewesen. Übrigens war ein anderes Jahrtausendgenie, nämlich Martin Luther, von der Ausbildung her Jurist und nicht etwa Theologe. Auch der hatte von der Rechtsgelehrsamkeit gelassen und war lieber Reformator geworden. Wen sollte man sich da zum Vorbild nehmen? Etwa die Eltern? Es war Zeit, eine erste Zwischenbilanz von 20 Jahren Leben zu ziehen. Was war geschehen? Wo stand Arnald? Eigentlich fühlte er sich schon als alter Mann. Welche Möglichkeiten gab es überhaupt noch?
Arnald lebte noch bei seinen Eltern in einer Art Symbiose aber meistens auch in großer Harmonie. Und was war mit seinen Eltern eigentlich los? Sein Vater war 59 Jahre alt, ein erfolgreicher Kieler Kleinunternehmer. Seine Druckerei hatte einen guten Ruf, und er hatte zahlreiche Preise für seine Kieler-Woche-Plakate gewonnen. Wahrscheinlich wäre er doch lieber bildender Künstler als Kleinunternehmer geworden. Arnald ging tatkräftig in der Druckerei mit zur Hand, und bekam gutes Geld dafür. Vor allem in der Buchbinderei, in der ein Meister und mehrere Gehilfen arbeiteten. Ob sein Vater es nicht vielleicht doch gut gefunden hätte, wenn er die Firma übernehmen würde? Aber ob Arnald dafür die Begabung gehabt hätte! Er war doch so unpraktisch: Zwei linke Hände und dann nur Daumen dran. Außerdem war es bereits Ende der 60er Jahre klar, dass derartige Kleinfirmen keine große Zukunft mehr hatten. Gerade im Druckereigewerbe wurde fusioniert, großinvestiert aber auch Konkurs angemeldet, was das Zeug hielt. Arnalds Vater hatte seinem Sohn zunächst einmal den guten Ratschlag mitgegeben: „Studiere mal was Anständiges, und dann sieht man weiter!“
Mit seiner Mutter, die schon früh ihre politische Karriere als Kultuspolitikerin der SPD an den Nagel gehängt hatte und nun auch noch als Berufsschullehrerin aus gesundheitlichen Gründen frühpensioniert worden war, sprach Arnald oft über die Aussichten, die ein junger Jurist in der Gesellschaft haben könnte. Die Mutter riet dazu, Jugendrichter zu werden:
„Da kannst du den jungen, über die gesellschaftlichen Verhältnisse gestrauchelten Menschen helfen.“ Die Mutter grübelte noch ein wenig und ergänzte: „Jugendrichter ist sicher das Beste, was man als Jurist werden kann. Aber das ist auch verdammt schwierig. Man muss viel Erfahrung mit dem Leben als solches haben, was man zwangsläufig eher als älterer Mensch hat. Und gleichzeitig muss man die jungen Menschen noch verstehen können, was als älterer Mensch dann wieder schwierig wird.“
Sie blickte kritisch auf ihren Sprössling, so als zweifelte sie an dessen Fähigkeiten und fuhr fort: „Oder du musst Völkerrechtler werden. Völkerrecht ist ganz wichtig. Das dient dem Weltfrieden. Oder Familienrechtler. Das ist ganz besonders wichtig. Da kannst du dann armen Frauen in deren Scheidungsverfahren gegen ihre herzlosen Männer beistehen.“ Mutter stutzte ein wenig: „Das ist dann vielleicht doch besser ein Beruf für Frauen. Die können sich besser in andere Frauen hineinversetzen.“
„So wie Frau Dr. Schibulka aus dem Lehmberg Nr. 63. Die vertritt nur Frauen in Scheidungsverfahren, hat Heiko Heitzmann erzählt", berichtete Arnald. „Die schreibt so harte Schriftsätze für ihre Mandantinnen, dass die Männer richtig Angst vor dem Postboten haben, weil der einen Brief von der Anwältin bringen könnte. Heiko hat auch erzählt, dass sich der Stadtinspektor Töpperwien aufgehängt hat, weil die Anwältin so hohe Unterhaltsforderungen für ihre Mandantin geltend gemacht hat, dass der Inspektor Töpperwien nicht nur nichts mehr selbst zum Leben gehabt hätte, sondern jeden Monat noch etwas hätte zusetzen müssen. Vielleicht könnte ich ja für scheidungswillige Männer das werden, was Frau Dr. Schibulka für die scheidungswilligen Frauen ist“.
Die Mutter war mit diesem Berufswunsch ihres Sprösslings nicht ganz einverstanden: „Ach für Männer gibt es genug Anwälte. Da ist dann die Konkurrenz unter den Anwälten auch groß und man verdient nichts. Und die Schibulka kocht auch nur mit Wasser. Die hat ein paar ehemalige Schülerinnen von mir bei der Scheidung vertreten. Überzogene Forderungen stellen und dann Verfahrensfehler machen, ist keine Kunst!“
Es war also klar, dass auch der Beruf des Scheidungsanwalts nicht so einfach war. Was hätte Arnalds Mutter wohl gedacht, wenn sie erfahren hätte, dass ihr Sohn nur acht Jahre später wirklich als Scheidungsanwalt gearbeitet hat. Und zwar in einer großen Praxis, in der tatsächlich überwiegend Frauen vertreten wurden, aber fast ausschließlich sehr wohlhabende Frauen, die durch die Scheidung noch reicher werden wollten.
„Wie bist du eigentlich auf Jura gekommen“, wollte seine Mutter, nun grundsätzlicher werdend, wissen. „Das passt doch gar nicht zu dir. Du bist doch mehr der verträumtwissenschaftliche Typ!“
Arnald stotterte ein bisschen herum: “Äh, äh! Eigentlich, weil mich Perry Mason in der amerikanischen Anwaltsserie so fasziniert hat. So wie der würde ich auch gerne werden.“
„Aber Perry Mason ist nur eine ausgedachte Figur in einer Fernsehserie. Den kann man sich doch nicht zum Vorbild nehmen. Weißt du eigentlich, dass Perry Mason auf Deutsch Peter Maurer heißt?“
„Doch, kann man wohl“, beharrte Arnald. „Hamlet ist auch nur eine ausgedachte Figur und trotzdem gibt es viele Menschen, die vor lauter Zweifeln nichts Vernünftiges gebacken kriegen.“
Aber in seinem Inneren wusste Arnald, dass die Geschichte vom Vorbild Perry Mason zumindest nicht die ganze Wahrheit war. Eigentlich studierte er Jura, weil er wie Hamlet an Entscheidungsschwäche litt. Jura ließ zunächst alle beruflichen Perspektiven offen.
2. Bizarre Lebensformen im Reihenhaus
Die Dagghes wohnten schon seit Sommer 1967 nicht mehr in der Innenstadt am Kleinen Kiel. Sie waren in ein Einfamilien-Reiheneigenheim in Mettenhof gezogen. Mettenhof war eine üble Großplattensiedlung um die herum man einen Cordon von Einfamilienhäusern gelegt hatte. Damals sah man aber gar nicht, wie übel das städtebauliche Konzept war, sondern freute sich über ein helles, modernes Häuschen mit Terrasse und gefliestem Badezimmer und im Fall der Dagghes sogar mit Blick ins Landschaftsschutzgebiet, wo es zierliche Rehe und auf den ersten Blick niedliche Häschen gab. Und Arnalds und seiner Eltern Ehrgeiz war groß, aus dem kleinen Grundstück mit dem verdichteten, lehmigen Baustellenuntergrund einen blühenden Garten zu machen. Ein wahrlich ehrgeiziges Unterfangen, aber man wächst ja mit seinen Aufgaben, auch wenn im Garten selbst nicht so viel wächst. Und dann gab es ein Hasenpoblem. Wann immer eine Pflanze sich traute, auch nur ein einziges kümmerliches, aber grünes Keimblatt aus dem steinharten Boden herauszustecken, kamen alle Häschen aus dem benachbarten Landschaftsschutzgebiet und mummelten alles, was nur halbwegs grünlich aussah, ratzekahl weg. Die Viecher fraßen wirklich, was das Zeug hielt. Sah süß aus, konnte einen Hobbygärtner aber bis an den Rand des Nervenzusammenbruchs treiben. Familie Heither aus dem Reihenhaussegment hinter den Dagghes rannte einmal vier Mann hoch hinter einer Rotte räuberischer Hasen her, bewarf sie mit Lehm und schrie den flüchtenden Nagern hinter her: „Ihr Schweine! Haut ab!“
Eigentlich eine lustige Geschichte. Aber das Schicksal der Familie Heither war trotz ihres Namens sehr tragisch. Als Vater, Mutter und zwei Söhne im Sommer 1967 in das Reiheneigenheim einzogen, war alles noch in Ordnung. Und man kauft so ein Eigenheim ja auch mit Blick auf eine längerfristige Zukunft. Aber schon kurz nach dem Einzug wurde Mutter Heither auf der Terrasse vom Schlag getroffen und war sofort tot. Vater Heither war Schiffskoch und für mehrerer Wochen auf großer Fahrt. Die Söhne, kaum älter als Arnald, fanden die Leiche ihrer Mutter, als sie von der Arbeit nach Hause kamen. Die Kripo und der Staatsanwalt untersuchten die Terrasse, das Reiheneigenheim und die nähere Umgebung einen halben Tag lang. Die Todesursache war aber eine natürliche. Herr Heither musste mit dem Flugzeug aus Afrika kommen, um überhaupt noch irgendetwas zu richten.
Kurz darauf ertrank der ältere Sohn der Heithers bei einer Segeltour auf dem nun wirklich eher harmlos wirkenden, nahe gelegenen Westensee; er war ausgerechnet aus dem Boot des Nachbarn Narjes gefallen, der ihn zu einem fröhlichen Tag auf dem Wasser eingeladen hatte. Narjes konnte nun die verheulten Gesichter von Vater Heither und dem jüngeren Sohn nicht mehr sehen und zog Knall auf Fall aus, obwohl auch der Staatsanwalt, der langsam zum Stammgast wurde, nach erheblichen und gründlichen Ermittlungen das Verfahren wegen fahrlässiger Tötung mangels Tatverdacht eingestellt hatte. Natürlich ist es töricht als Nichtschwimmer ohne Schwimmweste auf ein Segelschiff zu steigen. Aber wer denkt beim Westensee schon ans Kentern und Ertrinken?
Die letzten beiden Heithers – Vater und Sohn - blieben depressiv zurück, und Vater Heither verstarb verbittert und vereinsamt auch bald, und der überlebende Sohn verkaufte das Häuschen und zog in die Fremde. Arnald hat nie mehr etwas von ihm gehört.
Das ebenso plötzliche wie tragische Geschehen gab Arnald zu denken. Wie schnell es doch mit einer fröhlichen, gut situierten Familie zu Ende gehen konnte!
Grundsätzlich gilt für Reiheneigenheimler aber, dass man sich so wenig wie möglich um die Nachbarn und deren Probleme zu kümmern hat. Man bekommt unter Bewohnern dieser Scheibenhäuser sowieso sehr viel von den anderen mit, ob man will oder nicht. Da lebt man ziemlich kollektiv. Das heißt, dass man am besten durchkommt, wenn man sich selbst leise und unauffällig verhält, und seine Nächsten so weitgehend wie möglich freundlich, höflich und diszipliniert ignoriert. Nachbarschaftsstreitereien beschäftigen ohnehin schon im Übermaß die Gerichte. Aber gar zu furchtbare Schicksäler gehen einem schon nahe, wenn man kein Herz aus Stein hat.
Da die Dagghes in einem Reihenendheim wohnten, hatten sie nun zwar einen ganzen Satz weitläufiger Nachbarn, aber nur einen unmittelbaren Nachbarn. Diese direkten Nachbarn waren die Petersens, eine junge Lehrerfamilie. Herr Petersen war eigentlich nur wenige Jahre älter als Arnald, hatte aber schon Frau und Kind sowie ein eigenes Eigenheim und eine verantwortliche Stelle als Schulleiter der Paul-Paulsen-Schule in der Wik. Das hatte etwas Verheißungsvolles an sich. Wenn man nur schnell genug studierte, nur ein bisschen fleißig war, konnte einem das Leben schon so bald so viel bieten. Arnald überlegte, ob er nicht auch so schnell wie möglich die Pädagogische Hochschule absolvieren sollte. So ähnlich erklärte ihm Herr Petersen auch seine rasante Karriere. Er riet dem unsicheren Nachbarssohn, es genauso zu machen wie er:
„Nur ein paar Jahre nach dem Abitur, ein kurzes Studium und schon ist man ein gemachter Mann. Und wenn man keinen Ärger bei den Vorgesetzten macht, die Kolleginnen höflich behandelt und den Kindern halbwegs was beibringt, schafft man es als Mann auch schnell zum Schulleiter. Man hat ja fast nur Damen als Kollegen. Auch nicht schlecht! Da fühlt man sich gleich als Hahn im Korb. Und die Weiber werden natürlich immer dann schwanger, wenn Beförderungen anstehen. Da ist man dann eins-zwei-fix stellvertretender Schulleiter und mit Anfang dreißig kann man schon Rektor sein. Ich würde mich immer wieder dafür entscheiden, Grund- und Hauptschullehrer zu werden.“
Dabei blinzelte er Arnald vertraulich zu und machte mit Augenlied und Zeigefinger die berühmte Lucki-Lucki-Geste, die ja besagt, dass man nur schlau genug sein muss, um etwas zu erreichen. Vor allem bei der Karriereplanung. Das war schon einleuchtend, was der selbst noch junge, aber schon lebenserfahrene Nachbar da erzählte. Nach Arnalds eigenen Schulerfahrungen hatte er aber keine große Lust, Pauker zu werden. Außerdem wollte er seinen Eltern zeigen, was alles in ihm steckte. Diese Überlegung war vielleicht ein ganz großer Fehler gewesen. Denn schon nach einigen Jahren, als Arnald wirtschaftlich und ausbildungsmäßig wirklich ganz unten in den Sielen hing, jammerte er der verpassten Chance eines Studiums an der Pädagogischen Hochschule hinterher. Aber Kindern Sachen beizubringen, für die sie verständlicherweise kein Interesse haben, widerstrebte ihm doch gar zu sehr.
Es ist ja ein alter und nur allzu verständlicher Wunsch der Schüler, dass ihre Schule abbrennen möge. Der Brand der eigenen Schule ist, so könnte man sagen, ein fester Topos in der Bewusstseinswelt eines Schulkindes. Es gibt auch einen Schlager und einen Lustspielfilm mit dem Titel „Hurra, die Schule brennt!“ Arnald hatte sich auch immer gewünscht, dass seine Schule abbrennt. Seine Mutter hatte ihn aber wegen so törichter Wünsche getadelt:
„Wenn deine Schule abbrennt, dann habt ihr Schichtunterricht in der Elsa-Brandström-Schule. Und das ist noch blöder, weil ihr dann an manchen Tagen bis zum Abend in der Schule herumsitzen müsst. Möglicherweise sogar am Sonnabendnachmittag.“
In Mettenhof wurde der Wunsch aller Schüler wahr. Wie heißt es doch in alten Märchen: „Es geschah aber zu der Zeit, als das Wünschen noch mächtig war.“
Als Herr Petersen eines Tages nachmittags aus seiner Schule in der Wik nach Mettenhof zurückfuhr, sah er an der Ecke Hofholzallee, Skandinaviendamm, wie die Max-Tau-Grund- und Hauptschule in hellen Flammen stand. Die freiwillige Feuerwehr aus Achterwehr war schon mit einem Spritzenwagen und einem C-Rohr zugange. Das war aber nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Inzwischen kam auch die Berufsfeuerwehr aus Kiel, denn vom Kieler Zentrum bis nach Mettenhof ist es sehr, sehr weit. Die Feuerwehrleute versuchten zwar noch zu retten, was zu retten war. Jedoch konnte auch ein feuerwehrlicher Laie schnell erkennen, dass es da nichts mehr zu retten gab.
Herr Petersen wollte nun nett und hilfsbereit sein und rief seinen Kollegen, den Schulleiter der Max-Tau-Schule, an: „Herr Kollege, wissen Sie schon, dass ihre Schule gerade bis auf die Grundmauern abbrennt?“
Der Mettenhofer Schulleiter, der von nichts etwas mitbekommen hatte, war aber sofort wütend und brüllte ins Telefon: „Verdammte Bengels! Verarschen kann ich mich auch selber. Ich kriege schon noch raus, wer ihr seid, und dann gibt es ein Nachspiel, das sich gewaschen hat! Mit Nachsitzen, Strafarbeiten und allen Schikanen.“
Und für die Mettenhofer Schüler begann nun ein Reich der Freiheit. In ihre eigene Schule konnten sie nicht mehr gehen. Die war ja niedergebrannt, und was noch stand, war wegen Einsturzgefahr gesperrt. Und für Ausweich-Schichtunterricht kam allenfalls die Hasseldieksdammer Schule in Betracht, eben wegen der Stadtferne des Neubaugebietes. Ein Nachteil sowohl für Feuerwehreinsätze als auch für die Einführung von Schichtunterricht. Die Schule in Hasseldieksdamm war nämlich gerade geschlossen worden wegen Asbest, und die Hasseldieksdammer Schüler sollten eigentlich zum Schichtunterricht nach Mettenhof. Na, geschadet haben wird der monatelange Unterrichtsausfall niemandem, weder den Mettenhofern noch den Hasseldieksdammern. So viel lernt man ja gar nicht in der Schule außer Plutimikation und Redundanz.
Arnald, der bisher an dem kindlichen Glauben festgehalten hatte, dass sich früher oder später alles zum Guten wenden würde, musste nun lernen, dass dem nicht so war. Die Schicksalsfee hat oft keine Hemmungen, manche Zeitgenossen in tragische Situationen zu führen. Tragik im Sinne der griechischen Tragödie, also in die Ausweglosigkeit. So kam die Tragödie auch zum Oberstudienrat Lämpel, zuständig für alte und uralte Sprachen an der hoch angesehenen Kieler Gelehrtenschule, einem Humanistischen Gymnasium der ganz alten Klasse. Der lebte ebenfalls mit seiner Familie in der Reihe. Er hatte eine hübsche, nette Frau und drei wohlgeratene Kinder. Der Inbegriff einer heilen Familie. Und es gab auch noch einen ebenso pelzigen wie tapsigen Hund in der Familie.
Dann geriet Lämpel in den Focus des AUSS, des Aktionsbündnisses unabhängiger Sozialistischer Schüler. Irgendwie hatte der AUSS den Lämpel als Nazi entlarvt, und zwar sowohl als alten unverbesserlichen als auch als neuen Nazi. Noch Anfang 1945 hatte er sich freiwillig zur Waffen-SS gemeldet. Und jetzt hatte er im Unterricht und wohl auch auf einer Klassenfahrt offen rassistische Sprüche gekloppt, und zwar ausgerechnet gegen die Italiener. Wenn ein Studienrat für Latein ausgerechnet die Italiener als rassisch minderwertig bezeichnet, hinterlässt das allerdings selbst eingefleischte Rassisten in Ratlosigkeit.
Lämpel verteidigte sich dann eher ungeschickt und aggressiv gegen seine Widersacher. Statt sich für seine dummen Äußerungen mit Stress auf der Klassenfahrt zu entschuldigen und hinsichtlich seiner Nazi-Vergangenheit auf Jugend und Unerfahrenheit zu verweisen, riet er seinen Kritikern:
„Haut doch ab in die Ostzone! Beim Hitler ist auch nicht alles schlecht gewesen.“
Die Sache kam in die Nordschau und republikweit in die Presse, sogar in den Spiegel. Noch war es aber nicht zu spät. Durch rückhaltlose Distanzierung vom Nationalsozialismus hätte er noch irgendetwas zum Besseren wenden können. Aber es kam nichts! Kein Wort der Reue oder der Entschuldigung kam über seine Lippen! Er zog sich schmollend zurück. Reporter standen vor seinem Haus und wollten ihn interviewen. Zuerst ließ er sich verleugnen. Dann kam er doch heraus und beschimpfte die Journalisten als Links- und Lügenpresse.
Plötzlich war Herr Lämpel tot. Herzinfarkt hieß es offiziell. Arnald tippte aber auch auf die Möglichkeit eines Suizids. Kurz drauf starb auch Mutter Lämpel, es blieb unklar woran: Gram, Suizid oder eine tragische Doppelung des Geschickes? Die Kinder konnten dank einer geschickten Lebensversicherungstaktik des Vaters in der Reihenhausscheibe wohnen bleiben, standen aber jetzt natürlich sowohl unter Vormundschaft als auch unter Schock. Obwohl er selbst ein unverbesserlicher Faschist war, so ist er Lämpel gleichzeitig doch auch noch ein Opfer der faschistischen, deutschen Vergangenheit geworden. Viele Nazis waren nicht in der Lage gewesen, sich aus der auch für sie ungesunden und manchmal tödlichen Droge der Nazivergangenheit geistig zu lösen. Bis 1968 konnten sie damit irgendwie durchkommen. Nach 1968 konnten sie aber nicht mehr ohne weiteres mit Pardon rechnen.
Im vordersten Haus der Scheibenhausreihe wohnte ein jüngeres etwas flippiges Pärchen, Leute also, mit denen Arnald am ehesten gesellschaftlichen Kontakt hätte pflegen können, was er aber bis auf ein paar launige Bemerkungen im Vorgarten nie machte. So sehr die Dagghes sich freuten, dass sie aus der engen Wohnung in der Bergstraße nun in ein eigenes Haus umgezogen waren, so sehr fühlten Arnald und seine Eltern sich aus ihrer bisherigen Heimat im pulsierenden Zentrum der Großstadt herausgebrochen und taten sich schwer, in der neuen Umgebung heimisch zu werden, auch in sozialer Hinsicht. Die beiden jungen Leute in der vordersten Reihe nannten sich Donald und Daisy. Donald war bildender Künstler und leider dem Alkohol verfallen und war dann auch bald tot. Und Daisy verkaufte das Haus daraufhin und zog fort. Wenigstens kam das Häuschen nicht unter den Hammer, weil Donalds wohlhabender Vater das Reiheneigenheim bar bezahlt und seinem Sohn und seiner Schwiegertochter geschenkt hatte. Was gab es doch für großzügige Eltern!
Zwei Scheiben weiter in der Reihe war zeitgleich mit den Dagghes der Großkaufmann Reginald Reinemann eingezogen. Der war immer braun gebrannt und fuhr im offenen Sportwagen umher. Er trug Goldkettchen und eine Rolex. Seine Gattin sah aus wie Barbie. Bei den Nachbarn hatte er sich gleich unbeliebt gemacht, weil er den langen schmalen handtuchartig geformten Hintergarten des Reihenhauses von einem Landschaftsgärtner aufwändig als Steingarten umgestalten und durch Buxbaumhecken zu den Nachbarn hin abgrenzen ließ. Seine indignierten Nachbarn nannten den Garten jetzt „Reinemanns Grabmal“. Kurz nach dieser gärtnerischen Großtat klingelten Detektive bei den Dagghes und wollten wissen: „Haben Sie den Eindruck, dass der Großkaufmann Reinemann über seine Verhältnisse lebt?“
Arnald und seine Mutter reagierten natürlich wie die Leuchttürme des Datenschutzes, eines damals noch überhaupt nicht problematisierten Rechtsgebietes. Nein sie wüssten nichts über Herrn Reinemann, und wenn sie etwas wüssten, würden sie es nicht weiter erzählen. Die Detektive entfernten sich, und man sah noch wie sie im Häuschen von Mutter Lorden verschwanden. Mutter Lorden war die direkte Nachbarin der Reinemanns, und sie hatte offensichtlich sehr viel zu erzählen, was auch immer, aber wahrscheinlich nichts Gutes.
Bald darauf verschwanden die Reinemanns aus der Siedlung. Frau Barbie wurde noch mehrfach in der Öffentlichkeit beobachtet, wie sie herzzerreißend weinte. Arnald schloss daraus, dass das Häuschen der Reinemanns unter den Hammer gekommen war, wie man eine Zwangsversteigerung im Volksmund so nett umschreibt.
Mit der mitteilsamen Mutter Lorden, der Nachbarin der Reinemanns nahm es auch bald ein böses Ende. Sie war bis zu ihrer Berentung Schulsekretärin an der Hebbelschule gewesen. Sie hatte insgesamt eine hexenartige Anmutung, wie auch das Fräulein Scholzke, die Schulsekretärin der Humboldtschule, mit der Mutter Lorden in der Tat auch gut befreundet war. Sie wohnte zusammen mit ihrem Neffen Karl-Heinz, den sie fürchterlich kujonierte, der aber auch keine geistige Leuchte vor dem Herrn zu sein schien. Gut-aussehend und stattlich war er auch nicht. Ob Karl-Heinz überhaupt Eltern hatte, war unklar. Wahrscheinlich hatte Mutter Lorden den Knaben in Pflege genommen, damit etwas Anständiges aus ihm würde. Aber plötzlich erkrankte Frau Lorden schwer und kam ins Krankenhaus. Erstaunlich, wie viele Menschen in der neuen Nachbarschaft der Dagghes ernstlich erkrankten oder völlig unerwartet starben. Vielleicht lag das aber auch nur dran, dass Arnald jetzt erwachsen wurde und er derlei Geschehnisse überhaupt wahrnahm.
Zu jenem Zeitpunkt begann Arnalds Mutter immer antriebsärmer zu werden. Warum auch immer? Aber dennoch stellte sie ein Besuchskörbchen zusammen, um der erkrankten Nachbarin einen Genesungswunsch ins Krankenhaus zu bringen und ihr Mut zuzusprechen. In dem Körbchen befanden sich eine Schachtel Pralinen, ein Piccolo, ein Liebesroman und ein Patiencespiel. Der Besuch wurde aber immer weiter aufgeschoben, und Mutter Lorden starb schließlich. Noch ein Jahr nach der Beerdigung der Nachbarin hing am Schwarzen Brett in der Küche der Dagghes ein Zettel auf dem stand: „Mutter Lorden – Station 3, Zimmer 15, Besuchszeit Fragezeichen.“ Ein drängendes Mahnmal gegen die Folgen der Prokrastination.
Auch die Teilnahme an der Beerdigung ging völlig schief. Arnalds Mutter verkündete zunächst voller Tatkraft ihrem Sohn: „Montag um zwölf ist die Beerdigung von Mutter Lorden. Auch wenn ich es nicht geschafft habe, sie noch einmal im Krankenhaus zu besuchen, müssen wir ihr jetzt wenigstens die letzte Ehre erweisen. Wir fahren zusammen zum Friedhof und nehmen an der Beerdigung teil. Viele Leute werden sowieso nicht kommen.“
Vater Dagghe konnte natürlich nicht zur Beerdigung, weil er ja arbeiten musste. Die Druckerei Kunst-und Werbedruck durfte möglichst keine Stunde alleine bleiben. Nachbar Petersen entschuldigte sich: „Ich kann euch leider nicht im Auto mitnehmen, weil ich direkt von der Schule zum Friedhof fahre. Aber die Linie „3“ hält ja gleich vor dem Friedhofstor.“
Aber obwohl die Trauerfeier erst um zwölf Uhr anfangen sollte, vertrödelten sich Arnald und seine Mutter. Außerdem mussten sie am Wilhelmsplatz in die Linie „3“ zum Eichhof, wo sich der gleichnamige Friedhof befindet, umsteigen. Und die „3“ war mal wieder heftig verspätet. Mit fliegenden Rockschößen stürzten sie einige Minuten nach zwölf in die Kapelle. Die Trauerfeier begann bereits. Erstaunlich: Die Kapelle quoll von festlich gekleideten Menschen über. Nachbarn aus Mettenhof waren jedoch nicht zu sehen. Auch der Neffe Karl-Heinz schien zu fehlen, und von Fräulein Scholzke, der Freundin der Verstorbenen, gab es auch keine Spur. Dafür saß in der ersten Reihe eine schöne, schwarz gewandete Frau, die allenfalls vierzig Jahre alt war, die sich die Augen ausweinte. Neben ihr drei hübsche Kinder zwischen sechs und fünfzehn Jahren, ebenfalls in Schwarz, die hemmungslos heulten.
Die Trauerfeier nahm ihren Gang. Die Orgel spielte. Dann wurde ein Lied gesungen. Arnald und seine Mutter versuchten trotz ihrer Unmusikalität fleißig mit zu singen. Das war man der verstorbenen Nachbarin schon schuldig. Dann setzte ein Trauerredner an: „Es ist bitter, wenn ein Mensch lange vor seiner Zeit mitten aus seinem aktiven Leben gerissen wird.“
Mutter Dagghe zischte ihrem Sohn zu: „Na, das passt nun aber gar nicht. Mutter Lorden war ja schon weit über achtzig und seit Ewigkeiten Rentnerin!“
Dann ging die Rede weiter: „Ein liebender Ehemann, ein treusorgender Vater ist von uns und vor allem seiner Gattin und seinen Kindern……“
Elfriede Dagghe ging jetzt ein Licht auf: „Ich glaube, wir sind auf der falschen Beerdigung. Aber einfach rauslaufen können wir jetzt auch nicht. Das wäre pietätlos.“
Also blieben Arnald und seine Mutter bis zum Ende der Trauerfeier. Am Schluss sagte der Onkel des Verstorbenen, den Mutter Dagghe inzwischen als den schwedischen Honorarkonsul Schrotthoff identifiziert hatte: „Ich danke Ihnen allen, dass Sie so zahlreich erschienen sind, um meinem so jung unter tragischen Umständen verstorbenen Neffen das letzte Geleit gegeben zu haben. Ich darf daher alle noch zu einem kleinen Imbiss und einem Umtrunk ins Ballhaus Eichhof einladen.“
Arnalds Mutter meinte nun: „Irgendetwas ist schief gegangen. Ich weiß aber nicht was. Da müssen wir jetzt konsequent durch. Wir gehen mit ins Lokal.“
Während des geselligen Zusammenseins unterhielt sich Arnalds Mutter ausführlich mit der jungen Witwe, versuchte sie zu trösten und gab ihr auch noch einige Tipps zum Thema Witwen- und Waisenrente. Am Schluss umarmte die Witwe die ihr eigentlich völlig unbekannte Elfriede Dagghe. Auch Arnald unterhielt sich längere Zeit mit einem Vetter des Verstorbenen, der eine Agentur des dänischen Reiseveranstalters Tjæreborg betrieb. Am Schluss bot er Arnald nicht nur das Du, sondern auch einen Ferienjob an.
Als Arnald und seine Mutter am frühen Abend leicht angeschickert nach Mettenhof zurückkehrten, kam ihnen der Nachbar Petersen entgegen, und meinte: „Wir haben Sie heute Mittag auf dem Südfriedhof vermisst. Da war doch die Beerdigung von Frau Lorden.“
Jetzt begriff Arnald, was passiert war. Der Nordast der Linie „3“ endete zwar vor dem Friedhof am Eichhof, der Südast der Linie in Richtung Hassee kam aber am Südfriedhof vorbei, wo sich auch die Haltestelle mit dem treffenden Namen Südfriedhof in der Kirchhofallee befand. Da kann man dann auch schon mal durcheinander kommen. Selbst als gebürtiger Kieler.
Karl-Heinz schien aber nach dem Ableben seiner Pflegeperson aufzuleben, heiratete eine junge, gut aussehende, anspruchsvolle Dame und lebte schnell über seine Verhältnisse, bis das Häuschen dann unter den Hammer kam.
Das Schicksal der Coblentzers war dagegen eher harmlos und bizarr, entbehrte auch nicht einer gewissen Komik, obwohl Frau Coblentzer sich so aufführte, als stünde der Weltuntergang bevor. Die gewerkschaftseigene Neue Heimat als Bauträgerin hatte den Häuslekäufern zugesagt, dass alle Käufer am 1.Februar 1967 ins schlüsselfertige Heim würden einziehen können. Arnalds Eltern hatten das sowieso nicht geglaubt, und ihre alte Wohnung erst zum 30.Juni gekündigt. Coblentzers hatten, um sich die teure Doppelbelastung für Mietwohnung und Häuschen zu sparen, punktgenau ihre begehrte Altbauwohnung am noblen Ravensberg gekündigt. Der Vermieter und die Nachmieter verlangten herrisch die Herausgabe der Mietwohnung. Der Bauleiter in Mettenhof hatte aber ein Einsehen mit den jetzt wohnungslosen Kaufinteressenten, und richtete den Keller des Häuschens provisorisch her, so dass Coblentzers wenigstens im Keller hausen konnten. In den Garten wurde ein Bauklo gestellt. Frau Coblentzer weinte herzzerreißend: „Das ist ja schlimmer als auf der Flucht im Februar 1945!“
Arnals Mutter reagierte ein wenig ungehalten auf diese Bemerkung: „Nun haben Sie sich nicht so. Sie haben einen beheizten Keller und ein Bauklo. Damit wären wir 1945 ganz schön glücklich gewesen.“
Unter den Reihenhäuslern gab es aber immer so etwas wie eine Grundsolidarität. Als Herr Coblentzer, der bei Karstadt Abteilungsleiter war, dann auch noch in seinem Betrieb gemobbt wurde - der Begriff war damals ganz neu, der Vorgang des Mobbings im Betrieb ist aber schon alt - bekam er viel Zuspruch von den Nachbarn. Die wollten Karstadt jetzt boykottieren, was aber in Kiel schwierig war, weil es das einzige nennenswerte Kaufhaus in der Landeshauptstadt war.
Das Leben im Reihenhaus hatte also durchaus kollektivistischen Charme. Aber viele Reihenhäusler hatten erhebliche persönliche, vor allem finanzielle Probleme. So eine Finanzierung war ja auch nicht so leicht zu bewältigen, und damals verstand ernsthafterweise auch niemand so richtig, wie Finanzierung ging. Dabei waren Arnalds Eltern eigentlich Fachleute. Seine Mutter war eine der ersten weiblichen Betriebswirte Deutschlands und sein Vater Kleinunternehmer, der ohnehin ständig im Clinch mit den Banken lag. Und obwohl Arnalds Mutter immer wieder vorrechnete, dass die Familie sich übernommen hätte und früher oder später im Armenhaus oder auf der Straße landen würde, konnten Arnalds Eltern die Finanzierung leicht stemmen. Verglichen mit vielen anderen Bewohnern der Siedlung und deren oft schwierigen Schicksälern und Finanzierungsengpässen schien es so zu sein, dass Arnald und seine Eltern als Reihenhäusler nahezu unverwüstlich waren. Wirtschaftlich und menschlich ging es ihnen gut. Noch! Denn die Schicksalsfee hatte auch mit den Dagghes noch einiges an Üblem vor. Soweit zum Thema Reiheneigenheim. Nun zu einem anderen Thema! Der Deutschen Spaltung und ihren Folgen.
3. In geheimen Diensten
Arnalds erste Reise in die DDR im Herbst 1968 mit dem Genossen Pepe Krusius, dem Kreisvorsitzenden der Kieler Jusos verlief merkwürdig genug. Das Verhältnis der BRD zur Ostzone war gerade ganz besonders eiskalt, nachdem Truppen des Warschauer Paktes den Prager Frühling niedergeschlagen hatten. Pepe vertrat aber die selbst bei linken Jusos umstrittene Auffassung: „Gerade in Zeiten besonders schlimmer Spannungen muss man im Gespräch bleiben. Die Alternativen wären ja Boykott oder Krieg.“ Außerdem behaupteten die Jusos von sich auch noch: „Wir sind die SPD der 80er Jahre!“ Und natürlich war es umgekehrt klar, dass die FDJ die SED der 80er Jahre sein würde. Also immer ran ans Gespräch mit den Genossen von der FDJ! Vorwärts in eine friedliche Zukunft der Koexistenz!
Nach Überquerung der Grenze bei Schlutup sollten Pepe und Arnald zügig zum Café Sybille in Grevesmühlen fahren, ausgerechnet jene Gaststätte, aus der Arnalds Vater seinen Sohn Sieghelm nach dessen missglückter Flucht in die DDR abgeholt hatte.2) Dort würde man weitere Informationen erhalten, wo und bei wem man sich in der DDR melden sollte. Am Kuchentresen des Cafés sei ein versiegelter Brief hinterlegt. Der würde gegen Nennung des Kennwortes ausgehändigt werden.
Dort im Café Sybille trafen Pepe und Arnald dann auch noch Uwe Barschel, der damals noch keineswegs doppelpromovierter Ministerpräsident war, sondern gerade sein Erstes Juristisches Staatsexamen in Kiel abgelegt hatte. Immerhin war er aber der Landesvorsitzende der Jungen Union. Der saß da an einem Tisch mit einigen Männern, die – sagen wir es einmal vorsichtig – recht entschlossen drein schauten. Pepe Krusius, der als Kreisvorsitzender der Kieler SPD in etwa in der gleichen politischen Liga wie Barschel spielte, ging lachend an den Tisch vom Barschel, schlug ihm auf die Schulter und meinte: „Na, der Genosse Barschel mal wieder an vorderster Front im Kampf gegen das Reich des Bösen!“
Barschel war es offensichtlich gar nicht recht, dass man ihn hier getroffen und erkannt hatte und grummelte: „Und der Genosse Krusius ist auch hier! Nie um einen blöden Spruch verlegen.“
Ganz schön befremdlich, das Ganze! Und wieso war der Barschel eigentlich ein Genosse, wo er doch in der CDU war? Arnald und Pepe machten sich auf den Weg zu der ihnen angegebenen Adresse. Nur doof, dass Pepe die Stadt Neustrelitz mit dem nördlicher gelegenen Neubrandenburg verwechselte, und er und Arnald nun im schon herbstlich düsteren Neustrelitz nach einer Adresse suchten, die es dort nicht gab. Plötzlich löste sich aus dem Dunkel eine Gestalt und richtete das Wort an die beiden: „Sie sind in der falschen Stadt. Der Genosse Gruneberg erwartet Sie in Neubrandenburg!“
Die Mitternacht zog näher schon, als die beiden Kieler Jusos schließlich in Neubrandenburg ankamen. Die Gespräche mit den FDJ-Genossen fanden dann in sehr freundschaftlicher Atmosphäre statt, wobei Alkohol wohl auch eine gewisse Rolle spielte. Ob die Gespräche politisch etwas gebracht haben, ist jedoch auch aus heutiger Sicht nur schwer zu beurteilen. Einen Versuch war es aber auf jeden Fall wert gewesen.
Das mit der DDR war schon ein wenig unheimlich, aber es ging den Jusos wirklich nur um ein bisschen Frieden in Zeiten des Kalten Krieges. Und was der Genosse Barschel damals, dort im Café Sybille mit den düsteren Herren, die offensichtlich beim MfS tätig waren, im Sinne hatte, konnte man nicht einmal erahnen. Zur Aufklärung des geheimnisvollen Todes des Uwe Barschel kann Arnald daher auch nichts beitragen. Und wenn er es könnte, würde er wahrscheinlich lieber die Schnauze halten. Badewannen gibt es ja überall.
Vielleicht wusste der Genosse Krusius mehr, aber der ist vor einigen Jahren unter nicht ganz geklärten Umständen verstorben. Man hat ihn tot in seiner Wohnung in der Helsinkistraße in Mettenhof aufgefunden. Pepes Wohnung war ohnehin ein wenig unheimlich. Er hatte die ganze Wohnung mit Fischereiwerkzeugen, Netzen und Bojen aus dem Nachlass seines Großvaters, eines Eckernförder Fischers, dekoriert, wodurch die Räume, obwohl im vierten Stock gelegen, stets einen etwas düsteren und unheimlichen Eindruck machten. Das Unheimlichste an dieser ansonsten völlig normalen Neubauwohnung war ein Raum, der extra mit einer Stahltür voller Spezialschlösser von der übrigen Wohnung abgetrennt war.
„Wegen der vielen Einbrüche“, stotterte Pepe, als Arnald ihn auf dieses bunkerartige Verlies ansprach. Dabei wurde er aber rot wie eine Tomate. Und etwas beklommen fühlte Arnald sich schon, als er wenig später hörte, dass Pepe tot war. Denn einige Monate vorher hatte er ihn noch als einen kerngesunden, kräftigen und schlanken Mann Anfang 60 erlebt. So jemand ist ja nicht plötzlich tot, wenn er nicht überfahren wird. Doch zurück in die späten 60er Jahre und jetzt zum Thema „Geheimdienste und Spionage“:
Im Vorfrühling 1969 war Arnald als Vertreter der Kieler Jusos zum Fest der Jugend und der Sportler anlässlich der Leipziger Frühjahrsmesse nach Leipzig gefahren. Das war nicht nur in Bonn bei der CDU, das war auch in Kiel bei der SPD nicht unumstritten. Mit den Spaltern durfte man sich eigentlich nicht einlassen, sagten maßgebliche Köpfe der SPD. Andererseits galt aber auch immer der Grundsatz bei der linken SPD, dass man die Kontakte nach Osten nicht abreißen lassen dürfe, auch wenn man sich nicht liebt.
Man hatte an Korea gesehen, was passiert, wenn man nicht mehr mit einander redet. Dort hatte es drei Jahre lang Krieg zwischen den beiden Landesteilen gegeben. Am Ende waren vier Millionen Menschen tot, und das ganze Land war verwüstet worden. Und jetzt waren sämtliche Verbindungen zwischen den Menschen in Nord und Süd gekappt worden. Und im geteilten Vietnam herrschte sowieso schon seit 28 Jahren ununterbrochen Krieg. So etwas durfte es in Deutschland auf keinen Fall geben! Und so etwas wollten auch die meisten DDR-Funktionäre nicht, auch wenn es auf beiden Seiten Hardliner gab, die am liebsten jeden Kontakt zwischen den Bewohnern der DDR und der BRD unterbunden hätten.
Es war der 5. März 1969. In Berlin fand die Wahl zum Bundespräsidenten statt. Das war in zweifacher Sicht aufregend. Gustav Heinemann von der SPD kandidierte gegen Gerhard Schröder von der CDU, der Partei, die herrisch die ewige Alleinherrschaft über den westdeutschen Staat einforderte. Doch, der hieß wirklich Gerhard Schröder, und war ein stockreaktionärer Lawand-Order-Mann. Natürlich war er wie so viele CDU- und FDP-Politiker auch Mitglied der NSDAP und der SA gewesen. Für Schröder sprach allerdings, dass er 1941 aus der NSDAP ausgetreten war. Seine Gattin war nach den Rassevorschriften seines späteren CDU-Parteifreundes Globke nicht arisch genug. Heinemann hingegen war schon bei den Nazis wirklich widerständig gewesen, hatte sich gegen die Wiederaufrüstung der BRD stark gemacht, und Bürgerrechtler gegen die Justiz des Adenauerstaates vertreten, zum Beispiel den Spiegel gegen Franz-Josef Strauß. Wenn Heinemann es schaffte, Bundespräsident zu werden, wäre das schon ein kleiner Machtwechsel in den verkrusteten Strukturen des westdeutschen Restaurationsstaates gewesen! Und dann war der Tag auch aufregend, weil die Sowjets gegen die Wahl des Bundespräsidenten in Berlin-West protestierten, einerlei wer da nun kandidierte. Nach sowjetischer Auffassung hatte die Bundesversammlung in Berlin gar nichts zu suchen. Und nun dröhnten die MIGs über der westlichen Halbstadt auf Patrouillenflug.
Schon gleich hinter der Grenze, noch vor Bad Kleinen kamen zwei höherrangige NVA-Offiziere in Arnalds Abteil, in dem er ganz alleine saß. Der Interzonenzug war kaum besetzt. Die Offiziere zogen die Vorhänge zu. Ach du Schande! Es stimmte also doch, was man über die DDR erzählte. Arnald sollte verhaftet, gefoltert und nach Sibirien verbracht werden…. Nein – doch nicht: Die Herren blieben ganz freundlich und wollten wissen, ob Arnald Truppenbewegungen von NATO-Truppen beobachtet hätte, vor allem im Raum Ratzeburg. Er verneinte wahrheitsgemäß, und die Herren verabschiedeten sich höflich.
In der Messestadt Leipzig herrschte ein unbeschreiblicher Auftrieb. Das war ein metropolitanes Leben! Da kam man sich als Kieler wie ein Kleinstädter vor. Allerdings war auch klar, dass die kleine DDR während eines solchen Großereignisses alles was gut und teuer war in Leipzig massierte. Die norddeutschen Gäste wohnten im Stadtteil Wahren und fuhren ständig mit der Straßenbahn zu den Messehallen, zur Konzerthalle und diversen Veranstaltungsorten. Für Kieler faszinierend war auch, dass in Leipzig, einer Stadt, die nur etwa doppelt so groß wie Kiel ist, ein hervorragender Stadtverkehr mit einem dichten Straßenbahnnetz abgewickelt wurde. Von Wahren aus konnte man etwa alle drei Minuten in alle anderen Stadtteile fahren. Aber auch in Wahren wurde den Gästen im Kulturhaus ständig etwas geboten: Musical, Kabarett, Vorträge.
Während einer Kulturveranstaltung bat der Genosse Gruneberg Arnald zu einem persönlichen Gespräch mit seinem Führungsoffizier in einen Nebenraum. Arnald hatte schon gehört, dass westdeutsche Besucher erpresst worden waren, um für das MfS zu spionieren. Teilweise hatte man unschöne Einzelheiten aus ihrem Geschäftsleben herausbekommen, und man drohte nun mit Veröffentlichung, falls die ausgespähte Person nicht kooperierte. Oder dickbusige Tschekistinnen hatten unbedarfte Männer ins Bett gelockt, wo man sie dann beim Liebesspiel gefilmt hatte. Arnald hatte ja kein Geschäft und man konnte ihm deswegen keine ungesetzlichen Geschäftsmethoden vorwerfen, und dickbusige Tschekistinnen hatten sich leider auch nicht an ihn herangemacht. Ihm boten die beiden Herren vernünftigerweise gleich Geld an. 250,00 DM monatlich, wenn er Stimmungsberichte schreiben und ihnen schicken würde. 250,00 DM jeden Monat waren viel Geld und Stimmungsberichte sind keine Spionage. Es war aber auch einer in diesen Fragen eher unbedarften Person klar, dass die Stasi einen am Arsch hatte, wenn man ihr erst einmal ein noch so harmloses Schriftstück geliefert hatte. Arnald lehnte das Angebot ab mit der Begründung, dass eine derartige Tätigkeit für das MfS missverstanden werden könne. Der Ministerpräsident Lemke von Soltenizz, früher NSDAP, heute CDU, habe ohnehin gewettert, dass alle linken Studenten bezahlte Ostagenten seien. Da sollte man jetzt nicht noch Wasser auf diese braune Mühle gießen.
Das hört sich jetzt heroischer an, als es war. Das Geld hätte Arnald schon gereizt. Und das Leben der Spione war auch nicht ohne Reiz, wie man aus den James-Bond-Filmen wusste.3) Die beiden Herren blieben aber höflich: „Ja, das verstehen wir. Nichts für ungut. Dann noch schöne Tage in Leipzig.“
Richtig befremdet war Arnald erst, als ihn BND-Mitarbeiter in Wolfsburg aus dem Abteil des Interzonenzugs holten und in einem anderen abgeschlossenen Abteil bis Hannover in die Mangel nahmen. Er sollte Namen nennen. Er nannte dann auch die Namen, die er kannte, aber die BND-Leute kannten die Leute hinter den Namen schon besser als er, und man ließ ihn bald in Ruhe. Eines war klar: BND und MfS hatten eindeutig die besten Kontakte untereinander. Und das MfS hatte Arnald auch stante pede an den BND verraten, weil sie sauer waren, dass er bei ihnen nicht mitmachen wollte. Was auch immer es da zu verraten gab. Wahrscheinlich reichte bereits der kameradschaftliche Hinweis: „Nehmt den Dagghe mal unter die Lupe!“ Aber war es vielleicht auch die enge Zusammenarbeit der Geheimdienste, die den Weltfrieden rettete. Und die Jusos hatten recht mit ihrer Forderung: Ost und West müssen im Gespräch bleiben.
Arnalds Eltern waren ziemlich entsetzt, als sie hörten, dass Arnald in Geheimdienstkreise geraten war. Sie rieten ihm dringend: „Wende dich mit dieser Sache doch mal an Dr. Ka. Der ist beim Verfassungsschutz und linker Sozialdemokrat wie wir. Der kann dir bestimmt Ratschläge geben, damit du da nicht in Geheimdienstsachen reinschlitterst.“
Gesagt – getan. Arnald ließ sich einen Termin bei Dr. Ka. geben. Der empfing ihn nun keineswegs in den prächtigen Diensträumen des Verfassungsschutzes am Düsternbrooker Weg sondern in einer konspirativen Wohnung im Vorortbahnhof Hassee. Seit es dort kein Bahnpersonal mehr gab, nutzte der VS die dortige Dienstwohnung für seine verdeckten Tätigkeiten. Arnald berichtete dem Genossen Dr. Ka. ausführlich über seine Erlebnisse. Der lachte lauthals über Arnalds Abenteuer und erklärte dem unbedarften jungen Mann:
„Also, damit das erst einmal klar ist. Dem Verfassungsschutz kannst du voll vertrauen. Ihr jungen Leute glaubt immer, Inlandsgeheimdienste seien überflüssig. Stimmt aber nicht! Selbst in einer entwickelten, sozialistischen Gesellschaft kann man nicht auf einen Inlandsgeheimdienst verzichten. Auch der Klassenfeind schläft nicht. Also: Der nicht, und alle anderen potentiellen Feinde schlafen auch nie!“
Das war Arnald schon völlig klar gewesen. Gerade die kleine DDR hatte einen Geheimdienst, der sich gewaschen hatte, und der sich krakenartig durch die gesamte Gesellschaft gefressen hatte. Er murmelte daher etwas befremdet: „Ich glaube kaum, dass es dem Sozialismus nützt, wenn man das ganze Volk unter Generalverdacht stellt, mit dem Klassenfeind unter einer Decke zu stecken. Außerdem braucht man zu einer Bespitzelung des ganzen Volkes so viele Mitarbeiter, dass die rein mathematische Wahrscheinlichkeit groß ist, dass unter den Geheimagenten ziemlich viele Klassenfeinde sind. Ja, es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass es die schlimmsten Elemente sind, die sich da im Geheimdienst versammeln.“
Dr. Ka. war nicht beleidigt, sondern lachte: „Das ist wahr. Ich sehe schon du hast verstanden, was das Hauptproblem nachrichtendienstlicher Tätigkeit ist. Wer zu viele Knechte hat, wird oft von denen selbst verraten. ‚Belsazar wurd´ in selbiger Nacht von seinen eigenen Knechten umgebracht‘, heißt es ja auch schon so nett bei Heinrich Heine. Deswegen ist es ja auch gut, dass wir beim Landesamt für Verfassungsschutz hier in Kiel nur so ein paar Männeken sind. Da müssen wir nicht unsere ganze Kraft darauf verschwenden, die U-Boote und Maulwürfe in den eigenen Reihen zu enttarnen und zu eliminieren. Beim CIA geht 70 bis 80 Prozent der gesamten Arbeitskraft für die Bespitzelung der eigenen Leute drauf. Beim KGB ist es eher noch schlimmer.“
Und dann machte er Arnald einen Vorschlag, auf den der gar nicht gefasst war: „Wir machen das jetzt mal ganz systematisch: Du gehst zum Schein auf das Angebot der Stasi ein. Dann dekonspirierst du – ebenfalls zum Schein - gegenüber dem BND. Und dann berichtest du uns alles, was du über die Stasi und den BND und deren Zusammenarbeit herausbekommst. Du wirst von uns angemessen bezahlt, und das, was dir Stasi und BND bezahlen, kannst du auch behalten. Du musst die Summen nur unserer Rechnungsstelle gegenüber offenlegen. Die Einkünfte von der Stasi sind hier sowieso nicht einkommenssteuerpflichtig.“
Damals arbeiteten viele Menschen als Doppel-, Triple, oder gar Quadrupelagenten. Lothar Weirauch spähte im Auftrag von Adenauer die FDP, und im Auftrag von Ulbricht den Adenauer selbst aus. Da hätte Arnalds Leben an dieser Stelle leicht einen ganz anderen Verlauf nehmen können. Und er war noch keine 20 Jahre alt und fast schon ein international agierender Geheimagent.4) Dr. Ka ließ nicht locker: „Du könntest ja erst einmal probeweise einen Auftrag für uns erledigen. Dann siehst du, ob dir das liegt. Und wenn nicht, haust du wieder ab und unterschreibst, dass du 30 Jahre nicht über deine Tätigkeit sprechen darfst.“
Arnald: Und was wäre das für eine Aufgabe!
Dr.Ka.: Du wohnst doch in einem Reihenhaus in Mettenhof. In der Nummer 218 wohnt der Dr. N. Den beobachtest du ganz einfach mal einen Monat.
Arnald: Wie? Was? Beobachten?
Dr.Ka: Na ganz einfach! Beobachten eben! Ausspähen! Du machst Notizen, über das was er so den ganzen Tag macht. Wann er morgens aufsteht. Wann er das Haus verlässt. Ob er mit dem Auto wegfährt, oder nur zum COOP einkaufen geht oder zur Apotheke. Wer ihn besucht.
Arnald: Und warum soll ich den Doktor beobachten?
Dr.Ka: Die Frage ist jetzt falsch gestellt. Beim Nachrichtendienst ist es wichtig, so wenig wie möglich zu wissen. Einfach nur den Auftrag ausführen. Und dafür zahlen wir tausend Mark pro Monat. Wir erwarten dafür vier bis fünf Stunden Observation am Tag, allerdings auch an den Wochenenden.
Tausend Mark war damals viel Geld. Da konnte man gut von leben. Aber das Agentenleben ist voller Risiken und ein solches Leben ist auch oft sehr kurz. Und Arnalds Eltern hatten ihren Sohn zu Dr. Ka. geschickt, damit der ihn aus dem Geheimdienstsumpf heraushalten, nicht dass er ihn noch tiefer hineinziehen sollte. Arnald lehnte das großzügige Angebot ab. Dr. Ka. bedauerte diesen Entschluss: „Schade, wir hätten einen erstklassigen Agenten aus dir gemacht.“
Dr. Ka. wurde bald darauf ins Innenministerium befördert, und der Genosse Gruneberg wurde vom hauptamtlichen Parteifunktionär zum Stadtgärtner in Neubrandenburg degradiert. Das war vielleicht in seinen Augen das Ende einer Karriere, ist aber natürlich auch kein so sehr grausames Schicksal. Neubrandenburg gewann dann später bei einem republikweiten Wettbewerb städtischer Grünanlagen einen Preis.
Nach der Öffnung der Stasi-Unterlagen fuhr Pepe in die Normannenstraße zur Gauck-Behörde und erfuhr allerlei Merkwürdiges, unter anderem, dass er und Arnald als Agentenanwärter auch nur zweite oder dritte Wahl gewesen waren. Man schätzte sie seitens der Genossen vom MfS als linksradikale Utopisten und Illusionisten ein, möglicherweise handele es sich bei ihnen sogar um verkappte Trotzkisten.5) Als dann in den 90er Jahren der westdeutsche Verfassungsschutz seine Akten öffnen musste, war eine Person namens Arnald Dagghe dort völlig unbekannt, weder als Objekt der Bespitzelung noch als potentieller Mitarbeiter. Man konnte auch im Landesamt für Verfassungsschutz in Kiel die Aktenwölfe rattern hören.
******
Seinen 20. Geburtstag feierte Arnald dann ganz ruhig und ohne Agententrara mit seiner Freundin Annika Bahr-Epstein. Die beiden kannten sich seit etwa einem halben Jahr, oder wie man damals noch so altväterlich sagte: Sie gingen miteinander. An diesem Abend gingen sie jedenfalls miteinander erst einmal ins Tai-Ping in der Wilhelminenstraße schick essen. Das hört sich heute etwas merkwürdig an, dass man zum Chinesen geht, um schick zu essen. Aber damals gab es nur ein einziges Chinarestaurant in Kiel. Und das war immer super exotisch, wenn man dorthin ging. Sojabohnen und Bambussprossen waren der Gipfel dieser fernöstlichen Kulinarik. Und wer mit Stäbchen essen konnte, wurde bewundernd angeschaut.
Danach ging es ins Schauspielhaus, wo sich das junge Pärchen ein englisches Lustspiel über einen bizarren, versuchten Gattenmord ansah. Arnald und Annika waren damals selbst noch schwer verliebt und konnten über das Stück herzlich lachen. Einige ältere, lebenserfahrenere Paare im Parkett konnten aber schon nicht mehr richtig lachen, als sie dabei zusahen, wie zwei ältere Eheleute immer wieder versuchten, sich auf die putzigsten Arten und Weisen gegenseitig zu meucheln. Gut ging es nur den beiden Liebhabern der Eheleute, die sich zufällig im Wandschrank kennen und lieben lernten und schließlich beschlossen, gemeinsam auf die Bermudas zu gehen. Das mordlustige Ehepaar blieb alleine im englischen Winter zurück. Dass das Stück gar keine Komödie war, sondern dass das Leben wirklich so läuft, begriff Arnald erst später. Jetzt aber zu einem ernsten Thema: Dem Studium der Rechtsgelehrsamkeit und dem Ernst des Lebens!
4. Der wahre Ernst des Lebens
Zu Beginn des Sommersemesters 1969 ging es dann in die Übung Bürgerliches Recht für Anfänger, also der Veranstaltung, in der man den legendären Kleinen BGB-Schein erhalten kann. Mit dem Kleinen BGB-Schein beginnt sozusagen der Ernst eines Juristenlebens.
Professor Peters, der vom Äußeren her sehr an einen Pinguin erinnerte, erschien auf der Bühne mit seinen Korrekturassistenten, den Herren Schwartenkrach, Dziemballa, Strogy und Schultze-Rabotat. Der schlaue Fakultätsassistent Sachse, den Arnald ohnehin für die graue Eminenz des Fachbereichs hielt, moderierte die Veranstaltung und verdeutlichte durch sachgerechte Kommentare, was der Professor seinen Studenten eigentlich sagen wollte.
Professor Peters warnte eindringlich davor, was man alles falsch machen konnte, sowohl bei den Klausuren als auch der Hausarbeit. Seine Assistenten seien total ausfuchst, und würden jeden Versuch einer Ungenauigkeit der Argumentation oder Unsauberkeit der wissenschaftlichen Deduktion sofort erkennen. In den Hausarbeiten dürften keine Sekundärzitate verwendet werden. Da komme man nicht mit durch. Auch Abschreiben ohne Quellenangabe könnten seine Assistenten sogar noch mit geschlossenen Augen feststellen. Auch sollten die Anwesenden nicht glauben, dass er ihnen nicht auf die Schliche kommen werde, wenn sie sich eines Schleppers bedienten.
Fakultätsassistent Sachse bekräftigte die Worte des Professors: „Wir haben an der Fakultät einen Generalplan zur Bekämpfung des Schlepperunwesens erarbeitet. Notfalls kommt man nur noch unter Vorlage eines Personalausweises und eines Passierscheins in den Hörsaal, in dem die Klausuren geschrieben werden.“
Darauf erhob sich aufgeregtes Gemurmel und Scharren mit den Füßen im Saal! Arnald verstand nur Bahnhof. Bisher hatte er Schlepper immer für starke, kleine, wendige Schiff gehalten, die die großen Schiffe bugsierten oder abschleppten. Weiß doch jeder Kieler! Aber hier waren Schlepper wohl etwas anderes: Nämlich erfahrene Juristen, die für Studienanfänger gegen Geld die Klausuren und Hausarbeiten schrieben. Eines wurde jetzt aber klar: Arnald wusste viel weniger als die meisten seiner Kommilitonen über das Studium der Jurisprudenz. Denn die grinsten wissend bei der Erwähnung des Begriffs „Schlepper“ und kicherten überlegen. Arnald musste sich eingestehen: Er hatte keine Ahnung davon, worauf er sich mit dem Jura-Studium eingelassen hatte. Wahrscheinlich hätte er doch lieber Offsetdrucker werden sollen, um seinem Vater eine Freude zu machen. Oder dem Rat von Nachbar Petersen folgen: Nach einem kurzen Studium an der PH auf Grundschüler losgelassen werden.
Beim schlauen Fakultätsassistenten Sachse hatten Arnald und einige Kommilitonen einen Einführungskurs ins Juristische Denken. Sachse stellte lauter verquere Sachverhalte in den Raum, zum Beispiel einen Mops der eine Stange Karbid gefressen hatte und dann explodiert war. Wer haftet da für den Schaden, der durch die Explosion entstanden ist. Oder: Der A. hatte ein Klavier erst an den B. und dann den C. verhökert. Die noch unbedarften Kandidaten der Jurisprudenz mussten sich überlegen, wie man den Fall lösen könnte. Und wer das Klavier schließlich bekam. Da alle Teilnehmer des Kurses nur sehr wenig Ahnung hatten, kamen die merkwürdigsten Vorschläge aufs Tapet. Die kaum der autoritären Schulanstalt entwachsenen jungen Leute waren völlig verwirrt, als Sachse unterschiedliche Lösungen gelten ließ, wenn sie nur gut begründet waren. Einmal fragte Arnald: „Und was ist nun die richtige Lösung?“