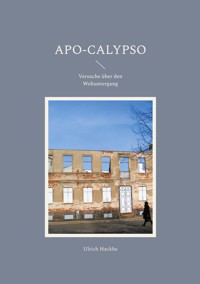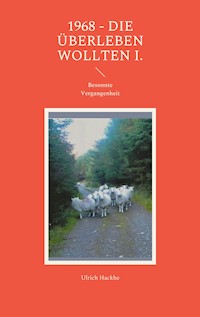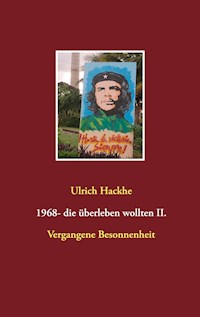Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vielleicht ist Weihnachten ja nur ein Missverständnis! Trotzdem kehrt es Jahr für Jahr wieder. Die Erwartungen sind hoch und können nicht erfüllt werden. Wahrscheinlich ist es wirklich am besten, wenn sich alles in Chaos auflöst und das tut es in allen fünf Geschichten dieses Buches.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu diesem Buch:
Jedes Jahr droht uns das Weihnachtsfest.
Gnadenlos! Immer wieder! Nichts kann es aufhalten! Die Glocken klingen süß, und die Erwartungen sind hoch! Sehr, sehr hoch. Aber die Erfahrungen sagen, dass sie nicht erfüllt werden können. Kein Wunder, dass die anfängliche Idylle aller dieser hier vorgestellten Weihnachtsgeschichten bald ins Chaos mündet. Da muss sich bereits vor vielen Jahren, als angeblich alles noch besser war, schon einmal eine vielköpfige und muntere Geschwisterschar auf einem abgelegenen Bergbauernhof gegen ein gar zu schlagkräftiges Christkindchen zur Wehr setzen. Dann entgleist am Heiligabend die vermeintliche Idylle einer westdeutschen Familie der 80er Jahre zu einer Symphonie des Grauens. Schöne, alte weihnachtliche Riten auf dem Land erweisen sich bei näherer Untersuchung als ein Schreckensszenario, und für die Kinder wird die Adventszeit zu einem Kabinett des Grauens. Eine adventliche Kulturveranstaltung muss wegen übergroßer Rührung der Teilnehmer abgebrochen werden. Und schließlich gelingt der Versuch eines ambitionierten Geistlichen, den wahren Geist der Weihnacht wieder zu beleben, auch nicht so richtig. Nichts aber auch gar nichts will an Weihnachten so richtig gelingen. Und wundern wir uns darüber? Doch nicht wirklich!
Fünf Versuche fiktiver Autoren über das schwierige Fest der Liebe und der Fleischwerdung
Für alle Christkind-Muffel und solche, die es werden wollen!
BoD
Inhalt:
Weihnachten im Hochgebirge
Von Heidemaria Unterberger (1973)
Weihnachten bei Muttern
Von Eberhardt Porkmann (1995)
Vorgeschichte in Berlin
Mit der Reichsbahn von Berlin nach Schafingen
Am 23.12. bei Familie Schultze bis zum Mittagessen
Was sonst noch nach dem Mittagessen passierte
Am 24.12. vormittags bei Schutzes
Was am 24.12. noch bei den Schultzes geschah
Die Weihnachtsgeschichte nach Lukas
Eine schöne Bescherung
Weihnachtliche Bräuche im Echterland
Von Heimatforscher Unterwöger (2008)
Das Märchen vom kleinen Tannenbäumchen
Von Hans-Heinrich Unschlitt (2016
Der Christmas Park
Von Unhold Hugendeubel (2017)
1. Weihnachten im Hochgebirge
Aus den Aufzeichnungen des Waldbauernmädels Heidemaria Unterberger
Wenn ich heute so in der Vorweihnachtszeit das laute und geschäftige Treiben sehe: Die prächtigen, prall gefüllten Schaufenster, die Lichterketten über den Straßen, den Trubel und den Lärm, die vielen Menschen, die sich nervös in den Geschäften drängen, dann muss ich oft daran denken, wie wir Weihnachten feierten, als ich noch jung war.
Ich bin das Kind armer, schlichter aber aufrichtig frommer Waldbauern. Unser Hof lag abseits aller Geschäftigkeit hoch droben im Gebirge. Und im Winter waren wir oft eingeschneit und von der Außenwelt so gut wie abgeschnitten.
Trotz dieser völligen Abgeschnittenheit und des sehr hohen Tiefschnees im tiefsten Hochgebirge herrschte bei uns zu Hause immer ein recht fröhliches Leben, denn es galt damals ja noch nicht als unfein, viele Kinder zu haben. Und ich hatte viele Geschwister: Große und Kleine.
Oh, es ging damals recht kärglich bei uns zu. Oft war es Schmalhans, der bei uns die dünne Suppe einbrockte. Dabei mussten unsere Eltern hart um unser Täglich Brot schaffen und wir Kinder wurden auch oft zu schweren Handreichungen in der Landwirtschaft oder im Haushalt herangezogen.
In der Stube blakte nur ein schummriges Talglicht. Selbst eine Petroleumlampe stellte einen solchen Luxus für uns dar, dass wir sie uns nicht hätten erlauben können. Und hätte man uns Kindern vom Gaslicht oder gar dem elektrischen Licht erzählt, so hätten wir dies bestenfalls staunend für Feenzauber aus dem Märchenland gehalten. Wahrscheinlich hätten wir aber jenen, der uns von dieser Art seltsamen Lichts erzählt hätte, für einen Lügenbold gehalten, und ihn verspottet und verhöhnt oder ihm auch eine ordentliche Portion Dresche zugemessen. Denn obwohl wir meistens recht herzlich und schlicht miteinander umgingen, waren wir, was unser Benehmen anging, doch oft auch recht rau und ehrlich und geradeheraus.
Natürlich hatten wir keinen Fernseher und kein Radio. Nicht einmal ein dampfbetriebenes. Und außer der Bibel, dem Gesangbuch und dem 100-jährigen Kalender gab es bei uns weder Bücher noch Zeitschriften, in denen ja oft doch nur Schlimmes steht. Doch im großen, grünen Kachelofen knisterten geheimnisvoll die harzigen Holzscheite. Und wenn der große Frost kam, und der kam oft schon sehr früh, da war oft schon Anfang Januar das Häusel mit dem Herzen in der Tür eingefroren. Ja, ja - sanitär ging es bei uns auch recht rustikal zu. Aber das war nicht so schlimm. Es gab ja auch nicht viel zu essen, da brauchte man das Häusel nicht so oft. Oh, oh vor allem der lange, düstere Winter war damals oft eine ärmliche und dunkle Zeit.
Aber die Weihnachtszeit mit ihrem inneren Leuchten war für uns Kinder strahlender und schöner als jede andere Zeit des Jahres. Das kümmerliche Licht unseres schlichten Adventskranzes vermochte tiefer in die Herzen zu dringen, als es das grelle, bunte Neonlicht der aufdringlichen Weihnachtsreklame heuer zu tun vermag.
Wurden wir sonst auch recht kurz gehalten, was Naschwerk und Süßigkeiten anging, teils weil es an Geld mangelte, teils aber aus erzieherischen Gründen, so war die Adventszeit eine besonders festliche Zeit der Leckereien. Nie wieder haben mir die teuersten Delikatessen aus den exotischsten Ländern so gemundet wie jene Teigreste, die ich in der Vorweihnachtszeit aus Mutters Töpfen und Tiegeln kratzen und schlecken durfte.
Überhaupt Mutter! Sie war die Priesterin unserer Weihnachtsstimmung. Wenn sie am Ersten Advent die kostbaren Messinggefäße und die kunstvoll bestickten Weihnachtsdecken aus den wuchtigen Schreinen und gewaltigen Truhen holte, wussten wir, dass das Christfest vor der Tür stand. Mit ihren alten, von der vielen Arbeit faltig und schrundig gewordenen Händen flickte sie die Decken, dass sie wie neu aussahen, und wienerte die Gefäße, bis man sich in ihnen spiegeln konnte. Wir wollten vor dem Christkind ja nicht wie Leute dastehen, die nichts hatten oder schlimmer noch: die nichts auf sich hielten.
Ja, das Christkind spielte für uns Kinder natürlich eine besonders wichtige Rolle. Advent kommt ja aus dem Lateinischen und heißt so viel wie Ankunftszeit. Und jede Ankunftszeit ist immer mit einer Wartezeit verbunden, wie wir von Bahnhöfen und Flugplätzen wissen. Und jede Adventszeit war immer wieder für uns Kinder eine Zeit, in der wir voll Vorfreude aber auch heimlicher Bänglichkeit auf die Ankunft des Christkindes warteten. Am Heiligen Abend würde es uns ja nicht nur Geschenke bringen, sondern uns für unsere
kleinen Missetaten zur Rechenschaft ziehen. Natürlich standen die Geschenke damals noch nicht so im Mittelpunkt des weihnachtlichen Geschehens, wie dies in unserer heutigen, kommerziellen Zeit der Fall ist. Trotzdem muss ich zugeben, dass wir Kinder Weihnachtsgeschenke als unser unveräußerliches und naturgegebenes Recht ansahen.
Advent war wegen des Christkindes auch eine Zeit der Geheimnisse und Heimlichkeiten. Vater verschwand öfter mit wissendem Lächeln im Holzschuppen, um - wie er sagte - etwas mit dem Christkind oder dessen Helfern zu besprechen. Da war uns Kindern der Zutritt zum Holzschuppen natürlich streng verboten. Vater ermahnte uns bei Androhung schwerer weltlicher und geistlicher Bestrafung, dieses Gebot auch ja einzuhalten. Mutter verzog sich bisweilen für längere Zeit mit den Helfern des Christkindes in der Nähkammer. Die blieb während der Adventszeit natürlich genau so streng verschlossen wie Vaters Holzschuppen.
Wir Kinder malten uns in unserer Phantasie in den prächtigsten Farben aus, was die Eltern mit den Helfern des Christkindes in den verbotenen Räumen so trieben. Einmal in einem der vielen Jahre meiner mir damals noch unendlich lang erscheinenden Kindheit hatte ich mich getraut, durch das Schlüsselloch der Nähkammer zu schauen. Aber das machte ich dann nie wieder. Das Christkind hatte mir wegen dieses in meinen Augen nur geringfügigen Fehlverhaltens sehr herbe Vorhalte gemacht und mir nur die halbe mir eigentlich zustehende Portion Pfeffernüsse zugeteilt. Und Knecht Ruprecht hatte bedrohlich die Rute geschwenkt.
Einzig die Zusammenarbeit des Großvaters mit dem Christkinde war nicht mit der Aura des Geheimnisvollen und Verbotenen umgeben. Großvater war nach einem Leben der harten Arbeit und strengen Pflichterfüllung halb erblindet, ziemlich ertaubt und fast gelähmt. Deswegen saß er am liebsten den lieben langen Tag auf der warmen Ofenbank und rauchte sein stinkiges Pfeifchen. Trotz seiner Leiden schnitzte er mit den gichtbrüchigen Fingern die kunstfertigsten Gegenstände und die putzigsten Spielsachen. Wenn wir den Großvater dann fragten, für wen er das mache, paffte er vergnügt ein paar übel riechende Qualmwölkchen und antwortete schmunzelnd: „Man musch dem Chrischtkindla doch ein wenig helfa. S‘ gibt doch gar zu viele Kindla, die beschenkt werden wolla.“
Manches Mal erschien es uns vorwitzigen Kindern zwar so, als ließe das Christkind die Sachen, die Großvater geschnitzt hatte, gleich bei uns. Aber das tat der weihnachtlichen Stimmung keinen Abbruch. Außerdem war Großvater ein begnadeter Schnitzer.
Wegen des Christkindes waren wir Kinder in der Adventszeit besonders hilfsbereit und höflich. Es war ja offensichtlich, dass die artigen Kinder bessere und schönere Geschenke bekamen als die bösen Buben und Mädels, denen im schlimmsten Fall die Rute aus Ruprechts riesigem Sack drohte. Zwar waren wir damals noch nicht unmäßig mit unseren Wünschen, wie man das heute leider bei den verwöhnten Kindern, vor allem aus der Großstadt, beobachten muss. Wir freuten uns damals bereits über einen bunten Teller mit braunen Plätzchen. Aber manches Mal hatten wir doch größere Wünsche, die erst durch gute Taten verdient werden wollten. Wer faul, aufsässig und unhöflich war, konnte jedenfalls nicht auf ein neues Mützchen, ein Taschenmesser oder gar ein Püppchen hoffen.
*****
Ich erinnere mich noch an die einschneidenden, weihnachtlichen Geschehnisse jenes Jahres, in dem ich mir Schlittschuhe vom Christkind gewünscht hatte. Hei, wie ein Wirbelwind über die spiegelnden Flächen der Teiche und Tümpel sausen, das war schon etwas. Aber mir war klar, dass ich angesichts eines so großen Wunsches erst einige Untaten wettmachen musste. Ich war das liebe lange Jahr nicht sonderlich höflich zu den Erwachsenen gewesen. In der Schule hatte es mir an dem gebotenen Fleiß gefehlt. Besonders im Sommer war ich lieber zum kühlen Bach gegangen und hatte dort im erfrischenden, klaren Wasser getobt, als dass ich in der Stickigkeit des heißen Schulhauses unter der Aufsicht des gestrengen Herrn Lehrers das Lesen, Schreiben, Rechnen und Beten oder gar die schwierige Plutimikation erlernt hätte.
Ich selber fand diese Sünden nicht so gravierend, aber wenn ich an meinen großen Bruder Xaver dachte, wurde mir ganz mulmig. Der hatte im letzten Jahr tatsächlich die Rute zu spüren bekommen. Dabei war der Xaver zumindest in meinen Augen kein schlechter Mensch. Oft hatte er Vater bei der harten Arbeit auf dem kargen, steinigen Felde mit dem störrigen Ochsengespann geholfen. Und wenn ein Ochse wegen Unwohlseins ausgefallen war, hatte er versucht, ihn nach Kräften zu ersetzen. Er war halt immer nur ein wenig launisch und eigensinnig, der Xaverl, der kleine Sauhund, der!
Das Christkind hatte sein vernichtendes Urteil über ihn im Wesentlichen damit begründet, dass er oft Widerworte gegeben, mürrisch dreingeschaut, und schließlich während des Gottesdienstes am 4. Advent dem kleinen Reserl ein rosa Schleifchen vom Kopfe gerissen und dabei auch noch höhnisch gelacht habe. Darin offenbare sich eine Einstellung, die mit dem Geist der Weihnacht nicht vereinbar sei. Da half es auch nichts, dass das Reserl eins ums andere Mal beteuerte, sie sei dem Xaver nicht mehr böse. Das Christkind war dem Reserl über den Mund gefahren, dass es gar nicht darum gehe, ob das Reserl böse sei oder nicht, sondern dass es ums Prinzip gehe. Unser Problem war dabei, dass wir die Prinzipien des Christkindes nicht kannten. Sonst hätten wir uns ja besser einschleimen können.
Das Christkind hatte sodann eine große Rute aus dem Sack des Knechts Ruprecht geholt und damit bedrohlich hin- und her gefuchtelt. Nachdem es genügend gefuchtelt hatte, gebot es dem Knecht Ruprecht, die Rute auf dem Hintern vom Xaver eine lustige Polka tanzen zu lassen. Hei, wie hatte der Xaver geschrien und geweint, obwohl er doch schon ein großer Junge war, der eigentlich nicht mehr weinen durfte. Schließlich hatte das Christkind die Rute an unseren Vater übergeben, mit dem Bemerken, dass ein Vater, der seinen Sohn liebte, ihn auch kräftig stäupen müsse. Sonst schlecht! Wir anderen Geschwister gaben zwar alle etwas von unseren Nüsslein, Äpfelchen und Küchlein an unseren geschundenen Bruder ab. Aber das konnte seinen Schmerz und seine menschliche Enttäuschung nur wenig lindern. Zusammenfassend kann man sagen, dass das vorherige Christfest für ihn völlig versaut war. Da gab es nichts zu bemänteln, zu deuteln oder zu beschönigen. Schließlich hatte Xaver sich neue Buntstifte gewünscht. Wozu er sich die gewünscht hatte, weiß ich allerdings auch nicht, denn der Xaver kann gar nicht zeichnen. Der ist so etwas von künstlerisch unbegabt, dass es schon weh tut.
Ich hoffte in diesem Jahr, dass ich meine Untaten, die im schwarzen Buch des Christkindes üblicherweise minutiös verzeichnet waren, dadurch wieder gut machen konnte, dass ich der Mutter bei ihrer schweren Arbeit in der Küche zur Hand ging, wie es sich für ein braves Landmädchen geziemt. Ich wollte doch so gerne die neuen Schlittschuhe haben. Aber das sagte ich natürlich nicht zu laut, um nicht unbescheiden zu wirken. Denn Bescheidenheit ist eine Tugend, und Unbescheidenheit ist ja etwas, das ein Christkind einem auch übel anrechnen konnte. Mutter war ganz gerührt, als ich ihr so freudig half. Aber natürlich durchschaute sie mich auch ein wenig und wusste, dass es nicht so sehr echte Selbstlosigkeit und Frömmigkeit war, sondern eher das bevorstehende Weihnachtsfest, das Fleiß und Hilfsbereitschaft bei mir so sehr befördert hatte.
„Ja, esch möchte doch öfter Chrischtfescht sei, dass man so artige und hilfsbereite Kinder hätt. Dasch Chrischtkindla versteht sich uffs Erziehe doch besser als unsereins.“
Aber der Winter hielt doch auch gar so viele Freuden für uns Kinder bereit, dass ich an manchen strahlenden Tagen lieber hinaus in die weiße Wunderwelt ging, um dort herumzutollen, als drinnen in der dumpfen Küche der Mutter zur Hand zu gehen. Und vor allem der Winter in jenem Jahr, in dem ich mir Schlittschuhe wünschte, war ein richtiger Schnee- und Frostwinter, so wie es ihn heute gar nicht mehr gibt. Die Winter waren damals ohnehin noch echte Winter. Nachts schneite es den herrlichsten Pulverschnee und tagsüber strahlte die Sonne vom blassblauen Winterhimmel. Am liebsten war ich da doch mit den Geschwistern und den Kindern von den anderen Berghöfen auf den verschneiten Feldern und Wiesen, wo wir nach Herzenslust rodelten oder ausgelassene Schneeballschlachten veranstalteten. Oder die gewaltigsten und schönsten Schneemänner bauten. Wir setzten ihnen dann einen alten, rostigen Eimer als Hut auf und steckten ihnen aus der Küche stibitzte Mohrrüben als lustige, rote Nasen in die eisigen Gesichter.
*********
Endlich war dann der 24. Dezember gekommen. Wir Kinder hielten es den lieben, langen Tag gar nicht aus, auch nur ein Minütlein stille zu sitzen. So aufgeregt erwarteten wir schon seit den frühen Morgenstunden die Ankunft des Christkinds, das doch traditionsgemäß erst nach Einbruch der Dämmerung kommen konnte.
Glücklicherweise gab es aber noch viel zu tun, was uns von den bangen und aufgeregten Gedanken ablenkte. Vor allem galt es, noch einen Weihnachtsbaum für die Weihnachtstube aus dem Walde zu holen. Zusammen mit Vater zogen wir hinaus in den weiß verschneiten, feierlichen Weihnachtswald. Wie in jedem Jahr gab es immer wieder große Dispute darum, welcher Baum es denn sein sollte. Der eine war zu klein, der andere zu groß und wieder einer war zu struppig. Endlich hatten wir eine herrliche, gerade gewachsene Fichte gefunden, die bis unter die Decke reichen würde. Vater war mit unserer Wahl nie einverstanden und wie in jedem Jahr brummte er:
“Die net, Kinder, die ischt zu grosch!“ Aber schließlich ergab sich Vater unseren Bitten, auch wie in jedem Jahr, und schlug den von uns Kindern ausgesuchten Baum. Mit lautem Jauchzen und unter Absingen zum Teil auch recht gewagter weihnachtlicher Lieder brachten wir den so hart erbeuteten Baum im Triumphzug nach Hause. Dort richteten wir ihn in der Stube auf und schmückten ihn auf das Prächtigste mit an den langen, dunklen Abenden selbst gebasteltem Schmuck, der viel schöner war als der, den man heute in den Geschäften wohlfeil kaufen kann. Nur Großvater, der mit seinem stinkigen Pfeifchen auf der Ofenbank saß, war mit unserem Treiben nicht ganz einverstanden. Er schüttelte den Kopf und brummte:
„So heidnische Bäum hän wir früher net g’hätt. Da war’s chrischtliche Krippeschiel gut g’nug.“
Aber so brummig, wie Großvater tat, war er gar nicht. Auch er liebte unseren bunten Baum. Und selbstverständlich fand auch unsere alte Krippe mit ihrer mit seiner bäuerlichen Schlichtheit einen Ehrenplatz unter dem Baum. Natürlich achteten wir bei der Baumaufstellung auch darauf, dass an seinem Fuße genügend Platz für die Geschenke blieb, die wir erwarteten.
Aber dann nach Erfüllung dieser weihnachtlichen Pflichten wurde der Tag immer mühseliger. Die Stunden verrannen wie klebriger Sirup. Wir sangen zusammen Weihnachtslieder und wir Kinder nutzten die Zeit, um die von uns auswendig gelerntem Weihnachtsgedichte noch einmal zu wiederholen. Denn schließlich sollte es ja schon vorgekommen sein, so wurde gemunkelt, dass das Christkind mit allen seinen Geschenken wieder davongesegelt war, nur weil ein ansonsten völlig braves Kind sein Weihnachtsgedicht wieder vergessen hatte. Und das sollte uns nicht passieren. Und bei mir ging es immerhin um ein paar Schlittschuhe.
Als es dunkel wurde und die Sternlein hell und klar funkelten, ging Vater mit uns zur Kirche. Mutter musste zu Hause bleiben, um den Weihnachtsschmaus zuzubereiten. Aber auch sie versäumte nie den Kirchgang. Sie ging immer schon am frühen Vormittag zu einer Art Hausfrauenmesse, um den Nachmittag und frühen Abend frei für die Küchenarbeit zu sein. Denn es war ja die vornehmste Pflicht aller Haus-, Land- und Bauersfrauen an diesem heiligen Tage besonders viel nahrhafte und schmackhafte Nahrung auf den sich biegenden Tisch zu bekommen.
Während wir Kinder nun von unserem Vater wohlbehütet unter dem sternenübersäten Himmelszeit durch die verschneite Landschaft zur Kirche geführt wurden, musste ich an den Stern von Bethlehem denken, der vor nun fast 2000 Jahren in die Herzen der Menschen geleuchtet hatte. Ich wusste ja, dass fromme Gedanken fast so viel bewirkten wie fromme Taten, jedenfalls bei der Bewertung durch das Christkind. Deshalb zwang ich meine Gedanken, sich mit aller Kraft auf geistliche Themen zu konzentrieren. Damit hatte ich die Schlittschuhe sicherlich schon halb verdient. Meinte ich jedenfalls. Aber das dicke Ende sollte ja noch kommen. Manchmal ist es ja gut, wenn man nicht weiß, was noch alles passiert.
Unsere kleine Dorfkirche hatte sich wie stets zu Weihnachten sehr festlich herausgeputzt. Der Kirchenraum war mit frischem Tannengrün geschmückt. Vor allem war neben dem Altar ein mächtiges Krippenspiel aufgerichtet worden. Maria und Josef waren so groß, dass sie uns Kindern bis zu den Schultern reichten. Und auf den Öchslein und den Eselein hätte zumindest eines meiner kleineren Geschwister ohne weiteres reiten können. Aber das schönste und herzigste am Krippenspiel war das niedliche Jesuskind, das in einer Krippe mit echtem Stroh lag und so groß wie ein junger Dackel war.
Neben dem Krippenspiel stand ein geschnitzter Mohrenbub, der so lebensecht ausschaute, dass ich mich vor ihm gefürchtet hatte, als ich noch klein war. Mit dem Mohrenbub hatte es eine besondere Bewandtnis. Er sammelte Geldspenden für die Heidenmission. Ein kunstreicher Mechanismus in seinem Inneren sorgte dafür, dass sich der Mohr verneigte und mit den Augen rollte, wann immer man eine Münze in seinen Mund steckte. Ach, was war der kleine Kerl putzig! Und er war auch für die kleinste Spende dankbar. Immer und immer wieder erbettelten wir vom Vater kleine Geldstücke, die wir auf diese spaßige Weise der Heidenmission zur Verfügung stellten.
Auch die Predigt war wunderschön. Der Pfarrer schilderte in farbigen Worten das Weihnachtswunder. Er sprach vom Engel des Herrn und den Hirten auf dem Felde und allerlei anderen wundersamen Dingen und Geschehnissen. Aber ich konnte mich langsam nicht mehr auf die Worte des Glaubens konzentrieren. Auch die geistlichen Gesänge sang ich zunehmend ohne innere Anteilnahme. Und bei den zum Teil sehr langatmigen Gebeten fehlte mir die heilige Kraft der frommen Inbrunst. Ich musste die ganze Zeit an das Christkind denken und fragte mich immer wieder, ob es denn mit den Schlittschuhen klappen würde. Ein Leben ohne Schlittschuhe kam mir öde, leer und nicht mehr lebenswert vor.
Endlich war der Gottesdienst vorbei, frohlockte ich. Und schon als ich frohlockte, wurde mir klar, dass ich mich schon wieder versündigt hatte. Wer Geschenke vom Christkinde wollte, durfte natürlich nicht froh sein, wenn der Gottesdienst vorbei war, sondern hatte gefälligst traurig zu sein, dass er nicht noch länger dauerte, als er ohnehin schon lang war. Sünden konnte man nicht nur mit Worten und Werken begehen, sondern auch mit Gedanken. Hatte der gelehrt drein redende Herr Pfarrer ja auch gesagt. Es gab im täglichen Leben ganz einfach kaum eine Chance, nicht zu sündigen. Selbst wenn man nur einfach die Gedanken mal so schweifen ließ, hatte man schon wie von selbst gesündigt. Und mit großer Sorge bewegte ich in meinem Herzen, was der hoch verehrte Herr Pfarrer über die Erbsünde gesagt hatte. Da gab es in der Tat kein Entkommen und kein Erbarmen. Man war nun einmal Sünder, ob man wollte oder nicht. Und Sünder brauchten sich keine großen Hoffnungen auf tolle Geschenke machen, geschweige denn auf Schlittschuhe. Ich war zutiefst beunruhigt. Aber ich merkte, dass es meinen Geschwistern nicht viel besser als mir erging. Die konnten auch kaum noch einen einzigen frommen Gedanken produzieren, so sehr waren sie mit der bevorstehenden Bescherung beschäftigt.
Lustlos nagte ich dann zuhause am festlich gedeckten Tisch sitzend an der knusprigen Weihnachtsgans. Dabei soll man für gutes Essen doch immer dankbar sein, und gutes Essen gab es bei uns nur selten, weil wir doch so arm waren. Da gab es meistens Graupen. Graupen mit gelierten Eingeweiden. Meine Geschwister rutschten auch nur noch nervös auf ihren hölzernen Hockern herum. Wir dachten nur noch an die bevorstehende Bescherung. Aber es sollte noch grausame Ewigkeiten dauern, die wir zum Warten verdammt waren. Vater las schon zum dritten Mal die Weihnachtsgeschichte aus unserer abgegriffenen und doch so würdigen Familienbibel vor. Wir hörten gar nicht mehr zu……… Allerdings kannten wir die Geschichte auch in- und auswendig.
*****
Aber dann – endlich – horch! Draußen ertönte Schellengeläut und englische Musik. Hier muss ich wohl einflechten, dass wir damals unter englischer Musik nicht etwa Lieder der Beatles oder Sonaten von Henry Purcell und Benjamin Britten verstanden, sondern meinten, dass wir die Engel singen hörten.
Schritte knarrten im Schnee. Und dann pochte es schwer und dumpf an der Haustür. Kein Zweifel: Das Christkind war da. Mein Magen krampfte sich schmerzhaft zusammen, und mein vor Angst rasendes Herz stürzte polternd in die Hose. Wie in jedem Jahr war es Mutter, die die Tür öffnete.
Und dann trat das Christkind in die Stube ein. Es war noch riesiger und furchterregender als im letzten Jahr. Vielleicht war es auch tatsächlich noch gewachsen. Mit nervös blitzenden Augen starrte es uns Kinder der Reihe nach, einen nach dem anderen, streng an. In diesem Jahr trug es ein langes, silbern glänzendes Gewand. In den Rücken des Gewandes waren geschickt Schlitze eingearbeitet, aus denen zwei gewaltige Flügel heraushingen. Mit denen schlug das Christkind hektisch hin und her, so dass in unserer überheizten Stube nunmehr eine unangenehme Zugluft herrschte.
Drei Schritte hinter dem Christkind stand mit devoter und gelangweilter Miene Knecht Ruprecht, der alte Gesell‘ und trug den verführerischen Rucksack auf dem Buckel. Mit ungeduldiger Stimme erläuterte das Christkind, dass es draußen vom Walde herkomme, wo es außergewöhnlich stark weihnachte. Auf den Tannenspitzen habe es goldene Lichtlein blitzen sehen. Bei diesen Worten blitzten auch die Augen des Christkinds so gewaltig, dass meine kleinste Schwester Zenz, die zum ersten Mal an der Bescherung teilnehmen durfte, so sehr erschrak, dass sie sich hinter den Tannenbaum verkrümelte. Das hätte sie lieber nicht tun sollen. Wir konnten ja deutlich sehen, dass das Christkind nervös und sehr in Eile war. Das konnte man ihm ja nicht verübeln, weil es so viele Menschenkinder gab, die beschert werden mussten. Deswegen passte es ihm auch gar nicht, wenn nicht alles nach Plan ablief. Unwirsch herrschte es daher die kleine Zenz an, die noch immer verängstigt hinter dem Weihnachtsbaum hockte:
„Komm heraus aus deinem Versteck. Wenn ich eins nicht leiden kann, dann sind es feige und verhockte Kinder.“
Bebend und käsebleich kroch das Schwesterlein hervor. Wie ein Häufchen Unglück stand sie vor dem gewaltigen, zornigen Christkind da. Ich kann mich noch genau erinnern, dass ich mich in diesem Augenblick zum ersten Mal zu fragen begann, warum Weihnachten als Fest der Liebe bezeichnet wird. Das Christkind war nämlich keineswegs lieb, sondern fauchte das kleine zitternde Mädchen an wie ein böser Drachen:
„So, da du schon einmal dumm aufgefallen bist, wollen wir gleich mal medias in res gehen. Gestehe deine Missetaten!“
Zitternd und zagend bekannte die kleine Zenz, dass sie die Mutter einmal angelogen hatte. Aber das mutige Geständnis führte nur zu frostigem Schweigen auf Seiten des Christkindes. Stammelnd fügte meine Schwester hinzu, dass sie es gewesen war, die der Katze eine Blechdose an den Schwanz gebunden hatte. Das Christkind schien von den doch recht freimütigen Geständnissen und Bekenntnissen meiner kleinen Schwester nicht so ganz befriedigt zu sein, denn es ließ sich von Knecht Ruprecht das schwarze Buch aushändigen. Mit gerunzelter Stirn las es ein wenig in diesem Konvolut des Grauens. Wir fürchteten schon das Schlimmste. Doch überraschenderweise meinte es schließlich mürrisch und etwas herablassend:
„Na, da wollen wir mal heute nicht so sein. Du bist ja noch so klein. Aber glaube nicht, dass du jedes Mal so billig davonkommst. Nächstes Jahr wird wieder Weihnachten gefeiert und da werden die Standards schon ganz schön höher geschraubt sein als in diesem Jahr.“
Dann wies das Christkind Knecht Ruprecht an, einen Teller mit Pfeffernüssen zu füllen und übergab ihn der kleinen Zenz. Man konnte ihr ansehen, dass sie enttäuscht war, denn sie hatte sich eine neue Puppe gewünscht. Xaver, mein ältester Bruder, der ja schon verdammt schlechte Erfahrungen an Weihnachten gesammelt hatte, stieß mich mit dem Ellenbogen in die Seite und zischte mir zu:
„Mein Gott ischt dasch Chrischtkindla heuer schlecht gelaunt. Und dann ist es auch noch knauserig. So mickrige Portionen hat es schon lange nicht mehr gegeben.“
Aber das Christkind hatte gute Ohren - wie eine Katze, und es hatte jedes Wort verstanden. Voll bitterer Häme und schneidender Ironie wandte es sich an meinen Bruder: „Was ist denn das? Hier wird nicht getuschelt. Hier wird Weihnachten so gefeiert, wie es die Geburt des Heilands allgemein erfordert.“
Was denn Tuscheln oder Nichttuscheln mit der Geburt des Heilands zu tun haben sollten, blieb unklar. Aber jetzt schien das Christkind sich an die wenig erfreulichen Ereignisse zu erinnern, die es mit dem Xaver im letzten Jahr gehabt hatte. Mit messescharfer, schneidend kalter, aber ganz ruhiger Stimme wandte es sich an meinen Bruder:
„Junger Freund, wir haben ja im letzten Jahr recht unschöne Erlebnisse gehabt, wenn ich mich recht erinnere! Harr, harr! Ich hoffe, mein kleines Geschenkchen war ein recht durchschlagender Erfolg, wenn mir dieses Wortspiel erlaubt sein darf. Kleiner Scherz am Rande! Muss ja auch mal sein. Nun – neues Jahr- neues Glück. Mir steht der Sinn nach Gedichten. Sag’ er mir doch schnell eins auf, Xaver!“
Xaver merkte schon, dass dieses Weihnachten wieder drauf und dran war, voll in die Hose zu gehen. Andererseits, wenn das Christkind ihn aufforderte, ein Gedicht aufzusagen, hatte er vielleicht noch eine Chance. Und stotternd murmelte er:
Drauss‘ vom Walde komme ich äh her,
ich muss euch sagen, es weihnachtet äh sehr!
Äh, äh, überall auf den äh, äh……..
Das Christkind flatterte entnervt mit den Flügeln und meinte völlig ungerührt und lakonisch: „So, so aus dem Wald kommst du. Vielleicht bist du ja ein Waldheini. Oder gar ein Waldschrat. Das glaube ich nur allzu gerne. Dann schlug es das Schwarze Buch auf und las ein wenig darin. Deutlich konnte man am Gesichtsausdruck des Christkinds sehen, dass es nicht erfreut über das war, was es dort lesen musste. Knurrig wandte es sich an Knecht Ruprecht: „Ich glaube, dieser Fall liegt so klar, dass wir ihn gar nicht weiter zu diskutieren brauchen. Tu deine Pflicht, alter Gesell!“
Und ehe wir es uns so recht versahen, hatte Knecht Ruprecht mit einer einzigen, geschickten und kraftvollen Bewegung seiner teils rötlich und teils schwärzlich behaarten, riesigen Hände meinem Bruder die krachledernen Hosen heruntergezogen und verbläute ihm mit einer nagelneuen Weihnachtsrute recht kräftig den Allerwertesten. Da halfen meinem armen Bruder auch kein Sträuben und kein Wehgeschrei. Der Knecht Ruprecht war einfach zu riesig und zu kräftig, als dass man sich ihm entwinden konnte. Auch die Beteuerungen des armen Xaver, dass er sich im nächsten Jahr bessern wollte, berührten das Christkind nicht im Geringsten. Das hatte natürlich seine Erfahrungen und war völlig abgebrüht und abgehärtet gegenüber solchen Versprechungen von Kindern. Die versprachen im Angesicht der Rute natürlich alles Mögliche, vor allem sich bis zum nächsten Weihnachten zu bessern. Das konnte man glauben oder auch nicht. Das Christkind zog es jedenfalls vor, diesen Versprechungen nicht zu glauben. Ohne sich weiter um das Weinen und das Geschrei meines Bruders zu kümmern, wandte sich das Christkind nun an meine größere Schwester Vroni. Die Vroni war wirklich ein braves Kind und hatte nichts Böses getan. Dazu wäre sie ja auch viel zu blöd gewesen. Und bigottisch war sie auch noch dazu und versuchte sich beim Kaplan einzuschleimen, indem sie immer besonders frommes und völlig unverständliches Zeug erzählte. Die Vroni wollte daher natürlich das Christkind mit ihrer Frömmigkeit und ihrem Glauben beeindrucken und sagte:
„Liebes Christkind, ich habe für dich ein modernes Gedicht auswendig gelernt. Es ist von Jörg Zink. Es reimt sich nicht einmal. So modern ist es:
Fluchtpunkt der Flucht ist Ägypten.
Fluchtpunkt der Flucht ist nicht Ägypten,
Fluchtpunkt der Flucht ist das Kreuz!
Das Christkind war nicht so richtig begeistert und moserte sogar etwas säuerlich: „Das Gedicht ist nicht von Jörg Zink sondern von Kurt Marti. Und es gefällt mir nicht. Karfreitag und Weihnachten soll man nicht vermischen. Außerdem mag ich es nur, wenn es sich reimt. Und irgendwie ist es auch zu kurz. Da muss man sich beim Auswendiglernen ja gar nicht richtig plagen und mühen.“
Na, da musste sich die Vroni nicht wundern, dass sie außer zwei Mandelkernen nur ein Paar Socken bekam und zwar von der Sorte, die so entsetzlich auf der Haut kratzt, dass man sie eigentlich nicht auf der Haut haben kann.
Nun wandte sich das Christkind der Heidi zu, einer meiner größeren und recht schlauen Schwestern, die auch Bücher las, die wir in der Schule eigentlich nicht behandelten. Der Herr Schulmeister und der Herr Kaplan hatten auch so manches Mal gewarnt: „Bildung ja, aber zu viel Bildung ist auch nicht gut!“ Aber die Heidi wollte nicht hören. Manchmal war es mir fast so erschienen, als sei das große Schwesterchen ganz vom Glauben abgefallen. Aber das war ja eigentlich bei uns im Hochgebirge gar nicht möglich. Tatsächlich trug die Schwester ein ganz eigenartiges Gedicht vor, wie wir es noch nie gehört hatten, das aber dunkel und geheimnisvoll klang:
Im Heiligen Land geschah hohes Geschehen,
der Götter Gunst traf auf gemeine Menschen,
die Hirten der Herden hörten es,
In Krippen krakeelt künftiger König.
Esel essen Engel!
Ochsen orgeln im Offizium
Drei Könige künden künftigen Herren.
Weh wird walten im Weltenkreis.
Das Christkind schluckte kurz: „Naja, irgendwie ist das ja schon ein Reim. Aber es fehlt ein bisschen der christliche Bezug. Finde ich jedenfalls.“
Heidi beharrte darauf, dass immerhin von Ochsen und Eseln, der Krippe und dem Heiligen Land die Rede war. Und das müsse nun auch fürs Christliche vorerst reichen. Das Christkind guckte etwas befremdet und meinte dann resigniert seufzend: „Na, ja! Mit mir kann man es ja machen.“ Und es gab drei Pfeffernüsse, einen Mandelkern und eine Haselnuss sowie ein buntes Heiligenbildchen, das den Heiligen Bartholomäus beim Märtyrertod durch Enthäuten zeigte.
Endlich hatte der Knecht Ruprecht mit seiner Prügelpeitsch von unserem Bruder abgelassen. Das Christkind überreichte dem Vater, der aufgrund der schnellen Dynamik des frommen Geschehens fast so eingeschüchtert wirkte wie das Xaverl selbst, die schon etwas abgewetzte Rute mit dem Bemerken, nicht zu sparsam mit ihr zu sein und sie tüchtig weiter zu nutzen.
„Wer bei seinem Sohn mit der Rute spart, der hasst ihn. So heißt es ja schon so nett in der Bibel“, meinte das Christkind kumpelhaft zum Vater.
Nun war die Reihe an mir. Durfte ich noch auf Schlittschuhe hoffen, nachdem man meine Geschwister so dürftig abgespeist hatte. Ich hoffte allerdings immer noch, dass sich das Christkind zunächst die schwarzen Schafe vorgenommen hatte, und nun der angenehmere Teil der Bescherung in Form meiner neuen Schlittschuhe beginnen würde. Es ließ sich auch recht gut an. Das Christkind verlangte zunächst ein Gedicht. Und ich hatte ein ganz, ganz langes und sehr, sehr frommes Gedicht auswendig gelernt, voller Anspielungen auf den Geist der Weihnacht. Und ich konnte es zu meinem eigenen Erstaunen ganz ohne Stocken aufsagen. Es sprudelte nur so aus mir heraus. Ja, jetzt zeigte es sich, dass ich ein guter Lerner war, obwohl ich die Schule so oft geschwänzt hatte. Was sollte der Schulmeister einer wie mir eigentlich noch bieten, in dieser trüben Anstalt für lernschwache Vollpfosten. Und ab ging es mit meinem sehr, sehr langen und sehr, sehr frommen Gedicht:
Das Jesulein im Krippelein,
Herzliebst und auch noch ziemlich klein,
Es ist der Heiland, der uns heut geboren,
Der liebe, gute Jesus Christ,
der für uns am Kreuz gestorben ist,
Just heute ist er auserkoren.
Zu Bethlehem im Heil‘ gen Land,
das war den Hirten wohlbekannt,
Es rührte an der Menschen Herzen,
die leiden oft so große Schmerzen,
Wir wissen ja, was dann geschah
am Freitag mit dem großen Kar.